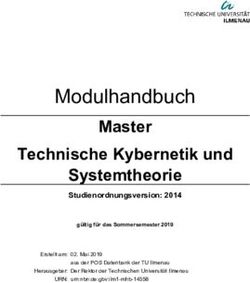HAMMER AUKTIONEN, African, Tribal, Oceanic, Asian, Ancient Art - HAMMER 94 / African and Oceanic Art Friday - February 18, 2022
←
→
Transkription von Seiteninhalten
Wenn Ihr Browser die Seite nicht korrekt rendert, bitte, lesen Sie den Inhalt der Seite unten
HAMMER AUKTIONEN, African, Tribal, Oceanic, Asian, Ancient Art
HAMMER 94 / African and Oceanic Art
Friday - February 18, 2022HAMMER 94 / African and Oceanic Art 1: 2 Papua New Guinean Necklaces CHF 20 - 40 2 ColliersPapua NeuguineaOhne Sockel / without baseMuschel, Samen. L 50 - 93 cm. Provenienz:- A. Brönimann, Basel.- Schweizer Privatsammlung, Zürich.CHF 20 / 40EUR 18 / 36 2: A Papua New Guinean Headdress CHF 50 - 100 KopfschmuckPapua NeuguineaOhne Sockel / without baseKasuar-Federn, Pflanzenfaser . H 9 - 26 cm. Provenienz:- A. Brönimann, Basel.- Schweizer Privatsammlung, Zürich.CHF 50 / 100EUR 45 / 91 3: A Huon Gulf Drum, "kundu" CHF 100 - 200 Trommel, "kundu"Papua-Neuguinea, HuongolfOhne Sockel / without baseHolz, Leder, Pflanzenfaser. H 53 cm. Provenienz:- Heinz-Werner Fusbahn (1905-1958, Stuttgart/Basel) und Margaret Fusbahn-Billwiller (1907-2001, St. Gallen/Sintra).- Erben Heinz-Werner Fusbahn.- Galerie Walu, Basel.Margaret Fusbahn und Heinz-Werner Fusbahn"...Margaret Fusbahn kommt als Rosa Margaretha Billwiller am 14. Juli 1907 in St.Gallen zur Welt und wächst in einer wohlhabenden Kaufmannsfamilie am Rosenberg auf. Mit 20 Jahren heiratet sie den deutschen Ingenieur Heinz-Werner Fusbahn. Margaret gehört zu einer Handvoll Flugpionierinnen, die sich in der Zwischenkriegszeit aufmachen, die Lüfte zu erobern.Weltweit bekannt wird Margaret Fusbahn als es ihr im April 1930 gelingt, den internationalen Höhenrekord für Leichtflugzeuge in der Klasse C zu brechen. .... Sie nimmt an zahlreichen Flugwettbewerben teil. Ihr Mann Heinz-Werner lässt sich von ihrer Flugleidenschaft anstecken und erwirbt ebenfalls das Brevet. Sie werden als das «fliegende Ehepaar» bekannt. 1932 fliegen sie zum ersten Mal nach Äthiopien. Danach fliegt Heinz-Werner jährlich nach Afrika ? ohne seine Frau. 1938 lässt sich Margaret Fusbahn scheiden..."Auszug aus "Pionierinnen: «Der Flug ist das Leben wert» von Christina Genova, erschienen am 24.10.2017, abrufbar auf tagblatt.ch.CHF 100 / 200EUR 91 / 182 4: A Iatmul (?) Figure CHF 100 - 200 FigurIatmul (?), Sepik, Papua-NeuguineaOhne Sockel / without baseHolz. H 99 cm. Provenienz:- Heinz-Werner Fusbahn (1905-1958, Stuttgart/Basel) und Margaret Fusbahn-Billwiller (1907-2001, St. Gallen/Sintra).- Erben Heinz-Werner Fusbahn.- Galerie Walu, Basel.Margaret Fusbahn und Heinz-Werner Fusbahn"...Margaret Fusbahn kommt als Rosa Margaretha Billwiller am 14. Juli 1907 in St.Gallen zur Welt und wächst in einer wohlhabenden Kaufmannsfamilie am Rosenberg auf. Mit 20 Jahren heiratet sie den deutschen Ingenieur Heinz-Werner Fusbahn. Margaret gehört zu einer Handvoll Flugpionierinnen, die sich in der Zwischenkriegszeit aufmachen, die Lüfte zu erobern.Weltweit bekannt wird Margaret Fusbahn als es ihr im April 1930 gelingt, den internationalen Höhenrekord für Leichtflugzeuge in der Klasse C zu brechen. .... Sie nimmt an zahlreichen Flugwettbewerben teil. Ihr Mann Heinz-Werner lässt sich von ihrer Flugleidenschaft anstecken und erwirbt ebenfalls das Brevet. Sie werden als das «fliegende Ehepaar» bekannt. 1932 fliegen sie zum ersten Mal nach Äthiopien. Danach fliegt Heinz-Werner jährlich nach Afrika ? ohne seine Frau. 1938 lässt sich Margaret Fusbahn scheiden..."Auszug aus "Pionierinnen: «Der Flug ist das Leben wert» von Christina Genova, erschienen am 24.10.2017, abrufbar auf tagblatt.ch.CHF 100 / 200EUR 91 / 182 5: A Tami Spoon CHF 100 - 200 LöffelTami, Papua-Neuguinea, Tami-InselnOhne Sockel / without baseHolz. H 65 cm. B 8,5 m. Provenienz:- Heinz-Werner Fusbahn (1905-1958, Stuttgart/Basel) und Margaret Fusbahn-Billwiller (1907-2001, St. Gallen/Sintra).- Erben Heinz-Werner Fusbahn.- Galerie Walu, Basel.Margaret Fusbahn und Heinz-Werner Fusbahn"...Margaret Fusbahn kommt als Rosa Margaretha Billwiller am 14. Juli 1907 in St.Gallen zur Welt und wächst in einer wohlhabenden Kaufmannsfamilie am Rosenberg auf. Mit 20 Jahren heiratet sie den deutschen Ingenieur Heinz-Werner Fusbahn. Margaret gehört zu einer Handvoll Flugpionierinnen, die sich in der Zwischenkriegszeit aufmachen, die Lüfte zu erobern.Weltweit bekannt wird Margaret Fusbahn als es ihr im April 1930 gelingt, den internationalen Höhenrekord für Leichtflugzeuge in der Klasse C zu brechen. .... Sie nimmt an zahlreichen Flugwettbewerben teil. Ihr Mann Heinz-Werner lässt sich von ihrer Flugleidenschaft anstecken und erwirbt ebenfalls das Brevet. Sie werden als das «fliegende Ehepaar» bekannt. 1932 fliegen sie zum ersten Mal nach Äthiopien. Danach fliegt Heinz-Werner jährlich nach Afrika ? ohne seine Frau. 1938 lässt sich Margaret Fusbahn scheiden..."Auszug aus "Pionierinnen: «Der Flug ist das Leben wert» von Christina Genova, erschienen am 24.10.2017, abrufbar auf tagblatt.ch.CHF 100 / 200EUR 91 / 182
HAMMER 94 / African and Oceanic Art 6: A Tami Bowl CHF 100 - 200 SchaleTami, Papua-Neuguinea, HuongolfOhne Sockel / without baseHolz. B 14 cm. L 32 cm. Provenienz:- Heinz-Werner Fusbahn (1905-1958, Stuttgart/Basel) und Margaret Fusbahn-Billwiller (1907-2001, St. Gallen/Sintra).- Erben Heinz-Werner Fusbahn.- Galerie Walu, Basel.Margaret Fusbahn und Heinz-Werner Fusbahn"...Margaret Fusbahn kommt als Rosa Margaretha Billwiller am 14. Juli 1907 in St.Gallen zur Welt und wächst in einer wohlhabenden Kaufmannsfamilie am Rosenberg auf. Mit 20 Jahren heiratet sie den deutschen Ingenieur Heinz-Werner Fusbahn. Margaret gehört zu einer Handvoll Flugpionierinnen, die sich in der Zwischenkriegszeit aufmachen, die Lüfte zu erobern.Weltweit bekannt wird Margaret Fusbahn als es ihr im April 1930 gelingt, den internationalen Höhenrekord für Leichtflugzeuge in der Klasse C zu brechen. .... Sie nimmt an zahlreichen Flugwettbewerben teil. Ihr Mann Heinz-Werner lässt sich von ihrer Flugleidenschaft anstecken und erwirbt ebenfalls das Brevet. Sie werden als das «fliegende Ehepaar» bekannt. 1932 fliegen sie zum ersten Mal nach Äthiopien. Danach fliegt Heinz-Werner jährlich nach Afrika ? ohne seine Frau. 1938 lässt sich Margaret Fusbahn scheiden..."Auszug aus "Pionierinnen: «Der Flug ist das Leben wert» von Christina Genova, erschienen am 24.10.2017, abrufbar auf tagblatt.ch.CHF 100 / 200EUR 91 / 182 7: A Sepik Figure CHF 800 - 1,200 FigurSepik, Papua-Neuguinea, East Sepik Provinz, Sepik Fluss GebietMit Sockel / with baseHolz. H 85 cm. Provenienz:Martin Gross (1922-2017), Biel (1968 erworben).CHF 800 / 1 200EUR 728 / 1 092 8: A Tuareg Saddle Bag, "elschibera nalen" CHF 100 - 200 Satteltasche, "elschibera nalen"Tuareg, Niger, AgadezOhne Sockel / without baseLeder. B 60 cm. L 70 cm. Provenienz:- Heinz-Werner Fusbahn (1905-1958, Stuttgart/Basel) und Margaret Fusbahn-Billwiller (1907-2001, St. Gallen/Sintra).- Erben Heinz-Werner Fusbahn.- Galerie Walu, Basel."elschibera nalen" = Sack des KamelsWeiterführende Literatur:Gabus, Jean (1959). Kunst der Wüste. Ornamente und Zeichen handwerklicher Kunst der Saharavölker. Olten: Walter-Verlag.-----------------------------------------------------Margaret Fusbahn und Heinz-Werner Fusbahn"...Margaret Fusbahn kommt als Rosa Margaretha Billwiller am 14. Juli 1907 in St.Gallen zur Welt und wächst in einer wohlhabenden Kaufmannsfamilie am Rosenberg auf. Mit 20 Jahren heiratet sie den deutschen Ingenieur Heinz-Werner Fusbahn. Margaret gehört zu einer Handvoll Flugpionierinnen, die sich in der Zwischenkriegszeit aufmachen, die Lüfte zu erobern.Weltweit bekannt wird Margaret Fusbahn als es ihr im April 1930 gelingt, den internationalen Höhenrekord für Leichtflugzeuge in der Klasse C zu brechen. .... Sie nimmt an zahlreichen Flugwettbewerben teil. Ihr Mann Heinz-Werner lässt sich von ihrer Flugleidenschaft anstecken und erwirbt ebenfalls das Brevet. Sie werden als das «fliegende Ehepaar» bekannt. 1932 fliegen sie zum ersten Mal nach Äthiopien. Danach fliegt Heinz-Werner jährlich nach Afrika ? ohne seine Frau. 1938 lässt sich Margaret Fusbahn scheiden..."Auszug aus "Pionierinnen: «Der Flug ist das Leben wert» von Christina Genova, erschienen am 24.10.2017, abrufbar auf tagblatt.ch.CHF 100 / 200EUR 91 / 182 9: A Bamana Figure, "jo nyéléni" CHF 3,500 - 4,500 Weibliche Figur, "jo nyéléni"Bamana, MaliOhne Sockel / without baseHolz. H 81 cm. Provenienz:- Galerie Maria Wyss, Basel.- René Signer (1927-2013), Pfeffingen.- Schweizer Privatsammlung, Basel.Jo nyeleni genannte Figur aus der Jo-Gesellschaft. Darstellung einer jungen, hübschen Frau, welche bei Sing- und Tanzauftritten mitgetragen oder nahe der Tanzfläche aufgestellt wurde.Sie sollte während den Vorführungen die Schönheit und Grazie der jungen Frauen illustrieren, und für zusätzliche Aufmerksamkeit sorgen damit die Gaben, die die Tänzer von den Zuschauern erhielten, möglichst üppig ausfielen.Weiterführende Literatur:Colleyn, Jean-Paul (2001). Bamana. Zürich: Museum Rietberg.CHF 3 500 / 4 500EUR 3 185 / 4 095 10: A Bamana Figure, "jo nyéléni" CHF 200 - 400 Figur, "jo nyeleni"Bamana, MaliOhne Sockel / without baseHolz. H 53 cm. Provenienz:- Madeleine und Jean-Jacques Keller (bis 1980 Abidjan, danach Rheinfelden).- Hammer Auktion 58, 28.08.2020, Lot 5.- Schweizer Privatsammlung, La Chaux-de-Fonds.Jo nyeleni genannte Figur aus der Jo-Gesellschaft. Darstellung einer jungen, hübschen Frau, welche bei Sing- und Tanzauftritten mitgetragen oder nahe der Tanzfläche aufgestellt wurde. Sie sollte einerseits das Konzept von Schönheit und Grazie mitklingen lassen und andererseits zusätzliche Aufmerksamkeit auf die Vorführungen lenken und somit die Zahl der Gaben erhöhen, die die Tänzer von den Zuschauern erhielten.Weiterführende Literatur:Colleyn, Jean-Paul (2001). Bamana. Zürich: Museum Rietberg.CHF 200 / 400EUR 182 / 364
HAMMER 94 / African and Oceanic Art 11: A Lobi Figure, "bateba phuwe" CHF 200 - 400 Figur, "bateba phuwe"Lobi, Burkina FasoMit Sockel / with baseHolz. H 16,5 cm. Provenienz:- Schweizer Privatsammlung, Solothurn. In situ erworben (1993).- Hammer Auktion 88, 22.12.2021, Lot 14 (unbezahlt & storniert).bateba-Schreinfiguren der Lobi vereinten menschenähnliches Aussehen mit übermenschlichen Qualitäten. Sie schützten ihre Besitzer vor unzugänglichen Bereichen wie bösen Gedanken und Hexerei.Weiterführende Literatur:Scanzi, Giovanni Franco (1993). L?art traditionnel Lobi. Milano: Ed. Milanos.CHF 200 / 400EUR 182 / 364 12: A Lobi Seat CHF 200 - 400 SitzLobi, Burkina FasoMit Sockel / with baseHolz. H 34 cm. Provenienz:- Max Itzikovitz, Paris.- Galerie Flak, Paris.- Cannes Enchères, 10.03.2020, Lot 15.- Schweizer Privatsammlung, La Chaux-de-Fonds.Publiziert:Bosc Julien, Itzikovitz Max (2004). Magie Lobi. Paris: l'Enfance de l'Art. Seite 124.Bei Zemanek an der Auktion 89 im 2018 (Lot Nr. 177) wie folgt beschrieben: "Karyatidenhocker mit Maternité. ?1.200-2.500"CHF 200 / 400EUR 182 / 364 13: A Lobi Figure, "bateba ti puo" CHF 200 - 400 Figur, "bateba ti puo"Lobi, Burkina FasoOhne Sockel / without baseHolz. H 34,5 cm. Provenienz:- Madeleine und Jean-Jacques Keller (bis 1980 Abidjan, danach Rheinfelden).- Hammer Auktion 57, 26.08.2020, Lot 24.- Schweizer Privatsammlung, La Chaux-de-Fonds.bateba-Schreinfiguren der Lobi vereinten menschenähnliches Aussehen mit übermenschlichen Qualitäten. Sie schützten ihre Besitzer vor unzugänglichen Bereichen wie bösen Gedanken und Hexerei.Weiterführende Literatur:Herkenhoff, Stephan und Petra (2013). Schnitzer der Lobi. Osnabrück: Stephan Herkenhoff.CHF 200 / 400EUR 182 / 364 14: A Mossi House Post CHF 4,000 - 8,000 PfostenMossi, Burkina Faso, OuaigouyaMit Sockel / with baseHolz. H 104 cm. B 13,5 cm. Provenienz:- Roger Budin (1928-2005), Genf.- Galerie Walu, Zürich.Bei Jean-Louis Picard, Paris, "Collection Roger Budin et divers amateurs" (Lot 205) wie folgt beschrieben: "MOSSI, Région de Ouaïgouya Haute Volta. POTEAU DE CASE ancien, en bois dur à section carrée, sculpté en fort relief sur une face d'une statue féminine debout. Visage et corps scarifiés traditionnellement, yeux en clous de cuivre. Belle patine d'usage brune et brillante."CHF 4 000 / 8 000EUR 3 640 / 7 280 15: A Senufo Heddle Pulley CHF 400 - 800 RollenzugSenufo, Côte d?IvoireOhne Sockel / without baseHolz, Polsternägel. H 16 cm. Provenienz:- wohl Galerie Künzi, Gottfried Künzi (1920-1979), Solothurn.- Martin Gross (1922-2017), Biel (erworben am 04.09.1968).- Hammer Auktion 73, 18.06.2021, Lot 24.- Schweizer Privatsammlung, Genf.- Hammer Auktion 88, 22.12.2021, Lot 16 (unbezahlt & storniert).Sich mit reizvollen Objekten zu umgeben, war seit jeher ein wesentliches Anliegen aller Völker. Diese Vorliebe für das Schöne kommt in Afrika bei den kunstvollen Gebrauchsgegenständen besonders deutlich zur Geltung.Der Rollenzug ist Bestandteil des Schmalband-Webstuhls. Er diente der Verankerung der Rolle, durch deren Mittelrille die Verbindungsschnur zweier sog. Litzenstäbe verlief, mit deren Hilfe man die Kettfäden heben und senken konnte.Weiterführende Literatur:Schaedler, Karl-Ferdinand (1987). Die Weberei in Afrika südlich der Sahara. München: Panterra VerlagCHF 400 / 800EUR 364 / 728 16: A Senufo Headdress, "kwonro" CHF 4,000 - 6,000 Kopfaufsatz, "kwonro"Senufo, Côte d?IvoireMit Sockel / with baseHolz, Rattan, Schnur. H 93 cm. B 64 cm. Provenienz:- René und Denise David, 1984 in situ erworben.- Fred und Ilse Mayer, Zürich (1985).CHF 4 000 / 6 000EUR 3 640 / 5 460
HAMMER 94 / African and Oceanic Art
17: A Baule Pair of Figures, "yassoua ni bla" CHF 2,000 - 4,000
Figuren-Paar, "yassoua ni bla"Baule, Côte d?IvoireOhne Sockel / without baseHolz. H 32 - 32,5 cm. Provenienz:Robert Slayton
Bourdon (1947-2020), West Chester, Pennsylvania.?Ohne schöne Dinge können wir nicht leben? ? dieses Bekenntnis eines Baule
könnte auch aus dem Munde eines westlichen Kunstliebhabers stammen. Sich mit reizvollen Objekten zu umgeben war den Baule in
der Côte d?Ivoire ein ähnlich grundlegendes Anliegen wie westlichen Sammlern afrikanischer Kunst. Diese Lebensauffassung der
Baule äusserte sich in fein gearbeiteten Ritualfiguren ebenso wie in liebevoll verzierten Gebrauchsgegenständen.Die Zuordnung der
Baule-Figuren ist ausserhalb des gesellschaftlichen Kontexts und im Nachhinein schwierig.Allgemein wird der Verwendung nach
zwischen symbolischen Partnern aus der "anderen Welt" und Wahrsage-Figuren unterschieden, wobei die Grenze zwischen diesen
Gruppen häufig fliessend war.Die liebevollen "blolo-bla"- und "blolo-bian"-Figuren gründen auf der Vorstellung, dass jeder Baule im
Jenseits (blolo = andere Welt) einen spirituellen Partner, d.h. eine Ehefrau (bla) oder einen Ehemann (bian), hat und bestrebt sein
muss, mit diesem in bester Beziehung zu leben. Gelingt ihm dies nicht, macht ihm sein Jenseits-Partner das Leben schwer. Die
Figuren-Paare werden lokal "yassoua ni bla" genannt (yassoua = männlich: ni bla = mit Frau).Die eher beopferten
Wahrsage-Figuren werden "asye-usu" genannt und stehen in Verbindung zu sämtlichen ungezähmten Dingen der Natur. Sie wurden
bei rituellen Handlungen zur Erlangung der Aufmerksamkeit der Buschgeister eingesetzt. Diese omnipräsenten Wesen galt es stets
zu besänftigen, auch weil sie als äusserst launisch galten und gelegentlich Besitz von Unvorsichtigen ergreifen
konnten.Weiterführende Literatur:Vogel, Susan M. (1997). Baule. Yale: University Press.CHF 2 000 / 4 000EUR 1 820 / 3 640
18: A Baule Figure, "waka sona" ("blolo-bian") CHF 400 - 800
Weibliche Figur, "waka sona" ("blolo-bian")Baule, Côte d?IvoireOhne Sockel / without baseHolz. H 29,5 cm. Provenienz:- Galerie
Walu, Zürich (1990er Jahre).- Diana Amrein-Stadelmann (1930-2020), Zürich- Schweizer Privatsammlung, Zürich.?Ohne schöne
Dinge können wir nicht leben? ? dieses Bekenntnis eines Baule könnte auch aus dem Munde eines westlichen Kunstliebhabers
stammen. Sich mit reizvollen Objekten zu umgeben war den Baule in der Côte d?Ivoire ein ähnlich grundlegendes Anliegen wie
westlichen Sammlern afrikanischer Kunst. Diese Lebensauffassung der Baule äusserte sich in fein gearbeiteten Ritualfiguren
ebenso wie in liebevoll verzierten Gebrauchsgegenständen.Die Zuordnung der Baule-Figuren ist ausserhalb des gesellschaftlichen
Kontexts und im Nachhinein schwierig.Allgemein wird der Verwendung nach zwischen symbolischen Partnern aus der ?anderen
Welt? und Wahrsage-Figuren unterschieden, wobei die Grenze zwischen diesen Gruppen häufig fliessend war.Die liebevollen
blolo-bla- und blolo-bian-Figuren gründen auf der Vorstellung, dass jeder Baule im Jenseits (blolo = andere Welt) einen spirituellen
Partner, d.h. eine Ehefrau (bla) oder einen Ehemann (bian), hat und bestrebt sein muss, mit diesem in bester Beziehung zu leben.
Gelingt ihm dies nicht, macht ihm sein Jenseits-Partner das Leben schwer.Die eher beopferten ?Wahrsage-Figuren? werden
asye-usu genannt und stehen in Verbindung zu sämtlichen ungezähmten Dingen der Natur. Sie wurden bei rituellen Handlungen zur
Erlangung der Aufmerksamkeit der Buschgeister eingesetzt. Diese omnipräsenten Wesen galt es stets zu besänftigen, auch weil sie
als äusserst launisch galten und gelegentlich Besitz von Unvorsichtigen ergreifen konnten.Weiterführende Literatur:Vogel, Susan M.
(1997). Baule. Yale: University Press.CHF 400 / 800EUR 364 / 728
19: A Baule Figure, "waka sona" ("blolo-bla") CHF 800 - 1,200
Weibliche Figur, "waka sona" ("blolo-bla")Baule, Côte d?IvoireMit Sockel / with baseHolz. H 29 cm. Provenienz:- lt. mündlicher
Auskunft der Besitzer, Galerie Maria Wyss, Basel.- Peter E. His (1922-2005), Basel.?Ohne schöne Dinge können wir nicht leben? ?
dieses Bekenntnis eines Baule könnte auch aus dem Munde eines westlichen Kunstliebhabers stammen. Sich mit reizvollen
Objekten zu umgeben war den Baule in der Côte d?Ivoire ein ähnlich grundlegendes Anliegen wie westlichen Sammlern
afrikanischer Kunst. Diese Lebensauffassung der Baule äusserte sich in fein gearbeiteten Ritualfiguren ebenso wie in liebevoll
verzierten Gebrauchsgegenständen.Die Zuordnung der Baule-Figuren ist ausserhalb des gesellschaftlichen Kontexts und im
Nachhinein schwierig.Allgemein wird der Verwendung nach zwischen symbolischen Partnern aus der ?anderen Welt? und
Wahrsage-Figuren unterschieden, wobei die Grenze zwischen diesen Gruppen häufig fliessend war.Die liebevollen blolo-bla- und
blolo-bian-Figuren gründen auf der Vorstellung, dass jeder Baule im Jenseits (blolo = andere Welt) einen spirituellen Partner, d.h.
eine Ehefrau (bla) oder einen Ehemann (bian), hat und bestrebt sein muss, mit diesem in bester Beziehung zu leben. Gelingt ihm
dies nicht, macht ihm sein Jenseits-Partner das Leben schwer.Die eher beopferten ?Wahrsage-Figuren? werden asye-usu genannt
und stehen in Verbindung zu sämtlichen ungezähmten Dingen der Natur. Sie wurden bei rituellen Handlungen zur Erlangung der
Aufmerksamkeit der Buschgeister eingesetzt. Diese omnipräsenten Wesen galt es stets zu besänftigen, auch weil sie als äusserst
launisch galten und gelegentlich Besitz von Unvorsichtigen ergreifen konnten.Weiterführende Literatur:Vogel, Susan M. (1997).
Baule. Yale: University Press.CHF 800 / 1 200EUR 728 / 1 092
20: A Yaure Mask CHF 4,000 - 8,000
MaskeYaure, Côte d?IvoireMit Sockel / with baseHolz. H 44 cm. Provenienz:- Privatsammlung, Abidjan.- René David, Kilchberg.-
Koller Auktionen Zürich, 26.06.2004, Lot 27.- The Joey and Toby Tanenbaum Collection, Toronto.Die Yaure sind Nachbarn der
Baule und wohnen im Zentrum der heutigen Republik Côte d?Ivoire. Vorwiegend in Dörfern ansässig, bildet die Landwirtschaft,
früher im stärkeren Maß ergänzt durch die Jagd, die wirtschaftliche Grundlage der Ethnie. Ihre traditionelle Religion wird durch lokale
Bünde bestimmt. Die zentralen Themen des Glaubens sind Fruchtbarkeit und Ahnenkult.Die Kunst der Yaure, insbesondere die
figürliche Gestaltung, zeichnet sich trotz der engen künstlerischen Verbundenheit mit den benachbarten Guro und den Baule durch
einen unverwechselbaren, subtilen und prägnanten Stil aus, den die hier angebotene Maske beispielhaft vor Augen führt.In diese
sensibel gestaltete Arbeit hat der Schnitzer, ohne Zweifel ein Meister seines Faches, sein ganzes Können einfliessen lassen. Das
gelungene Werk ist eine harmonische, ausgeglichene Kreation, deren Ausdruck den Betrachter in ihren Bann zieht.Nicht zufällig
erinnert das ovale Gesicht mit den sichelförmigen Augen, der eleganten, schmalen, langgezogenen Nase und dem kleinen Mund anHAMMER 94 / African and Oceanic Art die berühmten Köpfe Amedeo Modiglianis. Dieser hatte über seine Freunde Picasso, Brancusi und Lipchitz, allesamt Liebhaber und Sammler afrikanischer Kunst, nachweisbar vor 1909 die eleganten Masken der Côte d?Ivoire kennen gelernt. Sie bildeten eine wesentliche Quelle der Inspiration für die Formgestaltung seiner berühmten Skulpturen, wobei Modigliani auch die Darstellungsinhalte dieser so genannten Primitiven unglaublich fasziniert haben müssen.Die Maske mit dem idealisierten Gesichtszügen stellt sicherlich eine junge Schönheit dar. Geradezu zu einem Vexierbild wird die grazile Schnitzerei durch ihren Aufsatz: Er stellt den Kopf eines Geistwesens dar, der auf einem überlangen Hals gleichsam der Welt entrückt über der Maske zu schweben scheint und sie zum Körper werden lässt.Im Gesamtkontext der Kultur der Yaure mit ihren engen Verflechtungen von religiösen und profan-sozialen Bereichen kann diese mit vielschichtigen Inhalten beladene Maske kaum eindeutig einer Funktion zugeordnet werden.Ihre Funktion war vermutlich anlässlich der öffentlichen und von Musikanten begleiteten Auftritte sowohl schädliche als auch wohlwollende übernatürliche Kräfte zu Gunsten der Gemeinschaft beeinflussen. Die Maske war somit die Schnittstelle zwischen der Dorfgemeinschaft und der unsichtbaren Welt der Ahnen, Geister und Seelen.Weiterführende Literatur:- Rubin, William (1984). Primitivismus. München, Prestel-Verlag.- Kerchache, Jacques (1989). Die Kunst des schwarzen Afrika. Freiburg, Herder Verlag.- Barbier, Jean Paul (1993). Arts de la Côte d?Ivoire. Genf, Musée Barbier-Mueller.CHF 4 000 / 8 000EUR 3 640 / 7 280 21: A Dan Mask, "zakpai" CHF 800 - 1,200 Maske, "zakpai"Dan, Côte d?IvoireMit Sockel / with baseHolz. H 23 cm. Provenienz:- Marc Ducret und Patricia Monjaret, Frankreich.- Sammlung H., Haute-Garonne.Diese Maske diente als Illustration der Visitenkarte des Ehepaares Monjaret (siehe Fotos).Weil sich die Verwendung und Bedeutung der Masken, nebst den geografisch schon immer vorhandenen Unterschieden, im Laufe der Zeit verändert hat, sind nachträgliche Aussagen über den damaligen Gebrauch mitunter schwierig.Viel spricht dafür, dass es sich hier um eine zakpai genannte Feuermeldermaske handelt, die im Unterschied zu den meisten anderen Maskentypen weder tanzte noch sang. Während der Trockenzeit kontrollierten solche Maskengestalten, ob die Frauen das Herdfeuer nachmittags ausgelöscht hatten, da wegen der Windhosen erhöhte Brandgefahr herrschte. Bei Verstössen schritt sie strafend ein und konnte mitunter ein Pfand mitnehmen, das später eingelöst werden musste.Weiterführende Literatur:Fischer, Eberhard (1976). Die Kunst der Dan. Zürich: Museum Rietberg.CHF 800 / 1 200EUR 728 / 1 092 22: An Akan Heddle Pulley CHF 200 - 400 RollenzugAkan, Ghana / Côte d?IvoireMit Sockel / with baseHolz. H 20 cm. Provenienz:- Georges-Jacques Haefeli (1934-2010), La Chaux-de-Fonds.- Schweizer Privatsammlung, La Chaux-de-Fonds.Sich mit reizvollen Objekten zu umgeben, war ein grundlegendes Anliegen der Völker der Elfenbeinküste, was in diesem künstlerisch gestalteten Gebrauchsgegenstand besonders deutlich zur Geltung kommt.Der Rollenzug ist Bestandteil des Schmalband-Webstuhls. Er diente der Verankerung der Rolle, durch deren Mittelrille die Verbindungsschnur zweier sog. Litzenstäbe verlief, mit deren Hilfe man die Kettfäden heben und senken konnte.CHF 200 / 400EUR 182 / 364 23: An Elephant and a Dog (?) CHF 100 - 200 2 TierdarstellungenGhana / DR Kongo (?)Ohne Sockel / without baseHolz. H 14 - 23 cm. L 24 - 26,5 cm. Provenienz:- Heinz-Werner Fusbahn (1905-1958, Stuttgart/Basel) und Margaret Fusbahn-Billwiller (1907-2001, St. Gallen/Sintra).- Erben Heinz-Werner Fusbahn.- Galerie Walu, Basel.Margaret Fusbahn und Heinz-Werner Fusbahn"...Margaret Fusbahn kommt als Rosa Margaretha Billwiller am 14. Juli 1907 in St.Gallen zur Welt und wächst in einer wohlhabenden Kaufmannsfamilie am Rosenberg auf. Mit 20 Jahren heiratet sie den deutschen Ingenieur Heinz-Werner Fusbahn. Margaret gehört zu einer Handvoll Flugpionierinnen, die sich in der Zwischenkriegszeit aufmachen, die Lüfte zu erobern.Weltweit bekannt wird Margaret Fusbahn als es ihr im April 1930 gelingt, den internationalen Höhenrekord für Leichtflugzeuge in der Klasse C zu brechen. .... Sie nimmt an zahlreichen Flugwettbewerben teil. Ihr Mann Heinz-Werner lässt sich von ihrer Flugleidenschaft anstecken und erwirbt ebenfalls das Brevet. Sie werden als das «fliegende Ehepaar» bekannt. 1932 fliegen sie zum ersten Mal nach Äthiopien. Danach fliegt Heinz-Werner jährlich nach Afrika ? ohne seine Frau. 1938 lässt sich Margaret Fusbahn scheiden..."Auszug aus "Pionierinnen: «Der Flug ist das Leben wert» von Christina Genova, erschienen am 24.10.2017, abrufbar auf tagblatt.ch.CHF 100 / 200EUR 91 / 182 24: An Asante Comb, "duafe" CHF 400 - 800 Kamm, "duafe"Asante, GhanaMit Sockel / with baseHolz. H 20 cm. Provenienz:- René David (1928-2015), Zürich.- Jean David, Basel.Ausgestellt:Musée International du Golfe de Guinée, Lomé (2005-2011).Die Verbindung von Nützlichem und Schönem ist ein zentrales Anliegen der Akan-Völker.Dies gilt besonders für die kunstvoll gestalteten Alltagsgegenstände, wie z.B. Kämme.Prestige-Kämme waren ein beliebter Haarschmuck der gut situierten, begehrten Frauen sowie geschätzte Geschenke, um Beziehungen und Freundschaften zu vertiefen.Weiterführende Literatur:Sieber, Roy & Herremann, Frank (2000). Hair in African Art and Culture. New York: The Museum for African Art & Prestel.CHF 400 / 800EUR 364 / 728
HAMMER 94 / African and Oceanic Art 25: An Asante Commemorative Head CHF 300 - 600 KopfAsante, GhanaMit Sockel / with baseTerrakotta. H 8,5 cm. Provenienz:- Galerie Walu, Zürich.- Fred und Ilse Mayer, Zürich (1990).Thermolumineszenz-Altersbestimmung: 150 Jahre (+/- 20 %).Der Name "Akan" bezeichnet eine Gruppe von Völker der Côte d'Ivoire und Ghanas, die sprachlich und kulturell verwandt sind. Dazu zählen z.B. die Asante, die Fante oder auch die Baule.Idealisierte Abbilder aus gebranntem Ton wurden zur Erinnerung an Vorfahren in gesonderten Hainen aufgestellt. Sie wurden dort so lange zeremoniell verehrt, bis sich niemand mehr an die Dargestellten erinnern konnte.Die Ruhe und Gelassenheit ausstrahlenden Terrakotten waren somit materialisierten Verbindungen zwischen Dies- und Jenseits, die ähnliche Zwecke erfüllen konnten wie andernorts Denkmäler oder Grabsteine.Weiterführende Literatur:Cole, Herbert M. / Ross, Doran H. (1977). The Arts of Ghana. Los Angeles: University of California.CHF 300 / 600EUR 273 / 546 26: An Asante Sword with Figural Handle CHF 1,000 - 2,000 Schwert mit figürlichem GriffAsante, GhanaMit Sockel / with baseEisen, Holz, mit Goldfolie überzogen. H 117 cm. Provenienz:- René David (1928-2015), Zürich.- Jean David, Basel.Ausgestellt:Musée International du Golfe de Guinée, Lomé (2005-2011).Die afena genannten Staatsschwerter der Akan gehören zu den wichtigsten Regalien am Hof. Sie treten als die Prestige-Objekte schlechthin bei diversen offiziellen Anlässen in Erscheinung, beispielsweise auch anlässlich der Inthronisation eines neuen Regenten oder während der Reinigungs-Zeremonien.Zeremonialschwerter mit Symbolcharakter demonstrieren die Macht und den Wohlstand des Asantehene (Regent der Asante). Sie werden von seinen Schwertträgern vorgeführt und dokumentieren gleichzeitig den Status und Rang seines Trägers.Nimmt ein König z.B. an einer Prozession teil, wird er von zahlreichen Schwertträgern begleitet, wobei sie als Zeichen ihrer Treue die Klinge des Schwertes in ihre Hand nehmen und den Knauf zum König hin richten. Der König selbst hält in der rechten Hand ein kleines Schwert, welches ihm als Tanzstab und symbolische Waffe dient.Weiterführende Literatur:Ross, Doran und Eisner, Georg (2008). Das Gold der Akan. Museum Liaunig. Neuhaus: Museumsverwaltung GmbH.CHF 1 000 / 2 000EUR 910 / 1 820 27: An Agni (?) Figure CHF 4,500 - 6,500 FigurAgni (?), Ghana / Côte d'IvoireOhne Sockel / without baseHolz, Glasperlen, Kaurischnecken, Kokosnussscheiben. H 75 cm. Provenienz:- lt. Besitzer: Galerie Maria Wyss, Basel.- René Signer (1927-2013), Pfeffingen.- Schweizer Privatsammlung, Basel.Wohl eine der mannigfachen Fruchtbarkeitsfiguren aus dem Umfeld der Mädchen-Initiation.Weiterführende Literatur: Cole, Herbert M. / Ross, Doran H. (1977). The Arts of Ghana. Los Angeles: University of California.CHF 4 500 / 6 500EUR 4 095 / 5 915 28: A Ga-Dangbe Figure, "aklama" CHF 100 - 200 Figur, "aklama"Ga-Dangbe / Ewe, Ghana / TogoMit Sockel / with baseHolz. H 22,5 cm. Provenienz:- Schweizer Privatsammlung, Solothurn. In situ erworben (1997).- Hammer Auktion 88, 22.12.2021, Lot 46 (unbezahlt & storniert).Bildunterschrift zu dem von Schmeltz (op. cit.) publizierten Feldfoto von drei Figuren des gleichen Typus: "Die Worte Aklama kpakpewo oder Aklama sucwo bedeuten, ?kleine geschnitzte Gottheiten?. Die Figuren heissen auch Ame we luwo, ?Seele des Menschen?. Man kauft diese Figuren stets mindestens paarweise, Mann und Weib zusammen. ?Hat der Heide mehrere Frauen, so ist es unbedingt nöthig, dass jede der Frauen einen Mann und eine Frau sich kaufen muss.? Die Figuren gelten als trõwo und man richtet Gebete an sie, z. B. das regelmässige Morgengebet: ?Gieb mir Leben, mache stark meine Kniegelenke, meine Armgelenke, ich will auf Reisen gehen; ich komme zurück.? Nach einem glücklichen Kauf spricht man das Dankgebet: ?Ich danke euch, dass ihr mir geholfen, dass man von mir die Sachen kaufte.? ? Fehlt den Figuren, was oft vorkommt, ein Arm oder ein Bein, so erhalten sie den Namen Adelã (Wild) oder A?iza (Affenart), weil man glaubt, dass sie in diesem Zustand irgend einem Thiere des Feldes ähnlich sind (?). Wenn Jemand stirbt, so werden die ihm gehörenden Figuren weggeworfen. Diese Angaben sind höchst interessant, aber sehr lückenhaft. Zweifellos hält man die Figuren für beseelt, aber von wem? Ahnenbilder sind es nicht, und auch von den Legbawo scheinen sie sich in ihrem Wesen zu unterscheiden. Der Name ?Seele des Menschen? und die Thatsache, dass man die Figuren beim Tode des Besitzers als werthlos wegwirft, lassen vermuthen, dass man die kleinen Schnitzwerke in besonderer mystischer Beziehung zum Menschen glaubt, vielleicht für sie Verkörperungen seiner Schutzgeister hält. Auch an den weitverbreiteten Glauben wäre hier zu erinnern, dass der Mensch mehrere Seelen besitzt, die nicht sämmtlich fest an den Körper gebunden sind, sondern auch ausserhalb des Leibes wohnen können. Ganz räthselhaft ist die Erklärung der verstümmelten Figuren.?Weiterführende Literatur:Schmeltz, J.D.E (1901). Zaubermittel der Evheer (Aus dem Städtischen Museum in Bremen)." Archives Internationales D'Ethnographie., Vol. 14. Seite 9.CHF 100 / 200EUR 91 / 182
HAMMER 94 / African and Oceanic Art 29: A Ga-Dangbe Figure, "aklama" - Hammer Auktion 88, CHF 100 - 200 Figur, "aklama"Ga-Dangbe / Ewe, Ghana / TogoMit Sockel / with baseHolz. H 15,5 cm. Provenienz:Schweizer Privatsammlung, Solothurn. In situ erworben (2002).Bildunterschrift zu dem von Schmeltz (op. cit.) publizierten Feldfoto von drei Figuren des gleichen Typus: "Die Worte Aklama kpakpewo oder Aklama sucwo bedeuten, ?kleine geschnitzte Gottheiten?. Die Figuren heissen auch Ame we luwo, ?Seele des Menschen?. Man kauft diese Figuren stets mindestens paarweise, Mann und Weib zusammen. ?Hat der Heide mehrere Frauen, so ist es unbedingt nöthig, dass jede der Frauen einen Mann und eine Frau sich kaufen muss.? Die Figuren gelten als trõwo und man richtet Gebete an sie, z. B. das regelmässige Morgengebet: ?Gieb mir Leben, mache stark meine Kniegelenke, meine Armgelenke, ich will auf Reisen gehen; ich komme zurück.? Nach einem glücklichen Kauf spricht man das Dankgebet: ?Ich danke euch, dass ihr mir geholfen, dass man von mir die Sachen kaufte.? ? Fehlt den Figuren, was oft vorkommt, ein Arm oder ein Bein, so erhalten sie den Namen Adelã (Wild) oder A?iza (Affenart), weil man glaubt, dass sie in diesem Zustand irgend einem Thiere des Feldes ähnlich sind (?). Wenn Jemand stirbt, so werden die ihm gehörenden Figuren weggeworfen. Diese Angaben sind höchst interessant, aber sehr lückenhaft. Zweifellos hält man die Figuren für beseelt, aber von wem? Ahnenbilder sind es nicht, und auch von den Legbawo scheinen sie sich in ihrem Wesen zu unterscheiden. Der Name ?Seele des Menschen? und die Thatsache, dass man die Figuren beim Tode des Besitzers als werthlos wegwirft, lassen vermuthen, dass man die kleinen Schnitzwerke in besonderer mystischer Beziehung zum Menschen glaubt, vielleicht für sie Verkörperungen seiner Schutzgeister hält. Auch an den weitverbreiteten Glauben wäre hier zu erinnern, dass der Mensch mehrere Seelen besitzt, die nicht sämmtlich fest an den Körper gebunden sind, sondern auch ausserhalb des Leibes wohnen können. Ganz räthselhaft ist die Erklärung der verstümmelten Figuren.?Weiterführende Literatur:Schmeltz, J.D.E (1901). Zaubermittel der Evheer (Aus dem Städtischen Museum in Bremen)." Archives Internationales D'Ethnographie., Vol. 14. Seite 9.CHF 100 / 200EUR 91 / 182 30: A Ga-Dangbe Figure, "aklama" CHF 100 - 200 Figur, "aklama"Ga-Dangbe / Ewe, Ghana / TogoMit Sockel / with baseHolz. H 16 cm. Provenienz:Schweizer Privatsammlung, Solothurn. In situ erworben (2002).Bildunterschrift zu dem von Schmeltz (op. cit.) publizierten Feldfoto von drei Figuren des gleichen Typus: "Die Worte Aklama kpakpewo oder Aklama sucwo bedeuten, ?kleine geschnitzte Gottheiten?. Die Figuren heissen auch Ame we luwo, ?Seele des Menschen?. Man kauft diese Figuren stets mindestens paarweise, Mann und Weib zusammen. ?Hat der Heide mehrere Frauen, so ist es unbedingt nöthig, dass jede der Frauen einen Mann und eine Frau sich kaufen muss.? Die Figuren gelten als trõwo und man richtet Gebete an sie, z. B. das regelmässige Morgengebet: ?Gieb mir Leben, mache stark meine Kniegelenke, meine Armgelenke, ich will auf Reisen gehen; ich komme zurück.? Nach einem glücklichen Kauf spricht man das Dankgebet: ?Ich danke euch, dass ihr mir geholfen, dass man von mir die Sachen kaufte.? ? Fehlt den Figuren, was oft vorkommt, ein Arm oder ein Bein, so erhalten sie den Namen Adelã (Wild) oder A?iza (Affenart), weil man glaubt, dass sie in diesem Zustand irgend einem Thiere des Feldes ähnlich sind (?). Wenn Jemand stirbt, so werden die ihm gehörenden Figuren weggeworfen. Diese Angaben sind höchst interessant, aber sehr lückenhaft. Zweifellos hält man die Figuren für beseelt, aber von wem? Ahnenbilder sind es nicht, und auch von den Legbawo scheinen sie sich in ihrem Wesen zu unterscheiden. Der Name ?Seele des Menschen? und die Thatsache, dass man die Figuren beim Tode des Besitzers als werthlos wegwirft, lassen vermuthen, dass man die kleinen Schnitzwerke in besonderer mystischer Beziehung zum Menschen glaubt, vielleicht für sie Verkörperungen seiner Schutzgeister hält. Auch an den weitverbreiteten Glauben wäre hier zu erinnern, dass der Mensch mehrere Seelen besitzt, die nicht sämmtlich fest an den Körper gebunden sind, sondern auch ausserhalb des Leibes wohnen können. Ganz räthselhaft ist die Erklärung der verstümmelten Figuren.?Weiterführende Literatur:Schmeltz, J.D.E (1901). Zaubermittel der Evheer (Aus dem Städtischen Museum in Bremen)." Archives Internationales D'Ethnographie., Vol. 14. Seite 9.CHF 100 / 200EUR 91 / 182 31: A Ga-Dangbe Figure, "aklama" CHF 100 - 200 Figur, "aklama"Ga-Dangbe / Ewe, Ghana / TogoOhne Sockel / without baseHolz. H 18,5 cm. Provenienz:Schweizer Privatsammlung, Solothurn. In situ erworben (2009).Bildunterschrift zu dem von Schmeltz (op. cit.) publizierten Feldfoto von drei Figuren des gleichen Typus: "Die Worte Aklama kpakpewo oder Aklama sucwo bedeuten, ?kleine geschnitzte Gottheiten?. Die Figuren heissen auch Ame we luwo, ?Seele des Menschen?. Man kauft diese Figuren stets mindestens paarweise, Mann und Weib zusammen. ?Hat der Heide mehrere Frauen, so ist es unbedingt nöthig, dass jede der Frauen einen Mann und eine Frau sich kaufen muss.? Die Figuren gelten als trõwo und man richtet Gebete an sie, z. B. das regelmässige Morgengebet: ?Gieb mir Leben, mache stark meine Kniegelenke, meine Armgelenke, ich will auf Reisen gehen; ich komme zurück.? Nach einem glücklichen Kauf spricht man das Dankgebet: ?Ich danke euch, dass ihr mir geholfen, dass man von mir die Sachen kaufte.? ? Fehlt den Figuren, was oft vorkommt, ein Arm oder ein Bein, so erhalten sie den Namen Adelã (Wild) oder A?iza (Affenart), weil man glaubt, dass sie in diesem Zustand irgend einem Thiere des Feldes ähnlich sind (?). Wenn Jemand stirbt, so werden die ihm gehörenden Figuren weggeworfen. Diese Angaben sind höchst interessant, aber sehr lückenhaft. Zweifellos hält man die Figuren für beseelt, aber von wem? Ahnenbilder sind es nicht, und auch von den Legbawo scheinen sie sich in ihrem Wesen zu unterscheiden. Der Name ?Seele des Menschen? und die Thatsache, dass man die Figuren beim Tode des Besitzers als werthlos wegwirft, lassen vermuthen, dass man die kleinen Schnitzwerke in besonderer mystischer Beziehung zum Menschen glaubt, vielleicht für sie Verkörperungen seiner Schutzgeister hält. Auch an den weitverbreiteten Glauben wäre hier zu erinnern, dass der Mensch mehrere Seelen besitzt, die nicht sämmtlich fest an den Körper gebunden sind, sondern auch ausserhalb des Leibes wohnen können. Ganz räthselhaft ist die Erklärung der verstümmelten Figuren.?Weiterführende Literatur:Schmeltz, J.D.E (1901). Zaubermittel der Evheer (Aus dem Städtischen Museum in Bremen)." Archives Internationales D'Ethnographie., Vol. 14. Seite 9.CHF 100 / 200EUR 91 / 182
HAMMER 94 / African and Oceanic Art 32: A Krobo Figure CHF 100 - 200 FigurKrobo / Yilo-Krobo, GhanaOhne Sockel / without baseHolz, Glasperlen. H 28 cm. Provenienz:Schweizer Privatsammlung, Solothurn. In situ erworben (1990).Wohl eine der mannigfachen Fruchtbarkeitsfiguren aus dem Umfeld der Mädchen-Initiation.Weiterführende Literatur: Cole, Herbert M. / Ross, Doran H. (1977). The Arts of Ghana. Los Angeles: University of California.CHF 100 / 200EUR 91 / 182 33: A Koma-Bulsa Disc with four Faces, "kronkronbua" CHF 200 - 400 Scheibe mit vier Gesichtern, "kronkronbua"Koma-Bulsa, GhanaOhne Sockel / without baseTerrakotta. H 6 cm. Ø 14 cm. Provenienz:Schweizer Privatsammlung, Solothurn. In situ erworben (1988).kronkronbua = "Kinder aus früheren Zeiten".In den 1980er-Jahren wurden in der Upper West Region in Ghana, im Gebiet, das heute von den Koma (z.B. in Yikpabongo, Tantuosi, Wumobri) und den Bulsa (Builsa) bewohnt wird, die ersten Figuren dieses Stils aus gebranntem Ton gefunden. Thermoluminiszenz-Altersbestimmungen datierten die Objekte vom 13. bis 18. Jh u.Z.Karl Ferdinand Schädler beschrieb die Neu-Entdeckung dieser Kultur 1987 wie folgt: "Manche von ihnen sehen aus, als kämen sie von den Bandiagara-Schluchten und wären Produkte der Dogon. Doch das sind nur wenige. Die meisten dieser Terrakotten einer Kultur, von der man nichts weiss, sehen eher aus als kämen sie aus Somarzo oder als seien sie der Phantasiewelt eines Hieronymus Bosch entsprungen: Köpfe, deren Hirnschalen spitz zulaufen oder die umgekehrt becherförmig ausgehöhlt sind, mit brillenartigen Augen oder mit Ohren, die, zwei Henkeln gleich, am Hinterkopf angebracht sind. Münder, die sich, von irgendeinem Gesicht getrennt, mit anderen Mündern zu einem neuen "für sich sprechenden" Wesen vereinigen; umgekehrt wiederum Gesichter, die sich ebenfalls mit anderen zusammengeschlossen haben und - mit Armen und Beinen versehen - nun direkt aus der Unterwelt zu kommen scheinen.Es scheint müssig, darüber zu rätseln, welcher Gedanken- und Ideenwelt diese Figuren, Köpfe und Objekte entsprungen sind - ob sie als Grabbeigaben, Ahnen- oder Kultfiguren geformt wurden. Vielleicht ist es sogar beruhigend zu wissen, dass nicht jedes neu entdeckte Geheimnis in Afrika auch gleich zu lüften ist, dass - wenigstens für einige Zeit - eine Kultur nicht wie ein Leichnam seziert werden kann: Weil weder mündliche Überlieferungen noch archäologische Nebenprodukte irgendwelche Hinweise geben.Stattdessen sollte man sich vielleicht damit begnügen, zum einen die Genialität der Gestaltung und zum anderen den kraftvollen expressiven Ausdruck zu bewundern, der diesen Plastiken innewohnt. Dabei scheint es sich, urteilt man nach diesen beiden Kriterien und nach dem äusseren Erscheinungsbild der Objekte, um verschiedene Stilrichtungen, wenn nicht sogar um verschiedene Kulturen zu handeln, die entweder einander gefolgt sind oder aber - was immerhin auch möglich scheint - völlig unabhängig nacheinander in derselben Gegend entstanden sind.Eine der Stilrichtungen zeigt einen manieristischen Charakter: die bewusst verschobenen Gesichtszüge, die den Figuren, meist sitzende Gestalten mit Halsketten, Würdezeichen oder Oberarmmessern, häufig einen unheimlichen, transzendentalen, teilweise auch malignen Ausdruck verleihen - Fürsten einer anderen Welt. Wie bei vielen der offenbar singulär gestalteten Köpfe, die in einem meist spitz zulaufenden Hals enden, sind auch häufig die Köpfe der Figuren becherförmig ausgehöhlt. Die Hände ruhen meist auf den Knien (gelegentlich ganz unmotiviert auf einer der Schultern) und die Geschlechtsteile - der Grossteil ist männlich - sind häufig übergross und deutlich modelliert. Die einzeln gearbeiteten Köpfe sind dabei in der Regel viel grösser gestaltet als die Figuren; sie sind meist auch gröber in der Ausführung und im Stil viel urtümlicher und direkter.Eine andere Stilrichtung, die sich vor allem in den Köpfen von theriomorphen Wesen ausdrückt, zeigt häufig einen weit aufgerissenen, offenbar schreienden Mund und erinnert dann an gotische Wasserspeier. Ein besonderes Augenmerk müssen die Leute dieser Kultur janusförmigen Köpfen und darüber hinaus mehrköpfigen Wesen gewidmet haben. Die ersteren, als Einzelskulpturen konzipiert, erhalten durch die konisch zulaufenden Köpfe manchmal einen phallischen Charakter (sie verlaufen unten auch gerade, nicht konisch wie die "Hohlköpfe", die um die Gräber herum gesteckt gefunden wurden). Die letzteren mehrköpfigen Wesen haben, wie die janusförmigen Einzelköpfe, gleichfalls konisch zulaufende Spitzköpfe; der Körper ist bei diesen, von denen man bis zu vier Persönlichkeiten in einer Skulptur wiedergegeben finden kann, jedoch ganz rudimentär als rechteckiger Block geformt, mit nur angedeuteten Gliedmassen und Geschlechtsteilen.Was wird aus diesem Gebiet im Norden Ghanas, das heute die Koma (auch Komba, Konkomba, Bekpokpak etc.) bewohnen, noch ans Tageslicht kommen? War die Siedlung, aus der die Funde stammen, ebenfalls ein Umschlagplatz für Waren - Kolanüsse von der Küste, Gold, Salz, europäische Güter usw. - wie Salaga zu Ende des vorigen Jahrhunderts, das auf dem Weg zur Küste liegt, oder wie Kong, Bondoukou und das heute nicht mehr existente Begho im Westen? Der rege Warenaustausch zwischen Küste und Nigerbogen, der vermutlich um 1500, wenn nicht schon viel früher einsetzte, als die Mossi-Staaten durch Reiterheere aus dem (heutigen) Ghana gegründet wurden, mag sehr wohl seinen Weg über dieses Gebiet genommen und die ökonomische Basis für diese ungewöhnliche Kultur gebildet haben. Eine Kultur, die uns hoffentlich noch viele Kunstwerke offenbart - und uns hoffentlich auch noch viele Rätsel aufgibt!" Aus: Archäologische Funde aus Komaland. Zürich: Galerie Walu (1987).Weiterführende Literatur:Schaedler, Karl-Ferdinand (1997). Erde und Erz. München: Panterra Verlag.---------------------------------------------------------------Please feel free to contact us for all questions you might have regarding this lot (translations, additional views, condition report etc.).CHF 200 / 400EUR 182 / 364 34: A Koma-Bulsa Janiform Head, "kronkronbua" CHF 200 - 400 Janus-Kopf, "kronkronbua"Koma-Bulsa, GhanaOhne Sockel / without baseTerrakotta. H 14,5 cm. Provenienz:Schweizer Privatsammlung, Solothurn. In situ erworben (1990).kronkronbua = "Kinder aus früheren Zeiten".In den 1980er-Jahren wurden in der Upper West Region in Ghana, im Gebiet, das heute von den Koma (z.B. in Yikpabongo, Tantuosi, Wumobri) und den Bulsa (Builsa) bewohnt wird, die ersten Figuren dieses Stils aus gebranntem Ton gefunden. Thermoluminiszenz-Altersbestimmungen datierten die Objekte vom 13. bis 18. Jh u.Z.Karl Ferdinand Schädler beschrieb die Neu-Entdeckung dieser Kultur 1987 wie folgt: "Manche von ihnen sehen aus, als kämen sie von den Bandiagara-Schluchten und wären Produkte der Dogon. Doch das sind nur wenige. Die meisten dieser Terrakotten einer Kultur, von der man nichts weiss, sehen eher aus als kämen sie aus Somarzo oder als seien sie der Phantasiewelt eines Hieronymus Bosch entsprungen: Köpfe, deren Hirnschalen spitz zulaufen oder die umgekehrt becherförmig ausgehöhlt sind, mit brillenartigen Augen oder mit Ohren, die, zwei Henkeln gleich, am Hinterkopf angebracht sind. Münder, die sich, von irgendeinem Gesicht getrennt, mit anderen Mündern zu einem neuen "für sich sprechenden" Wesen vereinigen; umgekehrt wiederum Gesichter, die sich ebenfalls mit anderen zusammengeschlossen haben und - mit Armen und Beinen versehen - nun direkt aus der Unterwelt zu kommen scheinen.Es scheint müssig, darüber zu rätseln, welcher Gedanken- und Ideenwelt diese
HAMMER 94 / African and Oceanic Art Figuren, Köpfe und Objekte entsprungen sind - ob sie als Grabbeigaben, Ahnen- oder Kultfiguren geformt wurden. Vielleicht ist es sogar beruhigend zu wissen, dass nicht jedes neu entdeckte Geheimnis in Afrika auch gleich zu lüften ist, dass - wenigstens für einige Zeit - eine Kultur nicht wie ein Leichnam seziert werden kann: Weil weder mündliche Überlieferungen noch archäologische Nebenprodukte irgendwelche Hinweise geben.Stattdessen sollte man sich vielleicht damit begnügen, zum einen die Genialität der Gestaltung und zum anderen den kraftvollen expressiven Ausdruck zu bewundern, der diesen Plastiken innewohnt. Dabei scheint es sich, urteilt man nach diesen beiden Kriterien und nach dem äusseren Erscheinungsbild der Objekte, um verschiedene Stilrichtungen, wenn nicht sogar um verschiedene Kulturen zu handeln, die entweder einander gefolgt sind oder aber - was immerhin auch möglich scheint - völlig unabhängig nacheinander in derselben Gegend entstanden sind.Eine der Stilrichtungen zeigt einen manieristischen Charakter: die bewusst verschobenen Gesichtszüge, die den Figuren, meist sitzende Gestalten mit Halsketten, Würdezeichen oder Oberarmmessern, häufig einen unheimlichen, transzendentalen, teilweise auch malignen Ausdruck verleihen - Fürsten einer anderen Welt. Wie bei vielen der offenbar singulär gestalteten Köpfe, die in einem meist spitz zulaufenden Hals enden, sind auch häufig die Köpfe der Figuren becherförmig ausgehöhlt. Die Hände ruhen meist auf den Knien (gelegentlich ganz unmotiviert auf einer der Schultern) und die Geschlechtsteile - der Grossteil ist männlich - sind häufig übergross und deutlich modelliert. Die einzeln gearbeiteten Köpfe sind dabei in der Regel viel grösser gestaltet als die Figuren; sie sind meist auch gröber in der Ausführung und im Stil viel urtümlicher und direkter.Eine andere Stilrichtung, die sich vor allem in den Köpfen von theriomorphen Wesen ausdrückt, zeigt häufig einen weit aufgerissenen, offenbar schreienden Mund und erinnert dann an gotische Wasserspeier. Ein besonderes Augenmerk müssen die Leute dieser Kultur janusförmigen Köpfen und darüber hinaus mehrköpfigen Wesen gewidmet haben. Die ersteren, als Einzelskulpturen konzipiert, erhalten durch die konisch zulaufenden Köpfe manchmal einen phallischen Charakter (sie verlaufen unten auch gerade, nicht konisch wie die "Hohlköpfe", die um die Gräber herum gesteckt gefunden wurden). Die letzteren mehrköpfigen Wesen haben, wie die janusförmigen Einzelköpfe, gleichfalls konisch zulaufende Spitzköpfe; der Körper ist bei diesen, von denen man bis zu vier Persönlichkeiten in einer Skulptur wiedergegeben finden kann, jedoch ganz rudimentär als rechteckiger Block geformt, mit nur angedeuteten Gliedmassen und Geschlechtsteilen.Was wird aus diesem Gebiet im Norden Ghanas, das heute die Koma (auch Komba, Konkomba, Bekpokpak etc.) bewohnen, noch ans Tageslicht kommen? War die Siedlung, aus der die Funde stammen, ebenfalls ein Umschlagplatz für Waren - Kolanüsse von der Küste, Gold, Salz, europäische Güter usw. - wie Salaga zu Ende des vorigen Jahrhunderts, das auf dem Weg zur Küste liegt, oder wie Kong, Bondoukou und das heute nicht mehr existente Begho im Westen? Der rege Warenaustausch zwischen Küste und Nigerbogen, der vermutlich um 1500, wenn nicht schon viel früher einsetzte, als die Mossi-Staaten durch Reiterheere aus dem (heutigen) Ghana gegründet wurden, mag sehr wohl seinen Weg über dieses Gebiet genommen und die ökonomische Basis für diese ungewöhnliche Kultur gebildet haben. Eine Kultur, die uns hoffentlich noch viele Kunstwerke offenbart - und uns hoffentlich auch noch viele Rätsel aufgibt!" Aus: Archäologische Funde aus Komaland. Zürich: Galerie Walu (1987).Weiterführende Literatur:Schaedler, Karl-Ferdinand (1997). Erde und Erz. München: Panterra Verlag.---------------------------------------------------------------Please feel free to contact us for all questions you might have regarding this lot (translations, additional views, condition report etc.).CHF 200 / 400EUR 182 / 364 35: A Koma-Bulsa Terracotta Head CHF 200 - 400 Terrakotta-KopfKoma-Bulsa, GhanaMit Sockel / with baseTerrakotta. H 10,5 cm. Provenienz:Schweizer Privatsammlung, Solothurn. In situ erworben (1989).kronkronbua = "Kinder aus früheren Zeiten".In den 1980er-Jahren wurden in der Upper West Region in Ghana, im Gebiet, das heute von den Koma (z.B. in Yikpabongo, Tantuosi, Wumobri) und den Bulsa (Builsa) bewohnt wird, die ersten Figuren dieses Stils aus gebranntem Ton gefunden. Thermoluminiszenz-Altersbestimmungen datierten die Objekte vom 13. bis 18. Jh u.Z.Karl Ferdinand Schädler beschrieb die Neu-Entdeckung dieser Kultur 1987 wie folgt: "Manche von ihnen sehen aus, als kämen sie von den Bandiagara-Schluchten und wären Produkte der Dogon. Doch das sind nur wenige. Die meisten dieser Terrakotten einer Kultur, von der man nichts weiss, sehen eher aus als kämen sie aus Somarzo oder als seien sie der Phantasiewelt eines Hieronymus Bosch entsprungen: Köpfe, deren Hirnschalen spitz zulaufen oder die umgekehrt becherförmig ausgehöhlt sind, mit brillenartigen Augen oder mit Ohren, die, zwei Henkeln gleich, am Hinterkopf angebracht sind. Münder, die sich, von irgendeinem Gesicht getrennt, mit anderen Mündern zu einem neuen "für sich sprechenden" Wesen vereinigen; umgekehrt wiederum Gesichter, die sich ebenfalls mit anderen zusammengeschlossen haben und - mit Armen und Beinen versehen - nun direkt aus der Unterwelt zu kommen scheinen.Es scheint müssig, darüber zu rätseln, welcher Gedanken- und Ideenwelt diese Figuren, Köpfe und Objekte entsprungen sind - ob sie als Grabbeigaben, Ahnen- oder Kultfiguren geformt wurden. Vielleicht ist es sogar beruhigend zu wissen, dass nicht jedes neu entdeckte Geheimnis in Afrika auch gleich zu lüften ist, dass - wenigstens für einige Zeit - eine Kultur nicht wie ein Leichnam seziert werden kann: Weil weder mündliche Überlieferungen noch archäologische Nebenprodukte irgendwelche Hinweise geben.Stattdessen sollte man sich vielleicht damit begnügen, zum einen die Genialität der Gestaltung und zum anderen den kraftvollen expressiven Ausdruck zu bewundern, der diesen Plastiken innewohnt. Dabei scheint es sich, urteilt man nach diesen beiden Kriterien und nach dem äusseren Erscheinungsbild der Objekte, um verschiedene Stilrichtungen, wenn nicht sogar um verschiedene Kulturen zu handeln, die entweder einander gefolgt sind oder aber - was immerhin auch möglich scheint - völlig unabhängig nacheinander in derselben Gegend entstanden sind.Eine der Stilrichtungen zeigt einen manieristischen Charakter: die bewusst verschobenen Gesichtszüge, die den Figuren, meist sitzende Gestalten mit Halsketten, Würdezeichen oder Oberarmmessern, häufig einen unheimlichen, transzendentalen, teilweise auch malignen Ausdruck verleihen - Fürsten einer anderen Welt. Wie bei vielen der offenbar singulär gestalteten Köpfe, die in einem meist spitz zulaufenden Hals enden, sind auch häufig die Köpfe der Figuren becherförmig ausgehöhlt. Die Hände ruhen meist auf den Knien (gelegentlich ganz unmotiviert auf einer der Schultern) und die Geschlechtsteile - der Grossteil ist männlich - sind häufig übergross und deutlich modelliert. Die einzeln gearbeiteten Köpfe sind dabei in der Regel viel grösser gestaltet als die Figuren; sie sind meist auch gröber in der Ausführung und im Stil viel urtümlicher und direkter.Eine andere Stilrichtung, die sich vor allem in den Köpfen von theriomorphen Wesen ausdrückt, zeigt häufig einen weit aufgerissenen, offenbar schreienden Mund und erinnert dann an gotische Wasserspeier. Ein besonderes Augenmerk müssen die Leute dieser Kultur janusförmigen Köpfen und darüber hinaus mehrköpfigen Wesen gewidmet haben. Die ersteren, als Einzelskulpturen konzipiert, erhalten durch die konisch zulaufenden Köpfe manchmal einen phallischen Charakter (sie verlaufen unten auch gerade, nicht konisch wie die "Hohlköpfe", die um die Gräber herum gesteckt gefunden wurden). Die letzteren mehrköpfigen Wesen haben, wie die janusförmigen Einzelköpfe, gleichfalls konisch zulaufende Spitzköpfe; der Körper ist bei diesen, von denen man bis zu vier Persönlichkeiten in einer Skulptur wiedergegeben finden kann, jedoch ganz rudimentär als rechteckiger Block geformt, mit nur angedeuteten Gliedmassen und Geschlechtsteilen.Was wird aus diesem Gebiet im Norden Ghanas, das heute die Koma (auch Komba, Konkomba, Bekpokpak etc.) bewohnen, noch ans Tageslicht kommen? War die Siedlung, aus der die Funde stammen, ebenfalls ein Umschlagplatz für Waren - Kolanüsse von der Küste, Gold, Salz, europäische Güter usw. - wie Salaga zu Ende des vorigen Jahrhunderts, das auf dem Weg zur Küste liegt, oder wie Kong, Bondoukou und das heute nicht mehr existente Begho im Westen? Der rege Warenaustausch zwischen Küste und Nigerbogen, der vermutlich um 1500, wenn nicht schon viel früher einsetzte, als die Mossi-Staaten durch Reiterheere aus dem (heutigen) Ghana gegründet wurden, mag sehr wohl seinen Weg über dieses Gebiet genommen und die ökonomische Basis für diese ungewöhnliche Kultur gebildet haben. Eine Kultur, die uns hoffentlich noch viele Kunstwerke offenbart - und uns hoffentlich auch noch viele Rätsel aufgibt!" Aus: Archäologische Funde aus Komaland. Zürich: Galerie Walu (1987).Weiterführende Literatur:Schaedler, Karl-Ferdinand (1997). Erde und Erz. München: Panterra Verlag.---------------------------------------------------------------Please feel free to contact us for all questions you might have
Sie können auch lesen