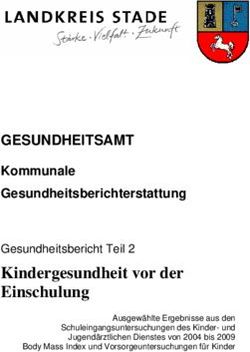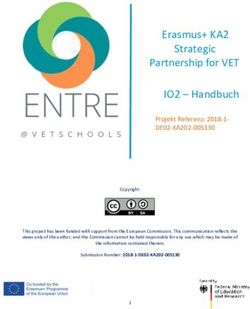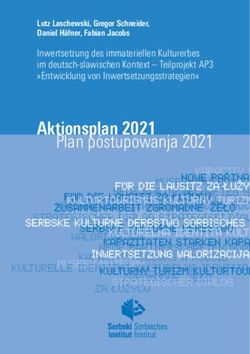HETEROGENITÄT ALS QUALITÄTSHERAUSFORDERUNG FÜR STUDIUM UND LEHRE: KOMPETENZ- UND WISSENSMANAGEMENT FÜR HOCHSCHULBILDUNG IM DEMOGRAFISCHEN WANDEL ...
←
→
Transkription von Seiteninhalten
Wenn Ihr Browser die Seite nicht korrekt rendert, bitte, lesen Sie den Inhalt der Seite unten
Heterogenität als Qualitätsherausforderung
für Studium und Lehre:
Kompetenz- und Wissensmanagement
für Hochschulbildung im demografischen
Wandel
Verbundantrag sachsen-anhaltischer Hochschulen
im Qualitätspakt LehreVerbundantrag sachsen-anhaltischer Hochschulen im Qualitätspakt Lehre
Inhalt
Verbundpartner
Zusammenfassung
1. Bestandsaufnahme und Problemdefinition 1
1.1 SWOT-Analyse 1
1.2 Problemdefinition 3
2. Problembearbeitung 6
2.1 Einordnung und Grundidee 6
2.2 Programm „Heterogenität als Qualitätsherausforderung für Studium und Lehre: Kom-
petenz- und Wissensmanagement für Hochschulbildung im demografischen Wandel“ 8
2.2.1 Professionalisierung und Hochschulentwicklung 8
2.2.2 Wissensmanagement: Vermittlung, Verwaltung, Verteilung, Verwertung
und Verknüpfung von Wissen 11
2.2.3 Hochschulmarketing als ‚Produkt‘-Entwicklung und ‚Markt‘-Platzierung 13
2.3 Struktur zur Programmrealisierung: HET LSA - Hochschulentwicklung
und Transfer in Sachsen-Anhalt 14
2.3.1 Kompetenzstützpunkte an Hochschulen 16
2.3.2 Transferstelle 23
2.3.3 Landesweite Kompetenzzirkel 27
3. Ausstattung und Finanzierungsplan 27
Anhang
Strukturdiagramm
Basisdaten
Bevölkerungsentwicklung
Anteil der Studienanfäger/innen an der altersspezifischen Bevölkerung (%)
Studierende
HochschulabsolventInnen
StudienanfängerInnen
Ausländische SchülerInnen und SchulabgängerInnen
Wissenschaftliches und künstlerisches Personal
Ausgaben und Ausgabenrelationen
AbsolventInnen nach Fächergruppen
Anteil an internationalen Studierenden
StudienkollegiatInnen nach Herkunft
ArbeitsplanVerbundantrag sachsen-anhaltischer Hochschulen im Qualitätspakt Lehre
Verbundpartner
Otto-von-Guericke-Universität Magdeburg (Koordinatorin), Universitätsplatz 2, 39106
Magdeburg, www.ovgu.de, Kontaktperson: Prof. Dr. Jens Strackeljan, rs@ovgu.de
Wissenschaftszentrum Sachsen-Anhalt Wittenberg (WZW), Schlossstraße 10,
06886 Wittenberg, www.wzw-lsa.de, Kontaktperson: Prof. Dr. Peer Pasternack,
geschaeftsfuehrer@wzw-lsa.de, in Verbindung mit dem Institut für Hochschul
forschung Halle-Wittenberg (HoF), Collegienstraße 62, 06886 Wittenberg, www.hof.
uni-halle.de, Kontaktperson: Prof. Dr. Peer Pasternack, peer.pasternack@hof.uni-halle.de
Martin-Luther-Universität Halle-Wittenberg, Universitätsplatz 10, 06108 Halle,
www.uni-halle.de, Kontaktperson: Prof. Dr. Christoph Weiser,
christoph.weiser@rektorat.uni-halle.de
Hochschule Magdeburg-Stendal, Breitscheidstraße 2, 39114 Magdeburg,
www.hs-magdeburg.de, Kontaktperson: Prof. Dr. Anne Lequy, anne.lequy@hs-magdeburg.de;
Projektleiterin des Zentrums für Lehrqualität und Hochschuldidaktik der HS MD-SDL
Hochschule Harz, Friedrichstr. 57–59, 38855 Wernigerode, www.hs-harz.de,
Kontaktperson: Prof. Dr. Folker Roland, froland@hs-harz.de
Hochschule Merseburg, Geusaer Straße, 06217 Merseburg, www.hs-merseburg.de,
Kontaktperson: Prof. Dr. Hardy Geyer, prorektorat.studium@hs-merseburg.de
Hochschule Anhalt, Bernburger Str. 55, 06366 Köthen, www.hs-anhalt.de,
Kontaktperson: Prof. Dr. Carola Griehl, vize_sl@hs-anhalt.de
Burg Giebichenstein, Kunsthochschule Halle, Neuwerk 7, 06108 Halle,
www.burg-halle.de, Kontaktperson: Prof. Karin Schmidt-Ruhland, ruhland@burg-halle.de
Für diesen Verbundantrag haben sich alle staatlichen Hochschulen des Landes zusammen-
geschlossen. Die Verbundpartner schließen einen Kooperationsvertrag, der die im Weiteren
beschriebene Ausgestaltung der Zusammenarbeit fixiert.Verbundantrag sachsen-anhaltischer Hochschulen im Qualitätspakt Lehre
Zusammenfassung
Ausgangspunkt des Antrages sind die Veränderungen, die für die sachsen-anhaltischen
Hochschulen auf Grund des demografischen Wandels zu erwarten sind. Dazu wird ein Hand-
lungsprogramm mit drei Handlungslinien innerhalb einer Vernetzungsstruktur realisiert. Diese
Vernetzungsstruktur wiederum soll eine neue Form des Kompetenz- und Wissensmanage-
ments im sachsen-anhaltischen Hochschulsystem umsetzen.
Die Handlungslinien sind: erstens Qualifizierung der Lehrenden und Sicherung der
Anschlussfähigkeit und des Studienerfolgs; zweitens Wissensmanagement und drittens
Hochschulmarketing als ‚Produkt‘-Entwicklung und ‚Markt‘-Platzierung.
Die Vernetzungsstruktur besteht aus drei Elementen: (a) Kompetenzstützpunkten an
den Hochschulen, (b) einer Transferstelle am Wissenschaftszentrum Sachsen-Anhalt und
(c) landesweiten Kompetenzzirkeln. Die Kompetenzstützpunkte mobilisieren Stärken und
Erfahrungen, die an den einzelnen Hochschulen jeweils vorhanden sind, und speisen sie
in den überlokalen Vernetzungszusammenhang (Hochschulentwicklung und Transfer LSA,
kurz HET LSA) ein. Die Transferstelle sorgt für Stetigkeit und Verbindlichkeit innerhalb der
Vernetzung, identifiziert lösungsbedürftige Probleme und führt (auch deutschlandweit bzw.
international) vorhandene Wissensbestände für Problemlösungen zusammen. Die landes-
weiten Kompetenzzirkel dienen dem Austausch fachbezogener und fächerübergreifender
hochschuldidaktischer Expertise sowie der Identifizierung und Verbreitung von best practice-
Beispielen in der Lehre. Ein Stukturdiagramm befindet sich im Anhang.
Dabei soll insbesondere das Instrument Wissensmanagement einerseits lokales
Wissen überlokal und andererseits überlokal vorhandenes Wissen lokal verfügbar machen.
Dieses Gegenstromverfahren zielt darauf, Wissen für alle Akteure jederzeit und jedenorts
verfügbar zu machen. Dabei wird hier Wissensmanagement ausdrücklich nicht (nur) als
technisches Problem verstanden, sondern zielt auf organisatorische Lösungen: Diese sollen
den Wissenstransfer so optimieren, dass alle Beteiligten ihr Handlungswissen für andere, die
dieses Wissen für ihre Problemlösungen benötigen, verfügbar machen, und umgekehrt sollen
alle Beteiligten auf das Handlungswissen der jeweils anderen zugreifen können. Auf diese
Weise können insbesondere Beispiele guter Praxis möglichst weiträumig bekannt gemacht
und Mehrfachentwicklungen identischer oder ähnlicher Lösungen vermieden werden.
Durch Kooperationen und landeseinheitliche Regelungen sollen Qualitätsstandards
auf höchstem Niveau gewährleistet werden. Durch empirische und konzeptionelle Aktivitäten
sowie Förder- und Beratungsangebote soll das Programm zu mehr Chancen- und Bildungsge-
rechtigkeit beitragen, sowohl die Studierenden- als auch Absolventenquoten in LSA erhöhen
und damit nicht zuletzt den Fachkräftebedarf im Land langfristig absichern.Verbundantrag sachsen-anhaltischer Hochschulen im Qualitätspakt Lehre
1. Bestandsaufnahme und Problemdefinition
1.1 SWOT-Analyse
Den Basisdatenzur Hochschulentwicklung Sachsen-Anhalts (siehe Anhang) lassen sich einige
kritische Entwicklungen entnehmen:
▬▬ Die Bevölkerung Sachsen-Anhalts nimmt vglw. dramatisch ab.
▬▬ Die Zahl der StudienanfängerInnen geht nach KMK-Prognose bis 2020 gegenüber
2010 um über ein Drittel, nach CHE-Prognose um über die Hälfte zurück.
▬▬ Der Anteil ausländischer SchulabsolventInnen mit Hochschulreife ist weit unter dem
Durchschnitt der deutschen SchulabsolventInnen.
▬▬ Der Anteil der internationalen Studierenden ist im Bundesvergleich weit unterdurch-
schnittlich.
▬▬ Das Hochschulpersonal in VZÄ nimmt kontinuierlich ab.
▬▬ Sachsen-Anhalt setzt zwar einen Ausgabenschwerpunkt bei Hochschulen, wird aber
auf Grund der allgemeinen Haushaltsentwicklungen bis 2020 deutliche Konsolidie-
rungsanstrengungen unternehmen müssen.
Auf dieser Grundlage und beruhend auf Untersuchungen des Instituts für Hochschulforschung
an der Universität Halle-Wittenberg (HoF),1 die für den hiesigen Zweck aktualisiert und präzi-
siert wurden, lässt sich nachfolgende SWOT-Darstellung generieren. Diese bezieht sich, da
für den Zweck des Verbundantrages erstellt, auf eine Gesamtschau der Hochschulsituation
in Sachsen-Anhalt; im Einzelfall gibt es Abweichungen von spezifischen lokalen Situationen,
etwa bei Aussagen zu einzelnen Fächern bzw. Fächergruppen.
1 Vgl. Peer Pasternack: Zusammenfassung und Schlussfolgerungen. Die ostdeutschen Hochschulen als Elemente
einer Problemlösungskonstellation Ost, in: ders. (Hg.), Stabilisierungsfaktoren und Innovationsagenturen. Die
ostdeutschen Hochschulen und die zweite Phase des Aufbau Ost, Leipzig 2007, S. 367–442; ders.: Die mitteldeut-
sche Leistungsachse. Hochschulbildung und Forschung in Sachsen, Thüringen und Sachsen-Anhalt. Resümee
und Schlussfolgerungen, in: ders. (Hg.), Relativ prosperierend. Die mitteldeutsche Region und ihre Hochschulen,
Leipzig 2010, S. 506–541.
1Verbundantrag sachsen-anhaltischer Hochschulen im Qualitätspakt Lehre
Zu stärkende bzw. Zu reduzierende, eliminierende
zu nutzende Aspekte bzw. zu meidende Aspekte
Stärken Schwächen
(innerhalb des Hochschulsystems unmittelbar beeinflussbar)
→→ ausgeglichene Verteilung der Hochschulen →→ Studienerfolgsquote: 69,8 % (D: 72,5 %)
im Raum →→ die Studienberechtigten des Landes,
→→ Hochschulfinanzierung vergleichbar mit west darunter insbesondere die Frauen, werden
deutschen Flächenländern unzulänglich erreicht
→→ Investitionen sowohl in Breite als auch Spitze →→ studentische Wanderungsverluste:
→→ Hochschulsteuerungsreformen mit Stärkung der Wanderungssaldo WS 2008/09: ca. -8.000
dezentralen Ebenen →→ z.T. isolierte Hochschulmarketingaktivitäten
Interne Faktoren
→→ attraktive Fächer- und Studienangebote →→ Anteil der BildungsausländerInnen an
→→ vglw. wenig Zulassungsbeschränkungen Studierenden: WS 2009 8,1 % (D: 8,8 %)
→→ keine Studiengebühren für das Erststudium →→ Verlust des ursprünglichen Gleichstellungs
→→ vglw. gute Betreuungsrelation vorsprungs
→→ gute Infrastruktur und Ausstattungsvorteile →→ vglw. geringe Anzahl von Promotionen je
→→ Ingenieurwissenschaften im Bundesvergleich Universitätsprofessur: pro Jahr 0,72 (D: 0,88)
personell überdurchschnittlich ausgestattet →→ vglw. wenig Juniorprof.-innen/ren
→→ dynamisch wachsender Frauenanteil an →→ Drittmittel je Professur: 2007 Universität
Studierenden 127.220 € (D: 192.880 €); FH 16.110 €
→→ Hochschulmarketing-Erfolge: bislang Ausgleich (D: 18.780 €)
des Rückgang der Studienanfängerzahlen durch
steigenden Anteil westdeutscher Studienanfän-
ger/innen
→→ zahlreiche Kooperationen Schule-Hochschule im
Bereich Studien- und Berufsorientierung Risiken
→→ stetiger Ausbau des Hochschul-QM durch Ziel-
vereinbarungen Land-Hochschulen →→ bis 2020 massive Einnahmenausfälle im Lan-
deshaushalt, die durch sinkende Studierenden-
zahlen noch verstärkt werden könnten
→→ problematische demografische Entwicklungen
(aus günstigen bzw. ungünstigen Kontextbedingungen resultierend)
→ massive Reduzierung der Zahl der Jahr-
Chancen gangskohorten
→→ Studienberechtigtenquote: 36,5 % (zweit-
→→ trotz Kürzungen nach wie vor hoher Stellenwert schlechtester Wert nach Bayern)
der Wissenschaft in der Ausgabenpolitik des →→ Studienanfängerquote: 2008: 34 %, 2010: 28 %
Landes →→ durch Personalabbau Verlust bisheriger Leis-
→→ Abmilderung früherer Einsparauflagen durch tungsstärken in der Lehre
Hochschulpakt 2020 →→ Entwicklungsbrüche bei der Hochschulsteuerung
→→ steigende Studiennachfrage aus sozial schwä- →→ Spannungen zwischen Kooperations- und Wett-
Externe Faktoren
cheren und/oder bildungsferneren Schichten bewerbspostulaten
→→ hohe Studiennachfrage in Westdeutschland mit →→ Wanderungsverluste bei StudienanfängerInnen:
Chancen auf Wanderungsgewinne 2008 ca. 1.400
→→ niedrigere Lebenshaltungskosten →→ hohe Abwanderungsneigung bei bildungsorien-
→→ massiv ansteigender Fachkräftebedarf in der tierten jungen Frauen
Region: für viele Studienrichtungen faktische →→ deutschlandweite geringe Mobilitätsneigung der
Arbeitsplatzgarantie in der Region Studieninteressierten
→→ überdurchschnittliche regionale Bedeutung →→ ab 2015 auch im Westen Deutschlands
öffentlich unterhaltener Hochschulressourcen sinkende Jahrgangsstärken
aufgrund geringer privat finanzierter FuE →→ teilweise problematisches Image der Region
→→ negative Differenzen zwischen Standortimages
und tatsächlicher Lebensqualität
→→ höhere Reputationsbewertung der Forschungs-
im Vergleich zur Lehrleistungen
→ Auswirkung auf HSL-Verhalten
→→ Abwerbeaktivitäten in Folge des Fachkäfte
mangels in Westdeutschland
→→ Gelingen des Generationenübergangs in
Unternehmen ungewiss: ggf. Auswirkungen auf
künftiges Arbeitsplatzangebot für Hochschul
absolventInnen
2Verbundantrag sachsen-anhaltischer Hochschulen im Qualitätspakt Lehre
1.2 Problemdefinition
Die demografischen Entwicklungen werden für die Hochschulen Sachsen-Anhalts in mehr-
facher Hinsicht zur Herausforderung:
Ergebnisse | Seite 9
1. In der Laufzeit des Qualitätspakts Lehre sind voraussichtlich zwei gegenläufige Ent-
wicklungen zu bewältigen: zum einen die aktuelle Überlast, zum anderen muss in der
2.2 Studienanfänger(innen) nach Ländern
zweiten Hälfte des Jahrzehnts die Möglichkeit einer Unterauslastung in Rechnung
Die zuvor skizzierten Entwicklungen stellen sich regional sehr unterschiedlich dar. So ist
auch gestellt werden. Bisaktuellster
trotz der Berücksichtigung 2015 istMobilitäten
mit einem Abbau der gegenwärtigen
der Studienanfänger(innen) innerhalb Überlast zu rechnen
Deutschlands immer noch ein sehr ausgeprägtes West-Ost-Gefälle festzustellen. 6 Nachste-
hende(Abb. 1).3 stellt die zusätzlichen Studienanfänger(innen) von 2011 bis 2015 im obe-
Abbildung
ren und unteren Szenario nach Ländern dar.
Abb. 1: StudienanfängerInnen 2011–2015 nach Ländern
Abbildung 5: zusätzliche Studienanfänger(innen) 2011-2015 nach Ländern - unteres und oberes Szenario
140.000
120.000
100.000
80.000
60.000
40.000
20.000
0
NW BY BW NI HE RP HH BE SH HB BB SL MV TH ST SN
-20.000
-40.000
oberes Szenario unteres Szenario
Die größten Zuwächse
Quelle: Christian sind demnach
Berthold/Gösta in denHerdin/Thimo
Gabriel/Gunvald Ländern Nordrhein-Westfalen, Bayern und
von Stuckrad: Studienanfänger(innen) an Ba-
Hochschulen in Deutschland. Erwartungen für
die zweite Phase des Hochschulpaktes, CHE Consult, Gütersloh 2011, S. 9.
den-Württemberg zu erwarten. Diese Länder müssen also in den nächsten Jahren mit dem
größten Andrang rechnen. In manchen Ländern liegt das obere Szenario unter dem unteren
Szenario. Dies mag zunächst verwundern, resultiert jedoch daraus, dass im oberen Szenario
Für die zweite Hälfte des Jahrzehnts lauten die Prognosen, dass die Zahl der Stu-
die Zahlen der Hochschulzugangsberechtigten angepasst wurden, indem die durchschnittli-
dienanfängerInnen
che Abweichung der Jahre 2009 und bis 2010
2020 für gegenüber
die Jahre 2011 bis 2010
2015 um über einwur-
fortgeschrieben Drittel bis über die Hälfte
de. 7 In den Ländern Sachsen und Berlin beispielsweise erreichte die Zahl der Hochschulzu-
zurückgehen
gangsberechtigten wird.
nicht die Prognose der Hochschulzugangsberechtigten der KMK aus dem
Jahr 2007. Die Zuwächse für das obere Szenario bei einem gegenüber 2009 konstant ange-
nommenen Wanderungsverhalten der Studienanfänger(innen) sind nach Ländern und Jah-
ren in den Abbildung 4 bis Abbildung 6 dargestellt.
2. Zugleich geht in der sachsen-anhaltischen Wirtschaft, aber auch bei öffentlichen
6
Beschäftigern die Transformationsgeneration innerhalb eines Zeitfensters von 15
In der Prognose wurde die Mobilität der Studienanfänger(innen) zwischen dem Land, in dem die Hochschulzu-
gangsberechtigung erworben wurde, und dem Land des Hochschulortes aus dem Studienjahr 2009 berücksich-
tigt. Jahren nahezu komplett in den Ruhestand. Ohne entsprechenden Nachwuchs ist hier
7
Vgl. Abschnitt 3
der innerbetriebliche Generationsübergang gefährdet. Daher gibt es einen erheblichen
Fachkräftebedarf, der wesentlich von den einheimischen Hochschulen zu bedienen
ist. Mithin müssen alle Bildungsreserven gehoben werden. In einzelnen Berufen be-
steht bereits heute akuter Fachkräftemangel – was wiederum die heutige Situation
mit der künftigen, in welcher der Fachkräftemangel zum allgemeinen Problem zu
werden droht, verzahnt. Dabei ist überdies zu berücksichtigen, dass die klein- und
3Verbundantrag sachsen-anhaltischer Hochschulen im Qualitätspakt Lehre
mittelständisch geprägte regionale Wirtschaft besondere Fachkräftebedürfnisse hat,
z.B. breit einsetzbares Personal, das von seiner Qualifikation her fachlich nicht zu
eng fokussiert ist.
3. Reduzierte Studienanfängerjahrgänge und gleichzeitig erheblicher Fachkräftebe-
darf erzwingen es, dass auch solche jungen Menschen an ein Hochschulstudium
herangeführt werden, die für ihre individuelle Qualifizierung bisher eher nichtaka-
demische Optionen präferiert hätten. Das heißt, die Heterogenität der Studierenden
wird deutlich zunehmen, insbesondere auch deshalb, weil mehr der vorhandenen
Studienberechtigten geworben und erreicht werden müssen. Diese betrifft nicht allein
die differenzierten kognitiven Anfangsausstattungen der Studierenden, sondern auch
unterschiedliche (berufs)biografische Erfahrungshintergründe, kulturelle Herkünfte
(sozial oder/und ethnisch), Lebensalter sowie Erwartungen und Intentionen, die sich
mit einem Hochschulstudium verbinden. Heterogenität von Studierendenkohorten,
besonders von Studierendengruppen innerhalb einer Lehrveranstaltung, wird von den
Lehrenden in der Regel als Problem wahrgenommen. Im Kontrast dazu findet sich
in der Didaktik konstruktivistischer Prägung die Position, dass sich aus der Hetero-
genität von Lerngruppen didaktische Funken schlagen lassen können. Dazu jedoch
bedarf es spezifischer, nämlich heterogenitätssensibler Fertigkeiten der Lehrenden.
Darüber hinaus bedarf es Rahmenbedingungen, die zur Öffnung der Hochschulen
für nichttraditionelle Studierendengruppen beitragen und die Nutzung der Diversity-
Potenziale ermöglichen, so entsprechender Strukturen etwa in der Kinderbetreuung
in Randzeiten, angepasster und flexibler Studienangebote, die Teilzeit ermöglichen,
Finanzierungsmodalitäten usw. Ebenso bedarf es entsprechender Einstellungen und
Kenntnisse bei den lehrunterstützenden Bereichen in Verwaltung, Studienfachbera-
tung und Studentenwerken, etwa in Gestalt von Leitfäden und Qualifizierungen.
Die gegenläufigen Entwicklungen, wie sie innerhalb der Laufzeit des Qualitätspakts Lehre in
Sachsen-Anhalt zu erwarten sind, formulieren im Blick auf die Qualität von Lehre, Studium
und Betreuung differenzierte Anforderungen:
▬▬ In der Überlastsituation muss Qualitätssicherung als Sicherung von Standards be-
trieben werden und zugleich eine Vorbereitung auf die anschließend geänderte
Nachfragesituation stattfinden.
▬▬ In der Situation geringerer Nachfrage muss Qualitätssicherung und -entwicklung ein
Beitrag zur maximalen Bildungspotenzial-Ausschöpfung sein.
Da die Situation geringerer Nachfrage nicht erst vorbereitet werden kann, wenn sie einge
treten ist, müssen sich die sachsen-anhaltischen Hochschulen innerhalb der aktuellen Über-
4Verbundantrag sachsen-anhaltischer Hochschulen im Qualitätspakt Lehre
lastsituation soweit ertüchtigen, dass sie zur Bewältigung der anschließenden gegenteiligen
Situation in der Lage sind.
Dabei können die Hochschulen Sachsen-Anhalts auf zahlreichen Aktivitäten der letz-
ten Jahre aufbauen. Insbesondere die im Rahmen des Hochschulpakts 2020 unternommenen
Anstrengungen im Hochschulmarketing haben zu systematischen Attraktivitätsverbesserun-
gen von Studium und Lehre geführt. Diese sind konkret messbar: Sie haben den Hochschulen
Sachsen-Anhalts einen steigenden Anteil westdeutscher StudienanfängerInnen beschert, mit
dem bisher der demografisch bedingte Rückgang der landesinternen Studienanfängerzahlen
kompensiert werden konnte. (Abb. 2) Ebenso haben die Hochschulen und das Land in ihren
Zielvereinbarungen 2011–2013 zahlreiche Maßnahmen vereinbart, die auf Attraktivitätsstei-
gerung der sachsen-anhaltischen Hochschulen zielen.
Abb. 2: StudienanfängerInnen in Sachsen-Anhalt mit HZB-West
Quelle: Kultusministerium LSA 2010)
Die künftigen Herausforderungen hinsichtlich der Studienanfängerzahlen werden jedoch be-
trächtlich steigen. Daher liegt es nahe, die bislang an die einzelnen Hochschulen gebundenen
Aktivitäten miteinander zu vernetzen, Erfahrungstransfers zu ermöglichen und gemeinsames
Handeln überall dort, wo das die Transaktionskosten für die einzelne Hochschule senkt, zu
entwickeln. Um diesen Ausbau der bisherigen Aktivitäten zu ermöglichen, werden stärkende
Ressourcen benötigt.
Zusammengefasst: Die demografischen Entwicklungen konfrontieren die Hochschulen Sach-
sen-Anhalts damit, aktuell Überlast bewältigen zu müssen, während mittelfristig Unteraus-
lastung möglich bis wahrscheinlich ist. Zugleich bahnt sich ein Fachkräftemängel an, und es
sind regional spezifische, nämlich eher breite als allzu spezialisierte Qualifikationsbedarfe
5Verbundantrag sachsen-anhaltischer Hochschulen im Qualitätspakt Lehre
der klein- und mittelständisch geprägten Wirtschaft zu bedienen. Die Heterogenität der
Berufsanforderungen fällt zusammen mit steigender Heterogenität der Studierenden, da
neue Klientelgruppen für ein Studium erschlossen werden müssen. Die Situation geringerer
Nachfrage kann nicht erst vorbereitet werden, wenn sie eingetreten ist. Daher müssen sich
die sachsen-anhaltischen Hochschulen innerhalb der aktuellen Überlastsituation soweit er-
tüchtigen, dass sie zur Bewältigung der anschließenden gegenteiligen Situation in der Lage
sind. Das zu lösende Hauptproblem besteht darin, Qualität unter Bedingungen verstärkter
Heterogenität zu sichern und zu entwickeln. Aufbauend auf zahlreichen Aktivitäten und Er-
fahrungen der letzten Jahre sind deshalb die bereits erzielten Attraktivitätsverbesserungen
von Studium und Lehre nochmals deutlich zu steigern. Dafür müssen Aktivitäten miteinander
vernetzt, Erfahrungstransfers ermöglicht und gemeinsames Handeln entwickelt werden. Um
dies zu ermöglichen, werden stärkende Ressourcen benötigt.
2. Problembearbeitung
2.1 Einordnung und Grundidee
HochschulabsolventInnen haben sich in ihren beruflichen Handlungskontexten typischerweise
nicht in Routinesituationen, sondern in Situationen der Ungewissheit, konkurrierender Deu-
tungen und Normenkonflikte, zugleich aber auch des Zeitdrucks und Handlungszwanges zu
bewegen. Um in solchen Situationen sicher und folgelastig handeln zu können, wird wissen-
schaftlich basierte Urteilsfähigkeit – d.h. die Befähigung, komplexe Sachverhalte methodisch
geleitet und kritisch zu analysieren und zu bewerten – sowie eine explizit darauf gründende
Handlungsfähigkeit benötigt. Diese sollen (auch) zum Lösen von Problemen befähigen, die
während des Studiums entweder aus Stoffmengengründen nicht gelehrt werden oder aber
noch gar nicht bekannt sein konnten. Lebenskluge Beschäftiger erwarten auch genau das,
denn „Praktiker wissen, daß Praxis blind macht. Sie suchen nicht nach Leuten, die ihre Blind
heit teilen“.2 Studierende als künftige AbsolventInnen sind daher in die Lage zu versetzen,
sowohl theoretisch angeleitet auf die Praxis schauen als auch die Praxisrelevanzen ihrer
Theorieschulung erkennen und fruchtbar machen zu können.
Ziele des Studiums sind insoweit Wissenserwerb, Fähigkeit- und Fertigkeitsaus-
prägung sowie kritisches Denken und Persönlichkeitsentwicklung. Dies schließt an die
einschlägige wissenschaftliche Kompetenzdebatte an. Jenseits berufspraktischer Verkür-
2 Dirk Baecker: Die Universität als Algorithmus. Formen des Umgangs mit der Paradoxie der Erziehung, in:
Berliner Debatte Initial 3/1999, S. 63–75, hier 64.
6Verbundantrag sachsen-anhaltischer Hochschulen im Qualitätspakt Lehre
zungen bezeichnen Kompetenzen danach auch die Voraussetzungen, die für den Einsatz
von Fähigkeiten und Fertigkeiten, Wissen und Bildung grundlegend bzw. ursächlich sind.
„Kompetenzen sind kein bloßes bzw. „leeres“ Wissen, sondern praktizierbares und prakti-
ziertes Wissen“. Zum einen könne auf dieses Wissen dauerhaft zurückgegriffen werden. Zum
anderen passe sich dieses Wissen flexibel an wechselnde Kontexte an. Insofern verschmelze
im Kompetenzbegriff das „Können“ und „Wollen“.3
Neben der Erarbeitung fachlicher Inhalte geht es insbesondere um die Fertigkeit der
Entschlüsselung von Zusammenhängen und darum, individuelle Strukturierungs-, Bewer-
tungs- und Kommunikationsfertigkeiten zu entwickeln, mithin: um überfachliche und multi-
funktionale Fertigkeiten – die sog. Schlüsselqualifikationen. Traditionell wurde angenommen,
diese Fertigkeiten würden an einer Universität nach Humboldtschem Muster gleichsam ne-
benher erworben. Dies wurde und wird mit der massiv ausgeweiteten Bildungsbeteiligung in
gleichzeitig unterfinanzierten Hochschulen zunehmend fragwürdig. Die Alternative besteht
darin, die Erarbeitung von Schlüsselqualifikationen nicht in separierte Studienmodule zu
delegieren, sondern sie weitgehend in die Fachstudien zu integrieren.
Berufsorientierung wird in diesem Sinne als Orientierung auf beruflichen Einsatz,
der im Studium noch nicht konkret bestimmt sein kann, verstanden. Flexibilität hinsichtlich
dessen, was die konkreten beruflichen Einsätze dann erfordern werden, ist insofern ein
zentrales Kompetenzmerkmal der Absolventinnen und Absolventen. Gerade die in Sachsen-
Anhalt dominierende klein- und mittelständische Wirtschaft als ein zentraler Abnehmer der
HochschulabsolventInnen benötigt keine frühzeitig verengten SpezialistInnen, sondern in
diverse Aufgaben einarbeitungsfähiges Personal. Die Beschäftigung eindeutig fokussierter
SpezialistInnen können sich eher Großunternehmen leisten.
Für die Gestaltung dementsprechender Lehre müssen das Lehrpersonal und die lehr-
unterstützenden Bereiche der Hochschulen entsprechend ertüchtigt werden. Stellt dies bereits
unter Normalbedingungen eine Herausforderung dar, so verschärfen sich die Anforderungen
(a) in Überlastsituationen (aktuell) und (b) in Situationen, die durch die mit geringeren Jahr-
gangsstärken einhergehende Heterogenität der Studierenden gekennzeichnet sind (künftig).
Hierzu wird ein Handlungsprogramm „Heterogenität als Qualitätsherausforderung für
Studium und Lehre: Wissensmanagement für Hochschulbildung im demografischen Wandel“
mit mehreren Handlungslinien (nachfolgend Punkt 2.2.) sowie eine dieses Programm unter-
setzende und dessen Realisierung ermöglichende Struktur „HET LSA – Hochschulentwicklung
und Transfer Sachsen-Anhalt“ aufgebaut und intern vernetzt (2.3.).
3 Tobias Sander: „Den Menschen da abholen wo er steht“. Kompetenzkonzept und Hochschulausbildung, in:
Das Hochschulwesen 1/2010, S. 3–11, hier S. 4f.
7Verbundantrag sachsen-anhaltischer Hochschulen im Qualitätspakt Lehre
2.2 Programm „Heterogenität als Qualitätsherausforderung
für Studium und Lehre: Kompetenz- und Wissensmanagement für
Hochschulbildung im demografischen Wandel“
Das Handlungsprogramm zielt auf die Auslastung der Studienplatzkapazitäten und eine
Qualitätssteigerung der Lehre,
▬▬ von denen einerseits alle Hochschulen unabhängig vom Umfang ihrer je eigenen (sehr
unterschiedlichen) Ressourcen und ihrer geografischen Lage profitieren,
▬▬ die andererseits die demografisch bedingt heterogener werdende Studierendenschaft
nicht als Träger von Begabungsmängeln, sondern grundsätzlich als erfolgreich qua-
lifizierungsfähige Klientel betrachten.
Das Handlungsprogramm „Heterogenität als Qualitätsherausforderung für Studium und Lehre:
Kompetenz- und Wissensmanagement für Hochschulbildung im demografischen Wandel“
wird im Rahmen dreier Handlungslinien
▬▬ Professionalisierung und Hochschulentwicklung
▬▬ Wissensmanagement
▬▬ Hochschulmarketing als ‚Produkt‘-Entwicklung und ‚Markt‘-Platzierung.
und unter Beteiligung verschiedener Kompetenzstützpunkte realisiert.
2.2.1 Professionalisierung und Hochschulentwicklung
Professionalisierung – Qualifizierung der Lehrenden
Der Hochschullehrerberuf ist durch eine erhebliche Rollenkomplexität gekennzeichnet und
erfordert die souveräne Bewältigung von Herausforderungen in Lehre, Forschung, Nach-
wuchsförderung, Mitteleinwerbung, Mitarbeiterführung, Teamorganisation, Zeitmanagement,
Netzwerkmanagement, Medienbeherrschung sowie Kommunikation nach innen und außen.
Dies ist zu berücksichtigen, wenn Lehrende für Lehre und Betreuung ertüchtigt werden sol-
len, die heutigen und künftigen Anforderungen gerecht werden. Entsprechende Angebote
stoßen dann auf Zustimmung, wenn ihre Transaktionskosten für die Lehrenden nicht höher
sind als die sich einstellenden Effekte – bzw. positiv formuliert: Die individuelle Neigung, sich
didaktische und Lehrorganisationskompetenzen anzueignen, ist umso höher, je deutlicher die
daraus resultierenden Lehr-Lern-Effekte den deshalb zu treibenden Aufwand überschreiten.
Insoweit bedarf es einer aufwandsrealistischen Hochschuldidaktik, die in Rechnung
stellt, dass die Lehrenden eine komplexe Berufsrolle auszufüllen haben und praktisch per-
manent mit Zeitproblemen kämpfen – m.a.W.: dass sie auch bei gutem Willen häufig nicht in
der Lage sind, komplizierte und aufwändige Handlungsalgorithmen für die Bewältigung von
8Verbundantrag sachsen-anhaltischer Hochschulen im Qualitätspakt Lehre
Lehr-Lern-Situationen zunächst zu studieren und sie hernach mit entsprechendem Vor- und
Nachbereitungsaufwand anzuwenden. Die Kunst der hochschuldidaktischen Angebote muss
daher darin bestehen, für real gegebene – statt ideal gedachte – Bedingungen Lösungen
zu offerieren, deren Anwendung die Anzahl der Probleme der Lehrenden nicht vergrößert,
sondern minimiert. In diesem Sinne werden die Angebote entwickelt und feedbackabhängig
weiterentwickelt.
Dafür soll eine Professur installiert werden, die sich der Lehr-Lern-Forschung widmet,
‚aufwandsrealistische‘ Handlungsalgorithmen ableitet sowie dementsprechende Qualifizie-
rungskonzepte für Lehrende entwickelt. Diese werden durch die ebenfalls zu installierende
Transferstelle mittels Mentoring, Veranstaltungen, das Zusammenführen vorhandener Best
Practices und ein systematisches überlokales Wissensmanagement landesweit verfügbar
gemacht.
Hochschulentwicklung – Sicherung der Anschlussfähigkeit und des Studienerfolgs
Die wachsende Vielfalt an Bildungsbiografien und Kompetenzniveaus bedingt eine Flexibili-
sierung und Differenzierung sowohl der Eingangsschnittstelle Schule-Hochschule bzw. Beruf-
Hochschule als auch der Ausgangsschnittstelle Hochschule-Beruf und des Studienverlaufs
selbst. Bildungsinstitutionen müssen neben der Flexibilisierung der Rahmenbedingungen
auch durch gezielte, diversifizierte (Förder-)Programme den Studienerfolg und somit die
Anschlussfähigkeit ihrer AbsolventInnen und Angebote sichern, um den landesspezifischen
Herausforderungen auch zukünftig gewachsen zu sein – etwa hinsichtlich der dynamischen
Anforderungsprofile insbesondere der KMU in Sachsen-Anhalt.
Um auf die prognostizierten Heterogenität der Studierenden, der Zugangswege zur
Hochschule und der Anforderungen in der Berufswelt angemessen reagieren zu können,
werden von den Verbundpartnern differenzierte Angebote an Nachwuchswissenschaftler/in-
nen, Neuberufene und ausländische Dozent/innen unterbreitet, FachberaterInnen qualifiziert,
Programme für ein externes Mentoring und internes Mentoring für das ganze Land verfügbar
gemacht, Handreichungen und Veranstaltungsformate zur Schlüsselqualifikationsvermittlung
angeboten. Vier der im Verbund beteiligten Hochschulen werden sich u.a. der mediendidakti-
schen Hochschulpraxis bzw. dem multimedialen Lernen widmen, eine davon mit Schwerpunkt
Ingenieursausbildung. Ergänzend wird ein Lehrendensurvey aufgelegt, um das Wissen für
die Weiterentwicklung der genannten Angebote zu erzeugen.
‚Anschlussfähigkeit‘ bezeichnet die Passgenauigkeit des Studiums zu gesellschaftli-
chen Funktionssystemen und der je individuellen Lebenswelt – die Berücksichtigung lebens-
weltlicher Bedingungen und Bedingungen gesellschaftlicher und beruflicher In- und Exklusion.
Anschlussfähigkeit muss zum einen Studierfähigkeit und zum anderen Berufsfähigkeit durch
Urteils- und Reflexionskompetenz erzeugen. Diese ist immanent, will man der „objektiven
9Verbundantrag sachsen-anhaltischer Hochschulen im Qualitätspakt Lehre
Vagheit der Qualifikationsanforderungen“4 gerecht werden. Der Begriff Anschlussfähigkeit
hat dabei sowohl eine qualitative Komponente hinsichtlich des Studienverlaufs und der Stu-
dienstruktur als auch der Lehr-Lern-Inhalte und -methoden. Blickt man auf die Arbeitsmarkt-
situation, so lässt sich Anschlussfähigkeit auch quantitativ bestimmen. Hier wird für einige
Fachbereiche – Stichwort „akademisches Proletariat“ – bspw. die Frage lauter, ob und wie
eine engere Abstimmung zwischen Absolventenzahlen und fachspezifischen Stellenange-
boten erfolgen sollte.
Diese Aktivitäten müssen durch entsprechendes Wissen untersetzt und mit geeigne-
ten Instrumenten betrieben werden. Die einzurichtende Professur widmet sich daher gleicher-
maßen der Professionalisierung der Lehrenden und der Erforschung von Lehre und Lernen
bedingenden Faktoren. Beispiele der diesbezüglichen einzusetzenden Instrumentarien sind:
▬▬ eine landesweite Studierendenbefragung,5 und
▬▬ die Erstellung einer Studienberatungs- Studienorientierungs- und Übergangsange-
botsmatrix, um Bedarfe und Best Practices zur Bedarfsbefriedigung analytisch zu
erfassen,
▬▬ Transferforschung zu Anschlussfähigkeit, Studienerfolgsbedingungen, Lebenswelt-
bezogenheit, beruflicher Relevanz, Kompetenzorientierung und internationaler Di-
mension sowie
▬▬ Untersuchungen zum Studienverhalten.
Von den anderen Verbundpartnern werden, um bei der prognostizierten Heterogenität der
Studierenden, aber auch der Anforderungen in der Berufswelt angemessene Studienerfolge
zu sichern, das Qualitätsmanagement mit systematischer Identifizierung von Schwachstellen
und Entwicklungsbedarf sowie der Erhebung Beispiele guter Praxis entwickelt, die Struktur
des Lehrpersonals erfasst, ein vorhandenes Handlungskonzept für den Aufbau regionaler
Hochschule-Praxis-Netzwerke umgesetzt
und ein Integrationsprogramm für auslän- Die Ziele sind:
▬▬ diversifizierte,
dische Studierende landesweit verallge- ▬▬ lebenswirklichkeitsbezogene und bildungsbiografische,
meinert; letzteres gilt auch für vorhande- ▬▬ (inter)national und interdisziplinäre,
▬▬ beruflich relevante und
ne Learningmanagement-Konzepte. Ein ▬▬ kompetenzorientierte
zentrales Element für die Entwicklung all Studienangebote. Deren qualitative Entwicklung und Gestal-
tung wird vorangetrieben und begleitet, um mit differenzier-
dessen werden landesweite Kompetenz- ten und passgenauen Angeboten die Studierenden- und die
zirkel sein. AbsolventInnen-Quote zu steigern.
4 Ulrich Teichler: Wissenschaftlich kompetent für den Beruf qualifizieren, in: Hochschulrektorenkonferenz (Hg.):
Neue Anforderungen an die Lehre in Bachelor- und Master-Studiengängen. Jahrestagung des HRK Bologna-Zen-
trums, Bonn 2009, S. 32.
5 wobei eine Kooperation mit dem CHE, anknüpfend an das Instrumentarium QUEST, angestrebt wird, vgl.
http://www.che.de/downloads/CHE_AP144_QUEST_Entwicklung_und_Test_des_Fragebogens.pdf
10Verbundantrag sachsen-anhaltischer Hochschulen im Qualitätspakt Lehre
Bei der Optimierung der Lernumwelt und somit der Erhöhung der Anschlussfähigkeit
und des Studienerfolgs gilt es, die Defizitperspektive durch einen ressourcenorientierten Blick
zu überwinden und einen hohen Passungsgrad zwischen den Studierenden, der Hochschule
und dem Anschlussfeld herzustellen. Die anzustoßenden Prozesse zielen hierbei auf eine
größere „Durchlässigkeit zwischen den Teilen des Bildungssystems“6 und führen zu einer
Ausdifferenzierung der Hochschullandschaft und Studienangebote bzw. -formate – folglich
zu einem chancengerechteren Umgang mit der Heterogenität der Studierendenschaft.
Zusammengefasst: Die Handlungslinie „Professionalisierung und Hochschulentwicklung“
ist an Lehrende einerseits und Studierende andererseits adressiert. Bei beiden Adressa-
tengruppen sind spezifische Bedingungen der Ansprache, des Interesseweckens und der
Organisation erfolgreichen Handelns zu berücksichtigen. Lehrende benötigen Angebote einer
aufwandsrealistischen Hochschuldidaktik mit Lösungen für real gegebene statt ideal gedach-
ten Bedingungen. Studierende und Studieninteressierte benötigen Angebote, die auf die
Probleme der Schnittstellen Schule-Hochschule und Hochschule-Beruf rekurrieren sowie die
zunehmende Differenzierung der Studierendenkohorten reflektieren. Sowohl die an Lehrende
als auch die an (potenzielle) Studierende gerichteten Aktivitäten zielen wiederum gemeinsam
auf einen chancengerechteren Umgang mit der Heterogenität der Studierendenschaft.
2.2.2 Wissensmanagement: Vermittlung, Verwaltung,
Verteilung, Verwertung und Verknüpfung von Wissen
Im Sinne einer ganzheitlichen Qualitätsverbesserung wird das Management von Wissens-
beständen, die systematische Bündelung der Ressourcen wissensbasierter Organisationen
zu einer zentralen Voraussetzung.
Durch Wissensmanagement sollen und können die Wirksamkeit von Qualitätsprozes-
sen sowie die Reichweite von Innovationsprozessen erhöht und damit die Nachhaltigkeit z.B.
hochschuldidaktischer Aktionen gesichert werden. Das scheint umso erfolgsversprechender
in einer stabilen Netzwerkstruktur, da sowohl die Nutzung relevanter Wissensbestände als
auch die Instrumente der Steuerung effektiviert werden. 7 Für ein erfolgversprechendes Wis-
6 Kornelia Haugg: Im Dialog Durchlässigkeit der Bildungssysteme und Anrechnung von Kompetenzen fördern. In: R.
Buhr, W. Freitag, E.A. Hartmann, C. Loroff, K.H. Minsk (Hg.), Durchlässigkeit gestalten! Wege zwischen beruflicher
und hochschulischer Bildung, Münster 2008, S 38–41.
7 Vgl. Kurt-Georg Ciesinger: Modernes Wissensmanagement in Netzwerken, Wiesbaden 2005, S. 4.
11Verbundantrag sachsen-anhaltischer Hochschulen im Qualitätspakt Lehre
sens- und Netzwerkmanagement ist die Etablierung einer Kooperationskultur unabdingbar,
die das „Fließgleichgewicht des Wissensaustauschs“ garantiert.8
Das Wissensmanagement wird einerseits lokales Wissen überlokal und andererseits
überlokal vorhandenes Wissen lokal verfügbar machen. Dieses Gegenstromverfahren zielt
darauf, Wissen für jeden jederzeit und jedenorts verfügbar zu machen. Die Erfahrung lehrt,
dass erhebliche Zeitressourcen dafür aufgewendet werden, Handlungswissen zu produzie-
ren, das an anderer Stelle bereits vorliegt bzw. erprobt ist. Innerhalb eines Landes und eines
vergleichsweise überschaubaren Hochschulsystems wie in Sachsen-Anhalt stellt dies eine
problematische Ressourcenvergeudung dar.
Dabei wird hier Wissensmanagement ausdrücklich nicht (nur) als technisches Problem
verstanden, sondern zielt auf organisatorische Lösungen: Diese sollen den Wissenstransfer
so optimieren, dass alle Beteiligten ihr Handlungswissen für andere, die dieses Wissen für
ihre Problemlösungen benötigen, verfügbar machen, und umgekehrt sollen alle Beteiligten
auf das Handlungswissen der jeweils anderen zugreifen können. Auf diese Weise können
insbesondere Beispiele guter Praxis möglichst weiträumig bekannt gemacht und Mehrfach-
entwicklungen identischer oder ähnlicher Lösungen vermieden werden.
Konkret wird das Wissensmanagement in einem breiten Spektrum entfaltet, etabliert
und wirksam gemacht, indem die bereits vorhandenen hochschulinternen Strukturen durch eine
übergeordnete ergänzt werden. Diese wird von der Transferstelle verantwortet.9 Deren Aufgaben
sind die Koordination landesweiter Kompetenzzirkel, die Erstellung einer Kompetenzmatrix des
Landes, die Entwicklung von Weiterbildungsangeboten sowie die Qualifizierung FachberaterIn-
nen, die Entwicklung von Handlungskonzepten für die Gestaltung der organisatorischen Kon-
texte der Lehre sowie Handreichungen zu den jeweils vordringlichsten Themen. Dabei erstellt
die Transferstelle z.B. ein Wissensbilanzierungmodells für LSA und etabliert landeseinheitliches
Standards im Wissensmanagement durch Mentoring an den einzelnen Hochschulen. Weitere
Verbundpartner werden sich der Bearbeitung strategischer Fragen des Wissensmanagements
betreffend IT-Services, Prozessmanagement, Medien, E-Learning und Reorganisation interner
Prozesse widmen und ein Applikationsnetzwerk zur Integration multimedialer Lehr-/Lernmodule
mit operativer Unterstützung der Lehrenden einbringen.
Zusammengefasst: Durch das Wissensmanagement werden die Wirksamkeit von Qualitäts-
prozessen sowie die Reichweite von Innovationsprozessen erhöht und damit die Nachhaltig-
keit z.B. hochschuldidaktischer Aktionen gesichert. Das Wissensmanagement wird einerseits
lokales Wissen überlokal und andererseits überlokal vorhandenes Wissen lokal verfügbar
8 Ebd., S. 157.
9 Vgl. unten 2.3.2. Transferstelle
12Verbundantrag sachsen-anhaltischer Hochschulen im Qualitätspakt Lehre
machen. So werden Mehrfachentwicklungen identischer oder ähnlicher Lösungen vermieden.
Dafür werden die vorhandenen hochschulinternen Strukturen durch eine übergeordnete er-
gänzt. Auf diese Weise werden die Koordination landesweiter Kompetenzzirkel, die Erstellung
einer Kompetenzmatrix, die Entwicklung von Weiterbildungsangeboten, Handlungskonzepten
und landeseinheitlicher Standards im Wissensmanagement durch Mentoring auf eine stabile
Grundlage gestellt.
2.2.3 Hochschulmarketing als ‚Produkt‘-Entwicklung
und ‚Markt‘-Platzierung
Im Rahmen der vom BMBF geförderten „Hochschulinitiative Neue Bundesländer“ werden
bereits seit einigen Jahren Maßnahmen ergriffen, um Studieninteressierte aus den westli-
chen Bundesländern anzuwerben. Dazu gehören u.a. Aufbau und Pflege von entsprechen-
den Internetauftritten, die Organisation besonderer Veranstaltungen und Aktionen sowie die
Bereitstellung von Beratungsangeboten. Das Land Sachsen-Anhalt und seine Hochschulen
können hierbei auf besondere Erfahrungen zurückgreifen. 10
▬▬ Zum einen hat das Kultusministerium bzw. Ministerium für Wissenschaft und Wirt-
schaft des Landes die Koordinierung der länderübergreifenden Kampagne („Studieren
in Fernost“11 und „Hochschulinitiative Neue Länder“12) übernommen.
▬▬ Zum anderen haben die Hochschulen des Landes Strukturen geschaffen, um Aufga-
ben der Studienwerbung verantwortlich wahrzunehmen (u.a. entsprechende Refe-
renten- und Stabstellen zum Hochschulmarketing).
Die Vielfalt und Qualität der ergriffenen Maßnahmen der Hochschulen Sachsen-Anhalts hat zu
wichtigen Erfolgen geführt: Im Rahmen der länderübergreifenden Studieren-in-Fernost-Kam
pagne wurden Hochschulwettbewerbe ausgerufen, bei denen die Hochschulen von Sachsen-
Anhalt oftmals zu den Gewinnern zählten. Die erste Runde 2009 zum Thema „Schneller ins
Studium“ hat u.a. die Universität Halle-Wittenberg gewonnen. Im zweiten Wettbewerb 2010
„Campus und Stadt erleben“ reüssierten drei Hochschulen des Landes: die Universität Halle-
Wittenberg, die Universität Magdeburg und die Hochschule Magdeburg-Stendal. Beim dritten
Wettbewerb 2011 „Vermarktungsfähige Attraktivität der Studienbedingungen an ostdeutschen
Hochschulen“ zählte die Otto-von-Guericke-Universität Magdeburg zu den Gewinnern.
Auf diesen Erfolgen und den geschaffenen Strukturen im Bereich Hochschulmarke-
ting und Studienwerbung kann aufbaut werden. Dabei wird es um ein Hochschulmarketing
10 Vgl. Kurt-Georg Ciesinger: Modernes Wissensmanagement in Netzwerken, Wiesbaden 2005, S. 147.
11 http://www.studieren-in-fernost.de
12 http://www.studieren-in-fernost.de/de/hintergrund
13Verbundantrag sachsen-anhaltischer Hochschulen im Qualitätspakt Lehre
in seiner doppelten Bedeutung gehen: die Entwicklung nachfrageorientierter Angebote und
deren Platzierung auf dem „Markt“ der Bildungsangebote. Leitendes Motto dabei ist: „Bei uns
können Sie studieren. Um alles andere kümmern wir uns“.
Bereits heute bezieht sich das Hochschulmarketing in Sachsen-Anhalt auf hetero-
gener werdende Adressatengruppen. Die großteils von den einzelnen Hochschulen isoliert
voneinander entwickelten Ansätze sind diesbezüglich zu systematisieren und landesweit zu
verallgemeinern – sowohl um die Studienberechtigten des Landes vollständiger als bisher
zu erreichen und zum Studienerfolg zu führen, als auch um auswärtige Interessenten wei-
terhin und in steigender Zahl anzusprechen. Dazu werden eine Landesarbeitsgemeinschaft
Hochschulmarketing, eine entsprechende Kommunikationsplattform und eine gemeinsame
Landeskampagne für das Studium in Sachsen-Anhalt etabliert. Unterstützend werden ein Mo-
nitoring zum Studienwahlverhalten und zum Berufsverbleib im Land sowie Transferforschun-
gen zu Anschlussfähigkeit, beruflicher Relevanz und internationaler Dimension aufgelegt. Ein
Integrationsprogramm für ausländische Studierende wird landesweit verallgemeinert und ein
vorhandenes Handlungskonzept für Aufbau regionaler Hochschule-Praxis-Netzwerke umge-
setzt. Die Ergebnisse werden in die Entwicklung von Handreichungen und Veranstaltungs-
formaten, z.B. zur Heranführung von SchülerInnen an die MINT-Fächer oder zur Gestaltung
von Studieneingangsphasen, münden.
Zusammengefasst: Aufbauend auf bereits intensiven, allerdings weitgehend isoliert von den
einzelnen Hochschulen betriebenen Aktivitäten, geht es um ein Hochschulmarketing in seiner
doppelten Bedeutung: die Entwicklung nachfrageorientierter Angebote und deren Platzie-
rung auf dem ‚Markt‘ der Bildungsangebote. Ebenso kann darauf aufgebaut werden, dass
sich das Hochschulmarketing in Sachsen-Anhalt bereits heute auf heterogener werdende
Adressatengruppen bezieht. Die diesbezüglich entwickelten Ansätze werden systematisiert
und landesweit verallgemeinert. Dazu werden eine Landesarbeitsgemeinschaft Hochschul-
marketing, eine entsprechende Kommunikationsplattform, eine gemeinsame Landeskampa-
gne, Monitorings sowie Transferforschungen etabliert sowie Handlungskonzepte einzelner
Hochschulen allgemein verfügbar gemacht und ihre Umsetzung unterstützt.
2.3 Struktur zur Programmrealisierung:
HET LSA – Hochschulentwicklung und Transfer in Sachsen-Anhalt
Zur Umsetzung der Ziele und Leitideen wird ein Verbund für Hochschulentwicklung und Trans
fer Sachsen-Anhalt (HET LSA) gebildet. Der Verbund übernimmt die Aufgaben, die überlokal
und in Kooperation besser erfüllt werden können als auf allein lokaler Ebene. Dafür werden
14Verbundantrag sachsen-anhaltischer Hochschulen im Qualitätspakt Lehre
zum ersten Kompetenzstützpunkte an einzelnen Hochschulen eingebunden, gestärkt und
vernetzt, zum zweiten eine Transferstelle gegründet und zum dritten landesweite Kompe-
tenzzirkel gebildet.13
Die Voraussetzungen, die zur Entscheidung über diese Struktur geführt haben, sind
(a) die identifizierten Problemlagen, (b) die notwendig zu beschreitenden Wege der Pro-
blembearbeitung, (c) die an den einzelnen Hochschulen bestehenden problemrelevanten
Kompetenzen, (d) ein systematisches Aufeinanderbeziehen von Problemlagen, Problembe-
arbeitungswegen und vorhandenen Kompetenzen sowie (e) die Identifizierung insoweit noch
verbleibender Lücken für eine zielführende Problembearbeitung.
Die Ausgangspunkte, um die Programmlinien und -struktur zu bestimmen, waren zwei-
erlei: Zum einen sind die vorhandenen Kompetenzen zunächst Kompetenzen der einzelnen
Hochschulen, sollen aber sowohl andernorts verfügbar gemacht als auch miteinander ver-
knüpft werden. Zum anderen bedarf die lokale Expertise der Ergänzung durch überregionale
und internationale Erfahrungen und Wissen.
Abb. 3: Struktur HET LSA
13 In Anlehnung an die Empfehlung des Wissenschaftsrates wird mit dieser Strukturierung unterschieden zwischen
Hochschularbeitsstellen mit Servicefunktionen und einer Arbeitsstelle, die überlokal handlungsrelevante Expertise
erarbeitet und für dessen Verbreitung sorgt.
Wissenschaftsrat: Empfehlungen zur Qualitätsverbesserung von Lehre und Studium. Drs. 8639-08, Berlin,
04.07.2008, S. 69ff.
15Verbundantrag sachsen-anhaltischer Hochschulen im Qualitätspakt Lehre
2.3.1 Kompetenzstützpunkte an Hochschulen
Die in den Kompetenzstützpunkten zu beschäftigenden MitarbeiterInnen nehmen eine dop-
pelte Brückenfunktion wahr: Einerseits identifizieren sie Bedarfe ihrer Sitzhochschule und
organisieren deren Befriedigung mittels nichtlokaler Expertise. Andererseits widmen sie sich
der Übertragung der orts- und fachspezifischen Erfahrungen, die im Rahmen ihrer speziellen
Projektinhalte erarbeitet werden, auf die Landesebene, d.h. der Verfügbarmachung für alle
Hochschulen Sachsen-Anhalts incl. der Bedienung entsprechender Nachfrage und Aufträge
bzw. der Unterbreitung entsprechender Angebote an alle Hochschulen. Die dazu erforderli-
chen Koordinationsleistungen werden von der Transferstelle (s.u. 2.3.2.) erbracht.
Otto-von-Guericke-Universität Magdeburg (Programmkoordination)
Die Otto-von-Guericke-Universität Magdeburg verfügt seit vielen Jahren über eine differen-
zierte wissenschaftliche Expertise im Bereich der beruflichen Weiterbildung und Professio-
nalisierung. Der Lehrstuhl für „Erziehungswissenschaftliche Medienforschung und Medienbil-
dung unter Berücksichtigung der Erwachsenen- und Weiterbildung“ (Prof. Fromme) und der
Lehrstuhl „Allgemeine Pädagogik“ (Prof. Matrozki) verfolgen mit der erfolgreichen Etablierung
des Studiengangs „Integrated Practice in Dentistry (M.A.)“ neue Ansätze zur Professionali-
sierung von akademisch hervorragend ausgebildeten Berufsgruppen (hier Zahnärzte). Mit
großem Erfolg wird neben grundständigen Studiengängen im Bereich der Bildungs- und Me-
dienwissenschaften auch der berufsbegleitende Master „Erwachsenbildung“ angeboten. In
Kombination mit weiteren Lehrstühlen zur Allgemeinen Didaktik, der beruflichen Weiterbildung
steht ein wissenschaftliches Umfeld zur Verfügung, dass durch die zu schaffende Professur
für „Professionalisierung und Hochschulentwicklung“ hervorragend ergänzt werden könnte.
„Professionalisierung“ als „Qualifizierungsangebot für Lehrende“ u.a. im Kontext der Analy-
se und kritischen Reflexion der Gebrauchsweisen von neuen Medien und die Entwicklung
wissenschaftlich begründeter Konzepte für die medienpädagogische und mediendidaktische
Hochschulpraxis würde als sichtbare Beitrag durch die OvGU geleistet werden.
Die Professur übernimmt daher im Verbund nachstehende Aufgaben der Qualifizie-
rung des Lehrpersonals und Hochschulentwicklung.
Die fachlichen Angebote der Hochschuldidaktik sollen – unterstützt durch die Trans-
ferstelle – in niedrigschwellige Informationsangebote überführt werden, die eine aufwandsre-
alistische hochschuldidaktische Qualifizierung des Lehrpersonals ermöglichen. Das bedingt
die Erstellung
▬▬ hochschulübergreifender hochschuldidaktischer Programmformate (Seminare,
Beratung, Coaching, Lehrsupervision etc.) und Zertifizierung ihres erfolgreichen
Absolvierens,
16Sie können auch lesen