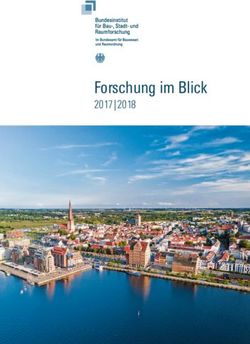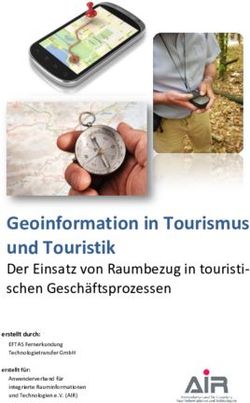Institutsbericht 2015 - Institut für sozial-ökologische Forschung
←
→
Transkription von Seiteninhalten
Wenn Ihr Browser die Seite nicht korrekt rendert, bitte, lesen Sie den Inhalt der Seite unten
Inhalt
4 Vorwort
6 Das ISOE
7 Ansprechpartner
8 Transdisziplinär forschen
10 Forschungsschwerpunkte
12 Wasserressourcen und Landnutzung
13 CuveWaters – Innovative Wasserversorgung in Namibia
14 IWaSP – Evaluation von Wasserpartnerschaften in Afrika
14 SASSCAL – Wasserbezogene Risiken im südlichen Afrika
15 OPTIMASS – Nachhaltiges Management von
Savannen-Ökosystemen
15 NiddaMan – Nachhaltige Bewirtschaftung im
Einzugsgebiet der Nidda
18 Wasserinfrastruktur und Risikoanalysen
19 Innovative Konzepte für Abwasser aus Einrichtungen des
Gesundheitswesens: Sauber+
20 TransRisk – Risiken durch neue Schadstoffe im Wasser-
kreislauf
20 Arznei für Mensch und Umwelt?
21 DSADS – Den Spurenstoffen auf der Spur
21 netWORKS 3 – Innovative Lösungen für die Wasserwirt-
schaft in Frankfurt am Main und Hamburg
22 KREIS – Innovative Stadtentwässerung und Energiege-
winnung in Hamburg22 Semizentral – Infrastrukturen für schnell wachsende 39 Lärmpausen Frankfurter Flughafen – Empirisches
Städte Wahrnehmungs- und Wirkungs-Monitoring
23 NaCoSi – Nachhaltigkeitscontrolling in der Siedlungs-
wasserwirtschaft 42 Biodiversität und Bevölkerung
44 Westafrikanische Savannen als sozial-ökologische
26 Energie und Klimaschutz im Alltag Versorgungssysteme
27 EiMap – Kommunikationsstrategie zur Sanierung beim 45 Ökosystemleistungen im Kontext von sozial-ökologischen
Eigenheimerwerb Systemen
28 Stromeffizienzklassen für Haushalte – Mehr Transparenz
beim Stromverbrauch 46 Transdisziplinäre Methoden und Konzepte
28 PowerFlex – Energiebedarf durch Klimatisierung von 47 TransImpact – Wirkungsvolle transdisziplinäre Forschung
Wohngebäuden 48 Transdisziplinarität in der Biodiversitätsforschung
29 IndUK – Individuelles Umwelthandeln und Klimaschutz 48 Wissenschaftliche Koordination der Energiewende-
29 Homes-uP – Zukunft des Einfamilienhauses Transformation
30 Modernisierung des Blauen Engel 49 Capital4Health – Transdisziplinär forschen für die
Gesundheitsvorsorge
30 Deutschland im Klimawandel
54 Begleitforschung für Reallabore in Baden-
Mobilität und Urbane Räume Württemberg
34
35 Sharing-Konzepte für multioptionale Mobilität in der 52 Vernetzt forschen – national und international
Rhein-Main-Region
36 share – Elektromobilität im Carsharing 56 Lehre und wissenschaftlicher Nachwuchs
36 Mobiles Baden-Württemberg – Wege der Transformation 58 Beratung
zu einer nachhaltigen Mobilität
37 WohnMobil – Innovative Wohnformen und Mobilitäts- 59 Wissenschaftliche Dienste
dienstleistungen
37 Smartphone statt Auto? 60 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter
38 COMPAGNO – Personalisierter Begleiter für 67 Wissenschaftlicher Beirat
Mobilität bis ins hohe Alter
38 Dezent Zivil – Neue Formen zivilgesellschaftlicher 68 Highlights 2015
BeteiligungLiebe Leserinnen, liebe Leser,
das Jahr 2015 war stark geprägt von einer öffentlichen, politischen und wis-
senschaftlichen Debatte um nachhaltige Entwicklung. Dazu haben die Ver-
handlung und Verabschiedung der Nachhaltigkeitsziele der Vereinten Nationen,
die sogenannten Sustainable Development Goals, ebenso beigetragen wie der
Weltklimagipfel in Paris. Zum anderen wurden aber auch die Stimmen aus
der Zivilgesellschaft in dieser Debatte lauter. So gingen etwa im November
weltweit in den großen Städten Menschen für den »Global Climate March« auf die Straßen.
Ihre Forderung nach mehr politischem Engagement für einen verbindlichen Klimaschutz
zeigt, dass inzwischen eine breite Auseinandersetzung mit den globalen gesellschaftlichen
Herausforderungen stattfindet.
4
In dieser Auseinandersetzung rückt der »Faktor Mensch« in seiner ganzen Komplexität immer
mehr in den Mittelpunkt. Dies zeigt sich deutlich in der anhaltenden Diskussion um das An-
thropozän – Thema unserer großen Tagung im November 2014 anlässlich des 25-jährigen
Bestehens des ISOE. Die Menschheit erscheint hier als die erdgeschichtlich jüngste, prägende
Kraft für Veränderungen der natürlichen Umwelt. Wir beginnen gerade erst, diese neue
Qualität gesellschaftlicher Naturverhältnisse wissenschaftlich und kulturell zu verarbeiten.
Ganz konkret rückt damit auch die Frage nach der Bedeutung individuellen Verhaltens im
Alltag stärker in den Blick. Denn längst ist deutlich geworden, dass Fragen zu Umwelt-,
Klima- und Ressourcenschutz nicht allein mit innovativen Technologien und politischen Ab-
sichten beantwortet werden können. Vielmehr wird es zunehmend auf die Bereitschaft Vieler
ankommen, ihr Alltagsverhalten für eine nachhaltige gesellschaftliche Entwicklung zu ändern.
Möglich wird dies aber nur, wenn wir die sozialen, politischen und ökonomischen Bedingungen
weiter diesem Kurs anpassen.
Dafür ist Wissen notwendig, das nicht im »Labor« erzeugt wird, sondern nur an den verschie-
denen Schnittstellen zwischen Wissenschaft und Gesellschaft gewonnen werden kann. Die
Wissenschaft wird hier mit dem Erfahrungswissen unterschiedlicher Akteure und ihrer jewei-
ligen Alltagswelt ebenso konfrontiert wie mit dem Fachwissen von Experten. Diese unter-
schiedlichen Wissensformen fruchtbar aufeinander zu beziehen, erfordert neue Methoden.
Am ISOE entwickeln wir solche transdisziplinären Integrationsmethoden und wenden sie an,
um wissenschaftlich fundierte und zugleich praktikable Lösungsvorschläge zu erarbeiten.In jüngster Zeit hält dieser Forschungsmodus in immer mehr Wissenschaftsbereiche Einzug:
Transdisziplinarität erfreut sich regelrechter Popularität und differenziert sich immer weiter
aus. Mit dieser begrüßenswerten Entwicklung wird aber auch eine Aufgabe immer dringlicher:
Angesichts der Vielfalt unterschiedlicher Definitionen und Ansätze brauchen wir Kriterien
zur Sicherung der Qualität und Wirksamkeit transdisziplinärer Forschung. Mit dem Projekt
TransImpact nehmen wir uns dieser Aufgabe an.
Ganz entscheidend war der transdisziplinäre Ansatz für den Erfolg unseres 2015 abgeschlos-
senen Projekts CuveWaters. In mehr als zehn Jahren Forschungs- und Entwicklungsarbeit hat
das deutsch-namibische Team in einer der trockensten Regionen der Erde, im nordnamibischen
Cuvelai-Etosha-Basin, ein komplexes Wasserversorgungssystem entwickelt und umgesetzt.
Dem gesamten Team, den Forschungs- und Praxispartnern, die über all die Jahre zum Erfolg von
CuveWaters beigetragen haben, möchten wir Respekt, Anerkennung und Dank aussprechen.
5
Gleich zu Beginn des Jahres war es uns eine große Freude, dem vormaligen Frankfurter
LOEWE Biodiversität und Klima Forschungszentrum (BiK-F) zur Integration in die Senckenberg
Gesellschaft für Naturforschung zu gratulieren, durch die das neue »Senckenberg Biodiversität
und Klima Forschungszentrum« zugleich in die Leibniz-Gemeinschaft aufgenommen und
verstetigt wurde. Als Gründungsmitglied und auch künftiger Kooperationspartner in BiK-F
hat das ISOE diesen Erfolg gerne mitgefeiert.
Bei unseren Kooperationspartnerinnen, Freunden und Fördererinnen möchte ich mich im
Namen des ganzen Instituts herzlich für ein erfolgreiches Jahr bedanken. Ihre Unterstützung
war für uns, gerade auch im Hinblick auf die Evaluation durch den Wissenschaftsrat in 2015,
besonders wichtig und hilfreich. Das Ergebnis dieser vom Hessischen Ministerium für
Wissenschaft und Kunst erbetenen Evaluation steht noch aus, doch ich darf mich bereits jetzt
bei allen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern am ISOE für ihr außerordentliches Engagement
bedanken. Meinen ausdrücklichen Dank möchte ich an dieser Stelle dem Land Hessen für die
institutionelle Förderung unserer Forschungseinrichtung aussprechen.
Thomas Jahn
Sprecher der InstitutsleitungDas ISOE
Das ISOE gehört zu den führenden unabhängi-
Wir leben Kooperation. Für unsere PartnerInnen
gen Instituten der Nachhaltigkeitsforschung. Seit
und unsere MitarbeiterInnen.
25 Jahren entwickelt das Institut wissenschaftli-
che Entscheidungsgrundlagen und zukunftsfähige Derzeit arbeiten 50 MitarbeiterInnen am ISOE,
Konzepte für Politik, Zivilgesellschaft und Wirt- davon sind 36 WissenschaftlerInnen. Wir sind
schaft – regional, national und international. aktiver Partner in unterschiedlichen Netzwerken
und Kooperationen. Bei unserer Arbeit werden
wir von einem internationalen und fachüber-
Wir finden für komplexe Probleme nachhaltige
greifenden Wissenschaftlichen Beirat unterstützt.
Lösungen. Für Mensch und Umwelt.
Als gemeinnütziges Institut finanzieren wir uns
Wir behandeln zielgerichtet und fallspezifisch die hauptsächlich durch öffentliche Fördermittel und
drängenden globalen Probleme Wasserknappheit, Aufträge. Darüber hinaus erhalten wir eine insti-
Klimawandel, Umweltzerstörung, Biodiversitäts- tutionelle Förderung durch das Land Hessen.
verlust und Landdegradation. Für konkrete Kon-
flikte finden wir nachhaltige Lösungen – im
Wir schaffen Denkräume. Für einen
ökologischen, sozialen und ökonomischen Sinne.
grundlegenden Wandel in Gesellschaft und
Die Soziale Ökologie ist dafür die theoretische
Wissenschaft.
Grundlage.
Wir nehmen eine kritische Position ein, denn nur
so können wir erreichen, dass die Lösungen von
Wir integrieren Akteure und deren Wissen.
heute nicht die Probleme von morgen werden.
Für praxisnahe, zukunftsfähige Konzepte.
Statt starre Ziele zu verfolgen, sehen wir Verän-
Wir beziehen die verschiedenen Interessenlagen derung als Korridore möglicher und wünschens-
der Akteure und ihr Wissen in den Forschungs- werter Entwicklungen. Erst auf diese Weise kön-
prozess ein. So tragen wir dazu bei, dass Lösungs- nen Alternativen entstehen. Im Denken wie im
konzepte in der Praxis besser angenommen und Handeln.
umgesetzt werden.Ansprechpartner
Institutsleitung
Thomas Jahn (Sprecher)
Diana Hummel
Engelbert Schramm
Wissenschaftskoordination
Vanessa Aufenanger
Forschungsschwerpunkte
Wasserressourcen und Landnutzung Stefan Liehr
Wasserinfrastruktur und Risikoanalysen Martina Winker Interne Dienstleistungen
Energie und Klimaschutz im Alltag Immanuel Stieß Finanzen und Personalverwaltung;
Mobilität und Urbane Räume Jutta Deffner Sekretariat und Publikationen;
Biodiversität und Bevölkerung Marion Mehring IT, Organisation und Bibliothek
Frank Schindelmann
Transdisziplinäre Methoden und Konzepte Alexandra Lux
Wissenskommunikation Lehre und wissenschaftlicher
und Öffentlichkeitsarbeit Nachwuchs
Nicola Schuldt-Baumgart Diana Hummel
Beratung
Konrad GötzTransdiszplinär
forschen
Weltweit sehen wir uns einer noch nie dagewe- Biodiversität. Wir untersuchen, inwieweit diese
senen sozial-ökologischen Krise gegenüber, die Themen miteinander verbunden sind und wie sie
Forschungsschwerpunkt
einen Verlust an Biodiversität, Bodenzerstörung von globalen Entwicklungen beeinflusst werden.
oder Klimawandel mit sich bringt. Diese Um- Welche Rolle spielen zum Beispiel die Urbanisie-
bruchsituation macht eine grundlegende Trans- rung, der Klimawandel, der Biodiversitätsverlust
formation notwendig – hin zu einer nachhaltigen oder demografische Entwicklungen für eine nach-
Entwicklung in allen Teilen der Gesellschaft. Für haltige Veränderung von Versorgungssystemen?
diese neuen Probleme und Herausforderungen
Die Soziale Ökologie als die transdisziplinäre
benötigen wir neues Wissen, um folgende zen-
Wissenschaft der gesellschaftlichen Naturverhält-
8 trale Frage beantworten zu können: Wie können
nisse liefert die theoretischen Grundlagen für un-
die gesellschaftlichen Naturverhältnisse in ihrer
sere Forschungsprojekte. Sie verbindet Grundla-
historischen Dynamik erkannt, verstanden und
genforschung mit anwendungsnaher Forschung.
gestaltet werden?
Dabei bleibt immer die Lösung praktischer Pro-
Mithilfe der transdisziplinären Forschung geben bleme des täglichen Lebens im Blick. Ein Schwer-
wir Antworten: Unsere Arbeit leistet einen Beitrag punkt der Arbeit am ISOE ist zum Beispiel die
zum Verständnis sozial-ökologischer Systeme, lie- Einschätzung, in welchem Ausmaß Lebensstile
fert eine Einschätzung von Krisensituationen und oder tägliche Routinen nachhaltigen Konsum be-
zeigt Wege auf in Richtung einer nachhaltigen einflussen oder wie Verhaltensänderungen dazu
Transformation der Gesellschaft. Transdisziplinär beitragen, dass weniger Schadstoffe in die Um-
heißt, dass wir sowohl die Forschungsergebnisse welt gelangen. Das ISOE entwickelt seine wissen-
verschiedener wissenschaftlicher Disziplinen als schaftlichen Grundlagen kontinuierlich weiter,
auch die Erfahrungen und das Wissen unter- um sie in transdisziplinäre Projekte einbringen zu
schiedlicher gesellschaftlicher Akteure berück- können. Zudem entwerfen wir Strategien für den
sichtigen. Die für diesen Integrationsprozess ge- Wissenstransfer. Damit unterstützen wir gemein-
eigneten Methoden werden fortlaufend weiterent- same Lernprozesse von Wissenschaft, Gesellschaft
wickelt. Unsere Arbeit konzentriert sich auf die und Politik auf dem Weg zu einer nachhaltigen
Themenbereiche Wasser, Energie, Mobilität und Entwicklung.ISOE-Modell des transdisziplinären Forschungsprozesses Zum Weiterlesen Jahn, Thomas /Matthias Bergmann/Florian Keil (2012): Transdisciplinarity: Between mainstreaming and marginalization. Ecological Economics 79, 1–10 dx.doi.org/10.1016/j.ecolecon.2012.04.017 Jahn, Thomas (2013): Wissenschaft für eine nachhaltige Entwicklung braucht eine kritische Orientierung. GAIA 22(1), 29–33 http://www.oekom.de/fileadmin/zeitschriften/gaia_leseproben/GAIA_1_2013_Jahn.pdf
Forschungs-
schwerpunkte
Wasserressourcen und Landnutzung Trinkwasser gemessen werden. Das ISOE erarbei-
Wasser prägt das gesamte tet innovative Konzepte, wie Infrastrukturen nach-
System Erde: Land und Bo- haltig umgebaut und an veränderte Rahmenbe-
den, das Klima, die Men- dingungen angepasst werden können. Außerdem
schen, die Biodiversität und entwickeln wir Methoden, um komplexe Risiken
die Energie. Deshalb ist es abzuschätzen, und Strategien, um sie zu minimie-
wichtig, Wasserressourcen-Management integriert ren. Dabei spielt die zielgruppenspezifische Kom-
zu betrachten, das heißt, die Einflüsse der lokalen, munikation eine wichtige Rolle.
regionalen und globalen Dynamiken zu sehen.
10 Und Wasser ist knapp. Daher muss diese Res-
source nachhaltig genutzt und gemanagt werden, Energie und Klimaschutz im Alltag
vor allem in wasserarmen Ländern. Das ISOE Es sind die alltäglichen Rou-
macht hierfür sozial-ökologische Folgenabschät- tinen und Konsummuster,
zungen und Modellierungen und entwickelt Sze- die den CO2-Ausstoß in un-
narien. Außerdem leiten und koordinieren wir serer Gesellschaft in die
internationale Projekte zum Integrierten Wasser- Höhe treiben. Um die Treib-
ressourcen-Management (IWRM). hausgas-Emissionen zu senken, ist es daher wich-
tig, klimafreundliche Lebensstile durchzusetzen
und gleichzeitig die Lebensqualität der Menschen
Wasserinfrastruktur und Risikoanalysen zu erhalten. Umwelt- und Sozialpolitik gehören
Weltweit steht die Wasser- für uns dabei zusammen. Das ISOE untersucht,
wirtschaft vor großen He- wie die Verbreitung und die Akzeptanz CO2-armer
rausforderungen: Überalterte Technologien und damit verbundene Alltagsprak-
und unzureichende Infra- tiken zielgruppengerecht gefördert werden können:
strukturen gefährden die Ef- zum Beispiel beim Energieverbrauch oder bei der
fizienz und Nachhaltigkeit. Hinzu kommen um- Ernährung. Dafür erstellen wir sozialempirische
strittene Substanzen, die vermehrt im Grund- und Studien, Evaluationen und Wirkungsanalysen.Mobilität und Urbane Räume Neben der eigentlichen Inanspruchnahme der Öko-
Der Wunsch nach Mobilität systemleistungen beeinflussen auch Bevölkerungs-
nimmt weiter zu – mit Fol- entwicklungen wie beispielsweise Migration oder
gen für Mensch und Umwelt. Urbanisierung die biologische Vielfalt. Vor diesem
Deshalb erforscht das ISOE, Hintergrund forscht das ISOE zu der Frage, wie
wie Mobilitätssysteme nach- sich Biodiversität und Bevölkerung gegenseitig
haltig und klimaneutral transformiert werden beeinflussen.
können. Mit unserer Forschung zu Mobilitäts-
stilen entwickeln wir dazu zielgruppenspezifische
Konzepte. Da immer mehr Menschen in Städten Transdisziplinäre Methoden und Konzepte 11
leben, entwerfen wir außerdem Szenarien für die Transdisziplinäre Forschungs-
zukunftsorientierte Entwicklung urbaner Räume. prozesse sind in der Regel
Neben Analysen zu Bedürfnissen und Akzeptanz geprägt durch eine sehr hete-
der Bewohner entwickeln wir auch Kommunika- rogene Zusammensetzung der
tionsmaßnahmen, um die Veränderungen in der Forschungspartner. Daher ist
Stadt- und Mobilitätskultur zu begleiten. es besonders wichtig, ein integrierendes For-
schungsdesign und passende transdisziplinäre
Methoden anzuwenden. Das ISOE entwickelt hier-
Biodiversität und Bevölkerung für wissenschaftliche Grundlagen. Sie werden in
Biologische Vielfalt ist eine das Gesamtinstitut vermittelt und in transdiszipli-
der wesentlichen Grundlagen nären Projekten umgesetzt. Wir konzipieren au-
unserer Gesellschaft. Das ßerdem Strategien für den Wissenstransfer, damit
Konzept der Ökosystemleis- das entstandene Wissen auch von den beteiligten
tungen erfasst alle ökonomi- Akteuren geteilt und praktisch umgesetzt werden
schen, ökologischen, kulturellen und sozialen Leis- kann. Als eine unserer Kernaufgaben sehen wir es
tungen der Biodiversität. Damit wird ein direkter an, die Soziale Ökologie als Grundlage unserer
Bezug zu menschlichem Wohlergehen hergestellt. Arbeit stetig weiterzuentwickeln.
ISOE.deForschungsschwerpunkt Wasserressourcen und
Landnutzung
Wasser ist die Grundlage allen Lebens auf der
Erde – für Menschen und Tiere, Land und Boden,
für Klima, Biodiversität und Energie. Und die
12 Ressource ist knapp, wenn es um gute Wasser-
qualität in ausreichender Menge geht. Trotz wich-
Ansprechpartner
tiger Impulse für ein nachhaltigeres Management Stefan Liehr
von Wasser- und damit verbundener Landres- liehr@isoe.de
sourcen bleiben wesentliche Probleme ungelöst.
Dazu zählen Übernutzung und Verschmutzung,
aber auch die Degradation von Feuchtgebieten.
Ziel unserer Forschung ist es, ein besseres Ver-
ständnis dieser Probleme zu erreichen und ange-
passte Lösungsstrategien zu entwickeln. Im Jahr
2015 war für uns der Abschluss des Forschungs-
und Entwicklungsprojekts CuveWaters, dem bis-
lang längsten und größten Projekt des ISOE, von
großer Bedeutung. Mit den pilothaften Arbeiten
für die Verbesserung der angespannten Wasser-
situation in Namibia und der Verknüpfung von
Wasser mit Ernährung, Energie und Klimawandel
hat das Projekt wichtige Erkenntnisse gebracht.
Diese fließen sowohl inhaltlich als auch metho-
disch in unsere laufenden und geplanten Projekte
und die Arbeit des Forschungsschwerpunkts ins-
gesamt ein.CuveWaters – Innovative Wissenstransfer für langfristigen Betrieb
Wasserversorgung in Namibia Die letzten Pilotanlagen wurden im November
2015 an die namibischen Betreiber übergeben.
In Namibia sind natürliche Wasserquellen knapp. Zuvor waren BewohnerInnen, TechnikerInnen,
Besonders im Norden des Landes ist die Bevöl- BetreiberInnen und lokales Personal ebenso wie
kerung auf eine nachhaltige Wassernutzung an- Studierende für Betrieb und Wartung der Anlagen
gewiesen. Hier können lang anhaltende Dürren geschult worden. Die Selbstverantwortung der
auf starke, flutartige Regenfälle folgen. In fast Menschen vor Ort durch ein »Capacity Develop-
zehnjähriger Forschungs- und Entwicklungsar- ment« zu stärken und Konzepte für ein »Good
beit hat das deutsch-namibische Projektteam von Governance« zu entwickeln, waren wesentliche
CuveWaters unter der Leitung des ISOE an ver- Teile des Projekts. Sie zielen darauf, den Betrieb
schiedenen Standorten im Cuvelai-Etosha Basin der Anlagen langfristig zu sichern und Impulse
Lösungen für eine nachhaltige Wasserver- und für die Verbreitung des Wissens und der Techno-
-entsorgung entwickelt und umgesetzt. Diese leis- logien zu setzen.
ten einen Beitrag zu einem Integrierten Wasser- ➜ www.cuvewaters.net
ressourcen-Management (IWRM) in der Region
und sind auf andere semiaride Gebiete der Erde 13
übertragbar. Ansprechpartner Jenny Bischofberger, Thomas Kluge;
bischofberger@isoe.de, kluge@isoe.de
Projektpartner Deutschland Technische Universität Darmstadt,
Natürliche Wasserquellen und Abwasser Institut IWAR; pro|aqua GmbH; Terrawater GmbH; Solar-Institut
nutzen Jülich; Ingenieurbüro für Energie- und Umwelttechnik (IBEU);
In enger Zusammenarbeit von Wissenschaft, Pra- Bilfinger Water Technologies GmbH
xispartnern und Bevölkerung entstanden Regen- Projektpartner Namibia Ministry of Agriculture, Water and
Forestry (MAWF); Outapi Town Council; Desert Research
und Flutwassersammelanlagen – in dieser Form Foundation of Namibia (DRFN); University of Namibia (UNAM);
eine Innovation in Namibia. Mehrere Familien Namibia University of Science and Technology (NUST); Deut-
sche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ);
können nun ganzjährig Gemüse anbauen. Darü-
Bundesanstalt für Geowissenschaften und Rohstoffe (BGR)
ber hinaus wurden kleinskalige, solarbetriebene
Laufzeit 11 /2006–12 /2015
Entsalzungsanlagen in Betrieb genommen. Ihr
Förderung Bundesministerium für Bildung und Forschung
Trinkwasser ersetzt das Wasser der offenen, mi- (BMBF), Fördermaßnahme Integriertes Wasserressourcen-
krobiologisch oft stark belasteten Brunnen. In der Management (IWRM)
Stadt Outapi ist ein neuartiges Sanitär- und Ab-
wasserkonzept mit anschließender Wasserwieder-
verwendung entstanden. Etwa 1.500 Personen
können Waschhäuser, Duschen und Toiletten nut-
zen. Aus dem Abwasser wird nährstoffhaltiges
Brauchwasser für die Feldbewässerung gewonnen
und Biogas kann für die Strom- und Wärmeer-
zeugung generiert werden.
ISOE.deIWaSP – Evaluierung von Wasser- SASSCAL – Wasserbezogene Risiken
partnerschaften in Afrika im südlichen Afrika
Ansprechpartner Stefan Liehr, liehr@isoe.de Ansprechpartner Stefan Liehr, liehr@isoe.de
Projektpartner Overseas Development Institute (ODI) Projektpartner Universitäten Hamburg, Bremen, Hannover,
Jena, Trier und Marburg; Climate Service Center 2.0; Deut-
Laufzeit 10/2013–12 /2014 sches Zentrum für Luft- und Raumfahrt (DLR); Bundesanstalt
Förderung Deutsche Gesellschaft für Internationale für Geowissenschaften und Rohstoffe (BGR); Deutscher Wet-
Zusammenarbeit (GIZ) GmbH, Eschborn terdienst (DWD)
Laufzeit 04/2013–10/2017
Weltweit haben etwa 900 Millionen Menschen Förderung Bundesministerium für Bildung und Forschung
keinen Zugang zu sauberem Trinkwasser. Und (BMBF), Förderinitiative Klimawandel und angepasstes Land-
management in Afrika
die Konkurrenz um die knappe Ressource nimmt
zwischen Haushalten, Industrie und Landwirt- Im südlichen Afrika leisten die bäuerlichen Fami-
schaft zu. In weiten Teilen Afrikas wird diese lienbetriebe einen entscheidenden Beitrag zur
Situation noch durch die Auswirkungen des Kli- lokalen Ernährungssicherheit und zur ländlichen
mawandels veschärft. Um die Konflikte zwischen Entwicklung. Im Cuvelai-Einzugsgebiet zwischen
14 den konkurrierenden NutzerInnen zu vermindern, Südangola und Nordnamibia lebt der Großteil der
hat die Deutsche Gesellschaft für Internationale ländlichen Bevölkerung von Ackerbau und Vieh-
Zusammenarbeit (GIZ) das Programm der Was- wirtschaft. Wetterextreme wie periodische Dürren
serpartnerschaften zwischen Privatwirtschaft, und Überschwemmungen verursachen Wasser-
Zivilgesellschaft und öffentlichem Sektor entwi- mangel und Ernteausfälle. Zusätzlich tragen Ur-
ckelt. Für dieses International Water Stewardship banisierung und ökonomische Entwicklung zu
Programme (IWaSP) hat das ISOE ein Evaluati- einer Veränderung der Ressourcennutzung bei,
onskonzept entwickelt und in laufenden Wasser- wodurch neue Konkurrenzen um das verfügbare
partnerschaften in Uganda, Kenia, Tansania und Wasser entstehen. Das ISOE untersucht, welche
Sambia angewendet. Ziel war es, Erfolgskriterien Risiken sich daraus für die Sicherung der Lebens-
für derartige Partnerschaften zu identifizieren grundlagen ergeben. Das Forscherteam ist Teil
und im konkreten Fall zu überprüfen. Schluss- der Initiative SASSCAL (Southern African Science
folgerungen und Empfehlungen sollen die Part- Service Centre for Climate Change and Adaptive
nerschaften in die Lage versetzen, ihre Erfolgs- Land Management). Es erhebt in enger Zusam-
chancen zu verbessern. Die Arbeiten wurden menarbeit mit lokalen Partnern sozial-empirische
gemeinsam mit dem britischen Kooperations- Daten. Diese werden in einem modellbasierten
partner Overseas Development Institute (ODI) Ansatz zur Identifizierung von Gebieten mit
durchgeführt. besonders hoher Vulnerabilität gegenüber Dürre
➜ www.isoe.de/iwasp analysiert. Daraus abgeleitete Vorsorge- und
Anpassungsmaßnahmen sollen langfristig die
Wasserrisiken unter Berücksichtigung möglicher
Folgen des Klimawandels verringern.
➜ www.sasscal.orgOPTIMASS – Nachhaltiges Manage- NiddaMan – Nachhaltige Bewirtschaf-
ment von Savannen-Ökosystemen tung im Einzugsgebiet der Nidda
Ansprechpartner Stefan Liehr, liehr@isoe.de Ansprechpartnerin Carolin Völker, voelker@isoe.de
Projektpartner Universität Potsdam; Freie Universität Berlin; Projektpartner Goethe-Universität Frankfurt am Main; BGS
Universität Tübingen; Alfred-Wegener-Institut (AWI); Universi- Wasser – Brandt Gerdes Sitzmann Wasserwirtschaft GmbH;
tät Hohenheim; Karlsruher Institut für Technologie (KIT); Univer- Bundesanstalt für Gewässerkunde (BfG); Eberhard Karls Uni-
sity of Namibia (UNAM); Namibia University of Science and versität Tübingen; Karlsruher Institut für Technologie (KIT);
Technology (NUST) Technische Universität Darmstadt; UNGER ingenieure Inge-
nieurgesellschaft mbH; Hessisches Landesamt für Umwelt
Laufzeit 08 /2014–07/2017 und Geologie (HLUG); Regierungspräsidium Darmstadt;
Förderung Bundesministerium für Bildung und Forschung Wetteraukreis
(BMBF), Förderprogramm SPACES Laufzeit 05/2015–04/2018
Förderung Bundesministerium für Bildung und Forschung
Savannen bieten mit ihrer Vegetation eine wich- (BMBF), Fördermaßnahme ReWaM
tige Lebensgrundlage für Mensch und Tierwelt.
In Namibia haben sie jedoch in den letzten Jahr- Die von der Quelle im Vogelsberg bis zur Mün-
zehnten an ökologischer Tragfähigkeit eingebüßt: dung in den Main etwa 100 Kilometer lange Nidda
Überweidung hat zu schlechteren Bodenbedin- ist nur noch teilweise in naturnahem Zustand. 15
gungen und zur Ausbreitung unerwünschter Überwiegend verläuft sie durch stark besiedeltes
Pflanzenarten geführt. Von den Folgen sind rund Gebiet, das auch intensiv landwirtschaftlich und
70 Prozent der namibischen Bevölkerung betrof- industriell genutzt wird. Die hohen Nutzungs-
fen, die als Selbstversorger oder als Arbeitskräfte ansprüche der gesellschaftlichen Gruppen haben
von der Landwirtschaft abhängig sind. Im For- den Fluss und seine umgebenden Flächen stark
schungsprojekt OPTIMASS sollen ein besseres verändert. Trotz Renaturierungsmaßnahmen
Verständnis für die komplexen Rückkopplungen weist er in weiten Teilen nur einen mäßigen
zwischen Geo-, Bio- und Atmosphäre in Savan- bis schlechten ökologischen Zustand auf und
nen gewonnen und robuste Lösungen für ein verfehlt damit den geforderten Standard der
nachhaltiges Management dieses Ökosystems EU-Wasserrahmenrichtlinie. Im Verbundprojekt
entwickelt werden. Hierfür wurden in Namibia NiddaMan entwickelt das Forschungsteam Stra-
drei Projektstandorte mit unterschiedlichen kli- tegien für ein nachhaltiges Wasserressourcen-
matischen Bedingungen ausgewählt. Aufgabe des Management im Einzugsgebiet der Nidda. Das
ISOE ist es, jene Formen des Wassermanagements ISOE verfolgt den Ansatz, über die Analyse der
zu identifizieren, die geeignet sind, langfristig Konstellation der Akteure und ihrer Interessen
wichtige Ökosystemleistungen zu sichern. Dabei sowie die Aufarbeitung der Konfliktfelder im
wird das Wissen aus prozessbasierten Modellen Umfeld der Nidda die Chancen und Hemmnisse
mit dem Praxiswissen von Akteuren zusammen- von Strategien besser zu verstehen. Der aktive
geführt, um übergreifende Empfehlungen für Dialog mit den Akteuren einschließlich der Bür-
Politik und Praxis abzuleiten. gerInnen wird hierbei als entscheidend für trag-
➜ www.isoe.de/optimass fähige Lösungen angesehen.
➜ www.niddaman.de
ISOE.deVeröffentlichungen Change Impacts and Adaptation Laura Woltersdorf, Stefan
Liehr und Petra Döll (2015). Water 7(4), 1402–1421
Wasserbedarfsprognose 2045 für das Versorgungsgebiet von Small-scale water reuse for urban agriculture in Namibia: Mo-
HAMBURG WASSER Thomas Kluge, Stefan Liehr, Oliver Schulz, deling water flows and productivity Laura Woltersdorf, Stefan
Georg Sunderer und Johann Wackerbauer (2014). Gutachten Liehr, Ruth Scheidegger und Petra Döll (2015). Urban Water
Journal 12(5), 414–429
Assessing the Processes and Performance of the International
Water Stewardship Programme: Concept Paper Johanna Kramm, The Management of Water Resources under Conditions of
Stefan Liehr, Engelbert Schramm, Martina Winker, Helen Tilley, Scarcity in Central Northern Namibia Martin Zimmermann, Ma-
Nathaniel Mason und Simon Hearn (2014). ISOE-Materialien So- rian Brenda, Alexander Jokisch und Wilhelm Urban (2015) in:
ziale Ökologie 44. Frankfurt am Main Susanne Hartard und Wolfgang Liebert (Hg.): Competition and
Conflicts on Resource Use. Natural Resource Management and
Water security and climate adaptation through storage and Policy 46, 231–242
reuse Stefan Liehr, Oliver Schulz, Thomas Kluge und Alexander
Jokisch (2015). ISOE Policy Brief 1. Frankfurt am Main Das Bewässerungsdispositiv. Staatliche Strategien, lokale
Praktiken und politisierte Räume in Kenia Johanna Kramm
Omeya ogo omwenyo – Water is Life Jenny Bischofberger, (2015). Sozial- und Kulturgeographie 10. Bielefeld
Nicola Schuldt-Baumgart und Elmer Lenzen (2015). CuveWaters
Report. Frankfurt am Main Indigenität als politische Ressource in Kenia Johanna Kramm
(2015). Geographische Rundschau 12, 32–37
Interactive Water Information and Planning Tool for the Cuve-
lai-Etosha Basin Oliver Schulz, Helvi Shalongo und Julia Röhrig Integriertes Wasserressourcen-Management im nördlichen
(2015). CuveWaters Factsheet. ISOE (Hg.). Frankfurt am Main Namibia – Cuvelai-Delta Thomas Kluge (2015). Poster, BMBF-
Workshop »Ressourcen und Nachhaltigkeit international – les-
Sanitation and Water Reuse in Central-Northern Namibia Mar-
16 sons learned«, 17.–18. September 2015, Bonn
tin Zimmermann, Johanna Kramm, Jutta Deffner, Katharina Mül-
ler, Anastasia Papangelou, Markus Gerlach und Peter Cornel Sustainable management of savannas Jenny Bischofberger,
(2015). CuveWaters Factsheet. ISOE (Hg.). Frankfurt am Main Oliver Schulz, Katharina Brüser und Stefan Liehr (2015). Poster,
Tropentag 2015, 16.–18. September 2015, Berlin
Groundwater Desalination in Central-Northern Namibia Stefan
Liehr, Anastasia Papangelou, Jutta Deffner, Alexia Krug von Sustainable management of savannas Jenny Bischofberger,
Nidda und Wilhelm Urban (2015). CuveWaters Factsheet. ISOE Oliver Schulz, Katharina Brüser und Stefan Liehr (2015). Poster,
(Hg.). Frankfurt am Main Jahrestagung der Gesellschaft für Ökologie (GfÖ), 31. August
2015, Göttingen
Floodwater Harvesting in Central-Northern Namibia Alexander
Jokisch, Oliver Schulz, Isaac Kariuki, Alexia Krug von Nidda,
Jutta Deffner, Stefan Liehr und Wilhelm Urban (2015). CuveWa-
ters Factsheet. ISOE (Hg.). Frankfurt am Main Vorträge
Rainwater Harvesting in Central-Northern Namibia Alexander
Jokisch, Oliver Schulz, Isaac Kariuki, Alexia Krug von Nidda, Research needs for rangeland management in Namibia
Jutta Deffner, Stefan Liehr und Wilhelm Urban (2015). CuveWa- OPTIMASS Stakeholder-Workshop, Universität Potsdam, Uni-
ters Factsheet. ISOE (Hg.). Frankfurt am Main versity of Namibia, ISOE, 21. November 2014, Windhoek/Nami-
Sustainable management of savannas – Integrating practitio- bia (Oliver Schulz, Jenny Bischofberger)
ner’s knowledge Jenny Bischofberger, Oliver Schulz, Katharina Wasserbedarfsprognose für HAMBURG WASSER Tagung des
Brüser und Stefan Liehr (2015) in: Eric Tielkes (Hg.): Conference Umweltausschusses Hamburg, 27. November 2014, Salzhausen,
on International Research on Food Security, Natural Resource Landkreis Harburg (Stefan Liehr)
Management and Rural Development. Tropentag 2015, Berlin,
Impact of drought on the inhabitants of the Cuvelai watershed:
16.–18. September 2015
A qualitative exploration International Conference on DROUGHT:
Impact of drought on the inhabitants of the Cuvelai watershed: Research and Science‐Policy Interfacing, 10.–13. März 2015,
A qualitative exploration Robert Lütkemeier und Stefan Liehr Universitat Politècnica de València / Spanien (Robert Lütke-
(2015) in: Joaquin Andreu Alvarez, Abel Solera, Javier Paredes- meier)
Arquiola, David Haro-Monteagudo und Henny van Lanen (Hg.):
Governing the Water-Land Nexus. Insights from a case study
Drought: Research and Science-Policy Interfacing. London, 41–48
in Kenya Achte WasserLandWerkstatt: Der Wasser-Land Nexus,
Rainwater Harvesting for Small-Holder Horticulture in Nami- DIE – Deutsches Institut für Entwicklungspolitik, 19.–20. März
bia: Design of Garden Variants and Assessment of Climate 2015, Bonn (Johanna Kramm)The OPTIMASS project – an overview Rangeland Advisory CuveWaters III Mid-term Workshop CuveWaters, 23. Oktober
Committee meeting, Namibian Agriculture Union, 8. Mai 2015, 2014, River Crossing Lodge, Windhoek/Namibia (Thomas Kluge,
Windhoek /Namibia (Oliver Schulz) Alexia Krug von Nidda, Stefan Liehr, Johanna Kramm, Martin
Zimmermann)
Sozial-ökologische Forschung im Südlichen Afrika. Aktuelle
Projekte des Instituts für sozial-ökologische Forschung Tagung CuveWaters Digital Atlas Workshop and Training Ministry of
»Millenniumsziele in Afrika und die Rolle der Geowissenschaf- Agriculture, Water and Forestry, 13.–14. November 2014 und
ten«, Afrikagruppe deutscher Geowissenschaftler (AdG), 26.– 12.–13. Mai 2015, Windhoek/Namibia (Oliver Schulz)
27. Juni 2015, Frankfurt am Main (Robert Lütkemeier, Stefan Liehr)
Alles Schwarzmalerei? – Wer zahlt für die Folgen unseres
Drought Vulnerability in Southern Africa. Update on current re- Wohlstandes? Podiumsdiskussion, Frankfurter Bürger-Univer-
search activities in the Cuvelai watershed Water Colloquium, sität der Goethe-Universität, 8. Dezember 2014, Frankfurt am
Geographisches Institut, Universität Bonn, 7. Juli 2015, Bonn Main (Thomas Kluge)
(Robert Lütkemeier)
CuveWaters: Oswin Namakalu Wastewater Treatment and
Costs and Evaluation of the CuveWaters Sanitation and Water Reuse Plant, Budget Planning and Scenarios 2015/2016 Work-
Reuse System CuveWaters Sanitation Information Event, 30. Juli shop on the financial planning of the sanitation facilities, treat-
2015, Windhoek /Namibia (Martin Zimmermann) ment plant and irrigation fields in Outapi, Outapi Town Council,
Closing the urban sanitation loop in practice: An example from 26.–27. Februar 2015, Outapi /Namibia (Martin Zimmermann)
Namibia SuSanA (Sustainable Sanitation Alliance) meeting; Nachhaltige Wassernutzung in Namibia – Das Beispiel
Sustainable cities: Closing the urban sanitation loop Working CuveWaters Nacht der Museen, Senckenberg Naturmuseum,
Group Exchange (WG 6: Cities), World Water Week, SEI, 22.– 25. April 2015, Frankfurt am Main (Stefan Liehr)
28. August 2015, Stockholm/Schweden (Thomas Kluge)
Gleiches Recht für Alle? Wie kann die Weltbevölkerung mit
Dürrevulnerabilität im Cuvelai: Zwischenergebnisse erster sauberem Trinkwasser versorgt werden? Veranstaltungsreihe 17
empirischer Untersuchungen SASSCAL Workshop, 26.–27. Au- der Frankfurter Bürger-Universität »Blaue Zukunft – Die kost-
gust 2015, Hannover (Robert Lütkemeier) bare Ressource Wasser und wie wir damit umgehen (müssen)«,
Water and food security on the household level: a multi-dimen- Goethe-Universität und ISOE, 10. Juni 2015, Frankfurt am Main
sional approach to measure water scarcity risk in the Cuvelai (Thomas Kluge)
Summer School »Collecting, Processing and Presenting Infor- Which »governance and institutional structures« are key to
mation in Bio-Geo-Sciences«, Volkswagen Stiftung, 20. Septem- successful implementation of priority measures? Workshop
ber bis 11. Oktober 2015, Äthiopien (Robert Lütkemeier) »Water resources and health«, Water Science Alliance e. V.
Forschung für eine nachhaltige Entwicklung: Transdisziplina- (ISOE), 18. Juni 2015, Berlin (Oliver Schulz, Stefan Liehr)
rität am Beispiel des CuveWaters-Projektes Deutscher Kon- Vom Sinn und Unsinn des Wassersparens Veranstaltungsreihe
gress für Geographie, Deutsche Gesellschaft für Geographie, der Frankfurter Bürger-Universität »Blaue Zukunft – Die kost-
1.–4. Oktober 2015, Berlin (Johanna Kramm) bare Ressource Wasser und wie wir damit umgehen (müssen)«,
Shared Water Risk: ein neues fuzzy concept der internationa- Goethe-Universität und ISOE, 24. Juni 2015, Frankfurt am Main
len Wasserpolitik? Deutscher Kongress für Geographie, Deut- (Stefan Liehr)
sche Gesellschaft für Geographie, 1.–4. Oktober 2015, Berlin Implementing IWRM in Namibia – CuveWaters Podiumsdiskus-
(Johanna Kramm, Heide Kerber) sion, Konferenz »Sustainable Development Goals – A water per-
Food security in the Cuvelai basin: Uncertainty analysis of sa- spective«, The Global Water System Project (GWSP) and Future
tellite rainfall datasets for estimating agricultural yields Zam- Earth, 17.–18. August 2015, Bonn (Thomas Kluge)
bia Water Forum and Exhibition (ZAWAFE), 3. November 2015,
Lusaka/Sambia (Robert Lütkemeier) CuveWaters Abschlussveranstaltung 25. November 2015, Wind-
hoek/Namibia (Johanna Kramm, Jenny Bischofberger, Thomas
Kluge). Vorträge: »Introducing the CuveWaters Project« (Tho-
mas Kluge); »Learning for the Future« (Stefan Liehr); »Closing
the Water Loop: Sanitation, Water Reuse, and Irrigation in
Veranstaltungen Outapi« (Martin Zimmermann)
Workshop on the monitoring, operation and maintenance of
the sanitation facilities, treatment plant and irrigation fields in
Outapi Outapi Town Council, CuveWaters, 21. Oktober 2014, Ou-
tapi /Namibia (Martin Zimmermann)
ISOE.deForschungsschwerpunkt Wasserinfrastruktur
und Risikoanalysen
Die Wasserwirtschaft steht weltweit vor großen
Herausforderungen: Überalterte und wenig fle-
xible Infrastrukturen gefährden Effizienz und
18 Nachhaltigkeit. Hinzu kommen umstrittene Subs-
tanzen, die vermehrt im Grund- und Trinkwasser
Ansprechpartnerin
gemessen werden. Für eine nachhaltige Anpas- Martina Winker
sung der Infrastrukturen an sich verändernde winker@isoe.de
Rahmenbedingungen erarbeiten wir praxisrele-
vante Konzepte. Zudem entwickeln wir Methoden
zur Abschätzung und Verringerung komplexer
Risiken. Im Forschungsprojekt netWORKS 3 unter-
suchen wir in Frankfurt und Hamburg, unter wel-
chen Voraussetzungen eine Transformation der
Wasserinfrastruktur sinnvoll ist. Im chinesischen
Quingdao begleiten wir im Zuge des Projekts
Semizentral die Umsetzung eines neuartigen Was-
serinfrastruktursystems mit Blick auf Ressourcen-
effizienz und Vulnerabilität. Parallel haben wir in
Sauber+ und DSADS eine sozial-ökologische Wir-
kungsabschätzung zur Bewertung von Maßnah-
men entwickelt und erprobt, die den Eintrag von
Arzneimitteln in die aquatische Umwelt reduzie-
ren können. Zudem erarbeitet ein Team in NaCoSi
ein Nachhaltigkeitscontrolling für die Siedlungs-
wasserwirtschaft.Innovative Konzepte für Abwasser Emissions-Check zur Risikominimierung
aus Einrichtungen des Gesundheits- Obwohl bei den meisten Einrichtungen das Ab-
wesens: Sauber+ wasser nicht stärker belastet war als in Privat-
haushalten, empfehlen die WissenschaftlerInnen
Pharmazeutische Einträge in den Wasserkreislauf im Einzelfall, den vom ISOE mitentwickelten
gehören nicht nur zum klinischen Alltag von »Emissions-Check« durchzuführen – beispiels-
Krankenhäusern. Auch in Spezialkliniken, Senio- weise, wenn es sich um eine große Einrichtung in
renresidenzen, Pflegeheimen und Hospizen ge- einer kleinen Gemeinde handelt. Damit können
langen regelmäßig Arzneimittelrückstände ins Umweltbeauftragte prüfen, ob in der Einrichtung
Abwasser. Die Risikoprofile dieser Emissionen bezogen auf die Arzneimittelfrachten eine »kriti-
wurden im Projekt Sauber+ erstmals erfasst und sche« Situation vorliegt. Soweit erforderlich, kön-
bewertet. nen dann Maßnahmen eingeleitet werden, wobei
technische Reinigungsoptionen nur eines von
Mit Zukunftsszenarien zu Handlungsstrategien mehreren Handlungsfeldern darstellt.
Unterstützt von Stakeholdern aus Gesundheitswe- ➜ www.sauberplus.de
sen, Wirtschaft und Gesellschaft haben die ISOE-
ForscherInnen Szenarien entwickelt, wie sich die 19
Gewässerbelastung mit diesen Stoffen zukünftig Ansprechpartner Engelbert Schramm, schramm@isoe.de
verringern lässt. Ein »Trendszenario« und ein Projektpartner RWTH Aachen, Institut für Siedlungswasser-
wirtschaft (Projektleitung); Leuphana Universität Lüneburg,
»Nachhaltigkeitsszenario« bilden die Entwick- Institut für Umweltchemie und Institut für Umweltkommuni-
lungsmöglichkeiten des Gesundheitsmarktes, der kation; DIALOGIK gemeinnützige Gesellschaft für Kommuni-
Umweltpolitik und der Arzneimittelinnovation ab. kations- und Kooperationsforschung mbH; team ewen;
Universitätsklinikum Freiburg, Institut für Umweltmedizin und
Dabei wurden neuartige Maßnahmen berück- Krankenhaushygiene; Emschergenossenschaft/Lippever-
sichtigt, etwa eine Integration von Umwelt- und band; Ortenau Klinikum; Carbon Service & Consulting GmbH
& Co. KG; Microdyn-Nadir GmbH; Umex GmbH
Gesundheitspolitik und Anreize zur Entwicklung
Laufzeit 10 /2011–05/2015
von umweltfreundlichen Arzneimitteln. Basierend
auf diesen Zukunftsszenarien wurden Handlungs- Förderung Bundesministerium für Bildung und Forschung
(BMBF), Fördermaßnahme RiSKWa
strategien und Maßnahmen abgeleitet, deren Wir-
kungen mithilfe Bayes’scher Netze abgeschätzt
wurden. Grundsätzlich lässt sich am besten mit
einer Strategie vorsorgen, die sich nicht auf
Umwelttechnik beschränkt, sondern Maßnahmen
aus unterschiedlichen Handlungsfeldern umfasst.
Dazu gehören auch Informations- und Beratungs-
angebote für PatientInnen und Verschreibungs-
alternativen für ÄrztInnen.
ISOE.deTransRisk – Risiken durch neue Arznei für Mensch und Umwelt?
Schadstoffe im Wasserkreislauf
Ansprechpartner Konrad Götz, goetz@isoe.de
Ansprechpartner Konrad Götz, goetz@isoe.de
Projektpartner European Academy for Environmental Medi-
Projektpartner Bundesanstalt für Gewässerkunde (Koordina- cine e. V.; Leuphana Universität Lüneburg, Institut für Nach-
tion); Goethe-Universität Frankfurt am Main; Technische Uni- haltige Chemie und Umweltchemie; IUTA – Institut für Ener-
versität Dresden; Technische Universität Darmstadt; Ludwig- gie- und Umwelttechnik e. V.; Universität Witten/Herdecke,
Maximilians-Universität München; Technische Universität Lehrstuhl und Institut für Gesundheitssystemforschung
Berlin; Karlsruher Institut für Technologie (KIT); Zweckverband
Landeswasserversorgung; ECT Oekotoxikologie GmbH; Konrad- Laufzeit 08 /2012–07 /2015
Zuse-Zentrum für Informationstechnik; ITT Water & Wastewa- Auftraggeber Umweltbundesamt (UBA)
ter Herford AG; Stulz-Planaqua GmbH; Deutsche Vereinigung
für Wasserwirtschaft, Abwasser und Abfall e. V. (DWA)
Laufzeit 11/2011–04 /2015 Etwa 38.000 Tonnen Arzneimittel werden in
Förderung Bundesministerium für Bildung und Forschung Deutschland jährlich verbraucht. Ein Teil der Arz-
(BMBF), Fördermaßnahme RiSKWa neimittelwirkstoffe gelangt über Ausscheidungen
und unsachgemäße Entsorgung in den Wasser-
In unseren Gewässern befinden sich zahlreiche kreislauf. Die Rückstände sind in nahezu allen
Spuren von Medikamenten, Desinfektionsmitteln Gewässern nachweisbar. Auch in geringen Kon-
20
und Kosmetika. Schon in kleinen Mengen bergen zentrationen bergen sie Risiken für die Umwelt.
diese Stoffe Risiken für die Umwelt – zum Bei- Neben der Weiterentwicklung der Kläranlagen-
spiel für Kleinstlebewesen im Wasser. Im Projekt technik und der Arzneimittelherstellung spielt der
TransRisk wurde ein Risikomanagement für den verantwortungsvolle Umgang mit Arzneimitteln
Umgang mit diesen Substanzen entwickelt. Dazu eine wichtige Rolle bei der Verringerung dieser
gehört auch die Sensibilisierung der Bevölkerung Einträge. Bei der Verschreibung und in der Kom-
durch zielgruppenspezifische Kommunikation. munikation mit PatientInnen kommt ÄrztInnen
Hierfür wurden im Vorfeld Wissensstand, Risiko- eine Schlüsselrolle zu: Sie haben die Möglichkeit,
einschätzung und Handlungsbereitschaft der einen verantwortungsvollen Arzneimittelver-
Bevölkerung erfasst. ISOE-WissenschaftlerInnen brauch zu fördern und über die richtige Entsor-
haben in einer Repräsentativbefragung 2.000 gung von Medikamenten zu informieren. Dafür
Deutsche befragt. Danach war knapp der Hälfte entwickelte das ISOE mit den Projektpartnern ein
der Befragten nicht bekannt, dass schon durch Ausbildungskonzept, das an der Universität Wit-
die Einnahme von Medikamenten und deren ten /Herdecke als Blockseminar für Studierende
Ausscheidung Spurenstoffe in den Wasserkreis- der Medizin umgesetzt wurde. Zusammen mit der
lauf gelangen. Große Wissenslücken gab es auch Landesärztekammer Baden-Württemberg wurde
bei der Entsorgung von Medikamentenresten. eine Fortbildung durchgeführt, an der 56 Perso-
Beispielsweise gaben 47 Prozent der Befragten nen teilnahmen.
an, flüssige Medikamente mehr oder weniger oft ➜ www.isoe.de/arznei-mensch-umwelt
über die Spüle oder die Toilette anstatt über den
Hausmüll zu entsorgen.
➜ www.transrisk-projekt.deDSADS – Den Spurenstoffen auf netWORKS 3 – Innovative Lösungen
der Spur für die Wasserwirtschaft in Frankfurt
Ansprechpartner Konrad Götz, goetz@isoe.de
am Main und Hamburg
Projektpartner Lippeverband, Essen (Konsortialführer);
Rhein-Ruhr-Institut für Sozialforschung und Politikberatung Ansprechpartnerin Martina Winker, winker@isoe.de
(RISP); Leuphana Universität Lüneburg, Institut für Nachhal- Projektpartner Deutsches Institut für Urbanistik gGmbH (Difu);
tige Chemie und Umweltchemie; keep it balanced (kib) Technische Universität Berlin, Fachgebiet Wirtschafts- und
Laufzeit 10 /2012–09 /2015 Infrastrukturpolitik; COOPERATIVE Infrastruktur und Umwelt
GbR; ABG FRANKFURT HOLDING Wohnungsbau- und Beteili-
Förderung Ministerium für Klimaschutz, Umwelt, Landwirt- gungsgesellschaft mbH und ABGnova GmbH; Hamburger
schaft, Natur- und Verbraucherschutz des Landes Nordrhein- Stadtentwässerung AöR
Westfalen (MKULNV); Kofinanzierung durch INTERREG-IV-B
im Rahmen des EU-Projekts NoPILLS Laufzeit 05 /2013–10 /2016
Förderung Bundesministerium für Bildung und Forschung
(BMBF), Fördermaßnahme INIS
Über das Abwasser gelangen Arzneimittelrück-
stände in unsere Gewässer. Aus Umweltgründen Unternehmen der Wasserwirtschaft stehen vor
und zur Vorsorge sollten bereits heute Maßnah- großen Aufgaben. Der Klimawandel, steigende
men gegen zukünftige Risiken ergriffen werden. Energiekosten und demografische Entwicklungen
21
Dazu gehören zum einen sehr kostspielige tech- fordern die bestehende Wasserinfrastruktur
nische Lösungen, wie der Ausbau der Kläran- heraus. Allerdings ist die Wasserver- und Ab-
lagen mit der vierten Reinigungsstufe. Daneben wasserentsorgung auf jahrzehntelange Nutzung
geht es darum, durch eine möglichst breite Ver- ausgelegt und kurzfristig wenig flexibel. Ziel des
haltensänderung den Eintrag von Spurenstoffen Projekts netWORKS 3 ist es daher, Kommunen
zu verringern. Dafür sollen NutzerInnen von bei der Anpassung an sich verändernde Rahmen-
Arzneimitteln ebenso sensibilisiert werden wie bedingungen zu unterstützen. Die Anwendung
die Ärzteschaft. Sie sind ExpertInnen für die neuer Techniken bedeutet, dass sich auch Akteurs-
Gesundheitsversorgung, doch Aspekte des Ge- konstellationen im Planungs- und Umsetzungs-
wässerschutzes im Zusammenhang mit der Ein- prozess verändern (müssen). Dafür bedarf es –
nahme und Entsorgung von Arzneimitteln spie- so ein zentrales Projektergebnis – eines bewusst
len in ihrem beruflichen Alltag bislang kaum gestalteten Kooperationsmanagements. Dieses
eine Rolle. Das ISOE beriet das Projekt DSADS in kann die Umsetzung teilräumlich angepasster
Dülmen bei der Planung und Durchführung von Lösungen erleichtern, insbesondere, solange hier-
Kommunikations- und Fortbildungsmaßnahmen für Planungsroutinen fehlen. Die empirischen
für Bevölkerung, ÄrztInnen und ApothekerInnen. Erhebungen zeigen, dass BewohnerInnen über-
Außerdem wurde mittels Bayes’scher Netze be- wiegend aufgeschlossen gegenüber neuartigen
rechnet, welche Wirkung derartige Maßnahmen Systemen sind und solche als sinnvoll erachten.
hinsichtlich der Reduktion von Spurenstoffen im Ein reibungsloses und unauffälliges Funktionie-
Wasser haben. ren muss dabei allerdings gewährleistet sein.
➜ www.dsads.de ➜ www.networks-group.de
ISOE.deKREIS – Innovative Stadtentwässerung Semizentral – Infrastrukturen für
und Energiegewinnung in Hamburg schnell wachsende Städte
Ansprechpartner Engelbert Schramm, schramm@isoe.de Ansprechpartnerin Martina Winker, winker@isoe.de
Projektpartner Bauhaus-Universität Weimar, Institut für Projektpartner Technische Universität Darmstadt, Institut
Siedlungswasserwirtschaft (wissenschaftliche Koordination); IWAR (Projektleitung); Kocks Consult GMBH; Endress+Hauser
Hamburger Stadt-Entwässerung (Projektleitung); OtterWasser Conducta; Bilfinger Water Technologies GmbH; m+p con-
GmbH; Hochschule Ostwestfalen-Lippe; Technische Universi- sulting; Emscher Wassertechnik; Cosalux; Far Eastern mbH;
tät Hamburg-Harburg; Öko-Institut e. V.; Solar- und Wärme- Gebr. Heyl Vertriebsgesellschaft; Gummersbach Environment
technik Stuttgart (SWT); VacuSaTec Vacuum Sanitärtechnik Computing Center, Fachhochschule Köln
GmbH & Co. KG; Buhck Umweltservices GmbH & Co. KG; Laufzeit 06 /2013–05/2016
Consulaqua Hamburg GmbH
Förderung Bundesministerium für Bildung und Forschung
Laufzeit 11 /2011–02 /2015 (BMBF), Fördermaßnahme CLIENT
Förderung Bundesministerium für Bildung und Forschung
(BMBF), Fördermaßnahme INIS
Schnell wachsende Städte in Schwellen- und
In einem neuen Stadtquartier auf einem 35 Hek- Entwicklungsländern leiden häufig unter Wasser-
tar großen ehemaligen Kasernenareal in Ham- knappheit. Zugleich ist die Entsorgung der Ab-
burg wird erstmals das neuartige Sanitärkonzept wässer problematisch. Hier sind nachhaltige Kon-
22
HAMBURG WATER Cycle® umgesetzt: In mehr zepte für die Wasser- und die Sanitärversorgung,
als 600 Wohneinheiten werden Schwarzwasser die Abwasserbeseitigung und die Abfallwirtschaft
und Grauwasser voneinander getrennt. Zudem gefragt. Am Projektstandort Qingdao, einer nord-
sind alle Haushalte mit wassersparenden Vaku- chinesischen Hafenstadt, in der in kürzester Zeit
umtoiletten ausgestattet, sodass aus dem konzen- ein Stadtteil für 12.000 Menschen entstand, setzt
trierten Schwarzwasser in einer Biogasanlage das internationale Verbundprojekt Semizentral
Energie gewonnen wird. Aufgabe des Verbund- auf eine effiziente und integrierte Systemplanung.
projektes »KREIS – Kopplung von regenerativer Dazu werden modulare Ver- und Entsorgungs-
Energiegewinnung mit innovativer Stadtentwäs- strukturen erprobt, die sich dem Bevölkerungs-
serung« war es, den Planungs- und Bauprozess wachstum flexibler anpassen und Abwasserteil-
sowie in einer zweiten Projektphase die Inbetrieb- ströme nach ihrer Entstehung und Verschmutzung
nahme zu begleiten. Das Forschungsteam des unterscheiden. Aufgabe des ISOE ist es, das
ISOE hat untersucht, wann Vakuumtoiletten von Verhalten der BewohnerInnen des Stadtteils im
den künftigen BewohnerInnen akzeptiert werden. Umgang mit Wasser sozio-empirisch zu erfassen.
Zudem wurde ermittelt, wo sich Übergabepunkte Wir analysieren zudem, wie sich die Stoffströme
zwischen öffentlicher und häuslicher Abwasser- durch die semizentralen Strukturen und die
leitung verändern und welche Betreiber- und Grauwassernutzung verändern und identifizieren
Kooperationsmodelle sich für den Betrieb der in einer Vulnerabilitätsanalyse Schwachstellen.
neuartigen Wasserinfrastruktur eignen. ➜ www.semizentral.de
➜ www.kreis-jenfeld.deSie können auch lesen