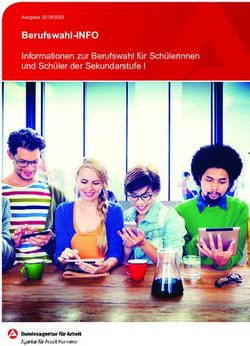Inverse Inklusion - Ein inklusives Bildungsangebot für Kinder mit und ohne Sehbeeinträchtigung oder Blindheit - Ein inklusives Bildungsangebot ...
←
→
Transkription von Seiteninhalten
Wenn Ihr Browser die Seite nicht korrekt rendert, bitte, lesen Sie den Inhalt der Seite unten
Humboldt-Universität zu Berlin
Kultur-, Sozial- und Bildungswissenschaftliche Fakultät
Institut für Rehabilitationswissenschaften
Abteilung Pädagogik bei Beeinträchtigungen des Sehens
Wintersemester 2018/19
Inverse Inklusion - Ein inklusives Bildungsangebot für Kinder
mit und ohne Sehbeeinträchtigung oder Blindheit
Reverse inclusion - An educational opportunity for visually impaired or blind children
Bachelorarbeit
zur Erlangung des akademischen
Grades Bachelor of Arts (B.A.)
Dieses Werk ist lizenziert unter einer CC BY 4.0
Creative Commons Namensnennung 4.0 International Lizenz
[https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/]
Vorgelegt durch:
Nikola Ueberreiter
Berlin, den 10. Dezember 2018Abstract
Das Thema „Inverse Inklusion“ wird diskutiert, um ein inklusives Bildungsangebot für Kinder
mit und ohne Sehbeeinträchtigung oder Blindheit vorzustellen. Die gemäß aktueller
Gesetzeslage bestehenden Anforderungen an ein solches Bildungsangebot, werden in einigen
Bundesländer - wie Berlin - derzeit nicht erfüllt. Weiterhin wird erläutert, warum sich
Privatschulen eher für inklusive Bildungsangebote eignen als öffentliche Schulen. Mit Hilfe
von vier Interviews, die mit Schulleiterinnen und Schulleitern von Schulen mit dem
Förderschwerpunkt Sehen geführt wurden, konnten Informationen zur inversen Inklusion
gesammelt werden. Die daraus resultierten Ergebnisse und die Diskussion dieser werden
vorgestellt. Letztlich werden Schritte aufgezeigt, mit denen das invers inklusive
Bildungsangebot bundesweit umsetzbar ist.
IInhaltsverzeichnis
1 Einleitung .......................................................................................................... 1
2 Theoretischer Hintergrund ............................................................................. 3
2.1 Begriffsklärung ........................................................................................................ 3
2.1.1 Inklusion ....................................................................................................... 3
2.1.2 Inverse Inklusion .......................................................................................... 3
2.2 Statistik ..................................................................................................................... 6
2.3 Gesetzeslage .............................................................................................................. 9
2.3.1 Allgemeine Lage ........................................................................................... 9
2.3.2 Vergleich der Bundesländer ....................................................................... 10
2.3.3 Berlin .......................................................................................................... 11
2.4 Vorteile und Grenzen Inverser Inklusion ........................................................... 12
2.4.1 Gemeinsames Lernen ................................................................................. 12
2.4.2 Differenzierter Unterricht .......................................................................... 13
2.4.3 Individuelle Förderung .............................................................................. 16
2.4.4 Soziales Lernen .......................................................................................... 17
3 Schulkonzepte für funktionierende Inverse Inklusion ............................... 20
3.1 Öffentliche Schulen................................................................................................ 20
3.2 Privatschulen .......................................................................................................... 21
4 Methoden ........................................................................................................ 23
4.1 Datenerhebung ....................................................................................................... 23
4.1.1 Interviews ................................................................................................... 23
4.1.2 Leitfaden ..................................................................................................... 24
4.1.3 Erhebung .................................................................................................... 25
4.2 Datenauswertung ................................................................................................... 26
4.2.1 Vorgehensweise .......................................................................................... 26
4.2.2 Durchführung der Auswertung .................................................................. 27
5 Ergebnisse und Diskussion ............................................................................ 29
5.1 Definition Inverser Inklusion ............................................................................... 29
5.2 Grenzen Inverser Inklusion .................................................................................. 30
5.3 Hürden und Aufgaben Inverser Inklusion .......................................................... 31
5.4 Umstellungsprozess und Finanzierung ................................................................ 33
5.5 Vorteile Inverser Inklusion für die Lernenden ................................................... 34
II5.6 Schwächen Inverser Inklusion ............................................................................. 35
5.7 Umsetzung auf didaktisch-pädagogischer Ebene ............................................... 37
5.8 Potenziale hinsichtlich der möglichen Bildungsabschlüsse ............................... 38
5.9 Erste konkrete Schritte zur Umsetzung .............................................................. 39
6 Zusammenfassung und Fazit ........................................................................ 41
Literaturverzeichnis ......................................................................................... 43
Rechtsquellenverzeichnis ................................................................................. 47
Anhang ............................................................................................................... 49
IIIAbbildungsverzeichnis
Abb. 1: Inklusion zwischen bildungspolitischer Steuerung und individueller
Schulentwicklung (Moser, 2017, S. 16) ...................................................................4
Abb. 2: Exklusionsquoten der Schülerinnen und Schüler der Bundesländer in Deutschland
(Klemm, 2014a; KMK, 2014a, b; KMK, 2015; KMK, 2016a, b, c; Berechnungen
durch Lange, 2017, S. 16) ........................................................................................6
Abb. 3: Abgängerinnen und Abgänger von Förderschulen ohne mindestens einen
Hauptschulabschluss (Statistisches Bundesamt, 2017; Berechnungen durch Lange,
2017, S. 13) ..............................................................................................................6
Abb. 4: Förderquoten der Schülerinnen und Schüler der Bundesländer in Deutschland
(Klemm, 2014a; KMK, 2014a, b; KMK, 2015; KMK, 2016a, b, c; Berechnungen
durch Lange, 2017, S. 14) ........................................................................................7
Abb. 5: Inklusionsanteile der Schülerinnen und Schüler der Bundesländer in Deutschland
(Klemm, 2014a; KMK, 2014a, b; KMK, 2015; KMK, 2016a, b, c; Berechnungen
durch Lange, 2017, S. 18) ........................................................................................7
IV1 Einleitung
Gemäß dem auf der UN-Behindertenrechtskonvention (UN-BRK) basierenden Grundsatz,
niemanden vom allgemeinen Schulsystem auszuschließen, besteht in Deutschland der Ansatz,
Schülerinnen und Schüler inklusiv zu unterrichten. Dies wurde bislang nur unbefriedigend
umgesetzt. Während in anderen Ländern viele Lernende mit und ohne Beeinträchtigung
gemeinsam beschult werden, erfolgt dies in der Bundesrepublik nur in geringem Umfang. Eine
Studie der Bertelsmann Stiftung zeigt, dass zwischen den Jahren 2008/09 und 2016/17 die
Anzahl der an Förderschulen Lernenden um nur 40.000 sank. Eine aktuelle Schlagzeile aus dem
Handelsblatt hierzu lautet: „10 years on, Germany still lags in inclusive education.” (vgl.
Gottschalk & Bulkeley, 2018)
“It should be education for everybody, and everybody’s needs should be met in an inclusive
setting.” (vgl. Gillmore, 2014) Um Inklusion in Deutschland voranzutreiben müsste - neben der
dazu nötigen Finanzierung - eine Neustrukturierung des Curriculums und des
Raummanagments stattfinden. Bisher orientiert sich die Ausbildung von Lehrpersonen vor
allem an Kindern und Jugendlichen ohne besondere Auffälligkeiten oder Behinderungen. Im
Zuge der Inklusion sollten Lehrerinnen und Lehrer zukünftig gezielter vorbereitet werden, auf
die Bedürfnisse aller Schülerinnen und Schüler einzugehen. (Gillmore, 2014)
Doch wie sind all diese Forderungen an Regelschulen vereinbar? Wie sollen Kinder und
Jugendliche mit unterschiedlichen oder gar mehreren Förderschwerpunkten auf einer Schule
bzw. in einer Klasse unterrichtet werden? Warum wird das inklusive Bildungsangebot
überwiegend an Regelschulen angeboten? Wäre eine „inverse“ Herangehensweise, einem
Konzept bei dem Lernende ohne sonderpädagogischen Förderbedarf in Förderschulen beschult
werden, umsetzbar?
Die Idee, sich mit dem Thema der inversen Inklusion auseinanderzusetzen, kam während eines
Praktikums an einer Schule mit dem Förderschwerpunkt Sehen auf. Im Rahmen des Studiums
an der Humboldt-Universität zu Berlin wurde das sechswöchige Praktikum absolviert. Es dient
insbesondere dazu sich mit der Unterrichtsgestaltung in einer Klasse mit sehbehinderten oder
blinden Lernenden auseinanderzusetzen. Die Erfahrungen wurden mit Hilfe von
Hospitationsbesuchen gemacht. In einem Vorbereitungsseminar wurden die Praktikantinnen
und Praktikanten Klassen zugeteilt, sodass Hospitationen schwerpunktmäßig in der Klasse 10
ISS (Integrierte Sekundarschule) stattfanden. Die angehenden Lehrerinnen und Lehrer wurden
innerhalb ihrer Besuche in die Prozesse der Unterrichtsgestaltung, Bewertung, Methodik und
Didaktik eingebunden. Hierbei kamen mehrfach alternative Bildungsangebote, wie das der
1inversen Inklusion zur Sprache. Die Lehrenden der Schule waren bezüglich der Idee dieses
Bildungsangebot für sehbehinderte und blinde Lernende in Berlin umzusetzen gegensätzlicher
Meinung. Dies gab den Anlass, sich mit dem Thema der Öffnung von Sonderschulen mit dem
Förderschwerpunkt Sehen im Bundesland Berlin zu beschäftigen.
Im Rahmen dieser Arbeit wird das Bildungsangebot Inverse Inklusion für Kinder mit und ohne
Sehbeeinträchtigung oder Blindheit im Land Berlin untersucht. Da es in Berlin bisher keine
Schulen mit diesem Bildungsangebot gibt, wurden Interviews mit Schulleiterinnen und
Schulleitern (invers) inklusiver Schulen im Förderschwerpunkt Sehen aus anderen
Bundesländern geführt. Ob und inwiefern zum heutigen Zeitpunkt inverse Inklusion an Berliner
Schulen angeboten werden kann, ist Inhalt dieser Ausarbeitung.
22 Theoretischer Hintergrund
2.1 Begriffsklärung
Zum besseren Verständnis der Arbeit werden im folgenden Kapitel die Begriffe Inklusion und
inverse Inklusion definiert. Die Definitionen beziehen sich auf die Institution Schule und den
Fachbereich Behinderung.
2.1.1 Inklusion
Bislang liegt keine allgemein anerkannte Definition von Inklusion vor. Der Begriff Inklusion
muss daher als multifaktorielles und mehrdimensionales Konstrukt betrachtet werden.
Unpräzise beschreibt Inklusion den gemeinsamen Unterricht von Schülerinnen und Schülern
mit und ohne sonderpädagogischen Förderbedarf an allgemeinbildenden Schulen. Die
Mehrdeutigkeit des Begriffs wird dabei allerdings vernachlässigt. Inklusion muss deshalb auf
deutlich mehr Ebenen betrachtet werden. (Grosche, 2015)
Inklusion ist das Recht auf Selbstbestimmung und Gleichheit, d.h. über dieselben Rechte wie
Menschen ohne Behinderung zu verfügen. Aus diesem Grund wird im inklusiven
Bildungsangebot darauf verzichtet, Lernende in Kategorien wie Schülerin bzw. Schüler mit
oder ohne Förderbedarf einzuteilen. (Grosche, 2015)
2.1.2 Inverse Inklusion
Inverse Inklusion ist ein Bildungsangebot für Schülerinnen und Schüler mit und ohne
sonderpädagogischen Förderbedarf an Sonder- bzw. Förderschulen. Im Gegensatz zur
Inklusion, werden Kinder und Jugendliche mit einer Behinderung nicht an allgemeinbildenden
Schulen, sondern an Schulen mit einem Förderschwerpunkt, unterrichtet. Durch das Öffnen der
Sonderschulen lernen Regelschülerinnen und -schüler an Förderschulen. Aufgrund dieses
umgekehrten Prinzips wird von inverser Inklusion gesprochen. Das Ziel des Schulkonzepts ist
die soziale Interaktion zu steigern, indem sich behinderte und nichtbehinderte Lernende, Lehr-
und Lerninhalte gemeinsam erarbeiten. (Schoger, 2006)
Dennoch lassen sich zwischen Inklusion und inverser Inklusion gewisse Parallelen und
Gemeinsamkeiten in Bezug auf Ziele, Prinzipien oder sogar Umsetzung finden. Inklusion
definiert unter anderem zwei direkte Ziele, die auch im invers inklusiven Bildungsangebot
erreicht werden wollen. Einerseits will Inklusion, dass eine effektive, passgenaue und
individuelle Förderung jedes einzelnen Kindes und Jugendlichen gelingt. (Grosche, 2014)
Andererseits strebt sie danach soziale Teilhabe, Freundschaft, Freiheit, Würde und
Anerkennung zu ermöglichen. (Prengel, 2006) Beide Ziele - Förderung und Anerkennung - sind
eng miteinander verbunden und bedingen sich gegenseitig. Mit Hilfe des Erwerbs von
3Qualifikationen, wird die Teilhabe am gesellschaftlichen Leben gesteigert. Das Erlernen der
Qualifikationen gelingt allerdings nur mittels einer pädagogischen Beziehung, die zugleich
anerkennend und wertschätzend ist. (Grosche, 2015)
Ein Prinzip beider inklusiver Bildungsangebote ist der Verzicht des Vergleichs von Kindern
und Jugendlichen mit und ohne sonderpädagogischen Förderbedarf. Sowohl Inklusion als auch
inverse Inklusion gelingt nur dann, wenn keine stigmatisierenden Gruppierungen von
Schülerinnen und Schülern vorgenommen werden. Die Diagnostik bleibt weiterhin zur
Bestimmung von Lernbedürfnissen, -ständen und Entwicklungsverläufen unvermeidlich,
allerdings nicht vor dem Hintergrund, eine bestimmte Schülerin oder einen bestimmten Schüler
als Inklusionskind zu bezeichnen. Jedes in der Inklusion unterrichtete Kind ist ein
Inklusionskind. (Grosche, 2015)
Inklusion kann steuerungsstrategisch, aufgrund unterschiedlicher Akteurinnen bzw. Akteure
und Interessen, nicht klar definiert und anschließend auch nicht entsprechend der in der
Abbildung dargestellten Top-Down-Vorgaben (UN-BRK, Schulgesetze, Bildungs-
administratives Handeln, Vorgaben der Schulinspektion) umgesetzt werden. Um inklusive
Bildungsangebote umsetzen zu können, sind ebenfalls Bottom-Up-Strategien (Schul-
programme, an Schwerpunkten orientierte Schulentwicklungen, Teambildung) nötig. „Insofern
ist die Organisation Schule ein zentrales und bedeutsames Feld, in dem Schulreform auf der
Ebene der Einzelschule implementiert wird.“ (vgl. Moser, 2017, S. 16)
Abb. 1: Inklusion zwischen bildungspolitischer Steuerung und individueller Schulentwicklung
4Für die Umsetzung von inklusiven Bildungsangeboten, bedarf es zum einen der
Professionalisierung aller am Bildungsprozess Beteiligten, zum anderen einer Veränderung der
institutionellen Rahmenbedingungen. Die Bundesländer verfügen allerdings über keine
einheitliche Strategie zur Organisation dieser Voraussetzungen. Zur Entwicklung eines
Gesamtkonzepts, müssen die vorhandenen Ressourcen für die inklusive Leitidee genutzt
werden, die von den Beteiligten in der Schule unterstützt wird. Weiterhin werden aufeinander
abgestimmte Ziele in den Bereichen der Schule, des Unterrichts und der Organisations- und
Personalentwicklung formuliert. Schließlich werden die festgelegten Ziele, mittels eines
konkreten Umsetzungsplans, überprüft. (Jahreis, 2014)
52.2 Statistik
Zu diesem Zeitpunkt liegen keine statistischen Daten zum invers inklusiven Bildungsangebot
vor. Das liegt zum einen daran, dass bisher kaum Förderschulen dieses Schulkonzept anbieten.
Zum anderen setzen die wenigen Förderschulen in Deutschland das Bildungsangebot noch
nicht lange genug für genügend Daten um. Statistiken über Inklusion geben allerdings einen
ebenso guten Aufschluss über die derzeitige Situation der Beschulung behinderter Schülerinnen
und Schüler in der Bundesrepublik.
Trotz politischer und rechtlicher Änderungen, haben einige Bundesländer Deutschlands die
Umsetzung der schulischen Inklusion kaum angenommen. Dass separierende Schulformen
nicht UN-BRK-konform sind, stellte der UN-Ausschuss mehrfach deutlich klar. Einigen
Bundesländern fehlt ein Gesamtkonzept für ein inklusives Schulsystem gänzlich. Erforderliche
Schritte zur Schaffung von inklusiven Schulstrukturen, blieben bislang aus. (Aichele &
Kroworsch, 2017)
Die Exklusionsquote verdeutlicht dies. Die Exklusionsquote gibt den Anteil der Kinder und
Jugendlichen mit Förderbedarf an, die an einer Förderschule bzw. separiert vom
allgemeinbildenden System unterrichtet werden. Innerhalb eines Zeitraums von sieben Jahren
hat sich diese Quote um nur 0,48% verringert. Im Schuljahr 2015/2016 besuchten stets 4,44%
der Kinder mit sonderpädagogischem Förderbedarf eine Sonder- oder Förderschule. (s. Abb. 2)
Abb. 2: Exklusionsquoten der Schülerinnen und Schüler Abb. 3: Abgängerinnen und Abgänger von Förderschulen
der Bundesländer in Deutschland ohne mindestens einen Hauptschulabschluss
6In Deutschland beenden 71% der Schülerinnen und Schüler mit sonderpädagogischem
Förderbedarf die Sonder- oder Förderschule ohne einen Hauptschulabschluss. (s. Abb. 3) Diese
Zahlen bezeugen keine positive Entwicklung, sondern vielmehr eine enttäuschende Stagnation.
Demzufolge ist es den Bundesländern bisher nicht gelungen, ein funktionierendes inklusives
Bildungsangebot zu etablieren. (Aichele & Kroworsch, 2017)
Unterschiede zwischen den Bundesländern zeigen sich in der Förderquote. Mit dieser Quote
wird der Anteil der Schülerinnen und Schüler mit sonderpädagogischem Förderbedarf
angegeben. In Mecklenburg-Vorpommern liegt diese bei 11%, in Hessen hingegen bei 5,7%.
Die Förderquote deutschlandweit hat sich im Vergleich zwischen den Schuljahren 2008/09 und
2015/16, im Jahr vor dem Inkrafttreten der Behindertenrechtskonvention (BRK), von 6,0 auf
7,1% erhöht. (s. Abb. 4) In Brandenburg, Bremen, Mecklenburg-Vorpommern, Sachsen-Anhalt
und Thüringen sinkt die Förderquote, während sie in Baden-Württemberg, Bayern, Hamburg,
Niedersachsen, Nordrhein-Westfalen, Rheinland-Pfalz, Saarland und Schleswig-Holstein
steigt. (Lange, 2017)
Abb. 4: Förderquoten der Schülerinnen und Schüler Abb. 5: Inklusionsanteile der Schülerinnen und Schüler
der Bundesländer in Deutschland der Bundesländer in Deutschland
Letztlich zeigt der Inklusionsanteil den Anteil der Schülerinnen und Schüler mit
sonderpädagogischem Förderbedarf an, die an einer allgemeinbildenden Schule unterrichtet
werden. Zwischen den Schuljahren 2008/09 und 2015/16 steigt der Inklusionsanteil,
insbesondere in Hamburg, Bremen und Niedersachsen. Ebenso erhöht sich der Inklusionsanteil
7in Berlin, Nordrhein-Westfalen, Sachsen-Anhalt und Schleswig-Holstein um mehr als 20%. (s.
Abb. 5) In Schleswig-Holstein und Berlin wurde schon vor dem Inkrafttreten der BRK ein
relativ hoher Inklusionsanteil nachgewiesen. (Lange, 2017)
Setzt man die Förderquote, Exklusionsquote und Inklusionsanteil in einen Zusammenhang, fällt
auf, dass in allen Bundesländern der Inklusionsanteil steigt, während sich gleichzeitig die
Förderquote erhöht und die Exklusionsquote stagniert. „Wenn bei mehr Schülerinnen und
Schülern, die ohnehin die allgemeine Schule besuchen, ein sonderpädagogischer Förderbedarf
festgestellt wird, dann erhöht sich der Inklusionsanteil, ohne dass effektiv weniger Kinder die
Förderschule besuchen.“ (vgl. Lange, 2017, S. 19)
Aus diesem Grund ist diese Betrachtungsweise für ein Gesamtbild in Deutschland nicht
ausreichend. Mit Hilfe der absoluten Zahlen lässt sich die Entwicklung besser erkennen. In
Berlin, Brandenburg, Bremen, Hamburg, Mecklenburg-Vorpommern, Niedersachsen,
Nordrhein-Westfalen, Sachsen, Sachsen-Anhalt, Schleswig-Holstein und Thüringen wurden im
Schuljahr 2015/16 weniger Schülerinnen und Schüler an einer Förderschule unterrichtet als im
Schuljahr 2008/09. Auf Bundesebene sind die Ergebnisse dennoch unbefriedigend. Bei einem
demografiebedingten Rückgang der Anzahl aller Schülerinnen und Schüler um 9%,
verzeichneten die Förderschulen einen Schülerrückgang von nur 18%. (Lange, 2017)
82.3 Gesetzeslage
In diesem Kapitel wird zunächst auf die allgemeine Lage der Gesetze bezüglich der Bildung
behinderter Kinder in Deutschland eingegangen. Im Anschluss werden relevanten Gesetze, die
zur Umsetzung des invers inklusiven Bildungsangebots nötig sind, beschrieben.
2.3.1 Allgemeine Lage
In Deutschland wurde durch die UN-Behindertenrechtskonvention eine Diskussion darüber
ausgelöst, was ein inklusives Bildungssystem ausmacht und wie die Ziele erreicht werden
können. Die UN-BRK hat zur Umsetzung des inklusiven Bildungsangebots, Ziele verfasst.
Deutschland als Vertragsstaat – mitsamt allen Bundesländern - muss zukünftig die dazu nötigen
Maßnahmen treffen. (UN-BRK, 2007)
Die Vertragsstaaten anerkennen das Recht von Menschen mit Behinderungen auf Bildung.
Um dieses Recht ohne Diskriminierung und auf der Grundlage der Chancengleichheit zu
verwirklichen, gewährleisten die Vertragsstaaten ein integratives Bildungssystem auf allen
Ebenen und lebenslanges Lernen mit dem Ziel,
(a) die menschlichen Möglichkeiten sowie das Bewusstsein der Würde und das
Selbstwertgefühl des Menschen voll zur Entfaltung zu bringen und die Achtung vor
den Menschenrechten, den Grundfreiheiten und der menschlichen Vielfalt zu stärken;
(b) Menschen mit Behinderungen ihre Persönlichkeit, ihre Begabungen und ihre
Kreativität sowie ihre geistigen und körperlichen Fähigkeiten voll zur Entfaltung
bringen zu lassen;
(c) Menschen mit Behinderungen zur wirklichen Teilhabe an einer freien Gesellschaft
zu befähigen. (vgl. UN-BRK, 2007, Art. 24)
Für die Entwicklung eines inklusiven Schulsystems macht der UN-Ausschuss deutlich, dass
Staaten, die sowohl ein reguläres als auch ein Sonder- oder Förderschulsystem aufrechterhalten,
widersprüchlich zur Verpflichtung aus Artikel 24 der UN-BRK handeln. Diese Staaten sollen
ihre bisherige Finanzierung des Bildungssystems neu strukturieren und zur Entwicklung eines
inklusiven Bildungsangebots nutzen. Weiterhin sind die Vertragsstaaten dazu verpflichtet,
einen Mindeststandard zu erfüllen. Neben den in Artikel 24 Absatz 1 der UN-BRK aufgeführten
Bildungszielen, müssen die Vertragsstaaten die folgenden Vorgaben in ihren Ländern
umsetzen: „Diskriminierungsfreiheit in allen Aspekten der Bildung, Bereitstellung von
angemessenen Vorkehrungen sowie verpflichtende, kostenlose Grundbildung für alle.“ (vgl.
Kroworsch, 2017, S. 4)
Zur Umsetzung eines inklusiven Bildungsangebots fordert der UN-Ausschuss einen
gesetzlichen und politischen Rahmen. Zeitvorgaben und die Möglichkeit Verstöße zu
9sanktionieren, sollen die Entwicklung des Systems erleichtern. 13 Schlüsselelemente sowie ein
Schulentwicklungsplan, der die Schulgesetzgebung unterstützt, dienen ebenfalls zum
Vorantreiben des Vorhabens. Der Schulentwicklungsplan wird in Zusammenarbeit mit
Selbsthilfeorganisationen und aktuellen Daten erstellt. Die Staaten sind verpflichtet,
aufgeschlüsselte Daten zum Bereich der inklusiven Bildung zu erheben. Außerdem fordert der
UN-Ausschuss angemessene Gelder und ausreichendes Personal zur Entwicklung
bereitzustellen. Die vorhandenen Ressourcen sollen von segregierenden zu inklusiven
Strukturen umdisponiert werden. (Kroworsch, 2017)
2.3.2 Vergleich der Bundesländer
Um ein invers inklusives Bildungsangebot umsetzen zu können, müssen zukünftig die Gesetze
einiger Bundesländer anpasst werden. Derzeit sind die Regelungen der Bundesländer
unterschiedlich und sogar gegensätzlich.
In Hinblick auf die Schulgesetze, ist die Öffnung von Sonderschulen für nichtbehinderte Kinder
zum heutigen Zeitpunkt lediglich in vier Bundesländern (Brandenburg, Baden-Württemberg,
Niedersachsen, Sachsen) möglich. ([2] §29 Abs. 3, [3] §15 Abs. 5, [10] §14 Abs. 1, [14] §13
Abs. 1) Im brandenburgischen Schulgesetz unter Abschnitt sechs „Sonderpädagogische
Förderung“ §29 „Grundsätze, gemeinsamer Unterricht“ Absatz 3, ist die folgende
Vereinbarung zur Umsetzung gemeinsamen Unterrichts zu finden.
Gemeinsamer Unterricht wird in enger Zusammenarbeit mit einer Förderschule oder einer
Sonderpädagogischen Förder- und Beratungsstelle organisiert. Er ermöglicht ein
wohnungsnahes Schulangebot. Die Formen des gemeinsamen Unterrichts sollen
individuell entwickelt werden. Sie können zeitlich befristet oder stufenweise ausgeweitet
werden. (vgl. [2] §29 Abs. 3)
Deutlich gegen die Organisation eines gemeinsamen Unterrichts an einer Sonder- oder
Förderschule, sprechen die Schulgesetze der folgenden sieben Bundesländer: Berlin, Bayern,
Bremen, Hamburg, Thüringen, Nordrhein-Westfalen und Saarland. ([1] §38 Abs. 1, [4] Art. 19
Abs. 1, [5] §70a Abs. 1, [6] §19, [8] §3 Abs. 11, [11] §20 Abs. 5, [13] §4a Abs. 1) Das
Schulgesetz von Nordrhein-Westfalen erlaubt unter Abschnitt „Schulstruktur“ §20 Absatz 5,
gemeinsames Lernen lediglich an einer allgemeinbildenden Schule anzubieten. Zuvor ist eine
Zustimmung des Schulträgers einzuholen. Weiterhin muss die Schule personell und sächlich
ausreichend ausgestattet sein oder ggf. ausgestattet werden. Eine weitere Alternative wird nicht
angeboten. ([11] §20 Abs. 5) Auf das Bundesland Berlin wird im anschließenden Kapitel
umfassender eingegangen.
Eine Kooperation zwischen allgemeinbildenden Schulen und Sonder- bzw. Förderschulen,
10lassen die Schulgesetze von Hessen, Mecklenburg-Vorpommern, Rheinland-Pfalz, Sachsen-
Anhalt und Schleswig-Holstein zu. ([7] §53 Abs. 2, [9] §36 Abs. 3), [12] §12 Abs. 2, [15] §8
Abs. 1, [16] §45 Abs. 1) Aus dem Hessischen Schulgesetz unter Abschnitt 7
„Sonderpädagogische Förderung unter §53 „Inklusive Schulbündnisse und
sonderpädagogische Beratungs- und Förderzentren“ Absatz 2, ist folgendes zu entnehmen:
Bei der Zusammenarbeit von Förderschulen mit allgemeinen Schulen ist das Ziel, die
Schülerinnen und Schüler optimal zu fördern, um im Rahmen der Möglichkeiten beson-
deren Förderbedarf zu vermindern oder zu beseitigen. Dies schließt auch das Erreichen
eines zielgleichen Schulabschlusses ein. Zwischen der Förderschule und der allgemeinen
Schule können Formen der Kooperation entwickelt werden, in denen das Kind Schülerin
oder Schüler der Förderschule bleibt (Kooperationsklassen). (vgl. [7] §53 Abs. 2)
2.3.3 Berlin
Im Schulgesetz für das Land Berlin unter Abschnitt V „Sonderpädagogische Förderung“ steht
im §36 – Grundsätze im zweiten Unterpunkt geschrieben, dass eine sonderpädagogische
Förderung sowohl an allgemeinbildenden Schulen als auch an Schulen mit
sonderpädagogischem Schwerpunkt erfolgen kann. Das Ziel ist, die Schülerinnen und Schüler
mit sonderpädagogischem Förderbedarf zu einem Schulabschluss zu führen und ihnen somit
den Wechsel in einen anderen Bildungsgang zu ermöglichen. Die sonderpädagogische
Förderung soll primär in einem gemeinsamen Unterricht mit Schülerinnen und Schülern ohne
sonderpädagogischen Förderbedarf an allgemeinbildenden Schulen erfolgen. Die Planung und
Durchführung des gemeinsamen Unterrichts wird zusammen mit den Lehrenden für
Sonderpädagogik und denen der allgemeinen Schulen erarbeitet.
Schulen mit sonderpädagogischem Förderschwerpunkt (Sonderschulen) sind
Grundschulen und Schulen der Sekundarstufen I und II für Schülerinnen und Schüler mit
sonderpädagogischem Förderbedarf. Die Organisation dieser Schulen richtet sich nach den
sonderpädagogischen Förderschwerpunkten "Sehen", "Hören", "Körperliche und
motorische Entwicklung", "Lernen", "Sprache" und "Geistige Entwicklung". Im Bereich
der beruflichen Schulen stehen für die sonderpädagogische Förderung Berufsschulen mit
sonderpädagogischen Aufgaben zur Verfügung. (vgl. [1] §38 Abs. 1)
Dies steht unter §38 - Schulen mit sonderpädagogischem Förderschwerpunkt Absatz 1
geschrieben. Folglich dürfen in Berlin derzeit keine Kinder und Jugendlichen ohne
sonderpädagogischen Förderbedarf an einer Förderschule unterrichtet werden.
112.4 Vorteile und Grenzen Inverser Inklusion
2.4.1 Gemeinsames Lernen
Ein wichtiger Aspekt des gemeinsamen Lernens ist, die in „Soziologie der Behinderten“ in
Kapitel 5 beschriebene Kontakthypothese. Daraus kann abgeleitet werden, welchen Zweck es
hat, Kinder gemeinsam lernen zu lassen. Der direkte Kontakt mit Menschen mit einer
Behinderung ist maßgeblich für die Qualität der Einstellung nichtbehinderter Menschen und
wichtigster Faktor. Im Sinne des inklusiven Bildungsangebots, behinderte und nichtbehinderte
Kinder gemeinsam zu beschulen, kann davon ausgegangen werden, „da[ss] unmittelbare und
möglichst frühzeitige Kontakte einer positiven und akzeptierenden Haltung im späteren Leben
förderlich sind.“ (vgl. Cloerkes, 2007, S. 145)
Es gibt drei Grundannahmen der Kontakthypothese. Die erste besagt, dass der Kontakt mit
behinderten Menschen, Vorurteile korrigieren kann. Der Kontakt soll Vertrautheit aufbauen,
um Fremdheit abzubauen, wie aus der zweiten Annahme zu entnehmen ist. Laut der dritten
Annahme erhöht sich die Zuneigung zwischen Menschen mit und ohne Behinderung, je
häufiger sie miteinander interagieren. Die Annahmen lassen sich in zwei Thesen
zusammenfassen:
1. Personen, die über Kontakte mit Behinderten verfügen, werden günstigere
Einstellungen gegenüber Behinderten zeigen als Personen, die keine derartigen
Kontakte haben oder hatten.
2. Je häufiger Kontakt mit Behinderten bestanden hat, um so positiver wird die
Einstellung des Betreffenden sein. (vgl. Cloerkes, 2007, S. 146)
Neben der Häufigkeit ist vor allem die Intensität des Kontaktes entscheidend. Auch der
intensive oder enge Kontakt garantiert nicht die Entwicklung positiver Einstellungen.
Nebenbedingungen sind die emotionale Fundierung sowie die Freiwilligkeit. Hingegen
günstige Bedingungen sind relative Statusgleichheit, eine aus der sozialen Beziehung folgenden
Belohnung und die Verfolgung gemeinsamer Aufgaben und Ziele. Weiterhin kann sich eine
ursprüngliche Einstellung im Kontakt, nochmals verstärken. So kann eine vorerst negative
Einstellung negativ oder eine vorweg positive Einstellung positiv bestärkt werden. Aus diesem
Grund ist es wichtig, behinderte und nichtbehinderte Kinder möglichst früh in den
gemeinsamen Kontakt kommen zu lassen. (Cloerkes, 2007)
„Inklusive Schulen fördern die Leistungspotenziale aller Schülerinnen und Schüler.“ (vgl.
Dräger, 2011, S. 16) Differenzierte Lerninhalte helfen sowohl leistungsschwächeren als auch
leistungsstärkeren Lernenden. Ebenso beweisen Studien, dass die Leistungen von Schülerinnen
und Schülern ohne Förderbedarf in Regelklassen genauso gut sind wie in Integrationsklassen.
12Gemeinsamer Unterricht fördert neben der individuellen Leistung, das Selbstwertgefühl sowie
die soziale Kompetenz der Kinder und Jugendlichen. Somit stellen gute Leistungen der
Lernenden und Inklusion keinen Widerspruch dar. Mit Hilfe des gemeinsamen Unterrichts
können insbesondere die Schülerinnen und Schüler mit einem sonderpädagogischen
Förderbedarf Kompetenzen erwerben, die eine Teilhabe am gesellschaftlichen Leben
ermöglichen. (Dräger, 2011)
Inklusion ist der notwendige Schritt, zur Entwickelung eines individuellen Förderungssystems,
von dem alle Schülerinnen und Schüler profitieren. Zwischen den Bundesländern in
Deutschland herrscht stets eine große Varianz. Somit ist es noch ein langer und umfangreicher
Prozess, bis sich in der Bundesrepublik das inklusive Bildungssystem etabliert hat. Hierfür ist
die Haltung aller Beteiligten (Lernende, Lehrende, Eltern, Erzieherinnen- und Erzieher und
Fachkräfte der Politik und Verwaltung) entscheidend. Sie alle müssen dem Vorhaben positiv
gegenübertreten. Genauso müssen Standards zur personellen, materiellen und finanziellen
Ausstattung geschaffen werden. Zuletzt werden Ressourcen benötigt, die in die individuelle
Förderung der Lernenden, Qualifikation der Fachkräfte und bauliche Maßnahmen der
Einrichtungen investiert werden. (Dräger, 2011)
Bestimmte Bildungsstätten, wie bspw. die Friedländer Grundschule, ist seit diesem Schuljahr
eine „Schule für gemeinsames Lernen“. Das bedeutet, dass nichtbehinderte Lernende und
Schülerinnen und Schüler mit einer Beeinträchtigung, Behinderung oder besonderen
Begabung, gemeinsam unterrichtet werden. Dafür wurden notwendige personelle und
räumliche Ressourcen geschaffen. Auch zukünftig sollen weitere Lehrende eingestellt werden,
um allen Grundschulkindern eine optimale Förderung gewähren zu können. (Kühl, 2016)
Dennoch gibt es neben Befürwortern, auch Kritiker des Schulkonzepts, Schülerinnen und
Schüler mit und ohne Behinderung gemeinsam lernen zu lassen. Zeitschriften wie „Die Zeit“
regen ihre Leser dazu an, gemachte Erfahrungen, sowohl aus Eltern- als auch Lehrer- bzw.
Lehrerinnenperspektive mitzuteilen. Grund ist, dass laut dem Artikel, die Idee Kinder und
Jugendliche gemeinsam lernen zu lassen in der Theorie einfacher klingt, als sie in der Praxis
umzusetzen ist. (Sadigh & Otto, 2015)
2.4.2 Differenzierter Unterricht
„No Two Students with a Visual Impairment Will Have Exactly the Same Needs or Levels of
Vision, So It Is Essential That All Accommodations and Instruction Be Individualized for Each
Student.“ (vgl. Gilbert, 2018, S. 25) Aussagen aus Zeitschriftenartikeln wie diese zeigen, dass
für ein inklusives Bildungsangebot, individualisierte und offene Unterrichtskonzepte essentiell
sind. Allerdings werden diese Konzepte derzeit, lediglich in selektiven Strukturen angewendet.
13Aufgrund von erwarteten und vor allem normierten Lernergebnissen, findet die Offenheit der
Unterrichtskonzepte, ihre Grenze. Folglich werden sie in heterogenen Lerngruppen kaum
umgesetzt. (Meister & Schnell, 2017)
Beispiele für individualisierte und offene Unterrichtskonzepte sind Freiarbeit, Stationsarbeit,
Wochenplanarbeit oder innere Differenzierung. Sämtliche Ansätze kritisieren die derzeitigen
Inhalte der Lehrpläne. Dort werden die Inhalte von der Lehrperson gesteuert und nur teilweise
mit differenzierten Lernprozessen ergänzt. Die genannten methodisch-didaktischen Ansätze
gehen vom Lernenden mit seinen spezifischen Interessen und Lernbedürfnissen aus. Das Kind
bestimmt neben dem Lerninhalt, die Vorgehensweise, das Tempo und die Sozialform im
Lernprozess. Wichtig ist sämtliche Schritte innerhalb der Methode, transparent und
nachvollziehbar zu gestalten, um sie gemeinsam mit der Lehrperson und Schülerinnen und
Schülern reflektieren zu können. Bei der Projektmethode dürfen die Lernenden das Thema, das
in den folgenden Stunden bearbeitet wird, wählen. Orientiert wird sich hierbei am Problem und
dem Ergebnis der Projektarbeit. Die Lernenden handeln innerhalb ihrer Gruppe demokratisch,
das Vorhaben, die Vorgehensweise, die Medien, das Produkt und Form der Präsentation aus.
Im Anschluss daran setzen die Schülerinnen und Schüler ihr gewähltes Vorgehen um und
reflektieren zuletzt den gesamten Prozess ihrer gemeinsamen Arbeit. Voraussetzung für diese
Lernmethode ist das geteilte Bewusstsein in der Vorstellung, den Intentionen und der
Handlungsplanung. (Meister & Schnell, 2017)
Individuelle Lernbarrieren müssen zukünftig, mittels Differenzierungsmaßnahmen zum
gemeinsamen Lerninhalt, abgebaut werden. Die Herausforderung ist dabei, die Schülerinnen
und Schüler weder zu unter- noch zu überfordern. Die Lehrenden dürfen sich nicht zu sehr an
das Niveau der Leistungsstärkeren oder -schwächeren anpassen. Von den Lehrenden wird
verlangt das richtige Maß zwischen individueller Lernbegleitung und dem Einbeziehen der
gesamten Klasse, zu treffen. „Als Voraussetzung für gelungene individualisierte
Bildungsprozesse gilt, dass der Bildungsinhalt als subjektiv sinnvoll erkannt wird und an das
Vorwissen angeknüpft werden kann.“ (vgl. Terfloth, 2017, S. 49) Die Lehrenden müssen
hierfür die Lernumgebung vorbereiten, lebensweltbezogene Lernanlässe eröffnen, Lern- und
Hilfebedarfe unterstützen sowie bei der Lösung von Problemen helfen. Unterschiedliche
Lernausgangslagen, innerhalb einer Lerngruppe, können mit Hilfe von flexiblen und
insbesondere differenzierten Lehrmethoden bewältigt werden. (Terfloth, 2017)
In einer Klasse bildet die soziale Gruppe den Rahmen, in dem das individualisierte Lernen jedes
einzelnen Kindes und Jugendlichen stattfindet. Innerhalb einer heterogenen Lerngruppe wird
mit anderen Schülerinnen und Schülern interagiert, um Erkenntnisse zu erarbeiten, das
Anregungspotenzial zu nutzen oder am Modell der anderen Kinder und Jugendlichen zu lernen.
14Aus diesem Grund sollen die Lernenden in regelmäßigen Abständen, die Möglichkeit erhalten,
sich neben dem Lernstoff, Lernort, Ziel und der Arbeitszeit, für eine Lernpartnerin oder einen
Lernpartner, zu entscheiden. (Terfloth, 2017)
15Somit gehört es zu den Aufgaben der Schule, Schülerinnen und Schüler zu differenzieren. Laut
Ahrbeck werden die Lernenden, insbesondere bei der Vermittlung von anspruchsvollen
Unterrichtsinhalten differenziert. „Talente können sich nur entfalten, wenn man feststellt, wo
es sie gibt. Das heißt zugleich, dass man auch bemerkt, wo sie nicht existieren. Gute Leistungen
kann es nur geben, wenn es auch schlechte gibt.“ (vgl. Denninghaus, 2015, S. 192)
2.4.3 Individuelle Förderung
Beim Unterrichten von Lernenden in Gruppen, ist es wichtig mit den Lernvoraussetzungen und
-fähigkeiten sowie Begabungen und Interessen der Kinder und Jugendlichen umgehen zu
können. Die Herausforderung ist, jeder Schülerin und jedem Schüler die Möglichkeit zu geben,
persönliche Stärken entsprechend dem individuellen Leistungsvermögen, voll zu entfalten. Zur
Umsetzung eines individualisierenden und differenzierenden Bildungsangebotes, ist eine
gezielte und abgestimmte Förderplanung nötig. Diese vereinbart zukünftige Lern- und
Entwicklungsschritte der jeweiligen Schülerin bzw. des jeweiligen Schülers. (Hülscher,
Wieneke-Kranz & Zöllner, 2010)
Im Artikel „Führt ein Curriculum für sehgeschädigte Menschen zur Isolation“ wird sich mit der
Problematik auseinandergesetzt, ob sehbehinderte oder blinde Kinder und Jugendliche mit
Hilfe eines speziell auf sie zugeschnitten Lehrplans unterrichtet werden müssen. Die Forderung
dessen, wird allerdings nur wenig diskutiert. Giese und Kohlstedt sind zu dem Entschluss
gekommen, dass sich der Bereich der Blinden- und Sehbehindertenpädagogik aufgrund eines
spezifischen Curriculums, nicht zusätzlich isolieren sollte. Grund ist, dass ein isoliertes System
entstehen könnte, das nur innerhalb seiner eigenen Grenzen wirksam und nicht mit den anderen
Förderschwerpunkten vereinbar ist. (Giese & Kohlstedt, 2016)
Die Aufgabe der Lehrenden besteht darin, den allgemeinen Lehrplan mit dem
sonderpädagogischen Lehrplan bzw. spezifischen Curriculum zu vereinen. Der für
Förderschüler verpflichtende sonderpädagogische Förderplan, definiert die individuellen
Bildungs- und Erziehungsziele. Er wird von Lehrenden, Eltern und ggf. den Schülerinnen und
Schülern selbst erstellt. Letztlich bietet ein Förderplan die Möglichkeit, Förderziele und
Maßnahmen, im Schulalltag umzusetzen. (Lang & Thiele, 2017)
Wer mit dem Anspruch der Individualisierung des Bildungsangebots für alle Kinder in
inklusiven Schulen allerdings ernst machen will, der wird auch nicht umhin können, die
individuellen Lern- und Förderbedürfnisse für alle Kinder und Jugendlichen differenziert
zu diagnostizieren und entsprechende Förderpläne für alle zu erstellen. (vgl. Heimlich,
2012, S. 16)
Das individuelle Lernen der Schülerinnen und Schüler wird in inklusiven Konzepten in den
16Mittelpunkt gestellt. Mittels der diagnostizierten individuellen Lernvoraussetzungen und
anschließenden Förderung aller Lernenden, kommt es zu keiner Selektionsdiagnostik von
bestimmten Kindern und Jugendlichen. Außerdem werden auf diese Weise Barrieren frühzeitig
abgebaut oder sogar verhindert. (Jahreis, 2014)
Das Ziel des inklusiven Bildungsangebots ist, den Unterricht auf Grundlage der individuellen
Lernstandsdiagnosen zu binnendifferenzieren. Zunächst werden Aufgaben formuliert, die für
alle Schülerinnen und Schüler gelten. Mit Hilfe von erweiterten und vertiefenden
Aufgabestellungen und Aktivitäten und gleichzeitiger Unterstützung durch Materialien, wird
das Lernangebot ausdifferenziert. Durch weitere Aufgaben für leistungsstarke Lernende und
pädagogische und fachdidaktische Unterstützung bei Lernschwierigkeiten, wird der Lehrstoff
nochmals individualisiert. (Jahreis, 2014)
Mit dem Auge können mehr Informationen schneller verarbeitet werden als mit den anderen
Sinnesorganen. Bei einer Beeinträchtigung des Sehens kann folglich die Entwicklung und das
Lernen erschwert werden. Der Nachteilsausgleich bezieht sich auf Leistungsanforderungen und
-nachweise. Mit Hilfe des Ausgleichs, werden aufgrund von einer Behinderung entstandene
Nachteile ausgeglichen. Die differenzierten Leistungsanforderungen müssen der
Chancengleichheit und dem Benachteiligungsverbot gerecht werden. Weiterhin müssen
Nachteilsausgleiche individuell von der jeweiligen Schulleitung festgelegt werden. Einerseits
darf sich der Ausgleich nicht auf fachliche Anforderungen auswirken. Andererseits gibt es die
Möglichkeit die Aufgabenstellungen differenziert anzupassen. Mögliche Nachteilsausgleiche
sind verlängerte Arbeitszeiten, das Bereitstellen von Arbeitsmitteln oder mündliche statt
schriftliche Arbeitsformen. (Lang & Thiele, 2017)
Um eine individuelle Förderung zu gewährleisten, müssen Lehrende miteinander kooperieren.
Die Zusammenarbeit fördert die eigenen reflektierenden Fähigkeiten der Lehrerinnen und
Lehrer. Auch das Zusammenspiel zwischen der Vermittlung von Inhalten durch die
Lehrperson, der Art und Weise wie Schülerinnen und Schüler lernen und wie Lehrende ihre
eigene Kompetenz weiterentwickeln, schaffen ein günstiges Lernklima. (Tjemberg &
Heimdahl Mattson, 2014)
2.4.4 Soziales Lernen
Ein großer Vorteil der inversen Inklusion ist das Erlernen des sozialen Miteinanders. Inklusion
soll langfristig soziale Ausgrenzung minimieren und bestenfalls verhindern. Auch
nichtbehinderte bzw. sehende Lernende und ihre Eltern legen großen Wert auf ein soziales
Miteinander. Indem Schülerinnen und Schüler von sich gegenseitig lernen, können
Berührungsängste abgebaut und darüber hinaus beseitigt werden.
17In Cloerkes „Soziologie der Behinderung“ werden in Kapitel sechs im Unterkapitel „Wichtige
soziologische Identitätskonzepte in der Behindertenforschung“, mehrere Identitätskonzepte
vorgestellt. Diese werden wiederum auf der Basis von Goffmans „Stigma - Über Techniken der
Bewältigung beschädigter Identität“ beschrieben. (Goffman, 1967) Es wird in drei Identitäten
unterschieden: soziale, persönliche und Ich-Identität. Die dreifache Identitätstypologie befasst
sich mit verschiedenen Problembereichen im Umgang mit Stigmatisierten. (Cloerkes, 2007)
Die soziale Identität wird über die von Personen gewünschte Gruppenzugehörigkeit definiert.
Menschen - mit und ohne Behinderung - ordnen sich stets sozialen Kategorien (wie bspw.
Studierende, Sehbehinderte, Blinde oder Arbeitende) zu. Infolge dieser Zuordnung kommt es
langfristig zur Stigmatisierung. Mit Hilfe eines Merkmals werden Personen nachteiligen
sozialen Kategorien zugeordnet. Die persönliche Identität ist das Einzigartige eines jeden
Menschen. Sie dient zur Identifizierung einer Person. Das Individuum kann mit Hilfe dieser
Identität stets von allen anderen differenziert werden. Die von Goffman beschriebenen
Techniken der Informationskontrolle, können einer Person helfen ihr Stigma zu verbergen.
(Goffman, 1967) Letztlich empfindet eine Person über die Ich-Identität die eigene Situation. Es
handelt sich um das subjektive Empfinden eines Menschen. Diese Identität resultiert aus
unterschiedlich gemachten sozialen Erfahrungen eines Individuums und kann durch
Interaktionserfahrungen stark beeinflusst werden. (Cloerkes, 2007)
Goffman beschreibt in „Stigma - Über Techniken der Bewältigung beschädigter Identität“ im
ersten Kapitel „Stigma und soziale Identität“, den Begriff „Weisen“. Es handelt sich dabei um
Personen, die stigmatisierten Personen helfen sich zu integrieren, um am sozialen Leben
teilhaben zu können. (Goffman, 1967)
[...] die „Weisen“, nämlich Personen, die normal sind, aber deren besondere Situation sie
intim vertraut und mitfühlend mit dem geheimen Leben der Stigmatisierten gemacht hat
und denen es geschieht, da[ss] ihnen ein Maß von Akzeptierung, eine Art von
Ehrenmitgliedschaft im Clan zugestanden wird. (vgl. Goffman, 1967, S. 40)
Trotz eines gewissen Mangels an sozialen Kompetenzen, wird ein Individuum mit Hilfe eines
Weisen als gewöhnlich angesehen. Folglich wird die bzw. der Stigmatisierte zu einer Person,
die sich vor anderen weder schämen, noch Selbstkontrolle ausüben muss. Bevor eine Person
zum Weisen wird, muss diese „eine ihr Innerstes verändernde persönliche Erfahrung
durchgemacht haben.“ (vgl. Goffman, 1967, S. 41)
Es gibt zwei Typen von Weisen. Der erste ist derjenige, der bspw. in einer bestimmten
Einrichtung arbeitet und somit in Kontakt mit stigmatisierten Menschen treten muss. Beispiele
hierfür sind Krankenpflegerinnen und -pfleger oder Heilpraktikerinnen und -praktiker. In
Bezug auf Menschen mit Behinderung handelt es sich um Institutionen, wie Krankenhäuser
18oder Sonderschulen, die den Bedürfnissen einer stigmatisierten Person dienen. Der zweite
Typus umfasst Personen, die aufgrund der Sozialstruktur mit einem stigmatisierten Individuum
verbunden sind. Beispiele dafür sind Kinder oder Eltern. In dem Fall teilen die Weisen,
aufgrund der Verbundenheit, die Diskreditierung der bzw. des Stigmatisierten. Aus diesem
Grund werden Beziehungen wie diese z.T. abgebrochen oder gemieden. Personen, die sich
hingegen dazu entscheiden, mit einem stigmatisierten Menschen in Kontakt zu treten, verfügen
über ein sog. Ehrenstigma. Sie zeigen, inwieweit es möglich ist, Stigmatisierten das Gefühl zu
geben, trotz der Behinderung, normal behandelt zu werden. Die Person mit dem Ehrenstigma
setzt dabei voraus, dass es moralisch wertvoll ist, so zu handeln wie sie es tut. Sie betrachtet
das Stigma als etwas Neutrales, das dennoch von anderen gesehen werden muss. Andere
Menschen könnten diesen Umstand als demütigend wahrnehmen. Weiterhin könnten
Stigmatisierte eine Abhängigkeit zu ihrem Begleiter entwickeln. Sowohl die Person mit einem
Ehrenstigma als auch die bzw. der Stigmatisierte müssen sich damit auseinandersetzen, keine
garantierte und vollkommende Akzeptanz von der Gesellschaft für das stigmatisierte
Individuum zu erhalten. (Goffman, 1967)
193 Schulkonzepte für funktionierende Inverse Inklusion
Der Artikel „Private Schule, öffentliche Schule: Wer kann besser fördern?“ stellt die Vor- und
Nachteile beider Schulkonzepte vor. Während Privatschulen oftmals eine segregierende
Funktion nachgesagt wird, haben öffentlichen Schulen mit dem Nachteil einer unzureichenden
Flexibilität zu kämpfen. (Liedtke, 2009) Das invers inklusive Bildungsangebot wurde bereits
in verschiedenen Schulkonzepten umgesetzt. In Deutschland gibt es sowohl private als auch
öffentliche Förderschulen, die Kinder und Jugendliche mit und ohne Sehbeeinträchtigung oder
Blindheit gemeinsam unterrichten.
Gemäß Artikel 20 des Grundgesetzes erlaubt der deutsche Bundesstaat den Bundesländern,
Aufgaben unterschiedlich zu lösen. Die dazu nötigen Finanzmittel werden vom Bund zur
Verfügung gestellt. „Die Ausübung der staatlichen Befugnisse und die Erfüllung der staatlichen
Aufgaben ist Sache der Länder [...].“ (vgl. [17] Art. 30) Auf dieser Basis entwickeln die Länder
der Bundesrepublik eine eigene Handlungskompetenz im Bildungsbereich. Weiter heißt es:
„Das gesamte Schulwesen steht unter Aufsicht des Staates.“ (vgl. [17] Art. 7 Abs. 1) Dennoch
kommt es zu einem steigenden Angebot an Privatschulen in Deutschland. Das Recht zur
Errichtung von Privatschulen, ist im Grundgesetz in Artikel 7 Absatz 4 verfasst. Private Schulen
müssen vom Staat genehmigt werden und unterstehen den Landesgesetzen.
3.1 Öffentliche Schulen
Öffentliche bzw. staatliche Schulen sind in der Bundesrepublik die häufigste Schulform. In
Deutschland gibt es kein einheitliches Schulsystem, sodass sich öffentliche Schulformen
innerhalb Deutschlands zwischen den einzelnen Bundesländern unterscheiden. Unter
staatlicher Aufsicht gehören die inhaltliche, organisatorische und planerische Gestaltung des
Schulwesens zu den Aufgaben der Länder. Diese Gestaltung obliegt weitestgehend den
Kultusbehörden. Weiterhin werden von den Schulaufsichtsbehörden, die Beratung, Förderung
und Beaufsichtigung der Schulen, wahrgenommen. Zu den Aufgaben der Bundesländer zählen
somit: Qualitätssicherung, Qualitätskontrolle und Unterstützung der einzelnen Schulen zur
Weiterentwicklung. Die jeweiligen Länder kommen diesen mit verschiedenen Maßnahmen,
wie bspw. Rahmenlehrplänen, nach. Zusammen mit der Schulgesetzgebung, bilden sie die
verbindliche Grundlage für Lehr- und Lernprozesse. (Czerwanski, 2000)
Die Bundeländer können ebenso innovative pädagogische Konzepte im kleinen Rahmen und
unter wissenschaftlicher Begleitung erproben. Landesintern können Schulversuche, wie bspw.
Inklusionsklassen, gefördert werden. Ebenso können staatliche Schulen Modellversuche
umsetzen. Diese werden von der Bund-Länder-Kommission für Bildungsplanung und
Forschungsförderung initiiert und vom Bundesministerium für Bildung und Forschung und den
20Ländern anteilig finanziert. Modellversuche haben bereits ihre Bedeutung als Instrument und
Mittel zur Weiterentwicklung bewiesen. Allerdings ist unklar, ob erfolgreiche Modelle auf
andere Schulen übertragbar und dauerhaft umzusetzen sind. (Czerwanski, 2000)
3.2 Privatschulen
Ursprünglich dienten Privatschulen dazu, öffentliche Schulen zu ergänzen. Um die
Jahrtausendwende erfuhren Privatschulen einen deutlichen Zuwachs. Aufgrund personeller und
finanzieller Ressourcen sind Privatschulen, verglichen mit öffentlichen Schulen, in der Lage
ein besseres Bildungsangebot aufrechtzuerhalten. Somit errichteten private Schulen, auch im
Bereich der Förderschulen, ein breit gefächertes Angebot. Zwischen den Schuljahren 1992/93
und 2011/12, gab es einen Zuwachs von Privatschulen von 31%. Während die Gesamtzahl an
Schulen sinkt, steigt der Anteil an Privatschulen kontinuierlich. Dem passten sich auch die
Schülerzahlen an. Im Schuljahr 2010 besuchte jede bzw. jeder elfte Lernende eine Privatschule,
1992 war es gerade mal jede bzw. jeder zwanzigste. (Gürlevik, Palentien & Heyer, 2013)
Es gibt mehrere Vorteile von Privatschulen. Insbesondere in ländlichen Gebieten sichern
Privatschulen wohnortnahe Bildungsangebote. Häufig sind bspw. konfessionelle Prägungen der
Grund zur Errichtung privater Schulen. Weiterhin sind Privatschulen nicht direkt an die
Rahmenlehrpläne gebunden. Sie bilden lediglich den Rahmen zum Kompetenzaufbau der
Schülerinnen und Schüler. Mit Blick auf Förderschulen, können Kompetenzen in
unterschiedlichen Lerntempi angeeignet werden. Somit können die Lernenden ihre Lernziele
individuell erreichen. Damit einhergehend erhalten Lehrende die Möglichkeit, ihren Unterricht
frei zu gestalten. Die ungebundene Unterrichtsgestaltung und individuelle Förderung der
Kinder und Jugendlichen sind vorrangig der Grund, warum Eltern oftmals Privatschulen
bevorzugen. Weitere Vorteile sind, die in privaten Schulen kleinere Klassengrößen und höhere
Anzahl an Lehrenden. (Geuer, 2013)
Die Ausbildung der Lehrenden an Privatschulen ist dieselbe, wie für Lehrende an staatlichen
Schulen. Im Bewerbungsprozess entscheiden die privaten Schulen selbst, ob die ausgebildeten
Lehrerinnen und Lehrer angestellt werden. Weiterhin gehen die Lehrenden kein
Dienstverhältnis mit dem Staat, sondern mit dem privaten Schulträger ein. Folglich haben die
Lehrenden an Privatschulen keinen Anspruch auf einen Beamtenstatus, der in einigen
Bundesländern vergeben wird. (Geuer, 2013)
Meist können private Schulen ihr Bildungsangebot kaum aus eigenen Mitteln aufrechterhalten.
Aus diesem Grund sind sie darauf angewiesen, neben einem Schulgeld der Eltern, finanzielle
Unterstützung vom Staat zu erhalten. Allerdings bekommen nur bestimmte Schulen eine
zusätzliche Finanzierung. Die Bundesländer haben das Recht, Kriterien an die Schulen in freier
21Sie können auch lesen