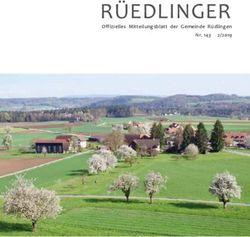Jahrheft 2017 - Ritterhausgesellschaft Bubikon - Das Ritterhaus Bubikon
←
→
Transkription von Seiteninhalten
Wenn Ihr Browser die Seite nicht korrekt rendert, bitte, lesen Sie den Inhalt der Seite unten
Ritterhausstrasse 35 8608 Bubikon Tel. 055 243 39 74 info@ritterhaus.ch www.ritterhaus.ch ISSN 2235-4751 Jahrheft der Ritterhausgesellschaft Bubikon Redaktion: Boris Bauer Layout: spinazze.ch I design without confusion, Rüti Druck: Eristra-Druck AG, Rüti Ritterhausgesellschaft Bubikon, 2018
Inhalt 6 Die Geschichte der Zeitmessung 12 Der Klöppel macht die Musik! 16 Die Renovation des «Neuhauses» 2017 22 Neue Betriebsleitung 24 Nachruf auf unser Ehrenmitglied Tom Vogel 25 Jahresbericht des Vorstandes 2017 29 Museumsbericht 36 Die musealen Exponate im Ritterhaus 38 Protokoll 81. ordentliche Hauptversammlung RHG 46 Jahresrechnung 51 Museumseintritte 2017 52 Mitteilungen, Organisatorisches
Vortrag
Thomas Muff
Die Geschichte der Zeitmessung
Schon vor dem 3. Jahrtausend v.Chr. befasst der Ablauf eines sich regelmässig wieder-
sich die Menschheit mit Zeitmessfragen, holenden Vorgangs.
den Problemen der Zeitmessung und dem
Uhrenbau (Stonehenge, Pyramiden). Doch Am Beginn der Entwicklung des Uhrenbaus
erst mit der Erfindung der mechanischen stehen die sog. Elementaruhren, die auf
Räderuhr vor über 700 Jahren beginnt elementare Wirkungen der Natur (Sonnen-
der eigentliche Siegeszug der Uhr. Ab uhr, Wasseruhr) zurückgreifen. Eine zweite
dem ausgehenden Mittelalter bestimmt Entwicklungsphase ist gekennzeichnet
die Uhr mehr und mehr die Zeitabläufe durch die Entfernung dieser Abläufe,
6 der Menschen. Sie wird allmählich zum was schliesslich zur Unabhängigkeit von
Ordnungsfaktor für das tägliche Arbeiten der Natur und zur Verselbständigung
und Leben. Ein Leben ohne Uhr ist nicht der Mechanik führt. Sie beginnt mit der
mehr vorstellbar. Damit verbunden ist Erfindung der mechanischen Räderuhr
eine Allgemeingültigkeit der Zeit für alle im 13. Jahrhundert und erstreckt sich bis
Menschen in unserer heutigen, modernen in unsere heutige Zeit. Das Weglassen
Industriegesellschaft, im sog. Computer- möglichst vieler mechanischer Elemente in
zeitalter. Bis zum 19. Jahrhundert liessen einer Uhr und die Benutzung von kleineren
sich die Menschen in viel geringerem Masse Zeiteinheiten als die Sekunde stehen für
bewusst von der Zeit beherrschen, als dies eine dritte Entwicklungsphase. Elektromag-
heute der Fall ist. Die Erfindung und kons- netisch (Stimmgabeluhr) oder elektronisch
tante Weiterentwicklung der mechanischen (Quarzuhr) angeregte Schwingungen und
Uhr, die Entwicklung der tragbaren Uhr die Konstruktion der Atomuhr (Messung
sowie die Konstruktion der an Genauigkeit von Strahlungen) ermöglichen immer
kaum noch zu überbietenden Quarz- und kürzere und präzisere Zeiterfassung. Diese
Atomuhren beeinflussen unsere Lebens- Phase beginnt erst in unserer Zeit und ihr
weise tief und damit auch unsere Kultur- Verlauf ist heute noch nicht absehbar.
und Gesellschaftsgeschichte.
Eine Uhr repräsentiert nicht nur einen
Es ist einer der herausragendsten Gedan- bestimmten Entwicklungsgang in der
ken der Menschen, die Zeit, also etwas, was Geschichte der Zeitmessung, sondern auch
man nicht sehen und konkret fassen kann, den Fortschritt eines technisch-wissen-
zu messen. Wenn man einzelne Ereignisse schaftlichen Grundprinzips im Laufe der
festlegen und ihren zeitlichen Abstand Jahrhunderte. Zugleich nimmt sie durch
ausdrücken will, muss man die Zeit messen. ihr Eindringen in die Bereiche des täglichen
Dies bedeutet die Feststellung, wie oft eine Lebens einen nicht zu unterschätzenden
bestimmte definierte Einheit – das Normal – Platz innerhalb unserer Kulturgeschichte
in der zu messenden Grösse enthalten ist. ein. Ebenso ist sie durch die Formgebung
Was mit einem Zeitmessgerät also wirklich und künstlerische Gestaltung des Gehäu-
eingeteilt und gemessen wird, ist lediglich ses ein wichtiger Exponent in der kunst-historischen Entwicklung geworden. Die
Uhr legt Zeugnis ab über die sich im Lauf
der Zeit verändernden Stilrichtungen. Sie
vermittelt uns demnach einen Einblick in
die unterschiedlichen künstlerischen Aus-
drucksformen und Geschmacksrichtungen
vergangener Epochen. Nicht zu vergessen
ist schliesslich noch der sozial- und wirt-
schaftsgeschichtliche Aspekt. Die Entste-
hung von lokalen Uhrmacherzentren und
Uhrenindustrien hat auch Auswirkungen
auf die soziale Lage derer Beschäftigten.
Zeitmasse in der Antike und
im Mittelalter Sonnenuhr mit Gnomon
Fast alle Völker der antiken Welt verfügten
über eine Methode der Zeitmessung und
Zeitrechnung. Die ursprünglichste Methode Sonnenuhren
der Zeitmessung basierte auf dem Zählen Beinahe vier Jahrtausende, von etwa
leicht erkennbarer und wiederkehrender 2500 v. Chr. – 1500 n. Chr., waren die
Phänomene wie den Wechsel von Tag und Sonnenuhren die wichtigsten Uhren der
Nacht. Für den antiken Menschen haben Menschheit. Das einfachste Instrument zur
die Auf- und Untergangszeiten der Sonne Zeitmessung war der auf eine waagerechte
weitgehend den Tagesrhythmus geprägt. ebene Fläche aufgestellte Stab oder Stift,
Der Lichttag war überall die praktische dessen mit der Sonne wandernde Schatten-
Grundeinheit für die Zeitmessung. spitze und auch -länge man beobachtete.
Dieser Schattenstab trägt den aus dem 7
Die Elementaruhren Griechischen kommenden Namen Gnomon
Die Geschichte der Zeitmessung beginnt (Anzeiger). Der Gnomon diente schon recht
mit der Konstruktion und dem Bau von bald als Sonnenuhr, indem man auf dem
Uhren, die sich zur Zeitmessung natürlicher Boden gemäss der Schattenlänge und -rich-
Elemente bedienen. Insbesondere bei den tung Stundenlinien einzeichnete, also eine
Sonnen- und Wasseruhren handelt es sich Art einfaches Zifferblatt herstellte.
oft um technische Meisterleistungen der
antiken und mittelalterlichen Uhrenkonst- Wasseruhren
rukteure. Neben den Sonnenuhren waren die Was-
seruhren häufigste und wichtigste Zeit-
messer in der Antike und im Mittelalter. Im
Gegensatz zu den Sonnenuhren funktio-Vortrag
In Europa benutzte man ab dem 9. Jahrhun-
dert zum Messen der Zeit durch Feuer vor-
wiegend Kerzen. Besonders in den Klöstern
liess man in der Nacht in einer Bronzeschale
Kerzen abbrennen, in die in Abständen
Metallkugeln eingefügt waren. Beim
Schmelzen des Wachses fielen die Kugeln
in die Schale und die Kerzenuhr «schlug».
8 Ab dem 16. Jahrhundert wurde in Europa
eine verwandte Form der Feueruhr ge-
bräuchlich: die Öllampenuhr aus Zinn. Der
Ölbehälter aus Glas war mit einer Skala
versehen, auf der die Nachtstunden durch
das allmähliche Abbrennen des Öls ange-
Altägyptische Wasseruhr um 1400 v. Chr. zeigt wurden. Auf diese Weise besass man
zugleich ein Nachtlicht.
nieren Wasseruhren bei Tag und Nacht und Sanduhren
bei bewölktem Himmel. Die Sanduhr oder das Stundenglas ist unter
den Elementaruhren der jüngste Zeit-
Wasseruhren sind im Altertum die Instru messer. Nachweisbar taucht die Sanduhr
mente zur Zeitmessung, die unseren in Europa erstmalig im 14. Jahrhundert
mechanischen Uhren sehr nahe kommen. auf. Ihre Erfindung war abhängig von der
Der Unterschied besteht darin, dass Wasser- Produktion klaren Glases und von der Ein-
uhren auf einem kontinuierlichen Vorgang führung eines neuen, feineren «Sandes».
beruhen, indem Wasser ständig durch eine
Öffnung fliesst, während die mechanischen Oft bestand der «Sand» aus Marmorstaub,
Uhren von einer mechanischen Bewegung feingemahlenen Eierschalen und Zinn oder
abhängen, die sich ständig wiederholt und Bleiasche. Grober Sand konnte für diesen
somit die Zeit in abgegrenzte Abschnitte Zweck nicht verwendet werden, da er
einteilt. die Öffnung des Sandgefässes, durch die
er rinnt, sehr rasch vergrössern würde.
Feueruhren Aufgrund ihrer leichten Handhabung
Neben den Sonnen- und Wasseruhren gab es waren Sanduhren vom 16. Jahrhundert an
seit dem Mittelalter Zeitmessgeräte, die das überall in Europa, aber auch bei den Ara-
gleichmässige Abbrennen von bestimmten bern, weit verbreitet. Neben der Räderuhr
Stoffen zur Zeitmessung nutzten. Die Brenn- wurde die Sanduhr das allgemein übliche
dauer dieser Stoffe ergab das Zeitmass. Zeitmessgerät. Ausser ihrem Einsatz im täg-lichen Leben fanden Sanduhren auch auf Die Konstruktionselemente
den Kirchenkanzeln und in der Schifffahrt Bei jeder mechanischen Räderuhr lassen
Verwendung. sich neben dem Gehäuse und den zusätz-
lichen Einrichtungen wie Schlagwerke und
Die Räderuhren Wecker im Wesentlichen drei Konstruk
Unter Räderuhren versteht man Uhren, tionselemente unterscheiden:
die selbsttätig auf mechanische Weise den
Ablauf der Zeit, ohne ständigen Bezug 1. D er Antrieb durch ein ablaufendes
auf die astronomischen Gegebenheiten, Gewicht oder eine Feder stellt die Kraft
zu messen vermögen. Sie werden durch zur Verfügung, die das «Laufen» einer
ein Gewicht oder durch eine Zugfeder Uhr und damit die Fortbewegung der
angetrieben und besitzen ein Hemmungs- Zeiger erst ermöglicht.
system mit einem Gangregler, welches ein
gleichmässiges Ablaufen des Räderwerkes 2. Das Räderwerk besitzt die Aufgabe, die
garantiert, so dass es zum Messen der Zeit Antriebskraft durch eine Kombination
unter Verwendung der Stunden, später mehrerer Räder und Triebe, die durch
auch der Minuten und Sekunden, genutzt Eingriffe miteinander in Verbindung
werden kann. stehen, auf die Hemmung zu übertra-
gen. Mit dem Räderwerk gekoppelt ist
das Zeigerwerk.
3. Die Hemmung ist dasjenige Konstruk
tionselement einer Uhr, welches die von
dem Gewicht oder der Zugfeder auf
das Räderwerk weitergeleitete Kraft in
kleine und kleinste Abschnitte unterteilt.
Die Energie geht vom Antrieb über das 9
Räderwerk bis zum Hemmrad und wird
dort in möglichst gleichmässige, sich
periodisch wiederholende Zeitspannen
zerlegt. Das Hemm- oder Gangrad ist mit
einem Schwingsystem, dem Gangregler
(z. B. Waag oder Pendel), kombiniert.
Der Gangregler bestimmt das Zeitnormal
der Uhr.
Kerzenuhr, Öllampenuhr, SanduhrVortrag
Die ersten Turmuhren
Es lässt sich nicht genau feststellen, wann
und von wem die Konstruktionselemente
der mechanischen Räderuhr erfunden
wurden. Seit der ersten Hälfte des 14. Jahr-
hunderts sind in fast allen europäischen
Städten grosse, schlagende Räderuhren
nachzuweisen, die zuerst in Kirchen, dann
auch in Rathäusern ihren festen Platz
10 erhielten. Diese Uhren werden heute unter
dem Oberbegriff Monumentaluhren
zusammengefasst. Das besondere an diesen
Turmuhren war, dass sie selbständig als
öffentliche Uhren die Stunden für das
gesamte Gemeinwesen schlugen. Anfangs
war dies mit einem einfachen Schlag auf
die Glocke. Ab dem Ende des 14. Jahrhun-
derts wurde der Viertelstundenschlag ein-
geführt. Man begann jetzt also die Stunde,
die bisher die kleinste Einheit im täglichen
Leben gewesen war, weiter zu unterteilen Die Pendeluhr: Beginn der
und mit dem «Viertel» zu rechnen. Bei den Präzisionszeitmessung
ersten Turmuhren existierte noch keine An- 1657 gelang dem holländischen Astrono-
zeige der Stunden durch Aussenzifferblatt men und Physiker Christian Huygens die
und Zeiger. Ein Aussenzifferblatt setzte sich Erfindung der Pendeluhr.
im Laufe des 15. Jahrhunderts erst allmäh-
lich durch. Nunmehr konnte man auch aus Das wesentlich Neue an diesen Pendel-
grosser Entfernung die Zeit ablesen. Ab uhren war die Verwendung eines frei
Mitte des 16. Jahrhunderts setzte sich in den schwingenden und frei aufgehängten
meisten europäischen Ländern allgemein Pendels, welches nur noch mittelbar über
die Anzeige von zweimal 12 Stunden durch. die Pendelgabel mit dem Räderwerk in
Verbindung stand. Aufgrund der Eigen-
Allerdings wiesen die Räderuhren in dieser schwingungsfähigkeit des Pendels konnte
Zeit noch relativ grosse Fehlweisungen auf. es fast unbeeinflusst isochron schwingen.
Die Kontrolle und Regulierung der Räderuhr Die ersten Pendeluhren besassen neben
war noch für eine sehr lange Zeit nur mit den Stundenzeigern schon Zeiger für
einer Sonnenuhr möglich. Aus diesem Grund Minuten. Die Fehlweisungen dieser Uhren
kombinierte man in der damaligen Zeit sehr waren geringer als fünf Minuten pro
häufig eine Räderuhr mit einer Sonnenuhr. Tag.Baar, kath. Kirche,
Turmuhr v. Hans Luter 1526
Beginn des 20. Jahrhunderts noch jenseits
aller Vorstellungskraft lagen. So gehen
die Quarzuhren der Observatorien um eine
Sekunde pro 30 Jahre genau. Die heutigen
Atomuhren erreichen eine Abweichung
von einer Sekunde in 140 Milliarden Jahre.
Die schnelle Übernahme des Pendels durch
die englischen Uhrmacher leitete eine neue Quellenverzeichnis
Phase in der Entwicklung der Uhr ein. SieVortrag
Thomas Muff
Der Klöppel macht die Musik!
ist also die Summe eines Ganzen. Damit die
Verbindung der mannigfachen Nebentöne
möglichst optimal erfolgen kann, benöti-
gen die Glocken – genau wie viele andere
Musikinstrumente – ein Hilfsmittel um
selbst erklingen zu können: den Klöppel.
Nur er verhilft dem schweren Klanginstru-
ment sich hörbar in Szene zu setzen.
12 Der Klöppel – was ist das eigentlich?
Der Glockenklöppel befindet sich im
Inneren der Glocke und wird dort in einer
eigens dafür angefertigten Halterung
befestigt, so dass er sich in Läuterichtung
frei im Klangkörper bewegen kann. Nach
Aussen sichtbar sind für den interessierten
Laien oft nur der Vorschwung des Glocken-
klöppels, sowie der untere Teil des Ballens.
Das muss man wissen
Armaturen, technisches Ensemble Damit die Glocke ihren Schlagton optimal
Glocken prägen unsere Kultur bereits seit zu Gehör bringen kann, kommt es auf
vielen Jahrhunderten sehr stark. Sie rufen das richtige Verhältnis von Aufhängung
die Menschen zum Gebet, zeigen die zur Glocke selbst und auf die Relation der
Zeit, verkünden freudig grosse Ereignisse Glocke zum Klöppel an. Bei dieser Art
und begleiten uns auf dem letzten Weg. von technischen Zusammenhängen kommt
Glocken brauchen ihre Zeit um zu entste- es vor allem auf Form- und Masseverhält-
hen und sind gleichzeitig Sinnbild für Zeit. nisse an. Ein weiteres wichtiges Indiz für
Trotz ihrer unterschiedlichen Grössen, egal die korrekte Bestimmung des Klöppels ist
ob es sich dabei um Tonnen oder wenige der richtige Schwungwinkel der Glocke.
Kilogramm handelt, Glocken sind auch Auf diese Gegebenheit hat die Firma Muff
Musikinstrumente. Die Glocke selbst besteht Kirchturmtechnik AG ihr verstärktes Augen-
je nach Grösse aus sehr vielen unterschied- merk gerichtet. Stimmen diese Verhältnisse
lichen Teiltönen. Sie allesamt werden beim nämlich nicht, so läutet der bronzene
Anschlagen eines bestimmten Punktes Klangkörper entweder unregelmässig
am Glockencorpus erregt und verbinden oder es besteht die Gefahr eines Risses im
sich in einen einzigen hörbaren Ton, dem Metallgefüge. Um die richtige Dimensionie-
Schlag- oder Nominalton. Was am Fusse des rung e ines Klöppels bestimmen zu kön-
Turmes unmerklich wahrgenommen wird, nen, bedarf es vielfältiger Gesichtspunkte.Während eines herkömmlichen Läutepro- Die Klöppelaufhängung
zesses bzw. immer dann, wenn der Klöppel Es spielen viele Faktoren zusammen, so
die Glockenwand trifft, muss die Bronze- ist auch die Ausführung der Klöppelbefes-
glocke innerhalb einer halben Tausendstel- tigung bzw. der Drehpunkt der Klöppel-
sekunde das 300fache des Klöppelgewich- aufhängung von massgeblicher Bedeutung.
tes aushalten können. Dies stellt natürlich Die heute verwendeten Techniken zur
eine sehr hohe Belastung dar, der es Stand Klöppelbefestigung gründen sich zum
zu halten gilt – über viele Jahrhunderte grössten Teil auf das Kreuzkehreisen.
hinweg. Glocken sind in ihrer Grundkon- Ein zentraler, mechanischer Metallstab
zeption für die Ewigkeit bestimmt. verbindet das Kehreisen mit dem Glocken-
13Vortrag
joch und sichert denn je zuvor. Verschie-
so die Aufhängung denste Möglichkeiten
des Glockenklöppels. der Klöppelherstellung
Unterhalb des Kreuz- wurden ausgetestet.
kehreisens befindet sich Angefangen beim tradi
ein mechanisches Dop- tionellen Schmieden, über das
pelgelenk. Bestehend aus Drehen bis hin zum Guss. Da-
zwei Industrielagern und bei wendete jeder Hersteller
einer Klöppelgabel, die zur eigene Berechnungsversuche
14 eigentlichen Klöppelauf- an, was zu vielen unterschied-
nahme bestimmt ist. Der lichen Klöppelformen und
schwingende Klangerzeuger Dimensionen führte. Von der
selbst wird mittels einer länglichen Birnenform über den
Kappe aus Rindsleder in die Ellipsoidballen kam alles zur
vorgesehene Gabel einge- Anwendung. Als Optimum hat
hängt und komplettiert sich die Rundballenform er-
somit das Doppelgelenk. wiesen. Diese verlangt jedoch
Es besteht aus zwei Indust- eine absolute Passgenauigkeit,
rielagern und einer Klöppel- bietet zum anderen dafür die
gabel, die zur eigentlichen bestmögliche Klangentfaltung
Klöppelaufnahme bestimmt beim «Küssen» der Glocke.
ist. Der schwingende Klanger-
zeuger selbst wird mittels einer Der Klöppel macht die Musik
Kappe aus Rindsleder in die Gabel Grundsätzlich ist es die Glocke, die
eingehängt und komplettiert somit den Ton von sich gibt. Der Klöppel
das Doppelgelenk. Wenn die Glocke aber erst macht die Musik und damit
in Bewegung versetzt wird, kann der sind beide Elemente untrennbar
Klöppel durch die im Kehreisen ein- miteinander verbunden. Darum ist
gesetzten Kugellager fast reibungsfrei das Fachwissen um die Entstehung der
hin und her pendeln. Die Berührung des Glocke von ebensolcher Bedeutung, wie
Klöppelballens am Anschlagpunkt der Glo- die Kenntnisse zur Berechnung und Her-
cke wird, bedingt durch das Doppelgelenk, stellung des richtigen Klöppels individuell
noch einmal abgefedert und gedämpft. für jede Glocke.
Diese technische Ausrüstung schont die
Glocke beim alltäglichen Läutevorgang. Der Klöppel als Verschleissmaterial
Glockenklöppel sind mit denen durch die
Der Aufbau des Klöppels Forschung neu erbrachten Kenntnissen
Die Fertigung von Klöppeln war in den grundsätzlich als Verbrauchsmaterial zu
letzten Jahrzehnten unterschiedlicher behandeln. Denn ein Klöppel ist der reinen15 Logik nach, schon sehr viel einfacher, selbst – ein Unikat. Nur so kann sicherge- preiswerter und schneller herstellbar als stellt werden, dass die Glocke noch viele eine Glocke – ihren historischen Wert Jahrhunderte ihrer Bestimmung Sorge nicht einmal mitgerechnet. Das weiche trägt. Denn, wie sagte Friedrich Schiller: Schmiedeisen wird exakt berechnet, aus «Freude dieser Stadt bedeute, Friede sei einem Stück geschmiedet. ihr erst Geläute». Jeder massgeschneiderte, freiformge- Bildnachweis schmiedete Klöppel ist – wie die Glocke
Bericht
André Barthel und Roland Böhmer, Kantonale Denkmalpflege Zürich
Die Renovation des «Neuhauses» 2016/2017
Baugeschichte
Das «Neuhaus» bildet im Ritterhausen
semble die westliche Fortsetzung des
«Bruderhauses». Bereits auf der um 1530
entstandenen Zeichnung in der Chronik
von Heinrich Brennwald und Johannes
Stumpf ist das Gebäude bildlich festge-
halten: ein Steinbau mit Eckquadern,
Kreuzstockfenstern und einem Aufzugs-
16 giebel. Das für die Geschossbalkendecken
verwendete Bauholz wurde im Winterhalb-
jahr 1500/1501 geschlagen. Während der
Restaurierung 2016/17 liessen sich keine
Hinweise auf noch ältere Bausubstanz
finden. Somit dürfte das Gebäude 1501
oder wenig später an das wesentlich ältere
«Bruderhaus» angefügt worden sein. Nach
etwas mehr als hundert Jahren erhielten
das Neuhaus und der östlich anschliessen-
de Bauteil des «Bruderhauses» eine neue
Dachkonstruktion. Als Fälljahr der verwen-
deten Hölzer liess sich das Winterhalbjahr Bericht über die Restaurierung 2016/17
1614/1615 ermitteln. 1853 veranlasste Das gesamte Ritterhausensemble ein-
Rudolf Weber, der damalige Eigentümer schliesslich des «Neuhauses» ist auf Grund
des «Neuhauses», einen Totalumbau; vom seiner politischen, wirtschaftlichen, sozia-
Altbestand blieben nur die Aussenmauern, len und baukünstlerischen Bedeutung als
die Dachkonstruktion, die Geschossbalken- kantonales Denkmalschutzobjekt einge-
lagen und eine Wand im Keller übrig. Das stuft. Diese herausragende gesellschaft
Innere erhielt eine neue Einteilung und liche Bedeutung erforderte im Rahmen des
einen Ausbau in spätklassizistischem Stil. Restaurierungsvorhabens die Beachtung
Seit dieser radikalen Umgestaltung hebt einer Reihe von planerischen und bauli-
sich das «Neuhaus» von den übrigen mit- chen Besonderheiten.
telalterlich und frühneuzeitlich geprägten
Gebäuden des Ritterhausensembles optisch Einen wichtigen Grundstein für die erfolg-
ab. Nicht nur die Bausubstanz des 16. und reiche Umsetzung der Restaurierung legte
frühen 17. Jahrhunderts, sondern auch der die Familie Amstutz schon zu Beginn. Sie
gut erhaltene, qualitätsvolle Ausbau der beauftragte das im Umgang mit histori-
1850er Jahre machen es zu einem wichti- scher Bausubstanz erfahrene Architektur-
gen Geschichtszeugen. büro Moos Giuliani Herrmann. Die AuswahlDas «Neuhaus» (Anbau links mit grünen
Fensterläden) nach der Renovation vom
Hof des Ritterhauses aus gesehen
nen «Leitsätze zur Denkmalpflege in der
Schweiz». Sie bilden die Grundlage für die
verschiedenen Entscheidungen, welche
im Planungsverlauf getroffen werden
mussten.
Im Folgenden soll eine Auswahl der wich-
tigsten denkmalpflegerischen Grundsätze
im Zusammenspiel mit den jeweiligen
Restaurierungsarbeiten im «Neuhaus»
dargelegt werden.
Substanzerhalt
Ein zentraler Grundsatz ist der Erhalt der
historischen Substanz eines Denkmals. Von
eines in denkmalpflegerischen Bereichen diesem hängt die sogenannte Authentizi-
erfahrenen Büros ist für eine gelingende tät eines Objektes ab. Je mehr historische
Restaurierung von zentraler Bedeutung. Gebäudeteile und -oberflächen mit all
ihren Zeitspuren erhalten bleiben, desto
Unter enger Begleitung durch die Kantonale besser sind die Voraussetzungen, dass heu-
Denkmalpflege wurde gemeinsam sehr tige, aber auch spätere Generationen die 17
früh begonnen, einen Abwägungsprozess Vielschichtigkeit des Baudenkmals erken-
zwischen den unterschiedlichen Ansprü- nen und interpretieren können.2
chen einer zeitgemässen Wohnnutzung,
den Auflagen von Baubewilligungsbehör- Daraus resultiert die Forderung, dass die
den und den denkmalpflegerischen Anfor- Unversehrtheit der historischen Substanz,
derungen durchzuführen. sprich der möglichst weitgehende Erhalt des
überlieferten Bestandes, bei allen Mass-
Diese bei der Restaurierung des «Neuhau- nahmen im Zusammenhang Vorrang hat.
ses» angewandten denkmalpflegerischen Auch gut gemeinte Zufügungen scheinbarer
Grundsätze beziehen sich auf die von der Verbesserungen und vermeintlicher Ver-
Eidgenössischen Kommission für Denkmal- schönerungen bergen die grosse Gefahr des
pflege EKD1 im Jahre 2007 herausgegebe- Verfälschens eines Baudenkmals.3Bericht
18
Das «Neuhaus» vor der Renovation im Jahr 2008
Im Rahmen der baulichen Massnahmen die Holzböden von 1853 fast vollständig
dürfen nur materielle Veränderungen belassen. Diese zeigen ähnliche Ausfüh-
vorgenommen werden, wenn sie für das rungsdetails wie die Böden einzelner Räume
Weiterbestehen des Denkmals nachge- im Ritterhaus. An den kritischen Stellen
wiesenermassen unerlässlich sind.4 Dazu wurden sie handwerklich ergänzt und zum
können auch auf das Denkmal abgestimmte Schluss gesamthaft schonend aufgearbei-
Anpassungen für eine zeitgemässe Wohn- tet. Die Ergänzungen heben sich aktuell
nutzung gezählt werden. Denn nur ein in auf Grund der noch fehlenden Patina zwar
Gebrauch sich befindendes Baudenkmal etwas ab. Im Laufe der Zeit werden sich die
kann als solches erhalten werden, wobei Reparaturstellen optisch dem historischen
sich die Nutzung deutlich an diesem orien- Material annähern und ein harmonisches
tieren muss. Gesamtbild ergeben.
Dieser Grundsatz der vorrangigen Erhal- Ein ähnliches Vorgehen wurde auch der
tung der historischen Bausubstanz lässt sich Restaurierung der Holzoberflächen an
an einer Reihe von Massnahmen bei der Wänden und Decken in den westlichen
Restaurierung des «Neuhauses» verdeut- Wohnräumen zugrunde gelegt. Auch
lichen. Zum Beispiel wurden im Inneren hier wurde die historische BausubstanzDas «Neuhaus» nach der Renovation im Jahr 2017
weitestgehend erhalten und restauriert. Im ten. Bis auf wenige Ausnahmen gelang es
gesamten Haus konnten zudem fast alle den historischen Bestand zu restaurieren.
noch vorhandenen historischen Türen und Mit Hilfe eines sich am historischen Bestand
Fenster aufgearbeitet und wo notwendig und am benachbarten Ritterhaus orien-
durch neue ergänzende Elemente z. B. tierenden Farbkonzeptes gelang es, einen
Vorfenster an die aktuellen nutzungstech- stimmigen Gesamteindruck zu erzeugen. 19
nischen oder energetischen Anforderungen
angepasst werden. Reversibilität
Ein zweiter wichtiger Grundsatz der Denk-
Im Aussenbereich bestand das Restaurie- malpflege ist die Reversibilität baulicher
rungsziel darin, den Gesamteindruck des Veränderungen. Eine bauliche, restaura
«Neuhauses» im Zusammenspiel mit dem torische oder konservatorische Massnahme
benachbarten Ritterhausensemble nicht zu kann als reversibel bezeichnet werden,
verändern. Alle relevanten Bauteile und wenn sie zu einem späteren Zeitpunkt
Oberflächen, wie zum Beispiel die Dach- rückgängig gemacht werden kann, ohne
eindeckung mit Biberschwanzziegeln, der dass an der historischen Substanz eine
Fassadenputz, die Holzfensterläden, sowie Veränderung zurückbleibt. Um dieses Ziel
die historischen Aussentüren blieben erhal- zu erreichen, muss bei baulich notwendi-Bericht
biniert mit von der Dachkonstruktion
unabhängigen vertikalen und horizontalen
Dämmebenen. Zum einen bleiben auf
diese Weise grosse Teile des historisch wert-
vollen Dachstuhls von baulichen Eingriffen
unberührt und zum anderen besteht auf
Grund der gewählten Konstruktionsart die
Möglichkeit bei eventuellem Nichtgebrauch
diesen Dachausbau rückgängig zu machen.
20
Neben diesen beiden eben besprochenen
zentralen denkmalpflegerischen Grund-
sätzen beim Umgang mit Baudenkmälern
gibt es noch eine Reihe anderer wichtiger
Ansätze, welche zur Anwendung kamen.
Zu nennen wären hier beispielsweise die
Reparatur- und Pflegefähigkeit, die Doku-
mentation, die Nachsorge bzw. der konti-
Blick ins renovierte Wohnzimmer nuierliche Unterhalt und die Nachhaltigkeit
der baulichen Massnahmen.
gen Veränderungen auf additive Massnah-
men zurückgegriffen werden. An diesem Die Restaurierung des «Neuhauses» konnte
Grundsatz ist trotz des Wissens um das im Sommer 2017 abgeschlossen und das nun
Nichterreichen einer absoluten Reversibili- in altem neuem Glanz erstrahlende Haus der
tät dennoch festzuhalten.5 Familie Amstutz übergeben werden. Aktuell
in Planung ist noch die Umgebungsgestal-
Als Beispiel für die Umsetzung dieses denk- tung, welche im Rahmen einer Gesamtstudie
malpflegerischen Ansatzes können die not- in enger Zusammenarbeit mit den angren-
wendigen Einbauten im östlichen Gebäude- zenden Eigentümern und der Kantonalen
teil für Bäder und die damit verbundenen Denkmalpflege durchgeführt wird.
Installationen erwähnt werden. Mit Hilfe
von reversiblen Trockenbaukonstruktionen Anmerkungen
konnten Raumteilungen und Installa 1
https://www.bak.admin.ch/bak/de/home/
tionsstränge erstellt werden. Als ebenfalls kulturerbe/heimatschutz-und-denkmalpflege/
reversible Intervention am Baudenkmal expertise/eidgenoessische-kommission-fuer-denk-
kann der Ausbau des ursprünglich nur peri- malpflege--ekd-.html
2
Wie Anm. 1, S. 13
pher genutzten Dachgeschosses bezeichnet 3
Wie Anm. 1, S. 22
werden. Eine auf ein Minimum reduzierte 4
Wie Anm. 1, S. 21
Zwischensparrendämmung wurde kom- 5
Wie Anm. 1, S. 2221 oben: Das Treppenhaus vor der Renovation unten: Das Treppenhaus nach der Renovation
Betriebsleitung
Monika Isenring Wild
Neue Betriebsleitung
Nach meiner dreijährigen Ausbildung im in ein neues spannendes Gebiet brachte.
Detailhandel arbeitete ich knapp neun Eine Neuorientierung der Agentur moti-
Jahre bei den Verkehrsbetrieben Zürichsee vierte mich, nach 14 lehrreichen Jahren,
und Oberland. In der ersten Zeit lernte ich eine neue Stelle im Bereich Personal
den lebhaften Betrieb im Sekretariat und anzunehmen. Als Personalverantwortliche
am Empfang kennen und konnte meine eines Alters- und Pflegeheims konnte ich
organisatorischen Fähigkeiten bestens während rund zwei Jahren entsprechende
unter Beweis stellen. Durch meinen Vor- Erfahrungen sammeln.
gesetzten schnupperte ich Luft in der Ab-
22 teilung Marketing, was mich sehr schnell Geboren wurde ich 1971 in Uster und
faszinierte. Zu meinem Glück schufen erlebte meine Kindheit in der schönen
sie dort eine neue Stelle für eine Marke- Oberländer Gemeinde Seegräben, wo
tingassistentin, welche ich übernehmen meine Eltern noch heute wohnen.
konnte und mich veranlasste, die Ausbil- Mit meinem Mann, einem gebürtigen
dung zur Marketingplanerin in Angriff zu Buebiker, lebe ich nun seit 14 Jahren in
nehmen. seinem Elternhaus in einer Aussenwacht
von Bubikon. Durch die Geburt unserer
Nach der Ausbildung war mein Ziel, Kinder und deren Schuleintritt lernte
Erfahrung in verschiedenen Agenturen ich die Gemeinde Bubikon immer besser
zu sammeln. Nach Dübendorf und Uster kennen und schätzen und fühle mich sehr
verschlug es mich sogar für ein Jahr nach wohl. Durch verschiedene ehrenamtliche
Bern. Nach diesem geografischen Abste- Tätigkeiten in der Schule und in Vereinen
cher landete ich in Stäfa in einer namhaf- bin ich gut vernetzt im Dorf und freue
ten Gestaltungsagentur, wo ich mehrere mich über die vielen spannenden Kontakte.
Jahre die Drehscheibenfunktion innehatte
bzw. als Projektmanagerin tätig war. Die Neben der Arbeit im Büro pflegte ich wäh-
Produktion eines hochwertigen Kunden- rend all der Jahre mein zweites Standbein:
magazins in Print- oder Online-Form ist Tanz und Bewegung. Kurz nach meiner
äusserst abwechslungsreich und verlangt Lehre absolvierte ich eine Ausbildung als
Organisation, Übersicht, Interesse an Gymnastiklehrerin, unterrichtete Aerobic
neuen Themen, Kompromissbereitschaft, und Tanz, engagierte mich im Jugend und
Einfühlungsvermögen und teilweise auch Sport-Bereich Turnen, bildete Leiterinnen
Hartnäckigkeit. und Leiter aus und war selbst eine aktive
Turnerin und Wettkämpferin. Die Lehr-
Nach der Geburt meiner beiden Kinder gänge zur Bewegungspädagogin nach
verringerte ich das Arbeitspensum und Franklin und zur Choreografin STV runden
übernahm nur noch kleinere, weniger meinen sportlichen Werdegang ab. Noch
zeitkritische Projekte, dafür aber mehr heute zählen Tanz und Bewegung zu mei-
und mehr die Personalaufgaben, was mich nen liebsten Freizeitbeschäftigungen.Seit dem 1. November 2017 bin ich als
Betriebsleiterin im Ritterhaus in Bubikon
angestellt und freue mich sehr auf die
neue Herausforderung. Ich schätze es
sehr, in meinem Wohnort eine span-
nende, kulturelle Tätigkeit bekommen
zu haben und möchte mich mit vollem
Engagement dafür einsetzen, den
attraktiven Ort weiter zu entwickeln.
Monika Isenring Wild
23Nachruf
Richard Vogel
Nachruf auf unser
Ehrenmitglied Tom Vogel
Thomas Vogel wurde am 2. Mai 1922 in Benefiziar er war. Die Waffensammlung
Walton Surrey, Grossbritannien, g eboren. wurde von Oberstleutnant Johann Jakob
Als er fünf Jahre alt war, kehrte seine Vogel Mitte des 19. Jahrhunderts zusam-
Familie in die Schweiz zurück, wo er das mengetragen und 1861 testamentarisch
Gymnasium in Zürich absolvierte. Sein als Fideikommiss dem Zweig der Familie
Studium an der Eidgenössischen Tech Vogel zum Schwarzen Horn hinterlassen.
nischen Hochschule Zürich schloss er Die Waffen wurden zuerst bis 1873 in
erfolgreich als Maschineningenieur ab. Zürich im Haus «Zum Schwarzen Horn» und
anderen Liegenschaften der Familie Vogel
24 Danach arbeitete er für einige Jahre in den ausgestellt, dann bis 1912 im Waffensaal
Vereinigten Staaten, bevor er sich in Genf des Zeughauses Zürich im heutigen Kaser-
niederliess. nenareal gezeigt. Von dort gelangten sie
ins Landesmuseum, bis sie 1947 von Oberst
Während seiner beruflichen Karriere hatte Richard Vogel ins Ritterhaus Bubikon ver-
er verschiedene Führungspositionen in bracht wurden, wo sie das neu eingerichtete
schweizerischen und internationalen Indus- Museum bereicherten. In den neunziger
triegesellschaften sowie internationalen Jahren erarbeitete Tom Vogel zusammen
Banken inne. mit Jürg A. Meier ein neues Ausstellungs-
konzept für die Waffensammlung. Sie wurde
Als Majoratsherr der Familie Vogel küm- 1999 von ihrem ursprünglichen Ausstel-
merte er sich von 1960 bis 2017 mit grosser lungsort im Bruderhaus in neue Vitrinen
Sorgfalt und viel Enthusiasmus um die in der Schütte unterhalb des Rittersaals
Waffensammlung Vogel, deren fünfter überführt. Diese Ausstellung, welche Tom
Vogel selbst finanzierte, kann heute noch
im Ritterhaus besichtigt werden.
Die Ritterhausgesellschaft Bubikon verlieh
Tom Vogel 2012 anlässlich des 150jährigen
Jubiläums der Waffensammlung Vogel
und aus Dankbarkeit für die langjährige
gute Zusammenarbeit und die grosszügige
finanzielle Unterstützung die Ehrenmit-
gliedschaft.
Tom Vogel verstarb am 23. Juni 2017 in
Genf. Er wird überlebt von Suzanne, die
während 60 Jahren seine Frau war, und
Ausstellung der Waffensammlung im seinen beiden Kindern, Christine und
Bruderhaus von 1947 bis 1999 Richard.Jahresbericht
Vorstand der Ritterhausgesellschaft Bubikon
Jahresbericht
des Vorstandes 2017
Die Beko-Mitglieder vor dem Schloss Wildegg, v.l.n.r.: Robert Hotz, Marco Zanoli, Beat Frey,
Irmgard Stutz, Annemarie Burkard, Dölf Burkard, Daniela Tracht
Das Jahr 2017 war für den Vorstand und senden dem spannenden Vortrag von
vor allem für die Betriebskommission Herrn Thomas Muff zum Thema «Entste-
einmal mehr eine sehr arbeitsintensi- hung der Glocken und Grossuhren». Zum
ve Zeit. Die laufenden Projekte (zweite Abschluss der Versammlung trafen sich die 25
Sanierungsetappe, Museumsneugestal- Mitglieder zum Apéro. Das Protokoll der
tung, Bürobereitstellung im Sennhaus) Hauptversammlung kann in vollem Wort-
wurden weiterbearbeitet bzw. vollendet laut im vorliegenden Jahrheft nachgelesen
und sind im Museumsbericht von Daniela werden. Als Höhepunkt der Saison 2017
Tracht in diesem Jahrheft beschrieben. kann die Sonderausstellung «Bim, Bam,
Wumm – Glockengeschichte(n)» mit ihren
Die 81. ordentliche Hauptversammlung Begleitanlässen verbucht werden.
der Ritterhausgesellschaft wurde am
24. Juni 2017 durchgeführt. Anwesend Nach dem Tag der offenen Tür spielte das
waren 61 Mitglieder, 34 Mitglieder hatten «Theater im Hof» das Stück «de Schacher
sich entschuldigt. Im Anschluss an die Sepp». Die Aufführungen fanden grosses In-
Hauptversammlung lauschten die Anwe- teresse, es reichte zu einem Besucherrekord.Jahresbericht
Nach den Sommerferien folgte das beliebte
Jazzkonzert mit der Bogalusa New Orleans
Jazzband. Bei sonnigem Wetter genossen
rund 160 Besucher einen schönen Abend
vor den alten Mauern im Hof.
Im Laufe des Sommers durften wir auch
unsere neuen Nachbarn im Neuhaus be
grüssen. Wir wünschen der Familie Amstutz
26 alles Gute in ihrem neuen Zuhause.
Im November fand die letzte Kunsthand-
werker-Ausstellung im Ritterhaus statt.
Dies aufgrund der geplanten Restaurie-
rungsarbeiten und der Museumsneu
gestaltung. Die Arbeiten werden sich über
mehrere Jahre hinziehen und es ist nicht
absehbar, welche Räume zu welcher Zeit
benutzt werden können. Der Vorstand der Ritterhausgesellschaft traf
sich an zwei Sitzungen für wegweisende
Anfangs Dezember wurde der Wienachts Entscheide wie Museumskonzept und die
märt aufgebaut und am zweiten Advents- neue Betriebsorganisation. Die Hauptar-
sonntag zum siebzehnten Mal durchge- beit wurde durch die Betriebskommission
führt. Aufgrund des garstigen Wetters an neun Sitzungen geleistet. Neben den
mit Schnee und Regen hielt sich der vielfältigen Tätigkeiten im reich befrachte-
Besucherandrang diesmal in Grenzen. An ten Berichtsjahr arbeiteten wir am Projekt
64 Ständen wurden vielfältige Geschenke Perspektivenwechsel und an der Umsetzung
zum Verkauf angeboten und reichhaltige der anstehenden und bewilligten Gebäude
Verpflegungsmöglichkeiten sorgten für sanierung weiter. Dies in enger Zusammen-
das leibliche Wohl. Die Tambouren vom arbeit mit der Denkmalpflege des Kantons
Musikverein Bubikon sowie die flausenkids Zürich und weiteren involvierten Behörden.
und der Chor Wolfhausen begeisterten
die Besucher mit ihren Vorträgen. Der Als weiterer Schwerpunkt wurde das
Samichlaus war ebenso vor Ort und Reorganisationsprojekt «RHG 2018»
erfreute die Kinder mit Samichlaussäckli. weiterbearbeitet und wird nun sukzessive
Gross und Klein genossen die Fahrten umgesetzt. Bis Mitte 2018 wird der Betrieb
mit der Wolfhuuser Bahn. des Ritterhauses professionalisiert und eine
Reduktion der ehrenamtlich geleisteten
Stunden erreicht sein.In diesem Zusammenhang wurde eine Am 23. Juni verstarb unser Ehrenmitglied Betriebsleitungsstelle geschaffen und Tom Vogel, Benefiziar der im Museum öffentlich ausgeschrieben. Darauf gingen ausgestellten Waffensammlung Vogel. 79 Bewerbungen aus der Schweiz, Deutsch- Trotz dieses traurigen Ereignisses musste land und Österreich ein. Die Findungskom- die Ritterhausgesellschaft im Herbst den mission unter der Leitung des Präsidenten Leihvertrag für die Waffensammlung im wählte in einem mehrstufigen Verfahren Hinblick auf die Museumsneugestaltung Monika Isenring Wild, wohnhaft in Bubi- vorsorglich per Ende 2017 kündigen, um kon, als Betriebsleiterin, die per 1. Novem- sich diesbezüglich alle Möglichkeiten offen ber 2017 mit einem 50 %-Pensum ange- zu halten. stellt werden konnte. Wir heissen Monika Isenring Wild herzlich willkommen und wünschen ihr einen guten Start in unserem Ritterhaus. Zusammen mit der Museums- leiterin Daniela Tracht haben wir nun eine kompetente Führungscrew vor Ort. Unsere IT-Infrastruktur wurde den neuen Be- dürfnissen angepasst. Unser Personal sowie die Beko-Mitglieder arbeiten nun auf einer Cloud-Plattform zwecks einfacherer und ver- besserter Zusammenarbeitsmöglichkeiten, Datenspeicherung und -synchronisierung. Im Zusammenhang mit der Museumsneuge- staltung besuchten einige Beko-Mitglieder am 16. September den Legionärspfad Vindo- nissa und das Schloss Wildegg. Diese beiden Orte wurden durch die Firma ImRaum in musealen Angelegenheiten beraten. ImRaum begleitet auch die Ritterhausgesell- schaft bei der Museumsneugestaltung. Am 4. November besuchten die Beko- Mitglieder die Turmuhrenfabrik Muff in Triengen. Dabei konnte jeder Teilnehmer seine eigene Fonduegabel schmieden, welche sogleich beim nachfolgenden Beim Schmieden der Fonduegabel zeigen die Fondueessen zum Einsatz kam. Beko-Mitglieder Karl Wyss und …
Jahresbericht
Dank vieler mehrheitlich unentgeltlich
geleisteter Stunden ist es uns möglich,
unser Haus zu einem Treffpunkt für die
Gemeinde, die Region und weit darüber
hinaus bekannt zu machen. Während
der Saison 2017 durften wir wieder für
rund 30’000 Besucher Gastgeber sein. Die
schönen Räume des Ritterhauses boten
bis Ende Dezember 2017 wiederum einen
28 besonderen Rahmen für folgende Anlässe:
28 Ziviltrauungen
11 Kirchliche Trauungen
3 Taufen
100 Führungen
15 Familien- und Firmenanlässe
8 Konzerte
2 Gottesdienste
43 Verschiedene Anlässe
12 Anlässe der Ritterhausgesellschaft
Total fanden 222 Anlässe statt.
Mit Stolz und Freude blicken wir zurück … Irmgard Stutz vollen Einsatz
auf die Saison 2017, die zahllose Begeg-
nungen und viele schöne Erlebnisse mit wird die Sonderausstellung «Chruut und
Besuchern, Helfern und Mitarbeitern mit Lüüt» eröffnet. Im Weiteren werden über
sich brachte. Wir sind dankbar für die das ganze Jahr Renovationsarbeiten im
Unterstützung, die wir immer wieder und am Ritterhaus durchgeführt, die trotz
erleben durften. Ohne diese Hilfe und das aller Rücksichtnahme hie und da zu Ein-
Wissen, dass wir durch unsere Mitglieder, schränkungen beim Besuch führen können.
die Behörden und Unternehmer unter- Ob ein Besuch im Museum oder ein gesell-
stützt werden, könnten wir unsere Arbeit schaftlicher Anlass in unseren Räumen –
nicht in dieser Form leisten. kommen Sie ins Ritterhaus Bubikon und
geniessen Sie einige erholsame Stunden.
Ein Ausblick Alle Beteiligten freuen sich auf die neue
Wir freuen uns, Ihnen auch im Jahr 2018 Museumssaison und darauf, Ihnen im
ein spannendes und vielfältiges Programm einzigartigen Ritterhaus bei einem unserer
im Ritterhaus zu bieten. Am 3. Juni 2018 vielfältigen Anlässe zu begegnen.Museumsbericht
Daniela Tracht
Das Museum im Ritterhaus Bubikon
während der Saison 2017
Die Museumssaison 2017 stand ganz im Form von Alarm-, Schulglocken oder ande-
Zeichen der Glocken. Nachdem uns der April ren Glockensignalen längst Bestandteil des
mit spannenden Wetterwechseln einen küh- täglichen Lebens geworden.
len Saisonauftakt beschert hatte, war vom
30. April bis zum 24. September im Museum Begleitet wurde die Ausstellung durch ein
die Sonderausstellung «Bim, Bam, Wumm – abwechslungsreiches Veranstaltungspro-
Glockengeschichte(n)» zu sehen. Die Aus- gramm. Insbesondere das Glockengiessen,
stellung griff ein aktuelles Thema auf, da das zwischen Mai und Juli vorgeführt wur-
fast täglich von Streitigkeiten um Glocken- de, fand rege Beteiligung. An drei Daten
klänge in den Medien zu lesen ist. Solche präsentierte die Schmiedin Christa Keller
Beiträge zeigen, dass das Bewusstsein um den Guss von Bronze zur Glocke im Hof
die historische Bedeutung der Glocke und des Ritterhauses. Alle drei Anlässe wurden
ihrer Aufgaben zunehmend verloren geht. von 60–80 Gästen besucht, die gespannt
Deshalb informierte die Ausstellung im das Geschehen verfolgten und interessiert
Ritterhaus über die kulturelle Bedeutung Fragen stellten. Öffentliche Führungen
der Glocke, über ihre Geschichte und ihre durch die Sonderausstellung ergänzten an
Funktion, denn in Europa ist die Glocke in diesen Tagen den Besuch im Ritterhaus.
29
Die Schmiedin Christa Keller beim Vorbereiten des BronzegussesMuseumsbericht
In den Freitagskinos vom 18. und 25. August Nur die öffentlichen Familienführungen,
sowie 1. September wurde der Film «Schel- die jeweils am ersten Mittwoch eines
lenursli» in der Kapelle des Ritterhauses Monats angeboten wurden, stiessen leider
Bubikon gezeigt. Die Besucheranzahl reichte auf deutlich weniger Resonanz als in
von 55 bis 23 Personen. Am 8. Juli und den Jahren zuvor. Deshalb planen wir,
23. September fanden Konzerte zum Thema diese in der kommenden Saison zu redu-
«Glocken und Klaviermusik» statt, die als zieren und nur noch alle zwei Monate
Anlässe der Musikschule Zürcher Oberland anzubieten.
Schülerinnen und Schülern die Gelegenheit
30 gaben, ihr Können zu zeigen. Beide Kon- Auch in dieser Saison hat Katharina Kom-
zerte wurden durch Lesungen des Zürcher patscher öffentliche Führungen durch den
Autors Kaspar Schnetzler, der aus seinem Kräutergarten als dreiteiligen Zyklus ange-
Roman «Glocken und Kanonen» vorlas, boten und dadurch einen tiefen Einblick in
begleitet. Einen Höhepunkt bildete die Ein- die Welt der Kräuter und Gewürze sowie
bettung des Themas «Glockengeschichte(n)» der Naturmedizin gewährt. Die positive
in den Internationalen Denkmaltag. Unter Resonanz freut uns sehr.
dem Motto «Macht & Pracht» wurde in
Zusammenarbeit mit den Kulturdetektiven Insgesamt blicken wir auf eine erfolgreiche
(www.kulturdetektive.ch) erörtert, welche Saison zurück, die zahlreiche neue Besu-
Bedeutungen Glocken haben und wo und cher in das historische Ritterhaus geführt
wie sie als Machtsymbole Ausdruck fanden hat. 5109 Besucher konnten wir in der
und finden. An beiden Führungen nahmen Saison 2017 im Museum zählen. Obwohl
25 Besucher teil. Zum Abschluss der Ausstel- dies eine vergleichsweise geringe Zahl ist,
lung fand das Konzert «Carillon, Orgel und haben wir 100 Gruppen durch Haus und
Glocken» in der Pfarrkirche Tann statt. Dort Garten geführt. Um die Zahl der Individual
spielten und improvisierten die Organisten besucher zu verbessern, planen wir, die
Esther und Martin Hobi gemeinsam mit dem Kommunikation anzupassen.
Percussionisten Ueli Kläsi vor einem begeis-
terten Publikum, das mehrfach Zugaben Dank des ehrenamtlich arbeitenden
wünschte. Eine Übersicht über die Medien- Gartenteams präsentierte sich der Garten
resonanz zur Ausstellung ist auf unserer stets vorbildlich gepflegt. Die Arbeiten im
Website unter http://www.ritterhaus.ch/de/ Garten begannen Ende März 2017 und
medienmitteilungen.php zu finden. zur Museumseröffnung am 1. April war
er bereit für die ersten Besucher. Nach
Neben der Sonderausstellung wurden auch den Eisheiligen Mitte Mai wurden noch
das Ritterhaus und seine Dauerausstellung die frostempfindlichen Pflanzen gesetzt.
von vielen Gästen besucht und die ange- Wegen des warmen Frühsommerwetters
botenen öffentlichen Führungen durch das und der heissen Sommertage verlangten
Ritterhaus rege genutzt. die Kräuter viel Wasser und das Garten-team musste häufig giessen. Insgesamt hat das 7-köpfige Gartenteam 285 Stunden im Garten gearbeitet. Seit den ersten Planungen des Gartens im Jahr 2009 war Annemarie Burkard in Werden und Leben des Gartens involviert. Sie half bei der Entwicklung des Projekts, bei Aufbau und Anpflanzung und über- nahm dann die Leitung des ehrenamtlichen Gartenteams. In den letzten sieben Jahren hat sie zuverlässig und umsichtig das Team geleitet und gleichzeitig selber aktiv mitge- arbeitet. Leider hat Annemarie Burkard auf Saisonende 2017 ihre Tätigkeit eingestellt, um zukünftig anderen Freizeitaktivitäten nachzugehen. Wir bedauern dies sehr. Vorausschauend hat sie bereits in der Saison 2017 Susan Mullarkey als Nachfolgerin ein- gearbeitet. Susan Mullarkey arbeitet bereits seit 2015 im Gartenteam mit und freut sich, diese Aufgabe übernehmen und weiter führen zu können. Leider hat mit Annemarie Burkard auch Jörg Hasler seine Arbeit im Gartenteam beendet. Wir danken auch ihm für seine 31 5-jährige Tätigkeit und wünschen ihm für die Zukunft alles Gute. Wir freuen uns, dass wir bereits zwei neue Helferinnen für den Garten finden konnten, die ab der Saison 2018 aktiv sein werden. Den jährlich stattfindenden «Tag der offenen Tür» eröffnete am Sonntag, den 25. Juni, der Musikverein Bubikon im Hof des Ritterhauses. Der anschliessende traditionelle Ländlersunntig konnte eben- Der anlässlich der Wechselausstellung im Hof falls wieder im Freien durchgeführt werden des Ritterhauses aufgestellte Glockenturm
Museumsbericht
und obwohl der Himmel den ganzen
Tag bedeckt blieb, genossen zahlreiche
Besucher diesen Tag in guter und fröhlicher
Stimmung.
Als das Museum am 31. Oktober seine
Türen für diese Saison schloss, herrschten
bereits herbstliche Bedingungen und die
Temperaturen im Inneren des Hauses luden
32 nicht mehr zum längeren Verweilen ein.
Neben den laufenden musealen Angebo-
ten wurden bereits Vorbereitungen für die
Ausstellung «Chruut & Lüüt» getroffen. In
dieser Ausstellung soll in der Saison 2018
die Thematik des Epochen-Kräutergartens
vertieft und anschaulich präsentiert wer-
den. Damit wir mit möglichst viel eigenem
Material arbeiten können, wurden bereits
Pflanzen für ein Herbarium gepresst und
getrocknet sowie fotografiert. Die Eröff-
nung der Ausstellung findet am Sonntag,
den 3. Juni 2018, statt.
Auch die Arbeit im Museumsarchiv wurde genannten Kernthemen – Geschichte der
weitergeführt. Schwerpunkte bildeten die Ritterorden und des Hauses – fokussiert
Kontrolle und Ergänzung der Aufnahme werden. Dabei wird auch eine inhaltliche
sowohl der eigenen Bestände als auch Überarbeitung stattfinden, sowie das
der im Museum ausgestellten Leihgaben Raumkonzept angepasst werden. Die Ziele
und Deposita. Einen ausführlichen Bericht der Neugestaltung sind das R itterhaus als
über diese Arbeiten hat Sascha Wisniewski kulturellen Ausflugsort zu stärken, das
geschrieben, der seit 2015 an diesen Aufga- Besuchererlebnis zu steigern und die Be-
ben im Ritterhaus mitarbeitet. Der Bericht deutung des Ritterhauses als die am besten
ist auf Seite 36 zu finden. erhaltene Kommende des Johanniterordens
in Europa sichtbar zu machen.
Ausserdem wurden die Pläne der Museums-
neugestaltung weiterverfolgt. Im Rahmen Auf betrieblicher Seite soll eine geänderte
einer Neugestaltung des Museums soll die Raumstruktur die Möglichkeit geben, geeig-
Ausstellung wieder auf die in den Statuten nete Depot- und Lagerräume für Museums-Blick in die Ausstellung
«Bim, Bam, Wumm –
Glockengeschichte(n)»
vergangenen Jahren beheben. Auch soll
bei der Neugestaltung die Barrierefreiheit,
die bislang nur im Epochen-Kräutergarten
erfüllt ist, berücksichtigt werden, um auch
Menschen mit Einschränkungen den Besuch
des Museums – oder mindestens eines
Teiles davon – zu ermöglichen. Detaillierter
soll das neue Konzept an der Hauptver-
sammlung der Ritterhausgesellschaft Bubi-
kon am 16. Juni 2018 vorgestellt werden.
Neben den musealen Aspekten müssen
auch betriebliche Abläufe optimiert
werden. Uns ist bewusst, dass die vielen
Treppen, Stufen und Schwellen des Hauses
für Besucher und auch für Dienstleister,
wie z. B. Caterer, ein Hindernis darstellen.
Deshalb wird neben der Barrierefreiheit
gut und -mobiliar bereitzustellen. Bislang im Museumsbereich auch die Vereinfa-
zeigt sich aufgrund des feuchten Klimas chung der Transportwege angestrebt. Das
im Haus eine ausserordentlich unbefriedi- bedeutet, dass Depot- und Lagerräume 33
gende Situation. Zu unseren Plänen und für Mobiliar und Material für den Betrieb
Projektierungen kommen aber gesetzliche (Bänke, Tische etc.) möglichst ebenerdig
Auflagen und Vorgaben, die erfüllt werden oder leichter erreichbar anzulegen sind.
müssen, um den sicheren Betrieb des Hauses Ferner würde ein Aufzug/Lift den Trans-
weiterhin zu gewährleisten. port von Menschen und Waren deutlich
erleichtern. Wo und ob dieser im Gebäude
Einerseits sind dies Brandschutzvorgaben. integriert werden kann, ohne historisches
Seit 2012 besteht eine Mängelliste, die Baumaterial zu zerstören, wird von Archi-
im Wesentlichen Ausgänge, Flucht- und tekten geprüft und abschliessend von einer
Rettungswege sowie Brandabschnitte und Jury, in der sowohl die Kantonale Denkmal-
Fluchtwegbeleuchtung zum Inhalt hat. pflege als auch die Ritterhausgesellschaft
Andere Mängel konnten wir bereits in den (RHG) vertreten sind, bestimmt.Museumsbericht
Die gesamte Projektarbeit wird eng mit für Elektro, EDV und Telefonanlage mit
der Kantonalen Denkmalpflege und den neuen Boden-, Wand- und Deckenverklei-
weiteren involvierten Behörden (Gebäu- dungen eingebaut. Darüber hinaus wurden
deversicherung, ARE, Gemeinde Bubikon) die Wand- und Deckentäfer repariert.
geplant, damit die diversen Anforderun- Die im Laufe der Zeit stark beanspruch-
gen Berücksichtigung finden. Ferner hat ten Holzböden wurden in allen Räumen
die RHG mit der Kantonalen Denkmal- repariert und gepflegt. Ferner wurden
pflege eine gemeinsame Projektstruktur sämtliche verputzte Wände gereinigt und
entwickelt, um die verschiedenen kon- neu gestrichen. Nachdem in allen Räumen
34 zeptionellen Massnahmen, die mit der Sockelkanäle für die Elektro, EDV- und
Neugestaltung des Museums und auch den Telefonanlagen installiert waren und die
laufenden Sanierungsarbeiten in engem Leitungszuführung vom Haupthaus in den
Zusammenhang stehen, zu koordinieren. neuen Technikraum des Gesindehauses
In diesem Rahmen wurde im Juni 2017 ein erfolgt war, konnten nach dem Wienachts-
umfassendes Bauaufmass des Ritterhauses märt vom 2. Advent die Arbeitsplätze der
durch Studierende der Hochschule Mün- Museums-, Betriebsleitung und für den
chen vorgenommen, dessen Ergebnisse Hauswart, Vermietungsbüro und Betriebs-
letztlich als Plangrundlagen für die Umset- kommission in den neuen Büroräumen
zung des neuen Museumskonzeptes sowie eingerichtet werden. Hiermit ist ein grosser
sämtlicher notwendiger baulicher Eingriffe Schritt auf dem Weg hin zur professionelle-
dienen. ren Arbeit erfolgt.
Unabhängig von den Planungen und Parallel zu diesen Arbeiten konnte die
Überlegungen zum neuen Museumskon- zweite Etappe der Sanierungsmassnah-
zept konnten während der Saison 2017 men begonnen werden. Der erste Teil
Baumassnahmen im und um das Ritterhaus der Sanierungsarbeiten wurde bereits
realisiert werden: 2009/2010 realisiert und umfasste Natur-
stein-, Putz- und Malerarbeiten an der
Diese betrafen an erster Stelle das Gesinde hofseitigen Fassade des Ritterhauses. Nun
haus. Bislang wurde von diesem Gebäude folgen ab März 2018 weitere Arbeiten an
teil lediglich das Erdgeschoss an kleinere der Ost- und Nordseite. Als ausführender
Gruppen vermietet sowie die Küche Architekt konnte Beat Meier, Wetzikon,
genutzt. Nun wurde im Obergeschoss, gewonnen werden. Beat Meier hat bereits
nach sorgfältiger und detaillierter Planung Erfahrung im Umgang mit historischen
mit der Denkmalpflege und auf Grundla- Bauten und es freut uns, dass er gemein-
ge des aktuellen Brandschutzkonzeptes, sam mit Richard Kälin als Gebäudeverant-
das alte Badezimmer inklusiv Türvorbau wortlicher der RHG die notwendigen Sanie-
demontiert und abgebrochen. An Stelle rungs- und Restaurierungsarbeiten betreut.
des Badezimmers wurde ein Technikraum Im Rahmen dieser Bauetappe werdenSie können auch lesen