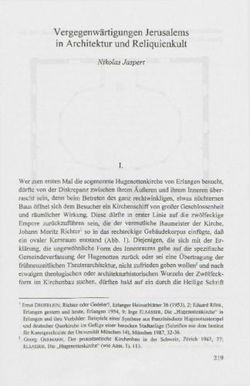Kirchen des Sports Österreichische Ballhäuser der Frühen Neuzeit als Kontaktorte von Adel, Studentenschaft und Bürgern - Universität Wien
←
→
Transkription von Seiteninhalten
Wenn Ihr Browser die Seite nicht korrekt rendert, bitte, lesen Sie den Inhalt der Seite unten
Martin Scheutz
Kirchen des Sports
Österreichische Ballhäuser der Frühen Neuzeit
als Kontaktorte von Adel, Studentenschaft und Bürgern
Der Haller Stadtarzt Hippolyt Guarinoni (1571–1654) schien 1610 vom Nutzen des
frühmodernen, vom Adel und den Studenten gleichermaßen geprägten Tennis über-
zeugt. Tennis (im Sinn von royal/real tennis) galt dem nahe Innsbruck lebenden Arzt
als das „Hauptspiel unter allen Spielen“.1 Viele Fürsten ließen „zu Erhaltung dieser
schönen und lustigen Übung / besonders gelegne und ansehenliche grosse Gebäw
führen / vnd darzu mit aller Nohtwendigkeit / auch mit darzu bestimpten vnd bey-
wohnenden Ballmeistern versehen / vnd ihre Jugend / meistens die Edle knaben son-
ders fleiß darinnen abrichten lassen“.2 Die adelige, aber auch die hier nicht erwähnte
studentische Jugend ging demnach unter der Anleitung von Ballmeistern in großen,
eigens errichteten Ballhäusern der körperlichen Ertüchtigung nach.
Eine Sportgeschichte der Frühen Neuzeit galt lange Zeit als inexistent, weil man
die sportliche Tätigkeit des frühneuzeitlichen Adels, der Bürger, der Unterschichten
oder der Studenten kaum mit dem heutigen fordistischen Modell von individuel-
ler Leistung in einer bestimmten Zeit unter bestimmten Regeln in Zusammenhang
brachte. Nach einem Vorschlag von Allen Guttmann definiert sich der moderne,
ab 1850 anzusetzende Sport durch Verweltlichung, durch Chancengleichheit im
Wettkampf und dessen Bedingungen, durch Rollenspezialisierung der Funktionen,
durch Rationalisierung, durch bürokratische Organisation und durch die stän-
dige Jagd nach Rekorden.3 Viele dieser von Guttmann angeführten Aspekte lassen
sich aber schon, ohne frühneuzeitliche Quellen in ihrem Aussagewert zu sehr zu
strapazieren, auf sportliche Praktiken ab dem 16. Jahrhundert anwenden.4 So fun-
gierte beispielsweise der als Ahnherr des „real tennis“ geltende Antonio Scaino
(1524–1612) in den 1550er Jahren als Schiedsrichter bei einem Ballspiel unter Teil-
nahme des Herzogs von Ferrara. Scaino musste bei diesem Tennismatch auch Ent-
scheidungen gegen seinen „Herrn“ fällen, was nach Reklamationen unter anderem
1
Guarinoni, Die Grewel, 1208; dazu auch Mallinckrodt (Hg.), Bewegtes Leben, 354 f.
2
Guarinoni, Die Grewel, 1208 f.
3
McClelland, Einleitung, 11.
4
Siehe den breiten Überblick von Behringer, Sport, 381–399.
147Martin Scheutz
zur Verschriftlichung der Tennisregeln und damit zu einer Normierung des Spiels
führte.5
Ballhäuser, aber auch das frühneuzeitliche Ballspiel6 bzw. die frühneuzeitliche
Sportgeschichte generell, haben sich in den letzten Jahrzehnten zu einem vielschich-
tigen, interdisziplinär begangenen Forschungsfeld entwickelt, das sich vor dem Hin-
tergrund einer kulturgeschichtlichen Wende der Geschichte7 in den letzten Jahren
aus der Umklammerung älterer, hochspezialisierter Forschungskontexte wie Sport-
pädagogik,8 Spielforschung9 oder anlassbezogenen Forschungen zu den Olympi-
schen Spielen10 lösen konnte. Die Existenz einer vormodernen kulturgeschichtlich
interpretierten Sportgeschichte – poppig mit dem Label „Frühneuzeitliche Sport
geschichte 2.0“ apostrophiert – wurde lange angesichts „einer archaisch-gewaltsamen
oder aber rituell geprägten Bewegungskultur“11 der Frühen Neuzeit ignoriert und
verstellte den Blick auf eine vormoderne Sportkultur, die schon am Beginn der Neu-
zeit durch Wettkampf, Chancengleichheit bei der sportlichen Auseinandersetzung,
Organisation des Sportes durch Regeln oder etwa Quantifizierung geprägt war.
Mit Blick auf die Raumforschung wurde lange das Fehlen von monofunktionalen
Sportstätten als Beweis für die Nichtexistenz von Sportpraktiken angeführt, doch
belegen die multifunktionalen Ballhäuser, Fechthallen, Reitschulen, Schießstätten
vor den Stadtgräben gerade das Gegenteil des Arguments und unterstreichen die
beginnende Institutionalisierung des Sportgeschehens in der Frühen Neuzeit.12
Gleichzeitig erscheint der frühneuzeitliche Sport auch als Teil der internationa-
len Wirtschaftsgeschichte: So lassen sich beispielsweise professionelle Tennisspie-
ler vom 16. bis 18. Jahrhundert in England und Frankreich nachweisen,13 ein ela-
borierter Markt für Sportartikel entstand; lukrative Bauaufgaben für Architekten14
sind mit elaborierten Sportpraktiken und gewandelten „Freiräumen“15 der Frühen
Neuzeit verbunden. Erste Anzeichen des Heldenkultes um Tennisspieler bzw. Pau-
miers waren etwa die Porzellanfiguren oder die Fayence-Teller der Manufaktur von
Nevers/Frankreich.16 Aber auch eine neue Wissensgeschichte ist mit Sportpraktiken
5
McClelland, Einleitung, 14.
6
Behringer, Ballspiel, 700–702; Mallinckrodt, Tennis, 363–366.
7
Etwa deutlich an der Verbrennung des königlichen „Book of Sports“ durch Puritaner 1618 Behringer,
Kulturgeschichte des Sports, 11–13.
8
Streib, Geschichte.
9
Bauer, Ballhaus [1994]; Bauer, Hofballhaus [1996].
10
Mehl, Prager und Wiener Erinnerungen.
11
Mallinckrodt, Frühneuzeitliche Sportgeschichte, 117.
12
Behringer, Sport, 387–390.
13
Schattner, Putting Sports in Place, 80; Gillmeister, Topspin, 215 f.
14
Zur Bedeutung der „Ballhäuser“ in Vergangenheit und Gegenwart Koch, Das Ballhaus.
15
Rosseaux, Freiräume.
16
Gillmeister, Topspin, 216 f.
148Kirchen des Sports
und Körperhaltungen verbunden.17 So transferierte der nur mehr in vier Exemp-
laren (Schlossbibliothek Ansbach, Erlangen-Nürnberg, Göttingen und Hannover)
erhaltene „Unterricht deß Ballen=Spiels“ des Nürnberger „Ballenmeister(s)“ Johann
Georg Bender aus dem Jahr 1680 adelig-städtisches Wissen nach Zentraleuropa. Das
erste „Tennisbuch“ in deutscher Sprache übermittelte Passagen eines Pariser Regel-
werkes von 1592 im Sinne des Kulturtransfers in den mitteleuropäischen Wissens-
raum.18
Vor allem in der Hofforschung und in der Kunstgeschichte weist die Behandlung
der Ballhäuser eine lange Tradition auf. Die „Österreichische Kunsttopographie“19 oder
etwa das auch aus der Sicht der Raumforschung innovative Hofburgprojekt20 behan-
deln diese Orte der fürstlichen Rekreation eingehend. Die Spielforschung wandte sich
dem Thema Ballspiel ebenfalls intensiv zu, Regelwerk und kunstgeschichtliche Dar-
stellung des Spiels interessierten hier besonders.21 Aus der Sicht der Stadtgeschichte
wurden die Ballhäuser bislang wenig zur Kenntnis genommen. Der Adel in der Stadt
erschien lange Zeit einerseits als Feindbild der Bürger, andererseits fungierte der Adel
sozial- und mentalitätsgeschichtlich als Vorbild für die Stadtbürger, ab dem Spät-
mittelalter stiegen die adeligen Konsumenten zu einem Massenphänomen in vielen
Städten auf.22 Aus einer konsumgeschichtlichen Perspektive mutierten viele Residenz-
städte typologisch damit vermehrt zu Konsumentenstädten. Adelige Freihäuser, Tur-
niere, adelige Luxusprodukte, aber auch Produkte des alltäglichen Lebensbedarfes
oder die Nächtigungen in Gasthäusern ließen den hohen, aber auch niederen Adel
zu einer begehrten städtischen Einkommensgruppe aufsteigen, die sowohl im städ-
tischen Handwerker- als auch im Dienstleistungssektor wichtige Impulse setzen
konnte. Auf das Ballspiel bezogen, bedeutete dies etwa die Ansiedlung von Racket-
machern – 1539 bildeten bereits die Pariser Racketmacher in Paris eine eigene
Zunft23 – in größeren Residenzstädten, die Anstellung von Ballmeistern und Mar-
queuren in der Stadt oder den Import von Luxuswaren. Die Augsburger Fugger bei-
spielsweise besorgten für die bayerischen Herzöge als qualifizierte Sportartikelhänd-
ler über ihre internationalen Faktoren in großem Umfang „Raggetten“ und die mit
17
Am Beispiel von kontrollierten Körperdrehungen und Fußstellungen, aber auch der dazugehörigen Nor-
men Kleinschmidt, Posituren.
18
Zollinger, Benders „Unterricht deß Ballen-Spiels“, 276: freie Übersetzung von L’Ordenance du Royal et
Honorable Jeu de Paume en XXIV Articles (Paris 1592); dazu auch Mallinckrodt (Hg.), Bewegtes Leben,
365.
19
Dreger, Baugeschichte; Felmayer, Innsbruck; Resch, Graz; Wied, Linz
20
Siehe die mehrbändige Kunst- und Raumgeschichte der Hofburg, die am „Institut für Kunst- und Musik
historische Forschungen“ der Österreichischen Akademie der Wissenschaft erarbeitet wurde (https://www.
oeaw.ac.at/ikm/forschung/habsburgische-repraesentation/die-wiener-hofburg/ [Zugriff: 26.4.2019]).
21
Am Beispiel des Ballone-Spiels Dolch, Das Spiel; am Beispiel von Ballspiel Bauer, Hofspielhaus.
22
Schneider, Adlige Konsumenten.
23
Bauer, Hofballhaus, 108.
149Martin Scheutz
Haar oder Wolle gestopften Bälle.24 So bestellte der dreiundzwanzigjährige Herzog
Ferdinand von Bayern am 1. April 1573 2.000 Tennisbälle und sechs Tennisschläger
aus Antwerpen, aber auch aus anderen Sportartikelverteilerzentren wie Paris, den
Niederlanden und England.25 Innerhalb eines Jahres orderten die bayerischen Her-
zöge 1573/74 nicht weniger als 11.000 Tennisbälle und 50 Rackets aus den Nieder-
landen. Dieses mühevolle Bestellen war begleitet von monatelangen Lieferfristen und
zahlreichen, von den Fuggern gegenüber den hochadeligen Bestellern vorgebrachten
Notlügen angesichts von Lieferproblemen der niederländischen Sportartikelhändler.
In einer auf den Akteur bezogenen Perspektive lässt sich das frühneuzeitliche Ballspiel
der jungen Adeligen und Studenten als eine Jugendphase (oft mit der Kavalierstour,
mit „Vergnügen und Symbolpolitik“26 verbunden), mitunter moniert von den besorg-
ten väterlichen Kommentaren mit Blickrichtung auf Spielsucht, interpretieren.27 Aber
auch den zahlreichen Zuschauern kam bei der Interpretation der Spielregeln durchaus
Bedeutung zu.28 Der bayerische Thronfolger Wilhelm V. (1548–1626) verbrachte nach
seiner Hochzeit 1568 während seiner prunkvollen Landshuter Hofhaltungsperiode
auf der Burg Trausnitz viel Zeit mit Tennisspiel. Das alte verfallene Brauhaus im äuße-
ren Schlosshof war rasch zu einem Ballhaus adaptiert, bald mussten die Sorgen der
Mutter besänftigt werden, dass der junge Herzog den sonntäglichen Gottesdienst ob
seiner Tennismanie – er spielte drei bis vier Mal pro Woche, auch auf Anraten seines
Arztes – versäumen würde, nur einmal habe der Mitzwanziger an einem Freitag und
damit an einem Fasttag Tennis gespielt.29 Der bayerische Herzog spielte auch öffentlich
bei Hofbesuchen in Graz, in Landshut und in München, wettete auf den Ausgang der
Spiele oder bezog Tennisbälle mit einer gewissen Selbstverständlichkeit aus Mailand,
Neapel und Paris.30 Die Geschichte des adeligen Sports in der Frühen Neuzeit lässt
sich konzeptionell im Spannungsverhältnis von bürgerlicher und adelig-höfischer
24
Dolch, Das Spiel, 176; zur Geschichte des „éteuf “ Mehl, Les jeux au royaume, 34–39.
25
Behringer, Fugger als Sportartikelhändler, 123 f.
26
Am Beispiel von Venedig, wo viele Kavaliere auch Zeit mit dem Ballspiel zubrachten, Weissmann, Der
verkleidete Staat, 167–174. Siehe den Beitrag von Cees de Bondt in diesem Band.
27
Am Beispiel der Kavalierstouren sächsischer Prinzen Keller, „Mein Herr befindet sich gottlob gesund
und wohl.“ 158: Johann Georg IV. Februar 1690, Venedig: „Divertirten sich ihre Durchlaucht vormittage
im ballhause“; ebd. 164: Johann Georg IV., März 1690, Florenz: „Sahen sie vormittage des Maquis Sal-
viati lusthauß und spielten in den darin befindlichen ballhause, worauff sie nach ihren quartiere kamen
und mittags speiseten“; ebd. 234: Friedrich August, Oktober 1687, Bayonne: „Ist der Herr Graff in das
ballhauß gegangen, aber ohne spielen wieder nach hauße gekehret.“; ebd. 328: Friedrich August, Oktober
1687, Paris: „Nach gehaltener taffel divertirte sich der Herr Graff mit den Printzen von Hannover in ball-
hause“; ebd. 334: Friedrich August, Oktober 1688, Paris: „Nachmittags fuhr der Herr Graff ins ballhaus,
und brachte die Printzen von Hannover mit nach hause.“
28
Streib, Geschichte, 429: Wenn ein Spieler die Entscheidung des Marqueurs anzweifelte, wurde die Mei-
nung der adeligen Zuschauer eingeholt.
29
Baader, Der bayerische Renaissancehof, 67.
30
Ebd., 69 f.
150Kirchen des Sports
Stadtnutzung verstehen, während die Bürger bei höfischen Festen als Staffage und
Zuschauer fungierten. Es zeichnete sich ab der Frühen Neuzeit ein Strukturwandel
der urbanen Freiräume31 ab. Die Formen der korporativen Handwerkerumzüge, die
bürgerlichen Schießveranstaltungen32 und das adelige Ballspiel veränderten sich all-
mählich. Eine Kommerzialisierung der Unterhaltung zeichnete sich ab, wie etwa am
Beispiel der Transformation der höfischen Feuerwerke in bürgerlich-kommerziali-
sierte Veranstaltungen deutlich wird.33 Auch die Ballspiele in den Ballhäusern wan-
delten sich ab der Mitte des 17. Jahrhunderts, indem die Studenten der Universitäten
das Ballspiel verstärkt für sich entdeckten, umgekehrt warfen die Ballhäuser für die
Betreiber kommerziell immer weniger ab – die Ballhäuser wandelten sich zu Theater-
sälen, wobei sich die bürgerlichen Wandertruppen ihr Publikum zunehmend sozial-
übergreifend eroberten. Die Theaterveranstaltungen für den Hof transformierten sich
im 18. Jahrhundert von ursprünglich exklusiven Veranstaltungen im Schloss, auch aus
Kostendruck, in Veranstaltungsformen mit bürgerlicher Mitnutzung.34
Die Quellengrundlage zu einer Geschichte der Ballhäuser, die von der Forschung
lange als ein „Vorlauf “ der jeweiligen Theatergeschichte der Stadt aufgefasst wur-
den,35 ist breit gestreut. So erweisen sich Reiseberichte36 oder Stammbücher37 als emi-
nent wichtige Quelle der sportgeschichtlichen Forschung. Ein Weimarer Gesandter
auf der Reise nach Wien zum jungen König Leopold I. berichtet 1660 anlässlich der
Durchfahrt ganz selbstverständlich von Ballhäusern als essentiellen, frühneuzeit
lichen „Stadtmöbeln“. „Vor dem Schmid-Thor [in Linz] / liegt das Ball-Hauß / und
weiter hinaus das Capuciner-Kloster mit einem schönen Garten.“38 Neben den Rei-
seberichten erscheinen Selbstzeugnisse39 von besonderer Bedeutung, weiters Akten
31
So die Kernidee von Rosseaux, Freiräume, 153–209.
32
Tlusty, Martial Ethic, 189–210; Delle Luche, Schützenfeste und Schützengesellschaften; Ders., Sportli-
ches Engagement und städtischer Wettbewerb, 369–398.
33
Scheutz, Zündende Idee.
34
Rosseaux, Freiräume, 98–112.
35
Als Beispiel Rudan, Stadttheater: „So haben die Ballhäuser in der Theatergeschichte als Vorläufer der heu-
tigen Theaterbauten ihre besondere historische und kulturelle Bedeutung.“
36
Der gantzen Welt bekandten Stadt Wienn, 167: „Der Ball-Häusern / so viel mir davon gesagt worden /
seynd viere / allwo nicht wenig des Balls Liebhaber ihre Geschicklichkeit erzeigen / in diesem spielet man
mit weissen / im anderen mit schwartzen Ballen / das Erste ist nicht weit vom Kayserl. Hoff / das Andere
bey den Himmel-Porten / das Dritte bey dem Schotten-Closter / das Vierte in dem Allbösischen Hauß
dabey den Franciscanern“; Keller, Kavalierstouren, 66: für Kopenhagen in der Sicht von Georg Friedrich
von Eulenburg 1656: „fünftens ein klein aber nett, mit schwarz und weißen Fliesen außgelegt, Ballhauß“.
37
Am Beispiel des Stammbuches des Fürsten Albrecht Ernst I. von Oettingen (1642–1683) Mallinckrodt
(Hg.), Bewegtes Leben, 225, 363; siehe das Stammbuch eines deutschsprachigen Studenten, der in Siena
oder Padua studierte, Gillmeister, Kulturgeschichte des Tennis, 144 (Abb. 57). Zu Stammbüchern von
Studierenden Kurras, Vita peregrinatio, 486 f.
38
Keller – Scheutz – Tersch, Einmal Weimar – Wien, 32; für Prag: 135.
39
So sucht etwa der inhaftierte calvinistische Christian von Anhalt um einen Besuch des Wiener Ballhauses
an, Tersch, Freudenfest, 171.
151Martin Scheutz
Abb. 1: Das erste Wiener Ballhaus, das unter Ferdinand I. in der Wiener Hofburg errichtet wurde, in
einer Rekonstruktion der Ansicht von 1564 (Copyright: Austrian Academy of Sciences; Markus Jeitler,
Herbert Karner, Jochen Martz, Paul Mitchell, Renate Leggatt-Hofer und Herbert Wittine; Visualisa-
tion: Herbert Wittine, IFOER, TU Vienna, 2015).
der Hofverwaltung,40 so beschwerte sich in den 1660er Jahren der kaiserliche Hof-
bibliothekar Peter Lambeck über zerbrochene Fenster aufgrund von irregeleiteten
Bällen aus dem Ballhaus der Hofburg. Die topographische Literatur,41 Hofbeschrei-
bungen und Hofkalender,42 Instruktionen für Hofbedienstete,43 Adressverzeich-
40
Als Beispiel Holzschuh-Hofer, Kaiserliche Rekreationsräume 203 (Fn).
41
Mallinckrodt (Hg.), Bewegtes Leben, 365: Ein Auszug aus dem „Wegweiser für Fremde in Nürnberg, oder
topographische Beschreibung der Reichsstadt Nürnberg nach ihren Plätzen, Märkten, Gassen, Gäßchen,
Höfen, geist- und weltlichen öffentlichen Gebäuden (Nürnberg 1801, Nachdr. 1992): Das „Ballhaus, das ehe-
malige, war beim Wöhrderthörlein auf der linken Seite, wenn man hinausgeht, und auch der Ballhof dabei“.
42
In den Hofzahlamtslisten für den Hofstaat Leopolds I. lassen sich Hans Jacob Amphoso (1684) und Jakob
Andrä Asch (1697) als Ballmeister bzw. als Edelknabenballonmeister nachweisen; als Marqueure im Ball-
haus Sebastian Tremmel (1750–1777), Andreas Summerer I (1750–1771), Bartholomäus Martin (1762–
1792), Andreas Summerer II (1762–1767); Karl Brandstetter (1774–1792), Kubiska-Scharl – Pölzl,
Karrieren, 333, 642, 714, 719. Verzeichnis der Ballmacher am Hof Rudolfs II. in Prag bei Hausenblasová,
Der Hof Kaiser Rudolfs II., 422.
43
Wührer – Scheutz, Zu Diensten, 667: Instruktion für den Edelknabenhofmeister (1661 März 12): „An
Sohn-, feyer- und recreationstägen nach verrichten diensten können sie, da es nicht regnet und sonsten
152Kirchen des Sports
Abb. 2 und 3: Wien 1, das 1746 neuerrichtete Ballhaus am heutigen Ballhausplatz (Gesamtaufnahme
mit Blick aus Nordwesten; dahinter das Kaiserspital beziehungsweise der Amalientrakt der Hofburg;
rechts am Bildrand die Ecke vom Neubau des Haus-, Hof- und Staatsarchivs; Fotograf: August Stauda
(Glasplatte) 1902; ÖNB Bildarchiv Inventarnummer ST 942F und ST 503F). Das Ballhaus war durch
einen eigenen Gang mit dem Amalienhof verbunden. Die niedrigen Anbauten waren für den Ball
meister, die Umkleideräume und die Werkstatt bestimmt. Im Ballhaus wurde bis 1855 gespielt (Kühr,
Ballhäuser 76 f.; Kisch, Alte Straßen 375).
nisse,44 Zeitungen wie das „Wiener Diarium“45 oder auch Vogelschaupläne und Bau-
pläne sind wichtige Grundlagen für eine Geschichte des „jeu de paume“ oder des
„real tennis“ in der Frühen Neuzeit.
unwittert, samentlich etwan in ein gartten mit dem praeceptor wüßen oder sonsten anderwerths spaziern
gehen, daselben sich mit ballen, ballon, ritter- und anderen ehrlichen spillen miteinander erlustigen“.
44
Jordan, Schatz, 40: „Hrn. Johann Andre Anfoß / Kayserl. Ballmeister“ (gemeint Hans Jackob Amphoso),
wohnhaft in der Teinfaltstraße. Ebd. 47: Bei der kaiserlichen Burg: „Das Kaserl. Ballhauß“; ebd. 108: „Hrn.
Richard Fauconet / Kays. Hoff-Hutmachers Pallhauß“. Siehe auch Huber, Analyse.
45
Wiener Diarium Nr. 22 (17. März 1731) pag. 7: „Man ist Tag und Nacht beschäftiget / in dem Ball-Haus
bey denen PP. Franciscanern ein neues Theatrum zum Gebrauch der Italiänischen Comoedie, und Musica
Bernesca in eben benennter Sprache / noch vor Ostern in Stand zu setzen; von dessen Einrichtung künfti-
gen Post-Tag mehrere Nachricht folgen wird“. Ebd. Nr. 24 (24. März 1731) pag. 8: „Nachdeme berichteter
massen in dem Ball-Haus bey denen PP. Franciscanern ein neues Theater für die Welsche Comoedien /
und sogenannte Musica Bernesca zu erbauen angefangen / dienet zu fernerer Nachricht / daß solches
nunmehro im Stande / und daß man künftigen Montag / den 26sten dieses Monats / darinnen anfan-
gen wird mit bemeldter Musica Bernesca, die schon vor diesem aufgeführet worden. Das Einlaß-Geld
anbelangend / wird es mit dem gleich seyn / was man in dem Comoedien-Haus bey dem Kärntner-Thor
erlegt / nemlichen: was man dort für die sogenanten Intermezzi Musicali erlegt / wird auch alhier für die
Musica Bernecsa, und was man dort für die teutsche Comoedien zahlet / wird auch alhier für die Wel-
sche bezahlet werden; worbey ferners avisiret wird / daß die Einfahrt von dem Franciscaner-Platz herein /
die Ausfahrt aber zu der anderen Gassen / genannt die Himmel-Port-Gassen / seyn wird.“ Ebd. Nr. 22
(18. März 1769) pag. 7: „Die Compagnie des Hrn Cinquanta wird den Anfang zu ihren Theatralbelusti-
gungen den 27. dies Monats März bey den Franciscanern machen. Es werden dabey vorgestellet werden,
große neue Pantomimen und italienische Lustspiele, die aus der berühmten Feder des Herrn Goldoni und
Chiari geflossen […].“
153Martin Scheutz
1. Ballhäuser in spätmittelalterlichen
und frühneuzeitlichen Städten in Europa
Sportpraktiken und räumliche Figuration derselben erscheinen erstaunlich präsent
in der vormodernen Gesellschaft. So verbucht beispielsweise das „Zedlersche Uni-
versallexikon“ mit Selbstverständlichkeit das mit Leder oder Tuch überzogenen und
mit Darmsaiten bespannten Rackets gespielte Ballspiel: „und werden zu diesen Spiele
gewisse Oerter, die Ballhäuser, Jeu de paume, Trigon, Sphaeristerium genennet,
gehalten. Dergleichen Ballhäuser nun sind lange schachtseitige Gebäude, an 100. und
mehr Schuh lang, und 40. bis 50. breit, da an der einen langen Seite eine in Manns-
Höhe mit einen schregen bretternen Dach bedeckte Gallerie ist, welche an den obern
Querseite theils offen, theils zu, weiter fortgehet.“46 Die Mauern der Ballhäuser sind
im Regelfall „20 und mehr Schuh hoch, auf welchen Gallerien umher sind, wohin die
Bälle verschlagen werden“.
Die spätmittelalterliche und frühneuzeitliche Stadtwelt war von einer Vielzahl
von anfänglich in der Freiluft gelegenen Ballspielörtlichkeiten geprägt.47 Der allmäh-
liche räumliche Institutionalisierungsprozess der frühneuzeitlichen Sportpraktiken
zeichnete sich neben Paris unter anderem an den Ballspielsälen in Italien ab; die Wie-
derbelebung bzw. Renaissance des antiken Ballspiels48 begann dort: Die „Salae della
Balla“ wurden nachträglich in die Schlösser der Gonzaga in Mantua, in die Resi-
denzen der Este in Ferrara und der Medici in Florenz, der Montefeltre in Urbino
eingebaut, erst nach 1450 scheinen die Ballsäle zur integralen, von den Architekten
bereits mitgeplanten Bauausstattung der fürstlichen Schlösser gehört zu haben.49
Die frühesten Regelwerke des ursprünglich mit der flachen Hand gespielten „jeu de
paume“ entstanden im italienischen Kontext. Der mit Ferrara verbundene Geistliche
Antoni Scaino (1524–1612) legte in seinem 1555 in Venedig gedruckten „Trattato del
Giuoco della Palla“ neben Spielregeln, moralischen und philosophischen Betrach-
tungen auch fünf Illustrationen zu Bällen, Spielinstrumenten, Ballspielplätzen, aber
auch Ballhäusern vor. Die Illustrationen zu einem kleineren („steccato minore“) und
zu einem größeren Ballspielplatz („steccato maggiore“) im Pariser Louvre enthalten
46
Johann Heinrich Zedler, Grosses vollständiges Universal-Lexicon Aller Wissenschaften und Künste Bd. 3
(Halle 1733), Sp. 229. Zu frühen Belegen (Belege aus 1596) Goebel – Reichmann, Frühneuhochdeutsches
Wörterbuch 2, 1771; Jacob und Wilhelm Grimm, Deutsches Wörterbuch, Bd. 1, Leipzig 1854, 1094. Beim
„Ständebuch“ von Christoph Weigel dem Älteren (1654–1725) sieht man Ballspieler im Freien, Todte,
Fecht-, Reit- und Tanzmeister, 149.
47
Zur mittelalterlichen Entwicklung an italienischen und französischen Beispielen Mehl, Les jeux au
royaume, 39–42.
48
Zu den antiken, großteils von den Griechen entwickelten und auch als Teil der Erziehung in Gymnasien
gespielten Ballspielen Hurschmann, Ballspiele, Sp. 426–427.
49
Behringer, Kulturgeschichte des Sports, 201; Ders., Tennis, Sp. 363.
154Kirchen des Sports
auch Angaben zu den Maßen.50 Anlass für die Abfassung von Scainos Traktat waren
neben den sich ergebenden, bis vor die Fürsten getragenen Streitigkeiten auch die
Rivalität zwischen den Este und den für „calcio“ stehenden Medici.51 Der kleinere,
mit einer Galerie an zwei Seiten für Zuschauer versehene Tennisplatz umfasste nach
dem Vorschlag von Scaino die Maße 19 x 6,5 Meter und wies Fensteröffnungen an
den Seitenwänden in einer Höhe von 6 Metern auf.52 Meist versah man die Ball-
häuser nicht mit Glasfenstern, sondern mit „Aufzugtücher[n]“;53 Netze aus Garn54
verhinderten das Hinausfliegen der Bälle. Der größere, aufwändiger zu errichtende
Tenniscourt hatte nach Scaino an drei der vier Seiten Zuschauerbereiche und dort
wurde bereits explizit mit Rackets gespielt, die in Italien später in Mode kamen als in
Frankreich.55 Während anfänglich die Ballsäle noch in die Schlösser integriert waren,
zeichnete sich nach 1500 verstärkt das freistehende Ballhaus ab, wobei hier Frank-
reich unter Franz I., aber auch den spanischen Niederlanden eine wichtige Schritt-
macherrolle zukam.
Die wichtigen Architekturtrakte der Frühen Neuzeit wie der des Architektur
theoretikers Leonhard Christoph Sturm (1669–1719) aus dem Jahr 1718 und des
Mathematikers und Architekturtheoretikers Friedrich Penther (1693–1749) von 1748
stellen die von ihm unter die Gattung der Speicherbauten subsummierten Ballhäuser
als eine der wichtigeren Bauaufgaben56 von frühneuzeitlichen Architekten dar, wobei
sie die Vorgaben von Scaino weitgehend übernahmen. „Was nun die Maasen des Ball-
Hauses anbelanget, richten sich solche nach denen heut zu Tage üblichen Reguln des
Ballspiels, welche erfordern, daß das Ball-Haus in Lichten 90. bis 100. Fuß lang sey.
Die Breite ist allemahl der dritte Theil der Länge, also 30. Fuß Breite bey 90. Fuß Länge
und 33 ⅓ Fuß Breite bey 100. Fuß Länge. Die Höhe bis an die Decke kan 40. Fuß, auch
wohl etwas weniges drüber oder drunter seyn.“57 Die Decken der Ballhäuser sollten
entweder mit Deckenbrettern verschalt werden oder offen den Blick in den Dachstuhl
gewähren. Nach den Vorstellungen Penthers besaßen die Ballhäuser „unten herum
50
Zollinger, Benders „Unterricht deß Ballen-Spiels“, 276. Zur Entwicklung der Regeln Mehl, Les jeux au
royaume, 42–48.
51
Mehl, Antonio, 440–442; mit einem Referat des Buches nach Kapiteln ebd. 442–445, 490–496; Bondt,
Royal tennis, 59–68.
52
Bondt, Royal tennis, 81–84; das Stuttgarter Ballhaus hatte die Fenster in einer Höhe von rund sieben
Metern, Gillmeister, Topspin, 211.
53
Bauer, Hofballhaus, 122.
54
Nail, Marburger Ballhaus, 214.
55
Gillmeister, Artisten ohne Netz: Das Racket wird erstmals in einem Match zwischen dem kastilischen
König Philipp und dem Marquis von Dorset 1505 angeführt.
56
Als Beispiel etwa das landesfürstliche Interesse (Philipp III. von Hessen-Butzbach) am Bau des Ballhauses
in Butzbach (1633/34), Hessisches Staatsarchiv, Bestand D 4, Nr. 175/4; siehe auch die Siedlungsentwick-
lungskarte von Butzbach (Städteatlas). Freundlicher Hinweis von Holger Gräf, Marburg.
57
Penther, Vierter Theil der ausführlichen Anleitung, 101.
155Martin Scheutz
Abb. 4: Friedrich Penther (1693–1749), Idealtypische Darstellung eines Ballhauses
(1748), aus Penther, Vierter Theil der ausführlichen Anleitung, Tafel 86.
156Kirchen des Sports
[…] keine Fenster“, sondern nur oben.58 Das Ballhaus hatte schwarz gestrichen zu
werden, „daß man die weißliche Bälle im Flug gut sehen könne“.59 Der tennisskepti-
sche und schon in der ausklingenden Ballhausära60 tätige Leonhard Sturm beschäf-
tigte sich in seiner Abhandlung über die Ballhäuser vor allem mit der komplexen Ver-
bindung des leichten Holzdaches zum Mauerwerk. Sturm, der nach eigenen Angaben
zwei Ballhäuser abgemessen hatte, wollte im Grundriss der Ballhäuser kein schlüssi-
ges System erkennen: „Doch kan ich auch nicht glauben / daß es mit selbigen Propor-
tionen so viel auf sich habe / weil die sechs oder sieben Ball=Häuser so ich besehen /
und zwey die ich abgemessen habe (weil sie zu einem andern Gebrauch musten ver-
ändert und eingerichtet werden) nicht allein nicht die geringste Harmonie der Maasse
und Verhältnusse gefunden / sondern auch in den Maassen der beyden letztern / die
ich deßwegen mit grossem Fleiß abgenommen habe / weder Arithmetische / noch
Geometrische / noch Harmonische Verhältnusse habe gewahr werden können“.61
Ballhäuser gehörten in der Frühen Neuzeit nahezu selbstverständlich zur „Grund
ausstattung“ größerer, adelig mitgeprägter Städte.62
Das Mekka des frühneuzeitlichen, von der Aristokratie, aber auch den Studenten
betriebenen Ballsports scheint Paris gewesen zu sein. Allein 1596 soll es dort nach
Auskunft eines Reiseberichtes 250 „feine“ und gut ausgestattete Ballhäuser63 gegeben
haben, wobei sich die sicher lokalisierbaren Ballplätze stadträumlich auf dem rechten
Seineufer befanden und sich um den Bereich außerhalb der königlichen Residenz,
den Louvre, gruppierten. Weitere Tennisplätze fanden sich um Les Halles und die
Place de Grève (heute: Place de l’Hôtel de Ville) sowie im Universitätsviertel. Neben
den privaten Ballhäusern (darunter auch den Ballhäusern des Louvre) gab es auch
öffentliche. Obwohl Tennis ein hochadeliges Spiel war, zeigt sich doch bereits im
16. Jahrhundert die ständeübergreifende Attraktivität des Sports, weil Studenten,
aber auch Handwerker dieser „Freizeitkultur“ vermehrt anhingen.64 Die konkrete
Zahl der Ballhäuser lässt sich auf der unsicheren Quellengrundlage der Reiseberichte
nur schwer ermitteln. Quellenmäßig gesichert kann man in Paris zwischen 1300 und
1600 rund 70 private und öffentliche Tennisplätze nachweisen.65 Der in Montpellier
ausgebildete, deutsche Arzt Thomas Platter der Jüngere (1574–1628) berichtet bei
seinem Paris-Besuch 1599 von dieser Ballsportbegeisterung und dem Aufstieg der
58
Siehe etwa die Pläne bei Dreger, Baugeschichte, Abb. 107–116.
59
Penther, Vierter Theil der ausführlichen Anleitung, 102.
60
Zum Niedergang im 17. und vor allem 18. Jh. Belmas, Grandeur, 70 f.
61
Sturm, Vollständige Anweisung, Grosser Herren Palläste, 51.
62
An französischen Beispielen Delsalle, Jeu de paume et tripots, 38: Beispiele aus Gray, Besançon, Salins,
Polgny, Lons-le-Saunier, Vesoul, Montbéliard und Arbois.
63
Bernard-Tambour, Le jeu de paume à Paris, 99; Jaser, The Capital of Tennis, 89.
64
Jaser, The Capital of Tennis, 94–100.
65
Bernard-Tambour, Le jeu de paume à Paris, 99–102; Jaser, The Capital of Tennis, 89.
157Martin Scheutz
„Kommerzarena“66 Ballhaus: „Mechtig viel ballenheüser sindt auch in der statt Paris,
sonderlich aber in den vorstetten, da man auß den zerstörten, abgebrochenen heü-
seren ballenheüser aufgebauwen, auß welchen sie mehr nutz ziehen, dann wann sie
gantze heüser hetten, unndt leihet man ihnen eher gelt drauf dann auf außgebauwene
heüser. Ettliche sagen, daß es bei 1100 ballenheüser zu Paris habe, aber so nur halb so
vil, wie ich glaub, in gantz Paris sindt, ist es ein hüpsche zahl. Unndt sindt gemeinlich
alle voller leüten, die ballenspilen, wie ichs gesehen.“67 Für das Jahr 1657 vermeldet
dann ein anderer Reisebericht für Paris 114 Ballsporteinrichtungen.68 Trotz dieser
changierenden Angaben der Ballhäuser für Paris lässt sich doch mit Sicherheit sagen,
dass deren Zahl im 17. Jahrhundert allmählich sank. Der englische Reisende Robert
Dallington bemerkte 1598 ironisch, dass Frankreich „übersät mit Ballhäusern“ sei.
Sie „sind zahlreicher selbst als die Kirchen – die Franzosen werden geboren ‚une
raquette à la maison‘“.69 Schließlich überlebten 1783 in Paris nur mehr 13 bzw. in
ganz Frankreich 5470 davon – die unzufriedenen Abgeordneten des dritten Standes
konnten sich deshalb im nicht mehr genutzten Ballhaus versammeln. Dort, bildlich
von Jacques-Louis David festgehalten – legten sie am 20. Juni 1783 den „Ballhaus-
Schwur“ ab – die Abgeordneten der Nationalversammlung wollten das Ballhaus erst
nach dem Vorliegen einer Verfassung verlassen.71 Aber noch 1862 ließ Napoleon III.
auf der Terrasse der Tuilerien eine neues Ballhaus bauen, das heute als Museums
gebäude dient.72 Die hochadelige Ballsportbegeisterung des 16. Jahrhunderts, der die
Habsburger zwangsläufig folgen mussten, zeigt sich auch daran, dass Heinrich VIII.
in seinen Schlössern Whitehall, Hampton Court oder St. James’s Palace zwischen
1532 und 1547 jeweils ein Ballhaus errichten ließ.73 Der Arzt Thomas Platter besuchte
1599 Schloss Windsor und notierte mit medizinischem Blick „gegen mittag hatts ein
schönen spilplatz, alda sie mitt dem racket den ball treiben undt sich sonst belusti-
gen“.74 Der Arzt rezipierte auf seinen Reisen immer wieder auch den Ballsport. In
Avignon befand sich das Ballhaus in einer alten Kirche. „ist daß grössist ballenhuß,
daß ich mein lebtag gesehen hab, darinnen ihren ettliche spilten, wie es dann einen
66
Gillmeister, Topspin, 209.
67
Keiser (Hg.), Beschreibung, 594; vgl. Schleiner, „We Who Are All Players“, 19: Benevenuto Cellini
berichtet vom Investment in Tennisplätze: „he keeps a tennis-court in his Château, from which he draws a
substantial income“.
68
Die Zahlen gehen auf Albert de Luze [La magnifique histoire du jeu de paume, Paris 1933] zurück, Kühr,
Ballhäuser, 29; Behringer, Tennis, Sp. 365; Bernard-Tambour, Le jeu de paume à Paris, 100.
69
Streib, Geschichte, 375; am Beispiel von Straßburg (bis 1681 Teil des Heiligen Römischen Reiches) Herr-
mann, Ballhäuser.
70
Nach Luze bei Kühr, Ballhäuser, 30.
71
Behringer, Tennis, Sp. 365; ders., Kulturgeschichte des Sports, 202 f.
72
Mehl, Prager und Wiener Erinnerungen, 13.
73
Schattner, Putting Sports, 80.
74
Keiser (Hg.), Beschreibung, 844.
158Kirchen des Sports
eigenen ballenmeister darauff hatt, der die leüt mitt ballen unndt racketen versihet.
Oben im palais sahe ich noch ein ballenhauß, ist gar klein“.75 Thomas Platter berich-
tet auch über seinen Studienort Montpellier, dass es dort insgesamt acht Ballhäuser
(eines in der Vorstadt) gab und dass sich vor allem die adeligen Soldaten im finan-
ziell aufwändigen „ballenspil“ übten, „auch stattliche däntz halten unndt auf schö-
nen pferden reiten, daß sich höchlich zeverwunderen, wo sie daß gelt bekommen.“76
Zahlen für andere europäische Städte des 16. und 17. Jahrhunderts belegen deutlich
den Unterschied zwischen dem französischem Zentrum und der resteuropäischen
Peripherie: So gab es im päpstlichen Rom 18, in Florenz zwölf und in Ferrara zehn
Ballhäuser,77 in frühneuzeitlichen Weltstädten wie Antwerpen und London dagegen
15 Ballspielstätten.78
2. Ballhäuser erobern Höfe und
österreichische Städte in der Frühen Neuzeit
Nach gegenwärtigem und nicht immer quellenmäßig gut abgesichertem Forschungs-
stand bestanden insgesamt 19 dem „royal/real tennis“ gewidmete Ballhäuser auf
dem Gebiet des heutigen Österreich, dennoch erweist sich die österreichische For-
schungslage als dürr, ein Umstand, dem der vorliegende Beitrag nur bedingt abhelfen
kann. In zahlreichen frühneuzeitlichen Schlossbauten dürfen Ballzimmer vermutet
werden, doch erscheint die Raumnutzung dieser Bauten abhängig von sich wandeln-
den, höfischen Konsumgewohnheiten häufigen Umwidmungen unterworfen gewe-
sen zu sein. Die Residenzstädte waren im 16. und frühen 17. Jahrhundert eindeutig
die Orte, wo sich das Ballhaus als eigener Bautyp entwickeln konnte. Wien wies in
der Frühen Neuzeit sechs, Linz vermutlich vier, Innsbruck drei und Graz zwei Ball-
häuser auf. Ein Ballhaus lässt sich zudem in Salzburg belegen, auch das im Besitz
der Stände befindliche Klagenfurt wies ein Ballhaus auf. Das obersteirische Juden-
burg diente unter dem jungen Ferdinand II. als eine Art Nebenresidenz für Graz und
verfügte deshalb ebenfalls über ein Ballhaus. Wien unter dem jungen Landesfürsten
Ferdinand I. und Innsbruck unter dem von Prag kommenden Ferdinand II. von Tirol
waren die Marktführer des Ballsports im 16. Jahrhundert, andere Städte schlossen
sich dann erst vermehrt am Beginn des 17. Jahrhunderts an (Graz, Salzburg). Linz
als Stadt ohne dauerhafte habsburgische Residenz, aber mit Adelsakademien folgte
75
Keiser (Hg.), Beschreibung, 117.
76
Ebd., 78.
77
Bondt, Royal Tennis, 221 f.
78
Streib, Geschichte, 377.
159Martin Scheutz
Mitte des 17. Jahrhunderts. In manchen Städten, etwa in Innsbruck, Lienz, Meran,
gab es auch sogenannte „Ballenhäuser“, wo für das Rodwesen Waren gelagert werden
konnten – die in diesem Kontext auftauchende Bezeichnung „Ballenstadel“ ist des-
halb leicht irreführend, weil diese Häuser dem Umladen der Ware auf neue Wägen,
der Verzollung der Ware und gelegentlich als Tanzhäuser79 dienten – Tennis wurde
dort aber nicht gespielt.
Die spanischen Niederlande spielten für die Vermittlung des Ballsportes in der
sich herausbildenden Habsburgermonarchie des 16. Jahrhunderts eine zentrale Rolle.
Der junge Landesfürst Ferdinand I. scheint zuerst mit dem Ballspiel in den Nieder-
landen, wo er aufwuchs, in Verbindung gekommen zu sein. Die Niederlande scheinen
neben Frankreich wichtige Vorbilder für das Ballspielen und die Ballhausarchitek-
tur gewesen zu sein, so lässt sich 1562 in Köln eine von einer Kölner Patrizierfamilie
offenbar lukrativ betriebene „katzbahn“ als Ballspielanlage nachweisen, auf der so viel
geflucht wurde, dass der Kölner Rat schließlich einschritt und dem gotteslästerlichen
Tun ein Ende bereitete.80 Das erste kaiserliche Ballhaus in Wien wurde vor 1525 auf
dem Areal des 1517 von Kaiser Maximilian I. angekauften Ebersdorfer Hauses auf
dem Burgplatz errichtet und überstand den Wiener Stadtbrand vom 18. Juli 1525
nicht.81 Nach dem Stadtbrand dürfte dieses erste Ballhaus – vermutlich in der Nähe
des Irrgartens der Hofburg – wiedererrichtet worden sein, ab 1534 können dafür
Ausgaben in den Rechnungen nachgewiesen werden. Ab 1540 findet sich zudem ein
neues „Pallhauß bey der Burckh zu wienn“ – der Neubau konnte am Nordwestrand
des Unteren Lustgartens verortet werden. In der zweiten Hälfte des 16. Jahrhunderts
war damit an der Nordecke der Alten Burg ein eigener Flügel angelegt worden, der ein
„Konglomerat von drei aneinander gefügten, funktionell jedoch autonomen Gebäu-
den“82 zu Rekreationszwecken bildete: die rudolfinische Galerie, die Kunstkammer
und das Ballhaus. Dieses Ballhaus in unmittelbarer Nähe der „alten“ Hofburg dürfte
bis 1640 in Gebrauch gestanden sein.83 In der Nähe der Hofburg und damit in Anbe-
tracht eines kaufkräftigen Publikums scheinen sich auch Privatballhäuser entwickelt
zu haben (1547: Ballhaus in der Ballgasse), dem dann im 17. Jahrhundert zwei weitere
Privatballhäuser folgen sollten.84 In Wien dienten die Ballhäuser zugleich als räum
79
Siehe https://www.arcanum.hu/hu/online-kiadvanyok/OsterreichischerStadtatlas-osterreichischer-stadte-
atlas-1/ (Zugriff: 26.3.2019), sub voce „Ballhaus“.
80
Gillmeister, Kulturgeschichte des Tennis, 196 f.
81
Holzschuh-Hofer, Kaiserliche Rekreationsräume, 198; mit älterem Forschungsstand Kühr, Ballhäuser,
63–78; Schlager, Wiener Skizzen, 242–244. Zum Vergleich: 1530 errichtete Franz I. im Louvre ein kleines
Ballhaus mit den Maßen 114 Fuß (37 Meter) Länge, 38 Fuß (rund 12 Meter) Breite; Kühr, Ballhäuser, 32.
82
Karner, Galerie, 214.
83
Kühr, Ballhäuser, 66.
84
Schlager, Wiener Skizzen, 244; Kühr, Ballhäuser, 78–87.
160Kirchen des Sports
Abb. 5: Ansicht des Ballhauses von Schloss Neugebäude, das um 1577 errichtet wurde und bis ca. 1660
in Gebrauch stand (danach Umwandlung in ein Tiergehege), Ansicht: Ausschnitt aus Johann Adam
Delsenbach nach einer Zeichnung von Joseph Emanuel Fischer von Erlach (Feuchtmüller, Neu
gebäude Abb. 13 (Ausschnitt).
liche Bezugspunkte, so erschien das „Wiener Diarium“, der Vorläufer der „Wiener Zei-
tung“ mit dem Titelblatt „Wienerisches Diarium […] Zu finden in der Kaiserlichen
Hof-Buchdruckerey / gegen dem Hof-Ball-Haus über“.85
Die Residenzen Wien und Prag müssen als höfische Residenzkonkurrenten gese-
hen werden. 1567–1569 ließ Maximilian II. von Bonifaz Wohlmuet (1510–1579) ein
prächtig ausgestattetes Ballhaus im Garten der Prager Burg errichten, das mit sei-
nen Dimension von 68 x 13 Metern und durch die prächtigen Sgraffito-Bilder an
der Schauseite besonders auffällig ist.86 Ballhäuser wurden in der Frühen Neuzeit
intensiv als Teil einer als neu empfundenen höfischen Repräsentationsform stark
rezipiert,87 wie Reiseberichte gut verdeutlichen. Das in Bau befindliche Lustschloss
„Neugebäude“ von Maximilian II. galt etwa dem italienischen Gesandten Leonardo
85
Etwa Wiener Diarium Nr. 93 (19. November 1729) Titelblatt.
86
Mehl, Prager und Wiener Erinnerungen, 14 f.; Lietzmann, Neugebäude, 177.
87
Als guter Überblick Cartier, Le jeu de paume et la vie de cour, 113–118.
161Martin Scheutz
Abb. 6: Das in den frühen 1570er Jahren entstandene Innsbrucker Ballhaus in der Renngasse mit dem
Statthaltereigebäude, Museum Ferdinandeum, Aignerscher Codex, FB 1673, Blatt 20, Zeichner: J.
Strickner, 1809; siehe auch Felmayer, Innsbruck 482.
Donà 1577 als schöner Palast mit verschiedenen Loggien, Gehegen für Fasane,
Hasen und Wild, aber auch als Ort des Ballspiels („con luocchi da gioco di balla
et di balone“).88 Der französische Reisende und Diplomat Jacob Bongar berichtete
1585 von den Gärten, Fischteichen und Tiergehegen im Schloss Neugebäude, einem
Ballspielplatz und eben auch von einem Ballhaus.89 Man scheint das Ballspielhaus im
Neugebäude bis in die 1660er Jahre verwendet zu haben, als man den offenbar wenig
bespielten Bau in Gehege zur Haltung von exotischen Tieren umwandelte.90
Als zweiter räumlicher Kulminationspunkt der Ballhausentwicklung in Öster-
reich muss Innsbruck gelten. Der Tiroler Hans Georg Ernstinger beschreibt 1579
die Hofburg in Innsbruck mit dem Turnierplatz und „zway bedeckhte palheuser[,]
da man mit dem grossen und klainen palen spilt“.91 Auch beim Besuch des Schlosses
Ambras beachtete er nicht nur den Spanischen Saal, sondern auch „das pallhauss“
und „das lusthauss in ainem garten“.92 Innerhalb von rund zehn Jahren, zwischen
88
Niederkorn, Beschreibung, 407.
89
Lietzmann, Neugebäude, 44. Ob das häufig als Ballhaus angeführte riesige Speichergebäude im Schloss
Neugebäude bei Wien wirklich als Ballhaus einzuordnen ist, erscheint aufgrund der außergewöhnlichen
Dimensionen fraglich, Abb. etwa bei Behringer, Kulturgeschichte des Sports, 225.
90
Lietzmann, Neugebäude, 98.
91
Walther, Ernstinger, 4 f.
92
Walther, Ernstinger, 12; keine Erwähnung von Ballspiel bei Bůžek, Ferdinand von Tirol.
162Kirchen des Sports
Abb. 7: Schloss Ambras, von Süden her gesehen, die Signatur „B“ weist das neben dem Spanischen Saal
gelegene Ballhaus aus (Kupferstich von M. Merian 1649).
1571 und 1581/82, entstanden in der Nähe der Innsbrucker Hofburg zwei städti-
sche Ballhäuser sowie 1581 ein großes und repräsentatives Ballhaus neben dem Spa-
nischen Saal auf Schloss Ambras.93 In zeitlicher Folge, und sicherlich dem Vorbild
Wien und Graz nacheifernd, bemühte sich der junge Ferdinand (später Kaiser Fer-
dinand II., 1578–1637), der seit 1596 als steirischer Landesfürst regierte, das von
ihm sicherlich auch während seiner Studienzeit an der Jesuitenuniversität Ingolstadt
(Ballhaus 1594) erlebte Ballspiel zu forcieren. Ende des 16. Jahrhunderts entstand
am linken Flügel der Grazer Burg und an die Stadtmauer angelehnt ein „großes“
Zeughaus,94 das im 16. Jahrhundert zum Teil als Schüttboden für Getreide, aber bis
ins 18. Jahrhundert auch für das Ballspielen verwendet wurde. In unmittelbarer Nähe
baute man gegenüber den Hofstallungen, ebenfalls an die Stadtmauer angebaut, ein
„kleines“ Ballhaus.95 Auf den Schlössern des Adels gab es sicherlich noch das eine
oder andere Ballhaus, wie das Beispiel der Schallaburg unter dem baufreudigen Hans
Wilhelm von Losenstein in der zweiten Hälfte des 16. Jahrhunderts zu verdeutlichen
93
Steinegger, Aus der Geschichte, 20.
94
Popelka, Graz, 253; Scheutz, Zeughäuser, 535.
95
Resch, Graz, 27.
163Martin Scheutz
scheint.96 Sogar in Judenburg, wo Ferdinand nach dem Ankauf von Freihäusern aus
dem Besitz der Familie Teuffenbach einen Witwensitz für seine verwitwete Mutter
Maria Anna von Bayern, aber auch eine Art Jagd- und Sommerresidenz errichten
ließ, gründete man ein Ballhaus.97 Die Stände griffen die landesfürstlichen wie die
akademischen Vorbilder auf, sodass bald in Klagenfurt (1605) und in Linz (1614)
Ballhäuser entstanden, die sicherlich sowohl vom Adel als auch von den jungen, in
den ständischen Schulen ausgebildeten Kavalieren zur körperlichen Ausbildung ver-
wendet worden sein dürften. Die oberösterreichischen Stände richteten das Linzer
Ballhaus ein, „vmb mehrer derselben vnd anderer adelichen persohnen recreation
willen“.98 Auch im Erzstift Salzburg fühlte sich der geistliche Landesfürst während des
Dreißigjährigen Krieges und angesichts des Neubaus des Salzburger Domes 1620/25
bemüßigt, ein Ballhaus zu errichten,99 und es scheint einen Ballspielplatz gegeben
zu haben. In vielen Städte zeichnet sich eine Konkurrenzsituation zwischen einem
„alten“ und einem „neuen“ Ballhaus ab, wie das Beispiel Leipzig gut verdeutlicht.
Der Jurist, Ratsherr und Ratsbaumeister Enoch Pöckel (1578–1627) erhielt 1623 das
kurfürstliche Privileg zum Betreiben eines Ballhauses,100 im Jahr 1692 erteilte der
sächsische Kurfürst ein Privileg zur Erbauung eines zweiten Leipziger Ballhauses an
Johann Petsch (mit der Auflage eines Spielverbotes an Sonntagen; Verbot von Zank,
96
Zum Ballhaus beim „Gerichtsstöckl“/Garten/Schießstätte Fries, Bauforschungsbericht Gartenanlage
53–56; der Umbau muss unter Hans Wilhelm von Stubenberg (1558–1601) zwischen 1570 und rund 1600
stattgefunden haben, Fries – Kuttig – Wolfgang, Castrum 250–258; OÖLA, HA Weinberg, Akten 1303,
sin. pag. et fol. (Herrschaftsanschlag 1650/1660): „daneben ain schen lustiges palhauß, 32 eln lang und
14 eln breith“ (Freundlicher Hinweis von Dr. Johannes Kritzl).
97
Andritsch, Judenburg, 169.
98
Marks, Ballhaus, 62.
99
Kühr, Ballhäuser, 100–102; Fuhrmann, Salzburg in alten Ansichten, 303 f., 317. Zum angeblichen Ball-
haus im „Collegium Marianum“ Kühr, Ballhäuser, 102–105; Bauer, Hofballhaus, 137 f. Das bei Kühr
erwähnte Salzburger Ballhaus des Studentenkonvikts „Collegium Marianum“ (als zweites Ballhaus) scheint
eine Mystifikation zu sein. Das von Kühr angeführte Gebäude (Bergstraße 14) steht leider nicht mehr. Die
Annahme Kührs geht vermutlich auf eine Stelle bei Wagner, Geschichte, 67 f., zurück, wo er auf das Edel-
knabeninstitut zu sprechen kommt: „Für diese Institute erbaute Erzb. Paris wahrscheinlich im Jahre 1651
ein Ballhaus in der Stadt für die adeligen Exercitien im Fechten, Voltigieren und Tanzen“. Ähnlich auch eine
Stelle bei Pick, Urkundliches Material 107, die das Ballspielen (Ballon-Spiel?) im Lehrplan zwar nennt,
aber keinen Ort dafür bezeichnet. Auf den Stadtansichten von Philipp Harpff (1611–1647) im rechten
unteren Viertel des großen Stadtbildes (Ausschnitt; Salzburg Museum, Grafiksammlung Inv.-Nr. 1583–49)
ist ein relativ niedriges Gebäude mit turmartigen Anbau (Treppe) am Knick der Bergstraße zu sehen. Das
„Panorama der Stadt Salzburg vom Dach des Hauses Linzer Gasse 21“ (Ölbild) in vier Bildern, Teil Rich-
tung Schloss Mirabell [1679] (Gemäldesammlung Inv.-Nr. 64–25) zeigt eine reiche Durchfensterung; der
Ausbau des Dachgeschosses deutet aber auf andere oder erweiterte Nutzung. Das Haus wurde 1651 als
Getreidekastenhaus erwähnt und 1800 als Kastenhaus oder Postmeisterhaus. Auch die Stadtbrandakten
(nach 1828) erzählen nichts von einem Ballhaus im „Collegium Marianum“ (Bergstraße 14), sondern dort
fanden sich im Erdgeschoß ein Gewölbe und darüber ein Getreidespeicher. Ich verdanke diese wichtigen
Hinweise der Kompetenz und Hilfsbereitschaft von Jutta Baumgartner (Universität Salzburg), Erich Marx
(Salzburg) und Gerhard Plasser (Salzburg Museum).
100
Todte, Fecht-, Reit- und Tanzmeister, 150 f.
164Kirchen des Sports
Schlägereien und Lärm).101 Umfangreiche Streitigkeiten zwischen den konkurrieren-
den Ballhausbesitzern waren die Folge.
Ein Ende der multifunktional verwendbaren Ballspielhäuser102 kündigte sich ab
der Mitte des 17. Jahrhunderts an, als sich dort immer häufiger Gastspiele von deut-
schen oder italienischen Wandertruppen lokalisieren lassen:103 Schon 1629/30 ver-
wendete man das große Ballspielhaus in Innsbruck vermehrt für Komödien,104 das
Franziskanerballhaus in Wien folgte um die Jahrhundertmitte dieser Entwicklung
mit periodischen Aufführungen der Commedia dell’Arte.105 Auch im Ballhaus in
der Wiener Teinfaltstraße (kleines Ballhaus) gab es gegen Ende des 17. Jahrhunderts
vermehrt Aufführungen deutscher Wanderbühnen.106 Spätestens um 1660 wurde
– wie schon erwähnt – das Ballspielhaus im Schloss Neugebäude in eine Menagerie
umgewandelt.107 Der kaiserliche Hofballmeister Ernst Soander suchte 1736 mit fol-
gender Begründung um seine Pensionierung an, weil „weder einige durchlauchtigste
Herrschaften und in dero Nachfolg in das Ball-Hauss zu spiellen kommen, noch von
andere privat Cavalliere und jungen Herrn des sonst adeliche Ballenspiel gar wenig
geuebet werde“.108 Das ständische Ballhaus in Klagenfurt wurde 1737 in eine Theater-
spielstätte umgebaut,109 diesem Beispiel folgten das neue ständische Ballhaus in Linz
1751 („Comedi Hauß“ und Redoutensaal) und auch Salzburg, wo der Vorgänger-
bau des heutigen Landestheaters 1775 baulich zum „Hoftheater“ mutierte. Wie eng
die gedankliche Verbindung von Ballhaus und Theatergebäude anfänglich war, wird
anlässlich der Aufführung einer Hanswurstiade 1740 in Klagenfurt deutlich, wo es auf
dem Theaterzettel heißt „Der Schauplatz in Pall-Hauß“.110 Manche Ballhäuser stan-
den zumindest zeitweise in ihrer Funktion zuwiderlaufender Verwendung, so nutzte
man die Wiener Privatballhäuser während der Belagerung 1683 als Lazarette.111 Die
Konvertierung der österreichischen Ballhäuser in Theater und Komödienhäuser fügt
sich nahtlos in die Entwicklung der Ballhäuser im Heiligen Römischen Reich, wo die
ehemaligen Ballhäuser entweder in Pferdeställe, Reitschulen, Versammlungshallen,
101
Todte, Fecht-, Reit- und Tanzmeister, 153–155.
102
Ballhäuser fanden neben Theateraufführungen auch als Orte von Hochzeiten (Beispiel Stuttgarter Ballhaus
1575) Verwendung, Gillmeister, Topspin, 210 f.
103
Rudan, Stadttheater, 10.
104
Klettenhammer, Ballspielhäuser, 88; Woditschka, Ballspielhaus, 16.
105
Siehe die Theaterzettel mit der Aufführung von Johann Spiegelberg (geb. 1682) im Franziskanerballhaus
am 16. Oktober 1707 („Hohe Vermählung zwischen Maria Stuart und Heinrich Darley“) Hansen, Formen,
23–27.
106
Kühr, Ballhäuser, 88.
107
Lietzmann, Neugebäude, 98.
108
Kühr, Ballhäuser, 73.
109
Rudan, Stadttheater, 11.
110
Rudan, Stadttheater, 11.
111
Schlager, Wiener Skizzen, 243; Stichwort Ballgasse, https://www.geschichtewiki.wien.gv.at/Wien_
Geschichte_Wiki (Zugriff: 26.3.2019).
165Martin Scheutz
katholische Kirchen, Warenhäuser oder Lazarette umgewandelt wurden. Viele Ball-
häuser fielen Bränden zum Opfer oder wurden einfach abgebrochen, wie das kai-
serliche Ballhaus 1903, und machten damit neuen stadträumlichen Entwicklungen
Platz.112 Die lokalen Toponyme der österreichischen Ballhäuser sind auffällig gleich-
förmig und benennen meist Größe und bauliche Innovation: Ein großes (Innsbruck,
Graz) Ballhaus wird häufig von einem kleinen (Innsbruck, Graz, Wien), ein altes
von einem neuen (Salzburg) Ballhaus unterschieden, mitunter scheint man die Ball-
häuser aus Gründen der besseren mentalen Verortung der Bevölkerung auch nach
einem nahegelegenen Bezugspunkt, wie etwa das „Franziskanerballhaus“ (Wien),
benannt zu haben. In Frankreich wurden die Ballhäuser meist nach dem Besitzer
oder Pächter, mitunter aber auch nach dem Straßennamen bezeichnet.113
Tabelle 1: Übersicht der österreichischen Ballhäuser
Ort erster Nachweis Betreiber Situierung Ende Literatur
1 Wien vor 1525, Brand Landesfürst Burgplatz (Ebers- 1741 Umbau in altes Holzschuh-Hofer, Rekrea-
1525 – Neubau dorfer Haus am Burgtheater; 1746 tionsräume, 198; Karner,
1540 (Ballhaus Burgplatz); Hofburg; neues Ballhaus beim Rekreationsräume, 214 f.;
bei der Burg), ab 1741 beim Kaiserspital; 1903 Sommer-Mathis – Weinberger,
Transferierung, Kaiserspital, (Abriss) Das alte Burgtheater,
1741 Neubau am Minoritenplatz 134–137; Dreger,
Ballhausplatz Baugeschichte, 288;
Kühr, Ballhäuser, 76;
Wandruszka – Reininghaus,
Ballhausplatz, 15
2 Wien 1547 (?) Privatballhaus „Franziskanerball- seit 1658 Theater- Kühr, Ballhäuser, 85–87
haus“; Ballgasse gebäude
3 Innsbruck 1572 Landesfürst Schloss Ambras 1880 Klettenhammer, Ballspiel-
(neben dem häuser, 94–98
Spanischen Saal)
4 Innsbruck 1572/73 Landesfürst Kleines Ballhaus, 1766 (Buchdruckerei Klettenhammer, Ballspiel-
Herrengasse 1–3 im alten Hofballhaus) häuser, 91
112
Behringer, Kulturgeschichte, 245: mit hier teilweise geänderten Daten: Halle/Salle [gegr. 1528] 1738
Abbruch; Zweibrücken [1530] 1760 Theater; Wien [1540] 1748 Burgtheater; Prag [1568] 1723 Pferdestall;
Innsbruck, Ambras [1581] 1880 Abbruch; München [1579] 1820 Abbruch; Heidelberg [1592] 1764 Brand;
Tübingen [1593] 1790 katholische Kirche; Kassel [1594] 1730 Theater; Ingolstadt [1594] 1783 Warenhaus;
Casale Monferrato [1597] ca. 1740 Synagoge; Oldenburg [1605] 1759 Münzprägeanstalt; Marburg [1606]
1757 Lazarett; Bückeburg [1610] 1750 Reitschule; Jever [1620] 1850 Abbruch; Rostock [1623] 1785 Thea
ter; Coburg [1628] 1750 Theater; Passau [1645] 1771 Opernhaus; Hannover [1649] 1672 Theater; Gotha
[1650] 1681 Theater; Regensburg [1652] 1912 Abbruch; Jena [1671] 1796 Theater; Breslau/Wrocław [1677]
1722 Opernhaus; Bremen [1685] 1688 Krankenhaus; Versailles [1686] 1792 Versammlungshalle; Schwerin
[1698] 1788 Theater; Erfurt [1716] 1750 Theater; Hildburghausen [1721] 1755 Theater.
113
Kühr, Ballhäuser, 32.
166Sie können auch lesen