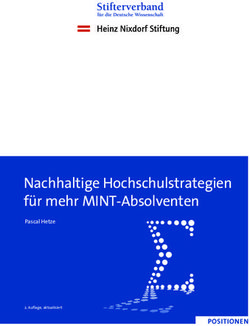LEITFADEN MATURAARBEIT MATURA 2019 - STAND 04.09.2017 - Kanton Luzern
←
→
Transkription von Seiteninhalten
Wenn Ihr Browser die Seite nicht korrekt rendert, bitte, lesen Sie den Inhalt der Seite unten
INHALTSVERZEICHNIS
Vorwort 5
1. Das Thema 6
1.1 Themenwahl 6
1.2 Geeignetes Thema 6
1.3 Organisationsform: Einzel- oder Gruppenarbeit 7
1.4 Arbeitsmethode 7
1.5 Unterschiedliche Typen von Arbeiten 7
1.5.1 Untersuchung 7
1.5.2 Praktische oder produktorientierte Arbeit
(bzw. Organisation einer Veranstaltung) 7
1.6 Kosten 8
1.7 Themenwunsch (Schriftlicher Fixpunkt 1) 8
1.7.1 Die Rahmenbedingungen 8
1.7.2 Das Vorgehen 8
1.8 Vertrag der Maturaarbeit (Schriftlicher Fixpunkt 2) 8
2. Das Vorgehen 9
2.1 Sammeln von Ideen, Material, Unterlagen 9
2.2 Disposition (Schriftlicher Fixpunkt 3) 9
2.3 Individueller Zeitplan 9
2.4 Digitales Arbeitsjournal (Fixpunkt 4) 10
2.5 Vorkorrektur und Zwischenbericht (Schriftlicher Fixpunkt 5) 10
3. Der Zeitplan 11
3.1 Phasen 11
3.2 Planung 11
3.3 Sonstiges 11
4. Die Form der Arbeit 12
4.1 Das Erstellen der Maturaarbeit 12
4.2 Die Sprache 12
4.3 Besonderheiten der praktischen oder produktorientierten Arbeit 13
4.4 Deklaration 13
4.5 Abgabe der Arbeit 135. Formale Richtlinien für die schriftliche Maturaarbeit 14
5.1 Gestaltung / Layout / Umfang 14
5.1.1 Titelblatt 14
5.1.2 Seitengestaltung in der Arbeit 15
5.1.3 Textgestaltung 15
5.1.4 Bilder, Grafiken, Tabellen 15
5.1.5 Umfang 15
5.2 Titel der Arbeit 15
5.3 Inhaltsverzeichnis 15
5.4 Zitate 16
5.5 Wörtliche Wiedergabe (Zitat) / sinngemässe Wiedergabe (Paraphrase) /
Plagiat 17
5.6 Literaturbelege und -verweise im laufenden Text – Autor-Jahr-Systeme /
Fussnoten / Referenznummern 18
5.7 Literaturverzeichnis (Bibliografie) 19
6. Die Präsentation 21
6.1 Ablauf der Präsentation 21
6.2 Bekanntgabe der Noten 21
7. Die Beurteilungskriterien 22
7.1 Schriftliche (praktische) Arbeit 22
7.2 Präsentation 22
7.3 Gesamtbeurteilung 22
7.4 Gesamtnote 23
8. Veröffentlichungen und Ansicht von Maturaarbeiten 23
9. Literatur 24
Anhang 1 – Schriftliche Fixpunkte 25
Schriftlicher Fixpunkt 1 und 2 26
Schriftlicher Fixpunkt 3 27
Schriftlicher Fixpunkt 5 29
Anhang 2 – Die Maturaarbeit in den Reglementen 30
Anhang 3 – Terminplan 34VORWORT
ICH KANN, WEIL ICH WILL, › Sie können Hilfe erhalten und diese
WAS ICH MUSS. bei Referenten und Referentinnen fin-
den, die Sie gewählt haben.
Immanuel Kant (1724-1804), › Sie können am Ende der Arbeit erfolg-
dt. Philosoph reich Materialsuche betreiben, Kapitel
gliedern, aus Büchern zitieren, Inhalte
Liebe Schülerinnen, liebe Schüler kontrovers diskutieren, präzise Frage-
stellungen formulieren, Literaturver-
Vor Ihnen liegt der Leitfaden zur Matu- zeichnisse anfertigen und sauber lay-
raarbeit. Er wird Ihnen helfen, das zu tun, outen.
was Sie müssen und auch können - und › Sie können einen schnellen, einen gu-
hoffentlich auch wollen. ten Weg zum Ziel finden, Sie können
aber auch Umwege machen und sich
verirren.
Damit sind alle wichtigen Wörter ge-
nannt: müssen – können – wollen
› Sie wollen ein Thema, das Ihnen liegt.
› Sie müssen innerhalb eines Jahres eine › Sie wollen diese Herausforderung an-
grosse Arbeit schreiben und diese nach nehmen.
Abschluss des schriftlichen Teiles öf- › Sie wollen eine Note, die Ihrer Arbeit
fentlich präsentieren. gerecht wird.
› Sie müssen sich längere Zeit mit einem › Sie wollen auf Ihre Arbeit stolz sein
Thema intensiv auseinander setzen. können.
› Sie müssen sich auf eine Arbeitsweise
einlassen, die Ihnen einerseits grosse Das wünscht Ihnen und uns
Freiheit lässt, andererseits aber auch
die AG Maturaarbeit
viel Eigenverantwortung abverlangt.
› Sie müssen wissenschaftlich arbeiten.
Alain Ehrsam, Rhea Julia Bucher, Klaus
Helfenstein, Günther Hünerfauth,
Ueli Isenegger und Christian Ruppen
› Sie können bei der Maturaarbeit viel
lernen. Dies zeigen die Erfahrungen
der Maturandinnen und Maturanden
der vergangenen Jahre.
› Sie können Inhalte, Arbeitsweise, Ziele
und den Weg dorthin weitgehend sel-
ber formulieren.
51. DAS THEMA
1.1 THEMENWAHL › Das Material muss zugänglich und in
Reichweite sein. Beachten Sie die zur
Das Finden eines Themas und die Formu- Verfügung stehende Zeit (erfahrungs-
lierung einer klaren Fragestellung bean- gemäss etwa 100 Arbeitsstunden) und
spruchen in der Regel einen längeren Zeit- die übrigen Rahmenbedingungen.
raum. Um Ideen zu bekommen oder sol- › Das Material muss bearbeitbar sein, und
che zu konkretisieren, sind Gespräche und Sie sollen über die für die Arbeit nötigen
Lektüren hilfreich. Führen Sie Gespräche Fähigkeiten und Hilfsmittel verfügen so-
nicht nur mit Lehrkräften oder anderen wie die gewählten Arbeitsmethoden
Fachleuten, sondern beziehen Sie Ver- entweder schon beherrschen oder sich
wandte und Bekannte mit ein. Machen Sie innert nützlicher Frist aneignen können.
sich Notizen von diesen Gesprächen. Je
offener und vielfältiger Sie ein Thema an- 1.2 GEEIGNETES THEMA
gehen, gewissermassen über Tage oder
Wochen umkreisen und ausleuchten, des- Grundsätzlich ist jedes Thema möglich,
to leichter werden Sie zu einer Fülle von das dem Bildungsziel des Gymnasiums
Ideen und Realisierungsmöglichkeiten und gemäss MAR Art. 5 entspricht. Für eine
auch zu einer genauen Fragestellung gute Arbeit ist eine klare und genaue Fra-
kommen. Es empfiehlt sich auch, einen gestellung die zentrale Voraussetzung.
solchen «Reifungsprozess» mit einer gewis- Überlegen und fragen Sie sich genau, was
sen Hartnäckigkeit durchzumachen, also Sie interessiert, was Sie untersuchen, was
nicht nur hie und da daran zu denken o- Sie wissen möchten, um das Thema präzi-
der darüber zu reden. Folgende Kriterien ser zu formulieren. Vermeiden Sie eine
sollten erfüllt sein (nach Fragnière, 1993): breite, sehr offene und damit unklare Fra-
› Das Thema soll Sie wirklich interessie- gestellung.
ren. An einer selber gestellten Aufgabe
arbeitet es sich in der Regel motivierter.
Geeignete Beispiele Uneignete Beispiele
Auswirkungen der Trittbelastung durch Weidetiere auf die Die Ökologie von Wiesen
Vegetation in extensiv bewirtschafteten Wiesen
Die verkehrstechnischen Auswirkungen des Lawinenwin- Lawinen und Verkehr
ters 98/99 auf die Transitachse Gotthard und San Ber-
nardino
Die Umsetzung von Mirós Bild «Der Hund» in zeitgenössi- Bild und Musik
sche Klaviermusik
Die Mutter-Kindbeziehung bei Hauskatzen Verhaltensstudien an Katzen
Die Berichterstattung der Luzerner Zeitungen über die Die Kubakrise 1962
Kubakrise 1962
Bruchstücke der Grossstadtwelt in Alfred Döblins Roman Der Grossstadtroman
«Berlin Alexanderplatz»
61.3 ORGANISATIONSFORM: 1.5 UNTERSCHIEDLICHE TYPEN
EINZEL- ODER GRUPPENARBEIT VON ARBEITEN
Schon sehr früh müssen Sie sich überle- 1.5.1 Untersuchung
gen, ob Sie die Arbeit alleine oder in ei- Die wissenschaftliche Untersuchung ist
ner Gruppe machen möchten. Die die klassische Version der Maturaarbeit.
Gruppe umfasst höchstens drei Mitglie- Ob Textvergleiche und -interpretationen,
der, die Gruppengrösse muss mit der be- naturwissenschaftliche Experimente und
treuenden Lehrkraft abgesprochen wer- deren Auswertung oder Feldstudien zu
den. Wenn Sie an eine Gruppenarbeit gesellschafts- oder sozialwissenschaftli-
denken, sollten Sie sich folgende Fragen chen Fragen, zumeist wird mit Hilfe ge-
stellen: eigneter und in dem Fachgebiet aner-
› Eignet sich das Thema überhaupt für kannter Methoden eine Fragestelllung
eine Gruppenarbeit? oder Hypothese untersucht, überprüft
› Soll innerhalb des Themas jedes und reflektiert.
Gruppenmitglied ein Unterprojekt be-
arbeiten, oder behandeln alle Grup-
1.5.2 Praktische oder produktorientierte
penmitglieder gemeinsam den ganzen
Arbeit (bzw. Organisation einer Veran-
Themenbereich?
staltung)
Innerhalb eines ausgewählten Themen-
1.4 ARBEITSMETHODE
bereichs wird selbstständig ein Schwer-
Die «Weisungen der kantonalen Maturi- punkt entwickelt und praktisch umgesetzt
tätskommission» (siehe Anhang 1) um- oder gestalterisch formuliert.
schreiben den Sinn und Zweck der Matu- Prozess und Produkt sind beide wichtig,
raarbeit. Zur Erreichung der dort formu- deshalb muss neben den Experimenten,
lierten Ziele ist eine systematische Ar- Skizzen, Modellen und Produkten auch
beitsweise unabdingbar. In der Matu- die theoretische Reflexionsarbeit des Ent-
raarbeit soll ein Thema möglichst vielfäl- stehungsprozesses in einem Arbeitspro-
tig und umfassend angegangen werden, tokoll sichtbar gemacht werden. Uner-
mit dem Ziel, überprüfbare Antworten wünscht sind der «geniale Wurf» und die
oder Aussagen zu suchen sowie diese «Superidee», in denen keine Entwicklung
klar zu formulieren und darzulegen. formaler und inhaltlicher Aspekte zum
Tragen kommt.
Umfang und Form der Arbeit ergeben
sich aus der individuellen Fragestellung
und den entsprechend gewählten Ar-
beitsformen.
Die praktische Maturaarbeit wird wie die
anderen mündlich präsentiert.
71.6 KOSTEN Die von den Lehrpersonen vorgeschlage-
nen Themen werden in einer Broschüre zu-
Grundsätzlich werden anfallende Kosten
sammengestellt.
durch die Schülerinnen und Schüler getra-
gen. In ausserordentlichen Fällen kann die Gesprächsrunde 1
betreuende Lehrperson vor der Ausschrei- 1. Die Schülerinnen und Schüler ent-
bung bzw. der Genehmigung des Themas scheiden sich für eine Einzelarbeit oder
bei der Schulleitung einen Budgetantrag formieren sich zu einer Schülergruppe.
einreichen. Auch unvorhergesehene grös- 2. Die Schülerinnen und Schüler bzw.
sere Kosten kann die Schule nur finanzie- Schülergruppen wählen ein ihnen ge-
ren, wenn ein ausreichend begründetes eignet und bearbeitbar erscheinendes
Gesuch vorliegt und von der Schulleitung Thema aus. Dieses Thema kann aus
bewilligt wird. der offiziellen Liste stammen oder ei-
genständig gewählt sein.
3. Die Schülerinnen und Schüler bzw.
1.7 THEMENWUNSCH Schülergruppen suchen sich eine MAR-
(SCHRIFTLICHER FIXPUNKT 1) Lehrperson, die dieses Thema als Ma-
turaarbeit akzeptiert und betreut. Die
1.7.1 Die Rahmenbedingungen Lehrperson bestätigt die provisorische
› Die Schülerinnen und Schüler wählen Zusage mit ihrem Visum auf dem For-
das Thema ihrer Arbeit in Absprache mular (siehe Anhang 1).
mit der betreuenden Lehrperson.
› Jede MAR-Lehrkraft ist verpflichtet,
1.8 VERTRAG DER MATURAARBEIT
mindestens zwei Arbeiten zu betreuen,
(SCHRIFTLICHER FIXPUNKT 2)
falls dazu Bedarf besteht.
› Eine MAR-Lehrkraft darf nur in Aus- Gesprächsrunde 2
nahmefällen mehr als drei Schülerin-
Mit der Unterschrift bestätigen die Schülerin
nen und Schüler betreuen.
oder der Schüler sowie die betreuende
› Eine MAR-Lehrkraft hat das Recht, die
Lehrperson, dass sie bis zum Abschluss der
Betreuung einer Arbeit abzulehnen,
wenn sie triftige Gründe nennen kann. Maturaarbeit zusammenarbeiten und die
› Jede MAR-Lehrkraft ist verpflichtet, be- Rahmenbedingungen, wie sie im MAR
treuend und korreferierend bei der Be- (eidgenössisches Maturitätsanerkennungs-
urteilung von maximal fünf Maturaar- reglement), im «Reglement für die Maturi-
beiten mitzuwirken. tätsprüfungen im Kanton Luzern» (SRL 506),
in den Weisungen der kantonalen Maturi-
tätskommission sowie im Leitfaden der
1.7.2 Das Vorgehen
Kantonsschule Seetal für die Maturaarbeit
Jede MAR-Lehrkraft reicht in Absprache festgehalten werden, zur Kenntnis genom-
mit der Fachschaft Themen für eine Matu- men haben. Dieser Vertrag muss gemäss
raarbeit ein und verpflichtet sich, diese bei Zeitplan abgeschlossen sein und kann nicht
Bedarf zu betreuen. ohne zwingende Gründe aufgelöst werden.
82. DAS VOR-
GEHEN
2.1 SAMMELN VON IDEEN, Im Laufe der Arbeit können neue Aspekte
MATERIAL, UNTERLAGEN auftauchen, sodass Sie die Disposition
um einzelne Teile erweitern müssen oder
Sobald das Thema festgelegt ist, begin-
können. Das Formular zur Disposition
nen Sie zum Thema zu lesen, Material zu
finden Sie digital als Download auf der
sammeln und wiederum häufig mit ver-
Homepage.
schiedenen Personen zu diskutieren. In
dieser Phase sind Kreativität und Phanta-
sie wichtig. Arbeiten Sie mit verschiede- 2.3 INDIVIDUELLER ZEITPLAN
nen Arbeitsmethoden wie Brainstorming,
Mind-Mapping, Zettelkasten usw. Ma- Der individuelle Zeitplan beinhaltet die
chen Sie sich Notizen, halten Sie fest, Terminierung und Organisation der ein-
was Sie wo gefunden haben; das erspart zelnen Arbeitsschritte und gibt Ihnen
Ihnen später viel Zeit. Antworten auf die folgenden Fragen:
Was muss bis zum Zwischenberichts vor-
liegen? Bis wann muss ich welche Vorar-
2.2 DISPOSITION beiten erledigt, welche Gespräche ge-
(SCHRIFTLICHER FIXPUNKT 3) führt haben? Wie konzipiere ich den Teil
mit meiner Eigenleistung (Experiment,
Mit Lesen, Materialsammeln und Disku-
Befragung, Malen, Modellieren, Kompo-
tieren erhalten Sie nach und nach eine
nieren usw.) Wann beginne ich mit der
Übersicht über das Thema. Damit schält
schriftlichen Abfassung der Arbeit? Bis
sich langsam auch eine Vorstellung her-
wann will ich die mündliche Präsentation
aus, wie die Arbeit aufgebaut bzw. ge-
konzipiert und vorbereitet haben? Wel-
gliedert werden könnte. Zunächst wird
che zusätzlichen Unterlagen, Informatio-
das eine Art Grobkonzept sein. Dieses
nen, Materialien brauche ich für die Prä-
wird nun zum Leitfaden für das Ordnen
sentation?
der Materialien und Lektüreunterlagen.
Am Ende dieser Phase werden Sie eine
detaillierte Disposition erstellen, die auf-
zeigt, welche Teile Ihre Arbeit enthalten
wird. Diese Disposition (evtl. schon ein
erstes grobes Inhaltsverzeichnis) muss mit
der betreuenden Lehrkraft besprochen
werden.
92.4 DIGITALES ARBEITSJOURNAL 2.5 VORKORREKTUR UND ZWI-
(FIXPUNKT 4) SCHENBERICHT
(SCHRIFTLICHER FIXPUNKT 5)
Seit im Schuljahr 2015/16 die Kantons-
schule Seetal an der Studie SelMa teil- Gesprächsrunde 3
nahm, notieren die Lernenden ihre Tätig- In der Zeit zwischen der Abgabe der Dis-
keiten in ein digitales Tagebuch. position und dem Zwischenbericht sind
die Schülerinnen und Schüler verpflichtet,
«Das Online-Lerntagebuch ermöglicht vier bis sechs Seiten ihres Textes mit ih-
die schriftliche Dokumentation des Lern- rem Betreuer genau zu analysieren (vgl.
und Arbeitsprozesses.» 1 Beurteilungsraster). Anschliessend wird
Wir empfehlen, für das Arbeitsjournal ab der Transfer zur restlichen Arbeit voraus-
dem Schuljahr 2016/17 in OneNote gesetzt und diese erst nach der Abgabe
ein Notizbuch zu eröffnen, dass sich Ler- als Ganzes beurteilt.
nender und Referent zur gemeinsamen Nach Ansicht des (digitalen) Arbeitsjour-
Nutzung freigeben. nals (vgl. 2.4), einzelner Probeseiten (vgl.
2.6) und ggf. weiterer von der betreuen-
Der Betreuer erhält damit auf alle Do- den Lehrperson verlangter Unterlagen
kumente Zugriff, die von (den) Schülerin- (z.B. Zeitplan für das weitere Vorgehen,
nen und Schülern im OneNote- vorläufige Literaturliste etc.) erstellt diese
Notizbuch freigeben wurden und kann einen Zwischenbericht. Dieser dient als
seinerseits Einträge formulieren und Do- verbindliche Standortbestimmung bezüg-
kumente hochladen. lich Einhaltung des Zeitplans, Ausrich-
tung der Weiterarbeit und voraussichtli-
Das Arbeitsjournal, in welcher Form cher Beurteilung. Der Zwischenbericht
auch immer gewählt, bildet einen obliga- fliesst in die Beurteilung des Arbeitspro-
torischen Bestandteil der Arbeit. zesses ein.
Das Arbeitsjournal wird vom Betreuer
eingesehen (Fixpunkt 4) und für den Zwi-
schenbericht herangezogen (Fixpunkt 5).
Vergleiche Terminplan, Anhang 3.
1
«Selbstreguliertes Lernen und Maturaarbeit» (SelMa) ist eine wissenschaftli-
che Studie der Universität Zürich mit dem Ziel der Optimierung des Arbeits-
prozesses. Aus nachfolgendem Link sind die obigen Informationen zitiert.
http://www.ife.uzh.ch/research/teb/forschung2/aktuelleprojekte/selma/selm
aindex.html
103. DER ZEITPLAN
3.1 PHASEN Diese Disposition vgl. auch Kapitel 2
(Fixpunkt 3, als Worddokument verfüg-
› Themenwahl und Abschluss des Ver-
bar) werden Sie im Frühjahr dem Betreu-
trags (Fixpunkte 1/2)
er abgeben und mit ihm gemeinsam
› Sondieren: Lesen, Ideen und Material
druchsprechen.
sammeln
Im Punkt 7 des Fixpunktes 3 wollen Sie
› Disposition und deren Beurteilung
ihren konkreten Zeitplan erstellen. Tun
durch die betreuende Lehrperson (Fix-
Sie dies z.B. mithilfe einer EXCEL-Datei
punkt 3)
oder outlook-Terminplanung.
› Recherchieren: Studium der Fachlitera-
Der Terminplan im Anhang 3 orientiert
tur, Beobachtungen, Versuche, Inter-
Sie über die einzelnen Phasen der Arbeit
views, Modelle entwerfen, weiteres
Material und/oder Literatur suchen und die genauen Daten.
› Auswertung und erste Niederschrift; in
dieser Phase wird der Zwischenbericht 3.3 SONSTIGES
erfolgen (Fixpunkte 4/5).
Für eine gelungene Maturaarbeit sind er-
› Endfassung mit Inhalts- und Literatur-
verzeichnis, ästhetische Gestaltung fahrungsgemäss 100 - 130 Arbeitsstun-
den einzurechnen. Abweichungen nach
oben und unten sind je nach Arbeitseffi-
3.2 PLANUNG zienz und persönlichem Anspruch mög-
lich.
Eine solche grössere Arbeit erfordert eine
genaue Zeitplanung. Die Eckdaten (An-
Gespräche mit der Betreuungsperson
meldung des Themas, Besprechung der
und die Arbeit selbst finden ausserhalb
Disposition, Besprechung des Zwischen-
der Unterrichtszeiten statt. Es wird kein
berichts, Abgabe der Arbeit, Präsentati-
Sonderurlaub genehmigt, im Rahmen
on) sind gegeben. Trotzdem ist eine per-
der Regeln kann der Lernende UOB ein-
sönliche Zeitplanung sehr wichtig. Über-
setzen.
legen Sie, ob bestimmte Teile Ihrer Arbeit
an bestimmte Zeiten gebunden sind (z.B.
Absenzen während der letzten Woche vor
Tierbeobachtungen an Jahreszeiten).
der Abgabe der Arbeit werden nur gegen
Planen Sie Zeiten grosser schulischer und
Vorweisen eines Arztzeugnisses entschul-
privater Belastung, die Ihnen im Voraus
digt.
bekannt sind, mit ein. Klären Sie frühzei-
tig ab, ob und wann Sie einen bestimm-
ten Arbeitsplatz oder bestimmte Hilfsein-
richtungen benützen können.
114. DIE FORM
DER ARBEIT
4.1 DAS ERSTELLEN DER 4.2 DIE SPRACHE
MATURAARBEIT
Bei fremdsprachlichen Arbeiten muss
Das Erstellen einer wissenschaftspropä- mindestens die Zusammenfassung (Re-
deutischen Arbeit ist ein sehr komplexer sümee, Abstract) im Umfang von zwei
Vorgang. Er umfasst als wesentliche Seiten in der Unterrichtssprache verfasst
Schritte das Sondieren, das Recherchie- werden. Nichtsprachliche Themen kön-
ren, das Konzipieren, das Beschaffen nen auch in einer Fremdsprache, welche
und Ordnen von Material, das eigentli- an der Schule unterrichtet wird, ge-
che Schreiben, das grafische Gestalten schrieben werden (Biologiearbeit in Eng-
und schliesslich das korrekte Belegen lisch, Geschichtsarbeit in Französisch,
von Literatur und Quellen. usw.).
Wichtig ist, dass Sie klar formulieren.
Eigene und fremde Beiträge müssen Beherzigen Sie folgenden Tipp: «Lange
auseinander gehalten werden. Hilfeleis- Sätze im Fachjargon zusammen mit der
tungen anderer Personen sowie verwen- Möglichkeitsform sollen meist die Banali-
dete Informationen von Fachliteratur bis tät einer Aussage verschleiern und wei-
Internet müssen deklariert werden. sen darauf hin, dass der Urheber selber
nicht so genau Bescheid weiss.»2
Sind die verwendeten Quellen nicht kor-
rekt belegt, erfolgt ein Abzug von der Verwenden Sie dort, wo es sachlich ge-
Note; wie hoch der Abzug ist, richtet sich rechtfertigt ist, die weibliche und die
nach dem Gewicht des nicht korrekt be- männliche Form. Mit etwas Phantasie
legten Teils. In schwerwiegenden Fällen findet sich meist eine elegante ge-
kommen § 25 (SRL 506) des Reglements schlechtsneutrale Formulierung.
über die Maturitätsprüfungen am Gym-
nasium bzw. § 10 der Weisungen der
Maturitätskommission vom 13. Januar
2009 (Stand 1. August 2017) zur An-
wendung (siehe auch 5.5 Plagiat und
Anhang 6).
2
Gmür Brianza, S. 11.
124.3 BESONDERHEITEN DER PRAK- 4.5 ABGABE DER ARBEIT
TISCHEN ODER PRODUKTORIEN-
TIERTEN ARBEIT Gesprächsrunde 4
Die Arbeit wird am Freitag vor der
Jede praktische Maturaarbeit beinhaltet
Herbst-Studienwoche vor den Herbst-
einen schriftlichen Teil, der den Entste-
ferien in vier gebundenen Exemplaren
hungsprozess, die Grundideen und die
(betreuende Lehrperson, Korreferent/in,
Ergebnisse aufzeigt und kommentiert.
Schularchiv, Mediothek) auf dem Sekre-
Form und Anlage entsprechen in redu-
tariat abgegeben. Die ganze Arbeit (aus-
zierter Weise derjenigen der schriftlichen
ser natürlich praktische Teile) muss zu-
Maturaarbeit einer Untersuchung. Um-
sätzlich als pdf-Datei über die Webseite
fang und Schwerpunkt werden mit der be-
der KS Seetal auf den Abgabetermin hin
treuenden Lehrperson abgesprochen. Das
hochgeladen werden. Ein Produkt, sei
Arbeitsjournal, eventuell auch Bilder, sol-
es ein künstlerisches Werk, ein techni-
len in die Abfassung miteinbezogen wer-
sches Produkt oder auch die Organisati-
den. Der schriftliche Teil wird mitbewertet.
on einer Veranstaltung, ist gemeinsam
Die Gewichtung von praktischem und
mit dem begleitenden Dokument zum
schriftlichem Teil wird im Beurteilungsras-
Abgabetermin der Arbeit abge-
ter festgelegt und spätestens zur Einrei-
schlossen. Die Form der Abgabe bzw.
chung der Disposition vereinbart.
Dokumentation eines Produktes legen
der Referent und Lernende oder Lernen-
4.4 DEKLARATION der im Vorhinein fest.
Vor der Präsentation haben Sie die Mög-
Die Maturaarbeit enthält am Schluss lichkeit, bei Ihren Referenten und Refe-
folgende Deklaration: rentinnen eine summarische Rückmel-
dung zur Arbeit und Tipps für die Präsen-
«Ich erkläre hiermit, tation einholen.
› dass ich die vorliegende Arbeit selbstän-
dig und nur unter Benutzung der ange-
gebenen Quellen verfasst habe,
› dass ich auf eine eventuelle Mithilfe Drit-
ter in der Arbeit ausdrücklich hinweise,
› dass ich vorgängig die Schulleitung und
die betreuenden Lehrpersonen informie-
re, wenn ich diese Maturaarbeit bzw.
Teile oder Zusammenfassungen davon
veröffentlichen werde und/oder Kopien
dieser Arbeit zur weiteren Verarbeitung
an Dritte aushändigen werde.»
Ort: Datum: Unterschrift:
135. FORMALE 5.1 GESTALTUNG / LAYOUT /
UMFANG
RICHTLINIEN 5.1.1 Titelblatt
FÜR DIE Die folgenden Angaben müssen auf dem
Titelblatt vorhanden sein. Anordnung,
SCHRIFTLICHE Reihenfolge und ansprechende grafische
MATURAARBEIT Gestaltung des Titelblattes ist Ihnen
überlassen.
› Titel (und ev. Untertitel)
Das Verfassen des schriftlichen Teils Ihrer › Maturaarbeit (im Fach xy = fakultativ)
Maturaarbeit bedeutet, einen Text mit › Kantonsschule Seetal
wissenschaftlichem Anspruch und nach › Langzeitgymnasium oder Kurzzeitgym-
wissenschaftlichen Spielregeln herzustel- nasium
len. › vorgelegt oder eingereicht von Vorna-
me und Name der SchülerIn
Wissenschaftlich arbeiten heisst, darauf › Titel (z.B. Dr., lic. phil. I, ... aber keine
zu achten, dass alle Argumentations- Anrede wie Herr/Frau), Vorname und
schritte jederzeit nachprüfbar und nach- Name der Referent/in
vollziehbar bleiben. Wissenschaftliche › Titel (z.B. Dr., lic. phil. I, ... aber keine
Texte zeichnen sich aus durch eine klar Anrede wie Herr/Frau), Vorname und
vorgeschriebene Form. Es existiert aller- Name der Korreferent/in
dings auch ein gewisser Spielraum. Ein › Schuljahr 20xx/20xx
einmal gewähltes Verfahren muss aber › Baldegg, xy. Oktober 20xx
konsequent verfolgt werden. Die Be-
treuerin oder der Betreuer Ihrer Matu-
raarbeit orientieren Sie darüber, welche
Form für Ihre Arbeit verlangt oder gestat-
tet wird.
Das vorliegende Papier enthält Vorgaben
für die wichtigsten Elemente der Matu-
raarbeit und gibt Ihnen in knapper Form
einige nützliche Tipps.
145.1.2 Seitengestaltung in der Arbeit 5.2 TITEL DER ARBEIT
› Seiten A4, hoch, Ränder: auf allen Sei- Titel und Untertitel sollen informieren
ten je 2.5 cm
und zum Lesen anreizen. Der Haupttitel
› Blätter nur einseitig bedruckt ist eher kurz gehalten und prägt sich den
› leserfreundliche Schrift Lesenden schnell ein. Der Untertitel prä-
› Schriftgrösse analog Arial 12 zisiert und widerspiegelt zusammen mit
› Zeilenabstand 1 ½ dem Titel die zentrale Frage der Arbeit.
› Seiten nummeriert Sprechen Sie den definitiven Titel mit Ih-
ren Betreuenden ab.
5.1.3 Textgestaltung
› Entscheid für eine Schriftart
5.3 INHALTSVERZEICHNIS
› automatische Silbentrennung
› Entscheid für wenige Arten der Zei- Ihre Arbeit muss klar gegliedert sein.
chenhervorhebung (fett / kursiv / un- Diese Gliederung3 wird im Inhaltsver-
terstrichen), diese konsequent anwen- zeichnis sichtbar. Das Inhaltsverzeichnis
den vermittelt den Lesenden einen Überblick
› Schattierungen sparsam einsetzen über die Arbeit. Das Inhaltsverzeichnis
beinhaltet zu jedem Kapitel / Titel / Un-
5.1.4 Bilder, Grafiken, Tabellen tertitel / Abschnitt eine Seitenzahl.
› Bilder, Grafiken, Tabellen immer mit
Nummerierung und Legende In Absprache mit Ihrem Betreuer wählen
› keine Tabellen, Grafiken ohne Erläute- Sie zwischen Dezimalklassifikation (heute
rungen im Text üblich) oder einer gemischten Klassifika-
tion (siehe Beispiele).
5.1.5 Umfang
Microsoft Word verfügt über eine Funkti-
Die Maturaarbeit umfasst in der Regel on, welche automatisch das Inhaltsver-
20 bis 25 Seiten Text (ohne Inhaltsver- zeichnis erstellt und aktualisiert.
zeichnis, Literaturverzeichnis, Abbildun-
gen und Anhang). Abweichungen nach Dezimalklassifikation:
oben sind frühzeitig mit der Betreuungs- 1. Einleitung 2
2. Regressionsanalyse 3
person zu besprechen. 2.1. Das lineare Standardregressionsmodell 3
Bei Gruppenarbeiten erhöht sich der 2.2. Der Kleinste-Quadrate-Schätzer 4
2.3. Der verallgemeinerte KQ-Schätzer 6
Umfang nach der Zahl der beteiligten 3. Relative Effizienz des KQ-Schätzers 8
Schülerinnen und Schüler. 3.1. Problemstellung 8
Für musisch-kreative Arbeiten gelten spe-
zielle Regelungen, über die die entspre-
chenden Fachlehrpersonen Auskunft ge-
ben können. 3
Nach: Brogli, A. und Weidmann, H.: Tipps für die schriftliche Maturaar-
beit, Kantonsschule Zug, Schuljahr 2004/05.
153.2. Theorem 9 5.4 ZITATE
3.2.1. Literaturüberblick 9
3.2.2. Formulierung 10
3.2.3. Beweis 12
Eine wissenschaftliche Arbeit enthält Zita-
4. Zusammenfassung 15 te. Diese illustrieren und stützen eigene
5. Schlusswort 16 oder fremde Gedanken. Zitate sind op-
6. Literaturverzeichnis 17
tisch jederzeit erkennbar, da sie sich ty-
pografisch vom restlichen Text der Arbeit
Dezimalklassifikation, typografisch gestaltet:
unterscheiden. Zitate können abgesetzt
1. Einleitung 2
oder im Text eingeflochten sein. Je nach
2. Regressionsanalyse 3 Gewicht, die der Aussage zugemessen
2.1. Das lineare Standardregressionsmodell 3
2.2. Der Kleinste-Quadrate-Schätzer 4
wird, werden sie unterschiedlich darge-
2.3. Der verallgemeinerte KQ-Schätzer 6 stellt. Längere Zitate werden in der Regel
abgesetzt.
3. Relative Effizienz des KQ-Schätzers 8
3.1. Problemstellung 8
3.2. Theorem 9
Verschiedene Varianten von Zitaten
3.2.1. Literaturüberblick 9
3.2.2. Formulierung 10
3.2.3. Beweis 12 a) vollständige Aussage, abgesetzt:
Auch Jules Michelet hat den Kaffee als
4. Zusammenfassung 15 das Genussmittel der Aufklärungszeit
dargestellt:
5. Schlusswort 16
Der Kaffee, das nüchterne Getränk,
6. Literaturverzeichnis 17 mächtige Nahrung des Gehirns, die,
anders als die Spirituosen, die Reinheit
und die Helligkeit steigert; der Kaffee,
Gemischte Klassifikation:
der die Wolken der Einbildungskraft
I. Einleitung 2
und ihre trübe Schwere vertreibt; der die
II. Zur Biografie von Joseph Roth 2
Wirklichkeit der Dinge jäh mit dem Blitz
III Der Roman «Radetzkymarsch»
der Wahrheit erleuchtet (Fussnote/
1. Die historische Dimension des Romans 3
Referenz).
2. Die Motivik
a) Das Dienermotiv 6
b) Das Kaiserbild-Motiv 6
b) vollständige Aussage, im Text als
c) Das Untergangsmotiv 7
d) Das Radetzkymarsch-Motiv 8 integriert, kursiv
3. Figuren Auch Jules Michelet hat den Kaffee als
a) Karl Joseph von Trotta 9 das Genussmittel der Aufklärungszeit
b) Der Kaiser Franz Joseph 11 dargestellt: Der Kaffee, das nüchterne
c) Graf Wojciech Chonicki 12
Getränk, mächtige Nahrung des Gehirns,
IV. Die Aktualität von Joseph Roth 13
V. Zusammenfassung 15 die, anders als die Spirituosen, die Rein-
VI. Literaturverzeichnis 16 heit und die Helligkeit steigert; der Kaffee,
der die Wolken der Einbildungskraft und
(Beispiele nach: Schardt / Schardt 1999, S. 56; in: ihre trübe Schwere vertreibt; der die Wirk-
Krämer 1999, S. 108)
lichkeit der Dinge jäh mit dem Blitz der
Wahrheit erleuchtet (Fussnote/Referenz).
16c) verkürzte Aussage (...), an den 5.5 WÖRTLICHE WIEDERGABE
Ausgangssatz angepasst, im Text (ZITAT) / SINNGEMÄSSE WIEDER-
integriert, GABE (PARAPHRASE) / PLAGIAT
mit «» versehen
Auch Jules Michelet hat den Kaffee «das Gelesenes kann entweder wörtlich zitiert
nüchterne Getränk, mächtige Nahrung oder auch sinngemäss in eigenen Wor-
des Gehirns, (...) der die Wirklichkeit der ten wiedergeben werden. Weisen Sie
Dinge jäh mit dem Blitz der Wahrheit er- nicht alle fremden Gedanken nach, nur
leuchtet» (Fussnote/Referenz) beschrie- solche Stellen, die Ihnen für Ihre Arbeit
ben. eine wichtige Anregung gegeben haben.
Allgemeinwissen muss nicht belegt wer-
d) Einzelwörter (...), im Satz einge- den.
bettet, mit «»
Nach Jules Michelet erleuchte der Kaf- Das Schlimmste, was Ihrer Arbeit passie-
fee, dieses «nüchterne Getränk», unsere ren könnte, wäre der Nachweis eines
Wirklichkeit «iäh mit dem Blitz der Wahr- Plagiats. Ein Plagiat ist die wörtliche
heit» (Fussnote/Referenz). Wiedergabe einer fremden TextsteIle oh-
ne Anführungszeichen und ohne Quel-
Alle vier Varianten des Zitierens sind kor- lennachweis. Wenn jemand auf diese Art
rekt. Beachten Sie aber auf jeden Fall: eine Stelle abschreibt, gilt dies als Betrug
Jedes Zitat muss wortwörtlich und zei- und als schwerer Verstoss gegen die wis-
chengenau sein. Schreibfehler müssen senschaftliche Redlichkeit. Auch wenn
übernommen werden. Wenn Sie etwas die Stelle nicht ganz wörtlich abgeschrie-
kursiv oder fett hervorheben, schreiben ben, das Gestohlene aber als Eigenes
Sie dazu: [Hervorhebung von xy = ausgegeben wird, gilt dies als Plagiat.
Ihr Vorname, Name]. Die ganze Arbeit ist damit disqualifiziert.
Es spielt dabei keine Rolle, ob das Plagi-
Jedes Zitat steht in Anführungszeichen at in Folge böser Absicht oder Flüchtig-
oder Kursivschrift. Ausser es sei - wie im keitsfehler entstanden ist.
ersten Beispiel - als längeres Zitat klar Bei Nachweis eines Plagiats gilt die Ar-
vom Text abgegrenzt und in anderer beit als zurückgewiesen und die Matura
Schriftgrösse dargestellt. als nicht bestanden (vgl. §25 SRL 506
und Weisungen der Maturitätskommissi-
Jedes Zitat muss nachgewiesen werden. on, siehe Anhang 2).
Die Quelle wird angegeben, so dass sie
jederzeit überprüfbar ist. Fügen Sie im-
mer eine Fussnote (im PC unter «Einfü-
gen») oder eine Referenz nach einem
analogen Zitiersystem (vgl. 6) ein.
17Zitat 5.6 LITERATURBELEGE UND -
Nach Wolfgang Schievelbusch «erscheint VERWEISE IM LAUFENDEN TEXT –
die Schokolade dem 17. und 18. Jahr- AUTOR-JAHR-SYSTEME / FUSS-
hundert als Gegenstück zum Kaffee. Die- NOTEN / REFERENZNUMMERN
ser gilt ... als ausgesprochen körperfeind-
Wird an einer Stelle auf Literatur zurück-
lich und anti-erotisch. ... Umgekehrt die
gegriffen oder aus einem anderen Text zi-
Schokolade. Sie nährt den Körper und die
tiert, so ist die betreffende Literatur oder
Potenz, sie repräsentiert barock-
Quelle an dieser Stelle genau anzugeben.
katholische Körperlichkeit gegen die pro-
Einzelne Fachwissenschaften oder Univer-
testantische Askese.» (Schievelbusch 1981,
sitäten verwenden unterschiedliche Syste-
S.99f.)
me. Jedes ist in der Maturaarbeit erlaubt,
wenn es anerkannt ist, die Quelle des zi-
Sinngemässe Wiedergabe
tierten Textes eindeutig identifiziert und im
(Paraphrase)
Verlauf der Arbeit durchgehend verwendet
In der Aufklärungszeit verstand man Kaf-
wird.
fee und Schokolade als Gegensätze: Das
alte Getränk war lustvoll körperlich er-
Die folgenden drei Systeme sind insofern
fahrenes Genussmittel, das neue dage-
geeignet, als dass sie einfach handhabbar
gen kopflastig und gegen die niederen
und übersichtlich sind. Bei allen wird im
Bedürfnisse des Körpers gerichtet (Schie-
laufenden Text nur ein kurzer Verweis ge-
velbusch 1981, S.99f.).
macht, die vollständige Quellenangabe
findet sich im Literaturverzeichnis.
Plagiat = (beinahe) wörtliche Wie-
dergabe ohne Quellenangabe
Autor-Jahr-System
Die Schokolade wird als Gegensatz zum
Das Autor-Jahr-System ist das aktuell
Kaffee verstanden: Dieser gilt als ausge-
meistverwendete System und folgt den
sprochen anti-erotisch und körperfeind-
den Regeln der American Psychological
lich; dagegen nährt die Schokolade Kör-
Society (APA).
per und Potenz. Schokolade ist barock-
Auf jede Quelle wird mit dem Namen des
katholisch, Kaffee protestantisch und as-
Autors und ihrem Erscheinungsjahr ver-
ketisch.
wiesen, bei direkten wie bei sinngemäs-
sem Zitaten (Bartlett, 1932, S. 14).
Die genaue Angabe der Quelle findet
sich im Literaturverzeichnis.
Hinweis zu Kapitel 5.5 – 5.7:
Wer ein Worddokument verfasst, kann
Das bei Thürmann/Otten (1992) vorge-
unter «Verweise» die Funktionen für stellte Modell bilingualen Lernens ...
Fussnoten, Zitate und Literaturverzeichnis
Dies fällt in eine eigentliche «Aufmerk-
nutzen.
samkeitslücke», um mit Frey (1996, S.
35) zu sprechen.
18Hat ein Autor im gleichen Jahr mehrere 5.7 LITERATURVERZEICHNIS
Publikationen, so werden diese zusätzlich (BIBLIOGRAFIE)
mit Kleinbuchstaben gekennzeichnet.
Der letzte Teil Ihrer Arbeit heisst «Literatur-
verzeichnis» oder «Bibliografie». Sprechen
Danneberg (1998a) erwähnte, dass ...
Sie mit den Betreuenden ab, ob Sie Ihr Lite-
raturverzeichnis auch noch nach «Primärli-
Fussnoten
teratur» und «Sekundärliteratur» unterteilen
Es ist nicht notwendig, bei jeder nachfol-
müssen.
genden Fussnote wieder alle Angaben zu
liefern. Gehen Sie so vor. Das erste Mal ist
In der Bibliografie geben Sie alphabetisch
der Nachweis vollständig (Autorennach-
alle Quellen an, die Sie in der Arbeit be-
name und Jahr, gefolgt von der Seitenzahl)
nutzt haben. Geben Sie keine Quellen an,
In den unmittelbar folgenden Fussnoten
die nicht zitiert werden. Es geht nicht um
heisst es nur noch: A.a.O., S.17 oder ebd.,
eine Liste von weiterführender Literatur und
S.17 («am angegebenen Ort» oder «eben-
nicht um eine Liste, die zeigt, wie viele Bü-
da»), bis eine neue Quelle angegebenen
cher Sie zum Thema gelesen haben. Es
wird. Der Quellenverweis in der Fussnote
geht darum, alle Quellen aufzunehmen, zu
bei einer Paraphrase beginnt mit «VgI.»
denen im Text Ihrer Arbeit auch ein Beleg
(«Vergleiche»).
(siehe 6) existiert.
Wenn Sie aus einem soeben genannten Halten Sie sich beim Bibliografieren genau
Text weiter zitieren, geben Sie nur die Sei- an die unten vorgeschriebenen Angaben.
tenzahl an. z.B. Das Einhalten dieser Vorgaben ist zwin-
1 Landmann 1979, S. 17. gend, ein Verstoss gegen die Regeln scha-
2 S. 24f. det der ganzen Arbeit. Seien Sie auch in
3 Litzeler 1983, S. 206. diesem Teil der Arbeit sorgfältig.
4 Landmann 1979, S. 15.
5 Ebda., S. 15. Es gibt mehrere Möglichkeiten, wie man
6 A.a.O., S. 15. bibliografiert, aber halten Sie sich konse-
quent an die einmal gewählte Methode.
Referenznummern Sprechen Sie die Details mit Ihrer Betreu-
Die Einträge des Literaturverzeichnisses ungsperson ab.
werden durchnummeriert und die Num-
mern dem Eintrag im Text in eckigen Tipp: Notieren Sie sich Angaben zur Litera-
Klammern vorangestellt. tur gleich bei der ersten Recherche: Im In-
ternet wechseln Texte nach einer bestimm-
wie in [47] dargelegt wird ten Zeit, werden nicht mehr aufgeführt oder
(vgl. dazu [18] und [23: S. 34-45]) erscheinen an einem anderen Ort. Eine
neue Suche ist dann mit grossem Aufwand
verbunden.
19Literaturverzeichnis nach dem System APA
ein Autor, ein Buch:
Landmann, Robert (1997). Auf der Suche nach dem Paradies. Wien: Ullstein.
zwei und mehr Autoren, ein Buch:
Briggs, John; Peat, F. David (1990). Die Entdeckung des Chaos. München/Wien:
Hanser.
Büntig, Karl-Dieter u.a. (1989). Computer im Deutschunterricht. Hannover: Schroedel
Schulbuchverlag.
Sammlung von Aufsätzen, ein Herausgeber
Litzeler, P. (Hrsg.). (1983). Romane des 20. Jahrhunderts. Königstein/Taunus: Athen-
äum Verlag.
Aufsatz in einer Sammlung
Hackert, Fritz: Joseph Roth (2001). 'Radetzkymarsch', In Paul Michael Litzeler (Hrsg.).
Romane des 20. Jahrhunderts. Königstein/Taunus: Athenäum Verlag, S. 183-199.
Aufsatz in einer Zeitschrift
Autor, A., Autor, B. & Autor, C. (Jahreszahl). Titel des Artikels. Titel der Zeitschrift, Aus-
gabe, Seitenzahl.
Woldeck, Rudolf (November 1989). Formeln für das Tohuwabohu. Kursbuch 98, S. 12.
Zeitungsartikel
Rorty, Richard (18.3.2004). Feind im Visier. Die Zeit S. 49.
Nachschlagewerk
Grosses Zitatenbuch (1984), München: Compact Verlag.
Unveröffentlichte Quelle
Hügi, Ilona (2002). Fotografische Darstellung der Mitosestadien. Maturaarbeit Gymna-
sium Hochdorf.
Text aus dem Internet:
Mr. (Ulrich Meister) Madrider Verdächtige in Untersuchungshaft. Hinweise auf einen
Sprengstoffdiebstahl. http://www.nzz.ch. (bzw. genaue URL) [20.3.2004]
Hier muss neben dem Autor unbedingt das Datum, an welchem die Seite herunter ge-
laden wurde, stehen. Wenn die Seite mit einer Suchmaschine gefunden wurde, gilt nicht
die Adresse der Suchmaschine, sondern die tatsächliche Adresse.
206. DIE PRÄSEN- 6.1 ABLAUF DER PRÄSENTATION
TATION Es finden jeweils gleichzeitig mehrere
Präsentationen gemäss dem von der
Schulleitung erstellten Programm statt.
Die Vortragenden haben vor Beginn der
Gegen Ende des 1. Semesters im Matu-
Präsentation rund eine halbe Stunde
rajahr (i.d.R. Ende November/Anfang
Zeit, im Zimmer ihre Vorbereitungen
Dezember) müssen Sie Ihre Arbeit der
(Aufbau von Medien, Material etc.) zu
betreuenden Lehrkraft und einer Korrefe-
treffen.
rentin/einem Korreferenten präsentieren.
Diese Präsentation ist öffentlich zugäng-
Gruppenarbeit:
lich. Gemäss den Weisungen handelt es
› Referat 30-40 Minuten
sich um eine Präsentation von mindes-
› Fachdiskussion 10-20 Minuten
tens 30 (bzw. bei Gruppen 45) Minuten
Dauer. Dabei gilt analog zum Aufbau Einzelarbeit:
der Arbeit auch für den mündlichen Vor- › Referat 20 Minuten
trag das Prinzip: Einleitung (Fragestel- › Fachdiskussion 10 Minuten
lung und Methoden) - Hauptteil - Schluss Beurteilungsgespräch
(Darlegung der Ergebnisse). Seien Sie zwischen den Referenten
kurz, klar, prägnant; Ihr Auftreten sollte und Korreferenten 15 Minuten
lebendig und überzeugend sein. Spre- kurze Rückmeldung
chen Sie langsam, laut und klar; bevor- (ohne Bekanntgabe
zugen Sie kurze Sätze! Visualisierungen der Noten) 5 Minuten
sind wichtig, sie fördern das Verstehen.
Beschränken Sie sich auf das wirklich
6.2 BEKANNTGABE DER NOTEN
Wichtige und «erschlagen» Sie die Zuhö-
renden nicht mit einer Unmenge von Vi- Die Noten der schriftlichen und der
sualisierungen! Beantworten Sie im an- mündlichen Arbeit werden nach der Prä-
schliessenden Fachgespräch die Fragen sentation in einem ausführlichen Ge-
der Lehrpersonen klar und knapp. Im spräch mit Hilfe des Beurteilungsrasters
Idealfall entsteht eine Fachdiskussion mit bis spätestens zu den Weihnachtsferien
echtem Austausch. Das abschliessende bekannt gegeben. An diesem Abschluss-
Beurteilungsgespräch findet unter Aus- gespräch nehmen der Referent / die Refe-
schluss der Öffentlichkeit statt. rentin und die Schülerin / der Schüler teil.
Bei einer Gruppenarbeit müssen alle Rekurs: Die Gesamtnote der Maturaarbeit
Mitglieder zu ungefähr gleichen Teilen zu kann nur im Rahmen einer Verwaltungs-
Wort kommen; sie haben auch entspre- beschwerde gegen das Ergebnis der Ma-
chend mehr Zeit zu Verfügung. turitätsprüfung angefochten werden.
217. DIE BEURTEILUNGSKRITERIEN
7.1 SCHRIFTLICHE (PRAKTI- 7.2 PRÄSENTATION
SCHE) ARBEIT
Die Präsentation wird nach den folgen-
Die schriftliche Arbeit wird nach den fol- den Kriterien beurteilt:
genden Kriterien beurteilt: › Sachkompetenz
› Arbeitsprozess › Auftreten
› Inhaltliche Gesichtspunkte › Sprache
› Gliederung › Wirkung
› Sprachliche Gesichtspunkte
› Formale Gesichtspunkte Die maximal mögliche Punktzahl beträgt
Im Falle einer Arbeit mit praktischemTeil 70 Punkte.
oder Produkt als Schwerpunkt kommen
hinzu: Die Gewichtung der einzelnen Kriterien
› Kriterien zur technischen, praktischen wird durch die Fachgruppen individuell
oder ästhetischen Qualität des Produk- geregelt.
tes oder des praktischen Teils.
Ausgehend von den oben genannten Kri-
Die maximal mögliche Punktzahl beträgt terien erstellt jede Fachgruppe ein detail-
130 Punkte. liertes fachspezifisches Beurteilungsraster,
das dem Schüler und der Schülerin bei
Die Gewichtung der einzelnen Kriterien Vertragsabschluss abgegeben werden
wird durch die Fachgruppen individuell muss.
geregelt, wobei dem Kriterium «Arbeits-
prozess» einheitlich 25 Punkte zuzuwei- Die erzielte Punktzahl wird in eine Note
sen sind. Ausgehend von den genannten umgerechnet:
Kriterien erstellt jede Fachgruppe ein de- ∙
Note = +1
tailliertes fachspezifisches Beurteilungs-
raster.
7.3 GESAMTBEURTEILUNG
Abweichungen von der im Beurteilungs-
raster vorgegeben Gewichtung sind bis Der Beurteilungsraster enthält neben ein-
zur Abgabe der Disposition zu vermerken zelnen Kriterien immer auch eine aus-
und zu begründen. formulierte Gesamtbeurteilung zum
Die erzielte Punktzahl wird in eine Note schriftlichen wie zum mündlichen Teil der
umgerechnet: Arbeit.
∙
Note =
+1
227.4 GESAMTNOTE
8. VERÖFFENT-
Für die Gesamtnote zählt die Note der
schriftlichen Arbeit zu 2/3, die Note der LICHUNGEN
Präsentation zu 1/3. Die Noten werden
bis spätestens vor den Weihnachtsferien
UND ANSICHT
bekannt gegeben. VON MATU-
RAARBEITEN
Vor der Bekanntgabe der Endnoten (Ge-
prächsrunde 4) dürfen weder das Doku-
ment noch Teile der Arbeit veröffentlicht
werden. Dies gilt auch für Publikationen
oder Kommentare in den Medien.
In jedem Fall muss eine Veröffentlichung
der Arbeit (des Produktes) mit der Schul-
leitung abgesprochen werden.
Nach Abschluss von Arbeit und Präsenta-
tion werden die besten Maturaarbeiten in
der Mediothek einer grösseren Schulöf-
fentlichkeit zugänglich gemacht. Die Ar-
beiten sind nur im Lesesaal ausleihbar
(Schutz der Exemplare).
239. LITERATUR
Becker, Fred (1992). Zitat und Manu- Krämer, Walter (1995). Wie schreibe ich
skript. Hinweise zur Anfertigung von wirt- eine Seminar-, Examens- und Diplomar-
schaftswissenschaftlichen Arbeiten. Stutt- beit? (4. Auflage). Stuttgart: Fischer.
gart: Schäffer-Poeschel.
Niederhauser, Jürg (2000). Die schriftli-
Eschenmoser, Karl (1995). Facharbeiten. che Arbeit. Ein Leitfaden zum Schreiben
TGV Tips zu Thema und Materialien Glie- von Fach-, Seminar- und Abschlussarbei-
derungsprinzipien Vorschriften. 4., revi- ten in der Schule und beim Studium (3.,
dierte Auflage. Mörschwil: Eigenverlag. völlig neu erarbeitete Auflage). Mann-
heim etc.: Dudenverlag.
Fragnière, Jean-Pierre (1993). Wie
schreibe ich eine Diplomarbeit? (3. Auf- Schmitz, Martina & Nicole Zöllner (2007).
lage). Bern: Haupt. Der Rote Faden. 25 Schritte zur Fach- und
Maturaarbeit. Zürich: Orell Füssli.
Gmür Brianza, Noëlle: Leitfaden. Anlei-
tung für eine wissenschaftliche Arbeit. Uhlenbrock, Karlheinz (2007). fit fürs abi
Winterthur: «Stiftung Schweizer Jugend – Referat und Facharbeit planen, erstel-
forscht». len, präsentieren. Braunschweig: Schroe-
del.
Heidtmann, Frank (1981). Wie finde ich
bibliothekarische Literatur? (2., veränder-
te Auflage). Berlin: Berlin-Verlag.
Kunz-Koch, Christina (1999). Geniale
Projekte – Schritt für Schritt entwickeln.
Ein Leitfaden zur persönlichen Strategie-
entwicklung in Projekten für Wirtschaft,
Berufsschulen, Gymnasien, Universitäten
und zum Selbststudium. Zürich: Orell
Füssli.
24ANHANG 1 –
SCHRIFTLICHE
FIXPUNKTE
Auf den folgenden Seiten finden Sie die
Formulare der Fixpunkte:
› Schriftlicher Fixpunkt 1 und 2
› Schriftlicher Fixpunkt 3
› Schriftlicher Fixpunkt 5
25SCHRIFTLICHER FIXPUNKT 1 UND 2
Schüler/Schülerin
Name, Vorname, Klasse
Betreuende Lehrperson
Name, Vorname, Fach
FIXPUNKT 1: THEMENWUNSCH / ANFRAGE BETREUUNG (Abgabe gem. Terminplan)
Art und Typ der Arbeit
o Einzelarbeit o Gruppenarbeit, arbeitsteilig o Gruppenarbeit, nicht arbeitsteilig
o wissenschaftliche Untersuchung (Ex- o Arbeit mit einem technischen, künstlerischen Produkt als Schwerpunkt
periment, Textvergleich, etc.) o Arbeit mit «Organisation einer Veranstaltung» als Schwerpunkt
- Bitte konkretisieren:
Titel der Arbeit:
Stichworte zu den angestrebten Zielen, zum Inhalt und zur Methode:
Meine Motivation für das Thema:
Unterschrift Datum
Betreuende Lehrperson
Die Lehrperson bestätigt mit ihrem Visum das provisorische Einverständnis zur Betreuung dieser Maturaarbeit. Die definitive
Unterschrift wird erst ab Anfang November erteilt (Vertragsabschluss).
FIXPUNKT 2: VERTRAG DER MATURAARBEIT (Anfang Nov. bis Anfang Dez.)
Mit der Unterschrift bestätigen die Schülerin oder der Schüler sowie die betreuende Lehrperson, dass sie bis zum Abschluss der Matu-
raarbeit zusammenarbeiten und die Rahmenbedingungen, wie sie im MAR (eidgenössisches Maturitätsanerkennungsreglement), im
«Reglement für die Maturitätsprüfungen im Kanton Luzern» (SRL 506), in den Weisungen der kantonalen Maturitätskommission sowie
im Leitfaden der Kantonsschule Seetal für die Maturaarbeit festgehalten werden, zur Kenntnis genommen haben.
Fachspezifisches Beurteilungsraster abgegeben: o ja o nein
Unterschriften Datum
Schülerin / Schüler
Betreuende Lehrperson
Korreferent/Korreferentin
Schulleitung
26SCHRIFTLICHER FIXPUNKT 3
DISPOSITION (ALS WORD-DOKUMENT UNTER DOWNLOAD VERFÜGBAR)
Sie füllen zuerst nur die ersten Rubriken aus und ergänzen jeweils nach den Beratungs-
gesprächen weitere Abschnitte.
Dieses Konzept wird der Betreuerin/dem Betreuer gemäss Terminplan abgegeben.
Vorname/Name/Klasse
Arbeitstitel
(aktuellste Version)
Betreuerin/Betreuer
1. Thema (Themenumschreibung)
Was interessiert mich daran? Warum?
2. Fachliche Einarbeitung
Was weiss ich bereits über das Thema? In welchen Bereichen sollte ich mehr wissen?
Quellenverzeichnis/konsultierte Quellen (Bücher, Internet, …):
Persönliche Erfahrungen:
Literatur / Texte, die ich noch lesen werde:
Fachpersonen, mit denen ich über das Thema gesprochen habe oder noch sprechen werde:
273. Zielsetzung meiner Matura-Arbeit Was soll dabei herauskommen? Worin soll der eigene Untersuchungsteil bestehen? 4. Fragestellungen und Thesen Folgende Fragen beschäftigen mich: Ich habe Vermutungen. Diese Vermutungen formuliere ich in Form von Thesen (Behauptungen): 5. Arbeitsmethoden Mit welchen Methoden will ich meine Untersuchungen durchführen? (Bitte so detailliert wie möglich angeben.) 6. Abgrenzung des Themengebiets Die Zeit reicht nicht aus, um alles zu einem Thema zu untersuchen. Ich beschränke mich auf folgende Teilgebiete: Die folgenden Teilgebiete möchte ich bewusst weglassen: 7. Zeitplan (auch als eigener Anhang möglich) nach Bonati / Hadorn: Matura und andere selbständige Arbeiten betreuen. Bern: hep, 2007, S. 192-19 28
SCHRIFTLICHER FIXPUNKT 5
ZWISCHENBERICHT DER BETREUENDEN LEHRPERSON
(als Worddokument im Internet als Download verfügbar)
Schüler/Schülerin
Name, Vorname, Klasse
Betreuende Lehrperson
Name, Vorname, Fach
Aktueller Titel der Arbeit:
Kommentar zu den Kriterien «Bewertung Arbeitsprozess» und sonstige Hinweise
Arbeitsjournal Arbeitsprozess o knapp nachvollziehbar
o gut o schwer nachvollziehbar
Zeitplan gemäss Disposition o eingehalten o wenig im Rückstand
o stark im Rückstand
Ausrichtung der Weiterarbeit o gemäss Planung o neue Planung nötig
Qualität der Textprobe o hohe Qualität o verbesserungswürdig
o stark verbesserungsbedürftig
Beurteilung zum Zeitpunkt o sehr gut o genügend
des Zwischenberichts o gut o ungenügend
Unterschriften Datum
Schülerin / Schüler
Betreuende Lehrperson
29ANHANG 2 –
DIE MATURA-
ARBEIT IN DEN
REGLEMENTEN
1. AUSZUG AUS DEM EIDGENÖSSI- Art. 15 Maturitätsnoten und Bewertung
SCHEN MATURITÄTSANERKEN- der Maturaarbeit
NUNGSREGLEMENT (MAR) 1
Die Maturitätsnoten werden gesetzt:
[…] in der Maturaarbeit aufgrund des
Art. 5 Bildungsziel
Arbeitsprozesses, der schriftlichen Arbeit
2
Maturandinnen und Maturanden sind
und ihrer Präsentation.
fähig, sich den Zugang zu neuem Wissen 2
Bei der Bewertung der Maturaarbeit
zu erschliessen, ihre Neugier, ihre Vor-
werden die erbrachten schriftlichen und
stellungskraft und ihre Kommunikations-
mündlichen Leistungen berücksichtigt.
fähigkeit zu entfalten sowie allein und in
Gruppen zu arbeiten. Sie sind nicht nur
gewohnt, logisch zu denken und zu abs- Art. 20 Formerfordernisse an den Aus-
trahieren, sondern haben auch Übung weis
im intuitiven, analogen und vernetzten 1
Der Maturitätsausweis enthält:
Denken. Sie haben somit Einsicht in die [ ... ]
Methodik wissenschaftlicher Arbeit. g. das Thema und die Bewertung der
Maturaarbeit.
Art. 10 Maturaarbeit
Schülerinnen und Schüler müssen allein
oder in einer Gruppe eine grössere ei-
genständige schriftliche oder schriftlich
kommentierte Arbeit erstellen und münd-
lich präsentieren.
302. DIE MATURAARBEIT AN DEN wie tief sie in die Thematik vorgestossen
LUZERNER MATURITÄTSSCHULEN sind und dass sie diese in einem grösse-
ren Kontext erörtern können.
Weisungen der Maturitätskommission vom
13. Januar 2009 (Stand August 2017):
3. Thema
› Die Maturandinnen und Maturanden
1. Rechtliche Grundlagen
wählen das Thema in Absprache mit
Die rechtlichen Grundlagen bilden das einer betreuenden Lehrperson.
Maturitätsanerkennungsreglement (MAR), › Das gewählte Thema muss dem Bil-
das sich in den Art. 52 (Bildungsziel), Art. dungsziel des Gymnasiums gemäss
10 (Maturaarbeit); Art. 152 (Maturitätsno- MAR, Art. 5 entsprechen.
ten und Bewertung der Maturaarbeit) und › Das Thema ist so festzulegen, dass es
Art. 20 1g (Eintrag von Thema und Bewer- im Rahmen des verlangten Umfanges
tung der Arbeit im Maturitätsausweis) auf behandelt werden kann.
die Maturaarbeit bezieht, das Reglement › Die Schule gibt den Maturandinnen
für die Maturitätsprüfungen im Kanton Lu- und Maturanden sowie den Lehrperso-
zern (SRL 506) sowie die Weisungen für nen einen verbindlichen Leitfaden ab.
die Maturitätsprüfungen. Dieser macht Aussagen zu folgenden
Diese Weisungen ersetzen die Weisungen Punkten: Themenwahl, Abfassung, Be-
der Maturitätskommission zur Maturaar- urteilungskriterien, Zeitaufwand, Um-
beit vom 8.1.2002. fang, Betreuung, Präsentation der Ma-
turaarbeit. Der Leitfaden ist der Maturi-
tätskommission zur Kenntnis zu bringen.
2. Zielsetzungen
Die Maturandinnen und Maturanden
4. Zeitrahmen
verfassen allein oder in einer Gruppe ei-
› Die Schule legt einen Zeitplan inner-
ne grössere eigenständige Arbeit, die lo-
halb der letzten zwei Schuljahre für die
gisch aufgebaut und klar strukturiert ist.
Vorbereitung und Durchführung der
Sie gehen von einer anspruchsvollen und Maturaarbeit fest; dazu gehören auch
präzis formulierten Fragestellung aus, die Information der Maturandinnen
wenden angemessene Methoden und und Maturanden und die Einführung in
Hilfsmittel an und folgen formal den das wissenschaftliche Arbeiten.
Grundsätzen wissenschaftspropädeuti- › Die Arbeit muss bis Ende des 1. Se-
schen Arbeitens. Ausser der Maturaarbeit mesters der 6. Klasse präsentiert sein.
werden keine weiteren grösseren Ab- › Für die MSE gilt folgende Regelung:
schlussarbeiten verlangt. Die Schule legt einen Zeitplan inner-
Bei der mündlichen Präsentation geht es halb des 3. bis 5. Semesters fest. Die
um die Fähigkeit, Thesen und Erkenntnis- Maturaarbeit muss bis Ende des 5.
se darzulegen sowie die gewählten Vor- Semesters präsentiert sein.
gehensweisen zu beschreiben und zu be-
gründen; damit zeigen die Studierenden,
315. Mündliche Präsentation 7. Betreuung
› Die mündliche Präsentation dauert › Jede Maturaarbeit wird von einer
mindestens 30 Minuten und umfasst Lehrperson betreut.
die Darlegung der Thesen und Er- › Alle Lehrpersonen, die MAR-Klassen
kenntnisse sowie ein Fachgespräch mit unterrichten, sind verpflichtet, in Ab-
der betreuenden Lehrperson und der sprache mit der Schulleitung Arbeiten
Korreferentin oder dem Korreferenten. in einem quantitativ zumutbaren Rah-
Die Schule kann die mündliche Prä- men zur Betreuung anzunehmen.
sentation öffentlich gestalten. › Lehrpersonen können in begründeten
› Bei Gruppenarbeiten dauert die münd- Fällen die Betreuung bestimmter The-
liche Präsentation mindestens 45 Mi- men ablehnen.
nuten. Dabei muss jedes Gruppenmit- › Zwischen den Maturandinnen und Ma-
glied aktiv an der Präsentation teil- turanden einerseits und den Betreuen-
nehmen und im Fachgespräch sowohl den anderseits wird für die Dauer der
seinen eigenen Teil als auch das Gan- Maturaarbeit eine Vereinbarung ge-
ze der Maturaarbeit vertreten können. troffen, die von keiner Seite ohne
schwerwiegende Gründe aufgelöst
6. Zuständigkeit werden kann.
Für die Durchführung der Maturaarbei- › Für die Beurteilung der Arbeit und der
ten ist die Schulleitung zuständig, welche mündlichen Präsentation wird der be-
treuenden Lehrperson eine Korreferen-
› die Einführung in das wissenschaftliche
tin oder ein Korreferent zugeteilt.
Arbeiten sicherstellt,
› den Ablauf der Maturaarbeit organi-
siert und koordiniert,
› den Zeitplan für jeden Jahrgang er-
stellt,
› die Prüfung der gewählten Themen auf
ihre Eignung sicherstellt,
› den Betreuenden Korreferenten oder
Korreferentinnen zuteilt.
32Sie können auch lesen