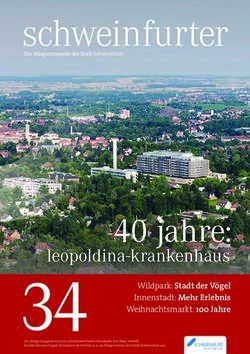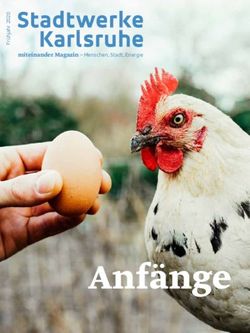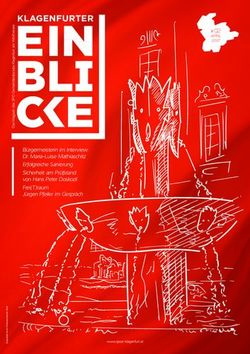Maßnahmenkatalog - Mobility Points Realisierung von multimodalen Mobilitäts angeboten in Wohnbauten und Stadtteilen - Stadt Salzburg
←
→
Transkription von Seiteninhalten
Wenn Ihr Browser die Seite nicht korrekt rendert, bitte, lesen Sie den Inhalt der Seite unten
Wir leben die Stadt
Mobility Points
Realisierung von
multimodalen
Mobilitätsangeboten
in Wohnbauten und
Stadtteilen
Maßnahmenkatalog
www.stadt-salzburg.atMaßnahmenkatalog
Zur Realisierung von multimodalen Mobilitäts
angeboten (Mobility Points) in Wohnbauten und
Stadtteilen
Inhalte
Kurzfassung 2
1. Einleitung und Ausgangslage 3
2. Zielsetzungen für multimodale Mobilität 6
3. Vorteile für Nutzerinnen und Nutzer 7
4. Pull-Maßnahmen: Multimodalität im Wohnbau 9
5. Push-Maßnahmen: Restriktive Lenkungsinstrumente 14
6. Stellplatzregulativ – rechtliche Grundlagen 17
7. Zusammenarbeit und Organisation bei Neubauten 18
8. Absicherung der Mobilitätsmanagement-Maßnahmen 20
9. Betriebsmodelle Shared Mobility 24
10. Finanzierung 28
11. Best-Practice-Beispiele 32
12. Abbildungen 35
13. Abkürzungen und Begriffserklärungen 35
14. Quellen 36
Auftraggeber Magistrat der Stadtgemeinde Salzburg,
MA 5/03, Amt für Stadtplanung und Verkehr
Auftragnehmerin MO.Point Mobilitätsservices GmbH
Niederhofsstrasse 30/13, A-1120 Wien
Projektleitung Josef Reithofer, Stadt Salzburg, MA 5
Stefan Arbeithuber, MO.Point Mobilitätsservices GmbH
Herausgeber
Stadtgemeinde Salzburg, Amt für Stadtplanung und Verkehr
Schriftenreihe zur Salzburger Stadtplanung, Heft 46
Erscheinungsjahr 2020, Erscheinungsort Salzburg
Kommentare und Anregungen
Verena Hefinger, Michael Buttler, Magistrat der Stadt Salzburg, MA 5/03
Ingeborg Straßl, Patrick Lüftenegger, Markus Fedra, Salzburger Institut für Raumordnung und Wohnen SIR
Stefan Arbeithuber, Stefan Melzer, MO.Point Mobilitätsservices GmbH
Salzburg, Dezember 2019
1Kurzfassung
Ziele und beabsichtigte Anwendungsmöglichkeiten dieses
Maßnahmenkataloges
80% der täglichen Wege starten und enden Für die Realisierung benötigt es ein Zusammen
am Wohnort. Die unmittelbare Wohnumgebung spiel aller Akteure. Dazu werden in Kapitel 7
beeinflusst unser Mobilitätsverhalten direkt und Empfehlungen zur Zusammenarbeit gegeben
unbewusst. Dieser ‚Maßnahmenkatalog Multi und aufgezeigt, wie die Maßnahmen bestmöglich
modalität’ thematisiert daher die Notwendigkeit abgesichert werden können (Kapitel 8). Darüber
derartiger Maßnahmen (Kapitel 1 und 2), wel hinaus werden unterschiedliche Betriebsmodelle
che Vorteile sich daraus ergeben (Kapitel 3) und (Kapitel 9), und Finanzierungsinstrumente
was Bauträger und Projektentwickler beitragen (Kapitel 10) aufgezeigt. Kapitel 11 rundet
können, um multimodale Mobilitätsangebote im den Leitfaden mit ausgewählten Best-Practice-
Wohnungsneubau zu verankern. (Kapitel 4). Das Beispielen ab.
Dokument ergänzt den aktuellen ‚Leitfaden für
ProjektentwicklerInnen‘ 1 (2018), in dem es die Der vorliegende Maßnahmenkatalog Multimo
Perspektiven von Bauträgern, zuständigen Fach dalität soll einerseits für FachplanerInnen, die
planerInnen und politischen Entscheidungsträger seitens der zuständigen Behörden und politischen
Innen verknüpft. EntscheidungsträgerInnen tätig sind, eine fun
dierte Argumentationsgrundlage bieten. Anderer
Die Handlungsempfehlungen beinhalten eine seits erhalten Bauträger und Projektentwickler in
Kombination von sanften Maßnahmen des Mobi Ergänzung zum ‚Leitfaden für Projektentwickler‘ 1
litätsmanagements (Pull-Maßnahmen) mit harten konkrete Informationen zur Organisation, Finan
Maßnahmen (Push-Faktoren, wie z.B. Verkehr zierung und Realisierung. Letztendlich sollen die
sinfrastruktur, Parkraumbewirtschaftung). Für wichtigsten Akteure davon profitieren: Die Bewoh
FachplanerInnen und politische Entscheidungs nerinnen und Bewohner.
trägerInnen werden in Kapitel 5 Lenkungsinstru
mente empfohlen, wobei jenes der Reduktion von
Stellplätzen vertieft wird (Kapitel 6).
21. Einleitung und
Ausgangslage
Problemstellung und Einen wertvollen Beitrag kann dabei die stärkere
Integration von Wohnen und Mobilität leisten.
Notwendigkeit Die Teilziele 20 und 21 der Smart City Strategie
Salzburg betreffen die Realisierung von Wohn
Im Bundesland Salzburg ist der Verkehr mit 1,44 bauprojekten mit integrierten Mobilitätskonzepten
Mio t CO2 der größte Verursacher von CO2.2 50% sowie die Schaffung von Ergänzungsangeboten
aller Wege im Großraum Salzburg werden mit dem zum öffentlichen Verkehr. Mittels Siedlungsbe
privaten PKW zurückgelegt.3 Der PKW-Bestand wertungen von Wohnbauprojekten können die
im Bundesland nahm von 2012 bis 2016 um 6% CO2-Einsparungspotentiale bei der Alltagsmobi
zu.4 Dabei beträgt die durchschnittlich mit dem lität auch berechnet werden.6 Zur Realisierung
PKW zurückgelegte Stecke nur rund 13 km.2 benötigt es aber die akkordierte Zusammenarbeit
Daher soll „die Zukunft der städtischen Mobilität aller Akteure: Bauträger und Projektentwickler
auf nachfrageorientierten Dienstleistungsangebo Innen, FachplanerInnen und politische Entschei
ten basieren. dungsträgerInnen. Für diese bietet der vorliegende
Maßnahmenkatalog fundierte Hintergrundinforma
An Stelle des privaten Autobesitzes tritt ein Mix tionen und eine konkrete Handlungsanleitung.
aus Zu-Fuß-gehen, Radfahren, öffentlichen Trans
portmitteln und ergänzenden Leihfahrzeugen.
(…)“, so die in der Smart City Strategie 2025 der
Stadt Salzburg formulierte Zielsetzung.5 Überge
Wozu Multimodalität?
ordnetes Ziel der Stadt Salzburg ist die Reduktion
Unsere Wege können als Wegeketten begriffen
von Treibhausgas-Emissionen, der Schadstoffbe
werden, die wir täglich mit einem oder mehreren
lastung sowie der Lärm-Emissionen und dadurch
Verkehrsmitteln zurücklegen. Stehen unterschied
die Steigerung der Lebensqualität, insbesondere
liche Verkehrsmittel und Verkehrsinfrastrukturen
im urbanen und semi-urbanen Umfeld.
– idealerweise direkt am Wohnort – zur Verfügung,
z.B. Bahn, Bus, Carsharing, Parkmöglichkeiten
für PKW und Fahrrad, Geh- und Fahrradwege,
so fördert das die Wahl des jeweils passenden
Verkehrsmittels.
Unter Rücksichtnahme auf bestimmte Voraus
setzungen (Push- und Pullfaktoren) kann dies zu
einer Reduktion von Fahrten mit dem PKW und
damit zu einer Reduktion der Umweltbelastung
durch den motorisierten Individualverkehr führen.
Abb. 1: Beispiel Stadtwerk Lehen, Salzburg
© Verein Stadtwerk
3EINLEITUNG UND AUSGANGSLAGE
Multimodales Sonderform von Multimodalität:
Verkehrsverhalten Intermodales Verkehrsverhalten
Mi +
Di
Mi
Do +
… … © MO.Point GmbH nach Von der Ruhren et al. (2003)
Abb. 2: Multimodales und intermodales Verkehrsverhalten
Quelle: MO.Point GmbH nach Von der Ruhren et al. (2003) in https://www.zukunft-mobilitaet.net/
Mobility Points Mobilitätsangeboten wird in Fachkreisen als
Mobility Points, Mobilitätsstationen oder Mobility
Hubs bezeichnet. Die verkehrliche Funktion
Multimodales und intermodales Verhalten kann
von Mobility Points liegt darin, unterschiedliche
durch die Verknüpfung der unterschiedlichen
Mobilitätsangebote und Services an einem
Verkehrsmittel gefördert werden. Diese
Standort räumlich zusammenzufassen und den
räumliche Verknüpfung von unterschiedlichen
Übergang zwischen den Verkehrsmitteln zu
vereinfachen.7
Charakteristisch für diese Mobility Points ist, dass
an diesen Umsteigepunkten sowohl öffentliche
Mobilitätsangebote als auch Sharing-Fahrzeuge,
etwa Car- und/oder Bikesharing-Fahrzeuge bereit
stehen. Weitere Angebote sind etwa in unmittel
barer Nähe gelegene Taxistandplätze, Fahrrad
abstellanlagen oder Sammelgaragen. Meist wird
die Errichtung von Mobility Points von entspre
chenden Marketingmaßnahmen zur Förderung von
multimodalem Verkehrsverhalten begleitet.
Abb. 3: Beispiel Mobilitätsstation, tim-Standort der Holding
Graz – Kommunale Dienstleistungen GmbH
© LupiSpuma
4EINLEITUNG UND AUSGANGSLAGE
Digitale Verknüpfung
Damit einher geht die digitale Verknüpfung der
unterschiedlichen Angebote. Idealerweise kann
man sich auf einer Applikation (App) via Smart
phone oder PC über unterschiedliche Mobilitäts
angebote informieren, diese nutzen und teilweise
auch bezahlen. Unterschiedliche ITPlattformen
von privaten Betreibern, IT Unternehmen oder öf
fentlichen Akteuren bieten derartige Lösungen an.
In Fachkreisen wird die Bündelung unterschied
licher Mobilitätsangebote als „Mobility as a
Service (MaaS)“ bezeichnet. Ziel ist es, die
wichtigsten Mobilitätsanforderungen eines Kun
den über eine digitale Schnittstelle und durch Abb. 4: Beispiel digitale Verknüpfung:
einen Dienstanbieter zu erfüllen.8 Mobilitätsplattform Wegfinder
Quelle: iMobiliy GmbH, 2019
Warum multimodale Mobilität planen?
n Möchlichst einfacher und bequemer Wechsel von einem Verkehrsmittel auf ein anderes
n Entlastungseffekte im fließenden und ruhenden PKWVerkehr durch Verlagerung auf den
Umweltverbund (zu Fuß gehen, Rad fahren, öffentliche Verkehrsmittel)
n Stärkung des Fuß und Radverkehrs sowie des öffentlichen Verkehrs
n Verbesserung der Erreichbarkeiten, insbesondere für Personen ohne permanente PKW
Verfügbarkeit – Reduktion der Abhängigkeit vom privaten PKW
n Herstellung und Sicherung kostengünstiger und flexibler Mobilität in urbanen Räumen
n Kosteneffiziente Ergänzung des öffentlichen Verkehrs – Attraktivierung des ÖV
n Sicherung kostengünstiger und flexibler Mobilität in urbanen und semiurbanen Räumen, aber
auch im ländlichen Raum
n Image und Marketingeffekte für multimodale Mobilitätskonzepte und für den bestehenden ÖV
52. Zielsetzungen für
multimodale Mobilität
Abb. 5: Verankerung
von Multimodalität am
Wohnstandort
© MO.Point GmbH 2016
80% der täglichen Wege starten und enden am
Wohnort. Die unmittelbare Wohnumgebung beein
Strategischer Rahmen für
flusst unser Mobilitätsverhalten direkt und unbe multimodale Mobilität im
wusst: Führt der kürzeste Weg von der Haustüre Wohnbau in der Stadt Salz
über den Lift in die Tiefgarage direkt zum eigenen
Auto, so ist man sehr geneigt, dieses Mobilitäts burg
mittel für seine Wege zu bevorzugen.
Energiepolitische Maßnahmen für die relevanten
Oberstes Ziel von Mobilitätsmanagement ist es, Bereiche, darunter auch für die Mobilität, mit
die Verwendung nachhaltiger Verkehrsmittel (zu Umsetzungsvorschlägen bis 2025 wurden defi
Fuß gehen, Rad Fahren, öffentlicher Verkehr) zu niert. Neben dem Umstieg auf energieeffiziente
fördern.9 Dies setzt die Gleichberechtigung aller Verkehrsträger wurden unter anderem die Realisie
Mobilitätsangebote am Wohnort voraus: Ob das rung von Wohnbauprojekten mit integrierten Mobi
private Fahrrad, die nächstgelegene ÖV-Haltestelle litätskonzepten sowie die Schaffung und bessere
oder ein Carsharing-Auto – sind alle Verkehrs Verknüpfung von Kombinationsangeboten mit dem
mittel einfach und gleich schnell erreichbar und ÖV als Maßnahmen definiert.10
können kostengünstig und bequem genutzt wer
den, so gewinnt die Vielfalt an Mobilitätsmöglich Der ‚Leitfaden Mobilitätsmanagement’ 11 (2013)
keiten an Attraktivität. Der / die BewohnerIn kann beschreibt, wie bei Wohnbauvorhaben mit
für jeden Einsatzzweck das für sie/ihn passende tels sanfter und angebotsseitiger Maßnahmen
Fahrzeug nutzen. Weitere Ziele sind die Erhöhung (Pull-Maßnahmen) die BewohnerInnen zur Verrin
der Aufenthaltsqualität durch die Reduktion von gerung der PKW Nutzung angeregt und dadurch
KFZ Stellplätzen im öffentlichen Raum und die nachhaltiges Verkehrsverhalten gefördert werden
Reduktion der Abhängigkeit vom privaten PKW kann. Der darauf aufbauende ‚Leitfaden für
(Mobilitätsgarantie). Projektentwickler‘ 12 (2018) beschreibt Schritt für
Schritt, wie Bauträger und Projektentwickler bei
Die Stadt Salzburg hat sich zum Ziel gesetzt, die Neubauvorhaben vorgehen können, um Mobili
Lebensqualität ihrer BürgerInnen nachhaltig zu tätsmanagement-Maßnahmen zu realisieren und
sichern. Der Masterplan 2025 ist das Ergebnis um KFZ-Stellplätze zu reduzieren. An Mobility
eines umfassenden Stakeholder-Dialogs und fasst Points verfügbare Mobilitätsangebote, wie Car-
die diesbezügliche Vision für die Stadt Salzburg oder Bikesharing stellen einen Teil der möglichen
im Jahr 2050 zusammen. Maßnahmen des Mobilitätsmanagements dar.
63. Vorteile für Nutzerinnen
und Nutzer
Idealerweise wird der Wohnbau und die Wohnum
gebung so gestaltet, dass das zu Fuß gehen, Rad
fahren sowie der öffentliche Verkehr an Attrakti
vität gewinnen. Wird der private PKW nicht mehr
täglich benötigt, können stattdessen bei entspre
chendem Bedarf Carsharing-Fahrzeuge oder bei
längerer Entlehnung auch Mietautos für Fahrten
herangezogen werden.
Davon profitieren vor allem die BewohnerInnen
selbst: Ist der Besitz eines PKWs nicht mehr zwin
gend notwendig, so spart dies erhebliche Kosten.
Österreichs Haushalte geben im Durchschnitt 425
Euro pro Monat für Mobilität aus13, einen Großteil
davon für das eigene Auto. Die regelmäßige Nut
zung eines Carsharing-Fahrzeuges rechnet sich,
wenn der eigene PKW weniger als rund 10.000km
Abb. 6: Kostenvergleich von Haushalten mit und
pro Jahr gefahren wird.14
ohne PKW Quelle: VCÖ – Mobilität mit Zukunft
Werden Alltagswege ohne privates Auto bewäl
tigt, so wird dadurch der ruhende und fließende
Verkehr vor der eigenen Haustüre minimiert. Das Schadstoffe des PKW-Verkehrs reduziert wer
unmittelbare Wohnumfeld gewinnt an Qualität: Es den. Die Förderung der Angebotsvielfalt und die
entsteht mehr und sicherer Freiraum für Bewoh bestmögliche Verknüpfung von unterschiedlichen
nerInnen und AnrainerInnen, während Lärm und Verkehrsmitteln erhöht somit die Lebensqualität.
Abb. 7: Vergleichsrechnung am Beispiel Wohnprojekte Wien: Reduktion
der Stellplätze um -85% gegenüber konventionellen Wohnbauten
Quelle: VCÖ – Mobilität mit Zukunft
7V O RT E I L E F Ü R N U T Z E R I N N E N
Weniger Stellplätze ermög Vor allem in innerstädtisch gut erschlossenen
Lagen größerer Städte Österreichs sinken die
lichen günstigeres Wohnen Motorisierungsgrade.16 Der Bedarf nach zur Woh
nung zugehörigen Parkplätzen sinkt dadurch.
2017 wurden bereits 37% der Privathaushalte in
Österreich als Einpersonenhaushalte geführt, bis Dabei erhöhen insbesondere Tiefgaragenstellplätze
2030 soll ihre Anzahl auf rund 39% steigen.15 die Baukosten von Wohnbauten: Die Baukosten
Dadurch wächst der Bedarf an kleineren, günsti von PKW- Tiefgaragenstellplätzen betragen je nach
geren Wohnungen und die Mobilitätsgewohnheiten Standort im Durchschnitt rund 15.000 €.17 Auf
ändern sich. Gute Anbindung an den ÖV, Fahrrad grund des sinkenden Bedarfs an PKW-Stellplätzen
infrastruktur sowie ergänzende Carsharing-Ange in Städten können mittels flankierenden Maßnah
bote haben das Potential, den Mobilitätsbedarf men (z.B. Mobilitätsmanagement) Pflichtstell
– insbesondere bei Einpersonenhaushalten – plätze eingespart werden. Die Reduktion von
effizienter zu decken. Stellplätzen, insbesondere von Tiefgaragenstell
plätzen, trägt damit zur Schaffung von leistbarem
Wohnraum bei.
Vorteile für Nutzerinnen und Nutzer18
n Einsparung von Kosten pro Haushalt
n Mehr Platz für die Menschen: Weniger parkende oder fahrende Autos vor der Haustüre
n H
öhere Verkehrssicherheit: Weniger PKW-Verkehr vor der Haustüre erhöht die Verkehrssicherheit
und mindert Gefahrenquellen, insbesondere für Kinder
n G
rünraum statt Parkplätzen: Mehr Aufenthaltsqualität durch ansprechende Gestaltung der
Wohnumgebung
n Gesünder unterwegs ist, wer Alltagswege zu Fuß oder mit dem Rad zurückgelegt
n W
eniger Zeit im Stau verbringt, wer aktiv unterwegs ist und Radfahren und zu Fuß gehen mit dem
ÖV kombiniert
n G
ünstiger wohnen: Die Reduktion der Pflichtstellplätze reduziert Baukosten und trägt dadurch zur
Schaffung von leistbarem Wohnraum bei
84. Pull-Maßnahmen:
Multimodalität im Wohnbau
Maßnahmen des Mobilitäts § F
ußwege nach dem Prinzip der ‚Stadt der
kurzen Wege‘ gestalten und – falls notwendig
managements (Pull-Maßnah – auch über private Flächen führen (rechtliche
men) Absicherung der Wegführung)
§ Stiegenhäuser attraktiv gestalten, Gemein
Durch sanfte Maßnahmen des Mobilitätsmanage schaftsanlagen im Quartier gut erreichbar
ments (Pull-Maßnahmen), wie Information, Kom situieren (z.B. Fahrrad- und Kinderwagenräume,
munikation und vor allem durch die Verbesserung Müllräume)
und Ergänzung des jeweils am Standort bestehen § Gehwege ansprechend gestalten: Vermeidung
den öffentlichen und privaten Mobilitätsangebotes von Hindernissen, Umwegen, Angsträumen und
sollen Veränderungen von Einstellungen und Ver Gefahrenzonen
haltensweisen der VerkehrsteilnehmerInnen hin zu § Gehwege sehr gut beleuchten: Das steigert
nachhaltigerem Mobilitätsverhalten erzielt werden. die Attraktivität und erhöht die subjektive wie
Dabei gilt: Eine einzelne Maßnahme hat meist be objektive Sicherheit
schränkte Wirkung. Ideal ist eine Kombination aus
mehreren Push- und Pull-Maßnahmen. Push-Maß Abb. 8: Fahr
nahmen beschreiben dabei restriktive Regelungen rad-Self-Service
und betreffen vor allem das Pkw-Stellplatzange Station Beispiel
bot (z.B. City Maut, Stellplatzbeschränkungen) Fahrradpark
und die PKW-Nutzung (z.B. Tempolimits, Road haus Amsterdm
Pricing). Zuid, Creative
Commons CCO
Dieses Kapitel gibt für Bauträger und Projektent 1.0
wickler einen Überblick, welche Maßnahmen bei
Bauvorhaben gesetzt werden können, um nachhal Fahrradinfrastruktur
tige Mobilität zu fördern, die städtische Mobilität
zu verbessern und die Unabhängigkeit vom PKW § D
ie Liegenschaft an das öffentliche Radwegnetz
zu erhöhen. PlanerInnen seitens der facheinschlä anbinden
gigen Behörden erhalten einen Überblick, welche § Qualitative Abstellanlagen errichten: Im Erd
Maßnahmen bei Neubauten vereinbart werden geschosss situieren, keine Hängesysteme
können. Da bereits umfangreiche Fachliteratur zu verwenden, barrierefrei zugänglich gestalten,
einzelnen oder mehreren Maßnahmen verfügbar ausreichende Dimensionierung (Empfehlung: 1
ist, werden die jeweiligen Maßnahmen nicht im Fahrradabstellplatz pro 30 m2 WNF)19, sichere
Detail erörtert. Stattdessen wird am Ende des Verwahrung; keine Angsträume, Ausstattung mit
Kapitels auf weiterführende Literatur verwiesen. Lademöglichkeiten für E-Bikes, Stellplätze für
Gästefahrräder, direkter Zutritt von Außen
§ Self-Service-Stationen mit Werkzeug und Pum
Attraktive Fußwege pe für Fahrradreparaturen installieren
§ Platz zum Abstellen von Kinderwägen und
§ B
erücksichtigung der fußläufigen Erreichbar
Sonderfahrzeugen (z.B. Fahrradanhänger,
keiten wichtiger Einrichtungen (Nahversorgung,
Lastenräder) in Fahrradräumen oder eigens
Schulwege, öffentlicher Verkehr, etc.) bei
dafür definierten Räumen ebenerdig zugänglich
Standortwahl und Bebauung des Grundstückes
vorsehen.20
9PULL-MASSNAHMEN
Abb. 9: Mobility Point Perfektastraße 58, 1230 Wien © MO.Point GmbH 2016
Öffentliche Anbindung § M
obilitätsgutscheine: Anreize für neu ein
ziehende BewohnerInnen, den öffentlichen
Verkehr zu nutzen, wichtig: Personalisierung der
Ein qualitatives, öffentliches Verkehrsangebot am
Mobilitätsgutscheine (Weitergabe oder Weiter
Standort ist die Grundlage jeglicher Mobilitäts
verkauf der ÖV-Tickets ausschließen)
managment-Maßnahmen. Qualitativ bedeutet
dabei regelmäßige Intervalle, hohe Taktfrequen
zen, sowie Linienführung auch am Abend und
Wochenende. Ergänzende Mobilitäts
Eine sehr gute Orientierung bieten dazu die
angebote: Sharing-/Pool-
österreichweiten ÖV-Güteklassen.21 Wo notwendig Fahrzeuge
sollte insbesondere bei entsprechender Projektgrö
ße der Bauwerber im Dialog mit der zuständigen Ergänzend zum vorhandenen öffentlichen Verkehr
Kommune und dem/den Verkehrsbetreiber(n) eine und zu Fahrzeugen im Privatbesitz verbessern
Qualitätsverbesserung des öffentlichen Verkehrs Car- und Bike-Sharing oder das Teilen anderer
im und um das Quartier anregen. Fahrzeuge, die direkt in der Wohnhausanlage
bzw. im Wohnumfeld positioniert sind, das lokale
Jedenfalls im direkten Einflussbereich des Bau Mobilitätsangebot. Art, Anzahl und Type der
trägers sind folgende Maßnahmen: geeigneten Sharing-Fahrzeuge und des Sharing-
§ Standorte und Grundstücksbebauung so wäh Systems hängen dabei stark vom jeweiligen
len, dass kurze Wege zu ÖV-Haltestellen erzielt Standort und den Bedürfnissen der dortigen
werden. Ideal ist die Erreichbarkeit von ÖV-Hal NutzerInnen ab.
testellen binnen 300m
§ Gute Wegeleitung und Beschilderung der Generell gilt: Sharing Fahrzeuge eignen sich als
nächstgelegenen ÖV-Haltestellen auf der Lie Ersatz für Privatfahrzeuge, wenn diese nicht täg
genschaft lich benötigt werden (z.B. als Ersatz des Zweitwa
§ Abfahrtsmonitore an zentralen Punkten im gens). Sollen die Angebote dem jeweiligen Wohn
Wohnbau / Quartier, z.B. in Stiegenhäusern und standort fix zugeordnet und dort verfügbar sein,
Eingangsportalen anbringen; ggf. Errichtung sind jedenfalls stationsbasierte Sharing-Angebote
von Info-Säulen (Pylonen) im Freiraum sinnvoll. Soll die Mikro-Mobilität im oder um das
10PULL-MASSNAHMEN
Quartier verbessert werden, sind Freefloating-Sys § Im öffentlichen Raum: Schaffung der infra
tem eine gute Möglichkeit. Zur Anbindung von strukturellen Voraussetzungen für die Ladeinfra
bestimmten Punkten eignen sich stationsbasierte struktur seitens der Kommune
Point-to-Point Sharing-Systeme. § Erweiterungsmöglichkeiten vorsehen: Bedingt
durch die steigende Durchdringungsrate von
Mögliche Sharing-Fahrzeuge sind: Elektroautos und die Technologie-Entwicklung
§ Carsharing und/oder E-Carsharing unterschiedli (v.a. steigende Batteriekapazitäten und Reich
cher Fahrzeug-Größe und Type weiten von E-PKWs) werden künftig höhere
§ E-Bikes Leistungen und ggf. auch Trafos oder Elektro-
§ E-Lastenräder Pufferspeicher notwendig sein.
§ Elektro-Scooter / Elektro-Mopeds § Wo möglich: Koppelung der Ladeinfrastruktur
§ Sonderfahrzeuge: Einkaufstrolleys, Fahrradan an nachhaltige, lokale Energieerzeugung (z.B.
hänger, sowie zugehörige Accessoires PV Anlagen)
Empfohlen wird, die Sharing-Fahrzeuge auch für
Anrainer zugänglich zu machen. Dies steigert die
Mobilitätsoptionen im gesamten Quartier und
Räumliche Verknüpfung der
erhöht die Auslastung. Ideal ist eine Mischnut Angebote – Mobility Points
zung aus privaten und gewerblichen Nutzern, um
höhere Auslastungen zu erreichen. Wichtig ist, Wie unterschiedliche Mobilitätsangebote an sgn.
dass die Angebote regelmäßig evaluiert und an Mobility Points räumlich verknüpft werden und
sich wandelnde Bedürfnisse angepasst werden. welchen Nutzen dies bringt, wurde bereits in
Für die Sharing-Fahrzeuge sollten dafür eigens Punkt 1 – ‚Wozu Multimodalität?’ erläutert.
Stellplätze bzw. Räumlichkeiten zugewiesen
werden. Diese sollten öffentlich zugänglich sein, Bei der Integration von Sharing-Fahrzeugen im
guten GSM-Empfang aufweisen, Lademöglichkei Wohnbau sollten allgemein folgende Aspekte bei
ten (für E-Bikes, E-Autos) haben und zumindest der Planung berücksichtigt werden:
überdacht sein. § Sharing-Fahrzeuge an Orten mit guter Frequenz
und Sichtbarkeit auf der Liegenschaft bzw. im
Quartier positionieren
§ Nicht-Zulassungspflichtige Fahrzeuge (z.B.
Ladeinfrastruktur E-Bikes, E-Lastenräder) so positionieren,
dass diese vandalismus- und wettergeschützt,
§ A
usreichenden Lademöglichkeiten für das La
ebenerdig und barrierefrei zugänglich unter
den von Elektroautos schaffen (s. entsprechen
gebracht sind
de Leitfäden)
§ Carsharing-Fahrzeuge auf eigens ausgewiese
§ Buchbare und verrechenbare Ladepunkte reali
nen Stellplätzen an der Oberfläche oder in der
sieren, idealerweise öffentlich zugänglich
Garage positionieren
§ Alle PKW-Stellplätze mit Leerverrohrung aus
§ Für die Sharing-Fahrzeuge notwendige Lade
statten, um eine Nachrüstung mit Lademöglich
infrastruktur errichten und zuweisen
keiten zu erleichtern; Vorsehen von Durchbrü
§ Vorhalteflächen und mögliche Nachnutzungen
chen und Platz für die spätere Einrichtung der
für die flexible Anpassung der Angebote berück
notwendigen Zähler/Sub-zähler Einrichtungen
sichtigen
§ Benötigte Netzanschlussleistungen und Last
management berücksichtigen bzw. Erweite
rungen vorsehen; falls notwendig: Platz für
allenfalls erforderliche Trafo (Nachrüstung)
berücksichtigen
11PULL-MASSNAHMEN
Abb. 10: Mobility Point – exemplarische Darstellung der räumlichen Verknüpfung © MO.Point GmbH 2016
Verknüpfung mehrerer Digitale Verknüpfung
Standorte der Angebote – System
Werden mehrere Mobility Points errichtet stellt
kompatibilität
sich die Frage nach Verknüpfung. Aus Nutzersicht
Optimal für BürgerInnen ist es, wenn im Stadtteil
ist es attraktiv, ein Fahrzeug an einem Standort
vielfältige Mobilitäts-Angebote verfügbar sind.
zu entlehnen und dieses einfach am Endpunkt
Dabei stehen häufig die mangelnde Systemkom
der Fahrt abzustellen und die Ausleihe zu been
patibilität der einzelnen Anbieter und das be
den. Freefloating-Systeme bieten diesen Komfort,
triebswirtschaftliche Interesse privater Anbieter im
indem es NutzerInnen möglich ist, das Fahrzeug
Widerspruch zum Bestreben der Verkehrsplanung,
innerhalb eines definierten Geschäftsgebietes ab
Insellösungen zu vermeiden. Umgekehrt soll durch
zustellen. Können die Fahrzeuge an einer Station
attraktive Rahmenbedingungen die Betreiber
entliehen und an einer andere zurückgegeben
landschaft gefördert werden. Digitale Mobilitäts
werden, spricht man von stationsbasierten Point-
plattformen bieten hier die elegante Möglichkeit,
to-Point Sharing-Systemen.
für den/die NutzerIn einen einfachen Überblick
und Zugang zu den Angeboten zu schaffen, ohne
Für Betreiber erhöht sich dabei in jedem Fall die
die Betreibervielfalt einzuschränken (vgl. Kapitel
Komplexität, um die Verfügbarkeit zu gewährleis
1 – Digitale Verknüpfung). Berücksichtigt werden
ten und die Verteilung der Fahrzeuge zu optimie
sollte:
ren. Sowohl bei freefloating- als auch bei point-
§ Unterschiedliche Sharing-Fahrzeuge, die an
to-point Systemen müssen Fahrzeuge rückgeführt
einem Mobility Point bereitgestellt werden,
und im Falle von E-Fahrzeugen auch aufgeladen
sollten über ein einheitliches, elektronisches
werden, wodurch die Betriebsaufwände steigen.
Buchungssystem nutzbar sein
Welche Art von System geeignet ist oder ob
(möglichst keine unterschiedlichen Anbieter-
mehrere Standorte verknüpft werden sollen, ist im
Accounts für verschiedene Fahrzeugtypen)
Rahmen des Mobilitätskonzeptes (s. Kapitel 7) zu
§ An Mobility Points angebotene und im Stadtteil
klären.
verfügbare Sharing-Angebote sollten in über
geordnete Digitale Applikationen (Apps) für
Information und Wegeplanung integriert werden
12PULL-MASSNAHMEN
(z.B. Quando Salzburg); Bestimmte Plattformen § Informationen über die Mobilitätsangebote auf
ermöglichen auch Buchung und Bezahlung der Website des Immobilienentwicklers sowie
der darauf integrierten Mobilitätsdienste (z.B. der Hausverwaltung (Kundenportal, Intranet,
Wegfinder22) o.ä.) schalten
§ Gut lesbare Abfahrtsmonitore mit Echtzeitdaten § Integration von Echtzeitinformationen auf
für den öffentlichen Verkehr und mit Verfügbar Schwarzen Brettern oder hausinternen,
keitsanzeigen (z.B. von Sharing-Fahrzeugen) digitalen Informationssystemen
in der Immobilie positionieren. Dies erhöht die
Sichtbarkeit dieser Mobilitäts-Optionen.
Mobilitätsmarketing
§ A
m Standort verfügbare Mobilitätsangebote in
den Vertriebsunterlagen der jeweiligen Immo
bilie integrieren
§ Bewohner-Info-Mappen mit Foldern über alle
Mobilitätsangebote im Quartier und in der Stadt
erstellen
Weiterführende Literatur
n M
agistrat der Stadt Salzburg, Amt für Stadt
planung und Verkehr, Leitfaden für Projekt
entwickler – Mobilitätsbewältigung durch neue
Bauvorhaben
n S
tadt Salzburg Magistrat, Amt für Stadtplanung und Verkehr, Leitfaden Mobilitätsmanagement,
Salzburg 2013
n e-mobility Graz GmbH, Handlungsleitfaden Wohnbau und Elektromobilität, Graz, 2015
n Stadt Graz, Stadt Graz, A10/8 – Verkehrsplanung, Leitfaden Mobilität für Bauvorhaben, 2016
n B
undesministerium für Verkehr, Innovation und Technologie – BMVIT: Bau auf’s Rad! Maßnahmen
zur Förderung des Radverkehrs bei Hochbauvorhaben, Wien 2012
n L
and Salzburg, Leitfaden Fahrradparken – Planung und Realisierung von Radabstellanlagen in
Salzburg, Salzburg 2013
n Radgeber Radparken, Verein Radlobby Österreich, 201723
n B
undesministerium für Verkehr, Innovation und Technologie – BMVIT, Nachrüstung von Lade
stationen in bestehenden großvolumigen Wohngebäuden, Wien 2017
Abb. 11: Beispiel für aktives Mobilitätsmarketing: Mobilitätsratgeber Strubergassenviertel
© Stadt Salzburg/Info-Z
135. Push-Maßnahmen:
Restriktive Lenkungs
instrumente
Mittels Push-Maßnahmen können die Rahmenbe
dingungen zugunsten des Umweltverbundes und
Stellplatzvergabe
eines lebenswerten Freiraumes gestaltet werden.
Einen sehr hohen Effekt birgt die bedarfsorientier
Als Push-Maßnahmen werden restriktive Rege
te Zuteilung von Stellplätzen. Es wird empfohlen:
lungen und Vorgaben bezeichnet, die in diesem
§ Getrennte Vergabe von Wohnung und Stellplatz:
Kontext vor allem das Pkw-Stellplatzangebot und
Keine Verpflichtung für BewohnerInnen, mit der
die PKW-Nutzung (z.B. Tempolimits, Wohnstra
Wohnung einen Stellplatz mieten oder kaufen
ßen, etc.) betreffen. Zentrale, sehr wirkungsvolle
zu müssen.
und intensiv diskutierte Maßnahmen bei der
§ Konsequenterweise sollte die Möglichkeit für
Steuerung des Mobilitätsverhaltens sind dabei die
BewohnerInnen beschränkt werden, im öffent
Parktraumbewirtschaftung und das Stellplatzma
lichen Raum gratis oder wesentlich günstiger zu
nagement.
parken, wenn diese bei der Wohnungsvergabe
angeben, keinen Stellplatz zu benötigen. Durch
eine zeitliche Befristung der Beschränkung
Parkraumbewirtschaftung kann ggf. auf späteren Bedarf reagiert werden.
§ G
ratisstellplätze vermeiden: Es wird empfohlen
Stellplätze, die unentgeltlich im öffentlichen
Raum in unmittelbarer Nachbarschaft von Neu
Konsequente Verwaltung
bauvorhaben mit Mobilitätsmanagement-Maß privater Stellplätze
nahmen erreichbar sind, zu vermeiden.
§ Einführung Parkraumbewirtschaftung: Gratis Die Reduktion von Stellplätzen sowie die Entkop
stellplätze im öffentlichen Raum können pelung der Vergabe von Wohnung und Stellplatz
entweder durch großflächige Verbotszonen erhöht die Komplexität in der Verwaltung der
(Parkverbote) oder die Einführung, den Lücken Stellplätze. Natürlich obliegt es auf privatem
schluss bzw. einer Aktualisierung der Park Grund dem Eigner der Liegenschaft bzw. der Woh
raumbewirtschaftung erfolgen. nungseigentümer-Gemeinschaft (WEG) ob und
§ Vermeidung von Gratisstellplätzen in öffent wie die Stellplätze genutzt werden. Üblicherweise
lichen Garagen; ggf. Anpassung der Tarif liegt es im Zuständigkeitsbereich der Hausverwal
strukturen. (z.B. Kurz- und Dauerparker) tungen, auf die zweckmäßige Nutzung zu achten.
§ Keine Ausgabe von Anrainer-Parktickets für den § Eine zweckwidrige Nutzung von Kurz- und
öffentlichen Straßenraum an neue einziehende Besucherparkplätzen als Dauerparkplatz sollte
BewohnerInnen für eine gewisse Laufzeit, wenn im Sinne aller Beteiligter verhindert werden.
diese angeben, keinen Tiefgaragenstellplatz im Dazu bedarf es nicht nur der entsprechenden
Neubau zu benötigen. Vorschriften in den Kauf- und Mietverträgen
sowie in den Garagenordnungen, sondern auch
entsprechender Möglichkeiten der Sanktionie
rung (z.B. Abschleppen zweckwidrig geparkter
KFZ).
§ Digitale Applikationen (Apps), über die Bewoh
ner Missbrauch an die Hausverwaltung melden
können, bieten hier eine Hilfestellung.
14PUSH-MASSNAHMEN
§ S
tadtteilgaragen: Schaffung von Stadtteilgara
gen. Seitens der Stadt können hierfür Flächen
in den verschiedenen Stadtteilen vorausschau
end gesichert und Projekte initiiert werden. Im
Bestand könnten z.B. Umbauten bestehender
kommunaler Gebäude eine Möglichkeit zur
Nachrüstung bieten. Die Garagen sollten eine
größtmögliche Flexibilität ermöglichen, sodass
Nach- und Zwischennutzungen möglich werden,
wenn sich der Bedarf ändert.
§ Digitale Plattformen zur Vermietung von Stell
plätzen: Digitale Plattformen (Apps) ermögli
chen es, dass Garagen- bzw. Stellplatzeigen
tümer freistehende Stellplätze registrierten
NutzerInnen als Kurzzeit- oder Dauerparkplatz
anbieten können. Dazu wird üblicherweise ein
digitales Zutrittssystem sowie Hardware zur
Abb. 12: Beispiel Sammeltiefgarage Wien Aspern Erkennung der Stellplatzbelegung in der Garage
Creative Commons CCO 1.0 installiert. Vorteil ist, dass Garagen-Leerstand
reduziert wird. Die Kommune hat auf die Tarif
gestaltung der Plattformanbieter (bislang) kei
nen Einfluss. Werden Stellplätze in innerstäd
Sammelgaragen – bauliche tischen Lagen sehr günstig vermietet, so kann
das aber auch dazu führen, dass das Pendeln
Trennung von Wohnung und mit dem PKW in die Innenstadt attraktiver wird
Stellplatz und zunimmt. Entsprechende Maßnahmen sind
zu treffen.
rrichtung von bauplatzübergreifenden Sam
§ E
melgaragen am Quartiersrand oder Sammeltief
garagen auf einem der Bauplätze, um Äquidis
tanz zum öffentlichen Verkehr und zu anderen
Autofreie Zonen und
alternativen Angeboten zu schaffen. Reduktion des PKW-Verkehrs:
§ Bauliche Trennung von Wohnung und Garage:
Die räumliche Entkoppelung von Wohnung und § S
chaffung von autofreien Zonen bei der Be
Stellplatz schafft die Möglichkeit, freie Stell bauungs- und Freiraumplanung, Wohnstraßen;
plätze auch an Liegenschafts-fremde Personen Erschließung von Liegenschaften bzw. Quar
oder Organisationen zu vermieten. Baulich soll tieren mit dem PKW von außen; Vermeidung
te dabei vermieden werden, dass hausfremde von PKW-Durchfahrtsmöglichkeiten durch den
Personen, welche einen Stellplatz mieten, über Stadtteil.
die Garage Zugang zu den Wohnungen haben.
15PUSH-MASSNAHMEN
Haltepunkte (Pick-Up Points) Haltemöglichkeiten. Mit fortschreitendem altern
der Gesellschaft werden vermehrt Zufahrts-,
Halte- und Kurzparkmöglichkeiten für mobile
§ S
chaffung von Haltepunkten (Pick-Up Points)
Hilfs- und Pflegedienste sowie für die Ver
für Zustelldienste, soziale Dienste sowie Taxis
sorgung und den Krankentransport benötigt.
und On-Demand Services: Bereits jetzt benö
Halte-, Rangier- und Kurzzeitparkmöglichkeiten
tigen neben Taxis und im PKW mitfahrenden
müssen dazu in unmittelbarer Nähe der Ein
Personen auch On-Demand Dienstleister und
gänge frei bleiben.
insbesondere Kurier- und Paketdienstleister
Beispiel Nordbahnhof-Areal, Wien 102022
n P
hase I Bebaut bis 2014 auf dem Gelände des ehem. Nordbahnhofes, 1020 Wien,
75 ha Grundfläche, 158 ha BGF
n G
emischte, städtebauliche Struktur (62% Wohnen, 24% Büro/Gewerbe,
14% soziale Infrastruktur)
n Q
ualitativ hochwertiger öffentlicher Raum: Rudolf-Bednar-Park im Zentrum des Quartiers,
Fahrverbot
n Fokus auf den Umweltverbund
n P
KW-Erschließung des Quartiers von außen durch Schleifenführung der Straßen,
Unterbindung von Schleichwegen und Durchzugsverkehr
n Keine KFZ-Stellplätze im Straßenraum in Wohnstraßen und verkehrsberuhigten Bereichen
n Tempo 30-Zohne im Gebiet
Abb. 13:
Stadtentwicklung Wien
Nordbahnhof, Rudolf-
Bednar-Park, 1020 Wien
Quellen und weiterführende Informationen24
166. Stellplatzregulativ –
rechtliche Grundlagen
Seitens der öffentlichen Hand etabliert sich, ne
ben den oben genannten, klassischen Push-Maß
Salzburger Bautechnikgesetz
nahmen (s. Kapitel 5) das Stellplatzregulativ 2015 – BauTG 2015 /
zunehmend als essentielles Lenkungsinstrument, Stellplatzverordnung /
um Maßnahmen des Mobilitätsmanagements im
Wohnbau zu verankern. Dieses Regulativ definiert Bebauungspläne
Vorgaben, wie viele Stellplätze für Kraftfahrzeuge
auf einem Grundstück herzustellen sind.25 Dabei Aufgrund der vom Gemeinderat der Stadt Salzburg
ergeben sich Win-Win Situationen für die jeweilige im Jahr 2016 gemäß § 38 Abs 3 BauTG 2015 er
Kommune sowie für Bauträger und BewohnerIn lassenen Stellplatzverordnung der Stadt Salzburg
nen: Bauträger können, im Falle einer Reduktion und der in der Anlage 2 zum Bautechnikgesetz
der vorgeschriebenen Pflichtstellplätze Errich 2015 geregelten Schlüsselzahlen für die Schaf
tungskosten einsparen. Im Gegenzug kann die fung von PKW Pflichtstellplätzen für Bauten ergibt
zuständige Kommune mit dem Bauträger Maßnah sich die im Bauverfahren vorzuschreibende und
men des Mobilitätsmanagements (s. Kapitel 4) festzulegende Zahl von Stellplätzen.
vereinbaren. Dadurch kann sichergestellt werden,
dass die BewohnerInnen des jeweiligen Wohnbaus Für Wohnbauten gilt grundsätzlich eine Fest
auch bei reduzierter Zahl an PKW-Stellplätzen legung von 1,2 Stellplätzen je geschaffener
eine gute Mobilitäts-Versorgung vorfinden. Die Wohnung. In der Stellplatzverordnung wurde dies
rechtlichen Rahmenbedingungen werden in die bezüglich bislang keine abweichende Regelung
sem Kapitel beschrieben. getroffen.
§ 38 Abs 3 BauTG 2015 berechtigt Gemeinden,
die Schlüsselzahlen für die mindestens zu schaf
fenden Stellplätze durch Verordnung, allenfalls in
Bebauungsplänen, in Hinblick auf die jeweiligen
örtlichen Verhältnisse und Interessen abweichend
von der Anlage 2 höher oder niedriger festzule
gen. Dabei sind die Interessen des öffentlichen
Verkehrs, der Ortsplanung, insbesondere ein
vorhandenes Verkehrskonzept, die Lage des Be
bauungsgebietes in der Gemeinde und dessen Er
schließungsgrad mit öffentlichen Verkehrsmitteln
zu berücksichtigen.
Unter solchen Umständen können im Bebauungs
plan auch Obergrenzen zur Herstellung festgelegt
werden.
177. Zusammenarbeit und
Organisation bei Neubauten
Im Rahmen der oben genannten rechtlichen 1. Mobilitätskonzept
Grundlagen kann zwischen Bauträger bzw. Pro Parallel zum Planungsverfahren erstellt der Bau
jektentwickler und der Kommune eine entspre träger ein Mobilitätskonzept. Dieses beschreibt,
chende Vereinbarung über Stellplatzregulativ und wie die Mobilität aller Nutzergruppen der Lie
Mobilitätsmanagement-Maßnahmen getroffen genschaft bzw. des Areals im Sinne der verkehrs
werden, sofern für die jeweilige Liegenschaft die planerischen Zielsetzungen organisiert wird und
Voraussetzungen für eine mögliche Reduktion der bewältigt werden soll. Das Konzept sollte Inhalte,
Pflichtstellplätze gegeben sind und dieser Wunsch Zielsetzungen und konkrete Maßnahmen zur Stell
seitens des Bauträgers besteht oder dies seitens platzanzahl für PKWs und Fahrräder, Infrastruktur
der Kommune gefordert wird. für den Fuß- und Radverkehr, Anreize zur Nutzung
des öffentlichen Verkehrs sowie ergänzende Mo
Dabei benötigt es das akkordierte Zusammenspiel bilitätsangebote (z.B. Carsharing) sowie Ladein
aller Akteure: Planungsämter, Grundeigentümer, frastruktur umfassen. Der längerfristige Bestand
Projektentwickler bzw. Bauträger, Behörden und der Mobilitätsmaßnahmen und der Betrieb sollten
Politiker. Dazu wird folgende, bewährte Vorgangs nachvollziehbar dargelegt werden. Das Mobilitäts
weise empfohlen (s. Abb. 13): konzept wird mit den Zuständigen FachplanerIn
nen der Kommune abgestimmt.
2. Vereinbarung
zwischen Bauträger bzw. Liegenschaftseigner und
der zuständigen Kommune über die geplanten
Mobilitätsmaßnahmen. Die Vereinbarung sollte
Städtebauliche Planungen
Fachkonzepte Evaluierung
Bebauungs- Bezug und
Widmung Errichtung
plan Betrieb
Mobilitäts-
konzept
Abb. 14: Vorgangsweise zur Absicherung von Mobilitätsmanagement – Maßnahmen
Quelle: © MO.Point GmbH, Eigene Darstellung
18Z U S A M M E N A R B E I T U N D O R G A N I S AT I O N
BEI NEUBAUTEN
konkrete Maßnahmen messbar spezifizieren, Lauf Details zu möglichen Betriebsmodellen s. Punkt 9.
zeiten und Kosten beinhalten und ein langfristiges
Monitoring sicherstellen. Im Bundesland Salzburg 5. Evaluierung
erfolgt diese Vereinbarung meist im Zuge der Ab dem Betrieb sollte ein laufendes Controlling
Erstellung von Raumordnungsplänen (Flächen durch die verantwortliche Organisationseinheit
widmungsplan, Bebauungsplan). Weitere Möglich erfolgen und regelmäßig (z.B. halbjährlich) ein
keiten zur Ausgestaltung und dem rechtlichen Reporting an die zuständige Kommune abgeben.
Rahmen der Vereinbarung werden unter Punkt 8.1 Diese kann dadurch die Wirksamkeit der verein
erläutert. barten Maßnahmen evaluieren und für künftige
Projekte lernen. Sollten durch die vereinbarten
3. Errichtung Mobilitätsmanagement-Maßnahmen die Ziele
der Immobilie bzw. des Quartiers: Mit der Errich nicht erreicht werden, können u.U. Nachbesserun
tung der Immobilie werden auch die im Mobili gen oder Ausgleichszahlungen nachgefordert wer
tätskonzept dargelegten und in der Vereinbarung den, sofern derartige Sanktionierungen festgelegt
verbindlich vereinbarten Maßnahmen durch den wurden.
Bauträger, bzw. eine von diesem beauftragte
Organisation realisiert. Sämtliche Infrastruktur
maßnahmen, z.B. Fuß- und Radwege, Abstellanla
gen, Beschilderung, E-Ladestationen, etc. werden
errichtet.
4. Bezug und Betrieb
Wurden ergänzende Mobilitätsangebote, wie z.B.
Car- oder Bikesharing vereinbart, ist es wichtig,
dass die Angebote direkt ab dem Bezug der Im
mobilie den Bewohnern zur Verfügung stehen. Der
Bauträger kann dazu einen Mobilitätsdienstleister
beauftragen oder die Fahrzeuge und Mobilitäts
dienstleistungen selbst organisieren und anbieten.
198. Absicherung der
Mobilitätsmanagement-
Maßnahmen
8.1. Sicherstellung der Eine andere Form der zivilrechtlichen Ausgestal
tung sind Baurechtsverträge: Mobilitätsmaßnah
Maßnahmen zwischen Stadt men können auch im Zuge der Vergabe des Bau
und Bauträger rechtes abgesichert werden, indem auf Basis einer
zivilrechtlichen Vereinbarung die zu realisierenden
Maßnahmen des Mobilitätsmanagements definiert
LOIs, Willensbekundungen, werden. So hat die Stadt Salzburg für zahlreiche
Liegenschaften ein Baurecht vergeben – vor allem
Qualitätsvereinbarungen an gemeinnützige Bauträger. Im Zuge künftiger
Baurechtsverträge können derartige Maßnahmen
Bei Vorliegen der rechtlichen und fachlichen Vor vereinbart werden.
aussetzungen kann der Bauträger seine Absichten
zur Realisierung der Mobilitätsmanagementmaß
nahmen im Rahmen einer Willensbekundung oder Städtebauliche Verträge
eines Letter of Interests (LOI) schriftlich festhal
ten. Konkreter ist das Instrument von Qualitäts Mobilitätsmaßnahmen können alternativ auch
vereinbarungen, in dem die Maßnahmen näher über die Vertragsraumordnung verankert werden.
spezifiziert werden. Starkes Vertrauensverhältnis Dabei werden im Rahmen von städtebaulichen
vorausgesetzt hat sich dieses Instrument durchaus Verträgen auch Mobilitätsmaßnahmen festgelegt.
als zweckdienlich erwiesen. Allerdings bestehen Im Rahmen von Vertragsbeilagen werden z.B.
im Falle der Nicht-Einhaltung kaum Möglichkei Mindest-Anzahl und Ausstattungsqualitäten von
ten für die Kommune, die vereinbarten Mobilitäts Fahrradabstellanlagen, Car- und Bikesharing-
maßnahmen rechtlich einzufordern. Angebote, sowie eine jährliche Evaluierung defi
niert. Das Bundesland Salzburg war bekanntlich
eines der Ersten, das die Vertragsraumordnung
Zivilrechtliche Verträge eingeführt hatte (§ 18 ROG 2009). Die Stadt
Wien nutzt diese Möglichkeit und definiert bei
Eine verbindliche Möglichkeit, Mobilitätsmaßnah großen Bauprojekten häufig Mobilitätsmanage
men im Wohnbau abzusichern stellen zivilrecht ment-Maßnahmen im Rahmen städtebaulicher
liche Vereinbarungen dar.So schließt z.B. die Verträge (§1a Bauordnung, Wien).
Stadt Graz so genannte Mobilitätsverträge mit
Bauträgern ab. Diese beinhalten sämtliche verein
barte Mobilitätsmanagement-Maßnahmen.26
20ABSICHERUNG DER
M O B I L I T Ä T S M A N A G E M E N T- M A S S N A H M E N
Eintragung ins Grundbuch Bei der Vergabe von Wohnungen mit Mobilitäts
management muss etwa auf reduzierte PKW-Stell
plätze hingewiesen werden. Es könnten jene
In bestimmten Kantonen der Schweiz kann die
Menschen bevorzugt angesprochen und bei der
Grundeigentümerschaft die Verpflichtungen zu
Vergabe berücksichtigt werden, die einem neuen
den Mobilitätsmanagement-Maßnahmen im
Mobilitätsangebot aufgeschlossen gegenüberste
Grundbuch festschreiben. Dadurch ist garantiert,
hen und dieses auch nutzen wollen.
dass nicht nur der aktuelle Liegenschaftseigner
die vereinbarten Maßnahmen garantiert, sondern
die Verpflichtung auch auf nachfolgende Grundei Auto-Verzichtserklärung
gentümer überbunden wird.27 In Österreich wurde
diese Möglichkeit bislang noch nicht exploriert. Bei Wohnbauprojekten mit reduziertem Stellplatz
schlüssel kann von einziehenden BewohnerInnen
eine Auto-Verzichtserklärung gefordert werden. So
8.2. Sicherstellung von verzichteten z.B. die MieterInnen der „Autofreien
Mustersiedlung“ in Wien Floridsdorf, im Miet
Mobilitätsmanagement- vertrag, dass sie kein eigenes Auto besitzen oder
Maßnahmen gegenüber dauerhaft nutzen werden.28
BewohnerInnen Bei einzelnen Schweizer Wohnbaugenossenschaf
ten wird der Verzicht auf das Privatauto in den
Statuten festgeschrieben. Ob derartige Verzichts
Wohnungsvergabe erklärungen im Falle eines Verstoßes und diesbe
züglichen Rechtsstreits der Rechtsprechung genü
Wenn die Kommune ein Zuteilungsrecht auf die gen und insbesondere vor dem MRG standhalten,
jeweilige Wohnung hat, sollten bei der Vergabe der wurde aber bislang weder in Österreich noch in
Wohnungen auch die Mobilitätsbedürfnisse der der Schweiz ausjudiziert.
Wohnungssuchenden stark berücksichtigt werden.
Frei finanzierter Geförderter
Wohnbau Wohnbau
Widmung
Wohnungseigentum WEG WEG
WGG
Mietwohnungen MRG MRG
WGG
Abb. 15: Mobilität im Wohnbau, Rechtliche Rahmenbedingungen
Quelle: © MO.Point Mobilitätsservices GmbH, 2019
21ABSICHERUNG DER
M O B I L I T Ä T S M A N A G E M E N T- M A S S N A H M E N
Absicherung des Mobilitäts Werden frei finanzierte oder geförderte Mietwoh
nungen geschaffen, greift der Rechtsrahmen des
angebotes gegenüber Mietern Mietrechtsgesetztes (MRG).31 Wird bei Mietwoh
oder Käufern nungen Mobilitätsinfrastruktur angeschafft oder
betrieben, kann entweder der Vermieter die Kos
In weiterer Folge wäre es sinnvoll, das am Bau ten für den Betrieb von Sharing-Angeboten tragen.
platz geschaffene Mobilitätsangebot und den Sollen die Kosten aber weiterverrechnet werden,
Betrieb von Sharing-Fahrzeugen gegenüber Mie greifen die engen Rahmenbedingungen des MRG:
tern oder Käufern langfristig abzusichern, damit Entscheidend ist hier, ob sich Mobilitätsmaß
Bauträger und die einziehenden BewohnerInnen nahmen als Gemeinschaftsanlage iSd § 24 MRG
auch Sicherheit haben, dass das Angebot lang qualifizieren.
fristig bereit stehen wird. Die Herausforderung ist
dabei der komplexe rechtliche Rahmen, insbe Voraussetzungen dazu sind vor allem:
sondere da im Bereich der Wohnrechtsmaterien § Es muss allen Mietern freistehen, die Gemein
hinsichtlich Mobilität keine juristische Klarheit schaftsanlage unter Beteiligung an den Kosten
besteht. Die Abbildung 15 gibt einen Überblick, des Betriebs zu benützen.
welche rechtliche Rahmenbedingungen zu be § Einzelne Mieter dürfen nicht von der Benützung
rücksichtigen sind: ausgeschlossen werden.
§ Das für die Benützung verlangte Entgelt darf
Wird frei finanziertes Wohnungseigentum durch nicht höher sein, als die anteiligen Betriebs
den Bauträger geschaffen, so kann der Bauträger kosten.32
Mobilitäts-Infrastruktur errichten (z.B. Ladesäu
len) und/oder z.B. einen Betriebsvertrag mit Es ist unter den genannten Rahmenbedingungen
einem externen Betreiber von Sharing-Fahrzeugen grundsätzlich möglich, bauliche Mobilitätsinfra
abschließen. Die Absicherung der Mobilitätsange struktur als Gemeinschaftsanlage zu qualifizieren.
bote im Kaufvertrag ist grundsätzlich möglich. So Aber Aufwendungen, die den laufenden Betrieb
kann z.B. der Betriebsvertrag mit einem Sha von Fahrzeugen betreffen, können nur dann den
ring-Anbieter oder die angeschaffte Mobilitäts-In Mietern als Betriebskosten weiterverrechnet
frastruktur oder auch Fahrzeugen an die WEG mit werden, wenn diese als Gemeinschaftsanlage iSd
dem Kauf überbunden werden.29 Die detaillierte § 24 MRG qualifiziert werden. Ob auch Sha
Ausgestaltung der Vereinbarungen sollte juristisch ring-Fahrzeuge als Gemeinschaftsanlage geltend
detailliert geprüft werden. gemacht werden können, wurde bislang nicht
ausjudiziert. Hier herrscht erhebliche Rechtsun
Schwieriger im WEG ist die Frage, ob die laufen tersicherheit. Jedenfalls muss eine Übernahme
den Betriebskosten von Sharing-Fahrzeuge der der Kosten dezidiert im Mietvertrag geregelt und
ordentlichen oder auch der außerordentlichen durch den Mieter akzeptiert werden. Eine Auf
Verwaltung zugerechnet werden können.30 Die Fra teilung der Kosten muss allenfalls gemäß MRG
ge ist insofern entscheidend, als dass Angelegen entsprechend dem Nutzwert-Schlüssel erfolgen.
heiten der außerordentlichen Verwaltung jederzeit
von einzelnen Wohnungseigentümern angefochten Für gemeinnützige Wohnbaugesellschaften gilt
werden können. Das bedeutet, dass de facto das Wohnungsgemeinnützigkeitsgesetz (WGG)
Einstimmigkeit unter den Wohnungseigentümern und damit noch engere Rahmenbedingungen,
herrschen muss. Insgesamt herrscht dazu Unei welche Aufwendungen als Errichtungs- und
nigkeit unter JuristInnen. Eine Klarstellung des Betriebskosten geltend gemacht werden dürfen.
Gesetzgebers ist wünschenswert. Die Errichtungskosten sowie Planungskosten für
Infrastruktur, z.B. für E-Ladeinfrastruktur oder
Fahrrad-Abstellanlagen können als Baukosten
22Sie können auch lesen