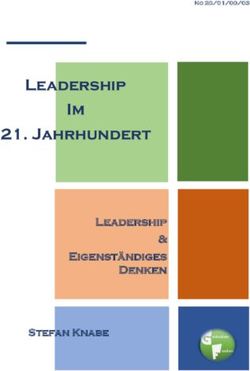Mehrsprachigkeit als Normalität bei Ivan Ivanji - Semih Murić - Schnittstelle ...
←
→
Transkription von Seiteninhalten
Wenn Ihr Browser die Seite nicht korrekt rendert, bitte, lesen Sie den Inhalt der Seite unten
Mehrsprachigkeit als Normalität bei Ivan Ivanji
Semih Murić
Ivan Ivanji, Sohn einer säkularisierten jüdischen Arztfamilie, wurde am 24.
Januar 1929 in Zrenjanin, einer serbischen Provinzstadt im Banat1 geboren. Er
ist ein jugoslawischer beziehungsweise serbischer Schriftsteller, Übersetzer,
Diplomat und Journalist. Der Dichter und politische Essayist hat über zehn
Romane geschrieben (z.B. Schattenspringen [1993]; Mein schönes Leben in
der Hölle [2014]) und jeweils drei Bände mit Gedichten und Erzählungen so-
wie zahlreiche Zeitungsartikel, Essays und Sachbücher. Darüber hinaus hat er
Werke von Bertolt Brecht, Heinrich Böll (Frauen vor Flusslandschaft – Žene u
pejzažu sa rekom [1988]), Günter Grass, Karl Jaspers, Max Frisch und von
weiteren Autoren aus dem Deutschen ins Serbische übersetzt; aus dem Serbi-
schen ins Deutsche sind es die Werke von Danilo Kiš (Frühe Leiden [1989];
Familienzirkus [2014]) und David Albahari. Seine Beiträge zu Zeitfragen
kann man heute noch regelmäßig in der internationalen Presse lesen (z.B. auf
spiegel.de, taz.de. dw.com oder im sn.at). Die Mechanismen von Politik und
Macht hat Ivan Ivanji hautnah erlebt: Er war lange Jahre Dolmetscher des
Jugoslawischen Staatschefs Josip Broz Tito sowie von einigen Belgrader Außen-
ministern. Dazu war er in den 1970er Jahren als Botschaftsrat Jugoslawiens in
Deutschland, und zwar in Bonn, tätig. In diesen oft sehr heiklen Funktionen
vor und hinter den Kulissen des Kalten Krieges lernte er viele der damaligen
deutschen politischen Akteure kennen: von dem SPD-Politiker Herbert Wehner
bis zum Generalsekretär der SED Walter Ulbricht, vom Bundeskanzler Willy
Brandt über den FDP-Politiker und den langjährigen Bundesminister des Aus-
wärtigen Hans-Dietrich Genscher bis zum Bundeskanzler der deutschen Wie-
dervereinigung Helmut Kohl.
Der jüdische Autor, ein Überlebender der Konzentrationslager Ausschwitz
und Buchenwald, verliert bereits mit 15 Jahren seine ganze Familie. Seine
Großeltern nahmen sich 1941 nach dem Einmarsch der Deutschen ins Banat
das Leben, und seine Eltern wurden von den deutschen Soldaten ermordet. Als
er deportiert wurde, sagte der damals 15-jährige zu dem Schutzstaffel-Arzt
am Eingangstor des Konzentrationslagers Auschwitz: „Ich bin arbeitsfähig!“
(Rujevic 2018) Diese lebensrettenden Worte beruhten auf einer falschen An-
nahme: Der 15-jährige dachte, wer arbeite, bekomme besseres Essen. Den
1 Das Banat ist eine historische Region in Südosteuropa, die heute in den Staaten Rumänien,
Serbien und Ungarn liegt. Der Begriff ‚Banat‘ leitet sich vom Herrschaftsbereich eines Ban
(serbisch/kroatisch/ungarisch für Graf/Markgraf) ab.
Schnittstelle Germanistik, Jahrgang 1 (2021), Ausgabe 1
© 2021 Universitätsverlag WINTER GmbH Heidelberg
Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)254 Semih Murić
Geschichten über die Vernichtung der Juden glaubte er nicht – erst nach dem
Krieg erfuhr er, dass seine Eltern in Belgrad getötet worden waren (Rujevic
2018). Er war eng mit Günter Grass befreundet, aber im Gegensatz zu Günter
Grass, der mehrere Jahre vor seinem Tod sagte, er wolle nichts mehr als
Schriftsteller anfangen, weil er nicht wisse, ob er es zu Ende bringen kann, war
Ivan Ivanji einer anderen Meinung: „Ich beginne immer wieder etwas Neues,
und wenn ich es nicht beenden kann, bleibt es eben unvollendet. Hat es ja auch
schon gegeben.“ (APA 2019) Ivanji schreibt seine Romane auf Deutsch und auf
for personal use only / no unauthorized distribution
Serbisch. Seine Werke sind auf Deutsch größtenteils im Wiener Picus Verlag
erschienen. Was noch wichtig ist und später ausführlicher behandelt werden
soll, ist die Tatsache, dass Ivan Ivanji von klein auf drei Sprachen lernte und
sprach, und zwar Serbisch, Ungarisch und Deutsch.
Der Autor ist demzufolge ein mehrsprachiger Verfasser par excellence.
Winter Journals
Hinzu kommt, dass er seine Muttersprache im traditionellen Sinn nicht be-
stimmen kann, womit Konzepte zum Schreiben in Zweitsprachen hinfällig
werden und offensichtlich zu kurz greifen (Lughofer 2014: 54).
In seinem großen Erinnerungsbuch Mein schönes Leben in der Hölle
(2014) blickt der Erzähler zurück auf sein Leben. Gezielt zieht Ivan Ivanji die
Leser/innen in sein Spiel mit ungelebten Möglichkeiten hinein, mischt Fanta-
sien mit Fakten und hinterfragt kritisch die Verlässlichkeit der eigenen Erin-
Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)
nerung:
Hat mich mein eigener Onkel an die Nazis ausgeliefert? Verraten? Oder einfach nur im Stich
gelassen? Das ist nicht die einzige Frage, die ich mir stellen werde, es schwirren auch viele ande-
re herum in der Luft, die ich atme, Fragen, die bisher unbeantwortet geblieben sind. Zumindest
aussprechen muss ich sie. Auch das ist mehr als nichts, besser, als an ihnen nur zu würgen, um
sie am Ende einfach hinunterzuschlucken. Wo wären sie dann, falls sie unverdaulich sind? Ob
ich Antworten finden werde, ist eine andere Frage. Die erste Frage? (Ivanji 2014b: 8)
Der autobiographische Roman enthält auch viele eindringliche Geschichten
von Reisen, von Begegnungen und Gesprächen während der Jahre als Titos
Dolmetscher und als Botschaftsrat Jugoslawiens in Deutschland, von Verwand-
ten und Frauen, von Büchern und Filmen. Schöne Geschichten in der ‚schlim-
men großen‘ Geschichte, die Ivanji mit nicht nachlassender Geduld und Heiter-
keit wiedergibt, die selbst den Tod nicht fürchtet. Hier beichtet ein wortgenauer
und erinnerungsskeptischer Schriftsteller sein eigenes Leben, der viele seiner
Bücher auf Serbisch und auch auf Deutsch geschrieben hat. Sein Erinnerungs-
buch allerdings nur auf Deutsch. Auf Serbisch ginge es nicht, in gar keiner
Weise, meint Ivanji. Deutsch sei zwar seine Sprache, aber nicht seine Mutter-
sprache. Die Muttersprache wäre Ungarisch, aber Ungarisch könne er nicht so
gut. (Ivanji 2014a: 4-7)
Übersetzen im eigentlichen Sinne aus einer Sprache in die andere wollte
Ivan Ivanji eigentlich nicht, denn er müsste dasselbe schreiben, und zwar in
Schnittstelle Germanistik, Jahrgang 1 (2021), Ausgabe 1
© 2021 Universitätsverlag WINTER GmbH Heidelberg
Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)Mehrsprachigkeit als Normalität bei Ivan Ivanji 255
einer anderen Sprache, oder besser gesagt anderssprachig ‚neu‘ schreiben. Ein
konkretes Beispiel für diese ‚Übersetzungsproblematik‘ ist das Wort drug,
welches Ivan Ivanji aus dem Serbokroatischen ins Deutsche übersetzte.
Das Wort drug kann man in einem bestimmten Kontext als Genosse übersetzen, aber in um-
gekehrter Richtung ist dieses deutsche Wort fast unübersetzbar. Wahrscheinlich wissen die
wenigsten Deutschen, falls sie nicht zufällig Sprachwissenschaftler/innen sind, dass dieses
Wort vom altdeutschen ginoz abstammt und dieses Genießen heißt, d. h. ursprünglich redeten
sich so Leute an, die etwas gemeinsam genossen haben. Dieser Sinn ist allerdings im Laufe der
Zeit verloren gegangen. Der heutige Deutsche weiß nur, dass sich die Mitglieder kommunisti-
scher, sozialistischer und anarchistischer Parteien oder Gruppen mit Genosse ansprechen.
Gewerkschaftler sagen zueinander Kollege. Das Wort drug heißt bei denjenigen, die gemein-
sam beim Militär waren, Kamerad. Im Zweiten Weltkrieg, insbesondere bei SS-Männern, hieß
es oft Kriegskamerad. Zu Hitlers Zeiten wurden Mitglieder seiner Partei Parteigenossen, Pg’s,
genannt. Der Rest der deutschen Bevölkerung wurde mit Volksgenossen und Volksgenossinnen
angesprochen. (Ivanji 2014a: 7)
An einem weiteren Beispiel möchte ich versuchen, die angeschnittene Proble-
matik zu vertiefen und anhand eines Buchtitels aufzeigen, womit Ivan Ivanji
bei seiner Übersetzungsarbeit zu kämpfen hatte:
Zuerst auf Serbisch habe ich eine Kurzgeschichte über die Experimente geschrieben, die SS-
Ärzte in Dachau mit jüdischen Häftlingen gemacht haben. Man wollte prüfen, wie man halb-
erfrorene, aus dem Ozean gefischte Piloten am besten wiederbeleben könnte. Unter anderem
steckte man also Männer in Eiswasser, holte sie halbtot heraus, und brachte sie mit einer
jungen nackten Frau zusammen. Oder mit zwei Frauen… Auf Serbisch war der Titel LEDENI
LJUBAVNIK. Und dann wollte ich die kleine Erzählung auf Deutsch schreiben. Aber wie den
Titel übersetzen? Wortwörtlich wäre es etwa EIN GEFRORENER GELIEBTER. Das konnte
selbstverständlich nicht an der Spitze der Beschreibung einer so entsetzlichen Tat stehen. Es
hat ziemlich lange gedauert bis ich den richtigen deutschen Titel gefunden habe, und zwar DER
KÄLTESTE KUSS. Sogar eine Alliteration war wieder da. Nur dass ich im serbischen Text keinen
Kuss erwähnt habe, den musste ich jetzt in den Text hineinschreiben, es passte gut. (Ivanji
2014a: 7)
Ivanji führt zwei konkrete Beispiele aus seinem Werk Mein schönes Leben in
der Hölle an, die sich mit den Übersetzungsvarianten des Wortes drug beschäf-
tigen: „Er erzählte es im Vertrauen zwei oder drei seiner Kumpel.“ (Ivanji
2014b: 7). Jeder von ihnen hatte zwei, drei weitere besten Kameraden.“ Oder:
„Mag sein, ich habe auf einem anderen Planeten gelebt als die meisten meiner
Zeitgenossen nach dem Krieg.“ (Ivanji 2014b: 7)
Das Kriterium des Schreibens in Sprachen, die nicht die eigene Mutter-
sprache sind, gilt in der Debatte um Migrations- und interkulturelle Literatur
als zentrales Phänomen (Rösch 1992: 5). Selbst die Bildungssprache lebte noch
punktuell in einer mehrsprachigen Gesellschaft des 20. Jahrhunderts wie im
Geburtsort Ivanjis – im historischen Banat (Ivanji 2014: 4-7). Wie schon am
Anfang erwähnt wurde, lernte Ivanji von Kindheit auf im Banat drei Sprachen:
Serbisch war die zentrale Umgebungssprache, die Eltern sprachen unterein-
ander ungarisch und mit dem Kind deutsch, ebenso wie das österreichische
Schnittstelle Germanistik, Jahrgang 1 (2021), Ausgabe 1
© 2021 Universitätsverlag WINTER GmbH Heidelberg
Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)256 Semih Murić
‚Kinderfräulein‘ das übrigens aus Slowenien war. Deswegen liest man oder
hört man von Ivanji selbst, dass er statt der deutschen Sprache immer wieder
die „Kinderfräulein-Sprache“ bevorzugte (Ivanji 2014a: 4). Später widmete er
einen Roman dem Kindermädchen mit dem Titel Das Kinderfräulein (1998).
Vielleicht wurden all diese Sprachen grammatikalisch nicht ganz fehlerfrei ge-
sprochen, sie waren aber allgegenwärtig und wurden als Kommunikations-
sprachen verwendet: „Serbisch, Deutsch und Ungarisch wurden durcheinander
gesprochen, tatsächlich verstand hier jeder alle drei Sprachen, wenn jemand
Fehler machte, wurde er nicht ausgelacht und schon gar nicht korrigiert.“
(Ivanji 1998: 27)
Wie die Lexik unterschiedlicher Sprachen verschmelzen kann, wird anhand
eines amüsanten Beispiels veranschaulicht: Respektspersonen grüßt man mit
„Küßdiehand“ (Ivanji 2008: 19) was ausgesprochen wird, als sei es eine einzige
Silbe, oder auf Serbisch „ljubimruku“ (Ivanji 2008: 19), Ungarisch „kecitsco-
kolom“ (Ivanji 2008: 19), oft aber, wenn man nicht weiß, welche Sprache gera-
de passend ist, einfach zum Scherz oder nur unüberlegt, blitzschnell alles her-
untermurmelnd: „Küßdiehandljubimrukukezitscokolom“ (Ivanji 2008: 19).
Im Banat wurden sogar mehr als die drei erwähnten Sprachen verwendet:
Nicht nur beim Arzt, beim Friseur, auf dem Bauernmarkt, sondern auch mit
dem Trafikanten und dem Rechtsanwalt sprach man, wie es einem gerade ge-
kommen ist und man sich im Augenblick bequemer und sicherer ausdrücken
konnte – Serbisch, Deutsch, Ungarisch, Rumänisch, Slowakisch oder Ruthe-
nisch: „Es ist das Gegenteil von Babylon, die Sprachenvielfalt führt zu keiner
Verwirrung, jeder versteht den anderen.“ (Lughofer 2014: 19). Ivanjis große
Bezugsperson Tito scheint von einer solchen Sprachverwendung auch betrof-
fen gewesen zu sein:
Sein Akzent war seltsam, man glaubte deshalb im Ausland, er sei eigentlich Russe, was nicht
stimmt. Er wurde in Kumrovec in Kroatien geboren, war als Kind aber oft bei seinen Großeltern
mütterlicherseits in Slowenien. So wuchs er zwischen dem Slowenischen und dem Dialekt
seiner kroatischen Heimat, dem Zagorje, auf und lebte später zwischen Deutsch, Serbisch und
Russisch. Daher sein ungewöhnlicher Duktus. (Ivanji 2007: 118)
Zusammenfassend lässt sich sagen, dass Ivan Ivanji seine eigene Mehrspra-
chigkeit als Autor in seiner Literatur formal wenig nutzt – Ausdrücke und
Sprichwörter aus dem Serbischen fließen in seine deutschen Werke ein, doch
sie werden immer sofort übersetzt. Sein Stil ist und bleibt prosaisch klar,
sachlich und nüchtern, obwohl er die Begebenheiten stets auf verschiedenen
individuellen und subjektiven Ebenen darstellt. In Ivanjis Romanen wird Tito
als wichtigste Bezugsperson betrachtet und als Galionsfigur Jugoslawiens
dargestellt. Die Romanfiguren identifizieren sich mit ihm als einem verbinden-
den Element im jugoslawischen Staatswesen. Mehrsprachigkeit scheint eine
Selbstverständlichkeit bei den meisten Protagonisten in Ivanjis Romanen zu
Schnittstelle Germanistik, Jahrgang 1 (2021), Ausgabe 1
© 2021 Universitätsverlag WINTER GmbH Heidelberg
Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)Mehrsprachigkeit als Normalität bei Ivan Ivanji 257
sein. Die Texte verzichten auf eine verfremdende Einarbeitung der Mehrspra-
chigkeit und auf Distanz und Brüche mit der deutschen literarischen Tradition,
im Gegenteil: Sie führen die Einteilung seines literarischen Schaffens in einer
Erst- oder einer Zweitsprache ad absurdum und zeichnen das Bild polyglotter
Individuen als Normalität.
Literatur
APA (2019): Ivan Ivanji – der Autor wurde 90. – In: Salzburger Nachrichten (27. Januar 2019)
[30.12.2020]
Ivanji, Ivan (1998): Das Kinderfräulein. Wien: Picus.
Ivanji, Ivan (2007): Titos Dolmetscher. Als Literat am Pulsschlag der Politik. Wien: Promedia.
Ivanji, Ivan (2008): Geister aus einer kleinen Stadt. Wien: Picus.
Ivanji, Ivan (2014a): Kinderfräuleinsprache und „naški jezik“, unsere Sprache. – In: Donko, Kristian/
Lughofer, Johann Georg/Ivanji, Ivan (Hgg.), Erinnerung an Jugoslawien in der deutschspra-
chigen Literatur. Zur Exophonie. Ljubljana: Goethe-Institut.
Ivanji, Ivan (2014b): Mein schönes Leben in der Hölle. Wien: Picus.
Lughofer, Johann Georg (2014): Konstruktion kultureller Identität bei Ivan Ivanji. – In: Aussiger
Beiträge 8, 49-65 [30.12.2020]
Rösch, Heidi (1992): Migrationsliteratur im interkulturellen Kontext. Eine didaktische Studie zur
Literatur von Aras Ören, Aysel Özakin, Franco Biaoni und Rafik Schami. Frankfurt/M.: Ver-
lag für Interkulturelle Kommunikation.
Rujevic, Nemanja (2018): Ivan Ivanji: NS-Opfer, Kommunist, Literat, Jugoslawien. – In: Deutsche
Welle [30.12.2020].
Schnittstelle Germanistik, Jahrgang 1 (2021), Ausgabe 1
© 2021 Universitätsverlag WINTER GmbH Heidelberg
Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)Schnittstelle Germanistik, Jahrgang 1 (2021), Ausgabe 1
© 2021 Universitätsverlag WINTER GmbH Heidelberg
Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)Sie können auch lesen