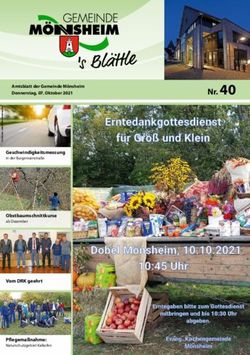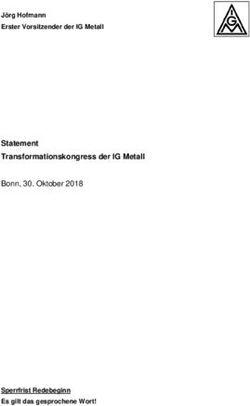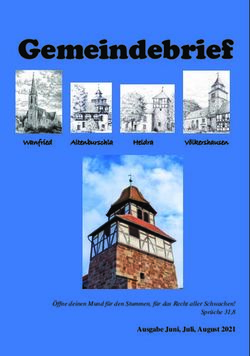OSTTIROLER WANDERBUCH - Tyrolia Verlag
←
→
Transkription von Seiteninhalten
Wenn Ihr Browser die Seite nicht korrekt rendert, bitte, lesen Sie den Inhalt der Seite unten
ErlebnisWANDERN
OSTTIROLER
WANDERBUCH
700 Wanderungen zwischen
Hohen Tauern,
Karnischen Alpen,
Großglockner und
Lienzer Dolomiten
TYR OLIA WALTER MAIRWalter Mair
Osttiroler Wanderbuch
700 Wanderungen zwischen den
Hohen Tauern und den Karnischen Alpen,
dem Großglockner und den Lienzer Dolomiten
8., aktualisierte und erweiterte Neuauflage
Tyrolia-Verlag · Innsbruck-WienBibliografische Information Der Deutschen Nationalbibliothek Die Deutsche Nationalbibliothek verzeichnet diese Publikation in der Deutschen Nationalbibliografie; detaillierte bibliografische Daten sind im Internet über http://dnb.d-nb.de abrufbar. Gedruckt mit freundlicher Unterstützung der Osttirol-Werbung 2013 8. aktualisierte und erweiterte Ausgabe Umschlaggestaltung: Tyrolia-Verlag, nach einem Layoutentwurf von nuovoline, Werner Niederkircher, Innsbruck Coverbild: Herbst im Kalser Lesachtal. Glödis, Ralfkopf und Ganot (von links) tragen bereits ein Winterkleid. Umschlagrückseite: Die Arnitzalm, im Hintergrund reihen sich die Gipfel um die Mittereggspitze in der Virgener Nordkette. Bild Seite 2: Das Ködnitztal mit Huteralm, Lucknerhütte und dem Kalser Gesicht des Großglockners Diese und alle weiteren Abbildungen: Walter Mair, Lienz Kartenausschnitte im Maßstab 1:100.000 © Kartografie KOMPASS-Karten GmbH, Lizenz-Nr. 2-0113-LAB Layout: Tyrolia-Verlag, Innsbruck Lithografie: Artilitho, Trento Druck und Bindung: Formatisk, Slowenien ISBN 978-3-7022-1681-8 E-Mail: buchverlag@tyrolia.at Internet: www.tyrolia-verlag.at
5
Inhalt
Vorwort . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7
Einleitung . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8
Erläuterungen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8
Berg- und Wanderausrüstung . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9
Osttirol: Lage und Übersicht . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9
Zur Namenskunde Osttirols . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11
Naturdenkmäler im Bezirk Lienz . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12
Der Nationalpark Hohe Tauern . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13
Übersichtskarte Lienz und Umgebung . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14/15
Lienz und Umgebung . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16
Lienz in Geschichte und Gegenwart . . . . . . . . . . . . . . . 16
Die bedeutendsten Kulturgüter von Lienz . . . . . . . . . . . .18
Wanderungen im Lienzer Talboden und in den Lienzer
Dolomiten . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19
Klettersteige in den Lienzer Dolomiten . . . . . . . . . . . . . 56
Hochstein und Böses Weibele . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 59
Ederplan und Ziethenkopf . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 68
Südliche Schobergruppe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 83
Übersichtskarte Iseltal . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 126/127
Das Iseltal . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 128
Übersichtskarte Iselregion . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 148
Die Iselregion und der Markt Matrei . . . . . . . . . . . . . . . . . 149
Das Tauerntal . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 179
Übersichtskarte Tauerntal . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 180/181
Das Kalser Tal . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 213
Übersichtskarte Kalser Tal . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 214
Das Virgental . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 251
Übersichtskarte Virgental . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 252/253
Sonnseitige Wanderungen in Virgen . . . . . . . . . . . . . . 254
Der Lasörlingkamm . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 269
Wanderungen im inneren Virgental . . . . . . . . . . . . . . . 2796
Übersichtskarte Defereggental . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 324/325
Das Defereggental . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 326
Wanderungen um St. Jakob . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 327
Das innere Defereggental . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 343
Die Deferegger Alpen (westl. Teil, Villgratener Berge) 357
Wanderungen in der St. Veiter Sonnseite . . . . . . . . . . 371
Wanderungen in der St. Veiter Schattseite . . . . . . . . . 378
Wanderungen um Hopfgarten . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 382
Deferegger Alpen (Gemeindegebiet Hopfgarten) . . . . 390
Das Pustertal (Drautal) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 400
Übersichtskarte Pustertal . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 402/403
Übersichtskarte Villgratental . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 442/443
Das Villgratental . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 444
Außervillgraten . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 445
Bergwanderungen im Winkeltal . . . . . . . . . . . . . . . . . 453
Innervillgraten . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 469
Übersichtskarte Gailtal . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 494/495
Das Tiroler Gailtal . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 496
Kartitsch – Karnischer Kamm . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 497
In der Sonnseite der Lienzer Dolomiten . . . . . . . . . . . 513
Ober- und Untertilliach – Karnischer Kamm . . . . . . . . 527
Der Karnische Kamm . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 539
Register . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5627 Vorwort zur achten Auflage Nie wird dieses Osttiroler Wanderbuch mich, noch werde ich es gänzlich freigeben. Stets werde ich versuchen, die Beschreibung aller zumutbaren Wanderwege und alpinen Steige auf einem mög- lichst aktuellen Stand zu halten. Von allen meinen Büchern ist mir das Osttiroler Wanderbuch das „liebste Kind“, das gewissenhaft bei der Hand zu führen mir eine Herzensangelegenheit geworden ist. Mit jeder Bergtour und Wanderung, mit dem Suchen und Finden, mit dem Blick um jedes Eck und in jeden Winkel wächst meine Verbundenheit mit Osttirol, dem liebenswerten Bezirk im Süden und in der Sonne. So hoffe ich, dass das wiederum erneuerte Osttiroler Wanderbuch allen Benützern ein guter Begleiter sein möge: in der Eiswelt der Hohen Tauern – der imposantesten Massenerhebung des alpinen Hauptkammes, dem größten geschlossenen Gletscherareal mit den stolzen Gipfeln, die Großglockner, Großvenediger und Hochgall anführen – genauso wie in den grauen, formschönen Felsburgen der Lienzer Dolomiten und zu den Gipfeln des Karnischen Kammes. Wenn nun die achte Auflage des Osttiroler Wanderbuches vorliegt, dann sind darin alle notwendigen Verbesserungen und Ergänzungen enthalten, die sich seit der letzten Auflage des Jahres 2005 ergeben haben. Dies gilt für die neuen Lehrpfade und Kulturwege im Ostti- roler Anteil des Nationalparks wie auch für Neutouren und Kletter- steige in den übrigen Berggruppen. Wenn dieses Wanderbuch auf all die vielen alpinen Möglichkeiten aufmerksam macht und mit selbst erlebter Freude gefühlvoll einführt, dann bin ich mir sicher, dass es abseits einzelner, stark besuchter Plätze kaum überlaufene Bergtäler und Wanderwege gibt und dass nach wie vor ein sanfter Tourismus Brot- und Arbeitgeber ist. Ich möchte ein stiller Bot- schafter unserer so abwechslungsreichen und abenteuerlichen Bergwelt sein und wünsche allen Benützern des Osttiroler Wander- buches eine erlebnisfrohe Wanderschaft. Lienz, im Frühjahr 2013 Walter Mair
8 Einleitung Erläuterungen Die Dolomitenstadt Lienz wurde mit den sie umgebenden Bergge- bieten an den Anfang des Osttiroler Wanderbuches gestellt. Im wei- teren Aufbau wendet es sich dem Iseltal bis zum Markt Matrei zu und schaut sich im Tauern-, Kalser und Virgental nach allen bedeu- tenden Wandermöglichkeiten um, ehe es nach dem Defereggental im südlichen Bereich des Bezirkes weiterforscht. Durch das Puster- tal bis zur Staatsgrenze, hinein in das Villgratental und weiter im Tiroler Gailtal werden alle Wanderstationen aufgesucht und mög- lichst verständlich dargelegt. Alle Gemeindezentren mit den dazugehörenden Ortsteilen und Weilern werden etwas aus dem Schriftbild gehoben und als logi- sche Ausgangspunkte zu den Almen, Hütten und Gipfeln darge- stellt. Die Beschreibungen der weit verzweigten Wege und Steige sind jeweils dem betreffenden Gemeindegebiet zugeordnet, ledig- lich die hüttenverbindenden Steige und die großen Höhenwege kennen keine „Gemeindegrenzen“. Nahezu alle in diesem Wander- buch erfassten Wege und Steige sind markiert und nach ihrem Schwierigkeitsgrad (leicht, mittel oder schwierig) eingestuft, wobei leichte Routen bei ungünstigen Wetterbedingungen auch schwierig sein können. Darauf nehmen die Beschreibungen Rücksicht. Mitt- lere Schwierigkeit bedeutet, dass Trittsicherheit notwendig ist, schwierige, dass witterungsbedingt durch Schnee oder Eis große Vorsicht geboten ist. Für die sportlichen Bergfreunde sind die Klettersteige erwähnt. Um die Übersichtlichkeit der einzelnen Routenbeschreibungen zu fördern, werden die Wegzeiten und Höhenunterschiede an den Beginn, das kulturell wie geschichtlich Erwähnenswerte an den Schluss der jeweiligen Kapitel gesetzt. Die Höhenzahlen wurden von den Freytag & Berndt-Karten übernommen, ungeachtet der geringen Abweichungen auf anderen Karten. Die in Osttirol gebräuchlichen Markierungen sind nicht einheitlich, am häufigsten in Rot-Weiß.
Osttirol: Lage und Übersicht 9 Berg- und Wanderausrüstung Zweckmäßige Kleidung und festes Schuhwerk sind unerlässlich. Für Schlechtwetter geeignete Reservewäsche ist wichtiger als ein Zuviel an Proviant und Flüssigkeit. Auf langen Wegen werden wir bald erkennen, was an unnötigem Beiwerk den Rucksack füllt. Ein Zeltsack oder wenigstens eine entsprechend große Plastikhaut vermag Wind und vorübergehenden Regen abzuhalten. Fäustlinge, eine Haube, Brille und Sonnenschutz sind mitunter schon bei Kurztouren unentbehrlich. In einer Seitentasche des Rucksackes verstauen wir ein Erste-Hilfe- Paket. Wenn die Wanderung oder Bergtour Gletscherstrecken oder schwierige Felsübergänge mit einschließt, soll die Mitnahme eines Seils nicht als Ballast betrachtet werden. Ein steiles Schneefeld, gepaart mit Angst und Unsicherheit, kann zur Katastrophe ausarten. Bieten Sie Ihrem noch ungeübten Begleiter vorbeugend Schutz und Hilfe an. Überfordern Sie auf weiten, vielstündigen Wegabschnit- ten Kinder nicht. Die Sonne am heißen Mittag lähmt Energie und Ausdauer genauso wie Sturm und Kälte. Übermüdete oder erschöpfte Begleiter werden den wahren Sinn einer Bergwanderung schwer verstehen und dem Bergsteigen keine positive Seite abge- winnen. Schenken Sie dem Wetter die größte Beachtung. Feuchte und noch kleine Morgennebel können nach wenigen Stunden ein Gewitter auslösen, das mit Blitz und Hagelschlag bedrohliche Situationen schafft. Treten Sie bei unsicherem Wetter lieber den Rückweg oder den Ab- stieg ins Tal an. Das hat nichts mit Zaghaftigkeit zu tun, sondern ist vielmehr ein kluger Entschluss. Osttirol: Lage und Übersicht Osttirol liegt zwischen hohen, wenig durchgängigen Gebirgszügen, wobei die Abschirmung gegen Norden durch den Alpenhauptkamm besonders ausgeprägt ist. Aufgrund des Reliefs und der Höhenlage ist der Dauersiedlungs- raum in Osttirol auf nur 10,5 Prozent der Gesamtfläche beschränkt. Dabei entfallen erhebliche Teile des dauernd bewohnten Gebietes auf extreme Lagen wie steile Hänge oder große Höhen.
10 Einleitung Die Fläche Osttirols ist mit 2020 Quadratkilometern etwas kleiner als vergleichsweise die Vorarlbergs. Mit rund 50.000 Einwohnern leben hier wegen der topografischen Gegebenheiten aber nur rund ein Sechstel der Menschen, die Vorarlberg bevölkern. Osttirol weist infolge seiner Lage im Bereich von hochaufgerichte- ten Gebirgszügen überwiegend kontinentalalpine Klimaverhältnis- se auf. Hinzu kommt, dass wesentliche Bereiche Osttirols auf über 1000 Metern Seehöhe liegen. Lediglich das Drautal bis Abfalters- bach sowie das Iseltal bis in den Raum Matrei liegen unterhalb die- ses Schwellenwertes. Außer durch Höhenlage und Relief wird das Klima in Osttirol auch dadurch beeinflusst, dass die mit bestimm- ten Großwetterlagen zusammenhängenden Witterungserscheinun- gen stark von der Lage zwischen Alpenhauptkamm und Südalpen abhängen. Osttirol ist durch seine inneralpine Beckenlage eher nieder- schlagsarm und trocken (Regenschatten des Alpenhauptkammes). Dessen ungeachtet führen Südwest- und Südniederdrucklagen viel- fach zu ergiebigen Niederschlägen in den Übergangszeiten bzw. im Vorwinter. Diese Wetterlagen sind für Osttirol die eigentlichen Schneebringer. Auch in der Windhäufigkeit weist Osttirol, vor allem in den Tallagen, günstige Verhältnisse auf. Der Land- und Forstwirtschaft kommt nach wie vor große Bedeu- tung zu. Ein bedeutender Teil der Bevölkerung ist hinsichtlich sei- ner wirtschaftlichen Existenz an diesen Betriebszweig gebunden. Die landwirtschaftliche Nutzfläche von durchschnittlich 51 ha pro Betrieb mag günstig erscheinen. Zu berücksichtigen ist aber, dass davon mehr als vier Fünftel auf Hutweiden und alpines Grünland (Bergmähder und Almen) entfallen. Osttirol hat sich als Bergland weitgehend auf den Sommer- und Wintertourismus eingestellt. Im Hinblick auf die vorzügliche Eig- nung für die Erholung, den großen Erlebniswert und die bisherige touristische Erschließung kann der Bereich der Hohen Tauern und all der übrigen Gebiete als Erholungsraum von europäischer Bedeutung eingestuft werden.
Zur Namenskunde Osttirols 11 Zur Namenskunde Osttirols Von Anton Draxl Im heutigen Osttirol trafen im Lauf der Geschichte Kelten, Roma- nen, Slawen und Bajuwaren aufeinander und lebten nebeneinander. Eine Fülle von Namen und Bezeichnungen aus den „alten“ Spra- chen sind überliefert – ein ganz rares Kulturerbe! Tief in das Dunkel der Vorzeit der Hohen Tauern reicht z. B. die Verwandtschaft der Namen für die Hauptflüsse in Osttirol und im Pinzgau. Der Name der Isel (urkundlich Isala, 1065) hat einen indoeuropäischen Stamm: i (dh) s bedeutet „kalt“, also „die Kalte“ (daneben zu stellen sind u. a. Isere, Isar oder Isarcus = Eisack). Der von den Römern überlieferte Name für die Salzach lautet Isonta. Die keltischen Stämme der Laianci (im heutigen Osttirol) und der Ambisonti („der um die Isonta Siedelnden“) bezeichneten den Fluss ihrer Heimat als kalt. Bei aller Spekulation in der Erklärung alter Namen eine treffende Bezeichnung für die beiden von den Venedigergletschern gespeisten Flüsse! Auch Kees oder Ferner für „Gletscher“ haben einen uralten Stamm, sie bedeuten eigentlich „vorjähriger Schnee“. Um Christi Geburt verleibte sich Rom das keltische Königreich Noricum ein. Das in der Antike hochgerühmte „Norische Eisen“ war dazu Anlass genug. Diese „alpenromanische“ Zeit hat im geo- grafischen Namensschatz von Osttirol viele Spuren hinterlassen. In den Wirren der Völkerwanderung zogen um 600 Slawen in die südlichen Tauerntäler von Oberkärnten und Osttirol. Eine Fülle von Flurnamen bezeugen diese „Landnahme“ inmitten der romanisier- ten Kelten. So leiten sich die häufigen Bachnamen Zopsen, Zope- nitz oder Zopatnitzen vom slawischen zopotu, „rauschen“, ab. Zwischen Slawen und Bajuwaren kam es im Lienzer Talboden zu verlustreichen Kämpfen. Vorerst behielten die Slawen die Ober- hand und zogen in die Iselgründe. Aber schließlich war der Baiern- herzog Tassilo III. der Stärkere, er gründete im Jahre 769 das Klos- ter Innichen und zwang die Slawen unter seine Herrschaft. Aus dieser Zeit stammt der Name Lenke oder Lenkl. Er leitet sich vom uralten slowenischen Begriff Lenice oder Lenka ab, der den flachen Teil eines Bergpfades, einen Rastplatz an Übergängen zwi- schen zwei Steilstücken oder einen flachen Kessel zwischen Berg- kämmen bedeutet. Am Kamm zwischen Gsies und Villgraten sind in nächster Nähe Übergänge, Namen mit romanischen und slawi-
12 Einleitung schen Wurzeln überliefert: Pürglesgungge, Pürgleslenke und Fisell. Das alpenromanische conca bedeutet „Mulde“, im Lateinischen concha „Muschel“, es ist in Gungge überliefert. Der Ausdruck bedeutet heute aber „runder Berggipfel, Hügel“. In nächster Nähe gibt es das Spitzginggele und das Marchkinkele, den südlichen Grenzberg von Villgraten („March“ = Mark hat eine indoeuropäi- sche Wurzel und bedeutet „Rand, Grenze“). Auch Fisell ist romanischen Ursprungs. Das lateinische sella = Sitz bedeutet im Alpenromanischen nicht nur „Sattel, Sessel“, sondern auch „Bergübergang, Joch“ (z.B. Sella, der Übergang von Gröden nach Fassa). Der urkundlich überlieferte Name für Versell – in Vill- graten und Gsies – lautet Vallesella = Übergangstal, in der Gsieser Mundart „Fosäl“ (älter „Fisäl“) gesprochen. Daneben gibt es noch das Pfanntörl und das Kalksteiner Jöchl. Der uralte Begriff taur bedeutet „Berg“ (z. B. Taurus, das südl. Randgebirge Kleinasiens), abgewandelt im Sinn von „Übergang zwischen zwei Bergen“. Das indoeuropäische iugom, „Joch“, bedeutet „das Verbindende“. – Auf diesem Bergkamm ist also eine ganze Palette „uriger“ sinnver- wandter Wörter überliefert. Naturdenkmäler im Bezirk Lienz 45 Naturdenkmäler zählt der Bezirk Osttirol, vielfach einzelne Baum- exemplare und wertvolle Biotope, die mit Hilfe von Alois Heinricher an den jeweils zutreffenden Stellen im Buch erwähnt werden. Der Nationalpark Hohe Tauern Von Anton Draxl Mit 1. Jän. 1992 wurde der Nationalpark Hohe Tauern auch in Tirol gesetzlich verankert. Dadurch ist die 1971 in Heiligenblut zwischen Kärnten, Salzburg und Tirol abgeschlossene Vereinbarung, den Nationalpark Hohe Tauern zu schaffen, erfüllt. Im Tiroler Bereich der Hohen Tauern haben die Gemeinden St. Jakob, St. Veit und Hopfgarten i. Def., Prägraten, Virgen, Matrei i. O., Kals a. G., Nuß- dorf-Debant, Dölsach und Iselsberg-Stronach Anteil am National- park. Die Fläche beträgt 610 Quadratkilometer, die des gesamten Nationalparkes 1786.
Der Nationalpark Hohe Tauern 13 Die Iselregion mit ihren Haupttälern, dem Kalser, dem Defereg- gen-, dem Virgen- und dem Matreier Tauerntal, bilden den Südwes- ten der Hohen Tauern um Großvenediger und Großglockner. Die Hohen Tauern und mit ihnen die Iselregion enthalten durch den geologischen Aufbau die gesamte Reihe alpiner Gesteinstypen. Dementsprechend vielfältig sind die Landschaftsformen, die Flora und die Fauna, vor allem aber wird das Hochgebirge der Iselregion von der starken Vergletscherung im Alpenhauptkamm geprägt. Die Iselregion ist uralter Kulturraum. Aus der Zeit um 2000 v. Chr. stammt ein in Kals gefundenes Lochbeil aus Serpentin, eine Art Geologenhammer. Dieser Fund – im Kalser Heimatmuseum aufbe- wahrt – könnte auf ein so frühes Begehen des Kalser Tauern hinweisen. Nachweis auf frühen Kupferbergbau mitten in den Hohen Tauern gelang auf dem Klaunzerberg bei Matrei. Die Berg- knappen waren zugleich die ersten Bergbauern in der Iselregion. Der Bergbauer schuf im Lauf der Zeit etwas Neues, die Kulturland- schaft. Das Kernstück dieser Landschaft ist die Alm- und Bergmahd- region. Die blumenbunten Almen und Bergwiesen stehen in reizvol- lem Gegensatz zur Naturlandschaft der Gletscher und Felsen. Im Kulturland veränderte der Mensch die Natur. Die Natur prägte aber auch den Menschen. Baulichkeiten, Arbeitsweisen und Brauchtum spiegeln die Auseinandersetzung mit der Natur wider. Das viele Jahrhunderte alte Wirken des Menschen in der Iselregion lässt sich aus vielen Flurnamen ablesen. Häufig kommen romanische, slawi- sche und deutsche Bezeichnungen nebeneinander vor. Das trifft besonders für Kals zu. Vielerorts in den Alpen gibt es nur mehr Allerweltsgegenden und Siedlungen ohne charakteristische Eigen- art. Die Iselregion konnte im Großen und Ganzen ihr eigenes Profil bewahren. Insgesamt ist hier in der bäuerlichen Bausubstanz viel Schönes und Wertvolles erhalten geblieben, was anderswo schon längst verschwunden ist. Das Erhalten, Pflegen und Gestalten dieser so wertvollen Kulturlandschaft mit all ihren Ausprägungen bedarf der Förderung der Berglandwirtschaft, des naturnahen Tourismus und des Kleingewerbes als Lebensbasis für die Bevölkerung. Die Nationalparkidee, verstanden als Bewahren und Pflegen des Na- tur- und Kulturerbes in den Hohen Tauern, kann einen Beitrag leis- ten. Dazu dienen Zentren, die im „Kesslerstadl“ von der Alpenver- eins-Sektion Matrei und im „Mitterkratzerhof“ von der Ortsstelle der Matreier Sektion betreut werden. Der Sitz der Tiroler National- park-Verwaltung ist im Matreier Gemeindehaus, Rauterplatz 1.
16 Lienz und Umgebung Lienz in Geschichte und Gegenwart Der Lienzer Talboden ist eine alluviale Aufschüttungsebene. Sie entstand in der Eiszeit, als Isel- und Draugletscher im Verein mit dem über den Iselsberg vorstoßenden Möllgletscher die voreiszeit- liche Talsohle weiträumig ausweiteten und aufschütteten. Die Ge- birgsgruppen im Westen, Norden und Osten des Lienzer Talbodens gehören den Zentralalpen an. Hochstein und Böses Weibele sind Ausläufer des Deferegger Gebirges, Zettersfeld und Schleinitz gehören zur Schobergruppe, Stronacher Kogel, Ederplan und der Ziethenkamm werden der Kreuzeckgruppe zugeordnet. Am westlichen Rand des Lienzer Talbodens, wo sich Drau und Isel vereinen, entstand die Stadt Lienz. Der größte Teil des Gemeinde- gebietes liegt in 673 Metern Seehöhe. Die wichtigsten Teile der Stadt sind der Stadtkern mit dem noch mittelalterlich wirkenden Hauptplatz, der Rindermarkt, das 1938 eingemeindete Patriasdorf, die während des 2. Weltkrieges entstandene Südtiroler Siedlung, die nach dem Krieg erbauten neuen Siedlungen Grafenanger, Frie- den-Siedlung, Pfarrsiedlung und schließlich die Peggetz (zum Großteil Industriegebiet). Die Vorläuferin der Stadt Lienz war eine Siedlung im Bereich des heutigen Patriasdorf. Dort stand schon im 5. Jh. an der Stelle der Pfarrkirche St. Andrä eine frühchristliche Kirche. Wann die Rodung im Talboden eingesetzt hat, lässt sich nicht nach- weisen, doch scheint im 11. Jh. das Kultivierungswerk zwischen Isel und Drau stark vorangetrieben worden zu sein. Gegen Ende des 12. Jh. wurde das „Burgum Lienz“ gegründet, und schon im 13. Jh. war es zu eng geworden. Erst im 15. Jh. schritt man wegen der ständi- gen Türkengefahr zum Bau eines erweiterten Mauerringes, der über 1000 Meter lang war und heute noch zum Teil erkennbar ist. Unmittelbare Obrigkeit war der Stadtrichter, den die Bürger ab dem 15. Jh. vorschlagen durften. Er musste für die Durchführung der lan- desfürstlichen Befehle und für die Sicherheit der Stadt sorgen. Nach dem Tod Graf Leonhards, des letzten Görzers, im Jahre 1500 fiel die Herrschaft Lienz an Maximilian I. von Österreich. Da er aber wegen seiner zahlreichen Kriege in Geldnöten war, verpfän-
Lienz in Geschichte und Gegenwart 17 dete er bereits ein Jahr später die Herrschaft Lienz an Michael Frei- herrn von Wolkenstein und Rodenegg. Die Wolkensteiner verlegten ihren Sitz vom Schloss Bruck in die Liebburg, die sie am Haupt- platz errichtet hatten. Durch den furchtbaren Stadtbrand des Jahres 1609 erlitten sie so große materielle Verluste, dass sie die Herr- schaft Lienz an den Landesfürsten zurückgeben mussten, der sie 1653 an das adelige Damenstift in Hall verpfändete. Im Verlauf des 19. Jh. verlor unsere Stadt mehr und mehr ihr mit- telalterliches Aussehen. Durch den Bau der Südbahnstrecke Mar- burg-Villach-Franzensfeste (1871) erlebte Lienz nach langer Zeit wieder einen wirtschaftlichen Aufschwung, den aber der 1. Welt- krieg und seine Folgen abrupt beendeten. Im 2. Weltkrieg litt die Stadt unter Bombenabwürfen. Durch den Bau der Felbertauern- straße (1967) erhielt der Bezirk Lienz eine kurze, wintersichere Verbindung mit Nordtirol. Als Bezirkshauptstadt ist Lienz Sitz zahlreicher Behörden und Äm- ter und ist nach Innsbruck, Kufstein und Hall die viertgrößte Stadt Tirols. Sie beherbergt rund 13.000 Einwohner. Unsere Stadt besitzt auch ein sehr aktives Kultur- und Vereinsleben, unter anderem haben viele alpine Vereine ihren Sitz in Lienz: Österreichischer Bergrettungsdienst und Österreichischer Alpenverein, Sektion Lienz, im Alpenvereinshaus in der Deferegger Straße 11, Touris- tenclub Lienz, Naturfreunde, Alpine Gesellschaft Alpenraute, Berg- wacht, Heeressportverein – Sektion Alpin, Alpinschule Lienz – Osttirol, SC Lienz, Skischule und andere Sommer- oder Winter- sportvereine. Lienz ist auch ein Sport- und Freizeitzentrum mit Dolomitenbad, Dolomitenstadion, Dolomitengolf (36-Loch-Anlage), einer neuen Kunsteisbahn, ausgedehnten Rad- und Wanderwegen, mehreren Tennisplätzen, Tennis- sowie Mehrzweckhallen und nicht zuletzt dem Tristacher See als Naherholungsgebiet am Fuße des Rauchko- fels. Zu den sportlichen Großveranstaltungen zählen der Dolomi- tenlauf, ein Volkslanglauf über 60 km, die Dolomitenradrundfahrt mit einer 110 km langen Straßenschleife um die Lienzer Dolomiten und der Dolomitenmann, ein extremer Mannschaftsbewerb beste- hend aus Berglauf, Paragleiten, Wildwasserpaddeln und Mountain- biking. Modellflugplatz südlich vom Dolomitenstadion. Ein inter- esantes Eisenbahnmuseum befindet sich am Lienzer Bahnhof. Weitere Informationen beim Tourismusverband Lienzer Dolomiten, Tel. 050212/400, oder der Osttirol-Werbung, Tel. 050212/212.
18 Lienz und Umgebung Die bedeutendsten Kulturgüter von Lienz Die Dekanats- und Stadt-Pfarrkirche St. Andrä: 1204 weihte der Bischof von Pola eine romanische Kirche ein. Im 19. Jh. wurde die Kirche mit Ausnahme des Chores regotisiert und erhielt bei der letz- ten Renovierung von 1967/69 ihr heutiges Aussehen. Im Kirchen- schiff befindet sich die Grabstätte der letzten Görzer Grafen. Außer- halb findet man das Bezirkskriegerdenkmal und die Albin-Egger- Kriegergedächtniskapelle. Neben dem städtischen Friedhof wird der Kriegerfriedhof sorgsam gepflegt, so auch der Kosakenfriedhof in der Peggetz, östl. von Lienz. Der Bau einer Kapelle ist dort geplant. Das Dominikanerinnenkloster (Klösterle) ist eine Stätte des Gebe- tes und mit seiner religiösen Ausstrahlung ein fester Bestandteil des kirchlichen und kulturellen Lebens von Lienz. Das Franziskanerkloster (ehemals Karmeliterkloster) ist ein frühes Werk der Görzer Bauhütte. 1785 hob Kaiser Joseph II. das Karmeliterkloster auf und übergab es den Franziskanern. Die Kirche zum hl. Erzengel Michael wurde im 13. Jh. im romani- schen Stil errichtet. Die Spitalskirche wurde wahrscheinlich, wie das Spital selbst, im 13. Jh. errichtet und war dem Heiligen Geist geweiht. Die Kapelle zum hl. Antonius von Padua (Antoniuskirchlein): Der alte Sakralbau wurde nach dem 2. Weltkrieg der kleinen griechisch- orthodoxen Gemeinde zur Verfügung gestellt. Die Kirche zur Hl. Familie in der Südtiroler Siedlung: Portal und Betonglasfenster von Jos Pirkner. Die Herz-Jesu-Kirche in der Peggetz wurde 1950 eingeweiht. Die Martin-Luther-Kirche ist die einzige evangelische Kirche in Osttirol. Der alte Holzbau wurde 1962 durch einen Natursteinbau ersetzt, der von wildem Wein überrankt wird. Schloss Bruck wurde von den Görzer Grafen zu Füßen des nach ihm benannten Schlossberges am Eingang ins Iseltal errichtet und 1277 erstmals urkundlich erwähnt. Zum ältesten Baubestand gehören Turm, Wohntrakt mit Rittersaal und Kapelle. Bis 1500 war die Burg Residenzschloss der Görzer, anschließend der Wolken- steiner. In der nachgörzerischen Zeit erfolgten viele Zu- und Umbauten. 1942 erwarb es die Stadt Lienz und adaptierte darin nach gründlicher Sanierung das Osttiroler Heimatmuseum. Es besitzt zahlreiche Gemälde von Albin Egger-Lienz, Franz von Defregger, Hugo Engl und anderen Osttiroler Malern. Auch seine
Wanderungen Lienzer Talboden/Lienzer Dolomiten 19 große volkskundliche Sammlung und die römische Abteilung mit Ausgrabungsfunden aus Aguntum sowie die Sammlung heimischer Vögel, Fische und Mineralien sind sehenswert. Der Schlossteich mit Linde, Eiche u. a. ist denkmalgeschützt. Liebburg: Da das mittelalterliche Schloss Bruck als Wohnsitz nicht mehr zeitgemäß war, erbauten sich die beiden Brüder Siegmund und Christoph von Wolkenstein-Rodenegg auf dem unteren Stadt- platz die Liebburg, die 1608 fertiggestellt war. Als es 1868 zur Errichtung der Bezirkshauptmannschaft kam, wurde die Liebburg Amtssitz dieser neu geschaffenen Verwaltungsbehörde. 1981 erwarb die Stadt vom Bund den alten Ansitz der Wolkensteiner und baute ihn 1985 bis 1988 zum Rathaus um. Tammerburg: Im Jahre 1992 erwarb die Stadt Lienz die Tammer- burg, einen historisch wertvollen Profanbau. Aguntum siehe 59, Lavanter Wallfahrtskirchen siehe 5. Kosakenfriedhof in der Peggetz, 1 km südöstl. von Lienz. Rosengasse und Messinggasse mit Stadtmarkt. Rieplerschmiede, 16. Jh., wöchentliches Schauschmieden. Iselpark mit Schmetterlingsbrunnen von Leonard Lorenz. Mariensäule am Johannesplatz. Wanderungen im Lienzer Talboden und in den Lienzer Dolomiten 1 Die Lienzer Klause bei Burgfrieden, 813 m 1 Std. von Lienz Von Lienz (Hauptplatz) auf der Pustertaler Straße nach Leisach (3 km). Von dort entweder am Pustertaler Dorfer Weg oder noch 2 km auf der Bundesstraße bis zur Auffahrt nach Burgfrieden. Die „Fes- tung“ Lienzer Klause im Hintertal vermochte das hier enge Puster- tal abzusperren. Eine ernste Bewährungsprobe bestand die Klause im 14. Jh. und 1809 konnte die Wehranlage den Franzosensturm erfolgreich aufhalten. Neu ist ein Themenweg (Schautafeln) bis zum renovierten, spätaltertümlichen Pulverturm oberhalb der barocken Bastionsanlage. Sehenswert ist die 1893 erbaute und 1985/87 restaurierte Lourdeskapelle, Osttirols älteste dieser Art.
20 Lienz und Umgebung 2 Naturlehrpfad (Waldlehrpfad) Von Lienz über Leisach bis zum Tristacher See oder nach Tristach; 4 Wegabschnitte, gesamt 31/2 Std. Die waldreiche Landschaft um Lienz und die interessante Geologie machen den vorher als Wald- lehrpfad bekannten Ausflug zu einem besonderen Erlebnis. Schauta- feln und Legenden weisen auf Besonderheiten hin. Die abwechslungsreiche Route beginnt mit dem Abschnitt 1 „Eich- hörnchen“, 1/2–3/4 Std., bei der Fachberufsschule und führt am Poeten- steig, der Isel entlang, zur Schlossbrücke. Etwa 100 Schritte stadtein- wärts, dann rechts zum Schlosshügel hinauf und am Burggemäuer vorbei. Dort setzt an der asphaltierten Schlossbergauffahrt der Abschnitt 2 „Spatz“, 11/2–2 Std., fort. Nach ca. 5 Min. nach links zur Skipiste und zur Pension Gribelehof (Kapelle zur hl. Katharina). Unterhalb des ehemaligen Schießstandes vorbei in den Bereich der Villa „Sonnenhof“. Wo sich in älterer Zeit Kurgäste beim „Bad Leo- poldsruhe“ Erholung versprachen, sind zehn große Schautafeln zu einem „Freiland-Klassenzimmer“ angeordnet. Bald darauf senkt sich der Weg in das Dorf Leisach und strebt nörd- lich des Gaßlerhofes über Fluren zur Bahn und Draubrücke. Wenig später erreichen wir von Wald umrauscht die Dolomiten-Waldschen- ke und das Goggkreuz. Hier wechseln wir in den Abschnitt 3 „Häschen“, 3/4 Std., der am Fuße des Rauchkofels in östl. Richtung zur Kapelle am Ulrichsbichl führt, wo sich der Naturlehrpfad in zwei Äste teilt. Abschnitt 4 – „Bambi“, 3/4–1 Std. a) In 2 Min. zur St.-Ulrichs- Kapelle, die leicht erhöht zwischen den Gemeindezentren von Amlach und Tristach steht. Auf der Südseite der Kapelle erklärt eine Infotafel den weiterführenden Wegteil nach Tristach, 1/4 Std. b) Bei der 2. Kehre der erwähnten Amlacher Seeauffahrt (E-Freilei- tungsmasten) führt diese Variante durch Föhren- und Mischwald den Rauchkofel ein Stück hinauf. Tafeln machen auf die Geologie des Berges aufmerksam. Wir queren eine Geröllrinne mit Talsperren vor der Scheitelstelle des Lehrpfades (Bank) und erreichen mit etwas Gefälle den Sakramentstein, dann das Naturdenkmal Alter See. Nahezu eben in 5 Min. zum Parkhotel, wo der Waldlehrpfad endet.
Sie können auch lesen