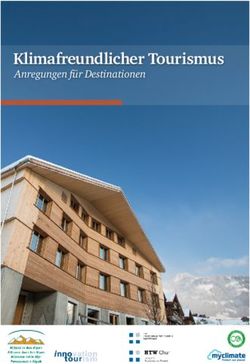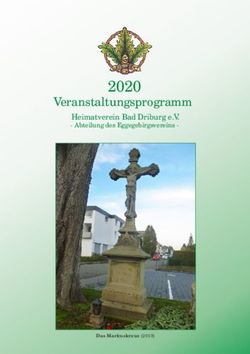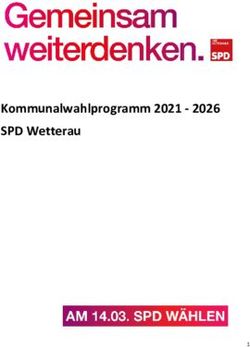Sachstandsbericht zum Handlungsprogramms Klimaschutz 2020 in Dortmund - Abgeschlossene oder in der Umsetzung befindliche Maßnahmen Stand Mai 2013
←
→
Transkription von Seiteninhalten
Wenn Ihr Browser die Seite nicht korrekt rendert, bitte, lesen Sie den Inhalt der Seite unten
Sachstandsbericht zum Handlungsprogramms
Klimaschutz 2020 in Dortmund
Abgeschlossene oder in der Umsetzung befindliche Maßnahmen
Stand Mai 2013INHALT
1 Handlungsfeld Kommunale Gebäude- und Stadtentwicklung ......................................... 5
1.1 Energetische Sanierung nach Passivhausstandard................................................................... 5
1.2 Klimafreundliches Beschaffungswesen................................................................................... 5
1.3 Green IT .................................................................................................................................. 6
1.4 Energieeffizienz in der Straßenbeleuchtung............................................................................ 6
1.5 Energieversorgung städtischer Objekte................................................................................... 7
1.6 Zoo Dortmund ......................................................................................................................... 7
2 Handlungsfeld Energieeffizienz im Gebäudebestand ........................................................ 7
2.1 Initial- und Förderberatung Gebäudeenergieeffizienz............................................................. 7
2.2 100EnergiePlusHäuser für Dortmund ..................................................................................... 8
2.3 Nachtspeicheraustausch........................................................................................................... 8
2.4 Innovation BusinessPark (beinhaltet außerdem die folgenden Maßnahmen des HP 2020:
Energiecontrolling für KMU, Firmen-zu-Firmen-Beratung, Energie-Coaching für KMU,
Potentiale der KWK und Betriebliches Mobilitätsmanagement) ............................................ 9
2.5 Energieeffizienzquartier Unionviertel ................................................................................... 10
2.6 Energiesparservice................................................................................................................. 10
2.7 Fortführung ÖKOPROFIT .................................................................................................... 11
3 Handlungsfeld Erneuerbare Energien und Energieversorgung..................................... 12
3.1 Ausbau Photovoltaik ............................................................................................................. 12
3.2 Windkraft Repowering und Ausbau...................................................................................... 12
3.3 Holzhackschnitzel und Holzpellets ....................................................................................... 12
3.4 KuLaRuhr.............................................................................................................................. 13
3.5 Nutzung Abwasserwärme...................................................................................................... 13
3.6 Aquaponic ............................................................................................................................. 13
3.7 Ausbau der oberflächennahen Geothermie ........................................................................... 14
4 Handlungsfeld Strukturübergreifende Maßnahmen....................................................... 14
4.1 Koordinierungsstelle Klimaschutz im FB 60 ........................................................................ 14
4.2 Verwaltungsinterner Konsultationskreis Energieeffizienz und Klimaschutz (InKEK) ........ 14
4.3 Kampagne Klima für Klimaschutz........................................................................................ 15
4.4 Strommessgeräte in der Stadt- und Landesbibliothek Dortmund.......................................... 15
4.5 Kampagne zur energetischen Gebäudesanierung .................................................................. 15
4.6 Dortmunder Dachmarke ........................................................................................................ 16
4.7 Selbstverpflichtung für Klimaschutz in Dortmund ............................................................... 16
5 Handlungsfeld Mobilität mit dem Maßnahmebündel Radverkehr und Radfahrklima
schaffen................................................................................................................................. 17
5.1 Fahrrad Sternfahrt Dortmund 2013 ....................................................................................... 17
5.2 Bambus-Fahrräder ................................................................................................................. 17
5.3 e-Cargo-Bikes........................................................................................................................ 17
5.4 Fahrradparken weiter ausbauen............................................................................................. 18
5.5 Radstation Dortmunder HBF................................................................................................. 18
5.6 Bessere Querbarkeit der City mit dem Fahrrad ..................................................................... 18
5.7 Fahrradschnellweg als Pilotprojekt ....................................................................................... 18
5.8 Barrierefreier Ausbau der Haltestellen .................................................................................. 19
5.9 E-Mobilität ............................................................................................................................ 19
5.10 Forcierung spritsparender Fahrweise .................................................................................... 21
5.11 Verwaltungsinternes Mobilitätsmanagement ........................................................................ 21
5.12 Schulisches Mobilitätsmanagement ...................................................................................... 22
6 Klimaschutz in Dortmund 2012 – eine Bilderstrecke ...................................................... 23
-2-Glossar
ASP Artenschutzprüfung
ALG II Arbeitslosengeld II
BGS Bruttogeschossfläche
BMU Bundesministerium für Umwelt, Naturschutz und Reaktorsicherheit
BHKW Blockheizkraftwerk
CO2 Kohlenstoffdioxid
dlze Dienstleistungszentrum Energieeffizienz und Klimaschutz
EE/EV Handlungsfeld „Erneuerbare Energien und Energieversorgung“
EffGeb Handlungsfeld „Energieeffizienz im Gebäudebestand“
EMS Energiemanagementsystem
EnergieStG Energiesteuergesetz
EnEV Energieeinsparverordnung
EEG Erneuerbare Energiengesetz
FB Fachbereich
FH Fachhochschule
GHD Gewerbe, Handel, Dienstleistungen
green IT die Nutzung von Informations- und Kommunikationstechnologie (IT) über deren gesamten
Lebenszyklus hinweg umwelt- und ressourcenschonend zu gestalten
GWh Gigawattstunden
Hi Heizwert
HWK Handwerkskammer
HP 2020 Handlungsprogramm Klimaschutz 2020 in Dortmund
IHK Industrie- und Handelskammer
KfW Kreditanstalt für Wiederaufbau
KMU kleine und mittlere Unternehmen
KomStadt Handlungsfeld „Kommunale Gebäude und Stadtentwicklung“
KuLaRuhr Nachhaltige urbane Kulturlandschaft in der Metropole Ruhr
kWel Kilowatt elektrisch
kWh Kilowattstunde
KWK Kraft-Wärme-Kopplung
-3-KWKG Kraft-Wärme-Kopplungs-Gesetz
LED Light Emitting Diode
Lignifizierung Die Einlagerung von Zellulose und Lignin, die sich in den Wänden der Zellen bildet und bei
Pflanzen zu einer Verholzung oder zumindest zu einer Verfestigung führt.
MFH Mehrfamilienhaus
MIV Motorisierter Individualverkehr
Mob Handlungsfeld „Mobilität“
MW Megawatt
MWh Megawattstunde
MWpeak eine im Bereich Photovoltaik gebräuchliche, nicht normgerechte Bezeichnung für die elektrische
Leistung von Solarzellen
Passivhaus Die Häuser werden „passiv“ genannt, weil der überwiegende Teil des Wärmebedarfs aus
„passiven“ Quellen gedeckt wird, wie Sonneneinstrahlung und Abwärme von Personen und
technischen Geräten
Primärenergie Als Primärenergie bezeichnet man in der Energiewirtschaft die Energie, die mit den natürlich
vorkommenden Energieformen oder Energiequellen zur Verfügung steht, etwa als Kohle, Gas,
Sonne oder Wind.
PV Photovoltaik
QM Qualitätsmanagement
StromStG Stromsteuergesetz
t Tonne (Gewichtseinheit; 1000 kg = 1t)
UMS Umweltmanagementsystem
ÜM Handlungsfeld „Strukturübergreifende Maßnahmen“
U-Wert Wärmedurchgangskoeffizient/Wärmedämmwert
VZ Verbraucherzentrale
WE Wohneinheit (eine nach außen abgeschlossene Unterkunft, in welcher ein Haushalt geführt
werden kann)
THG Treibhausgas-Emissionen (in den meisten Fällen als CO2- oder CO2eq-Emissionen angegeben)
-4-1 Handlungsfeld Kommunale Gebäude- und Stadtentwicklung
1.1 Energetische Sanierung nach Passivhausstandard
Die baulichen Maßnahmen der städtischen Immobilienwirtschaft laufen nach einer klar gegliederten
Ablauforganisation ab. Dabei werden die Bewertungskriterien für nachhaltiges Bauen berücksichtigt.
Neben einer ökonomischen Betrachtung mittels Wirtschaftlichkeitsberechnung, finden auch die
ökologischen und soziokulturellen Auswirkungen Berücksichtigung. So wird besonders auf die
Einsparung von Energie, bzw. dem geringsten Einsatz von Energie für die Nutzung der Immobilien
Wert gelegt und das Einsparungspotential des CO2-Ausstoßes ausgewiesen.
Die ganzheitliche Betrachtung von Immobilien wird durch eine Berechnung der Lebenszykluskosten
sichergestellt. Das integrale Planungsteam untersucht z. B. bei Neubauvorhaben unterschiedliche
Wärmeenergieversorgungen in Abhängigkeit der Dämmeigenschaft der Gebäudehülle und identifiziert
so die optimale Ausführungsart.
Aktuell konnte für das Erweiterungsbauwerk an der Grundschule Kirchhörde ein Passivhaus-Gebäude,
durch das ausgezeichnete Zusammenspiel der einzelnen Fachgebiete, entwickelt werden. Das erste
öffentliche Gebäude in Passivhaustechnik auf Dortmunder Stadtgebiet wird durch den geringen
Energieverbrauch nicht nur zu Kosteneinsparung und geringem CO2-Ausstoß beitragen, sondern den
Schülern durch die integrierte Lüftung auch ein gesundes Raumklima und somit bessere
Lernbedingungen bieten.
Projektträger: FB 65
1.2 Klimafreundliches Beschaffungswesen
Das Vergabe- und Beschaffungszentrum führt als zentraler Einkaufs-Dienstleister Vergaben für
Waren, Dienstleistungen und Bauleistungen für die Stadt Dortmund durch.
Durch diese Zentralisierung der Vergaben und die Übernahme der Prozessverantwortung kann
gewährleistet werden, dass Zielsetzungen auch hinsichtlich „nachhaltiger“ Aspekte innerhalb der
Vergabeverfahren besser berücksichtigt werden können.
Die Stadt Dortmund ist sich ihrer gesellschaftlichen Verantwortung bewusst und setzt sich im Rahmen
der Lokalen Agenda 21 für eine nachhaltige Entwicklung ein. Dies setzt im Zusammenhang mit
öffentlichen Beschaffungen voraus, dass nicht nur rein ökonomische Kriterien betrachtet, sondern
auch die gesellschaftlichen Auswirkungen berücksichtigt werden müssen. Die von der Stadt Dortmund
verfolgte Zielsetzung liegt in einer ausgewogenen Berücksichtigung von ökonomischen, sozialen,
ökologischen und innovativen Aspekten innerhalb der Vergabeverfahren. Diese Aspekte können z. B.
bei der Definition des Leistungsgegenstands, bei der Ausgestaltung des Vertragswerks (zusätzliche
Bedingungen für die Ausführung des Auftrags) oder bei der Festlegung der Zuschlagskriterien in das
Verfahren einfließen.
Beispielsweise werden bei IT-Beschaffungen Umwelt-Aspekte gleichermaßen neben
Wirtschaftlichkeits- und Sicherheitsaspekten berücksichtigt. Energie- und Umweltsiegel werden
regelmäßig gefordert. Die erwarteten Energieverbrauchskosten im Lebenszyklus der Komponenten
werden im Rahmen der Angebotswertung unmittelbar berücksichtigt, sodass auch teurere
Komponenten mit geringem Energieverbrauch die wirtschaftlichere Variante darstellen können.
Es wird weiterhin darauf geachtet, dass nach dem Nutzungsende von IT-Komponenten eine
umweltschonende bzw. umweltverträgliche Entsorgung bzw. ein Recycling möglich ist.
Im Rahmen des Projektes „Green IT“, welches federführend durch dosys bearbeitet wird, sollen noch
weitere Möglichkeiten zur klimafreundlichen Beschaffung ermittelt werden.
Projektträger: FB 19
-5-1.3 Green IT
Das Projekt Green IT in der Stadtverwaltung Dortmund hat deutschlandweit Pilotcharakter. Außer
Dortmund hat bisher keine andere Stadt einen Förderantrag innerhalb der nationalen
Klimaschutzinitiative beim BMU zur finanziellen Unterstützung von Green IT gestellt. Bisher wurde
durch den FB 10 eingehende Untersuchungen der IT-Infrastruktur mit Unterstützung durch die Fa.
erecon in Form von Workshops vorgenommen. Die Ergebnisse der Untersuchungen hinsichtlich
finanzieller und klimarelevanter Einsparungen übertrafen die Annahmen aus dem Handlungs-
programm Klimaschutz von 1.951 t CO2-Einsparung pro Jahr um ein Vielfaches. In den Workshops
wurden die Bereiche primäres Rechenzentrum und PC-Systeme der Büroumgebung untersucht.
Weitere Untersuchungsgegenstände sind die Bereiche Ausfall-Rechenzentrum und die dezentralen
Technikräume der Verwaltung. Für die notwendige Evaluation der über 300 dezentralen IT-Standorte
der Stadtverwaltung wird durch das Umweltamt Personal bereitgestellt. Derzeit werden zwei
wesentliche Veränderungen der IT-Infrastruktur vorgenommen in denen empfohlene Maßnahmen von
Green-IT berücksichtigt werden. Die erste Maßnahme ist der Umzug des zentralen Rechenzentrums,
die zweite das verwaltungsweite Roll-out des Betriebssystem Windows 7 und eine damit verbundenen
Anpassung der PC-Systeme.
Projektträger: FB 10, 60, 65, 23
1.4 Energieeffizienz in der Straßenbeleuchtung
Im Rahmen der Klimaschutzinitiative fördert das BMU seit 2011 auch Klimaschutztechnologien bei
der Stromnutzung. Damit wird insbesondere der Einbau hocheffizienter LED-Beleuchtungstechnik bei
der Sanierung der Straßenbeleuchtung mit einem CO2-Minderungspotenzial von mindestens 60 %
angesprochen.
In 2012 wurden 204 Leuchten – vornehmlich in Einkaufsstraßen und auf Plätzen – auf LED-Technik
umgestellt. Außerdem wurde, wo immer die Randbedingungen es zuließen, eine Leistungsreduzierung
eingebaut. Das bedeutet, dass hier der ohnehin geringe Stromverbrauch während der besonders
verkehrsschwachen Nachstunden noch zusätzlich gedrosselt wird. Der Stromverbrauch sank so um rd.
77.000 kWh pro Jahr, entsprechend 73 %.
Bis zum 30.04.2013 wurden auch die Umrüstungsmaßnahmen aus der Fördermaßnahme 2012
durchgeführt. In der Überdachung vor dem Hauptbahnhof wurden 49 Tiefstrahler erneuert. Weitere 24
Straßenleuchten mit veralteter Lichttechnik in verschiedenen Stadtbezirken wurden auf LED-Technik
umgestellt. Die Energieeinsparung beträgt rd. 80 %, die CO2-Reduzierung liegt bei fast 11 Tonnen pro
Jahr.
Ein weiterer Projektantrag wurde in diesem Jahr eingereicht. Er umfasst die Umrüstung von 237
Ringleuchten „Modell Dortmund“ und von 1500 Peitschenmastleuchten in Anliegerstraßen auf LED.
Die angestrebte Einsparung an Energie liegt bei über 200.000 kWh pro Jahr, die des CO2-Ausstoßes
bei über 125 Tonnen pro Jahr
Über diese Fördermaßnahmen hinaus werden natürlich bei Erweiterungen und Erneuerungen im
Beleuchtungsnetz alle Möglichkeiten ausgeschöpft, effiziente Lichtlösungen zu realisieren.
Projektträger: FB 66
-6-1.5 Energieversorgung städtischer Objekte
Betriebshof Westerholz
Die Stadt Dortmund hat eine Vorbildfunktion bei der energetischen Sanierung ihrer Immobilien. Da
eine Sanierung des Forstbetriebshofs Westerholz längst überfällig ist, wurde dieser als geeignetes
Objekt ausgewählt, um durch den FB 60 einen Förderzuschuss aus der nationalen
Klimaschutzinitiative des BMU zu beantragen. Das Wirtschaftsgebäude, Baujahr 1958, verfügt derzeit
über keine Wärmedämmung und wird durch dezentrale Gasradiatoren beheizt. Neben dem sehr hohen
anlagenbedingten Verbrauch an Erdgas, tragen auch besondere Anforderungen an das Nutzerverhalten
und fehlende Nachtabsenkung zur Ineffizienz der Wärmeversorgung bei. Derzeit liegen die jährlichen
Wärmeenergiebedarfe bei rd. 150.000 kWh/a. Dies ergibt einen spezifischen Wärmebedarf von 682
kWh/(m2 * a) bei einer Bruttogeschossfläche (BGF) von 220 m2. Mit der Sanierungsmaßnahme
können vor Ort 93% der jährlichen CO2-Emissionen vermieden werden. Das Gebäude liegt innerhalb
eines Naherholungsbereiches (Fredenbaumpark) und verfügt über öffentliche Toiletten. Damit wird
das Gebäude im öffentlichen Raum besonders wahr genommen.
Projektträger: FB 65, 23 und 60
1.6 Zoo Dortmund
Im Zeitraum Oktober 2011 bis August 2012 wurde durch ein Konsortium aus der Fa. B.A.U.M.
Consult und dem Ökozentrum Hamm, ein Energiegutachten für den Dortmunder Zoo angefertigt. Das
Gutachten beinhaltete im Wesentlichen die Bewertung von drei Referenzgebäuden, den möglichen
Einsatz Erneuerbarer Energien zur Versorgung des Zoos und mögliche organisatorische Maßnahmen
zur Senkung des Energiebedarfes und zur Steigerung der Energieeffizienz. Ziel des Projektes ist die
Klimaneutralität des Dortmunder Zoos bis zum Jahr 2030.
Das Gutachten beinhaltet Maßnahmen, die gerade im Bereich der Gebäudesanierung und dem Einsatz
Erneuerbarer Energien Schnittstellen zum Handlungsprogramm Klimaschutz 2020 aufweisen. Zur
Beurteilung des Einsatzes Erneuerbarer Energien wurde der Klimaschutzmanager des FB 60 bereits
frühzeitig eingebunden. Der Schwerpunkt liegt hier in der energetischen Verwertung von Stallmist
und Grünschnitt von städtischen Flächen. Durch die energetische Nutzung stadteigener Biomassen
könnte der Zoo bilanziell vollständig mit Wärme versorgt und damit annähernd klimaneutral gestellt
werden. Daneben könnten durch die energetische Aufbereitung Entsorgungskosten von jährlich rd.
80.000 Euro eingespart und wichtige Nährstoffe im Kreislauf gehalten werden, was dem Einsatz von
künstlichem Wirtschaftsdünger vorbeugt.
Die Möglichkeit des wirtschaftlichen Einsatzes einer dafür notwendigen Biogasanlage im Dortmunder
Zoo wird derzeit untersucht. Dazu ist eine Messreihe zur Analyse anfallender Biomassen hinsichtlich
Gasertrag und Belastung von Gärresten eingeleitet worden, die ein Jahr in Anspruch nehmen wird
In Vorschau auf den Förderzeitraum 2014 mit der Förderung von Klimaschutzteilkonzepten für eigene
Liegenschaften, erscheint der Zoo Dortmund als besonders gut geeignet. Damit könnte das Ziel
„Klimaneutraler Zoo 2030“ verstetigt werden. Für die anschließende Umsetzung dieses
Klimaschutzteilkonzeptes kann beim BMU eine fachlich-inhaltliche Unterstützung
(Klimaschutzmanager) für einen Zeitraum von vier Jahren beantragt und gefördert werden.
Projektträger: FB52, 60 und 65
2 Handlungsfeld Energieeffizienz im Gebäudebestand
2.1 Initial- und Förderberatung Gebäudeenergieeffizienz
Viele Gebäudeeigentümer fühlen sich angesichts der Herausforderungen bei der Umsetzung von
Sanierungsprojekten überfordert. Eine Initialberatung zu den Möglichkeiten gekoppelt mit einer
konkreten Empfehlung zum weiteren Vorgehen erhöht die Umsetzungsrate der Sanierungs-
-7-maßnahmen. Das mit der Koordinierungsstelle Klimaschutz verbundene dlze (siehe Begründung zu
2.) bietet hier die umschließende Klammer und ist erste Anlaufstelle zur Beratung.
Projektträger: FB 60
2.2 100EnergiePlusHäuser für Dortmund
Im Rahmen der Kampagne 100 EnergiePlusHäuser für Dortmund, sollen von 2011 bis 2016, 100
Wohneinheiten realisiert werden. Die Stadt Dortmund reserviert speziell für EnergiePlusHäuser 75
geeignete Grundstücke und bietet ein umfassendes Qualitätsmanagement und Beratungsangebot an.
Die gute Dämmung und Komfortlüftung eines Passivhauses in Kombination mit Photovoltaik auf dem
Dach führt zu einem Energieüberschuss bzw. einem „PLUS“ von 1.000 kWh pro Jahr und Haus.
Die Kampagne „100 EnergiePlusHäuser für Dortmund“ ist die konsequente Fortführung der
bisherigen Beschlüsse des Rates, um die Energieeffizienz im Neubau zu verbessern:
2006: Solarenergetische Optimierung städtebaulicher Entwürfe
2007: Energiekonzepte für Neubaugebiete
2008: KfW 60 Standard im Wohnungsneubau
2010: erhöhte Energieeffizienz auch für Nichtwohngebäude
2011: Kampagne „100 EnergiePlusHäuser für Dortmund“
Bisher konnten 7 Doppelhaushälften als EnergiePlusHäuser realisiert werden. Weitere sind im Bau
und viele andere Projekte in der konkreten Planung, wie z. B.:
- 7 Familienhaus Prinz-Friedrich-Karl-Straße: Baubeginn Mitte 2013
- EnergiePlusKindertagesstätte Weingartenstraße: Baubeginn 2013
- EnergiePlusSiedlung am PHOENIX See mit 15 EFH
- EnergiePlusSiedlung Bergparte mit 55 Wohneinheiten: Bebauungsplan bis Herbst 2013
Selbst wenn nicht alle Projekte umgesetzt werden, können die 100 EnergiePlusHäuser bis 2016 fertig
gestellt sein und damit jährlich 100 t CO2 einsparen. Derzeit wird mit der Auslobung eines
Architekturwettbewerbes für EnergiePlusHäuser eine konkrete Maßnahme des Handlungsprogramms
umgesetzt. Die Preisverleihung und Ausstellungseröffnung wird im Juli 2013 erfolgen.
Projektträger: FB 61
2.3 Nachtspeicheraustausch
In Dortmund sind noch über 17.000 WE mit Nachtspeicherheizungen ausgestattet.
Vorteile der Nachtspeicheröfen sind geringe Anschaffungs-, Investitions- und Wartungskosten.
Nachteile dieser Heizungen sind die unkomfortablen Regelmöglichkeiten.
Aus Klimaschutzsicht ist aber die Stromheizung die ökologisch problematischste. Der für die
Speicherheizung benötigte Strom wird zurzeit überwiegend in Kraftwerken erzeugt, deren
Wirkungsgrad erheblich unter dem der Einzelheizungen mit fossilen Brennstoffen liegt. Beim Heizen
mit Strom wird aufgrund des etwa doppelt so hohen Primärenergieeinsatzes auch ca. doppelt soviel
CO2 emittiert als bei einer Öl- oder Gasheizung. Aufgrund dieses hohen Primärenergieverbrauches
und der daraus resultierenden CO2 – Belastung ist von der Bundesregierung mit der ENEV 2009 bei
Gebäuden ab 6 Wohneinheiten, die Außerbetriebnahme von Nachtspeicheröfen, die Anfang 2020
mehr als 30 Jahre in Betrieb sind, vorgeschrieben worden. Bei fehlender Wirtschaftlichkeit besteht
kein Umsetzungszwang. Ob diese gesetzliche Verpflichtung aber zum Tragen kommt, ist im
Augenblick fraglich. Die Bundesregierung plant eine Überarbeitung zur Aufhebung dieser
Verpflichtung nicht zuletzt aufgrund der laufenden Debatte, ob Nachtspeicherheizungen als
Energiespeicher für die Energiewende in Frage kommen.
-8-Kampagne „Effizienzsteigerung Nachtspeicherheizungen im Energieeffizienzquartier
Unionviertel“
In einem mit Nachtspeicherheizungen ausgestatteten Gebäude mit 15 WE im Unionviertel soll
exemplarisch untersucht werden, welche Energieeffizienzsteigerung und Heizkosteneinsparung durch
eine qualifizierte Wartung und Beratung zum Betrieb der Speicheröfen erzielt werden kann. Die
Kosten für das zzt. vorgesehene Gebäude belaufen sich auf ca. 2000 - 3000,- €. Diese Kosten werden
aus dem Projektansatz Energieeffizienzquartier übernommen. Im Gegenzug wird von dem Eigentümer
eine Aussage zu den Auswirkungen auf Energiebedarf und Heizkosten eingefordert. Sollte die
Energie- und Kostenbilanz positiv ausfallen, werden die Ergebnisse dieses Pilotvorhabens in
geeigneter Form auf das gesamte Stadtumbaugebiet bzw. das Stadtgebiet Dortmund übertragen
werden.
Projektträger: FB 60
2.4 Innovation BusinessPark (beinhaltet außerdem die folgenden Maßnahmen des HP 2020:
Energiecontrolling für KMU, Firmen-zu-Firmen-Beratung, Energie-Coaching für KMU,
Potentiale der KWK und Betriebliches Mobilitätsmanagement)
Für die Aufstellung eines integrierten Klimaschutzteilkonzeptes im Modellgewerbegebiet Dortmund-
Dorstfeld-West wurde durch FB 60 ein Förderantrag aus der nationalen Klimaschutzinitiative des
BMU gestellt. Mit diesem Konzept für das Modellgewerbegebiet Dorstfeld-West sollen
Handlungsoptionen und konkrete Maßnahmen aufgezeigt werden, mit denen die gesamtstädtischen
Klimaschutzziele für den Sektor GHD und Industrie erreicht werden können. Die Entwicklung der
sektoralen Treibhausgas Emissionen (THG) zeigt, dass die Klimaschutzziele durch selbstorganisierte
Aktivitäten der Unternehmen nicht erreicht werden. Daher wird einer gemeinsamen Erarbeitung und
späterer gemeinsamen Umsetzung des Konzeptes mit den Unternehmen aus diesem Gebiet besondere
Bedeutung beigemessen. Ein Kooperationsnetzwerk mit Akteuren aus dem Gewerbegebiet,
kommunalen Vertretern, Kammern und Gutachtern sowie ein Gewerbeparkmanagement zur
Verstetigung sollen aufgebaut werden. Die Effekte, die mit der Umsetzung des Konzeptes erreicht
werden sollen liegen
- im Bereich der Energieeffizienz und Energieeinsparung,
- im lokalen Lastmanagement für Stromanwendungen,
- in der Verbesserung der Wärmeinfrastruktur,
- in nachhaltiger Mobilität,
- im Städtebau und der Freiraumentwicklung (auch Klimafolgenanpassung),
- im Grünflächenmanagement,
- sowie in Information und Image.
Der Fokus liegt dabei bei auf innovativen und wirtschaftlichen Lösungsansätzen.
Die Projektierung ist wie folgt vorgesehen:
- Aufbau eines Kooperationsnetzwerkes aus ansässigen Unternehmen, kommunalen Vertretern,
Kammern sowie externen Gutachtern und Moderatoren zur Erarbeitung des Konzeptes
- Gemeinsame Bestandsanalyse des Gebietes
- Gemeinsame Aufstellung von Bilanzen für Energie- und Stoffströme
- Aufbau eines Gewerbeparkmanagement, idealerweise als Public Privat Partnership
- Potenzialerhebung auf Basis der Bilanz und Bestandsanalyse
- Ableitung von Handlungsoptionen und Maßnahmen zur Erreichung von gesamtstädtischen
Klimaschutzzielen
-9-- Aufbau eines gebietsbezogenen Monitorings und Controllings zur Feststellung der Wirksamkeit von
Maßnahmen und Akteursmotivation
- Flankierende Öffentlichkeitsarbeit zur Darstellung der Arbeitsergebnisse, zur Motivation und
Animation aller Beschäftigten und für den Imagegewinn
- Sofortige Umsetzung einer ausgewählten Klimaschutzmaßnahme z. B. Fahrertrainings zur
spritsparenden Fahrweise
Projektträger: FB 60 und 8/WF in Kooperation mit IHK
2.5 Energieeffizienzquartier Unionviertel
Das Stadtquartier rund um die Rheinische Straße soll zum Vorzeigequartier für Energieeffizienz in
Dortmund werden. Die Einwohner und Gewerbetreibenden im Quartier sollen auf unterschiedlichen
Ebenen für das Thema Energie sensibilisiert und zum Energie sparen motiviert werden.
Das Projekt „Energetische Modernisierung im Quartier“ richtet sich an Immobilienbesitzer/-innen im
Unionviertel. Seit Juli 2010 beraten dort 2 qualifizierte Energieberaterinnen zur Gebäudesanierung.
Der Auftrag endet im Juni 2013. Neben konkreter Einzelberatung gehören öffentlichkeitswirksame
Maßnahmen wie Fachvorträge, Erstellen von Infomaterialien und Durchführung von Kampagnen zum
Aufgabenprofil. Im Projektzeitraum konnten die Gebäudeeigentümer/-innen für das Thema
energetische Gebäudemodernisierung sensibilisiert werden, es wurden zahlreiche Beratungen
durchgeführt und erste Sanierungen umgesetzt.
Zurzeit wird ein Beratungsnetzwerk für die Immobilienbesitzer/-innen im Stadtumbaugebiet
entwickelt. Um keinen Bruch in der Beratung entstehen zu lassen und damit einhergehend der Gefahr
vorzubeugen, den bereits erzielten Mobilisierungseffekt zu verlieren, soll eine Energieberatung bis
Mitte 2014 weiter bereitgestellt werden.
Im Dezember 2011 ging mit dem Projekt „ Mit Energie sparen“ ein weiterer wichtiger Baustein des
Energieeffizienzquartiers an den Start. Das Projekt möchte alle Bürger/-innen im Unionviertel zum
sparsamen Umgang mit Energie motivieren. Die Aufmerksamkeit soll auf den eigenen, individuellen
Umgang mit Energie gelenkt werden, um darauf aufbauend, nachhaltige Verhaltensänderungen
herbeizuführen. Im Jahr 2012 lag der Fokus auf der Entwicklung und Bereitstellung von Werbe- und
Infomaterialien (u. a. Internetauftritt, Logo, Presse, Aktionslokal, Flyer), um das Projekt im
Stadtumbaugebiet bekannt zu machen. In 2013 werden vor allem zielgruppenspezifische Kampagnen
durchgeführt, um konkrete Energieeinspareffekte zu erzielen und Multiplikatoren für das Projekt zu
gewinnen.
Es wird erwartet bis Ende 2013 eine Reihe von „Mitmachern“ gewonnen zu haben. Mit diesen
Repräsentanten im Rücken soll „der bewusste Umgang mit Energie“ im Jahr 2014 breiter in das
Stadtumbaugebiet hinein getragen werden. Dabei wird besonderes Augenmerk auf der Unterstützung
und Vernetzung der bereits gewonnen Multiplikatoren im Quartier liegen.
Als dritter Baustein soll ein Beratungsangebot für Kleingewerbetreibende im Unionviertel angeboten
werden. Es soll neben baulichen Maßnahmen auch die energetische Optimierung von Betriebsabläufen
unterstützen. Dieser Baustein wird sich an die im Unionviertel vorhandene Gewerbestruktur anpassen
und gemeinsam mit dort ansässigen Akteuren entwickelt. Es ist eine Projektlaufzeit bis Ende 2014
vorgesehen.
Projektträger: FB 60 und 61
2.6 Energiesparservice
Die Energiearmut nimmt zu, genauso wie die Zahl der Stromabsperrungen bei nicht bezahlten
Rechnungen. Hier setzt der Energiesparservice der Caritas ein. Bürger/-innen der Stadt, die ALG II
- 10 -beziehen, werden kostenlos beraten, wie sie den Energieverbrauch in ihren Wohnungen senken
können. Dieses Projekt ist bisher äußerst erfolgreich in Dortmund, knapp 8000 Haushalte wurden bis
heute besucht. Neben dem besonderen Engagement der Caritas ist dies wohl auch dem Konzept der
„freiwilligen Beratung auf Augenhöhe“ zu verdanken. Allerdings ist die gemeinsame weitere
Finanzierung des Projekts durch die Stadt Dortmund und Caritas zzt. unterbrochen (s. dazu VV-
Vorlage: DS-Nr.: 09485-13).
Projektträger: FB 60, 50
2.7 Fortführung ÖKOPROFIT
In den Jahren 2011/2012 haben erneut 14 Dortmunder Unternehmen das Beratungsprogramm
absolviert. Sie haben ihre Betriebskosten gesenkt, die Effizienz der Produktion gesteigert,
Mitarbeiter/-innen geschult, Rechtssicherheit erlangt, innerbetrieblichen Umweltschutz implementiert
und nicht zuletzt Arbeitsplätze gesichert. Die Betriebe haben im Rahmen des ÖKOPROFIT-Projektes
umfangreiche Umweltprogramme erarbeitet. Die darin enthaltenen Maßnahmen umfassen die
Bereiche Energie/Emissionen, Rohstoffe/Abfälle, Wasser/Abwasser, Kommunikation und Sicherheit.
Sie beziehen sich auch auf die Veränderungen im Verhalten der Menschen und optimieren
innerbetriebliche Abläufe.
Die ökologische Gesamtbilanz der insgesamt 151 erarbeiteten Maßnahmen:
Die Unternehmen können ihren jährlichen Energieverbrauch insgesamt um fast 1,8 Millionen
Kilowattstunden senken. Dadurch werden insgesamt jährlich über 1.100 Tonnen klimaschädliches
Kohlendioxid eingespart. Zudem sparen sie 148 Tonnen Abfall und senken den Wasserverbrauch um
75.677 m3.
Dortmunder ÖKOPROFIT-Betriebe im Projektzeitraum 2011/2012:
- BlumenCompany Kersting
- dh mining system GmbH
- Deutsche Post AG, Briefzentrum Dortmund
- DULA Dustmann & Co. GmbH
- Günter Pauli GmbH
- Herbert Heldt KG
- KHS GmbH
- Klöpper Therm GmbH & Co. KG
- Ringhotel Drees
- Seaquist Perfect Plastic GmbH aus Menden
- TRILUX GmbH & Co. KG aus Arnsberg
- Verzinkerei Dortmund Kaufmann GmbH & Co. KG
Darüber hinaus wurden zwei Unternehmen rezertifiziert nach deren Teilnahme in vorangegangenen
Jahren:
- KODA Stanz- und Biegetechnik GmbH
- Murtfeldt Kunststoffe GmbH & Co. KG
Damit sind seit 2001 in Dortmund 101 Unternehmen mit diesem Umwelt-Siegel zertifiziert.
Ab 2013 müssen diejenigen Unternehmen des produzierenden Gewerbes, die den Spitzenausgleich
nach § 55 EnergieStG und § 10 StromStG weiterhin in Anspruch nehmen wollen, ein
Energiemanagementsystem (EMS) oder Umweltmanagementsystem (UMS) einführen und
nachweisen. In einer ersten Phase (2013 bis 2014) reicht es aus, wenn betroffene Unternehmen
- 11 -nachweisen, mit der Einführung eines EMS oder UMS begonnen zu haben. Diese Anforderung wird
durch die Teilnahme an ÖKOPROFIT erfüllt.
In der zweiten Phase (ab 2015) muss das EMS oder UMS dann zertifiziert sein. Für eine solche
Zertifizierung ist ÖKOPROFIT ein einfacher und kostengünstiger Einstieg.
Die zehnte Projektrunde beginnt am 27. Mai 2013 mit neuen Unternehmen.
Projektträger: 8/WF
3 Handlungsfeld Erneuerbare Energien und Energieversorgung
3.1 Ausbau Photovoltaik
Die Stadt Dortmund gibt ihre Liegenschaften frei für den Ausbau von Photovoltaik. Zurzeit befinden
sich 170 Anlagen auf Dortmunder Schuldächern. Möglich sind auch Anlagen auf ca. 7 ha der
ehemaligen Mülldeponien in Grevel und Huckarde in einer Größenordnung von etwa 2 MWpeak. Die
erforderliche Baugenehmigung wurde bereits erteilt.
Mit den Photovoltaikanlagen auf den Westfalenhallen und dem Signal Iduna Park des BVB besitzt
Dortmund großflächige Solarstromerzeugung (1,67 MWpeak).
Eine Freiflächen-Photovoltaikanlage auf Dortmunder Konversionsflächen mit einer Leistung von
3.912 kWp ist derzeit in Planung. Der Bauantrag befindet sich in der Vorbereitung.
Den Bürger/-innen in Dortmund steht online und unentgeltlich ein Solardachkataster zur Verfügung,
das sie bei der Planung ihrer privaten Photovoltaikanlage unterstützt. Dieses Online-Tool konnte in
2012 auf der Internetseite der Stadt Dortmund unter www.solarkataster.dortmund.de gestartet werden.
Entwickelt wurde es durch die Technische Universität Dortmund. Das Solardachkataster wurde mit
zielgruppenspezifischen Veranstaltungen wie bspw. Vorträgen auf der Baumesse NRW und über
Multiplikatoren wie Eigentümer-Verbände beworben. Des Weiteren wurde in einer bundesweit
erscheinenden Fachzeitschrift darüber berichtet.
Projektträger: FB 60, 62, 20, 23, EDG
3.2 Windkraft Repowering und Ausbau
Mit den 7 existierenden Windkraftanlagen (11 MW Leistung) sind alle bis heute möglichen Standorte
mit Windrädern belegt. Vor dem Hintergrund des Windenergieerlasses NRW und Änderungen im
Baugesetzbuch wurde ein neuerliches Gutachten für das Dortmunder Stadtgebiet in Auftrag gegeben,
das die Ausweisung neuer Standorte untersuchen soll. Das Gutachten liegt seit Mitte April 2013 der
Stadtverwaltung vor. In Erweiterung des Gutachtens wird eine Artenschutzprüfung (ASP) nach Stufe
1 durchgeführt, um bereits erste Konzentrationszonen im Flächennutzungsplan ausweisen zu können,
sofern eine ASP nach Stufe 2 für entsprechende Gebiete nicht erforderlich sein sollte. Der Abschluss
der ASP nach Stufe 1 ist für August 2013 vorgesehen. Anschließend wird dem Rat der Stadt
Dortmund eine Beschlussvorlage vorgelegt.
Projektträger: FB 60 und 61
3.3 Holzhackschnitzel und Holzpellets
Betriebshof Westerholz
Die Sanierung des Betriebshofes Westerholz wurde bereits unter 1.5 beschrieben. Neben der
Sanierung der Gebäudehülle und Verbesserung der Gebäudeausrüstung wird auch die Heizungsanlage
ausgetauscht. Die bisher eingesetzten ineffizienten Gasradiatoren werden durch eine zentrale
- 12 -Pelletheizung ersetzt. Eine Holzhackschnitzelanlage, die mit stadteigenem Holz befeuert wird, lies
sich in diesem speziellen Fall nicht wirtschaftlich darstellen.
Mit dem Austausch der Heizung und der Sanierung des Gebäudes kann die jährliche CO2-Emission
um 93% gesenkt werden. Die jährliche Wärmeenergieeinsparung liegt bei rd. 113.900 kWh. Das
entspricht heute einer Kostenreduzierung von 15.260 € pro Jahr. Bei prognostizierter
Wärmepreissteigerung von ca. 7% amortisiert sich diese Investition unter Einbeziehung der
Fördermittel innerhalb von 9 Jahren.
Projektträger: FB 60 und 65
3.4 KuLaRuhr
Seit August 2012 ist die Stadt Dortmund Partner im Verbundprojekt KuLaRuhr (Nachhaltige urbane
Kulturlandschaft in der Metropole Ruhr). Die Stadt Dortmund ist Modellkommune im
Betrachtungsraum östliches Ruhrgebiet für eine energetische Verwertung von anfallender Biomasse
aus der Garten-, Straßen- und Landschaftspflege. Im Rahmen des Projektes soll die Möglichkeit der
Refinanzierung der Pflegearbeiten durch die energetische Verwertung anfallender Biomasse
untersucht werden. Dabei geht es sowohl um krautiges oder halmgutartiges Material für die
Vergärung, wie auch um lignifiziertes Material für die Verbrennung (Scheitholz, Hackschnitzel,
Pellets, Stroh usw.). Durch die Erweiterung des Grünflächenkatasters werden Mengen,
Pflegeintervalle, Art der Biomasse usw. erfasst. Die TU Darmstadt wird nach einer Datenanalyse
Empfehlungen für eine energetische Nutzung der Biomasse aussprechen, die auch notwendige
Ressourcen, Logistik und Anlagentechnik berücksichtigen.
Projektträger: FB 66 und 60 in Kooperation mit der TU Darmstadt und der Hochschule Ostwestfalen-
Lippe
3.5 Nutzung Abwasserwärme
Im Zuge des Kanalumbaus im Stadtgebiet Scharnhorst wird die Abwärmenutzung aus Abwässern
etabliert. Als ideale Abnahmestellen konnten zwei Objekte identifiziert werden. Eines der Objekte ist
der Seniorenwohnsitz Westholz für den der Lipperverband eine Machbarkeitsstudie in Auftrag
gegeben hat. Anhand der Ergebnisse aus der Studie wird über die Umsetzung entschieden. Bei dem
anderen Objekt handelt es sich um fünf Mehrfamilienhäuser der Vivawest Wohnungsbaugesellschaft,
die sich zum Teil im Sanierungsstadium befinden.
Projektträger: 60 und 66 in Kooperation mit dem Lippeverband
3.6 Aquaponic
Neben der Energieversorgung spielt für den Klimaschutz auch der nachhaltige Konsum eine große
Rolle. Dazu zählen Produktionsbedingungen ebenso wie der Ort der Produktion und die damit
verbundene Logistik. Mit Aquaponic, ein Verfahren, das Techniken der Aufzucht von Fischen in
Aquakultur und der Kultivierung von Nutzpflanzen in Hydrokultur verbindet, z. B. innerhalb eines
Gewächshauses, soll die Möglichkeit einer weitestgehend klimaneutralen Lebensmittelproduktion in
urbanen Räumen untersucht werden. Im Fokus stehen dabei Wärmeversorgung aus Umwelt- oder
Abwärme, fast vollständige Kreislaufwirtschaft bei der Aufzucht und der Verzicht auf Herbi- und
Pestizide sowie künstlichem Wirtschaftsdünger. Derzeit werden mögliche Förderungen seitens
Deutsche Bundesstiftung Umwelt und BMU geprüft und eine Modellanlage projektiert.
Projektträger: Gründung einer Projektgruppe unter Beteiligung eines Investors, der TU Dortmund und
FB 60
- 13 -3.7 Ausbau der oberflächennahen Geothermie
Längst etabliert ist der Ausbau von Wärmepumpen in Dortmunds Neubaugebieten. Ca. 650 Anlagen
sorgen für Wärme in den Eigenheimen unserer Bürger/-innen und z. B. in den Bürogebäuden am
Phoenixsee. Die Genehmigungen für die jeweiligen Anlagen werden durch das Umweltamt erteilt.
Projektträger: Private Investoren
4 Handlungsfeld Strukturübergreifende Maßnahmen
4.1 Koordinierungsstelle Klimaschutz im FB 60
Die Umsetzung eines erfolgreichen kommunalen Klimaschutzes erfordert eine transparente
übergeordnete Koordination, die gesamtstädtische Ziele verfolgt, Strategien und Schwerpunkte
formuliert und in Zusammenarbeit mit lokalen Akteuren Projekte anstößt und begleitet.
Wichtigste Ziele sind:
• die Sensibilisierung für die Themen Klimaschutz und Klimafolgenanpassung,
• die Überführung von Handlungsnotwendigkeiten in alle Entscheidungsprozesse
• und die gemeinsame Umsetzung von Maßnahmen mit Akteuren innerhalb und außerhalb der
Stadtverwaltung.
Zu diesem Zweck wurde die Koordinierungsstelle Klimaschutz im Umweltamt der Stadt Dortmund
etabliert und personell ausgebaut. Das Team ist zentraler Ansprechpartner, Moderator und
Projektinitiator für bereits 39 Maßnahmen aus dem HP 2020, davon 27 Maßnahmen, die im Team
durchgeführt werden (s. hierzu auch „Begründung“ in der Vorlage). Mit denen durch das BMU
geförderten Klimaschutzmanager und Klimaschutzmanagerin wurde die personelle Unterstützung für
einen befristeten Zeitraum (bis Ende 2014) ausgebaut. Die verwaltungsintern ausgeschriebenen zwei
Energieberater/-innen für das dlze und eine Verwaltungskraft werden ebenfalls der
Koordinierungsstelle angehören.
Auch die vorübergehend nicht mehr besetzte Stelle für die Anpassung an die Folgen des
Klimawandels in Dortmund wird ebenfalls ab 01. Juli 2013 wieder besetzt sein, so dass dieses für
Dortmund „neue Thema“ nun mit der notwendigen Kapazität ausgestattet ist. Zum Thema Anpassung
an die Folgen des Klimawandels wird eine gesonderte Ratsvorlage zeitnah erstellt.
Zurzeit besteht die Koordinierungsstelle aus einem 6-Personen-Team, das Klimaschutz nicht nur
durchführt sondern auch repräsentiert.
Projektträger: FB 60
4.2 Verwaltungsinterner Konsultationskreis Energieeffizienz und Klimaschutz (InKEK)
Die Geschäftsführung des InKEK ist bei der Koordinierungsstelle Klimaschutz angesiedelt. Im InKEK
werden Projekte angestoßen, begleitet, rückgekoppelt. Außerdem gibt es einen intensiven, fachlichen
Austausch und er dient auch zur Etablierung ganz neuer Klimaschutzmaßnahmen. Der InKEK tagt im
Umweltamt sechsmal im Jahr und ist über alle relevanten Fachbereiche hinweg das anerkannte und
akzeptiere Gremium für das Monitoring der Maßnahmen aus dem HP 2020. Durch die
Kommunikationsstruktur des InKEK lässt sich feststellen, dass Klimaschutz und Energieeffizienz in
den meisten Fachbereichen integraler Bestandteil von Planungs- und Entscheidungsprozessen
geworden ist. Damit ist die Stadtverwaltung Dortmund im nachhaltigen Handeln den meisten
deutschen Kommunen weit voraus.
Geschäftsführung: FB 60
- 14 -4.3 Kampagne Klima für Klimaschutz
Grundlage der Öffentlichkeitsarbeit war die Überarbeitung und Aktualisierung der Internetpräsenz des
Dortmunder Klimaschutzes. Kern der Öffentlichkeitsarbeit bestand in der Entwicklung und
Etablierung der Dortmunder Dachmarke für Klimaschutz. Damit waren Veranstaltungen, klassische
Werbemaßnahmen und die medialen Berichterstattungen verbunden. Beispielhaft seien die
Nachnutzung der sog. „Wesselmänner“ (großformatige Plakate der vergangenen Kommunalwahl) an
100 Standorten in Dortmund zu einer Teaser- Kampagne (englisch: Anreißer, soll Neugier wecken)
sowie die Bereitstellung eines Online-Adventskalender für den Dortmunder Klimaschutz zu nennen.
Zudem wurde die Arbeit der Koordinierungsstelle Klimaschutz über die lokale Presse und der
Mitarbeiterzeitung präsentiert. Gelegenheiten wie regionale Netzwerktreffen und lokale Arbeitskreise
konnten genutzt werden, um die Maßnahmen des Handlunsgprogramms zu präsentieren und neue
Projekte anzustoßen. Im Rahmen der umgesetzten Maßnahmen, wurden diverse Veranstaltungen
seitens der Koordinierungsstelle eigenverantwortlich und gemeinsam mit Partnern organisiert und
begleitet. Besonders zu nennen sind:
10.02.12 Jugend Klima Nacht
13.03.12 Pressekonferenz Einstellung der Klimaschutzmanager
22.03.12 Pressekonferenz zur Einführung des Solarkatasters
22.-25.03.12 BAUMesse NRW, Dortmund
1./2.06.12 Markt der Gerechtigkeiten in der Innenstadt
19.06.12 Jurysitzung des Dachmarken-Wettbewerbs
02.07.12 Preisverleihung des Dachmarken-Wettbewerbs
21.07.12 Wanderung „Regenerative Energien in Dortmund“
21.09.12 Klima Korso – Einführung der Dachmarke
21.-23.09.12 Dortmunder Immobilienmarkt
26.09.12 Auftaktveranstaltung Masterplan Energiewende (unterstützt)
13.02.13 Dortmunder Energiewendekongress (unterstützt)
19.03.13 Pressekonferenz WWF Earth Hour
23.03.13 WWF Earth Hour
16.06.13 Fahrrad-Sternfahrt Dortmund 2013
Projektträger: FB 60 und 3
4.4 Strommessgeräte in der Stadt- und Landesbibliothek Dortmund
Im Durchschnitt gibt ein Drei-Personen Haushalt 1.000,- € im Jahr für Stromkosten aus. Ein Drittel
davon kann man mit wenig Aufwand und ohne auf Komfort zu verzichten einsparen. Dies gelingt in
der Regel durch bewusstes Verhalten mit den Geräten, der Wahl eines besonders Strom sparenden
Geräts beim Neukauf und durch den Einsatz von Gas oder Solarenergie bei der Warmwasserbereitung.
Dabei ist die Bestandsaufnahme der „Stromdiebe“ im eigenen Haushalt notwendig. Ab Sommer 2013
sind in der Hauptstelle der Bibliothek so wie in allen Zweigstellen in Dortmund Strommessgeräte
erhältlich. Jeder, der einen gültigen Bibliotheksausweis der Stadt- und Landesbibliothek Dortmund
besitzt, kann dann die Strommessgeräte kostenfrei ausleihen.
Projektträger: FB 60 und Stadt- und Landesbibliothek
4.5 Kampagne zur energetischen Gebäudesanierung
Die Eröffnung und der Betrieb des dlze (s. Punkt 2. in der Begründung dieser Ratsvorlage) wurden
ebenfalls zielgruppenspezifisch beworben. Wesentliche Aspekte der Vorarbeit waren hierbei die
Gestaltung eines Corporate Designs inklusive Logo und Erstellung geeigneter Materialien für die
Beratung und den Betrieb. Dazu zählen beispielsweise die datenschutzadäquate Abfrage der
- 15 -Kontaktdaten von Interessenten hinsichtlich Themenschwerpunkten für die bessere Information über
weitere Angebote des dlze.
Zudem wurden Vorträge zum Thema Energetisches Modernisieren und Bauen veranstaltet und über
die Presse, Multiplikatoren und Internet beworben. In dem Zusammenhang wurden Eigentümer-
Verbände über das Angebot informiert. Nachfolgend einige Beispiele:
11.10.12 Vortrag „Passivhaus/ Energieplushaus“
08.11.12 Vortrag „Holzbau“
06.12.12 Vortrag „Moderne Heizsysteme“
17.01.13 Vortrag „Die richtigen Schritte zum Energiesparhaus im Gebäude“
31.01.13 Vortrag „Innendämmung oder Aussendämmung, Schimmel vermeiden“
14.02.13 Vortrag „Leben und Wohnen ohne Barrieren
19.02.13 Vortrag „Komfortlüftung - Feuchte- und Schimmelschutz im Mehrfamilienhaus“
21.03.13 Vortrag „Dämmen mit Naturmaterialien/Recyclingmaterial“
18.04.13 Vortrag „Alternative Heizsysteme – ein Überblick“
23.05.13 Vortrag „ Die neue Energieeinsparverordnung (EnEV 2014)
Projektträger: FB 60 und 3
4.6 Dortmunder Dachmarke
Die „Dortmunder Dachmarke“ bildet das Fundament für Maßnahmen der Öffentlichkeitsarbeit wie
bspw. „Kampagne Klima für Klimaschutz“. Mit einem gemeinsamen Logo soll gezeigt werden, wo
überall Klimaschutz in Dortmund steckt und wer alles mitmacht. Es macht deutlich, dass Klimaschutz
nicht ein Anliegen einiger wenigen Akteure ist. So sollen gerade die finanziellen und personellen
Ressourcen alle Klimaschutz-Akteure effizient für den Klimaschutz genutzt werden. Durch die
Dachmarke sollen besonders in Bezug auf Öffentlichkeitsarbeit Synergien genutzt werden und durch
eine engere Vernetzung der Akteure auf operativer Ebene Expertisen besser nutzbar gemacht werden.
Um die Akzeptanz der Dachmarke wesentlich zu fördern, wurde diese in einem partizipativen Prozess
entwickelt. Im Rahmen eines Studenten-Wettbewerbs wurden Vorschläge einer Wortmarke erarbeitet,
die über ein Online-Voting den lokalen Klimaschutz-Akteuren zur Abstimmung gegeben wurden. Der
Sieger der Abstimmung „dortmund– Klima ist heimspiel“ wurde über die o. g. Teaser-Kampagne (s.
4.3), dem „Klima Korso“ am 21. September 2012 der Öffentlichkeit präsentiert. Somit ist die
Maßnahme „Dortmunder Dachmarke“ abgeschlossen.
Projektträger: FB 60 und 3 in Kooperation mit der FH-Dortmund
4.7 Selbstverpflichtung für Klimaschutz in Dortmund
Als weiterer Baustein wurde eine Mitmach-Kampagne „Wir sind Klimafans“ initiiert, die über eine
freiwillige Selbstverpflichtung, Dortmunderinnen und Dortmunder zum Klimaschutz auffordert.
Dortmund nutzt hier ressourcensparend eine gute Vorlage aus Karlsruhe. Jede Dortmunderin und jeder
Dortmunder kann sich online oder schriftlich für mindestens ein Jahr zu klimafreundlichem Handeln
im Alltag verpflichten. Aus 33 möglichen Aktionen – diesen sind jeweils Punkte zugeordnet – ist eine
Auswahl mit mindestens 20 Punkten zu treffen. Unter Handlungsfeldern wie „Ich drehe runter, Ich
schalte ab, Ich recycle, Ich bin mobil, Was ich sonst noch tue“ werden beispielsweise
Verhaltensweisen wie „Ich verwende Wasserspar-Duschköpfe“ mit Punkten belohnt. Im Ergebnis
wird dem Klimafan gezeigt, wie viel er persönlich zum CO2-Sparen in der Stadt beiträgt. Zusätzlich
nimmt er an einem Wettbewerb teil. Es winken so attraktive Preis wie eine klimafreundliche Reise,
ein Fahrrad und Abos für den ÖPNV. Unterstützt wurde diese Kampagne durch Bewerbung auf
zahlreichen Veranstaltungen und über einen Online-Adventskalender.
Projektträger: FB 60 und 3
- 16 -5 Handlungsfeld Mobilität mit dem Maßnahmebündel Radverkehr und Radfahrklima
schaffen
5.1 Fahrrad Sternfahrt Dortmund 2013
Am 16. Juni 2013 beteiligt sich Dortmund unter dem Motto “Klare Sache – Mobil ohne Auto” mit
einer Fahrrad-Sternfahrt am bundesweiten gleichnamigen Aktionstag “Mobil ohne Auto”. Zahlreiche
Radfahrer starten bereits am Vormittag in umliegenden Städten und werden sternförmig ins
Dortmunder Zentrum radeln. Die Liste der teilnehmenden Städte liest sich derzeit wie folgt: Bochum,
Castrop-Rauxel, Ennepe-Ruhr-Kreis, Hagen, Hamm, Herne, Iserlohn, Paderborn, Recklinghausen,
Soest, Kreis Unna, Waltrop, Werl und Wuppertal. Startpunkt der rund 15 km langen Hauptroute ist
der Hörder-Burg-Platz am PHOENIX-See. Zudem gibt es weitere Treffpunkte entlang der Route, die
schließlich auf dem Friedensplatz endet, wo ein Fest mit zahlreichen Fahrrad-Aktionen die
Teilnehmer erwartet. Insgesamt wird mit bis zu 1.000 Radlern gerechnet. Die Veranstaltung ist
gleichzeitig die Auftaktveranstaltung des AOK-Wettbewerbs „Mit dem Rad zur Arbeit“.
Projektträger: FB 60 und 3 in Kooperation mit Kreisverbänden Dortmund und Unna der Vereine
ADFC und VCD, dem Fahrrad-Netzwerk VeloCityRuhr, der Fahrrad-Selbsthilfewerkstatt
VeloKitchen aus der Dortmunder Nordstadt, der Polizei, sowie weiteren Vereinen und Privatpersonen
5.2 Bambus-Fahrräder
Im Rahmen der Klimapartnerschaft mit Kumasi, Ghana, wurde eine Vernetzung mit örtlichen
Händlern angeregt, um Bambus-Fahrräder in Dortmund anzubieten. Durch dieses ungewöhnliche
Angebot sollen neue Zielgruppen erreicht werden. In dem Zuge wurden diese Räder beispielsweise auf
der FAIR 2012, eine Messe zum fairen Handel in den Westfalenhallen, vorgestellt. Die Materialien
des Fahrradrahmens stammen aus nachwachsenden Rohstoffen, die in Schwellen- bzw.
Entwicklungsländern geerntet und zusammengefügt werden.
Projektträger: FB 60 und 1 innerhalb des Projekts „Klimapartnerschaft mit Kumasi/Ghana“
5.3 e-Cargo-Bikes
Mit der Erhebung über den Modal-Split Dortmunder Verkehrsteilnehmer/-innen wurde festgestellt,
dass 41% für die alltäglichen Wege einen Pkw benutzen. Etwa 80 % der Wege liegen innerhalb eines
Radius von 5 km. Häufiges Argument für den Einsatz eines Pkw ist der Transport von Gütern, der
alternativ nicht zu bewerkstelligen sei. Mit dem Einsatz von elektrisch unterstützten Lastenrädern soll
eine Alternative aufgezeigt werden. Neben der Vermeidung von Treibhausgasemissionen gehen mit
dem Einsatz der s. g. eCargo-Bikes weitere positive Effekte einher. Der lokale Einzelhandels- und
Dienstleistungsbereich wird gestärkt, der Bezug zur umgebenden Umwelt und die körperliche
Aktivität werden erhöht. Um den Test von eCargo-Bikes zu ermöglichen mietet FB 60 drei Räder mit
unterschiedlicher Konfiguration für den Zeitraum April bis Oktober 2013. Die Räder werden im
Tremonia Wohnpark, im Union Gewerbehof und in der Stadtverwaltung zur Verfügung gestellt. Es
wird derzeit geprüft, ob das Rad der Stadtverwaltung über das Verleihsystem NextBike auch der
Öffentlichkeit zugänglich gemacht werden kann. Die Nutzung der eCargo-Bikes wird durch die TU
Dortmund, Fakultät Raumplanung wissenschaftlich analysiert.
Der ADFC Dortmund beabsichtigt einem Gewerbebetrieb ein eCargo-Bike zu finanzieren. FB 60
knüpfte in diesem Zusammenhang den Kontakt zu potenziellen Nutzern mit der Absicht diese
Transportalternative auch für den gewerblichen Bereich darzustellen.
Wichtigste Absicht der Vorhaben ist die Etablierung von Lastenrädern im Dortmunder Stadtbild zur
Erzeugung von Nachahmungseffekten und damit verbundener Verbreitung. Die Räder werden durch
die Dortmund-Agentur beworben und sowohl das Stadtwappen und das Logo „dortmund - Klima ist
Heimspiel“ tragen.
- 17 -Sie können auch lesen