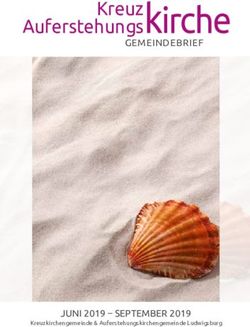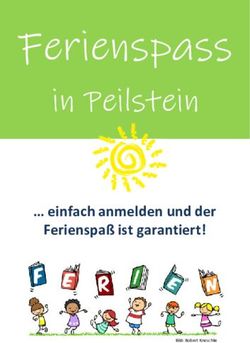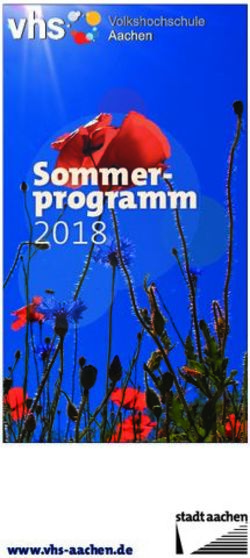Skandal in Aachen. Die Fluxus-Performance von 1964 als Einübung' in die antiautoritäre Bewegung - Brill
←
→
Transkription von Seiteninhalten
Wenn Ihr Browser die Seite nicht korrekt rendert, bitte, lesen Sie den Inhalt der Seite unten
Skandal in Aachen. Die Fluxus-Performance von
1964 als ‚Einübung‘ in die antiautoritäre Bewegung
Stephan Braese
Die Stadt Aachen, am äußersten westlichen Rand der Bundesrepublik
Deutschland gelegen, war keines der Zentren der antiautoritären Bewegung.
Seit langer Zeit – wie noch heute – ist sie vorrangig bekannt durch ihren in die
karolingische Zeit zurückreichenden Dom sowie allenfalls noch durch die so-
genannten Printen, eine Süßware, deren Rezeptur ebenfalls, wenn auch nicht
bis in die karolingische Zeit, so doch weit in die Geschichte zurückreicht. Und
dennoch hat es auch hier – wie so oft in der Provinz – Akteure gegeben, die ver-
sucht haben, ihre lokale Öffentlichkeit an jene Entwicklungen anzuschließen,
die sich andernorts als unabweisbar objektive Schritte im Weltprozess auszu-
weisen schienen. Im Folgenden sei von einem solchen Versuch berichtet, der
sich recht genau datieren und lokalisieren lässt: auf den Abend des 20. Juli 1964
im Auditorium Maximum der Rheinisch-Westfälischen Technischen Hoch-
schule. Zwei Tage später titelten die Aachener Nachrichten: „Auf der Bühne
regierte die Faust“. Sie berichtete von „Krakeel ohne Ende“ und „Geld zurück“-
Sprechchören aus dem Publikum;1 der Kölner Stadtanzeiger identifizierte
einen „Hochschul-Skandal“ und erkannte auf „würdelosen Klamauk“;2 Bundes-
präsident Lübke suchte auf den nordrhein-westfälischen Kultusminister
einzuwirken, den an der Veranstaltung beteiligten Joseph Beuys von seiner
Professur an der Düsseldorfer Kunsthochschule zu entbinden. Das von den
Veranstaltern als „Festival der neuen Kunst“ angekündigte Ereignis nimmt
heute einen festen Platz in der kunstgeschichtlichen Rekonstruktion der
Durchsetzung von Fluxus im deutschsprachigen Raum ein und ist gut
dokumentiert;3 ihr Status im zeitgeschichtlichen Vorraum der antiautori-
tären Bewegung hingegen verdient noch genauere Betrachtung. Diese sei im
Folgenden versucht. Nicht eine kunstgeschichtliche Bewertung steht also
in ihrem Mittelpunkt, sondern die Stellung dieses Ereignisses zu den Um-
brüchen im öffentlichen Raum, die im historiographischen Rückblick auf
„’68“ die antiautoriäre Bewegung erst zu einer Zäsur gemacht haben. Zwei
Elementen gilt dabei die herausragende Aufmerksamkeit: den Referenzen der
1 Aachener Nachrichten (1964b), S. 10.
2 Kölner Stadtanzeiger (1964), o.S.
3 Vgl. Oellers/Spiegel (1995); Franzen (2011).
© Wilhelm Fink Verlag, 2020 | doi:10.30965/9783846764305_006 Stephan Braese - 9783846764305
Downloaded from Brill.com10/26/2021 05:48:50AM
via free access74 Stephan Braese
Veranstaltung auf die NS-Vergangenheit und dem Versuch einer „Evokation
des Handelns“4 durch die Akteure, wie der Beteiligte Bazon Brock die Per-
formance später zu charakterisieren versuchte.
Das Ereignis, vor allem aber die Reaktionen, die es im Publikum auslöste,
sind nicht zu verstehen ohne einen genaueren Blick auf den spezifischen
Charakter Aachens. Seit je eine Festung des Katholizismus, pflegte ihr Bürger-
tum zudem eine eigentümliche, wohl lokalpatriotisch motivierte dezidierte
Abgrenzung – um nicht zu sagen: Abschottung – zu den größeren Nach-
barstädten Köln und Düsseldorf. Um 1960 galt Aachen als „Hochburg der
Burschenschaften und des Karnevals, das waren Printen und Kaisergrab“5.
Den Geist, der hier herrschte, gibt ein Kommentar wieder, der im April 1964,
also nur einige Wochen vor dem „Festival der neuen Kunst“, anlässlich einer
Aufführung von Rolf Hochhuths Stellvertreter in einem Athener Theater
im Lokalblatt Aachener Nachrichten erschien. Der Kommentator nennt das
Drama nicht nur ein „verfälschendes Stück […], das Pius XII. verleumdet“,
und seine Aufführung „Blasphemie“, sondern der Regisseur der Welturauf-
führung in Berlin, Erwin Piscator, wird in der Tonlage des Kalten Krieges als
„Altkommunist“ diffamiert, und zur Athener Aufführung heißt es: „Die Juden
werden durch Hochhuths Drama zu Haß und neuen Psychosen aufgehetzt.“6
Die vielleicht aber für die Konstellation von 1964 erhellendste Analyse
der mentalen Landschaft Aachens findet sich in den Ausführungen, die Saul
Padover gemacht hat, als er als Mitglied des Psychological Warfare Branch der
US Army Ende 1944 Aachen erreichte und mit zahlreichen Aachener Bürgern
Interviews führte, um die Stimmung unter der deutschen Bevölkerung zu er-
mitteln und die Voraussetzungen für den Aufbau einer demokratischen Gesell-
schaft zu mustern. In seinen 1946 ersterschienenen Aufzeichnungen heißt es:
Aachen war eine verrückte Stadt. Die wichtigste Person war nicht der US-
Stadtkommandant, sondern der von ihm ernannte Oberbürgermeister. Den
größten Einfluss hatte ein Mann, der überhaupt kein politisches Amt bekleidet –
der Bischof. Nicht die amerikanischen Eroberer bestimmten, wo es langging,
sondern die Deutschen, die zu einer Clique von Rüstungsproduzenten ge-
hörten. Die herrschende Ideologie war nicht von Demokratie geprägt, sondern
von einem autoritären Faschismus. […] Oberbürgermeister Oppenhoff und
seine Freunde verfolgen politisch und wirtschaftlich weitreichende Ziele. […]
Sie streben die Errichtung eines autoritären Ständestaates (à la Dollfuß) an,
der sich vor allem auf kleine Industriebetriebe, auf das Handwerk und eine
hierarchisch organisierte, rechtlose Arbeiterschaft stützt. Oppenhoffs Ziel
4 Vgl. Brock (2011), S. 40.
5 Pickhaus (1988), S. 344.
6 Sellenthin (1964), S. 4.
Stephan Braese - 9783846764305
Downloaded from Brill.com10/26/2021 05:48:50AM
via free accessSkandal in Aachen 75
war ein kleinstaatlicher Klerikalismus und ein dezentralisiertes Reich. […]
Oppenhoff und seine Freunde sind entschiedene Gegner von Wahlen, Parteien
und Gewerkschaften. […] Kurzum, Oppenhoff errichtete unter den Augen der
US-Militärverwaltung die Strukturen eines autoritären, hierarchischen, büro-
kratischen Ständestaates, wie ihn selbst die Nazis abgelehnt hatten. – Diese
Gruppe sitzt mit neun Bürgermeistern, siebenundsechzig Dienststellen und
siebenhundertfünfzig Verwaltungsangestellten fest im Sattel.7
Im direkten Interview mit Padover plädiert Oppenhoff ausdrücklich „für ein
autoritäres Regime, wie es Mussolini, Franco oder Pétain errichtet hatten.“8 „In
Aachen hieß es“, so Padover, „dass man Parteigenosse sein müsse, wenn man
ein Geschäft eröffnen wolle.“9 Die Zustände, von denen Padover hier berichtet,
riefen schließlich den US-Spionageabwehrdienst CIC auf den Plan, „als die
unzähligen Nazis in der Aachener Stadtverwaltung mittlerweile eine Gefahr
für die militärische Sicherheit darstellten.“10
Diese Vorgänge liegen im Sommer 1964 noch keine 20 Jahre zurück; und eine
Form der ‚Aufarbeitung‘ dieser Vorgänge war in Aachen – analog zur übrigen
Bundesrepublik – im restaurativen Klima der Adenauer-Jahre ausgeblieben.
Im Gegenteil: Dadurch, dass etliche Protagonisten dieser klerikalfaschistoiden
Auffassungen der katholischen Kirche nahestanden und oftmals keine NSDAP-
Mitglieder gewesen waren, profitierten sie von der zeittypischen und in der
Region bis in jüngste Zeit verbreiteten Legende einer allem Katholizismus ver-
meintlich inhärenten Resistenz gegen den Nationalsozialismus – ungeachtet
der Tatsache, dass die von Padover genannten Entscheider in der Aachener
Verwaltung nahezu ohne Ausnahme, wie er akribisch aufführt, unter dem
Nationalsozialismus gute Geschäfte gemacht hatten. Das Aachener NS-Erbe
beschränkte sich also nicht nur auf die verdrängte Geschichte einer – oftmals
freudig-emphatischen – Teilhabe am nationalsozialistischen Projekt des An-
griffskrieges, der Ausbeutung Europas und der Vernichtung der europäischen
Juden, sondern es schloss eine weit über 1945 hinausreichende Kontamination
mit aggressiv antidemokratischem Gedankengut ein, die zwar auch anders-
wo, ja, weithin flächendeckend wirksam war, in Aachen jedoch mit einer von
Padover fassungslos zur Kenntnis genommenen Unverfrorenheit unter den
Augen der Alliierten in konkrete Politik umzusetzen versucht worden war. Die
Voraussetzung dieser Unverfrorenheit war freilich der Mangel an jeglichem
Schuldbewußtsein; die Kritik an Hitler, der Padover am häufigsten begegnete,
7 Padover (1999), S. 177, 179f.
8 Ebd., S. 197.
9 Ebd., S. 195.
10 Ebd., S. 200.
Stephan Braese - 9783846764305
Downloaded from Brill.com10/26/2021 05:48:50AM
via free access76 Stephan Braese
bestand in dem Vorwurf, „den Krieg verloren, und nicht, ihn begonnen zu
haben“.11
Im Frühjahr 1964 richtet der ASTA-Kulturreferent der Rheinisch-West-
fälischen Technischen Hochschule, der aus Lettland stammende Architektur-
student Valdis Abolins, eine Anfrage an Tomas Schmit in Köln, „ob er mit ihm
eine Fluxus-Veranstaltung für die Studenten der Aachener TH organisieren
könne“.12 Kurz darauf sendet Schmit einen entsprechenden Rundbrief an
zahlreiche Künstler, darunter Joseph Beuys, Bazon Brock und Wolf Vostell.
Schmit schreibt: „abolins weiss was ihn erwartet, ist ein erstaunlich ver-
nünftiger oder erstaunlich unvernünftiger mann, wird uns bezüglich dessen
was gemacht wird keine grenzen setzen“. Schmit antizipiert für den Abend
im Audimax „eine grosse, sehr dichte sache […] sehr viel verschiedenes auf
dem podium, ums publikum rum, im publikum etc.etc.“13 Nachdem die Hoch-
schulleitung den 20. Juli als Veranstaltungstermin gestattet hatte, wies Schmit
in seinen Rundschreiben an die beteiligten Künstler auf die Besonderheit
dieses Datums – als Jahrestag des mißglückten Attentatsversuchs auf Hitler
durch einige Wehrmachtsoffiziere – hin.14 In der Programmbroschüre zur Ver-
anstaltung schreibt Abolins:
Die Sache ist vollkommen klar. Das Datum, der 20. Juli, ist vollkommen klar. All-
zu offensichtlich sind die Parallelen und die Analogien zwischen der Aktion des
20. Juli 1944 und den Aktionen am 20. Juli 1964. Aber es geht nicht um diese
äußeren, leicht herbeizuführenden Merkmale, sondern um das Wesen einer
Handlung, einer action. – Der 20. Juli ist nicht zu BEGEHEN (je mehr offiziell,
umso unpersönlicher = ohne eigene Anteilnahme). Durch Begehen wird man
keiner Aktion gerecht, sondern nur durch eine weitere (weiter führende) Hand-
lung, eine sinnähnliche, sinngemäße, Handlung. – Wesentlich ist eine Handlung,
wenn sie aktiviert, wenn sie Bewegung ist, Bewegung im Raum (körperlichem
Raum, geistigem Raum). – So war die Aktion am 20. Juli 1944 eine Handlung, die
Raum schuf in einem Zustand der Totalität (einer räumlich-körperlichen und
einer geistigen Totalität). – So sind die Aktionen am 20. Juli 1964 Handlungen, die
Raum schaffen, Raum aktivieren, Gegenstände, Personen im Raum aktivieren
(räumlich-körperlich wie auch geistig). – […] Es geht um ein Bewußtmachen des
größten happening, der reichsten décollage, der aktivsten Aktion: das Leben. –
[…] Es gibt nur eine Wahrheit – die der Aktion, des lebendigen, des Lebens.15
11 Ebd., S. 94.
12 Oellers/Spiegel (1995), o.S.
13 Ebd.
14 Ebd.
15 Ebd.
Stephan Braese - 9783846764305
Downloaded from Brill.com10/26/2021 05:48:50AM
via free accessSkandal in Aachen 77
Während die Künstler – neben Beuys, Brock und Vostell nahmen auch Eric
Andersen, Stanley Brown, Henning Christiansen, Robert Filliou, Ludwig
Gosewitz, Arthur Koepcke, Thomas Schmit, Ben Vautier und Emmett Williams
an der Veranstaltung teil – am 18. Juli in Aachen eintrafen, widerrief der Rektor
der TH die Genehmigung zur Raumnutzung. Laut Aachener Nachrichten war
der Hochschulleitung die Bedeutung des ursprünglich genehmigten Termins
nicht bewusst gewesen.16 Nach Gesprächen mit Bazon Brock und Joseph Beuys
(der vergeblich versucht hatte, auch den an der RWTH lehrenden Arnold
Gehlen als Befürworter zu gewinnen) lenkt die Hochschulleitung ein und ge-
stattet die Veranstaltung unter der Bedingung, dass die von Nam June Paik ge-
stalteten Plakate mit einem Aufkleber folgenden Wortlauts versehen werden:
„Diese Veranstaltung ist als Gedenkfeier einer internationalen Künstlergruppe
für den 20. Juli gedacht und findet unter ausschließlicher Verantwortung
des ASTA statt.“17 Gegen einen „Unkostenbeitrag“ von 4 D-Mark, „studenten
2 DM“, beginnt die Veranstaltung im Audimax um 20 Uhr.
Über ihren Ablauf liegen mehrere recht exakte Beschreibungen vor, auch
existieren Filmaufnahmen. Vor den rund 800 Zuschauern entfalteten sich
simultan sehr verschiedenartige Aktionen. Zum Auftakt hielt Bazon Brock
„einen scheinbar akademischen“18 Einführungsvortrag, während gleichzeitig
die Sportpalast-Rede von Goebbels („Wollt ihr den totalen Krieg?“) abgespielt
wurde. Auf den sofort im Publikum einsetzenden Lärm versuchte Brock
dadurch zu reagieren, dass er versuchte, seine Rede im Kopfstand fortzusetzen.
Im weiteren Verlauf der Veranstaltung verteilte Brock Postkarten mit Galgen-
szenen und gab per Mikrophon Kommandos an fünf auf der Bühne stehende
Männer aus, die schließlich alle mit zum Hitlergruß erhobenen Armen da-
standen. Über Vostells Beitrag sei hier die Zusammenfassung durch Brigitte
Franzen zitiert:
Der für die Zeitgenossen spektakulärste Aktionsbeitrag (Nie wieder – never –
jamais) kam ohne Zweifel von Wolf Vostell, zumal er ausdrücklich eine Be-
teiligung des Publikums arrangiert hatte. Vostell saß mit Gasmaske und blauer
Lampe den Zuschauern gegenüber und hatte Zettel mit verschiedenen Auf-
forderungen verteilt: Wenn das blaue Licht angeschaltet würde, sollten sie ihre
Trillerpfeifen benutzen – worauf dann die acht Studierenden auf der Bühne rück-
wärts in die ausgeschüttete gelbe Farbe fallen würden, weiterhin gab es die An-
weisung, in das aus Korngarben aufgestellte Kornfeld im Audimax zu kriechen.
Die angesprochene Symbolik der Massensuggestion wie auch die Blut- und
16 Vgl. Aachener Nachrichten (1964a), S. 8.
17 Oellers/Spiegel (1995), o.S.
18 Franzen (2011), S. 25.
Stephan Braese - 9783846764305
Downloaded from Brill.com10/26/2021 05:48:50AM
via free access78 Stephan Braese
Boden-Thematik konnte durch die fehlende Disziplin der Studierenden und die
Störungen nur ansatzweise vermittelt werden.19
Arthur Koepcke hielt u.a. ein Foto aus dem Playboy hoch, was „studentisches
Gegröle und Geklatsche“ auslöste, sodann dessen Rückseite, einen Schlacht-
plan aus dem 1. Weltkrieg, der studentische Buhrufe hervorrief.20 Ein Boxer-
hund wurde durch die Reihen des Auditoriums geführt.21 Joseph Beuys spielte
auf einem Klavier ein Stück von Satie, warf Waschpulver, Gewürze und eine
Postkarte mit dem Aachener Dom hinein und brachte später auf einer Herd-
platte ein Paket RAMA-Margarine zum Schmelzen. Als die Kleidung eines
Studenten versehentlich durch eine Flasche Salpetersäure Schaden nahm,
suchte dieser einen Schuldigen und versetzte Beuys einen Faustschlag. Dieser
erwiderte den Schlag und ergriff daraufhin ein auf einen zusammenpressbaren
Sockel montiertes Kruzifix und erhob deklamatorisch den rechten Arm – das
Photo dieses Moments zählt heute zu den ikonischen Aufnahmen von Beuys
als Aktionskünstler.
Bereits zu einem frühen Zeitpunkt der Veranstaltung forderten Sprechchöre
aus den Zuschauerrängen: „Aufhören“, „Halt die Schnauze“, „Kreuzigt ihn“,
„Geld zurück“ oder skandierten karnevalistisch „Humba, Humba, Täterätä“.22
Nachdem nicht mehr als etwa ein Drittel des Programms realisiert worden
war,23 brach der ASTA-Vorsitzende gegen 21.30 h24 die Veranstaltung ab und
bat das Publikum, den Saal zu verlassen. Als Grund wird in den Quellen zum
einen angegeben, dass „eine ordnungsgemäße Durchführung des Programms
nicht mehr möglich“25 gewesen sei, zum andern, dass „der aufgewirbelte gelbe
Farbstoff der Vostell-Aktion […] das Luftfiltersystem des Audimax zu ver-
stopfen und zu beschädigen drohte.“26 Die wegen der tätlichen Auseinander-
setzung um Beuys herbeigerufenen Feuerwehrleute und Polizisten mussten
nicht tätig werden.27 Während nach Abbruch der Veranstaltung Vostell die
Bühne reinigte, diskutierte Beuys „bis zum frühen Morgen“28 mit Besuchern
vor dem Audimax.
19 Ebd., S. 26.
20 Ebd.
21 Vgl. Vigener (2001), S. 55.
22 Oellers/Spiegel (1995), o.S.
23 Vgl. ebd.
24 Vgl. Aachener Nachrichten (1964b), S. 10.
25 Franzen (2011), S. 29.
26 Oellers/Spiegel (1995), o.S.
27 Ebd.
28 Ebd.
Stephan Braese - 9783846764305
Downloaded from Brill.com10/26/2021 05:48:50AM
via free accessSkandal in Aachen 79
Die regionale und überregionale Presse nahm die Ereignisse zum Anlass,
ihren älteren Affekten gegenüber moderner Kunst freien Lauf zu lassen. Die
Aachener Nachrichten zitierten den Hausmeister des Audimax, der „resigniert
das Schlachtfeld“ betrachtet habe, mit dem Votum: „Eine Schande, daß
deutsche Steuerzahler dafür Geld aufbringen müssen. Das ist nicht mehr zu
rechtfertigen.“29 Der Kommentator des Blattes, der den „avantgardistischen
Verfechtern der Schocktherapie“ als Aufführungsort einen „Kneip-Keller
[…] unter Ausschluss der Öffentlichkeit“ gewünscht hätte, sah den Fehler in
der überzogenen Toleranz von Hochschulleitung und ASTA und stellte die
rhetorische Frage, „ob die Toleranzgrenze des Taktes nicht von vornherein
überschritten war, als ein offenbares Klamotten-Theater mit dem 20. Juli in
Verbindung gebracht wurde.“30 Der Kölner Stadt-Anzeiger stimmte mit seiner
Bewertung des Ereignisses als „würdelosem Klamauk“31 mit ein. Die Zeit be-
gann ihren immerhin um einige Sachlichkeit bemühten Bericht mit dem Satz:
„Im größten Hörsaal der Rheinisch-Westfälischen Technischen Hochschule
in Aachen schienen die schweren Fälle einer ‚geschlossenen Abteilung‘ ihren
Kameradschaftsabend zu feiern“.32 Die Revue hingegen verurteilte den Abend
unzweideutig als „widerliches Experiment mit dem 20. Juli“ und zitierte offen-
kundig empört und angeekelt aus der Kurzbiographie von Joseph Beuys, die
im Programmheft des Fluxus-Abends abgedruckt war: „Beuys empfiehlt Er-
höhung der Berliner Mauer um 5 cm (bessere Proportion!)“.33 Der Arbeits-
kreis 20. Juli, ein „Zusammenschluss der Überlebenden und Hinterbliebenen
der Widerstandsbewegung 20. Juli“, führte als Beleg für seine Anzeige gegen
den ASTA-Vorsitzenden, die Künstler des Abends sowie Beuys im Besonderen
wegen „groben Unfuges“ diesen Bericht der REVUE an;34 im Nachraum dieses
publizistischen Echos standen auch die schon erwähnten Bemühungen ver-
schiedener Stellen, Beuys von der Düsseldorfer Akademie zu entfernen.35
Brigitte Franzen hat darauf aufmerksam gemacht, dass in den Lektüren
der Aachener Fluxus-Veranstaltung vom 20. Juli 1964 „bis heute der Mythos
von einer unverstandenen, künstlerischem Banausentum ausgesetzten
Avantgarde erhalten“36 geblieben sei. Etliche Zeugnisse der Zeit haben dieser
Fokussierung auf das Banausentum der Aachener Studierenden Vorschub
29 Aachener Nachrichten (1964b), S. 10.
30 Ebd.
31 Kölner Stadtanzeiger (1964), o.S.
32 Die Zeit (1964).
33 REVUE (1964), o.S.
34 Vgl. Oellers/Spiegel (1995), o.S.
35 Vgl. ebd.
36 Franzen (2011), S. 29.
Stephan Braese - 9783846764305
Downloaded from Brill.com10/26/2021 05:48:50AM
via free access80 Stephan Braese
geleistet. In SPOTS, einem Aachener Studierenden-Organ, wurde lauthals be-
klagt, dass „das geistige Niveau unserer Studenten einfach nicht ausreicht, um
einer vernünftigen Aussprache standzuhalten“, dass „unsere Kommilitonen
[…] den Charakter der TH durch Gebrüll und Infantilismus“ prägen und „daß
das studentische Publikum heute auf Herausforderungen mit hilflosem Ge-
johle und primitiver Gewalt antwortet“. „Es bleibt zu hoffen“, so heißt es, die
Künstler „vor einem vernünftigeren Publikum wiederzusehen.“37 Die Tatsache,
dass das studentische Publikum der Veranstaltung – charakteristisch für eine
technische Hochschule nicht nur dieser Jahre – ganz überwiegend männlich
war und zu großen Teilen aus Studierenden natur- und technikwissenschaft-
licher Fächer bestand, galt den Verfassern dieser Zeilen offenkundig nicht als
hinreichende Entschuldigung.
Den Vorwurf des Banausentums schien auf den ersten Blick auch Kultur-
referent Abolins zu erheben; in den Aachener Nachrichten vom 25. Juli wird er
mit den Worten zitiert, „die Vorkommnisse am 20. Juli“ hätten „die ganze Sinn-
losigkeit der letzten 20 Jahre“ gezeigt: „Noch sei nichts besser geworden, noch
reagiere die Masse auf den Druck von außen. Das Verhalten der Studierenden
seien bezeichnende Vorkommnisse.“38 „20 Jahre waren an ihnen abgelaufen
wie Regenwasser“39 – das hatte Peter Weiss in sein Tagebuch notiert, nach-
dem Hans-Werner Richter und Günter Grass den jüdischen Exilierten mit Hin-
weis darauf, wo er denn während des Krieges gewesen sei, verbieten wollten,
an einem Anti-Vietnam-Kriegs-Sit-In während der Princetoner Tagung der
Gruppe 47 im April 1964 teilzunehmen.40 So verschieden beide Anlässe waren,
so deutlich stimmen Abolins in Aachen und Weiss in Princeton in ihrer Wahr-
nehmung überein, dass die beobachteten Affektlagen auf in vielfältiger Hin-
sicht unbearbeitete Hypotheken zurückzuführen waren, die in die NS-Ära
zurückreichten. Doch auch mit größerem historischen Abstand, von 1988 aus,
bleibt Verblüffung über die Reaktionsweisen der Aachener Studierenden vor-
herrschend, wie die um Abwägung bemühte Einschätzung durch Peter Moritz
Pickshaus offenlegt:
Gewiß kann man den Studierenden nicht vorhalten, daß sie das Auditorium
nicht als Konzentrationslager erkannten und in den Korngarben nicht die An-
spielung auf die strohblonde Blut-und-Boden-Ideologie ihrer Elterngeneration
sahen. Aber hätten sie als sogenannte geistige Elite nicht einen eigenständigen
37 Kreusch (1964): „Mehr Sandkästen als Honnef“, und Spiegel (1964): „Staunen und
Schrecken im Audi-Max – Protokoll“, in: SPOTS, II/1964, o.S.
38 Aachener Nachrichten (1964c), S. 17.
39 Weiss (1982), S. 492.
40 Vgl. Kramer (1999).
Stephan Braese - 9783846764305
Downloaded from Brill.com10/26/2021 05:48:50AM
via free accessSkandal in Aachen 81
Gedanken auf die Aachener Fluxus-Darbietungen zum 20. Juli 1944 verwenden
können? Zugestanden, hier waren von Anfang an Aversion und Provokation in
sich wechselseitig verschärfender Aggression verknüpft. – Doch selbst noch die
einfachsten Gesten wurden mißverstanden. Ein vollbusiges Ausziehmädchen
und ein Schlachtplan sprechen eine eindeutige Sprache. Addi Koepcke führte
den angehenden Ingenieuren die zwei Seiten einer Medaille vor: Die Vergangen-
heitsbewältigung der Adenauer-Ära. Der totale Konsum, die vordergründige Be-
friedigung, als Sinnersatz, als moralisches Ruhekissen für ein ganzes Volk mit
schmutzigen Händen.41
Entgegengesetzte – und weiterführende – Interpretationen der „Aachener Vor-
kommnisse“ haben hingegen Günther Rühle, Bazon Brock und Dorothee Sölle
vorgelegt. Rühle notierte:
Als endlich die Versammlung zum Gegenangriff überging: da war nicht nur das
Stereotyp ‚Feierschema‘ (schwarzer Anzug, gesenkter Kopf, nachempfundene
Heldentat) durchbrochen, sondern dem geduldigen Publikum auch ‚Aktion‘
entlockt. Es war ein Triumph für die mit Polizeigewalt an weiteren Aktionen ge-
hinderten Veranstalter, daß durch Unsinn eine sinnvolle Handlung provoziert
wurde: Aufstand, Widerstand, ‚20. Juli‘, die Revolte der Opfer. Aktionen mit dem
Ziel, nicht mehr Opfer sein zu wollen.“42
In dieselbe Richtung zielen die Hinweise, die Bazon Brock, teilnehmender
Künstler der Veranstaltung, in einer Ansprache am 30. Jahrestag des Fluxus-
Abends gegeben hat, als er feststellte, es sei „nicht um Provokation [ge-
gangen], sondern um Evokation, also um ein ‚Hervorrufen‘ von Kräften, die
bis dato keinen Anlass gefunden hatten, sich zu zeigen und in Wirkung zu
setzen. […] Evokation hieß: ‚Habe den Mut, Dich Deines eigenen Verstandes
zu bedienen …‘“ Ziel sei es gewesen, die Verlogenheit der offiziösen Feiern
aus Anlass des 20. Juli, die „lächerlichen, weil kontraproduktiven Selbst-
beweihräucherungen von Opportunisten, die beweisen wollten, wie gute,
unverführbare Demokraten sie seien“, zu „enttarnen“.43
Welche Risiken solche „Evokation“ einging, und worauf diese Risikobereit-
schaft bei den Künstlern deutete, hat Dorothee Sölle – die später weltweit be-
kannte Theologin war 1964 wissenschaftliche Assistentin am Philosophischen
Institut der RWTH – in einer eindrucksvollen Deutung zur Diskussion gestellt,
die hier etwas ausführlicher zitiert sei:
41 Pickshaus (1988), S. 360f.
42 Zit.n. Oellers/Spiegel (1995), o.S.
43 Brock (1995), S. 40, 41.
Stephan Braese - 9783846764305
Downloaded from Brill.com10/26/2021 05:48:50AM
via free access82 Stephan Braese
Die ersten fünf minuten der sache waren großartig. WOLLT IHR DEN TOTALEN
KRIEG? Wer es noch nicht vergessen hat, wer es nun oft genug gehört, wem
es vor-demonstriert wird, bis zum JA aus dem Zuschauerraum, der vergißt es
jetzt weniger schnell. Wollt ihr? JA. Das war der tatbestand. Davon wurde aus-
gegangen, mit diesem material gearbeitet. Also nicht: ihr müßt, ihr könnt nicht
anders, ihr habt es ja nicht gewußt, es war ja alles viel komplizierter, sondern
einfach WOLLT IHR DEN TOTALEN KRIEG? JA. Und nun lautsprecher
und krach, und sinnlose handlungen und halbsinniges reden. Währenddessen
breitete sich eine atmosphäre aus. Hilflosigkeit und wut. Nichts tun können und
ständig zum tun provoziert werden. Zuschauer sein und zugleich opfer und täter.
Ein dumpfes bewußtsein, sagen wir mal FASCHISTOID. Es ist idiotisch, unsere
gefahren in neofaschismus, revanchismus und militarismus zu suchen, wie das
neue deutschland ulbrichts wähnt. die sache liegt viel schlimmer. Schreien und
pfeifen, auf provokation warten und dann immer feste druff. O heiliges herz
der völker, o vaterland. Gerade diese Sache habe ich bei den Blooms erfahren44,
das war wichtig, mich kennenzulernen in der hinsicht. Sie heißt: potentieller
faschismus. Heute trillerpfeifen, morgen gewehre, übermorgen zyklon beta.
Heute gesangbücher, morgen urgroßmütter, übermorgen listen von goldzähnen.
Wir Eichmannssöhne. – Hätten die Blooms nur dieses deutlich gezeigt, gespielt,
demonstriert – großartig. Aber ich bin nicht ganz sicher, ob das ihre sache war.
Ob sie nicht heimlich denken, daß faschismus so blöd ist wie antifaschismus. Es
wird nicht alles klar im nihilistischen wohnzimmer mit absurdem nippes. – Diese
unklarheit beruht auf ästhetisch-politischem versagen. Oder weil sie ästhetisch
versagten, blieben sie auch politisch nichts als gutgemeint.
Sölle ergänzt:
In der atmosphäre des absurden wächst nur zweierlei: irrationalismus und
agression. […] Den zuschauern wird verantwortung für die panne zugeschoben.
Sie waren nur ohnmächtig und haben sich mit den mitteln der situation ge-
wehrt. Trillerpfeifen und krach. Andere formen der abwehr waren von den ver-
anstaltern nicht vorgesehen. Meinungsbildung, diskussion, denken war nicht
erwünscht.
Abschließend stellt sie fest: „[Die Veranstalter] sind, was sie kritisieren.
Sie sehen keine möglichkeit. Sie haben keine zukunft. Es fehlt ihnen – an
dialektik.“45
Sölles Ausführungen öffnen eine reflexive Perspektive auf Bedingungen,
in denen die Arbeit der Akteure der antiautoritären Bewegung ab 1966
stand. Sölle erweitert zunächst die Kritik am verlogenen Feierkult der Eltern-
generation zum 20. Juli, wie sie Rühle und Brock pointiert hatten, in eine
44 Anspielung auf Bazon Brocks BLOOM-Zeitung, hier als Kürzel für die in Aachen ver-
sammelte Künstlergruppe.
45 Sölle (1964), S. 16f.
Stephan Braese - 9783846764305
Downloaded from Brill.com10/26/2021 05:48:50AM
via free accessSkandal in Aachen 83
deutlich radikalere Analyse: die eines „potentiellen Faschismus“, den sie zu-
nächst in sich selbst – die noch der HJ-Generation angehört –, aber auch in der
unterdessen nachgewachsenen Generation erkennt und die sie in der Formel
„Wir Eichmannssöhne“ verschmelzt. Die Formel spielt zudem an auf die kurz
zuvor erschienene Schrift von Günter Anders, Wir Eichmannsöhne,46 in der
der Philosoph auf das Fortdauern jener Strukturen hinwies, für die Adolf Eich-
mann zum weltberühmten Ausdruck geworden war. Mit dieser Erbschaft,
dieser Unmittelbarkeit der 68er-Jahrgänge zur NS-Epoche, machte Sölle einen
Sachverhalt namhaft, der in weiten Teilen der antiautoritären Bewegung un-
reflektiert blieb – was zugleich die Voraussetzung eines Moralismus bildete,
der für die Distanzierung von der Elterngeneration unabdingbar geschienen
haben mochte. Der zweite Aspekt, den Sölle mit ihrer Perspektive einbringt,
ist eine Kritik an den Künstlern – nämlich ihr Verdacht, „ob sie nicht heimlich
denken, daß faschismus so blöd ist wie antifaschismus.“ Den archimedischen
Punkt dieser Kritik bildet Sölles Überzeugung, dass der von ihr so erlebte
Nippes-Nihilismus nur erklärbar ist durch die Gewissheit der Künstler, Faschis-
mus drohe ernsthaft nicht, oder, in anderen Worten: dass eine, wenn man so
will, todernste – und das wäre nach Sölle die allein angemessene – Auseinander-
setzung mit dem Faschismus anachronistisch sei. Auch diese Beobachtung
deutet auf Erscheinungsweisen der antiautoritären Bewegung voraus. Gewiss:
Viele ihrer Protagonisten führten mit dem faschistischen Erbe und ihrem
Nachleben eine Auseinandersetzung, die – zumindest subjektiv – ernst-
hafter gewesen sein mag als die der Künstler in Aachen. Doch der augenfällige
Sachverhalt, dass für viele 68er lange Zeit die Vernichtung der Arbeiter-
bewegung durch den NS eine deutlich prominentere Stellung einnahm als
die Vernichtung der europäischen Juden – von Sölle deutlich mit „zyklon
beta“, „goldzähnen“ und „Eichmannssöhne“ angespielt – legt offen, dass auch
diese Auseinandersetzung lange nicht ohne Leerstellen auskam. Als dritten
Aspekt bringt Sölle die energisch vorgetragene Forderung nach „Meinungs-
bildung, Diskussion, Denken“ ein, für die die Künstler im Aachener Audimax
keinen Raum geboten hätten. Hier wird deutlich, dass sie keine Alternative
zur Diskursivierung sieht – ohne intersubjektiven, diskursiven Austausch
keine Aufklärung und Selbstaufklärung. Aus Sölles Sicht war das Publikum
in Aachen zu Aktionen „evoziert“ worden, ohne Chance, über sie zuvor Ver-
abredungen herzustellen. Keine Frage: Der ausführliche ‚Ratschlag‘ wurde
nicht nur in weiten Teilen der antiautoritären Bewegung grundlegend; auch
in den sozialen Bewegungen der siebziger Jahre und bis weit hinein in heutige
46 Anders (1964).
Stephan Braese - 9783846764305
Downloaded from Brill.com10/26/2021 05:48:50AM
via free access84 Stephan Braese
außerparlamentarische Organisationsformen ist die ausführliche Diskussion
und Meinungsbildung in allen möglichen ‚Plenen‘ Alltag.
Ist die Aachener Fluxus-Veranstaltung vom Juli 1964 lesbar als eine „Ein-
übung in die antiautoritäre Bewegung“? Sicher nicht hinsichtlich der Mehr-
heit der Aachener Studierenden. Die politischen Ereignisse von 1967/68 haben
am TH-Standort Aachen – von ein paar Demonstrationen abgesehen – nur ein
mäßiges Echo gefunden.47 Zugleich haben die Künstler vom Juli 1964 jedoch
vermocht, zwei, vielleicht drei Momente namhaft zu machen, die konstitutiv
für die antiautoritäre Bewegung und ihre bis heute reichende Nachgeschichte
sind. Dies ist zum einen das abgrundtief verlogene, von Verschleierung und
Täuschung geprägte Verhältnis zur NS-Vergangenheit, in dem sich eine
heuchlerische Gedenkkultur, justitiable und nicht-justitiable Schuld, Schuld-
wissen und die umfassende Verhinderung einer juristischen Aufarbeitung
verbündet hatten. Das ist zum zweiten eine Disposition in der Generation
der Nachgeborenen, die – auch wenn man sie nicht explizit als „potentiellen
faschismus“ definiert – auf ein hochvirulentes Nahverhältnis zum NS-Erbe
hinweist, ein Nahverhältnis, das erst im Nachraum der antiautoritären Be-
wegung in mühseligen Prozessen der Selbstaufklärung hat erhellt werden
können. Das dritte Moment, das – gleichsam negativ aus den Aachener „Vor-
kommnissen“ herausgelesene – Erfordernis der Diskurskultur, die heute so
ubiquitär scheint, dieses dritte Moment könnte, wenn man Sölle folgt, sogar
ein Widerschein des unbewussten Wissens um jene problematische Dis-
position sein, die eben nicht vorschnell in Aktionen zum Ausdruck kommen
soll. In diesem Sinn warf die Aachener Fluxus-Veranstaltung ein Licht voraus
auf das Kommende, auf die antiautoritäre Bewegung, deren Zentren bekannt-
lich woanders lagen; auf manche ihrer reichhaltigen, gerade auch kulturellen
Erträge wartet man in Aachen noch heute.
Literatur
Aachener Nachrichten (1964a): „Sie wollen schockieren – Veranstaltung des Asta der
TH als Gedenkfeier zum 20. Juli geplant“, in: Aachener Nachrichten, 21.07.1964, S. 8.
– (1964b): „Auf der Bühne regierte die Faust“, in: Aachener Nachrichten, 22.07.1964,
S. 10.
– (1964c): „Zweite Fluxusschau in Aachen? – Heftige Debatte im Studentenparlament –
Abolins: Bezeichnend“, in: Aachener Nachrichten, 25.07.1964, S. 17.
47 Vgl. Vigener (2001), S. 58.
Stephan Braese - 9783846764305
Downloaded from Brill.com10/26/2021 05:48:50AM
via free accessSkandal in Aachen 85
Anders, Günther (1964): Wir Eichmannsöhne – Offener Brief an Klaus Eichmann.
München: Beck.
Brock, Bazon (2011): „Bildstörung und Bildersturm“, in: Brigitte Franzen (hg.): Nie
wieder störungsfrei! Aachens Avantgarde seit 1964. Bielefeld: Kerber, S. 40-41.
Franzen, Brigitte (Hg.) (2011): Nie wieder störungsfrei! Aachens Avantgarde seit 1964.
Bielefeld: Kerber.
Kölner Stadtanzeiger (1964): „Hochschul-Skandal – Würdeloser Klamauk in Aachen
als Feier zum 20. Juli“, in: Kölner Stadtanzeiger, 25./26.07.1964, hier nach dem
faksimilierten Abdruck in Oellers/Spiegel (1995), o.S.
Kramer, Sven (1999): „Zusammenstoß in Princeton – Peter Weiss und die Gruppe
47“, in: Stephan Braese (Hg.): Bestandsaufnahme – Studien zur Gruppe 47. Berlin:
Schmidt, S. 155-174.
Kreusch, Peter (1964): „Mehr Sandkästen als Honnef“, in: SPOTS, II/1964, o.S.
Oellers, Adam C./Spiegel, Sibille (Hg.) (1995): „Wollt ihr das totale Leben?“ Fluxus und
Agit-Pop der 60er Jahre in Aachen. Aachen: Neuer Kunstverein.
Padover, Saul (1999): Lügendetektor – Vernehmungen im besiegten Deutschland 1944/45.
Frankfurt a.M.: Eichborn.
Pickshaus, Peter Moritz (1988): Kunstzerstörer – Fallstudien: Tatmotive und Psycho-
gramme. Reinbek bei Hamburg: Rowohlt.
REVUE (1964): „Aachen, am 20. Juli“, in: Revue, 09.08.1964 [hier nach dem faksi
milierten Abdruck in Oellers/Spiegel (1995)], o.S.
Sellenthin, H.G. (1964): „Griechischer ‚Stellvertreter‘“, in: Aachener Nachrichten,
22.04.1964, S. 4.
Sölle, Dorothee (1964): „die gutgemeinte panne“, in: Aachener prisma, 11/1964, S. 16-17.
Spiegel, Dietmar (1964): „Staunen und Schrecken im Audi-Max – Protokoll“, in: SPOTS,
II/1964, o.S.
Vigener, Manfred (2001): Was war los in Aachen 1950-2000. Erfurt: Sutton.
Weiss, Peter (1982): Notizbücher 1960-1971. Frankfurt a.M.: Suhrkamp.
Zeit, Die (1964): „Ein Professor wurde geschlagen …“, in: Die Zeit, 31.07.1964.
Stephan Braese - 9783846764305
Downloaded from Brill.com10/26/2021 05:48:50AM
via free accessSie können auch lesen