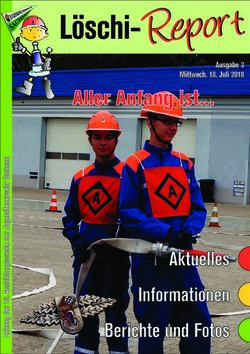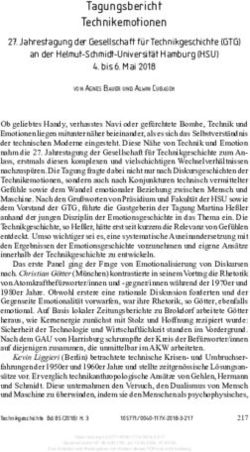Sonderdruck - Zeitschrift für Germanistik Neue Folge
←
→
Transkription von Seiteninhalten
Wenn Ihr Browser die Seite nicht korrekt rendert, bitte, lesen Sie den Inhalt der Seite unten
Zeitschrift für Germanistik
Neue Folge
XXX – 1/2020
Herausgeberkollegium
Ulrike Vedder (Geschäftsführende Herausgeberin, Berlin)
Alexander Košenina (Hannover)
Mark-Georg Dehrmann (Berlin)
Claudia Stockinger (Berlin)
Gastherausgeberin
Christiane Holm (Halle)
Sonderdruck
PETER LANG
Internationaler Verlag der Wissenschaften
Bern · Berlin · Bruxelles · New York · Oxford · Warszawa · WienBesprechungen | 213
im Deutschen – keinen Unterschied zwischen den Spätauf klärern Kant, Jefferson, Schiller,
Glück (happiness: die Erfahrung der unmorali- Robespierre, um nur einige bedeutende post-Les-
schen oder moralisch gleichgültigen Freiheit – die sing’sche Diskursivitätsbegründer zu nennen. Ins-
happiness eines Bankräubers) und Glückseligkeit gesamt zeigt Arend eine bemerkenswerte Vorsicht
(Autonomie oder Freiheit von jedem äußerlichen gegenüber der Schule, die leichtfertig meint, dass
oder innerlichen Zwang – die Glückseligkeit Kants wiederholte Kritik an den Eudämonisten
eines sterbenden Sokrates oder die Freiheit in der seiner Zeit gleichbedeutend damit sei, dass die
Erscheinung von Schillers „Freund, geprüft im Glückseligkeitsphilosophie schon zur Zeit Kants
Tod“)2 gibt. Es wäre zu wünschen gewesen, dass (und Humes) überholt gewesen wäre. Weit davon
der politische Höhepunkt des „Zeitalter[s] der entfernt.
Glückseligkeit“ (S. 12), die Revolutionen in Nord- Abschließend bleibt es, die gesellschafts- und
amerika und Frankreich und die Philosophie von bildungskritische Signifikanz einer so wichtigen
deren gemeinsamen Zeitgenossen, am Ende doch Begriffsgeschichte wie die dieses Buches zu beto-
noch zur Sprache gekommen wäre, zumindest nen, das ironischer Weise bald keiner mehr im re-
kurz. Doch Arend hält Wort, „die Aufklärer [die] publikanischen Abendland wird verstehen können,
auf je eigene Weise an der Geschichte mitschrei- wenn die Glückseligkeit – die ,,Bestimmung des
ben“ und Gestus sowie Ziele, mit denen sie „an Menschen“ des jungen Schiller (NA 20, 11) – nicht
dieser partizipieren“ (S. 12 f.), methodologisch wieder neben dem modernen Glücksbegriff in der
klar und in einem kohärent zu lesendem Narrativ politischen und bildungspolitischen Tagesordnung
vorzustellen, und kurzum die „ästhetisch-rhetori ernst genommen wird.
sche Faktur“ der Aufklärer durch diejenigen ihrer
Vorgänger zu erläutern. Eines der (zahlreichen)
großen Verdienste ist die komplexe Darstellung Anmerkungen
der Entwicklung der Glückseligkeitstheorie. Die
christliche Glückseligkeitstheorie leitete sich recht 1 Friedrich Schiller: Werke. Nationalausgabe, Bd. 21:
Philosophische Schriften, Teil II. Unter Mitwirk.
unlogisch (da das diesseitige Glück außer Acht
v. Helmut Koopmann hrsg. v. Benno von Wiese,
gelassen wird) vom antiken griechischen Konzept Weimar 21987, S. 311. Im Folgenden: NA.
her, fand in einem dann wieder nachvollziehba- 2 NA, Bd. 1: Gedichte in der Reihenfolge ihres
reren Übergang zurück zum Naturgesetz und zu Erscheinens. Hrsg. v. Julius Petersen, Friedrich
den vernünftigeren Thesen der Deisten, Atheisten Beißner, Weimar 21992, S. 171.
und modernen Republikanern. In erster Linie
gelingt es Arend, eine seit langem bestehende Jeffrey L. High, Luke Beller
Lücke zu beheben und eine nicht nur desiderate, California State University
sondern auch unverzichtbare Begriffsgeschichte Department of Roman, German, Russian
zu liefern, die leider dort aufhören muss, wo die German Studies
Arbeit der Frühaufklärer in Sachen Glückseligkeit Long Beach, USA
endlich moralphilosophische und politische Di-
mensionen erreichte: nämlich bei deren Lesern,
Joel L ande
Persistence of Folly. On the Origins of German Dramatic Literature. Cornell University Press,
Ithaca 2018, 354 S.
Die im Jahr 1737 durch Karoline Neuber auf noch immer nicht ganz zu Ende gedeutet ist, weil
einer Leipziger Bühne inszenierte Verbannung des es undokumentiert blieb. Klarheit besteht immer-
Harlekins gehört zu den ominöseren Ereignissen hin darüber, dass die Aktion der Konkurrenz
der deutschen Literaturgeschichte, das auch darum mit dem populären Harlekin-Darsteller Joseph
Peter Lang Zeitschrift für Germanistik, Neue Folge XXX (2020)214 | Besprechungen
Ferdinand Müller entsprang, wie etwa bei Daniela Problemlagen kennt und eingehend reflektiert, die
Weiss-Schletterer oder Bärbel Rudin nachzulesen Existenz ihres Untersuchungsgegenstands aber
ist.1 Was aber stand dabei ästhetisch auf dem Spiel? nichtsdestoweniger souverän behauptet. Ihr Vorge-
Welche theatralische Welt wurde damit bekämpft, hen scheint zunächst paradox: nämlich close reading.
und wie wirkte sich dieser Kampf auf die deutsche Schließlich haben die englischen Komödianten im
Komödie aus? Bei dem Versuch, die theatralische 17. Jahrhundert trotz alledem ganze fünf Bände von
Arbeit der Wanderbühne in die Geschichte der Komödien publiziert – faszinierendes Material, das
deutschen Literatur einzuschreiben, sieht sich von Manfred Brauneck wieder herausgegeben wur-
die Forschung mit systematischen Problemen de, bislang jedoch leider weitgehend unter dem Ra-
konfrontiert: So war die Publikation von Texten dar der Literaturgeschichtsschreibung geblieben ist.2
für die auf musikalische und tänzerische Einla- Am Gegenstand dieser Lektüren gewinnt Lande ein
gen spezialisierten englischen Komödianten und Verständnis dafür, wie sich die ästhetischen Praxis
ihre Nachfolger zweitrangig, unter Umständen der komischen Person des 17. Jahrhunderts zu einer
ökonomisch sogar kontraproduktiv. Zwischen Text stabilen literarischen Form ausprägt hat, und unter
und Performance klafft bei der Wanderbühne also der Voraussetzung dieser Formanalyse kann Lande
noch ein Abgrund, und dies hat sich analytisch auf die in der Forschung existierenden Problemlagen
im Auseinanderfallen von Theatergeschichte und erfrischend klare Antworten geben: Mit den mora-
Dramenanalyse niedergeschlagen. Ihre Stoffe lie- lisch funktionalisierten Narren des Fastnachtsspiels
hen sich die Komödianten zudem von den renom- habe die komische Person der in Deutschland tou-
mierten Autoren des elisabethanischen Theaters, renden englischen Truppen nichts mehr zu tun, vom
die sie bis zur Unkenntlichkeit deformierten. Die clown des elisabethanischen Theater unterscheidet
dabei entstandenen Spieltexte scheinen nurmehr sie sich aber ebenfalls fundamental, nicht zuletzt
Spuren der eigentlichen Aufführung aufzuwei- deshalb, weil die Sprachbarriere die Schauspieler zu
sen, und sie können kaum Originalitätsanspruch permanenten performativen Innovationen nötigte.
erheben. Schwierigkeiten bereitet aber auch die Und ebenso klar unterscheidet Lande seinen Gegen-
Tatsache, dass es sich bei den „Englischen Komödi- stand von der commedia dell’arte und dem Erfolg
anten“ des 17. Jahrhunderts zunächst nicht um eine ihres Harlekins insbesondere in höfischen Kreisen,
genuine Angelegenheit der deutschen Literatur ungeachtet dessen, dass Hanswurst und Harlekin zu
zu handeln scheint, zumal der Import sowohl der Beginn des 18. Jahrhunderts weitgehend synonym
commedia dell’arte als auch des elisabethanischen als Bezeichnung der komischen Figur verwendet
Theaters verglichen mit den Ursprungskontexten wurden (S. 97).
in deutscher Sprache auf den ersten Blick keine Landes zentrale literaturhistorische These geht
Produkte von gleichwertigem Rang gezeitigt hat. aber über die synthetische Kraft dieser Formana-
Hinzu kommt die Vielgestaltigkeit der komischen lyse hinaus: Die komische Figur der deutschen
Figur: Sind Hanswurst und Harlekin im 18. Jahr- Literatur sei, so Lande, im 18. Jahrhundert eben
hundert dieselben, und wer ist ihnen gegenüber nicht von der Theaterbühne verschwunden. Ihre
der Pickelhering des 17. Jahrhunderts? Wie also diversen Transformationen hätten im Gegenteil
lässt sich die Existenz eines einzigen ästhetischen Entscheidendes zur Etablierung eines literarischen
Prinzips nachweisen, wenn die komische Figur in Dramas in deutscher Sprache beigetragen. Diese
der Schauspielpraxis von unterschiedlichen Ak- Argumentation entfaltet sich folgendermaßen:
teuren doch immer wieder neu erfunden, mit der Im alles entscheidenden ersten Kapitel The Fool
individuellen Signatur des jeweiligen Schauspie- at Play: Comic Practice and the Strolling Players
lers versehen wurde und unendlich viele Namen handelt Lande nicht nur die komplexen Voraus-
kannte? Kein Wunder also, dass der fool in diesem setzungen und epistemischen Hindernisse zur Er-
Sinne, als komische Figur der modernen deutschen forschung der Figur ab, sondern er analysiert auch
Literatur, noch kaum erforscht wurde – seine eine Reihe der von den Komödianten publizierten
literarische Existenz könnte mit guten Gründen Stücke und charakterisiert dabei die ästhetische
angezweifelt werden. Logik der sie beherrschenden komischen Figur, die
Nun ist es Joel L ande s Studie The Persiten- insbesondere in ihrer liminalen Position und der
ce of Folly hoch anzurechnen, dass sie all diese fluiden Transgression der zwei kommunikativen
Zeitschrift für Germanistik, Neue Folge XXX (2020) Peter LangBesprechungen | 215
Achsen (intern/extern: Dialog auf der Bühne und autochthoner Traditionen u. a. durch Herder und
mit dem Publikum) sowie in der spezifischen Flögel kann sich Lande in Teil IV, The Vitality of
Temporalität (Punktualität, Episodizität, Extem- Folly in Goethe’s Faust and Kleist’s Jug, schließlich
poralität) ihres komischen Spiels bestehe. Teil II, der bis dato auffallend knapp ausfallenden Dra-
Fabricating Comedy and The Fate of the Fool in menanalyse widmen. In diesen Lektüren erweist
the Age of Reform, zeichnet dann die Verbannung sich dann der von der Studie erzielte Erkenntnis-
des Harlekins im Kontext des Gottsched’schen gewinn, denn die zuvor profund aufgefächerte
Reformprogramms und seiner hygienischen Logik Geschichte und Formcharakteristik der komischen
(„hygenic logic“, S. 140) nach. Lande versteht die Bühnenperson schärft den Blick für die Funktion
Verbannung des Harlekins als Ursprungsmythos des Komischen in der Analyse der beiden kano-
der deutschen Literatur, die seit Gottsched als nischen Dramen erheblich. Mephistopheles im
Resultat einer Feedbackschleife von regelmäßiger Faust und Adam im Zerbrochenen Krug, die Lande
Autorschaft und regulierender Kritik konzipiert zielsicher als Reinkarnationen der lustigen Person
worden sei. Zentrales Argument ist hierbei, dass ausmacht, teilen mit dieser nicht nur ihre mondäne
der Ausschluss der Narrenfigur überhaupt erst Orientierung an der Befriedigung sinnlichen Be-
die Einheit der Gattung Komödie ermöglicht gehrens, sondern insbesondere formal ihre liminale
habe. Die komische Figur bedrohte Lande zufolge Position im dramatischen Figurenensemble, die
allerdings nicht nur die generische Ordnung und, doppelte Adressierung von anderen Figuren und
wie zu erwarten wäre, die moralischen Absich- Publikum gleichermaßen sowie die Position der
ten der Reformbühne, sondern seine spezifische heimlichen Regieführung. Beide Dramen erweisen
Temporalität habe auch die Notwendigkeit der sich zudem ohne große Mühe als Zwittergebilde
syntagmatischen Kontinuität der komödiantischen zwischen Tragödie/Komödie. Dass der Narr oder
Narrative sabotiert. Dass die Disziplinierung das Närrische – verstanden nicht als Charakter,
des komischen Spiels nämlich auch für die auf sondern als ästhetisches Prinzip – selbst in der
Finalität abstellenden Handlungskonzeptionen deutschen Klassik noch das Salz in der Suppe oder
der Frühaufklärung wesentlich war, zeigt sich – wie es bei Gryphius heißt – die Bratwurst auf
besonders markant bei der Analyse von Johann dem Sauerkraut ist, hat Lande damit eindrucksvoll
Elias Schlegels Der geschäftige Müßiggänger (1741). demonstriert.
Bereits hier wird deutlich, dass der Narr nicht Für die Rettung der komischen Person liegt
einfach verschwunden ist, sondern durch die in seiner Nobilitierung durch Goethe und Kleist
Beschränktheit und Belehrbarkeit des Menschen indes auch ein Problem: Mit den Schlusskapiteln
insgesamt ersetzt wurde: Der Narr wird zu der wird zwar der Untertitel der Studie, On the Ori-
jeder Komödienfigur innewohnenden Fehlbarkeit. gins of German Dramatic Literature, eingelöst.
Teil III, Life, Theater, and the Restoration of the Während der Beitrag des Narren zur Entwick-
Fool, zeigt schließlich, dass die Verbannung der lung der deutschen Literatur am Ende der Studie
komischen Person nie wirklich vollständig voll- sichtbar geworden ist, haben die dabei erbrachten
zogen wurde, sondern im Gegenteil vom Gegen- Verluste jedoch wieder an Kontur verloren. Die
stand der ästhetischen Disziplinierung zu ihrem teleologische Zuspitzung auf die global bedeut-
Agenten umfunktionalisiert werden konnte, und samen Dramen um 1800 verbannt die historische
zwar insbesondere im Kontext der entstehenden Vielfalt der lustigen Person und ihrer ästhetischen
Polizeiwissenschaft. Dies zeigt Lande etwa am Praxis in Landes Studie schließlich auch wieder
Beispiel von Justus Mösers vieldiskutierter Schrift dorthin, woraus sie eigentlich befreit werden soll-
Harlekin, oder Vertheidigung des Groteske=Komi- te: in die Position des Supplements, ins exotische
schen (1761), die ihre Sprengkraft als Kombination Abseits der Literaturgeschichte.
rhetorischen und polizeilichen Wissens entfaltet Schwerer dürfte indes ein anderer Einwand
habe. Vermittelt über Lessings umfassende Re- wiegen. Wenn Lande im dritten Kapitel an einer
evaluierung des Komischen, die Entdeckung der eindrucksvollen Fülle von Material die Funktion
Komödie als privilegierter Agentin für die Dar- des Narren und seines Spiels für die von der histo-
stellung der konkret-materiellen Welt und damit rischen Polizeiwissenschaft propagierte Steigerung
auch für die Revitalisierung nationalkulturell der Arbeitsproduktivität diagnostiziert, so wäre
Peter Lang Zeitschrift für Germanistik, Neue Folge XXX (2020)216 | Besprechungen
anzumerken, dass dieser ökonomische Kontext der es vermeidet, dass die existierenden epochalen
bereits zur Geburtsstunde der modernen komi- Zäsuren in einer Zensur der historiografischen
schen Figur gehört. Diese betritt – etwa als Jahn Ref lexion resultieren, ist Lande eindrucksvoll
Posset in den Stücken Jakob Ayrers – die Bühne gelungen. In Erinnerung gerufen ist damit die
um 1600 eben nicht, wie Lande behauptet, als fundamentale Funktion der Dialektik von Komik
„comic servant“ (S. 55), sondern als freier Arbeiter, und Komödie für die nicht selten als allzu ernst
der mit seinem Arbeitgeber einen Arbeitsvertrag verschriene deutsche Literatur.
aushandelt. Dass der Pickelhering im 17. Jahr-
hundert nicht nur Anhänger, sondern auch viele
Feinde hatte, liegt ursächlich daran, dass er die Anmerkungen
damit einhergehende ökonomisch-soziale Ent-
bindung repräsentiert. Anregungen hätte hierfür 1 Daniela Schletterer: Die Verbannung des Harlekin
die insbesondere von Rudolf Münz vertretene – programmatischer Akt oder komödiantische In-
apokryphe Linie der Theatergeschichte liefern vektive? In: Frühneuzeit-Info 8 (1997), S. 161–169;
können.3 Dass Lande die Fabel der Komödien Bärbel Rudin: Venedig im Norden oder: Harlekin
und damit auch die ökonomische Dimension der und die Buffonisten. Die Hochfürstl. Braunschw.
Figur weitgehend marginalisiert, ist wohl ein wohl Lüneb. Wolffenbüttelschen Teutschen Hof-Acteurs
kaum vermeidbarer Effekt der gut begründeten (1727–1732). Reichenbach i. V. 2000.
Form-Konzentration seiner Studie. An ihr mag 2 Manfred Brauneck, Alfred Noe (Hrsg.): Spieltexte
der Wanderbühne. 5 Bde. Berlin u. a. 1970–1999.
es ebenso liegen, dass die subversive Rolle, die
3 Rudolf Münz: Das „andere“ Theater. Studien über
der Narr gegenüber Geschlechterordnungen ein- ein deutschsprachiges teatro dell´arte der Lessing-
nimmt, wie u. a. die Arbeiten von M. A. Katritzky zeit. Berlin 1979.
gezeigt haben, unerwähnt bleibt.4 4 M. A. Katritzky: Women, Medicine and Theatre
Das Projekt und Verdienst von Persistence of 1500–1750: Literary Mountebanks and Performing
Folly besteht aber nicht in der allumfassenden Quacks, Aldershot u. a. 2007.
Darstellung der modernen Komödiengeschichte,
sondern in der Behauptung eines sehr spezifischen Roman Widder
Gegenstands in seiner genuinen ästhetischen Qua- Humboldt-Universität zu Berlin
lität sowie in der Darstellung seiner historischen Sprach- und literaturwissenschaftliche Fakultät
Beharrlichkeit. Die umstrittene Geschichte der Institut für deutsche Literatur
komischen Figur des 17. und 18. Jahrhunderts in D–10099 Berlin
einem konsistenten Zusammenhang zu erzählen,
Friedrich Vollhardt
Gotthold Ephraim Lessing. Epoche und Werk. Wallstein Verlag, Göttingen 2018, 490 S.,
12 Abb.
Nicht wenige Leserinnen und Leser werden sich das grundlegende, bei Metzler erschienene Lessing
die Frage stellen, ob Friedrich Vollhardts fast Handbuch von Monika Fick, das seit 2016 in der
500 Seiten umfassende Lessing-Werkbiographie vierten Auflage vorliegt.2 Erwähnt werden muss
mehr als eine Liebesmühe ist. Schließlich stehen aber in erster Linie die umfassende Lessing-Bio-
bereits zahl- wie hilfreiche Arbeiten zur Verfügung, graphie von Hugh Barr Nisbet. Sie wurde 2008
die je nach konkretem Rezipientenbedürfnis bei C. H. Beck publiziert3 und zurecht vom Ver-
vorbildlich über Lessings Werk, Leben und Zeit lag als „Die erste große Lessing-Biographie seit
informieren. Das gilt für die kleine Lessing-Bio- fast 100 Jahren“ beworben. Sie ist ausgesprochen
graphie, die Vollhardt selbst erst 2016 in der zuverlässig und umfangreich. Warum also eine
Beck’schen Reihe vorgelegt hat1 ebenso wie für zweite Lessing-Biographie?
Zeitschrift für Germanistik, Neue Folge XXX (2020) Peter LangSie können auch lesen