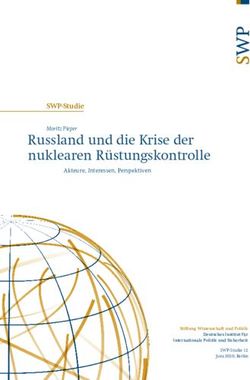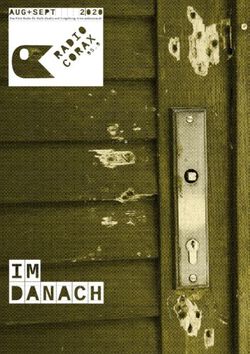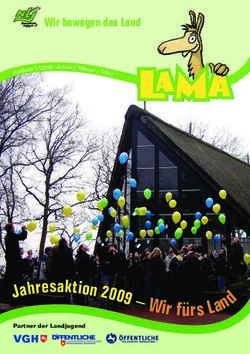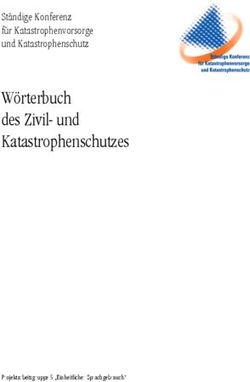Spätlese Das Magazin für aufgeweckte Seniorinnen und Senioren - Berlin.de
←
→
Transkription von Seiteninhalten
Wenn Ihr Browser die Seite nicht korrekt rendert, bitte, lesen Sie den Inhalt der Seite unten
Ausgabe September - Oktober 2019
Spätlese
Das Magazin für aufgeweckte Seniorinnen und Senioren
71. Ausgabe der Spätlese
Liebe Seniorinnen und Senioren, liebe
Leserinnen und Leser!
Auch die vorliegende Herbstausgabe der
„Spätlese“ widmet dem 40jährigen Bestehen
des Bezirkes Marzahn-Hellersdorf noch
einmal den gebührenden Platz. Unsere
Bezirksbürgermeisterin Dagmar Pohle
beantwortet in einem Interview für den
Rundfunksender rbb 88,8 die Fragen von
Journalistenkollegen Ingo Hoppe zu den
guten und den schlechten Zeiten in der
„Viele kleine Leute in vielen kleinen Orten,
Geschichte von Marzahn-Hellersdorf.
die viele kleine Dinge tun, können das
An ein anderes Jubiläum in unserem Bezirk
erinnert Ursula. A. Kolbe, nämlich an den Gesicht der Welt verändern.“
aus Afrika
125.Geburtstag des Malers Otto Nagel, der
bis zu seinem Tode im Jahre 1967 in Biesdorf
lebte. In einem anderen Beitrag stellt die
Autorin die diesjährige Kunstmesse Art Week Mit einem Schmunzeln auf den Lippen nimmt
vor. Im Rahmen der Berlin Art Week werden Kathrain Graubaum vom Halberstädter
im September hunderte von Galerien neue Literaturmuseum einen Scherz-Keks in den
künstlerische Positionen vorstellen. Fokus: Anläßlich des 300. Geburtstags des
Ursula A. Kolbe lädt die Leserinnen und Dichters Johann Wilhelm Ludwig Gleim
Leser aber auch ins Ermelerhaus am beschäftigt sich der Beitrag mit der heiteren
Märkischen Ufer ein, wo Anfang Oktober eine Seite der Aufklärung.
Party der Erinnerungen gefeiert wird. Wer Unser Reporter Günter Knackfuß war wieder
noch hat, kann da seine Zeche sogar noch zu unterschiedlichen touristischen Terminen
mit DDR-Mark begleichen. Hans-Jürgen unterwegs: So folgte er ein letztes Mal der
Rudolf informiert über die letzte Sitzung des Spuren Theodor Fontanes im näheren Umland
Welterbe-Komitees der Unesco, die das von Berlin; in Lübben/Spreewald wohnte er
Erzgebirge, das historische Bergbaugebiet in dem Deutschen Trachtenfest bei und in
Sachsen und Böhmen in Tschechien auf Mecklenburg-Vorpommern verbrachte er die
seiner Sitzung in Aserbaidschan in die Liste Nacht der nordischen Guts- und Herrenhäuser.
schützenswerten Erbes der Welt aufnahm. Zu guter Letzt nehme ich Sie mit in ein
Außerdem stöberte er in der Geschichte des Erlebnisdorf im niederösterreichischen
Automobilbaus und stieß auf die Tatsache, Mostviertel – in die Schmiedegemeinde
dass Opel vor 120 Jahren das erste Auto Ybbsitz. Hier begegnet man der starken
baute.„Vom Genie zum armen Schlucker“, mit Tradition des Schmiedehandwerks im Einklang
diesen Worten könnte man den Beitrag mit einem sanften Tourismus.
unseres Autors Tristan Micke zusammen- Diese Vielfalt der Herbstausgabe will das
fassen. Auf informative Weise beleuchtet sein Redaktionsteam auch weiterhin „am Glühen
Artikel den 250. Geburtstag Alexander von halten“.
Humboldts aus einem interessanten Blick- Ihr Hans-Jürgen Kolbe
winkel.Inhaltsverzeichnis
„Marzahn-Hellersdorf ist ein sehr dynamischer Bezirk“ ...........3
Vom Blick zurück ins Heute und Morgen ..................................5
Jahrestage 2019 – September/Oktober......................................7
Otto Nagel und sein 125. Geburtstag ..........................................8
Erzgebirge ist Weltkulturerbe.....................................................9
Das erste Auto feiert Geburtstag............................................... 10
Zum 250. Geburtstag Alexander von Humboldts..................... 12
Zeitgenössische Kunst wieder im Berliner Fokus..................... 14
Ein „Scherz-Keks“ im Fokus .....................................................16
Trachten und Musik – ein Fest für die Sinne ........................... 18
Party der Erinnerungen im Ermelerhaus ................................. 19
Letzte Spur FONTANE ..............................................................21
„Ein Schmied, ein Schlag, ein Gulden“... ..................................22
MitsommerRemise – ein Rückblick .........................................24
Herbst ........................................................................................ 27
Reiseführer Slowenien ..............................................................28
Die berühmteste Klappbrücke der Welt................................... 28
www.magazin-spätlese.net ! von 29
2 !Aus dem Bezirk
„Marzahn-
Hellersdorf ist ein
sehr dynamischer
Bezirk“
von Ingo Hoppe
Foto: rbb24/Marat Zakirov Marzahn-Hellersdorf wächst seit einigen
Bezirksbürgermeisterin Dagmar Pohle Jahren - das birgt Konflikte.
Bezirksbürgermeisterin Dagmar Pohle (Linke)
sagt im Interview mit Ingo Hoppe für den rbb 88,8, warum der Bezirk altert, warum es dort viele
Hartz-IV-Empfänger gibt - und über welche Klischees sie sich aufregt.
Ingo Hoppe: Frau Pohle, wir haben mal rumgefragt bei den Menschen, die in Ihrem Bezirk
leben - und die haben oft gesagt: Was uns stört, ist die schlechte Verkehrsanbindung. Die S-
Bahn fährt nicht häufig genug. Kann man daran noch ein bisschen was drehen?
Dagmar Pohle: Ja, wir sind dazu mit der BVG und der Bahn im Gespräch, weil wir merken, dass
Straßenbahnen, Busse und S-Bahnen voll sind. Als Außenbezirk sind wir darauf angewiesen, dass
möglichst viele Menschen mit den Öffentlichen fahren. Dazu kommt, dass auch viele aus
Brandenburg hier bei uns ihr Auto abstellen, manchmal auch an Stellen, wo es uns nicht so recht
ist, und dann öffentlich weiterfahren. Deshalb brauchen wir einfach einen dichteren öffentlichen
Personennahverkehr.
Ingo Hoppe: Wenn man die Menschen in Marzahn-Hellersdorf fragt, wie sie sich fühlen, ist
deren Stimmung viel besser als das Image des Bezirks...
Dagmar Pohle: Ja, das ist so, das erlebe ich seit vielen Jahren. Alle Versuche, die wir bisher
unternommen haben, das mal zu ändern, sind noch nicht wirklich gelungen.
Ingo Hoppe: Die Gärten der Welt haben auch nichts gebracht?
Dagmar Pohle: Das ist genauso: Wenn ich Menschen treffe, die noch nie dort waren, und ich ihnen
sage: 'Geht doch mal hin.' - dann sagen sie nachher immer: 'Das ist ja toll - warum sind wir nicht
schon eher hingegangen!' Das soll jetzt keine Journalistenschelte sein, aber ich habe immer das
Gefühl: Wenn jemand etwas über Marzahn-Hellersdorf recherchiert und alte Beiträge guckt,
findet er immer nur bestimmte Standardsätze, die die Klischees bedienen.
Ingo Hoppe: Plattenbauten zum Beispiel. Dabei gibt es da auch Unmengen Einfamilienhaus-
Siedlungen, das ist vielen gar nicht so bekannt.
Dagmar Pohle: Genau. Als jetzt gerade zum Sommerpausenstart etwas gealterte Architekten der
Meinung waren, man müsste in Buch neu bauen, war ein Satz dabei, der mich wirklich tierisch
aufgeregt hat: Es solle nicht zu einer Schlafstadt wie Marzahn-Hellersdorf werden. Da habe ich
gedacht: Hallo? Was ist denn das? Das hat mit uns gar nichts zu tun.
Ingo Hoppe: Die Bewohnerinnen und Bewohner, die wir befragt haben, beklagen auch
fehlende gute Spielplätze und zu wenig Schulen. Marzahn-Hellersdorf ist lange geschrumpft,
www.magazin-spätlese.net ! von 29
3 !jetzt wächst der Bezirk wieder. Sie ziehen auch Familien an, weil die Mieten nicht so hoch
sind. Schule ist ein Thema für Sie, oder?
Dagmar Pohle: Schule ist auf jeden Fall ein Thema. Ich will mal die Zahlen nennen: Anfang der
1990er Jahre haben in Marzahn-Hellersdorf 310.000 Einwohnerinnen und Einwohner gewohnt.
Dann sind wir geschrumpft bis 2004/05 auf 242.000 Einwohnerinnen und Einwohner - und jetzt
sind wir bei knapp 270.000. In der Zeit, als wir geschrumpft sind, standen Wohnungen leer,
brauchten wir nicht alle Schulen und Kindertagesstätten. 4.900 Wohnungen sind abgerissen
worden, aber eben auch viele Gemeinschaftseinrichtungen. Leerstehende Gebäude werden
zerstört, sind einfach in einem Kiez nicht zu ertragen, und es konnte nicht alles nachgenutzt
werden. Jetzt wären wir froh, wenn wir diese Gebäude noch hätten. Wir haben sie nicht - und
deshalb bauen wir auch neu. Die ersten neuen Schulen sind eröffnet, beziehungsweise werden
jetzt zum Schuljahresbeginn eröffnet - und wir müssen weitere Schulen bauen. Wir haben auch an
bestimmten Standorten Ergänzungsbauten in der Planung, die jetzt sukzessive umgesetzt werden.
Wir sind ja ein sehr dynamischer Bezirk in der Bevölkerungsentwicklung - und alle, die schon
lange dabei sind, wissen, dass es auch mal wieder weniger werden kann.
Ingo Hoppe: Im Moment altert der Bezirk, obwohl so viele Familien mit Kindern kommen oder
die jungen Einwohner Kinder bekommen.
Dagmar Pohle: Wir liegen über dem Berliner Durchschnitt. Jahrzehntelang, kann man fast sagen,
lagen wir deutlich drunter - jetzt liegen wir drüber. Das hat etwas damit zu tun, dass viele, die
wann auch immer in den Bezirk Marzahn-Hellersdorf kommen, sich hier wohlfühlen und auch
bleiben. Wer geht, sind die jungen Leute. Sie haben die Schule abgeschlossen, gehen in die
Ausbildung und zum Studium. Interessant ist für mich, die ja schon sehr lange im Bezirk lebt, dass
sie dann, wenn sie eine Familie gründen, wiederkommen. Ich finde, das spricht für den Bezirk.
Ingo Hoppe: Zu meiner Überraschung ist der Anteil von Hartz-IV-Empfängern doch sehr hoch
im Bezirk, es gibt auch viele Alleinerziehende, was ja oft damit einhergeht. Sind Sie nicht
überrascht?
Dagmar Pohle: Nein, ich bin nicht überrascht, weil ich natürlich die Situation in meinem Bezirk
kenne. Sie müssten noch eine andere Zahl des Bezirkes dazusetzen - und die macht auch das
Problem des Bezirkes deutlich, vor allen Dingen in unseren Großsiedlungen: Wir liegen unter dem
Arbeitslosen-Durchschnitt des Landes Berlin, wir haben die viertniedrigste Zahl der zwölf Bezirke.
Wir haben einen sehr hohen Anteil von Menschen, die erwerbstätig sind, deren Einkommen aber
nicht ausreichend ist und die deshalb auf weitere finanzielle Unterstützung angewiesen sind. Das
betrifft insbesondere Alleinerziehende: Familien mit ein, zwei, drei Kindern, aber nur einem
Einkommen. Da bedarf es Transferzahlungen. Es sind oft Arbeitstätigkeiten, mit denen sie nicht
gerade zu den Spitzenverdienerinnen und Spitzenverdienern gehören.
Ingo Hoppe: Die letzte Frage, die ich all ihren Kolleginnen und Kollegen stelle, ist die
Kristallkugel-Frage: Wo sehen Sie Ihren Bezirk in zehn Jahren?
Dagmar Pohle: Ich habe jetzt 40 Jahre Marzahn-Hellersdorf in unterschiedlicher Art und Weise
miterlebt und bin sehr optimistisch, dass der Bezirk weiterhin eine positive Entwicklung nimmt.
Zurzeit wird sehr viel gebaut. Wohnungsneubau, der zum Glück - und darauf achten wir sehr -
nicht dazu führt, dass unsere Grünflächen sich reduzieren oder dass wir Innenhöfe extrem
zubauen. Deshalb glaube ich, dass in zehn Jahren Marzahn-Hellersdorf ein sehr angesehener
Wohnort wird, in dem auch - wir haben nämlich sehr große Gewerbeflächen - die Wirtschaft sich
www.magazin-spätlese.net ! von 29
4 !weiterentwickelt. Damit müssen dann auch die Menschen gar nicht mehr so durch die Gegend
fahren, sondern sie finden auch Arbeit bei uns im Bezirk.
Vielen Dank für das Gespräch!
Das Interview führte Ingo Hoppe für rbb 88,8. Der Autor gestattete der „Spätlese“
freundlicherweise den Nachdruck dieser leicht gekürzten Fassung.
Aus dem Bezirk
Vom Blick zurück ins
Heute und Morgen
von Ursula A. Kolbe
In den vergangenen Wochen und Monaten zog
immer wieder ein Jubiläum die Aufmerksamkeit
Bild: Hans-Jürgen Kolbe
auf sich: Das 40jährige Jubiläum des Berliner
Stadtbezirks Marzahn-Hellersdorf, auf die
Titelseiten der Broschüren Gründung des Stadtbezirks Marzahns am 5. Januar
1979 und die Fusion mit dem Stadtbezirk
Hellersdorf am 1. Januar 2001, der am 1. Juni 1986 gegründet worden war. Seitdem entwickelt der
jüngste Bezirk eine besondere Dynamik. Vergegenwärtigen wir uns noch einmal kurz, dass das
Durchschnittsalter vor 40 Jahren bei 27 Jahren lag und es heute mit über 43,5 Jahren über dem
Berliner Durchschnitt liegt. Der älteste Stadtteil ist der rund um die Marchwitzastrasse, jüngster
ist der Stadtteil Hellersdorf – Nord. Heute leben rund 270.000 Menschen in Marzahn-Hellersdorf
als unseren Heimat- und Zukunftsort, wie es treffender Bezirksbürgermeisterin Dagmar Pohle mit
Blick auf das Jubiläum nicht ausdrücken konnte.
Und natürlich lag es nahe, dass für alle Einwohnerinnen und Einwohner und ihre Gäste zur
großen Geburtstagsfeier Mitte Juni in den Gärten der Welt diese Entwicklung festgehalten worden
ist: Das Bezirksamt hat seine Imagebroschüre „Berlins beste Aussichten“ verteilt, vom rührigen
Heimatverein des Bezirks Marzahn - Hellersdorf e. V. gab es die Broschüre „40 Jahre Marzahn-
Hellersdorf. Eine Chronik“:
Bezirksamts-Broschüre „Berlins beste Aussichten“
Das Bezirksamt Marzahn – Hellersdorf als Herausgeber hat in Zusammenarbeit mit der apercu
Verlagsgesellschaft mbH den Titel dieser Jubiläums-Broschüre nicht zufällig gewählt. Mit diesem
Slogan wirbt der Bezirk schon seit einigen Jahren für sich. Und dieses Exemplar ist ein weiterer
Mosaikstein, den über Jahrzehnte durch Vorurteile und Medienberichte beschädigten Ruf des
Bezirks zu verbessern. Aber die Entwicklung ist unaufhaltsam. Die zunächst eigenständigen
Bezirke Marzahn und Hellersdorf wuchsen schnell auf insgesamt über 300.000 Einwohner. Nach
der Wende aber sank die Zahl auf 230.000. Inzwischen nähert sie sich wieder der Marke von
270.000 an.
Es siedelten und siedeln sich Unternehmen an, und das ist auch der Schwerpunkt: Die
wirtschaftliche Entwicklung im Bezirk. Vorgestellt werden insgesamt 34 Firmen und
Unternehmen, die hier ihren Sitz oder wichtige Standorte haben. Jörg Franzen,
Vorstandsvorsitzender der Gesobau, z. B. stellt das Engagement der landeseigenen
Wohnungsbaugesellschaft im Bezirk vor. Sie begann mit einem Bestand von 120 Wohnungen. Bis
www.magazin-spätlese.net ! von 29
5 !2023 will sie im Bezirk rund 500 Millionen Euro investieren. Dabei sollen rund 2.800 Wohnungen
neu gebaut werden, rund 1.250 allein im und am Stadtgut Hellersdorf; die Hälfte davon mit
Fördermitteln und einer Miete von 6.50 Euro netto kalt pro Quadratmeter.
Tom Lüders ist der Geschäftsführende Direktor der Berlin.Industrial.Group (BIG), und seine
rasant wachsende Unternehmensgruppe setzt auf technische Innovationen für die industrielle
Produktion. Zu ihr gehören u. a. die Firmen Scansonic, Pionier der modernen Lasertechnologie,
und Gefertec, Schrittmacher bei der Nutzung von Druckverfahren in der Metallurgie. Die BIG zog
2015 von Weißensee auf ein fünf Hektar großes Grundstück am Boxhagener Ring. Sie hat
inzwischen rund 320 Mitarbeiter und strebt zweistellige Wachstumsraten an. Mit Berliner
Forschungseinrichtungen ist sie eng vernetzt. „Wir haben im Bezirk Platz für Wachstum gefunden
und Raum für Ideen“, so der BIG- Geschäftsführende Direktor.
Broschüre des Heimatvereins Marzahn – Hellersdorf e. V.:
„40 Jahre Marzahn – Hellersdorf. Eine Chronik“
Auch der Heimatverein hat es sich nicht nehmen lassen, zum 40. Gründungsjubiläum mit der
Chronik des Bezirks von 1973 bis 2018 seinen eigenen Beitrag beizusteuern. Sein Vorsitzender
Wolfgang Brauer hat es zum Ausdruck gebracht, als er im Vorwort hervorhob, das mit dieser
Chronik gezeigt werden soll, was hinter der Überschrift „40 Jahre Marzahn – Hellersdorf. Eine
Chronik“ steht.
Und weiter:“ Natürlich spielen die Baugeschichte vor und nach 1990 und die ihnen zugrunde
liegenden politischen Entscheidungen eine tragend Rolle. Aber das Entscheidende im Leben einer
Kommune – mit mittlerweile fast 270.000 Einwohnern handelt es sich um eine Großstadt, größer
als die Landeshauptstädte Magdeburg oder Kiel – sind die in ihr lebenden Menschen und die Art
und Weise, wie sie ihre Lebensumstände gestalten. Daher haben wir in diese Chronik auch die
wesentlichen Daten zur politischen Geschichte, zur Wirtschaftsgeschichte, zur Kulturentwicklung
und zur Gestaltung der infrastrukturellen und sozialen Einrichtungen einschließlich derer von
Gesundheitswesen und Gesundheitswirtschaft aufgenommen.“
Ja, der Bezirk ist ein Werk von vielen. Auch seine aufgeschriebene Geschichte kann nur das Werk
vieler sein. Diese vor uns liegende Broschüre ist ein lebendiger Beweis dafür und an dieser Stelle
gilt die besondere Wertschätzung den Autorinnen Dr. Christa Hübner, Dr. Renate Schilling und
dem dritten im Bunde, dem Autor Dr. Manfred Teresiak; alle drei Historiker und
Vorstandsmitglieder des Heimatvereins.
In aufwendigen Recherchen erarbeiteten sie die Chronik, die für viele Marzahner und
Hellersdorfer so manch Denkwürdiges in Erinnerung ruft. Der erste Eintrag beginnt mit dem
27. März 1973: „Das Politbüro des ZK der SED bestätigt eine Vorlage zur Entwicklung des
komplexen Wohnungsbaus in Ostberlin. Biesdorf-Nord wird als Standort für den Bau von 20.000
Wohnungen bis 1980 und 15.000 nach 1980 benannt.“…
Am 25. März 1983 heißt es: „Das Spree-Center in der Hellersdorfer Straße 77 – 83 wird als
erstes nach 1990 im Bezirk Hellersdorf errichtetes Einkaufszentrum eröffnet.“… 12. Mai 1994:
„An der Landsberger Allee/Allee der Kosmonauten wird der 21 Meter hohe Neubau einer
traditionellen Bockwindmühle nach Plänen der holländischen Firma Harrie Beijik eingeweiht. Aus
Anlass der Einweihung findet das erste Marzahner Mühlenfest statt. Am 5. Mai hatte sich der
Mühlenverein Berlin-Marzahn e. V. mit dem Ziel gegründet, den Betrieb und die bauliche
Erhaltung der Mühle zu unterstützen….
Ach, man vergräbt sich in den Inhalten. Überhaupt könnte über beide Broschüren auch an dieser
Stelle noch viel mehr geschrieben werden. Aber lesen Sie selbst, sind beide zusammen doch eine
Einheit. Wie es auch Bürgermeisterin Dagmar Pohle im Geleit zur Heimatverein-Broschüre
www.magazin-spätlese.net ! von 29
6 !schrieb: “Ich habe die Chronik mit Gewinn gelesen, mich an Manches erinnert, was mir entfallen
war, Neues entdeckt und erfahren und diese oder jene Erinnerung korrigiert auf Grund der
gründlichen Recherche und Darstellung…“
Was ich selbst nur bestätigen kann, lebe ich mit meiner Familie doch seit August 1980 in einer der
schönen Neubauwohnungen Marzahns.
Aus dem Bezirk
Jahrestage 2019 –
September/Oktober
von Kempen Dettmann
Die Geschichte der Dörfer Marzahn, Biesdorf,
Kaulsdorf, Mahlsdorf und Hellersdorf, die heute
Bild: Hans-Jürgen Kolbe den Stadtbezirk Marzahn-Hellersdorf bilden,
erweckt immer wieder das Interesse unserer Leser.
Heimatmuseum Marzahn-Hellersdorf in der ehemaligen
Dorfschule in Alt-Marzahn
Alle fünf Ortsteile gehörten einst zum Landkreis
Niederbarnim und wurden 1920 durch das Groß-Berlin-Gesetz nach Berlin eingemeindet. So ist es
auch seit mehreren Jahren zu einer guten Tradition geworden, dass der Heimatverein Marzahn-
Hellersdorf e.V. alljährlich ausgewählte Daten von Jahrestagen herausgibt. Es handelt sich um
eine Übersicht von wichtigen Jahres- und Gedenktagen, die den Bezirk betreffen. Denn Marzahn
und „seine Dörfer“ sind ja schon viel, viel älter als der jetzige Bezirk. Bedeutsame Ereignisse, die
Entstehung historischer Bauten, Geburts- und Todestage bekannter Persönlichkeiten des Bezirks
sind in dieser Zusammenstellung zu finden. Wir schauen in die Monate September und Oktober:
125 Jahre
Am 1. September 1894 wird der Kaufmann Alexander Scheuer geboren. Er lebt seit etwa 1926 in
Mahlsdorf und verlegt 1933 sein Woll-, Weiß- und Kurzwarengeschäft dorthin. Am 13. Januar
wird er in das Getto Riga deportiert, am 2. November 1943 ins Vernichtungslager Auschwitz
verbracht und dort ermordet. Am 3. September 2018 wird für ihn ein Stolperstein vor seinem
Haus in der Hönower Straße 213 verlegt.
Der Maler und Kulturpolitiker Otto Nagel wird am 27. September 1894 geboren. Von 1951 bis zu
seinem Tod 1967 lebt er in Biesdorf. 1968 wird die Königstraße nach ihm benannt, 1969 die
Polytechnische Oberschule in der Schulstraße in Biesdorf.
100 Jahre
Der Unternehmer Wilhelm von Siemens verstirbt am 14. Oktober 1919. Er ist seit 1889 Besitzer
des von seinem Vater zwei Jahre zuvor gekauften Rittergutes und Schlosses Biesdorf. Seit 2000
trägt das Gymnasium an der Allee der Kosmonauten seinen Namen.
75 Jahre
Der Widerstandskämpfer gegen das NS-Regime Hugo Härtig (KPD) aus Kaulsdorf wird am 11.
September 1944 im Zuchthaus Brandenburg hingerichtet.
60 Jahre
Am 10. Oktober 1959 wird im Schloss Biesdorf der erste Ostberliner Dorfclub eröffnet. Er verfügt
www.magazin-spätlese.net 7! von 29
!über einen Vortrags- und Konzertsaal, ein Fersehzimmer, eine Zweigstelle der Volksbücherei und
eine Bauernstube als Tagungsraum.
40 Jahre
Der VEB Elektroprojekt und Anlagenbau (EAB) verlagert am 14. September 1979 seinen Sitz in
die Marzahner Rhinstraße. Am 2. August 1990 wird aus Teilen des EAB die Elpro AG gebildet.
Eine Stele in Gestalt einer stilisierten Richtkrone wird am 24. Oktober 1979 an der
Marchwitzastraße aufgestellt. Sie erinnert an das Richtfest, das am 2. September 1977 für das erste
Gebäude der Großsiedlung Marzahn stattfand.
Am 4. Oktober 1979 wird die erste kommunale Poliklinik Marzahns am Helene-Weigel-Platz
fertiggestellt.
30 Jahre
Im FreizeitForum an der Marzahner Promenade 55 wird am 15. Oktober 1989 die Schwimmhalle
eröffnet.
Die U-Bahn-Linie 5 fährt seit 30 Jahren bis Hönow. Was heute selbstverständlich ist, war damals
ein Kraftakt, der durch den Bau der Großsiedlung Hellersdorf notwendig wurde.
20 Jahre
Am 11. September 1999 wird die ehemalige Dorfschule Marzahn als Bezirksmuseum (heute:
Bezirksmuseum Marzahn-Hellersdorf) eröffnet.
10 Jahre
Der Förderkreis „Freunde der Gärten der Welt“ gründet sich am 1. September 2009.
Aus dem Bezirk
Otto Nagel und sein
125. Geburtstag
von Ursula A. Kolbe
Der Berliner Künstler Otto Nagel, seit 1970
Ehrenbürger der Stadt, steht im Fokus des
Bild: Marcel Gäding/lichtenbergmarzahnplus.de „Initiativkreis Otto Nagel 125“, um seines 125.
Geburtstages am 27. September zu gedenken und
Dr. Klaus Freier, Juliane Witt, Dana Wolfram, Dr. Heinrich
Niemann (v.l.n.r.) vor dem Nagel-Bild „Wochenmarkt am sein Wirken als Maler, Publizist und
Gesundbrunnen“ im Erdgeschoss von Schloss Biesdorf Kulturpolitiker in den Blickpunkt der Öffentlichkeit
zu rücken. Dem Initiativkreis gehören der Verein „Freunde Schloss Biesdorf“, das Bezirksamt
Marzahn-Hellersdorf, das Otto-Nagel-Gymnasium, Familienangehörige, die beiden letzten noch
lebenden Meisterschüler des Künstlers, das Bezirksamt Berlin-Mitte und das DDR-Kunstarchiv
Beeskow an. Otto Nagel wurde am 27. September 1894 im Wedding geboren und lebte die letzten
15 Jahre seines Lebens in der Otto-Nagel-Straße in Biesdorf. Er hat die Berliner Kunstgeschichte
mit geprägt, war im künstlerischen und gesellschaftlichen Anspruch mit Käthe Kollwitz und
Heinrich Zille eng verbunden. So nahm er nach 1945 auch beim kulturellen Neuaufbau als
Präsident der Akademie der Künste in der DDR einen wichtigen Platz ein.
www.magazin-spätlese.net ! von 29
8 !Zahlreiche Ehrungen
Im Heino-Schmieden-Saal des Schlosses Biesdorf hatte Dr. Heinrich Niemann für den
Initiativkreis das Programm vorgestellt. So finden am 27. September zu Ehren Otto Nagels zwei
Festveranstaltungen statt: Vormittags ehren die Schülerinnen und Schüler des Otto-Nagel-
Gymnasiums ihren Namenspatron in der Aula ihrer Schule, verbunden mit der erstmaligen
Verleihung eines Otto-Nagel-Preises, berichtet Kunstlehrerin Dana Wolfram.
Abends findet eine festliche Begegnung im Schloss Biesdorf unter Mitwirkung der Enkelin Salka
Schallenberg und der Präsentation von Werken des Künstlers statt. Eine gute Idee ist auch, die
entsprechenden Straßenschilder in Biesdorf mit seinen Lebensdaten zu ergänzen.
Der Senat gedenkt an diesem Tag des Künstlers an seinem Ehrengrab auf dem Zentralfriedhof in
Friedrichsfelde. Am 20. Oktober gibt es eine Stadtrundfahrt zu den Stätten des Lebens und
Wirkens von Otto Nagel in Berlin. Darüber hinaus finden Vorträge, Lesungen und Führungen
statt. Der Verlag Frey hat als „Wedding-Bücher 1 + 2“ zwei Bücher zu Otto Nagel neu aufgelegt.
Würdigung vom Meisterschüler
Übrigens war auch der 85jährige ehemalige Meisterschüler Ronald Paris mit seiner Frau Isolde
aus Rangsdorf ins Schloss Biesdorf gekommen, um mit ein paar Erinnerungen aus den 60er
Jahren an die Zeit mit seinem Lehrer zu dessen Lebenswerk beizutragen. So z.B., als er das alte
Berlin in den 20er und 30er Jahren in seinem Weddinger Atelier gemalt hat: den Briefträger, die
Nutte vom Nettelbeckplatz oder den Budiker von der Ecke. In all den Gesprächen mit den
Schülern sei Nagel immer gerade, offen für alle gewesen, sagte Paris. Immer habe er die
Verbindung zu den einfachen Menschen gesucht. Sein Anliegen sei gewesen, das, was man sehe
und erlebe, direkt wiederzugeben, die direkte Betroffenheit des Gegenwärtigen. Dr. Klaus Freier,
der stellvertretende Vorsitzende des Vereins „Freunde des Schloss Biesdorf“, betonte, eines der
langfristigen Ziele sei es, das künstlerische Schaffen Otto Nagels dauerhaft zu zeigen. Das sei noch
ein sehr langer Weg. Kulturstadträtin Juliane Witt sieht in dem Projekt „Otto Nagel 125“ einen
Impuls, der in die Welt hinaus getragen wird.
Politik, Wirtschaft, Soziales
Erzgebirge ist
Weltkulturerbe
von Hans-Jürgen Rudolf
Erzgebirge/Krušnohoří als Weltkulturerbe
anerkannt. So lautete die Erfolgsnachricht. Das
Bild: epd Komitee der Unesco nahm das historische
Bergbaugebiet in Sachsen und Böhmen in
Bergleute im Bergbaumuseum Tschechien auf seiner letzten Sitzung in
Aserbaidschan in die Liste schützenswerten Erbes der Welt auf. Diese von den beiden Ländern
nominierte Stätte sei von universellem Wert. Delegierte sprachen von einem „Meisterwerk
menschlicher Kreativität“.
Kooperation von Tschechien und Deutschland
Die Region wollte eigentlich schon vor wenigen Jahren das Unesco-Siegel erhalten. Nach
Bedenken des Weltdenkmalrats (Icomos) wurde die Bewerbung aber zurückgezogen und
www.magazin-spätlese.net ! von 29
9 !überarbeitet. Nun klappte es nach 20 Jahren auf der Vorschlagsliste für den Welterbe-Titel.
Die Region bewarb sich auf sächsischer Seite mit 17, auf tschechischer Seite mit 5 Bestandteilen
um den Titel. Die ausgewählten Denkmäler, Natur- und Kulturlandschaften repräsentieren als
Zeugen einer 800-jährigen Geschichte die wichtigsten Bergbaugebiete und Epochen des
sächsisch-böhmischen Erzbergbaus. Hinter dem Antrag stehen drei Landkreise sowie 32 Städte
und Gemeinden, die sich in einem Verein zusammengeschlossen haben, um das Erzgebirge zum
Welterbe zu machen.
Die Menschen – seit Jahrhunderten das Pfund der Region Erzgebirge
Der Menschenschlag der Region war von Beginn an ein wesentlicher Baustein, der das Projekt
erfolgreich auf den Weg brachte. Das unterstreicht Prof. Dr. Helmuth Albrecht von der TU
Bergakademie Freiberg, der das Welterbeprojekt vor allem fachlich intensiv begleitete: „Es war
von vorneherein klar, die Umsetzung der ersten Idee kann nicht von oben kommen, sondern muss
aus den Menschen herauswachsen. Wir wollten Kommunen, Landkreise, Vereine, Ehrenamtliche
und tschechische Partner mitnehmen. Das ist auch eine Erklärung dafür, dass der Prozess so lange
dauerte. Stück für Stück konnten wir so die Politik überzeugen: die Menschen der Region wollen
das Projekt. Und auch künftig wird unser Welterbe nur durch die hier lebenden Menschen
vorangetrieben werden. Da bin ich guter Dinge – wir haben gezeigt, dass wir zusammenhalten
können.“ Mehr als 1.000 Beteiligte haben in den Jahren das Vorhaben begleitet und unterstützt.
Die Chancen – auf das Erzgebirge schaut die Welt
Welterbe werden ist das eine, Welterbe sein das andere. Man habe jetzt die große Chance, das
Thema mit Leben zu füllen und den Menschen auf der ganzen Welt zu zeigen, welche Schätze die
Region hat. Und zwar nicht nur bergbauliche, sondern auch kulturelle und industrielle, die alle
eng mit der mehr als 800-jährigen Bergbauhistorie verknüpft sind. So bringt der Welterbetitel
nicht nur einen Schub für die Identifikation der Erzgebirger mit ihrer Heimat sondern auch
enorme Chancen für eine Imageaufwertung durch ein weltweites Qualitätssiegel im Tourismus.
Ines Hanisch-Lupaschko, Geschäftsführerin Tourismusverband Erzgebirge e. V. zeigt sich
richtungsweisend: „Gemeinsam mit unseren touristischen Partnern und den Menschen in der
Region ist es unser Ziel, diese interessante Weiterentwicklung nachhaltig zu gestalten, eine neue
Qualitätsebene zu erreichen und erweiterte Gästekreise anzusprechen. Der gemeinsame Blick ist
auf emotional authentische und erlebbare Angebote gerichtet, so dass ein Mehrwert für unsere
Gäste geschaffen werden kann. Der Aufbau eines einheitlichen Qualitätssiegels wird als Prozess
gesehen, der mit der Ernennung zum UNESCO-Welterbe beginnt und neue Impulse in der Region
setzen wird.“ Gemeinsam wird man sich kommenden Herausforderungen stellen und sich
gegenseitig unterstützen. Prof. Dr. Albrecht spricht von einem Touristischen Managementkonzept,
bei dem die Konzentration auf die gesamte Region gesehen wird – „Heimat ist da, wo man sich
wohlfühlt“ und dies gilt nicht nur für die Menschen im Erzgebirge, sondern auch für die Gäste in
der Erlebnisheimat.
Politik, Wirtschaft, Soziales
Das erste Auto feiert Geburtstag
von Hans-Jürgen Rudolf/dpa-tmn
Erst wurden Nähmaschinen und Fahrräder gebaut, doch vor 120 Jahren sattelte Opel auf die
Produktion von Autos um. 1899 – vier Jahre nach dem Tod des Firmengründers Adam Opel –
startete Sophie Opel auf den Rat ihrer Söhne Carl, Wilhelm und Friedrich die Autoproduktion.
www.magazin-spätlese.net ! von 29
10 !Bild: Dani Heyne/dpa
Das erste Modell war eher eine Kutsche ohne Pferd –
und zum Fahren des Patentmotorwagens System
Lutzmann braucht man fast so viel Erfahrung wie ein
Kutscher. Was in einer Werkstatt in Rüsselsheim mit
insgesamt 65 handgefertigten Fahrzeugen begann,
wurde zum Massenphänomen mit bis heute mehr als
70 Millionen Fahrzeugen.
Wer in den Kindertagen des Automobils seinen
Wagen starten wollte, der musste buchstäblich ein
Flotte Fahrt im ersten Opel: Zwischen 25 und 30 km/h
Kraftfahrer sein. Das weiß kaum jemand besser als
waren im Patentmotorwagen System Lutzmann schon drin
Joachim Zok aus der Klassik-Werkstatt von Opel.
Und weil die Hessen in diesem Jahr 120 Jahre Automobilbau feiern, muss er gerade besonders oft
die große Kurbel schwingen und darauf hoffen, dass der Einzylinder seines ältesten Falls
anspringt. Denn Zok ist einer der wenigen in Rüsselsheim, die genau jenes Auto zum Laufen
bringen, mit dem die Geschichte 1899 begonnen hat: den Patentmotorwagen System Lutzmann.
Beginn der Fahrzeugproduktion 1899
Entwickelt hat Opel den Wagen nicht selbst, das Metier der Hessen waren erst Nähmaschinen und
dann Fahrräder. Doch waren die Opels erfolgreiche Geschäftsleute mit gutem Riecher. Deshalb
haben sie früh erkannt, wohin die Reise geht und entsprechend umgesattelt. Dazu hatte man die
Patent-Motorwagen-Fabrik F. Lutzman aus Dessau gekauft. Der Vertrag dafür wurde nach
Angaben des Unternehmens am 21. Januar 1899 unterschrieben, so dass Opel offiziell dieses
Datum als Beginn der Fahrzeugproduktion feiert.
Damit konnte sich der Hofschlossermeister, Automobilpionier und Konstrukteur Friedrich
Lutzmann seinen Traum von der Massenproduktion erfüllen - selbst wenn Masse damals noch
eine andere Bedeutung hatte. Denn bis zum Jahr 1901 sind gerade einmal 65 Patent-Motorwagen
gebaut und verkauft worden, berichtet Opel-Klassik-Sprecher Uwe Mertin. Ausgehend vom
damaligen Durchschnittslohn von 60 Mark, kostete der damals 2650 Mark teure Opel nach
heutigen Maßstäben umgerechnet mindestens 100.000 Euro, so Mertin. Kein Auto sah aus wie
das andere. Zwar stehen alle auf einem Rahmen aus Holz, haben den Motor im Heck, und ein
kompliziertes System mit Lederriemen, Wellen, Ritzeln und Ketten übernimmt die
Kraftübertragung zur Hinterachse. Doch die Zahl der Sitzplätze, Aufbau, Farbe und Antrieb sind
unterschiedlich: Anfangs gab es den Wagen mit einem Zylinder, 1,5 Litern Hubraum und etwa 2
kW/3 PS, später wurde ein Zweizylinder mit 3 kW/4 PS eingebaut. Überlebt haben nach heutigem
Wissen genau drei Exemplare.
Leichte Bedienung
Läuft der Wagen, ist er überraschend leicht zu bedienen. Die zwei Gänge wechselt man ohne groß
zu kuppeln, das Tempo regelt man mit einem Hebel am Lenkrad, und die Bremse hat buchstäblich
Hand und Fuß. Denn egal, ob man außen am Hebel zieht oder das kleine Pedal im Boden tritt,
immer wirkt die Kraft auf den Transmissionsriemen - und verpufft fast unbemerkt. Wer nicht
rechtzeitig in den Leerlauf schaltet, wird den Motorwagen schwerlich zum Stehen bekommen.
Lausig kalt ist es auf dem Bock, der entfernt an eine Kutsche erinnert, nur dass der Fahrer hier
hinten sitzt statt vorne und Wind und Wetter schutzlos ausgeliefert ist. Daneben gibt es beim
ersten Opel aber eigentlich nur ein echtes Problem: das Lenken. Denn vor dem Fahrer ragt an
einer langen Stange senkrecht aus dem Wagenboden nur eine Kurbel hervor. Und man braucht
schon reichlich Kraft, Geduld und Weitsicht, um den Lutzmann um die Kurve zu bekommen. Aber
wer einmal versucht hat, eine Kutsche mit vier oder mehr Pferden zu lenken, der wird den Opel
der ersten Stunde als Wunder der Wendigkeit anerkennen.Eine eigentliche Kupplung gibt es
www.magazin-spätlese.net ! von 29
11 !nicht. Der Schalthebel liegt unter der Lenkkurbel. Mit ihm können zwei Gänge gewählt oder der
Leerlauf eingestellt werden. Die Riemenübertragung ist elastisch genug, um das Rucken beim
Gangwechsel zu dämpfen. Auch ein Differenzial braucht es offenbar nicht: Niedrige
Geschwindigkeiten, große Kurvenradien und robuste Vollgummireifen sorgen dafür, dass der
Lutzmann die Linie hält. Und flott ist er obendrein, selbst wenn das Museumsstück noch den
schwächeren Motor im Heck hat und auf gerade einmal 2,6 kW/3,5 PS bei 650 Umdrehungen
kommt. "Mit ein bisschen Übung, Geschick und vor allem Mut schafft man 25 oder 30 Kilometer
in der Stunde", sagt Zok.
Inspektionen alle 15 Kilometer
Einst war ein Unfall kein großer Schaden. Viele andere Autos, mit denen man hätte kollidieren
können, gab es noch nicht, und Schäden am Lutzmann wurden unterwegs behoben. "Schließlich
wurden die Kraftfahrer damals zumeist von Mechanikern begleitet", so Mertin. "Nicht zuletzt
deshalb, weil Inspektionen nicht wie heute alle 15.000 oder 25.000 Kilometer, sondern alle 15
Kilometer fällig wurden." Und wer sich damals ein Auto leisten konnte, der hat sich ganz bestimmt
nicht selbst die Finger am Ölkännchen schmutzig gemacht.
Wiederaufbau und Wirtschaftswunder
Seit den Fünfzigern startete die Marke in allen Fahrzeugklassen durch – Modelle wie Opel Kadett,
Rekord und Kapitän prägten die Zeit von Wiederaufbau und Wirtschaftswunder. Es folgten
Stilikonen wie Opel GT,Manta und Monza. In den Achtzigern und Neunzigern wurden Corsa,
Astra und Zafira zu Bestsellern.
Kultur, Kunst, Wissenschaft
Zum 250. Geburtstag
Alexander von
Humboldts
von Tristan Micke
Alexander von Humboldt gilt als einer der Begründer
Bild: wikipedia_eduard-ender
der wissenschaftlichen Erdkunde, der Klimalehre, der
Alexander von Humboldt und sein Begleiter Lehre vom Erdmagnetismus, der Meeres- und
Bonpland am Orinoco
Pflanzenkunde. Er erforschte den Vulkanismus und
verfasste zahlreiche Schriften zu diesen Themen. Er ist einer der letzten Universalgelehrten und in
der Welt einer der bekanntesten Deutschen.
Friedrich Wilhelm Heinrich Alexander von Humboldt wurde am 14. September 1769 in Berlin
geboren. Seine Eltern waren der aus Pommern stammende preußische Offizier Alexander Georg
und Marie Elizabeth von Humboldt. Er hatte noch den 1767 geborenen Bruder Wilhelm. Wegen
seiner Verdienste im Siebenjährigen Krieg war sein Vater zum Kammerherrn der Kronprinzessin
ernannt worden. Der Kronprinz, der spätere Friedrich Wilhelm II., war einer der Taufpaten
Alexanders. Nach der Scheidung der Ehe des Thronfolgers im Geburtsjahr Alexander von
Humboldts entfielen die Aufgaben des Vaters als Kammerherr und er zog sich ins Privatleben auf
Gut und Schloss Tegel zurück.
www.magazin-spätlese.net ! von 29
12 !Ausbildung und Studium
Dort kümmerte er sich um eine gute Erziehung und Ausbildung seiner Söhne durch Hauslehrer.
Lange Zeit erschien Alexander seinen Erziehern als weniger befähigt als Bruder Wilhelm. Abstrakt
aufbereiteter Lernstoff lag ihm weniger. Alexander zeigte besonderes Interesse an der Natur und
beschäftigte sich mit Insekten, Pflanzen und Steinen. Er entwaf bereits als Zehnjähriger Karten
zum Planetensystem und von Amerika. Dieser Beschäftigung ging er zusätzlich zum Unterricht
nach, sodass er schließlich ein größeres Stoffpensum bewältigte als Bruder Wilhelm. Von Vorteil
war dabei sein Zeichen- und Maltalent, welches unter Anleitung von Daniel Chodowiecki im
Kupferstechen und Radieren geschult wurde. 1786 stellte er in der ersten Kunstausstellung der
Berliner Akademie seine Werke der Öffentlichkeit vor. Nach dem Tod des Vaters ging die Planung
der Erziehung von Wilhelm und Alexander an die Mutter über. Bei verhältnismäßig bescheidener
eigener Lebensführung war ihr Ziel, den Söhnen zu bedeutenden Posten im Staatsdienst zu
verhelfen. 1787 gingen beide Söhne nach Frankfurt/Oder an die Viadrina. Wilhelm studierte dort
Jura, Alexander Staatswirtschaftslehre. Nebenbei hörte Alexander Altertumswissenschaften,
Medizin, Physik und Mathematik. Mit dem Theologiestudenten Wilhelm Gabriel Wegener schloss
Alexander von Humboldt 1788 einen "ewigen Freundschaftsbund". Weil er außerdem
unverheiratet blieb, wird in einem Teil der Forschungsliteratur die Meinung vertreten, dass
Alexander von Humboldt homosexuell gewesen sei.
In Frankfurt/Oder offenbar akademisch unterfordert, ging Alexander von Humboldt nach einem
Semester wieder zurück nach Berlin. Hier ließ er sich von Carl Ludwig Willdenow in Botanik
ausbilden. 1789 immatrikulierte er sich an der Universität Göttingen. 1790 schloss Humboldt das
Manuskript seiner Publikation über einige Basalte am Rhein ab. Von Ende März bis Juli 1790
unternahm er zusammen mit dem Naturforscher Georg Förster eine Forschungsreise von Mainz
über den Nordrhein nach England und zurück über Paris. Danach setzte Humboldt seine
Ausbildung in Staatswirtschaftslehre an der Hamburger Büsch-Akademie fort.
Karriere im Staatsdienst
1791 schlug Alexander von Humboldt den Weg als Bergbeamter im Staatsdienst ein. Dazu war
noch ein Studium an der Bergakademie in Freiberg nötig. Er erforschte die Pflanzenwelt unter
Tage und befasste sich mit den chemischen Problemen der Verbrennung. 1792 erhielt er ein Patent
als Bergassessor und wurde mit der Untersuchung des Lotharheiler Schiefers betraut. Bereits nach
einem halben Jahr erfolgte die Beförderung Humboldts zum Oberbergmeister. Er wurde mit der
Sanierung des Bergbaus im Fichtelgebirge und im Frankenwald beauftragt. Im Fichtelgebirge
endeckte er, dass der Haidberg bei Zell teilweise aus stark magnetisiertem Gestein besteht und
bezeichnete ihn als "Magnetberg". Humboldt modernisierte den Abbau von Silber, Nickel, Zinn,
Eisen und Alaunschiefergestein in der Region Bayreuth sowie den Goldbergbau in Goldkronach,
wodurch sich auch die Arbeitsbedingungen der Bergarbeiter verbesserten. Humboldt entwickelte
eine Atemschutzmaske und verbesserte die Sicherheit der Grubenlampen. In Steben gründete er
eine Bergschule, die erste Arbeiter-Berufsschule in Deutschland. 1794 traf Alexander von
Humboldt in Jena Johann Wolfgang von Goethe. Beide Männer waren daraufhin eng befreundet.
Im selben Jahr wurde Humboldt Bergrat und 1795 Oberbergrat. Um sich seinen Forschungen zu
widmen, bat er aber den preußischen König um Entlassung aus dem Dienst im Bergbau. Er
befaßte sich nun mit Mykologie und der "tierischen Elektrizität".
Weltreisen
Durch den Tod seiner Mutter war Alexander von Humboldt zu einem vermögenden Erben
geworden. Jetzt konnte er seine erträumten Forschungsreisen unternehmen. Er nahm dabei die
modernsten Instrumente mit:
www.magazin-spätlese.net ! von 29
13 !Amerikanische Forschungsreise 1799-1804
Humboldt sammelte in Amerika Pflanzen und Fossilien, studierte die Düngeeigenschaften von
Guano (Vogelkot); betrieb geographische und geologische Forschungen, protokollierte ein heftiges
Erdbeben und machte astronomische Beobachtungen. Ihm ging es dabei vor allem um das
"Zusammenwirken der Kräfte, den Einfluss der unbelebten Schöpfung auf die belebte Tier- und
Pflanzenwelt." Auf seiner Reise musste Humboldt immer wieder die grausame Behandlung der
Sklaven beobachten, was ihn zu einem entschiedene Gegner der Sklaverei machte. Zum Ende der
Reise war Humboldt zu Gast bei Präsident Thomas Jeffersen in Washington und in Philadelphia.
Nach seiner Rückkehr lebte Humboldt 20 Jahre in Paris, der damaligen Hauptstadt der
Wissenschaft. Dann zwangen ihn finanzielle Engpässe zurück nach Berlin. Sein zwischen 1805 und
1839 entstandenes 34-bändiges Reisewerk, welches unvollendet blieb, hatte ihn ruiniert.
Russlandexpedition (1829)
Die Expedition führte Alexander von Humboldt über Moskau, Kasan, Perm nach Jekaterinburg.
Die Route ermöglichte geologische Forschungen und ein reichhaltiges Sammeln von geologischem
Material. Auf dieser Reise verbrachte Humboldt seinen 60. Geburtstag. Der Zarin sagte Humboldt
Diamantenfunde im Ural voraus, die dann tatsächlich eintraten.
Lebensende
Wegen seines guten Gespürs für den Umgang mit Menschen wurde Alexander von Humboldt von
Preußen mehrmals in diplomatischen Missionen eingesetzt.
1848 hatte die Revolutionswelle auch Deutschland erreicht. Humboldt begrüßte zwar das Streben
nach Reformen, lehnte jedoch das brutale Vorgehen der Revolutionäre ab. Er nahm aber an ihrer
Siegesfeier Teil und lief an der Spitze des Trauerzuges der Märzgefallenen mit.
Bis kurz vor seinem Tode arbeitete Humboldt an seinem 1834 begonnenen Lebenswerk, dem
"Kosmos", in dem er das gesamte Wissen der Welt vereinen wollte.
Am 6. Mai 1859 starb Humboldt verarmt in seiner Berliner Wohnung in der Oranienburger Straße
67. Sein Vermögen hatte er in seine Forschungen investiert. Beigesetzt wurde Alexander von
Humboldt im Familiengrab im Schlosspark von Tegel, einem Ehrengrab der Stadt Berlin.
Kultur, Kunst, Wissenschaft
Zeitgenössische Kunst
wieder im Berliner Fokus
von Ursula A. Kolbe
Die Berlin Art Week – Zum nunmehr achten Mal lädt
Bild: dpa sie die Berliner und Gäste aus aller Welt zu einem
vielfältigen Programm aus Messen, Ausstellungen,
Urban Interventions, Preisverleihungen und
Sonderausstellungen an bewährte und neue Orte ein.
Zwei Messen, 17 Museen und Ausstellungshäuser, 15 Privatsammlungen, 20 ausgewählte
Projekträume und zahlreiche Galerien machen die Hauptstadt zu einem internationalen
Treffpunkt der zeitgenössischen Kunst. „Mit der Berlin Art Week gelingt es jedes Jahr aufs Neue,
die verschiedensten Akteure der Berliner Kunstszene zusammenzubringen“, so Moritz van Dünen,
Geschäftsführer der landeseigenen Kulturprojekte GmbH, „Das eigene Engagement der
unterschiedlichen Partner, ein vielfältiges Programm und der rege Zuspruch der Besucherinnen
www.magazin-spätlese.net ! von 29
14 !und Besucher unterstreichen die Bedeutung Berlins als internationalen Kunst- und
Kulturstandort, an dem aktuelle Themen der zeitgenössischen Kunst verhandelt werden.“
Erneut stehen auch die beiden jährlich zu Berlin Art Week stattfindenden Kunstmessen im
Zentrum der Aufmerksamkeit. Die art berlin zeigt im dritten Jahr der Kooperation mit der Art
Cologne junge sowie international etablierte Galerien in den Hangars 5 und 6 des ehemaligen
Flughafens Tempelhof. Die sechste Ausgabe Positions Berlin Art Fair präsentiert im Hangar 4
ausgewählte Galerien mit künstlerischen Positionen der zeitgenössischen und modernen Kunst.
Gleich mehrere Ausstellungshäuser beschäftigen sich im 30. Jahr des Mauerfalls thematisch mit
den Entwicklungen der letzten drei Jahrzehnte. Ausgehend von der eigenen Lage am ehemaligen
Grenzverlauf zeigt der Gropius Bau in Durch Mauern Gehen internationale künstlerische
Perspektiven auf von Menschen geschaffene Barrieren, Trennungen und Grenzen. So zeigt die
Ausstellung No Photos on the Dance Floor! bei C/O Berlin anhand namhafter Arbeiten aus
Fotografie, Video und Film einzigartige Bilder der Berliner Clubkultur der vergangenen 30 Jahre.
Das Gesehene wird abends mit bekannten DJs, Sound- und Visual Artists erfahrbar.
Den stadtpolitischen Veränderungen und architektonischen Transformationsprozessen in Berlin
zwischen 1989 und 2019 spürt die Ausstellung Politik des Raums im Neuen Berlin im n.b.k.
nach. Im zentral gelegenen Haus der Statistik am Alexanderplatz findet das Projekt Statista statt.
Die Die Kooperation zwischen dem ZK/U—Zentrum für Kunst und Urbanistik und dem KW
Institute for Contemporay Art bestimmt mit mehreren Künstlerkollektiven in zehn Aktionsfeldern,
wie sich ein auf Gemeingütern basierende Stadtgesellschaft entwickeln lässt.
Weitere Höhepunkte sind die Ausstellungen von Bettina Poustchi in der Berlinischen Galerie,
von Bjorn Melhus im Kindl-Zentrum für zeitgenössische Kunst, von Christopher Kulendran
Thomas in Kollaboration mit Annika Kuhlmann im Schinkel-Pavillon, die
Gruppenausstellung Magic Media – Media Magic.Videokunst seit den 1970er Jahren
aus dem Archiv Wulf Herzogenroth in der Akademie der Künste, die Gegenüberstellung
Pablo Picasso x Thomas Scheibitz im Museum Berggruen sowie Ernst Ludwig Kirchner,
Gerhard Richter und Jonas Burgert im me Collectors Room.
Einzelausstellungen von Anna Virnich in der Schering Stiftung, Iman Issa in der daadgalerie,
Tobias Dostal im Haus am Lützowplatz sowie Christina Ramberg im Dialog mit weiteren
künstlerischen Positionen ergänzen das vielseitige Ausstellungsprogramm. Darüber hinaus startet
das Haus der Kulturen der Welt das diskursive Veranstaltungsprogramm Körper lesen!
Corpoliteracy in Kunst, Bildung und Alltag.
Die Berliner Festspiele gehen nach dem erfolgreichen Auftakt im letzten Jahr im Rahmen ihrer
Programmreihe Immersion hinaus in den Stadtraum und bespielen zur Berlin Art Week mit ihrem
Projekt The New Infinity – Neue Kunst für Planetarien und dem Künstlerkollektiv
Metahaven erneut den Mariannenplatz. Die nGbK verwandelt U-Bahnhöfe der Stadt mit Kunst
im Untergrund – Up in Arms in einen urbanen Ausstellungsraum.
Überhaupt gewähren vom Bunker bis zur Privatwohnung 15 Privatsammlungen mit
Sonderöffnungszeiten exklusive Einblicke in ihre Sammlungsbestände. Daran beteiligen sich
Collection Regard, EAM Collection, Fluentum, haubrok foundation, Julia Stoschek
Collection Berlin, Kienzle Art Foundation, Kunstsaele Berlin, Miettinen Collection /
Salon Dahlmann, Museum Frieder Burda / Salon, Sammlung Boros, Sammlung Ivo
Wessel, SOR Rusche Sammlung, The FeuerleCollection und Wurlitzer Pied à Terre
Collection.
Zum 10. Mal fördert der Preis der Nationalgalerie, für den 2019 Pauline Curnier Jardin,
Simon Fujiwara, Flak Haliti und Katja Novitskova nominiert sind, eine bedeutende, junge Position
der Gegenwartskunst. Der Preis der Nationalgalerie wird ebenso wie der VBKI-Preis Berliner
www.magazin-spätlese.net ! von 29
15 !Galerien und der Berlin Art Prize während der Berlin Art Week verliehen.
Die diesjährigen Partner sind art berlin, Positions Berlin Art Fair, die Akademie der Künste,
Berliner Festspiele/Immersion, Berlinische Galerie, C/O Berlin, daadgalerie, Gropius Bau, Haus
am Lützowplatz, Haus der Kulturen der Welt, Kindl-Zentrum für zeitgenössische Kunst, KW
Institute for Contemporary Art, me Collectors Room, Nationalgalerie – Staatliche Museen – Berlin
mit Hamburger Bahnhof – Museum für Gegenwart und Museum Berggruen, Neuer Berliner
Kunstverein (n.b.k.), neue Gesellschaft für bildende Kunst (nGbK), Schering und Schinkel Pavillon
sowie das Projekt Atatista, eine Kooperation zwischen dem ZK/U – Zentrum für Kunst und
Urbanistik und den KW Institute for Temporary Art. Auch zahlreiche Privatsammlungen und
Projekträume sind wieder mit dabei.
Kultur, Kunst, Wissenschaft
Ein „Scherz-Keks“ im
Fokus
von Kathrain Graubaum
Die Jugend kichert albern, witzelt und spottet – „...
und das ist gut so“, hätte wohl der Dichter Johann
Bild: Kathrain Graubaum Wilhelm Ludwig Gleim (1719-1803) gesagt. Nach
Porzellangruppe von Johann Peter Melchior
dem Motto „versäumte Freuden sind
„Der Hahnrei im Weinfass“ (aus 1770/75) unwiederbringlich“– wurde der junge Gleim für
seine Scherzlieder und für seine exzessive Freundschafts- und Geselligkeitskultur berühmt.
Anlässlich des 300. Geburtstages des Dichters zeigt das Halberstädter Literaturmuseum
Gleimhaus die Ausstellung „Scherz – Die heitere Seite der Aufklärung“.
Das trendy T-Shirt mit der Aufschrift YOLO hat den Weg nach Halberstadt in eines der ältesten
deutschen Dichtermuseen gefunden: in das einstige Wohnhaus von Johann Wilhelm Ludwig
Gleim (1719 -1803). YOLO, die Buchstaben für „you only live once“, kennt heute beinahe jede und
jeder im jugendlichen Alter. Aber wer kennt Gleim?
Aufklärung des Verstandes und der Aufheiterung
Allenfalls ältere und zudem literaturinteressierte Generationen haben vom „Vater“ Gleim gelesen
oder gehört. Heute würde man sagen: Gleim war der Begründer des analogen Facebook: Er
pflegte mehr als 550 Freundschaften und sammelte all die Briefe, die so rege hin und her geschickt
wurden. Er ließ über 150 Porträts malen und arrangierte sie in seinem Wohnraum zu einem
Freundschaftstempel. Der ist bis heute das Herz des Dichterhauses. So hatte er seine Freunde
auch zwischen den Ereignissen der persönlichen Begegnung um sich. Denn die geselligen Runden
waren ihm und seinen Gleichgesinnten noch wichtiger als das Briefeschreiben. Von heiteren
Kostümfesten, neckischen Rollenspielen und vergnüglichen Tändeleien ist in den
Korrespondenzen aus jener Zeit zu lesen – wie auch vom lustvollen geistigen Austausch über
Literatur und Kunst. Das 18. Jahrhundert war eben nicht nur die Epoche der Aufklärung des
Verstandes,sondern auch der Aufheiterung des Gemütes. Gerade im 300. Geburtsjahr von Johann
Wilhelm Ludwig Gleim nimmt in Halberstadt das Museum der deutschen Aufklärung den jungen
Dichter in den Fokus – und stellt Bemerkens- wie Staunenswertes ins Rampenlicht: Schon Gleim
propagierte „you only live once – Du lebst nur einmal“ als Lebensgefühl und gab YOLO als heitere
www.magazin-spätlese.net ! von !29
16Aufforderung weiter: Genieße das Leben mit all seinen Facetten. Nutze jeden Tag als Chance zum
Spaß haben und fröhlich sein. Lebe im Moment.
Die heitere Seite der Aufklärung
So empfangen denn auch zwei geöffnete Bücherschränke mit Kichern und Räuspern die Besucher
der Ausstellung „Scherz – Die heitere Seite der Aufklärung“. Alle Bücher, die in diesen Schränken
stehen, haben den „Scherz“ in ihrem Titel – und haben unsichtbare Leser, deren Glucksen zu
hören ist.
Mit seinem Debüt „Versuch in scherzhaften Liedern“ wurde der junge Gleim 1744 zum Star in der
Literaturszene. In Halle hatte er Jura studiert, war gerade nach Berlin gezogen und als 25-Jähriger
sehr zum Spaßen und Spotten aufgelegt. Er wurde mit weiteren Scherzliedern über Wein, Liebe
und Lebensfreude zum Trendsetter; entsprach die neue jugendliche Lebenslust doch der Befreiung
von einer verstaubten Religion, die glauben machte, erst im Jenseits sei die Existenz schön.
Gleim brachte die scherzhafte Dichtung in Mode – nach Vorbildern aus verschiedenen Epochen:
Aristoteles, Epikur und vor allem der griechische Lyriker Anakreon. Die Büsten aller vier Dichter
weisen als illustres Quartett den Ausstellungs-Weg in das 18. Jahrhundert der Aufklärung, der
Freundschaft, des Briefes – und eben auch des Scherzes.
Ein scherzhafter Ton beflügelt die Geselligkeit – die Halberstädter Domherren, den irdischen
Vergnügungen zugeneigt, wollten vermutlich auch darum Gleim als Sekretär für ihr Domstift.
Denn dem jungen Juristen in Berlin war der Ruf des lustigen Vogels voraus nach Halberstadt
geeilt. 1747 ließ sich Gleim mit einer dauerhaften Anstellung in den Vorharz locken. Der
ungezwungene Aufenthalt in der „unverbildeten“ Natur entsprach so ganz seiner Künstlerseele.
Nuretwas einsam fühlte er sich hier. So besann er sich auf sein Talent als Netzwerker und scharte
einen illustren Kreis Gleichfühlender um sich.
Nicht nur in der Lyrik, auch in der Musik (man denke an das Scherzo), in Malerei und Grafik
sowie in der Gestaltung von Porzellanplastiken nahm sich die ungebremste Daseinsfreude im
Diesseits ihren Raum. Die Ausstellung im Halberstädter Literaturmuseum baut die Brücken, über
die der Besucher Zugang findet zur heiter bis spöttischen, versteckten wie offenen Darstellung der
„Lebensgelüste“ in den Künsten zur Jahrhundertmitte des Rokoko. Die „Vergnügungen der
Jugend“ sind ein typisches Thema jener Zeit.
Exponate aus bedeutenden öffentlichen wie privaten Sammlungen aus Deutschland und der
Schweiz sowie aus dem Kunsthandel laden die Besucher der Ausstellung zum „Schäferstündchen“
ein. Denn zumeist sind die fröhlichen Begegnungen, die geselligen Spiele, die amourösen
Abenteuer und Flirts in einer idyllisch-friedvoll wirkenden Natur angesiedelt, in einem
vermeintlich ländlich-einfachen und sorgenfreien Leben der Schäfer und Hirten.
Aus den Porzellan-Manufakturen Meißen, Ludwigsburg und Höchst kamen zu jener Zeit Schäfer
und Liebesgruppen, deren Motive in ihrer Zweideutigkeit bis heute verstanden werden. Man
erinnert sichschmunzelnd an die Metapher etwa für Vogel und Vogelbauer, für Flöte und
Ziegenbock. Auch Amor taucht immer wieder als scherzhafter Gott auf, um sein (hinter)listiges
Werk zu verrichten.
Ebenso die Rokoko-Malerei und -Grafik etwa von Bouchet, Lancret und Pater vermittelt
vergnügliche Atmosphäre in naturnahen Landschaften. Neben dem Schäferstück ist das
Blindekuh-Spiel unter Mitwirkung von Amor ein beliebtes Motiv. Und wen wundert‘s, dass auch
Gläser und Kelche, Kannen und Tassen für die geselligkeitsstiftenden Getränke mit kunstvoll
eingravierten „rauschhaften“ Motiven verziert wurden. Wer sich auf Scherz-Suche nach
Halberstadt ins Gleimhaus begibt, mag erstaunt sein über eine Erkenntnis: Die brandaktuelle und
Ratgeber-füllende Frage, wie es gelänge, mehr im Hier und Jetzt zu leben, ist nicht erst ein
Produkt unserer heutigen Zeit. Zu sehen ist die Ausstellung noch bis 15. September 2019.
www.magazin-spätlese.net ! von 29
17 !Sie können auch lesen