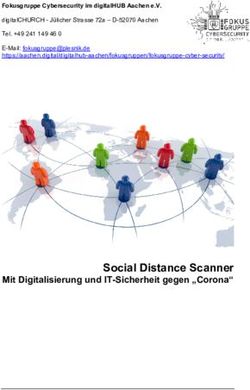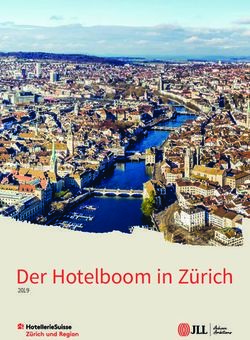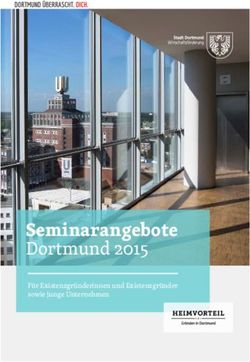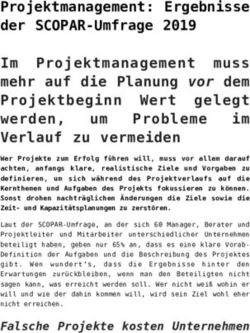Strukturwandel im Energiemarkt: Implikationen für die Unternehmenstätigkeit der Stadtwerke - DKB
←
→
Transkription von Seiteninhalten
Wenn Ihr Browser die Seite nicht korrekt rendert, bitte, lesen Sie den Inhalt der Seite unten
Strukturwandel im Energiemarkt:
Implikationen für die Unternehmenstätigkeit der Stadtwerke
Eine Studie des Kompetenzzentrums Öffentliche Wirtschaft, Infrastruktur und Daseinsvorsorge
e.V. an der Universität Leipzig gemeinsam mit der DKB Deutsche Kreditbank AG
Dr. Oliver Rottmann, Dipl.-Geogr. / Dipl.-Ing. André Grüttner, M.Sc. Tim Starke
KOMPETENZZENTRUM
Öffentliche Wirtschaft, Infrastruktur und
Daseinsvorsorge e. V.2
INHALT
1 Executive Summary 6
2 Institutioneller Rahmen und Studiendesign 9
3 Aktuelle Entwicklungen im Energiemarkt 12
4 Strukturwandel im Energiemarkt:
Implikationen für die Unternehmenstätigkeit
der Stadtwerke – Befragungsergebnisse 14
4.1 Befragungsdesign 14
4.2 Unternehmenskontext 14
4.3 Herausforderungen aus der veränderten
Energiepolitik 22
4.3.1 Status quo: Struktur und räumliche Verteilung
der Energieerzeugung 22
4.3.2 Herausforderungen und Chancen für
Stadtwerke aus der Energiepolitik der
Bundesregierung 23
4.4 Handlungsoptionen und Strategien für
Stadtwerke 30
5 Zusammenfassung 44Strukturwandel im Energiemarkt: Implikationen für die Unternehmenstätigkeit 3
Vorwort
Verband Kommunaler Unternehmen e.V.
versorgungssicheren Energieerzeugung
und -verteilung, der Entwicklungsgeschwin-
digkeit einer umfassenden Digitalisierung
und der Anwendungschancen von in der
Erforschung befindlichen Erzeugungs- und
Speichertechnologien sowie der flanki-
erungsbedürftigen Etablierung von Ener-
giedienstleistungen ergeben.
Die Entwicklung der vergangenen
zwanzig Jahre war insofern für die
Stadtwerke mit erheblichen Neu-
orientierungs- und Umstrukturierungs-
Die Energiewirtschaft befindet sich seit der erfordernissen verbunden. Die kommunale
Liberalisierung der europäischen Strom- Energiewirtschaft hat sich diesen
und Gasmärkte Mitte der 1990er Jahre in Herausforderungen gestellt. Durch
einem kontinuierlichen Fortentwicklung- Identifizierung von Marktchancen und
sprozess. Handlungsoptionen sowie durch vielfältige
Anpassungsmaßnahmen konnten sie ihre
In Deutschland folgten auf die Umsetzung
Marktanteile in der Energieerzeugung
des 2. Binnenmarktpakets mit der
stärken, im Verteilnetzbereich ausbauen
zentralen Vorgabe der Entflechtung des
und in den Segmenten Vertrieb, Handel
Stromnetzes von den wettbewerblichen
und Energiedienstleistungen optimieren.
Wertschöpfungsstufen die Einführung
des klimapolitischen Instruments des Die vorliegende Studie und die
EU-Emissionszertifikatehandels sowie die Auswertung der Erhebungsergebnisse
Vorgaben aus dem Energiekonzept der verdeutlichen, dass die Stadtwerke in
Bundesregierung 2009. Die politische - und (fast) allen Bereichen der Neuausrichtung
gesellschaftlich getragene - Entscheidung des Energiesystems eine maßgebliche
zum Verzicht auf die Nutzung der Rolle haben. In Abstimmung mit ihren
Kernenergie in der Energieerzeugung sowie kommunalen Eigentümern, durch
der dynamische Ausbau der Erneuerbaren erhebliche Investitionen in bisherigen und
Energien brachten einen Transformation- zu erschließenden Wertschöpfungsfeldern
sprozess in Gang, der die Strukturen des sowie in verschiedenartigen Kooperationen
Energiesystems, die Marktbedingungen, mit Bürgern, anderen kommunalwirtschaft-
die Zusammensetzung der Marktakteure lichen oder privaten Unternehmen nutzen
und bestehende Unternehmens- und die Stadtwerke die strategischen und
Geschäftsfeldstrategien weitreichend wirtschaftlichen Chancen, die sich aus
verändert. der Energiewende ergeben. Sie leisten
damit einen beachtlichen Beitrag zur
Die im Sommer 2016 von Bundestag und
Modernisierung des Energiesystems
Bundesrat verabschiedeten Energiegesetze
und zur Erreichung der Klimaschutzziele,
werden allerdings den ordnungs-
optimieren in Zusammenarbeit mit den
politischen Rahmen und den daraus
Kunden ihre Dienstleistungsangebote
resultierenden Planungshorizont für die
und bleiben zugleich wesentlicher
energiewirtschaftlichen Akteure lediglich
Standortfaktor der lokalen und regionalen
für einen mittelfristigen Zeitraum bieten
Wirtschaftsentwicklung.
können. Nachsteuerungsbedarfe werden
sich aufgrund noch nicht abschätzbarer
Michael Wübbels
Marktauswirkungen, der erforderlichen
Gewährleistung einer auf zunehmender Stv. Hauptgeschäftsführer
Dezentralität und Volatilität beruhenden, Leiter der Abt. Energiewirtschaft4 Strukturwandel im Energiemarkt: Implikationen für die Unternehmenstätigkeit
Vorwort
Deutsche Kreditbank AG (DKB)
Energiewende, Stromwende, Wärmewende – seit Insbesondere die Kommunen können als Bindeglied
Beginn moderner Anstrengungen zur nachhaltigen zwischen öffentlichen Interessen, Bürgern und der
Energieerzeugung und –nutzung überschlagen sich Wirtschaft eine treibende und einflussnehmende Kraft
die Bezeichnungen. Oft geschieht dies in einem bei der regionalen Ausrichtung energetischer Konzepte
kritischen Kontext, der eine einseitige Entwicklung der sein. Nicht umsonst wird kommunaler Klimaschutz
Geschehnisse bemängelt. Nicht selten auch zu Recht. intensiv von der Bundesregierung gefördert, zuletzt
Die Bundesregierung hat in ihrem 2010 vorgestellten im April 2016 mit einem Nationalen Förderaufruf für
„Energiekonzept der Bundesregierung“ nicht nur Ziele kommunale Modellvorhaben durch das Bundesumwelt-
hinsichtlich der Stromerzeugung, sondern auch der ministerium. Lokale Klimaschutzprojekte werden mit
Effizienz gestellt. Die im Entwurf des Strommarkt- mindestens 200.000 Euro je Projekt gefördert. Im Rahmen
gesetzes beschlossene Überführung von ca. 2,7 der Nationalen Klimaschutzinitiative (NKI) aus der die
GW Braunkohlekraftwerksleistung ist im Sinne der Kommunalrichtlinie zur Förderung von Klimaschutzpro-
Dekarbonisierungsstrategie ein Schritt in die richtige jekten in Kommunen hervorging, konnten bislang 7.000
Richtung, die Energiewende stellt allerdings eine Projekte in rund 3.000 Kommunen gefördert werden.
Herausforderung für Unternehmen verschiedener Aufgrund dieses Erfolgs plant das Umweltministerium bis
Branchen dar. Im Hinblick auf die Zwischenziele des 2019 das Budget für den kommunalen Klimaschutz weiter
Jahres 2020 sind nach aktuellem Monitoringbericht des aufzustocken.
Wirtschaftsministeriums noch große Anstrengungen
besonders im Wärme- und Verkehrsbereich nötig. Die DKB steht Stadtwerken, Kommunen und anderen
Viele sehen darin eine Gelegenheit, den Grundstein wichtigen Akteuren der Energiewende seit vielen
für eine funktionierende und umweltschonende Jahren mit maßgeschneiderten Produkten zur
Energieversorgung zu legen – und zugleich aktuelle Seite. Hindernissen begegnen wir mit innovativen
Megatrends wie Digitalisierung, Urbanisierung und Finanzierungskonzepten. Darüber hinaus begrüßen
demografischen Wandel miteinbezieht. wir den Willen zur Vernetzung und bringen deshalb
regelmäßig Akteure unterschiedlicher Branchen im
Damit aus der Gelegenheit ein Erfolg wird, muss ein
Rahmen diverser Veranstaltungen zusammen.
kollektives Umdenken in allen energierelevanten
Bereichen stattfinden. Unterschiedliche Marktakteure
sind gefordert, gemeinsam Lösungen zu erarbeiten und
umzusetzen. Es gilt: durch das Einbringen der eigenen
Stärken zusammen große Herausforderungen zu
meistern.
Die Stadtwerke sind als dezentrale Energieproduzenten
und -lieferanten das Fundament einer erfolgreichen
Energiewende. Sie haben das nötige Know-how und
die Erfahrung um Investitionen und Geschäftsideen im
Gesamtkontext regionaler Entwicklungen zu bewerten.
Sie agieren auf mehreren Wertschöpfungsstufen wie
Erzeugung, Verteilung und Vertrieb gleichzeitig und
kennen die stufenabhängigen Herausforderungen,
denen es sich zu stellen gilt. Sie beliefern die Bürger
nicht nur mit einem Energieträger, sondern mit
Strom, Wärme und Gas. Aber auch andere Player
wie beispielsweise Wohnungswirtschaft, Kommunal- Wir wünschen uns, dass die Leserinnen und Leser dieser
verwaltungen, Bürgergenossenschaften oder Projektierer Studie angeregt werden selbst aktiv zu werden oder ihr
können erheblichen Einfluss auf die Entwicklungen bisheriges Engagement zu erweitern und hoffen, dass
haben und einen Beitrag leisten. Im Laufe der letzten wir einen kleinen Beitrag für ein gemeinsames Gelingen
Jahre haben sich deshalb viele Kooperationen zwischen leisten können.
solchen Akteuren und Stadtwerken gebildet. Neben
dem gemeinsamen Bestreben hin zur sauberen
Thomas Jebsen
Energieversorgung gibt es darüber hinaus auf beiden
Seiten vielschichtige Motive sowohl strategischer als Mitglied des Vorstands
auch operativer Natur.6 Strukturwandel im Energiemarkt: Implikationen für die Unternehmenstätigkeit
1 Executive Summary
Die Umsetzung der klima- und energiepoli- Nicht zuletzt steht die Finanzierung im Fokus:
tischen Ziele der Bundesregierung führte zu der Ausbau Erneuerbarer Energien, Netzaus-
deutlichen Veränderungen auf dem Strommarkt. und -umbau oder neue Angebote im Bereich
Die Liberalisierung des Strommarkts sowie Energiedienstleistungen. Aber auch in neuen
die intensive Förderung erneuerbarer Geschäftsfeldern außerhalb des klassischen
Energien brachten enorme Veränderungen Energiebereichs soll verstärkt investiert werden,
der Marktstrukturen mit sich. So spielen hier v. a. in Quartiersentwicklungen oder neue
zukünftig insbesondere Digitalisierung, Big Mobilitätskonzepte. Zusätzlich führt das sich
Data und intelligente Technologien eine wandelnde Marktdesign dazu, dass sich neue
wesentliche Rolle. Mit der Neujustierung der Investitionen in die klassischen Kernbereiche,
bundesdeutschen Energiepolitik, welche u. und hier insbesondere in die Energieerzeugung
a. durch die erneute Reform des EEG, dem (effiziente und flexible GuD- oder Braunkohle-
geplanten Strommarktgesetz, dem geplanten kraftwerke) nicht mehr rentieren. Für die
Gesetz zur Digitalisierung der Energiewende geplanten Investitionen bzw. den Ausbau der
oder der geplanten Kapazitätsreservever- Geschäftstätigkeit können die gegenwärtigen
ordnung gekennzeichnet ist, wird sich Kapitalbedarfe noch aus dem laufenden
insbesondere das Strommarktdesign weiterhin Geschäftsbetrieb (Innenfinanzierung), über
verändern. Vor diesem Kontext müssen auch Gesellschaftereinlagen (Eigenkapitaler-
die Stadtwerke mit entsprechenden Geschäfts- höhungen oder Gesellschafterdarlehen) oder
strategien auf diese Herausforderungen über langfristige Bankdarlehen gedeckt werden.
reagieren.
Veränderte Erzeugungsstrukturen, An-
Die vorliegende Studie hat auf Basis einer passungen der Netzstrukturen, ein neues
Stadtwerkebefragung untersucht, welche Strommarktdesign und Auswirkungen der
Herausforderungen sich für Stadtwerke technologischen Entwicklung (Digitalisierung,
aus der Energiewende heraus ergeben und Big Data, intelligente Technologien etc.) wirken
welche Strategien genutzt werden, um diesen auf die traditionellen Geschäftsfelder und
entgegenzutreten. Dabei lag ein Schwerpunkt erfordern aus Perspektive der Stadtwerke die
auf den Sinn und Umfang möglicher Notwendigkeit, sich auf diese strukturellen
Kooperationen, die zwischen Stadtwerken und Veränderungen unternehmensstrategisch
relevanten Marktakteuren wie bspw. anderen neu auszurichten. Dies sehen alle Stadtwerke,
Energieversorgern, der Wohnungswirtschaft unabhängig vom jeweiligen Geschäftsfeld.
oder Kommunen gebildet werden. Im Detail werden von der überwiegenden
Mehrheit der Stadtwerke Veränderungs- bzw.
Gegenwärtig werden die Unternehmensziele der
Anpassungsbedarfe in den Vertriebsstruk-
Stadtwerke um zwei wesentliche Zielstellungen
turen, den Erzeugungsstrukturen und dem
der kommunalen Anteilseigner vorangestellt:
Bereich Services gesehen. Gut die Hälfte
sie sollen einerseits den kommunalen
der Stadtwerke erwartet zudem einen
Querverbund weiter unterstützen sowie eine
Rückgang des klassischen Kerngeschäfts
Daseinsvorsorge-Funktion gewährleisten
– der Versorgung von Haushalts- und
und andererseits Mindestrenditen an die
Gewerbekunden mit Strom, Gas und Wärme.
kommunalen Eigner ausschütten. Dabei sind
Mit diesen Veränderungen sollen verschiedene
fast alle Stadtwerke im Vertrieb von Strom,
Maßnahmen korrespondieren.
Gas und Wärme tätig und zugleich Betreiber
der dazugehörigen Netze. Gut zwei Drittel Die Vertriebsstrukturen sollen bspw. durch
sind zudem im Bereich Energieerzeugung neue Vertriebsmaßnahmen – etwa IT-gestützte
tätig, ebenso im Bereich Services (Service- Systeme, die schnelle und flexible Lösungen
dienstleistungen), bei größeren Stadtwerke für Kundenwünsche ermöglichen – angepasst,
spielt zudem der Energiehandel (Strom und Erzeugungsstrukturen durch Maßnahmen wie
Gas) eine bedeutende Rolle. ÖPNV oder die Betreiben bzw. Errichten dezentraler Stromer-
Wasserversorgung bilden nur bei einigen zeugungsanlagen mit den Kunden oder
befragten Stadtwerken Portfolioelemente. Bürgerbeteiligungen flankiert werden. Hohe
Aufmerksamkeit liegt dabei auf MaßnahmenStrukturwandel im Energiemarkt: Implikationen für die Unternehmenstätigkeit 7
im Bereich Services, da mit diesen zugleich Bezug wichtig ist. Dabei sollten entsprechende
der Rückgang des Kerngeschäfts kompensiert Kooperationen verbindlich-strategisch,
werden soll. Hier wurden bspw. Angebote von folglich langfristig und vertraglich geregelt,
Energieeffizienzmaßnahmen, digitalen Kommu- erfolgen. Zentrale Kooperationsfelder sind hier
nikationsdiensten oder die Kundenbindung Erneuerbare Energien, die Energieversorgung
durch eine engere Vernetzung der Stadtwerke und Energieeffizienz, weniger die
mit den Endkunden durch das Angebot Energieverteilung, Energiespeicherung,
„smarter“ Produkte genannt. Schließlich wollen Breitbandausbau oder die Entwicklung neuer
weit über die Hälfte der Stadtwerke zunehmend Geschäftsfelder. Damit sollen Kooperationen
Systemdienstleistungen erbringen. folglich vorrangig in den Kernbereichen
der Unternehmen stattfinden, welche
Aber nicht nur die oben benannten Aspekte
zunehmend unter Druck geraten. Die Ziele
sind für die Anpassung der Unternehmen-
entsprechender Kooperationen sind vielfältig.
stätigkeit verantwortlich. Auch das sich
Primär stehen die Kostensenkung und Prozes-
verändernde Marktumfeld bedingt diese.
soptimierung im Fokus, indem Skaleneffekte
So sehen gut zwei Drittel der Stadtwerke
gehoben und Synergiepotenziale generiert
in dem sich verändernden Verbraucher-
werden, um auch bei Großinvestitionen Risiko
verhalten – bspw. zunehmende Bereitschaft
und Investitionsvolumen zu diversifizieren.
zum Anbieterwechsel – Anpassungsnot-
Stärkere Kundenorientierung und folglich
wendigkeiten. Aber auch aus der Nachfrage
eine höhere Kundenbindung werden durch
nach anderen bzw. neuen Dienstleistungen
Kooperationen angestrebt. Nicht zuletzt spielen
und Produkten seitens der Kunden ergibt
Kooperationen zur Sicherung der kommunalen
sich ein entsprechender Handlungsbedarf.
Daseinsvorsorge durch integrierte kommunale
Schließlich wirken hierauf auch sich wandelnde
Versorgungskonzepte, zur Know-how-Gewin-
Lieferbeziehungen und Kundenstruktur.
nung für das eigene Unternehmen sowie zur
Risikostreuung eine größere Rolle.
Um auf diese Veränderungen zu reagieren,
stehen den Stadtwerken verschiedene
Kooperationen mit anderen Sektoren werden
Möglichkeiten offen: Sie können v. a. neue
interessanter. Unternehmen der Wohnungs-
Geschäftsfelder entlang der Wertschöp-
wirtschaft, Kommunalverwaltungen und
fungskette (Erzeugung, Netze/Verteilung,
Privatpersonen im Rahmen von Bürgergenos-
Beschaffung/Handel und Vertrieb) erschließen,
senschaften bilden für Stadtwerke neue Partner.
bspw. im Bereich IT oder Shared Services.
Erneuerbare Energien, Energieverteilung und
Ferner können bestehende Geschäftsfelder
Energiedienstleistungen werden hierbei als
erweitert oder neue Geschäftsfelder
Felder genannt. In der Wohnungswirtschaft
außerhalb der Wertschöpfungskette, bspw.
sind neben der Energieversorgung vor allem
Entwicklung energetischer Quartierskonzepte
die Energieeffizienz und die Erbringung
oder Elektromobilität, generiert werden.
von Energiedienstleistungen entscheidend.
Nischenmärkte bzw. Innovationsfelder,
Klassischerweise deutet dies auf Projekte
bspw. Entwicklung und Vertrieb intelligenter
wie energetische Quartiersentwicklung und
Technologien im Bereich Energie, werden
autarke/quartiersbezogene Energiever-
interessanter. Dabei sehen die Stadtwerke
sorgungsprojekte (Mini-BHKW, Mieterstrom-
vorrangig in erstgenannter Option einen
modelle etc.) hin. Da es sich hier um eine
wesentlichen Strategieansatz, aber auch
Zusammenarbeit außerhalb der klassischen
die zweite Option ist für über zwei Drittel
Geschäftsfelder der Stadtwerke handelt,
der Stadtwerke relevant. Nur wenige
wird vorrangig eine unverbindlich-situa-
Stadtwerke sehen in der Erschließung neuer
tive, d.h. auf konkrete Maßnahmen bzw.
Geschäftsfelder außerhalb der Wertschöpfung-
Projekte beschränkte, Kooperation bevorzugt.
skette oder der Spezialisierung auf Nischen
Mit Kommunalverwaltungen werden
bzw. Innovationsfelder eine geeignete Strategie.
vorrangig Projekte von Energieeffizienz,
Kooperationen bilden dabei ein strategisches Energieversorgung, Energiedienstleistungen
Element, wobei hier der lokale bzw. regionale und Elektromobilität interessant. Besonders8 Strukturwandel im Energiemarkt: Implikationen für die Unternehmenstätigkeit
die Kooperationsbereiche Energieeffizienz
und Elektromobilität werden durch gesetzlich
abgeleitete Maßnahmen im Rahmen der
Energiewende beschleunigt, da konkrete
Energieeffizienzziele für den kommunalen
Gebäudebestand, Verbrauchsreduktionsziele
oder Treibhausgasemissionsreduktionsziele
und Ziele für den Bereich Elektromobilität
vorgeben werden. Aber auch die Vielzahl von
Förderprogrammen und damit die Aussicht auf
Fördermittel können Kooperationen in diesen
Bereichen befördern. Zugleich sind Stadtwerke
als oftmals kommunale Unternehmen hier
„natürliche“ Kooperationspartner und zugleich
„Know-how-Lieferanten“. Simultan bietet sich
hier für die Stadtwerke die Möglichkeit, neue
Geschäftsfelder zu erschließen.
Nicht zuletzt haben Bürgergenossen-
schaften und Projektentwickler Potenzial
für Kooperationsmodelle. In Bürgergenos-
senschaften sehen Stadtwerke v. a. im
Bereich Energieerzeugung/Erneuerbare
Energien einen Kooperationspartner, was
mithin in der regionalen Verankerung der
Stadtwerke allgemein und der Bindung der
dahinterstehenden Privatpersonen an das
Unternehmen im Speziellen begründet werden
kann. Zugleich kann hierin aber auch eine
Möglichkeit der Kostenteilung bei Investitionen
in den Ausbau erneuerbarer Energien
gesehen werden. Mit Projektentwicklern wird
erwartungsgemäß projektbezogen kooperiert,
dabei stehen v. a. die Bereiche Erneuerbare
Energien/Energieerzeugung, Energieversorgung
und Energiespeicherung im Mittelpunkt.
Tendenziell sind dies eher technische Bereiche
und deuten auf eine Zusammenarbeit bezogen
auf Planung und Durchführung technischer
Projekte. Folglich könnte dies als Outsourcing
bestimmter, kostenintensiver Unternehmens-
bereiche gedeutet werden.Strukturwandel im Energiemarkt: Implikationen für die Unternehmenstätigkeit 9
2 Institutioneller Rahmen
und Studiendesign
Die energiepolitischen Ziele der Bundes- Strukturen sind mit denen privatwirtschaft-
regierung umfassen neben dem unter dem licher Konzerne vergleichbar. Diese
Begriff „Energiewende“ zusammengefassten Entwicklungen stellen neue Herausforderungen
Umbau der Energieversorgung hin zu einer an das kommunale Beteiligungsmanagement.
möglichst vollständigen Energieerzeugung aus Zudem bestehen durch Zuschusszahlungen
erneuerbaren Energien ebenfalls Maßnahmen und die Ausgliederung von Verbindlichkeiten
zur Energieeffizienz, Energieeinsparung und zahlreiche Verknüpfungen zwischen den
Reduzierung der CO2-Emissionen. Stadtwerke städtischen Unternehmen und dem städtischen
als regional verankerte Versorgungsunter- Haushalt. Aber auch strategisch bietet der
nehmen haben diese fundamentalen Mark- „Konzern Kommune“ zahlreiche Chancen,
tveränderungen bei ihren Entscheidungen bestehende Herausforderungen, wie das
über zukünftige Strategien und Geschäfts- Gelingen der Energiewende auf kommunaler
feldentwicklungen zu berücksichtigen, um ihrer Ebene durch Vernetzung und intelligenter
wichtigen Rolle am Gelingen der Energiewende Steuerung zu erreichen. So ergeben sich daraus
gerecht zu werden. Die Energiewende führt in neue Kooperationsfelder von Stadtwerken im
ihrer derzeitigen Ausgestaltung allerdings nicht Rahmen von Mobilitätskonzepten im ÖPNV oder
automatisch zu Vorteilen für Stadtwerke und in der Quartiersentwicklung mit Wohnungsun-
andere EVU. So treten durch Einspeisevorrang ternehmen.
und -vergütung für erneuerbare Energien
Vor diesem Hintergrund verfolgen
gerade für moderne, effiziente konventionelle
zahlreiche Unternehmen die Strategie,
Erzeugungsanlagen Wirtschaftlichkeit-
neue Geschäftsfelder zu erschließen und
sprobleme auf. Diese können nicht mehr
auch innerhalb solcher zu kooperieren,
kostendeckend betrieben werden.
wobei dies sowohl horizontale, vertikale
als auch diagonale (bspw. branchenfremde
Dennoch wird besonders von öffentlicher
Unternehmen) Kooperationen umfassen kann.
Seite erwartet, im Rahmen der Energiewende
So kann bspw. ein Stadtwerk im Rahmen der
mit „gutem Beispiel“ voranzugehen und
energetischen Sanierung von Wohnquartieren
entsprechende Maßnahmen zu ergreifen.
und in Kooperation mit dem kommunalen
Dies betrifft in erster Linie die Kommunen
Wohnungsunternehmen im Rahmen eines
und ihre Energieversorger, die Stadtwerke.
integrierten Entwicklungskonzepts die
Derartige Maßnahmen schließen bspw.
Konzeption, Errichtung und Betreibung
Konzepte zur Energieverbrauchseinsparung,
von Anlagen zur Energieerzeugung aus
effiziente Energieversorgung und Nutzung
erneuerbaren Energieträgern vornehmen und
eines möglichst hohen Anteils erneuerbarer
damit die Energieversorgung des Quartiers mit
Energien und deren Integration und Umsetzung
dezentralen Anlagen als neues Geschäftsfeld
im Rahmen kommunaler Energiekonzepte ein.
erschließen.
Hierfür bedarf es entsprechender Konzepte
und Strategien, die eine Vielzahl von Akteuren Stadtwerke sind hierbei die zentralen
einbinden müssen und von Stadtwerken als Instrumente zur Umsetzung der kommunalen
kommunale Unternehmen angetrieben werden. energiepolitischen Ziele im Rahmen der
Insbesondere im Rahmen sog. „Kommunaler Energiewende. Aus ihrer wirtschaftlichen
Energiekonzepte“, die zwar z. T. bereits Betätigung und einem sich immer stärker
integraler Bestandteil kommunaler Stadt- ändernden Marktumfeld ergeben sich für die
entwicklungsplanungen sind, empfiehlt sich Stadtwerke selbst neue Herausforderungen,
die integrative Einbindung von Stadtwerken welche die Erschließung neuer Geschäftsfelder
als Know-how-Träger und Partner vor Ort. Hier erfordern. Bspw. steigt die Wechsel-
spielt der „Konzern Kommune“ eine zentrale bereitschaft der Stadtwerke-Kunden. Strom
Rolle. Durch die Ausgliederung zahlreicher ist ein homogenes Gut. Eine Abgrenzung von
Aufgaben der Daseinsvorsorge aus dem Wettbewerbern ist vor diesem Hintergrund
städtischen Kernhaushalt entstand in vielen nicht unkompliziert. Ferner werden immer
Städten ein Geflecht zahlreicher kommunaler mehr Privat- und Geschäftskunden zukünftig
Unternehmen. Die dabei entstandenen aufgrund des herrschenden Energiemarkt-10 Strukturwandel im Energiemarkt: Implikationen für die Unternehmenstätigkeit
designs von Konsumenten zu Produzenten strukturell angespannte fiskalische Lage der
(Bürgerprojekte, eigene Erzeugungsanlagen Städte und Gemeinden rückt die effiziente
von Unternehmen, Langfristverträge etc.). Die und effektive Performance der kommunalen
Frage ist, ob und wie Stadtwerke an diesem Unternehmen immer stärker in den Fokus.
Trend im Kontext ihrer regionalen Verankerung
partizipieren können. Die Unternehmen Als kommunale Gesellschaften sind
stehen vor diesem Hintergrund derzeit vor Stadtwerke gefragt, an entsprechenden
großen Herausforderungen. Einerseits stehen integrierten Konzepten mitzuwirken, da ihre
Stadtwerke im Wettbewerb, sind als kommunale originären Geschäftsfelder direkt von den
Energieversorger allerdings mit einer Vielzahl energie- und klimapolitisch induzierten
von Restriktionen konfrontiert (bspw. eine Vorgaben und Maßnahmen betroffen
starre Kommunalgesetzgebung, die das sind. In der Kommunalwirtschaft bildet die
wirtschaftliche Agieren über Gemeindegrenzen Interaktion von Wettbewerb und öffentlicher
hinweg untersagt oder bei kommunaler Anteil- Aufgabenerfüllung eine zentrale Säule und
seignerschaft kommunale Vorgaben wie bspw. wirkt direkt auf die strategische Ausrichtung der
Querfinanzierungen oder Gewinnausschüt- Unternehmen. Dabei wird häufig argumentiert,
tungen beinhaltet). Die Unternehmen stehen dass Wettbewerb einerseits und die kommunal
vor der Frage, wie sie dennoch in einem sich zu gewährleistende Daseinsvorsorge
ständig verändernden energiewirtschaftli- andererseits schwer in Übereinstimmung
chen Umfeld künftig erfolgreich positionieren zu bringen sind. Demgegenüber vertritt die
können. Europäische Kommission die Auffassung, dass
Wettbewerb ein zentrales Element für eine
In den letzten Jahren wurden – häufig fiskalisch
adäquate Daseinsvorsorge darstellt. Aufgrund
induziert – die Aufgaben im kommunalen
dieser vielschichtigen Herausforderungen aus
Wirtschaften stärker gebündelt. Im Fokus
Markt und Politik ist es derzeit für Stadtwerke
steht häufig der „Konzern Stadt“, aus dessen
nicht leicht, sich nachhaltig strategisch zu
Perspektive die konzertierte Durchführung,
positionieren.
Steuerung und Verteilung der Aufgaben und
Versorgungsleistungen die zentrale Rolle Die Studie, die das Kompetenzzentrum
spielt. Neue institutionelle oder gesellschafter- Öffentliche Wirtschaft, Infrastruktur und
strukturbezogene Veränderungen können vor Daseinsvorsorge e. V. an der Universität Leipzig
diesem Hintergrund für Stadtwerke notwendig gemeinsam mit der DKB Deutsche Kreditbank
werden. Nachdem in den letzten Jahre die AG erstellt hat, analysiert auf Basis einer
Diskussion um Privatisierung vs. Rekommu- Stadtwerke-Befragung Herausforderungen
nalisierung im Vordergrund stand, implizieren sowie Handlungsfelder für Stadtwerke, die
derzeit die bereits genannten Kooperations- sich aus dem Strukturwandel im Energiemarkt
lösungen wesentliche Marktveränderungen, ergeben. Speziell institutionelle Auswirkungen
in horizontaler, vertikaler und diagonaler auf den Konzern Kommune stehen im Zentrum
Dimensionierung eine Herausforderung der Studie. Folgende Fragestellungen wurden
und Anpassungsoption. Im Hinblick auf die untersucht:Strukturwandel im Energiemarkt: Implikationen für die Unternehmenstätigkeit 11
Studien
Herausforderungen
Welche Herausforderungen
Fragestellungen ergeben sich für Stadtwerke
aus der Energiewende für ihre
Geschäftsfelder?
Strategie
Welche Strategien werden
Neue Geschäftsfelder
genutzt, um diesen Welche Rolle spielen hierbei
Herausforderungen neue Geschäftsfelder?
entgegenzutreten?
Integration
Kooperation Werden mit anderen Organisation
(kommunalen) Unternehmen
Werden neue Geschäftsfelder Wie wird die Zusammenarbeit
im Rahmen integrierter
auch durch Kooperationen, bei neuen Geschäftsfeldern
Konzepte gemeinsam eine
und hier speziell vertikale organisiert (interne und externe
Strategie bzw. gemeinsam neue
Kooperationen, erschlossen? Strukturen)?
Geschäftsfelder entwickelt und
falls ja, in welchen Bereichen?
Methodisch erfolgt im Rahmen der Studie eine empirische Untersuchung durch eine schriftliche, standardisierte
Befragung. Es wurden 680 Unternehmen befragt, wovon 83 an der Umfrage teilnahmen. Der Rücklauf lag bei 12,03%.12 Strukturwandel im Energiemarkt: Implikationen für die Unternehmenstätigkeit
3 Aktuelle Entwicklungen im
Energiemarkt
Die Energieversorgung in Deutschland Betrachtung der bisherigen Entwicklung im
soll entsprechend des energie- Sinne einer Trendbeschreibung erfolgen.
politischen Zieldreiecks wirtschaftlich und
Die Reduzierung der Treibhausgasemissionen
umweltverträglich sein sowie hohes Maß
gegenüber 1990 betrug im Jahr 2014 ca. 28%.
an Versorgungssicherheit gewährleisten.
Dabei ging der Ausstoß von Treibhausgasen
Diese Ziele stehen dabei gleichwertig
von etwa 1.250 Tonnen CO2-Äquivalent im
nebeneinander. Zugleich setzt die
Jahr 1990 auf 902 Tonnen im Jahr 2014 zurück.
Bundesregierung mit ihren klima- und ener-
Nach aktuellem Stand sind diese im Jahr 2015
giepolitischen Zielstellungen den politich-
gegenüber dem Vorjahr wieder leicht auf 908
rechtlichen Rahmen des Energiemarkts. Im
Tonnen gestiegen, sodass der prozentuale Wert
Zuge der Energiepolitik der Bundesregierung
zur Treibhausgasreduktion gegenüber 1990 für
wird neben dem Ziel der Energie-
2015 nach unten korrigiert werden muss.⁴
verbrauchsreduktion und der Steigerung
der Energieeffizienz auch der Umbau der Bisher wurde der Energiemarkt maßgeblich
Erzeugungsstrukturen hin zu erneuerbaren durch den Auf- und Ausbau von Erzeugungs-
Energien forciert. Dafür sind zahlreiche kapazitäten erneuerbaren Energien als
Maßnahmen erforderlich, welche sich auf die zukünftigen Hauptenergielieferant geprägt,
verschiedenen Segmente des Energiemarkts zudem ging es vorrangig um den Netzaus- und
auswirken, bspw. auf den Bereich Energieüber- -umbau infolge des Wandels von zentralen
tragung und Energieverteilung, den Bereich zu dezentralen Erzeugungsstrukturen.
Energieerzeugung, aber auch Bereiche wie Weiterhin bildeten erste Bemühungen der
Energiehandel. Die große Herausforderung Systemintegration der erneuerbaren Energien
der erneuerbaren Energien bleibt aber die sowie Speicherlösungen den Kern. Unter
hohe Fluktuation und die noch fehlende dem Begriff „Energiewende 2.0“ wird aktuell
Speichertechnologie. Um Versorgungssicherheit die digitale Transformation des Energiever-
zu gewährleisten, werden „Brückentechnolo- sorgungssystems diskutiert. Deren Hauptziel
gien“ benötigt, solange noch keine vollständige bildet die Digitalisierung der gesamten
Systemintegration der erneuerbaren Energien Wertschöpfungskette (Energieerzeugung,
erfolgt ist und die Übertragungs- und Speicherung und Verbrauch) sowie die
Verteilnetze nicht in dem Maße aus- und effiziente Verknüpfung aller Sektoren
umgebaut wurden, dass diese Erzeugung und (bspw. Strom, Wärme oder Verkehr) und
Verbrauch in nahezu Echtzeit steuern können. möglichst vieler dezentraler (Erzeugungs-)
Nach dem Atomausstieg ist die ursprünglich als Einheiten untereinander. Darüber hinaus
Brückentechnologie vorgesehene Kernenergie gilt es im Hinblick auf das energiepolitische
weggefallen. Der Steinkohlebergbau soll Zieldreieck, neben der Umweltverträglich-
bis 2018 eingestellt werden. Daher kommt keit auch dauerhaft – insbesondere jedoch
gegenwärtig der Braunkohle, aber auch Erdgas in der Übergangsphase – die Versorgungs-
hier eine wesentliche Rolle zu. sicherheit und die Wirtschaftlichkeit der
Energieversorgung bei wachsenden Anteilen
Tabelle 1 illustriert zunächst die quantitativen
der Erneuerbaren Energien zu gewährleisten,
Ziele der deutschen Energiepolitik bis 2050
folglich diese vollkommen in das Energie-
und die daraus abgeleiteten Teilziele für die
versorgungssystem zu integrieren und auch
Jahre 2020, 2030 und 2040 mit dem Status
an Systemdienstleistungen zu beteiligen.
quo 2014/2015. Die quantitativen Ziele
Vor dem Hintergrund ist seitens der
beziehen sich dabei auf Bereiche Treibhausgas-
Bundesregierung eine tiefgreifende Reform
emission, erneuerbare Energien sowie Effizienz
des Strommarktes geplant, die perspektivisch
und Verbrauch. Ein Großteil dieser Ziele
zu einer vollständigen Marktintegration der
bezieht sich dabei auf die (z. T. stufenweise)
Erneuerbaren Energien führen soll.⁵
Erreichung einer vorgegebenen Reduktion
innerhalb eines bestimmten Zeitraums – i. d. Diesen Trends unterliegen auch die Stadtwerke
R. für das Jahr 2020 und/oder 2050. Hier kann als regionale Energieversorgungsunter-
die Zielerreichung lediglich über die Ex-Post- nehmen. Insbesondere durch die Liberal-Strukturwandel im Energiemarkt: Implikationen für die Unternehmenstätigkeit 13
isierung des Strommarkts und die mit der Novelle
⁴ Nach Angaben des Umweltbundesamts nahm die Treibhausgasemission um 0,7%
des EEG 2012 beschlossene Förderung der
gegenüber 2014 zu, was einer Emission von 908 Tonnen CO2-Äquivalent führt
Direktvermarktung von Strom aus erneuerbaren
(vgl. UBA 2016).
Energien führten zu einem hohen Anpassungsdruck
für Stadtwerke. Die Liberalisierung des Strommarkts
⁵ Vgl. bspw. Rottmann/Grüttner/Kilian 2016, S. 28
umfasste dabei als wesentliche Elemente die freie
Anbieterwahl seitens der Verbraucher und die standort-
unabhängige Leistungsanbietung der Stromversorger,
die Förderung der Direktvermarktung führte zu
zahlreiche neue Stromerzeuger auf den Markt. Zugleich
führte insbesondere auch die Direktvermarktung
von Strom aus erneuerbaren Energien infolge deren
niedrigen Produktionskosten zu deutlich sinkenden
Börsenstrompreisen. Auch hieraus ergibt sich die
Notwendigkeit neuer Geschäftsstrategien.
Tabelle 1: Quantitative Ziele der Energiewende und Status quo 2015
Zielvorgaben Status quo
2020 2030 2040 2050 2014/2015
Treibhausgasemission
Treibhausgasemission gegenüber 1990 mind. -40% mind. -55% -27,4%*
Erneuerbare Energien
Anteil am Bruttoendenergieverbrauch 18% 30% 45% 60% 13,5%
mind. 50% mind. 65%
Anteil am Bruttostromverbrauch mind. 35% EEG 2025: EEG 2035: mind. 80% 32,6%*
40 bis 45% 55 bis 60%
Anteil am Wärmeverbrauch 14% 13,2%*
Anteil im Verkehrsbereich 10% 5,3%*
Effizienz und Verbrauch
Primärenergieverbrauch ggü. 2008 -20% -50% -8,7%
Endenergieproduktivität 2008 - 2050 2,1% pro Jahr (2008 - 2050) 1,6% p. a.
Bruttostromverbrauch ggü. 2008 -10% -25% -4,6%
Primärenergiebedarf Gebäude ggü. 2008 -80% -14,8%
Wärmebedarf Gebäude ggü. 2008 -20% -12,3%
Endenergieverbrauch Verkehr ggü. 2005 -10% -40% 1,7%
* Aktualisierte Angaben für 2015 nach UBA 2016. Quelle: BMWi 2015, S. 714 Strukturwandel im Energiemarkt: Implikationen für die Unternehmenstätigkeit
4 Strukturwandel im Energiemarkt:
Implikationen für die Unternehmenstätigkeit der Stadtwerke
4.1 Befragungsdesign 4.2 Unternehmenskontext
Die Stadtwerke-Erhebung gliedert sich in drei An der Studie beteiligten sich 83 Stadtwerke.
Befragungsteile. In Teil A wurden allgemeine Die regionale Verteilung ist in Abbildung 1
Unternehmensangaben, wie Unternehmenssitz, dargestellt. Der Großteil der teilnehmenden
Anteilseigner- und Zielstruktur sowie Unterne- Unternehmen kam aus den Ländern
hmenssparten und Kundenstruktur erhoben. Nordrhein-Westfalen (19,3%), Baden-
Befragungsteil B fokussiert Herausforderungen Württemberg (16,9%) und Niedersachsen
aus der veränderten Energiepolitik für die (13,3%). Insgesamt nahmen mit einem Anteil
Unternehmen, bezogen auf Unternehmens- von über zwei Dritteln verstärkt Unternehmen
tätigkeit, Investitionen oder Unternehmens- aus den westdeutschen Bundesländern an der
umfeld. Teil C rekurriert auf mögliche Strategien, Umfrage teil.
mit denen den Herausforderungen begegnet
werden soll. Hierbei liegt ein Schwerpunkt auf Die häufigste Rechtsform bildet mit 83,1% die
Kooperationen, welche nach Kooperationsrich- GmbH. Der kommunale Eigenbetrieb spielt mit
tung, -tiefe und Sektoren differenziert werden. 2,4% der Nennungen eine nachrangige Rolle
(Abbildung 2).
Abbildung 1: Unternehmenssitz der teilnehmenden Stadtwerke nach Ländern*
Nordrhein-Westfalen 19,3%
Baden-Württemberg 16,9%
Niedersachsen 13,3%
Sachsen 10,8%
Sachsen-Anhalt 10,8%
Bayern 9,6%
Mecklenburg-Vorpommern 4,8%
Brandenburg 3,6%
Hessen 3,6%
Rheinland-Pfalz 2,4%
Thüringen 2,4%
Saarland 1,2%
Schleswig-Holstein 1,2%
n=83; Quelle: Kompetenzzentrum und DKB (2016).
* Aufgrund von Rundungsdifferenzen ist es möglich, dass in der Summierung der Abbildungen nicht genau 100% erreicht werden.Strukturwandel im Energiemarkt: Implikationen für die Unternehmenstätigkeit 15
Abbildung 2: Rechtsform der teilnehmenden Stadtwerke
GmbH
GmbH 83,1%
83,1%
GmbH&&Co.
GmbH Co.KGKG 10,8%
10,8%
AGAG 3,6%
3,6%
Eigenbetrieb
Eigenbetrieb 2,4%
2,4%
Quelle: Kompetenzzentrum und DKB (2016).
Kommunale Anteilseigner dominieren die Zusammensetzung des Gesellschafterkreises. Insgesamt sind
60,2% der Unternehmen zu 100% in kommunaler Anteilseignerschaft. Jedoch zeigen sich hier regionale
Unterschiede. Besonders hoch ist die Anzahl solcher Unternehmen in den Bundesländern Mecklen-
burg-Vorpommern, Brandenburg, Hessen und Niedersachsen⁶, hingegen sind Unternehmen mit 100%
kommunalen Anteilseignern in Baden-Württemberg und Sachsen-Anhalt deutlich weniger vertreten.
⁶ Aufgrund der geringen Nennungen ist die
Aussagekraft für die Länder Schleswig-
Holstein, Saarland, Rheinland-Pfalz und
Thüringen eingeschränkt.
Abbildung 3: Anteilseignerstruktur nach Bundesländern
Baden-Württemberg 42,9% 50,0% 7,1%
Bayern 100,0%
Brandenburg 66,7% 33,3%
Hessen 66,7% 33,3%
Mecklenburg-Vorpommern 100,0%
Niedersachsen 63,6% 36,4%
100% kommunal
Nordrhein-Westfalen 56,3% 43,8%
Rheinland-Pfalz 50,0% 50,0%
unter 100% - 50% kommunal
Saarland 100,0%
Sachsen 55,6% 44,4%
unter 50% - 25% kommunal
Schleswig-Holstein 37,5% 50,0% 12,5%
Sachsen-Anhalt 100,0% unter 25% kommunal
Thüringen 50,0% 50,0%
Quelle: Kompetenzzentrum und DKB (2016).16 Strukturwandel im Energiemarkt: Implikationen für die Unternehmenstätigkeit
Der Gesellschafterkreis der teilnehmenden Unternehmen ist dabei wenig diversifiziert. 65,1% der
Unternehmen mit ausschließlich kommunaler Anteilseignerstruktur befinden sich im Eigentum
eines kommunalen Gesellschafters. Sofern eine private Beteiligung vorliegt, überwiegt auch
hier mit 26,5% die Beteiligung eines privatrechtlichen Anteilseigners.
Abbildung 4: Anzahl privater und kommunaler Anteilseigner der Unternehmen
4,8% 6,0% 4,8% 6,0%
13,3% 13,3%
24,1% 24,1%
26,5% 26,5% 60,2% 60,2%
Anzahl Anzahl
privater kommunaler
Anteilseigner 65,1% 65,1% Anteilseigner
keinen genau 1 2 bis 5 mehr als 5
Quelle: Kompetenzzentrum und DKB (2016).
Kommunale Anteilseigner richten ihren Schwerpunkt in der
Steuerung der teilnehmenden Stadtwerke auf zwei Aspekte:
die Unterstützung des kommunalen Querverbundes und
die Vorgabe einer Mindestausschüttung.
Abbildung 5: Einflussbereiche der kommunalen Anteilseigner
Kommunaler Querverbund 50,6%
Mindestausschüttung 44,6%
Investitionsvorgaben 26,5%
Bürgerbeteilligungen 7,2%
Sonstige / Andere 10,8%
Quelle: Kompetenzzentrum und DKB (2016).Strukturwandel im Energiemarkt: Implikationen für die Unternehmenstätigkeit 17
50,00
Eigenkapitalquote - Vergleich
45,00
50,00
39,5 39,8 40,0
40,00 39,3 38,5 38,3 38,3
DIES KORRESPONDIERT 35,00
45,00
AUCH MIT DEN 40,00
39,5 39,3 39,8 40,0
38,5 38,3 38,3
ERGEBNISSEN DES
30,00
35,00
STADT WERKE- 25,00
2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
VERGLEICHS, WELCHEN DIE
30,00
DEUTSCHE KREDITBANK 25,00
2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
IM ZUGE IHRER Mittlere Streuung Median
KUNDENAUSWERTUNG
87,9 87,9 87,9
90,00 90,00 90,00
DURCHFÜHRT HAT.
Aussschüttungsquote
80,5 - 80,5
80,6 Vergleich
78,6
80,6 81,2
80,5
78,6
80,6 81,2
78,6
81,2
80,00 80,00 80,00
75,9 75,9
87,9 75,9
80%
90,00
71,4 71,4 71,4
70,00 70,00 70,00 81,2
80,5 66,9 80,6 66,9 66,9
63,9 63,980,00 64,2 63,9 64,2 64,2 63,6 78,6
63,1 63,6 63,1 63,1 63,6
75,9 62,8 62,8 62,8
59,4 59,4 59,4
ca.
60,00 60,00 60,00 71,4
55,6 55,6 55,6
70,00
66,9
63,9 50,4 50,4 50,4
64,2 63,1 63,6
50,00 50,00 50,00 62,8
59,4
60,00
41,5 43,4 41,5
55,6 43,5 43,4 41,5 43,5 43,4 43,5
39,3 39,3 39,3
40,00 40,00 40,00
34,7 34,7 34,7 50,4
50,00
DER STADT30,00
WERKE 30,00 40,00
30,00
39,3
41,5 43,4 43,5
SCHÜT TETEN 2014 AN 2008
IHRE
34,7
20,00 20,00 20,00
20092008 2010 2009 2008
20112010 2009
2012 2011 2010
2013 2012 2011
2014 2013 2012 2014 2013 2014
30,00
ANTEIL SEIGNER AUS.
20,00
2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
ÜBER Durchschnitt komm. Stadtwerke komm. Anteil < 100%
85%
12,00
Investitionsquote - Vergleich
10,00
12,00
8,00
10,00 6,9 7,1 6,9
6,1 6,1
6,00
DAVON TATEN 8,00
4,8 4,9
6,9 7,1 6,9
DIES MIT EINER
4,00 6,1 6,1
6,00
4,8 4,9
AUSSCHÜT TUNGSQUOTE 2,00
2008
4,00
2009 2010 2011 2012 2013 2014
VON ÜBER 50%.
2,00
2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
Mittlere Streuung Median18 Strukturwandel im Energiemarkt: Implikationen für die Unternehmenstätigkeit
Privatrechtliche Anteilseigner nehmen neben ihrer Kontroll- und Aufsichtsfunktion insbesondere
eine fachspezifisch beratende Rolle ein. Zudem stellen sie für die teilnehmenden Stadtwerke
oftmals einen weiteren strategischen Partner dar.
Knapp die Hälfte der teilnehmenden Stadtwerke weist eine mittlere Unternehmensgröße auf
(Umsatz zwischen 25 und 100 Mio. € p.a.; 49,4%), etwa ein Viertel der Unternehmen liegen unter
25 Mio. € Jahresumsatz.
Abbildung 6: Unternehmensgröße anhand des Jahresumsatzes 2014
weniger als 10 Mio. Euro 8,4%
10 Mio. bis 25 Mio. Euro 15,7%
25 Mio. bis 50 Mio. Euro 26,5%
50 bis 100 Mio. Euro 22,9%
mehr als 100 Mio. Euro 18,1%
keine Angabe 8,4%
Quelle: Kompetenzzentrum und DKB (2016).
Diese spiegelt sich ebenfalls in der Anzahl der versorgten Kunden wider. Die Mehrheit der
Studienteilnehmer verfügt über bis zu 40.000 Privatkunden, bis zu 1.000 private Gewerbekunden
und bis zu 75 öffentliche Gewerbekunden. Dabei überwiegen Unternehmen, welche 10.000 bis
25.000 Privatkunden, 100 bis 500 private Gewerbekunden und 10 bis 25 öffentliche Gewerbekunden
versorgen.
Abbildung 7: Anzahl der Privatkunden (SLP-Kunden⁷)
Anzahl versorgter Privathaushalte
weniger als 5.000 6,0%
5.000 bis 10.000 10,8%
10.000 bis 25.000 32,5%
25.000 bis 40.000 16,9%
mehr als 40.000 12,0%
keine Angabe 21,7%
Quelle: Kompetenzzentrum und DKB (2016).
⁷ Standard-Last-ProfilStrukturwandel im Energiemarkt: Implikationen für die Unternehmenstätigkeit 19
Abbildung 8: Anzahl der privaten Unternehmen (RLM-Kunden⁸)
weniger als 50 4,8%
versorgte private Unternehmen
50 bis 100 7,2%
100 bis 500 31,3%
500 bis 1.000 10,8%
mehr als 1.000 19,3%
keine Angabe 26,5%
Quelle: Kompetenzzentrum und DKB (2016).
⁸ Registrierende Leistungsmessung
Abbildung 9: Anzahl der öffentlichen Institutionen (RLM-Kunden)
versorgte öffentliche Institutionen
weniger als 5 10,8%
5 bis 10 4,8%
10 bis 25 21,7%
25 bis 75 14,5%
mehr als 75 16,9%
keine Angabe 31,3%
Quelle: Kompetenzzentrum und DKB (2016).20 Strukturwandel im Energiemarkt: Implikationen für die Unternehmenstätigkeit
Die teilnehmenden Stadtwerke verfügen über eine hohe, regionale, wenngleich produktspezi-
fische Wertschöpfungstiefe. Nahezu alle Teilnehmer sind im Vertrieb der Kernprodukte Strom, Gas
und Wärme und dem Betrieb der dazugehörigen Netze tätig. Abhängig vom Geschäftsfeld wird
die Wertschöpfungstiefe um die Erzeugung (Strom, Wärme) und das Angebot von Zusatzdienst-
leistungen (z. B. Messdienstleistungen) ergänzt. Der Handel mit Strom und Gas wird von größeren
Stadtwerken betrieben und ist aufgrund der Gewichtung dieser Stadtwerke in der Gesamtgruppe
dieser Studie ein nachrangiges Geschäftsfeld. Der Betrieb des regionalen öffentlichen Nahverkehrs
spielt mit 12,0% ebenfalls eine untergeordnete Rolle. In Bezug auf sonstige Aufgabenfelder wurden
die Wasserversorgung und der Bäderbetrieb am häufigsten genannt.
Der Ausbau erneuerbarer Energien, der Netzaus- und -umbau und neue Dienstleistungen im
Energiebereich, neue Geschäftsfelder wie Quartiersentwicklung oder neue Mobilitätskonzepte
korrespondieren mit einem erhöhten Bedarf an Finanzmitteln. Ferner rechnen sich derzeit aufgrund
des Marktdesigns vielfach die hohen Investitionen in effiziente GuD- oder anderen konventionelle
Kraftwerke für viele Stadtwerke nicht. Die Studienteilnehmer finanzieren den Ausbau ihrer
Geschäftstätigkeit zum einen aus dem laufenden Geschäftsbetrieb (Innenfinanzierung), über
Gesellschaftereinlagen (Eigenkapitalerhöhungen oder Gesellschafterdarlehen) oder über
langfristige Bankdarlehen. Keines der teilnehmenden Stadtwerke gab an, dass der bisher
erforderliche Kapitalbedarf nicht gedeckt werden konnte. Zudem wurde kein Änderungsbedarf
im Hinblick auf die gewählte Finanzierungsform oder die verwendeten Finanzierungsprodukte
benannt. Klassische Bankfinanzierungen werden somit bevorzugt. Dies ist vor allem in den sehr
günstigen Finanzierungskosten begründet. Die Aufnahme zusätzlichen Fremdkapitals ist jedoch
nicht unbegrenzt möglich und nur den Unternehmen offen, die über eine ausreichende Fremd-
kapitalkapazität verfügen. Dies gilt insbesondere auch vor dem Hintergrund des sich ändernden
Regulierungsumfeldes für Banken (bspw. Basel III) und deren Risikoeinschätzung kommunaler
Strukturen. Ferner könnten aufgrund der Finanzierungsherausforderungen (in Erzeugung, Netzen,
Dienstleistungen) alternative Finanzierungsformen an Bedeutung gewinnen. Die Bandbreite
reicht dabei von Bürgerprojekten bis hin zu Finanzierungen über bzw. mit institutionellen
Finanzinvestoren.Strukturwandel im Energiemarkt: Implikationen für die Unternehmenstätigkeit 21
WERTSCHÖPFUNGS-
S TUFEN
VON DEN BEFR AGTEN
UNTERNEHMEN SIND...
96,4% GE SCHÄF TSBEREICHSFELDER
IM VERTRIEB,
DIE GESCHÄF TSFELDER DER BEFR AGTEN
86,7% UNTERNEHMEN UMFA SSEN ZU...
IN DER VERTEILUNG/
DEM NETZBETRIEB,
96,6% STROM,
63,9% 91,6% GA S,
81,9%
IN DER ER ZEUGUNG
63,9% WÄRME,
IN SERVICES UND
12,0% ÖPNV SOWIE
32,5% 72,3% ANDERE GESCHÄF TSBEREICHE.
IM HANDEL TÄTIG.
25, 3% DER UNTERNEHMEN SIND AL S
INTEGRIERTES UNTERNEHMEN TÄTIG.22 Strukturwandel im Energiemarkt: Implikationen für die Unternehmenstätigkeit
4.3 Herausforderungen aus der veränderten Energiepolitik
4.3.1 Status quo: Struktur und räumliche Verteilung der Energieerzeugung
Gegenwärtig beträgt der Anteil erneuerbarer das Übertragungsnetz konzipiert. Erneuerbare
Energien am Strommix etwa 30%, wobei Windkraft Energie wird hingegen dezentral und verteilt
und Biomasse hier den überwiegenden Anteil über das gesamte Bundesgebiet erzeugt, wobei
einnehmen (vgl. Abbildung 10). Es zeigt sich, dass sich für bestimmte Energieträger hier gewisse
erneuerbare Energieträger in der Rangfolge direkt räumliche Konzentrationen zeigen. So wird
nach der Braunkohle stehen und folglich für die Windkraft vorrangig im Norden und Solarenergie
Stromerzeugung von Bedeutung sind. hauptsächlich im Süden erzeugt. Besonders die
zunehmende Stromerzeugung aus Windkraft
Das Leistungsangebot steht dem Strommarkt nicht
bedingt zahlreiche Herausforderungen für
kontinuierlich zur Verfügung, da die Leistung aus
Energieversorger, nicht nur infolge der bereits
Wind- und Solarenergie von den Wetterverhält-
genannten Volatilität. Bedingt durch klima-
nissen abhängt und damit mitunter sehr volatil
tisch-topologische Gegebenheiten sind (Onshore-)
ist. Folglich wird das Angebot an gesicherter
Windkraftanlagen derzeit i. d. R. nur im Norden/
Leistung gegenwärtig fast ausschließlich durch
Nordosten Deutschlands wirtschaftlich zu
konventionelle Kraftwerke bereitgestellt. Während
betreiben, der Hauptenergieverbrauch findet
die Erzeugung konventioneller Energie räumlich
aber im Süden und Westen statt. Erneuerbare
zentralisiert und i. d. R. an Lagerstätten gebunden
Energie wird demnach vorrangig von Nord
ist, erfolgt die Erzeugung erneuerbarer Energien
nach Süd/West transportiert. Dies stellt
dezentral und teilweise in Abhängigkeit natur-
maßgeblich den Energietransport und damit
räumlich-klimatischer Gegebenheiten. So finden
Einspeisung, Übertragung und Verteilung vor
sich Kohlekraftwerke v. a. im Rheinischen Revier,
Herausforderungen und ist folglich wesentlicher
in der Lausitz und im mitteldeutschen Raum.
Faktor des Übertragungsnetz- als auch – für
Auf Basis dieser Standorte ist größtenteils auch
Stadtwerke relevant – Verteilnetzausbaus.
Abbildung 10: Anteile der Energieträger an der Bruttostromerzeugung 2015
Photovoltaik 5,9%
Erneuerbare Energien
Wasserkraft 3,0%
Biomasse 7,7%
18,1%
(inkl. biogener Müll) Steinkohle
30,1%
Windenergie 13,5%
Braunkohle
Erdgas
23,8%
4,8%
Kernenergie
14,1%
9,1% Sonstige
Eigene Darstellung, Datengrundlage: BMWi, Stand 04/2016. https://www.bmwi.de/DE/Themen/Energie/Erneuerbare-Energien/erneuerbare-energien-auf-einen-blick.html.Strukturwandel im Energiemarkt: Implikationen für die Unternehmenstätigkeit 23
4.3.2 Herausforderungen und Chancen für Stadtwerke aus der Energiepolitik der Bundesregierung
Die klima- und umweltpolitischen Ziele der
Bundesregierung wirken auf zahlreiche Bereiche
der Stadtwerke. Während regelmäßig über den
Ausbau der Erzeugungskapazitäten erneuerbarer
Energieträger oder den Stromnetzausbau berichtet
wird, stehen andere für die Zielerreichung relevante
Bereiche des Energiesektors weniger stark im
Fokus. Ein Beispiel bildet der Wärmemarkt, der
eine wesentliche Relevanz für die Reduzierung
der CO2-Emissionen und folglich den Klimaschutz
aufweist, da dieser einen Anteil von ca. 40% am
Energieverbrauch in Deutschland impliziert. Hier
benötigen seit 2009 Gebäude nach § 16 EnEV einen
im Rahmen der sogenannten „Energiewende
„Energieausweis“, der energieeffiziente Gebäude
2.0“⁹ Speicherlösungen, Virtuelle Kraftwerke oder
voraussetzt. Bei Neubau oder Sanierung von
Demand-Side-Management an Bedeutung gewinnen.
Gebäuden sind nun Richtwerte für Primärener-
Virtuelle Kraftwerke zeichnen sich dadurch
giebedarf und Wärmeschutz vorgeschrieben, welche
aus, dass sie dezentralen Stromerzeugungs-
zu höheren Baukosten oder kostenintensiveren
einheiten bündeln, wie zum Beispiel Photovoltai-
Sanierungsmaßnahmen führen können. Auch hier
kanlagen, Wasserkraftwerke, Biogas- und Wind-
können Stadtwerke im „Konzern Stadt“ wesentliche
energieanlagen. Sie können damit
Akteure darstellen.
nachfragebetonter Leistungen aus Großkraftwerken
ersetzen. Virtuell bedeutet vor diesem Hintergrund,
Grundsätzlich wird sich der im Rahmen der
dass die Erzeugung mehrere Standorte umfasst.
Energiewende vollziehende Wandel der Erzeu-
Demand-Side-Management oder Lastmanagement
gungsstrukturen hin zu kleinen, dezentralen
impliziert die Steuerung der Nachfrage
Anlagen auf die Strukturen der Energiewirtschaft
nach netzgebundenen Dienstleistungen bei
auswirken. Stadtwerke scheinen auf den ersten Blick
verschiedenen Abnehmern (Industrie, Gewerbe
vor dem Hintergrund ihres regionalen Versorgungs-
und Haushalte). Durch das Demand-Side-Manage-
ansatzes Nutznießer der Energiewende zu sein.
ment kann eine Verringerung der Nachfrage erreicht
Allerdings besteht besonders für moderne, effiziente
werden, ohne das Angebot zu erhöhen (z. B. durch
Kraftwerke infolge von Einspeisevorrang und Eins-
Erhöhung der Erzeugung von Strom).
peisevergütung ein enormes Wirtschaftlichkeits-
problem, da diese derzeit nicht mehr kostendeckend
Im Rahmen der Erhebung in der Studie ist unstrittig,
betrieben werden können. Zudem kommt es durch
dass die energiepolitischen Vorgaben, speziell
die bisherige Förderung der erneuerbaren Energien
der Ausbau der erneuerbaren Energien, zu einer
zu keiner bedarfsgerechten Erzeugung, was
steigenden Zahl von Marktteilnehmern führen, wobei
wiederum die Netzstabilität und Versorgungssicher-
verstärkt auch Bürger an die Energieerzeugung
heit gefährden könnte. Allerdings ergeben sich auch
partizipieren und in diese investieren.
Chancen für Stadtwerke aus dem energiepolitischen
Rahmen: Aufgrund ihrer traditionellen regionalen Die Notwendigkeit, sich aufgrund dieses
Verankerung und Nähe zu den Endverbrauchern Strukturwandels unternehmensstrategisch
können sich neue Geschäftsfelder ergeben. Dazu neu auszurichten, wird unter den Studienteil-
sind jedoch Strategien sowie auch Anpassungen nehmern mehrheitlich hoch oder sehr hoch
sowohl in den Netzinfrastrukturen als auch im eingeschätzt. Diese Sichtweise fällt unabhängig
zukünftigen Marktdesign erforderlich. Bspw. werden vom zugrundeliegenden Geschäftsfeld aus (vgl.
Abbildung 11).
⁹ Vgl. Rottmann/Grüttner/Kilian (2016),Sie können auch lesen