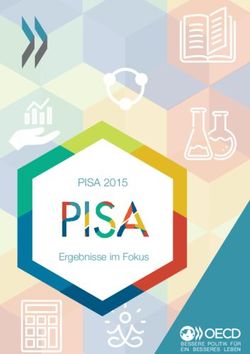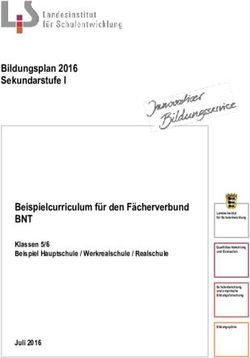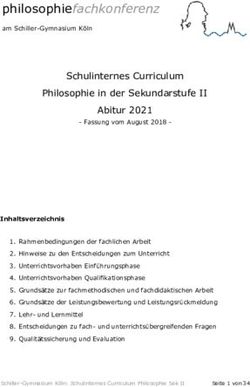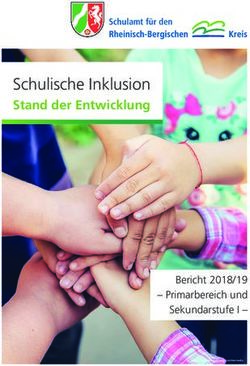Unterrichtsbeispiel für Bewegung, Spiel und Sport - GS Klasse 1 unter besonderer Berücksichtigung der Leitperspektive "Prävention und ...
←
→
Transkription von Seiteninhalten
Wenn Ihr Browser die Seite nicht korrekt rendert, bitte, lesen Sie den Inhalt der Seite unten
Unterrichtsbeispiel für Bewegung, Spiel und Sport GS Klasse 1 unter besonderer Berücksichtigung der Leitperspektive „Prävention und Gesundheitsförderung“ 2018
Unterrichtsbeispiel für Bewegung, Spiel und Sport der Klasse 1
Redaktionelle Bearbeitung
Redaktion Alexandra Baisch, LS Stuttgart
Jutta Schneider, LS Stuttgart
Autorin Judith Herden
Layout Jannis Westermann
Lektorat Beate Wörner
Stand Juni 2018
Impressum
Herausgeber Landesinstitut für Schulentwicklung (LS)
Heilbronner Straße 172, 70191 Stuttgart
Telefon: 0711 6642-0
Web: www.ls-bw.de
E-Mail: poststelle@ls.kv.bwl.de
Druck und Landesinstitut für Schulentwicklung (LS)
Vertrieb Heilbronner Straße 172, 70191 Stuttgart
Telefon: 0711 6642-1204
Telefax : 0711 6642-1099
Web: shop.ls-bw.de
Urheberrecht Inhalte dieses Heftes dürfen für unterrichtliche Zwecke in den Schulen und Hoch-
schulen des Landes Baden-Württemberg vervielfältigt werden. Jede darüber hin-
ausgehende fotomechanische oder anderweitig technisch mögliche Reproduktion
ist nur mit Genehmigung des Herausgebers möglich.
Soweit die vorliegende Publikation Nachdrucke enthält, wurden dafür nach
bestem Wissen und Gewissen Lizenzen eingeholt. Die Urheberrechte der Copyright-
inhaber werden ausdrücklich anerkannt. Sollten dennoch in einzelnen Fällen Ur-
heberrechte nicht berücksichtigt worden sein, wenden Sie sich bitte an den Her-
ausgeber. Bei weiteren Vervielfältigungen müssen die Rechte der Urheber beachtet
bzw. deren Genehmigung eingeholt werden.
© Landesinstitut für Schulentwicklung, Stuttgart 2018Landesinstitut für Schulentwicklung
Inhaltsverzeichnis
1 Hinweise zur Leitperspektive „Prävention und Gesundheitsförderung“ (PG)................................ 1
2 Konzeption der Unterrichtsbeispiele ............................................................................................ 3
3 Unterrichtsverlauf ........................................................................................................................ 6
3.1 „Mein Reifen“ – Explorieren und Kunststücke erfinden .................................................................... 6
3.2 Kunststücke mit dem Reifen“ – Koordinationsschulung im Stationsbetrieb ............................... 11
3.3 „Wo ist mein Reifen?“ – Orientierungsspiele mit dem Reifen zur Schulung der exekutiven
Funktionen ............................................................................................................................................. 17
3.4 „Reifenwechsel“ – Schulung der exekutiven Funktionen mit dem Reifen gemeinsam in
der Gruppe ............................................................................................................................................. 22
4 Literatur- und Quellenverzeichnis ...............................................................................................27
5 Anhang – Kopiervorlagen für den Stationsbetrieb .......................................................................28Landesinstitut für Schulentwicklung
1 Hinweise zur Leitperspektive „Prävention und Gesundheitsförderung“
(PG)
Die Leitperspektive „Prävention und Gesundheitsförderung“ zielt auf die Förderung von Lebenskompetenzen
und die Stärkung persönlicher Schutzfaktoren. Kinder sollen darin unterstützt werden, altersspezifische Ent-
wicklungsaufgaben bewältigen und sich im täglichen Handeln als selbstwirksam erleben zu können, d.h. als
Urheber von positiven Handlungen und deren Ergebnis.
Im Mittelpunkt pädagogisch-präventiven Handelns steht die Frage, was Schülerinnen und Schüler lernen
müssen, um Lebenskompetenzen entwickeln zu können und in welchen schulischen Feldern dies möglich ist.
Im Rahmen der Leitperspektive werden deshalb die Lebenskompetenzbeschreibungen der Weltgesundheits-
organisation sowie personale und soziale Schutzfaktoren in fünf zentralen Lern- und Handlungsfeldern zu-
sammengefasst:
Selbstregulation: Gedanken, Emotionen und Handlungen selbst regulieren
ressourcenorientiert denken und Probleme lösen
wertschätzend kommunizieren und handeln
lösungsorientiert Konflikte und Stress bewältigen
Kontakte und Beziehungen aufbauen und halten
Diese fünf zentralen Lern- und Handlungsfelder korrespondieren mit den prozessbezogenen Kompetenzen
der Fächer des Bildungsplans 2016.
Eine grundlegende Stärkung der Lebenskompetenzen findet in einem Unterrichtsalltag statt, der bei den
Schülerinnen und Schülern zu einer gesunden und positiven Persönlichkeitsentwicklung beiträgt und sie dazu
befähigt, verantwortungsbewusst mit sich selbst und anderen umzugehen. Dies wird als Grundprävention
bezeichnet. Die Grundprävention ist in den Leitgedanken der Fachpläne verankert.
Die darauf aufbauende Primärprävention hat ergänzend eine themenspezifische Ausrichtung, indem be-
stimmte Themenfelder der Prävention und Gesundheitsförderung in den Mittelpunkt der Förderung gestellt
werden. Diese Themen sind in den inhaltsbezogenen Kompetenzen der Fachpläne verankert und über folgen-
de Begriffe konkretisiert:
Wahrnehmung und Empfindung
Selbstregulation und Lernen
Bewegung und Entspannung
Körper und Hygiene
Ernährung (Essen und Trinken)
Sucht und Abhängigkeit
Mobbing und Gewalt
Sicherheit und Unfallschutz
1Unterrichtsbeispiel für Bewegung, Spiel und Sport der Klasse 1
Die Fähigkeit zur Selbstregulation spielt für eine positive Entwicklung der Kinder und Jugendlichen in den
zentralen Lern- und Handlungsfeldern sowie der Grund- und Primärprävention eine grundlegende Rolle. Der
Selbstregulation von Schülerinnen und Schülern liegen u.a. kognitive Prozesse zugrunde, die in ihrer Gesamt-
heit auch als exekutive Funktionen bezeichnet werden. Es gibt keine standardisierte Definition exekutiver
Funktionen. Dennoch besteht breiter Konsens darüber, dass sie u. a. kognitive Prozesse wie
die Aufrechterhaltung und simultane Verarbeitung von Informationen (Arbeitsgedächtnis),
die flexible Fokussierung der Aufmerksamkeit auf verschiedene Aufgabenanforderungen (Aufmerk-
samkeitsverschiebung bzw. kognitive Flexibilität) und
die Fähigkeit dominante Reaktionen zu unterdrücken (Inhibition),
beinhalten.
Die Fähigkeit zur Selbstregulation ist bei Schülerinnen und Schülern ganz unterschiedlich ausgeprägt und
kann gezielt gefördert werden. So liefert beispielsweise eine gute Selbstwahrnehmung Informationen über
innere Zustände und Bedürfnisse, die für die Selbstregulation sowie angemessenes Handeln notwendig sind.
Ein wesentliches Element für das Gelingen der hier vorgestellten Unterrichtseinheit ist die Fähigkeit zur Kon-
zentration und Selbstwahrnehmung der Schülerinnen und Schüler. Die Fähigkeit, sich auf die Eigenschaften
des Sportgeräts zu konzentrieren und den eigenen Körper wahrzunehmen, ist eine Voraussetzung dafür, dass
die Übungen gelingen. Eine gute Selbstwahrnehmung ermöglicht es zudem, sich auch in andere einzufühlen,
in Beziehung zu ihnen zu treten und gemeinsam mit dem Reifen zu turnen.
Die erfolgreiche Bewältigung der Bewegungssituationen stärkt die Selbstwirksamkeitserwartung. Dies hat
positive Auswirkungen auf die Selbstregulation, indem zukünftige Aufgaben beispielsweise zielorientierter
und motivierter geplant und ausgeführt werden.
Aspekte der zentralen Lern- und Handlungsfelder, der Grund- und Primärprävention finden sich in jeder Un-
terrichtsstunde wieder und sind nicht losgelöst voneinander wirksam. Prävention und Gesundheitsförderung
braucht die Auseinandersetzung mit folgenden Fragen:
Wo steht das Kind gerade in seinem Lern- und Entwicklungsprozess?
Was passiert beim Kind, wenn es den nächsten Lern- und Entwicklungsschritt geht?
Auf welche Ressourcen (u.a. Fähigkeiten und Fertigkeiten) kann es dabei zurückgreifen?
Wie und wodurch können Lehrkraft und Klassengemeinschaft es auf diesem Weg konstruktiv unter-
stützen?
Bei welchen Gelegenheiten können Lehrkraft und Klassengemeinschaft es dem Kind ermöglichen, sich
als positiv handelnd (selbstwirksam) zu erfahren?
Anregungen für die Auseinandersetzung mit diesen Fragen finden sich im Unterrichtsverlauf in der rechten
Spalte.
2Landesinstitut für Schulentwicklung
2 Konzeption der Unterrichtsbeispiele
In einem mehrperspektivisch gestalteten Bewegungs-, Spiel und Sportunterricht erfahren die Schülerinnen
und Schüler „dass kontinuierliches Bewegen und Sporttreiben Grundlage einer gesunden Lebensführung sind
und ihr Wohlbefinden maßgeblich beeinflussen. Wichtige Aspekte im Sinne der Leitperspektive „Prävention
und Gesundheitsförderung“ sind Körperwahrnehmung, Anspannung und Entspannung, motorisches Lernen,
wertschätzendes Handeln, sowie eine Stärkung der Selbstregulation.“ (Ministerium für Kultus, Jugend und
Sport Baden-Württemberg 2016).
Das vorliegende Unterrichtsbeispiel zeigt exemplarisch die durchgängige und offensichtliche Verflechtung der
prozess- und inhaltsbezogenen Kompetenzen von „Bewegung, Spiel und Sport“ mit allen fünf im Bildungs-
plan genannten Lern- und Handlungsfeldern1 der Leitperspektive „Prävention und Gesundheitsförderung“:
Im dargestellten Unterrichtsbeispiel konkretisiert sich die Leitperspektive durch die folgenden Begriffspaare
der Primärprävention1 welche in den einzelnen Unterrichtssequenzen in unterschiedlichem Maße zur Geltung
kommen:
Wahrnehmung und Empfindung
Selbstregulation und Lernen
Bewegung und Entspannung
Körper und Hygiene
Sicherheit und Unfallschutz
Das nachfolgende Unterrichtsbeispiel „Bewegen und Spielen mit dem Gymnastikreifen“ bietet damit ein gro-
ßes Potenzial zur Konkretisierung der Leitperspektive „Prävention und Gesundheitsförderung. Der Schwer-
punkt des Unterrichtsvorhabens liegt im Bewegungs- und Erfahrungsfeld „Spielen – Spiele – Spiel“. Dabei
erfolgt eine enge Verzahnung mit den weiteren Bewegungs- und Erfahrungsfeldern von „Bewegung, Spiel und
Sport“ des Bildungsplanes 2016. Im dargestellten Unterrichtsverlauf werden bewusst zusätzlich die Teilkom-
petenzen weiterer Bereiche geschult. So finden sich auch die Bewegungs- und Erfahrungsfelder „Orientierung
– Sicherheit – Hygiene“, „Körperwahrnehmung“ und „Bewegungskünste“ in der vorliegenden Planung wieder.
Im Bewegungs- und Erfahrungsfeld „Spielen – Spiele – Spiel“ sammeln die Schülerinnen und Schüler zahlrei-
che Bewegungs- und Sinneserfahrungen und gewinnen Bewegungssicherheit. „Sie lernen verschiedene Mate-
rialien, Gegenstände und Kleingeräte kennen und können phantasievoll und freudvoll damit umgehen. Sie
spielen „Kleine Spiele“, erfinden neue Spielmöglichkeiten und akzeptieren Spielregeln und Ordnungsformen.“
(Ministerium für Kultus, Jugend und Sport Baden-Württemberg 2016)
Mit Blick auf das Alter der Schülerinnen und Schüler und deren individuelle Lernvoraussetzungen gibt die
Lehrkraft individuelle Hilfestellung und Anregungen, durch direkte Ansprache und Vorbild. Dieses betrifft so-
wohl die prozess- als auch die inhaltsbezogenen Kompetenzen.
Zu Beginn der Unterrichtseinheit bewegen sich die Schülerinnen und Schüler nach einer Instruktion zum
sachgerechten Umgang mit dem Sportgerät selbstständig allein mit dem Reifen und setzen sich einzeln mit
dem Sportgerät auseinander, explorieren und improvisieren. Im Laufe des Unterrichtsverlaufs tritt das ge-
meinsame Spielen mehr und mehr in den Vordergrund.
1
Siehe hierzu die Leitperspektive „Prävention und Gesundheitsförderung“ im Bildungsplan 2016
http://www.bildungsplaene-bw.de/,Lde/Startseite/BP2016BW_ALLG/BP2016BW_ALLG_LP_PG Abrufdatum 04.01.2018
3Unterrichtsbeispiel für Bewegung, Spiel und Sport der Klasse 1 Das gemeinsame Spielen fördert die Teamfähigkeit der Schülerinnen und Schüler. Hierbei werden Kontakte und Beziehungen mit Partnern und in der Gruppe aufgebaut, die das Klassenklima positiv beeinflussen kön- nen. Die aktive Bewegungszeit in den einzelnen Unterrichtssequenzen soll möglichst hoch gehalten werden, auch um physiologische Reize zu setzen. Daher wird zu Beginn jeder Stunde jedem Kind vom Betreten der Turnhal- le an die Möglichkeit gegeben, sich frei, alleine oder mit Partner zu bewegen und zur Verfügung stehendes Material zu nutzen. In der ersten Klasse benötigen die Schülerinnen und Schüler gegebenenfalls unterschied- lich lange Zeit zum Umziehen. Es wird jedoch davon ausgegangen, dass die Notwendigkeit des Umziehens und des Ablegens von Schmuck schon von Beginn des Schuljahres an den Schülerinnen und Schülern bekannt ist. Die Lehrkraft thematisiert die Notwendigkeit des Tragens von Sportkleidung bei Bedarf mit einzelnen Schülerinnen und Schülern noch einmal. So wird auch dem Bereich der Leitperspektive „Körper und Hygiene“ in jeder Unterrichtsstunde Rechnung getragen. Der Bereich „Sicherheit und Unfallschutz“ gelangt insbesondere bei laufintensiven Spielen und dem sachge- rechten Aufräumen der Gymnastikreifen in den Fokus. Vor Beginn der laufintensiven Spiele bietet es sich an, je nach Leistungsstand und Vorerfahrungen der Klasse, noch einmal Blickrichtung, peripheres Sehen, Lauf- tempo und Rücksichtnahme auf Mitspieler zu thematisieren. Der sachgerechte Umgang mit Spielgeräten wird zu Beginn der Unterrichtseinheit erörtert. Je nach örtlichen Gegebenheiten erfolgen das Aufräumen und die Lagerung der Gymnastikreifen unter Ansage, Kontrolle und Aufsicht der Lehrkraft in der Turnhalle und im Geräteraum. Beim freien Spielen mit dem Gymnastikreifen und bei der Gestaltung von Kunststücken allein oder mit der Partnerin oder dem Partner nutzen die Schülerinnen und Schüler ihre körperliche Ausdrucksfähigkeit und schulen ihre Kreativität. Dadurch können sie das gemeinsame Turnen als einen Bereich erleben, in welchem sie durch Üben und Gelingen Erfolge erzielen und Selbstwirksamkeit erfahren. Lauf- und bewegungsintensive Phasen durchziehen die Unterrichtssequenzen, auch im Wechsel mit notwendigen Reflexionsphasen, die zeit- lich kurz gehalten werden sollten. Durch die Reflexionsphasen bietet die vorliegende Unterrichtsplanung den Schülerinnen und Schülern Mög- lichkeiten, ressourcenorientiert zu denken und Probleme zu lösen, sowie eventuell auftretende Konflikte und Stress zu bewältigen. Die Schülerinnen und Schüler können sich zu ihren Erfahrungen, Empfindungen und sozialen Erfahrungen äußern und so eigene Lösungsvorschläge bei auftretenden Schwierigkeiten beitragen. Die Lehrkraft besitzt beim wertschätzenden Kommunizieren eine Vorbildfunktion. Eines der zentralen Lern- und Handlungsfelder der Leitperspektive „Prävention und Gesundheitsförderung“ ist die Fähigkeit zur Selbstregulation. Kinder und Jugendliche planen und handeln in unterschiedlichen Be- wegungssituationen zielgerichtet. Sie wenden dazu passende Strategien an und können sich auf ihre Aufgabe, ihr Sportgerät sowie ihre Partnerin beziehungsweise Partner fokussieren. Durch die themenbezogene Einbindung von Spielen zur Förderung der exekutiven Funktionen wird der Fähig- keit zur Selbstregulation in der geplanten Einheit ebenfalls Rechnung getragen. Das geschieht jedoch nicht nur durch die dargestellten Spielvarianten, sondern ebenfalls durch eingesetzte Rituale. Im vorliegenden Un- terrichtsmodul sind die Spiele und Übungen zur Förderung der exekutiven Funktionen exemplarisch darge- stellt. Durch geringfügige Varianten können diese Spiele jederzeit in ihrer Intensität verändert und an die Lerngruppe angepasst werden. Auch Spiele und Übungen zur Entspannung und Achtsamkeit unterstützen dieses Lern- und Handlungsfeld und sorgen für einen rhythmisierten Stundenablauf. 4
Landesinstitut für Schulentwicklung
Der Tabellenaufbau des vorliegenden Unterrichtsbeispiels entspricht dem der Beispielcurricula des Bildungs-
plans. In den ersten beiden Spalten werden die prozess- und die inhaltsbezogenen Kompetenzen2 des Bil-
dungsplanes 2016 in „Bewegung, Spiel und Sport” dargestellt und zueinander in Beziehung gesetzt. Die dritte
Spalte beschreibt das konkrete Vorgehen und die Abläufe im Unterricht. In der vierten Spalte finden sich er-
gänzende Möglichkeiten zur Unterrichtsgestaltung und -organisation, weitere Hinweise und Bemerkungen zur
Methodik und Didaktik sowie die konkreten Verweise auf die Leitperspektive „Prävention und Gesundheits-
förderung“. Der Themenbereich „Bewegung und Entspannung“ zieht sich durchgängig durch alle Phasen des
Unterrichtsentwurfs und wird daher nicht noch einmal explizit in der nachfolgenden Unterrichtsskizze aufge-
führt. Hierbei wird deutlich, wie komplex der Beitrag dieses Unterrichtsbeispiels zur Leitperspektive ist.
2
Siehe hierzu die Standards für prozessbezogene und inhaltsbezogene Kompetenzen aus „Bewegung, Spiel und Sport“ im Bildungsplan 2016
http://www.bildungsplaene-bw.de/,Lde/LS/BP2016BW/ALLG/GS/BSS/PK/01,
http://www.bildungsplaene-bw.de/,Lde/LS/BP2016BW/ALLG/GS/BSS/PK/02,
http://www.bildungsplaene-bw.de/,Lde/LS/BP2016BW/ALLG/GS/BSS/PK/03,
http://www.bildungsplaene-bw.de/,Lde/LS/BP2016BW/ALLG/GS/BSS/IK/1-2/01,
http://www.bildungsplaene-bw.de/,Lde/LS/BP2016BW/ALLG/GS/BSS/IK/1-2/02,
http://www.bildungsplaene-bw.de/,Lde/LS/BP2016BW/ALLG/GS/BSS/IK/1-2/06,
http://www.bildungsplaene-bw.de/,Lde/LS/BP2016BW/ALLG/GS/BSS/IK/1-2/09
Abrufdatum 04.01.2018
5Unterrichtsbeispiel für Bewegung, Spiel und Sport der Klasse 1
6
3 Unterrichtsverlauf
3.1 „Mein Reifen“ – Explorieren und Kunststücke erfinden
ca. 1 Std.
Intentionen der Unterrichtssequenz:
Die Schülerinnen und Schüler lernen den Gymnastikreifen als ein Spielobjekt kennen, üben und festigen ihre koordinativen Fähigkeiten, indem sie sich mit
dem Reifen bewegen, Kunststücke erfinden und präsentieren.
In ausgewählten Spielsituationen schulen sie verstärkt ihre Orientierungsfähigkeit sowie ihre exekutiven Funktionen.
Der Themenbereich „Bewegung und Entspannung“ der Leitperspektive PG lässt sich in allen Phasen der Unterrichtsplanung wiederfinden und wird daher
nicht noch einmal in der Tabelle aufgeführt.
Prozessbezogene Inhaltsbezogene Konkretisierung Hinweise, Arbeitsmittel,
Kompetenz Kompetenzen Vorgehen im Unterricht Organisation, Verweise
Die Schülerinnen und Schüler können
2.1 Bewegungskompetenz – Koordination 3.1.2 Spielen – Spiele – Spiel Freies Bewegen L PG Körper und Hygiene
und Kondition (1) einzeln und gemeinsam einfache Spieli- Die Schülerinnen und Schüler bewegen Den Schülerinnen und Schülern wird ausreichend
1. koordinative Fähigkeiten und technische deen und Bewegungsformen erfinden und sich frei im Raum. Danach erfolgt der Zeit zum Umkleiden gegeben, gegebenenfalls
Fertigkeiten entwickeln und diese anwen- abwandeln (zum Beispiel kooperative Spie- gemeinsame Stundenbeginn mit bekann- thematisiert und wiederholt die Lehrkraft die
den le, Symbolspiele, Freies Spiel) tem Begrüßungsritual, zum Beispiel Notwendigkeit des Tragens von Sportkleidung
(2) einzeln, zu zweit und in der Gruppe mit Rhythmusklatschen (die Lehrkraft gibt individuell.
2.2 Personalkompetenz – Persönlichkeit Materialien, Gegenständen und unterschied- einen Klatschrhythmus vor, die Schülerin- Die „Wartezeit“, bis alle Schülerinnen und Schüler
und Identität lichen Spielgeräten in überschaubaren Situ- nen und Schüler wiederholen diesen). umgezogen sind, wird bewegungsaktiv gestaltet,
4. ihre Selbstregulationsfähigkeit durch die ationen auf vielfältige Art und Weise umge- zum Beispiel durch freies Spielen und Bewegen.
Förderung der exekutiven Funktionen hen (zum Beispiel unterschiedliche Bälle,
(Arbeitsgedächtnis, Inhibition/Impuls- Spiele mit Kleingeräten, Alltagsmaterialien,
L PG Zentrale Lern- und Handlungsfelder:
kontrolle, kognitive Flexibilität) stärken und Luftballon, Chiffontuch, Schwungtuch)
Kontakte und Beziehungen aufbauen und
entwickeln
halten
3.1.9 Orientierung – Sicherheit – Hygiene Im Freien Spiel können die Schülerinnen und
(6) Regeln der Körperhygiene beachten (zum Schüler durch freie Partnerwahl und gemeinsa-
Beispiel zweckmäßige Sportkleidung) mes Agieren Kontakte knüpfen. Die Lehrkraft
sollte sicherstellen, dass alle eine Partnerin be-
ziehungsweise einen Partner finden.Landesinstitut für Schulentwicklung
2.3 Sozialkompetenz – Gemeinschaft und L PG Wahrnehmung und Empfindung
Verantwortung L PG Selbstregulation und Lernen
4. Absprachen, Regeln und Rituale in Bewe- Dieses Ritual fordert und trainiert vor allem die
gung, Spiel und Sport vereinbaren, akzep- Selbstwahrnehmung sowie die Fähigkeit zuhören
tieren und einhalten und abwarten zu können und damit die Inhibition
und das Arbeitsgedächtnis der Schülerinnen und
Schüler.
2.3 Sozialkompetenz – Gemeinschaft und 3.1.9 Orientierung – Sicherheit – Hygiene Arbeitsauftrag L PG Sicherheit und Unfallschutz
Verantwortung (4) Geräte benennen, sachgerecht aufbauen, Die Lehrkraft zeigt einen Gymnastikreifen, Die Schülerinnen und Schüler lernen den sachge-
4. Absprachen, Regeln und Rituale in Bewe- abbauen und transportieren benennt ihn und erklärt den sachgerech- rechten Umgang mit dem Reifen, um sich und
gung, Spiel und Sport vereinbaren, akzep- ten Umgang mit dem Gerät (nicht werfen) andere nicht zu verletzen und Unfälle zu vermei-
tieren und einhalten und formuliert den Arbeitsauftrag für die den.
folgende Explorationsphase.
2.1 Bewegungskompetenz – Koordination 3.1.2 Spielen – Spiele – Spiel Explorieren und Kunststücke erfinden Es ist davon auszugehen, dass die Schülerinnen
und Kondition (1) einzeln und gemeinsam einfache Spieli- Die Schülerinnen und Schüler bewegen und Schüler bereits im Kindergarten den Reifen
1. koordinative Fähigkeiten und technische deen und Bewegungsformen erfinden und sich frei mit den Reifen und erfinden kennengelernt haben, daher wird hier auf eine
Fertigkeiten entwickeln und diese anwen- abwandeln (zum Beispiel kooperative Spie- Kunststücke, wahlweise einzeln oder mit reine Explorationsphase ohne zusätzlichen Ar-
den le, Symbolspiele, Freies Spiel) einer Partnerin beziehungsweise einem beitsauftrag verzichtet und sofort mit dem Erfin-
(3) einzeln, zu zweit und in der Gruppe mit Partner. den von Kunststücken begonnen. Sollte die Vor-
Materialien, Gegenständen und unterschied- erfahrung der Schülerinnen und Schüler nicht
3. Bewegungen gestalten und sich mit und lichen Spielgeräten in überschaubaren Situ- Wenn ein Signal (zum Beispiel Klingel, vorhanden sein, wird entsprechend mehr Zeit
durch Bewegung ausdrücken ationen auf vielfältige Art und Weise umge- Handzeichen) ertönt, legen die Schülerin- zum freien Bewegen mit dem Reifen eingeräumt.
hen (zum Beispiel unterschiedliche Bälle, nen und Schüler ihren Reifen auf den
Spiele mit Kleingeräten, Alltagsmaterialien, Boden und setzen sich hinein. L PG Selbstregulation und Lernen
Luftballon, Chiffontuch, Schwungtuch)
Die Lehrkraft hat hier die Möglichkeit zu beobach-
ten, inwieweit die Schülerinnen und Schüler
3.1.6 Bewegungskünste
Strategien zum selbstregulierten Umgang mit
(1) einen Gegenstand (zum Beispiel Ballon,
dem Reifen einsetzen und ihre Aufmerksamkeit
Reifen) entsprechend seiner Eigenschaften
fokussieren können.
bewegen
2.1 Bewegungskompetenz – Koordination 3.1.6. Bewegungskünste Präsentation und Imitation Die Lehrkraft unterstützt gegebenenfalls in der
und Kondition (1) einen Gegenstand (zum Beispiel Ballon, Immer drei Schülerinnen beziehungsweise Bewegungsphase sowie in der Präsentationspha-
1. koordinative Fähigkeiten und technische Reifen) entsprechend seiner Eigenschaften Schüler präsentieren zeitgleich ihr Kunst- se, auch bei der Verbalisierung.
Fertigkeiten entwickeln und diese anwen- bewegen stück, während die anderen sie beobach-
den ten. Sollten die gezeigten „Kunststücke“ nicht eindeu-
tig und damit unklar für eine Imitation sein, ist
Sie verbalisieren, was sie tun (zum Bei- hier Hilfe und Unterstützung durch die Lehrkraft
spiel „Ich rolle den Reifen“, „Ich springe“, notwendig.
7Unterrichtsbeispiel für Bewegung, Spiel und Sport der Klasse 1
8
2.2 Personalkompetenz – Persönlichkeit „Ich balanciere“, „Ich kann Hula- L PG Zentrale Lern- und Handlungsfelder:
und Identität Hoop“…). wertschätzend kommunizieren und han-
7. erarbeitete Bewegungsgestaltungen Danach erproben alle Schülerinnen und deln
präsentieren Schüler die gezeigten Übungen und Gedanken, Emotionen und Handlungen
Kunststücke. selbst regulieren
Durch die erfolgreiche Bewältigung der Bewe-
8. „Bewegung, Spiel und Sport“ als einen gungsabläufe mit dem Reifen vor Publikum, die
Bereich erleben, in welchem sie durch Üben unter anderem auch Angst- und Erregungskon-
und Gelingen Erfolge erzielen (Persönlich- trolle erfordert, können sich die Schülerinnen und
keitsbildung, Selbstwirksamkeit) Schüler als selbstwirksam erleben.
Die Schülerinnen und Schüler beschreiben und
benennen ihre Tätigkeit, halten dabei Gesprächs-
regeln ein, hören einander zu, und würdigen
damit die Leistungen der anderen. Die Lehrkraft
ist dabei Vorbild.
2.1 Bewegungskompetenz – Koordination 3.1.2 Spielen – Spiele – Spiel Spiel „Finde deinen Reifen“ Durch Einsatz aktivierender Musik wird zum
und Kondition (3) sich im Spielraum orientieren und kon- Erste Spielrunde: Jedes Kind sitzt in sei- schnellen Laufen angeregt.
1. koordinative Fähigkeiten und technische trolliert bewegen nem Reifen („Nummer 1“). Sobald die
Fertigkeiten entwickeln und diese anwen- Musik ertönt, laufen die Schülerinnen und Sollten in einem Reifen zwei Schülerinnen bezie-
den Schüler in der Halle umher. Bei Musik- hungsweise Schüler ankommen, bleiben beide
stopp sucht jedes Kind seinen Reifen weiter im Spiel (kein Ausscheiden, gegebenen-
wieder. falls. Hilfe durch die Lehrkraft).
2.2 Personalkompetenz – Persönlichkeit Zweite Spielrunde: Sobald die Musik er- L PG Wahrnehmung und Empfindung
und Identität tönt, laufen die Schülerinnen und Schüler L PG Selbstregulation und Lernen
4. ihre Selbstregulationsfähigkeit durch die in der Halle umher. Bei Musikstopp sucht L PG Zentrale Lern- und Handlungsfelder:
Förderung der exekutiven Funktionen sich jedes Kind seinen Reifen „Nummer 2“. Lösungsorientiert Konflikte und Stress be-
(Arbeitsgedächtnis, Inhibition/Impuls- Dritte Spielrunde: Sobald die Musik ertönt, wältigen
kontrolle, kognitive Flexibilität) stärken und laufen die Schülerinnen und Schüler in der
entwickeln Halle umher. Bei Musikstopp ruft die Lehr- Die Schülerinnen und Schüler nehmen akustische
Reize wahr und setzen sie um. Sie orientieren sich
kraft „Nummer 1“ oder „Nummer 2“. Die
an der Lage und gegebenenfalls an der Farbe der
Schülerinnen und Schüler laufen in den
Reifen sowie an den Platznachbarn und Merkma-
2.3 Sozialkompetenz – Gemeinschaft und entsprechenden Reifen.
Verantwortung Diese letzte Spielrunde wird beliebig häu- len im Raum. Sie können dabei Hilfe von anderen
annehmen. Sollte ein Reifen bereits besetzt sein,
4. Absprachen, Regeln und Rituale in Bewe- fig gespielt.
muss diese Situation konstruktiv gelöst werden.
gung, Spiel und Sport vereinbaren, akzep-
Im ausgewählten Spiel werden sowohl die Orien-
tieren und einhalten
Spielvariante: tierungsfähigkeit, als auch das Arbeitsgedächtnis,
die Inhibition und die kognitive Flexibilität gefor-
Je nach Leistungsstand der Lerngruppe
dert und gefördert. Die Schülerinnen und Schüler
wird die Anzahl der „Merkreifen“ auf drei
oder mehr erhöht. Dadurch wird sowohl nutzen die oben genannten Orientierungspunkte,
um ihren Reifen in jeder Spielrunde wiederzufin-
der Anspruch an die Orientierungsfähig-
den.Landesinstitut für Schulentwicklung
keit wie auch an das Arbeitsgedächtnis Damit sich alle Schülerinnen und Schüler bei
und die kognitive Flexibilität erhöht. diesem Spiel als selbstwirksam erleben können,
sollte die Lehrkraft den Schülerinnen und Schüler
entsprechend ihres Entwicklungsstandes Hand-
lungsstrategien vermitteln.
2.2 Personalkompetenz – Persönlichkeit Reflexionsgespräch L PG Wahrnehmung und Empfindung
und Identität Im Reflexionsgespräch äußern die Schüle- L PG Selbstregulation und Lernen
4. ihre Selbstregulationsfähigkeit durch die rinnen und Schüler ihre Eindrücke, Erfah- L PG Zentrale Lern- und Handlungsfelder:
Förderung der exekutiven Funktionen rungen und Lösungsvorschläge zu dem ressourcenorientiert denken und Probleme
(Arbeitsgedächtnis, Inhibition/Impuls- Spiel „Finde deinen Reifen“. lösen
kontrolle, kognitive Flexibilität) stärken und wertschätzend kommunizieren und han-
entwickeln deln
Impulse für das Reflexionsgespräch:
Wie hast du es geschafft, deine Reifen wie-
2.3 Sozialkompetenz – Gemeinschaft und derzufinden?
Verantwortung Wie konntest du Zusammenstöße vermei-
3. sachlich kommunizieren, Konflikte wahr- den?
nehmen und sind in der Lage, diese zu lösen
Im gemeinsamen Gespräch werden auftretende
4. Absprachen, Regeln und Rituale in Bewe- Probleme und Gelingensfaktoren kommuniziert.
gung, Spiel und Sport vereinbaren, akzep- Das setzt voraus, dass sich die Schülerinnen und
tieren und einhalten Schüler während der Übungen selbst beobachten
und auf die Impulse der Lehrkraft achten. Im
Gespräch haben die Schülerinnen und Schüler die
Möglichkeit, sich über ihre Empfindungen zu
äußern und Lösungsmöglichkeiten zu benennen.
Indem über das eigene Tun, die eigenen Gedan-
ken und Gefühle in der Situation reflektiert wird
und Lernprozesse mit ihren Schwierigkeiten,
Umwegen und erreichten Erfolgen überdacht und
besprochen werden, können die Schülerinnen
und Schüler ihr Tun bei ähnlichen Aufgaben an-
passen und verbessern. Dadurch werden die
Selbstwirksamkeitserwartungen und das Selbst-
wertgefühl gestärkt.
In dieser geführten Gesprächssituation können
die Schülerinnen und Schüler zudem üben, auf-
merksam zuzuhören, Feedback zu geben und sich
an Gesprächsregeln zu halten.
9Unterrichtsbeispiel für Bewegung, Spiel und Sport der Klasse 1
10
2.3 Sozialkompetenz – Gemeinschaft und 3.1.9 Orientierung – Sicherheit – Hygiene Stundenabschluss L PG Sicherheit und Unfallschutz
Verantwortung (3) verantwortlich mit Sportstätten und dem Es folgt das gemeinsame Aufräumen der Die Schülerinnen und Schüler transportieren
7. achtsam mit Geräten, Materialien und Geräteraum umgehen (zum Beispiel Ord- Reifen und ein Abschlussritual, zum Bei- sachgerecht die Reifen und lagern diese je nach
Bewegungsräumen umgehen nung im Geräteraum, schonender Umgang spiel ein kurzer Sprechvers. Anweisung der Lehrkraft. Das sachgerechte Auf-
mit Sportgeräten, Sauberkeit, Aufräumen) räumen und Lagern der Reifen richtet sich nach
(4) Geräte benennen, sachgerecht aufbauen, den Gegebenheiten des Geräteraumes. Entweder
abbauen und transportieren stapeln die Schülerinnen und Schüler die Reifen
vor dem Geräteraum auf dem Boden oder hängen
sie unter Aufsicht der Lehrkraft im Geräteraum
auf.
Dadurch tragen sie zur Vermeidung von Unfällen
bei.
L PG Selbstregulation und Lernen
Abschlussrituale fordern und trainieren je nach
Auswahl die Selbstwahrnehmung und die Fähig-
keit zuhören und abwarten zu können und damit
die Inhibition und das Arbeitsgedächtnis der
Schülerinnen und Schüler.Landesinstitut für Schulentwicklung
3.2 Kunststücke mit dem Reifen“ – Koordinationsschulung im Stationsbetrieb
ca. 1 Std.
Intentionen der Unterrichtssequenz:
Die Schülerinnen und Schüler üben und festigen ihre koordinativen Fähigkeiten mit dem Gymnastikreifen im Stationsbetrieb.
Der Stundenaufbau ist so gewählt, dass er von einer ersten Klasse innerhalb einer Unterrichtsstunde genutzt werden kann.
In der vorliegenden geplanten Unterrichtsstunde wird davon ausgegangen, dass den Schülerinnen und Schülern bereits das Üben an Stationen bekannt ist.
Der Themenbereich „Bewegung und Entspannung“ der Leitperspektive PG lässt sich in allen Phasen der Unterrichtsplanung wiederfinden und wird daher
nicht noch einmal in der Tabelle aufgeführt.
Prozessbezogene Inhaltsbezogene Konkretisierung Hinweise, Arbeitsmittel,
Kompetenz Kompetenzen Vorgehen im Unterricht Organisation, Verweise
Die Schülerinnen und Schüler können
2.1 Bewegungskompetenz – Koordination 3.1.2 Spielen – Spiele – Spiel Freies Bewegen Die „Wartezeit“ bis alle Schülerinnen und Schüler
und Kondition (1) einzeln und gemeinsam einfache Spieli- Die Schülerinnen und Schüler bewegen umgezogen sind, wird bewegungsaktiv gestaltet,
1. koordinative Fähigkeiten und technische deen und Bewegungsformen erfinden und sich frei im Raum. Die Gymnastikreifen zum Beispiel durch freies Spielen oder durch
Fertigkeiten entwickeln und diese anwen- abwandeln (zum Beispiel kooperative Spie- stehen zum freien Spiel zur Verfügung. freies Bewegen mit den zur Verfügung gestellten
den le, Symbolspiele, Freies Spiel) Reifen, einzeln oder mit der Partnerin bezie-
(2) einzeln, zu zweit und in der Gruppe mit Auf ein Signal hin (zum Beispiel Klingel, hungsweise dem Partner.
Materialien, Gegenständen und unterschied- Handzeichen) kommen die Schülerinnen
2.2 Personalkompetenz – Persönlichkeit lichen Spielgeräten in überschaubaren Situ- und Schüler in den Sitzkreis, lassen die L PG Zentrale Lern- und Handlungsfelder:
und Identität ationen auf vielfältige Art und Weise umge- Reifen aber frei in der Halle auf dem Bo- Kontakte und Beziehungen aufbauen und
4. ihre Selbstregulationsfähigkeit durch die hen (zum Beispiel unterschiedliche Bälle, den an ihrem Platz liegen. halten
Förderung der exekutiven Funktionen Spiele mit Kleingeräten, Alltagsmaterialien,
Im Freien Spiel können die Schülerinnen und
(Arbeitsgedächtnis, Inhibition/Impuls- Luftballon, Chiffontuch, Schwungtuch) Danach erfolgt der gemeinsame Stunden-
Schüler durch freie Partnerwahl und gemeinsa-
kontrolle, kognitive Flexibilität) stärken und beginn mit bekanntem Begrüßungsritual,
entwickeln zum Beispiel Rhythmusklatschen (Die mes Agieren Kontakte knüpfen. Die Lehrkraft
sollte sicherstellen, dass alle Schülerinnen und
3.1.6 Bewegungskünste Lehrkraft gibt einen Klatschrhythmus vor,
Schüler Partner beziehungsweise Partnerinnen
(1) einen Gegenstand (zum Beispiel Ballon, die Schülerinnen und Schüler wiederholen
2.3 Sozialkompetenz – Gemeinschaft und Reifen) entsprechend seiner Eigenschaften diesen). finden.
Verantwortung bewegen
4. Absprachen, Regeln und Rituale in Bewe- L PG Wahrnehmung und Empfindung
gung, Spiel und Sport vereinbaren, akzep- L PG Selbstregulation und Lernen
tieren und einhalten Dieses Ritual fordert und trainiert vor allem die
Selbstwahrnehmung sowie die Fähigkeit zuhören
11Unterrichtsbeispiel für Bewegung, Spiel und Sport der Klasse 1
12
und abwarten zu können und damit die Inhibition
und das Arbeitsgedächtnis der Schülerinnen und
Schüler.
L PG Sicherheit und Unfallschutz
Die Schülerinnen und Schüler berücksichtigen
den sachgerechten Umgang mit dem Reifen, um
sich und andere nicht zu verletzen und Unfälle zu
vermeiden. Die Lehrkraft unterstützt und erinnert
gegebenenfalls einzelne Kinder daran.
2.3 Sozialkompetenz – Gemeinschaft und 3.1.9 Orientierung – Sicherheit – Hygiene Arbeitsauftrag Die Lehrkraft stellt zur Orientierung und Markie-
Verantwortung (4) Geräte benennen, sachgerecht aufbauen, Im Sitzkreis erklärt die Lehrkraft die rung farbige Pylonen auf, an welche die Reifen
7. achtsam mit Geräten, Materialien und abbauen und transportieren Übungen des folgenden Stationsbetrie- und Aufgabenkarten angebracht werden.
Bewegungsräumen umgehen bes. Die Erklärung erfolgt im Sitzkreis anhand von
Zur weiteren Veranschaulichung können Aufgabenkarten. Einzelne Übungen können im
Auftrags- oder Symbolkarten an den Pylo- Sitzkreis demonstriert werden.
nen ausgelegt werden, zum Beispiel: Pro Station werden vier bis sechs Reifen bereitge-
„Springe durch den Reifen wie legt, so dass genügend Reifen für die Klasse vor-
durch ein Springseil“ handen sind.
„Hula-Hoop“
„Rolle dir mit deinem Partner einen L PG Sicherheit und Unfallschutz
Reifen zu.“
Die Schülerinnen und Schüler transportieren
„Springe mit geschlossenen Füßen
sachgerecht die Reifen. Der sachgerechte Um-
von Reifen zu Reifen“
gang mit den Reifen und mögliche Gefahrenquel-
„Erfinde mit einem Partner ein
len werden thematisiert.
Kunststück! Ihr dürft einen Ball hin-
zunehmen.“
„Zwirble den Reifen. Springe hinein L PG Wahrnehmung und Empfindung
und wieder hinaus.“ L PG Selbstregulation und Lernen
„Zwirbelt eure Reifen. Wechselt den Die Erklärung des Arbeitsauftrags fordert die
Platz, ohne dass ein Reifen umfällt.“ Fähigkeit zuhören und abwarten zu können und
„Balanciere auf dem Reifen vor- damit die Inhibition und das Arbeitsgedächtnis
wärts und rückwärts.“ der Schülerinnen und Schüler. Die Lehrkraft un-
terstützt je nach Entwicklungsstand der Schüle-
rinnen und Schüler mit angepassten Anforderun-
gen (Wie lange können sie zuhören? Wie viele
Stationen können sie sich merken?) und Instruk-
tionen (Wie ausführlich müssen die Instruktionen
sein? Müssen Begriffe geklärt werden?).Landesinstitut für Schulentwicklung
2.1 Bewegungskompetenz – Koordination 3.1.2 Spielen – Spiele – Spiel Üben im Stationsbetrieb L PG Zentrale Lern- und Handlungsfelder:
und Kondition (2) einzeln, zu zweit und in der Gruppe mit Die Schülerinnen und Schüler durchlaufen Kontakte und Beziehungen aufbauen und
1. koordinative Fähigkeiten und technische Materialien, Gegenständen und unterschied- die Stationen mit einer Partnerin bezie- halten
Fertigkeiten entwickeln und diese anwen- lichen Spielgeräten in überschaubaren Situ- hungsweise einem Partner. Der Wechsel Die Partner finden sich nach dem Zufallsprinzip,
den ationen auf vielfältige Art und Weise umge- von Station zu Station erfolgt individuell so kann eine Diskriminierung vermieden werden.
hen (zum Beispiel unterschiedliche Bälle, nach Entscheidung der Schülerinnen und Durch gemeinsame Absprachen und Bewegen
Spiele mit Kleingeräten, Alltagsmaterialien, Schüler. bauen die Schülerinnen und Schüler Beziehungen
2.2 Personalkompetenz – Persönlichkeit Luftballon, Chiffontuch, Schwungtuch) zueinander auf. Besonders bei Bewegungsaufga-
und Identität ben mit der Partnerin/dem Partner müssen sie
8. „Bewegung, Spiel und Sport“ als einen 3.1.6 Bewegungskünste sich aufeinander einstellen. Der zeitliche Wechsel
Bereich erleben, in welchem sie durch Üben (1) einen Gegenstand (zum Beispiel Ballon, an die nächste Station muss mit der Partne-
und Gelingen Erfolge erzielen (Persönlich- Reifen) entsprechend seiner Eigenschaften rin/dem Partner abgesprochen werden.
keitsbildung, Selbstwirksamkeit) bewegen
L PG Selbstregulation und Lernen
2.3 Sozialkompetenz – Gemeinschaft und Das Üben an Stationen, insbesondere auch der
Verantwortung individuell selbständige Wechsel zwischen den
1. im Bereich Bewegung, Spiel und Sport Stationen, stellt hohe Anforderungen an die
einfühlsam und rücksichtsvoll handeln, Selbstregulationsfähigkeit der Schülerinnen und
anderen helfen und sie unterstützen Schüler. Sie müssen zur Bewältigung des Stati-
2. gemeinsam mit anderen Bewegungsauf- onsbetriebs in der Lage sein, sich mit ihrem Part-
gaben bearbeiten und ausführen ner ein gemeinsames Ziel zur Umsetzung des
Auftrags an der jeweiligen Station zu setzen, sich
von Störungen abzuschirmen, das Ergebnis zu
überprüfen und gegebenenfalls neue Strategien
zum Erreichen des Ziels auszuprobieren. Zudem
müssen sie beim Wechsel den Überblick über alle
Stationen behalten, um die Stationen zielorien-
tiert und effektiv zu absolvieren.
Je nach Entwicklungsstand der Schülerinnen und
Schüler bietet es sich an, zunächst einen von der
Lehrkraft strukturierten und kommentierten
Durchlauf durchzuführen.
2.3 Sozialkompetenz – Gemeinschaft und Reflexionsgespräch L PG Wahrnehmung und Empfindung
Verantwortung Im Reflexionsgespräch äußern die Schüle- L PG Selbstregulation und Lernen
3. sachlich kommunizieren, Konflikte wahr- rinnen und Schüler ihre Eindrücke, Erfah- L PG Zentrale Lern- und Handlungsfelder:
nehmen und sind in der Lage, diese zu lösen rungen und Lösungsvorschläge. ressourcenorientiert denken und Probleme
4. Absprachen, Regeln und Rituale in Bewe- lösen
gung, Spiel und Sport vereinbaren, akzep- wertschätzend kommunizieren und han-
tieren und einhalten deln
13Unterrichtsbeispiel für Bewegung, Spiel und Sport der Klasse 1
14
Impulse für das Reflexionsgespräch:
Welche Station fiel dir leicht, welche war
schwierig? Was genau war leicht bezie-
hungsweise schwierig?
Was möchtest du noch üben?
Hast du eine Idee, was du noch ausprobie-
ren kannst, damit die schweren Übungen
leichter gelingen?
Im gemeinsamen Gespräch werden auftretende
Probleme und Gelingensfaktoren kommuniziert.
Das setzt voraus, dass sich die Schülerinnen und
Schüler während der Übungen selbst beobachten
und auf die Impulse der Lehrkraft achten. Im
Gespräch haben die Schülerinnen und Schüler die
Möglichkeit, sich über ihre Empfindungen zu
äußern und Lösungsmöglichkeiten zu benennen.
Indem über das eigene Tun, die eigenen Gedan-
ken und Gefühle in der Situation reflektiert wird
und Lernprozesse mit ihren Schwierigkeiten,
Umwegen und erreichten Erfolgen überdacht und
besprochen werden, können die Schülerinnen
und Schüler ihr Tun bei ähnlichen Aufgaben an-
passen und verbessern. Dadurch werden die
Selbstwirksamkeitserwartungen und das Selbst-
wertgefühl gestärkt.
In dieser geführten Gesprächssituation können
die Kinder zudem üben, aufmerksam zuzuhören,
Feedback zu geben und sich an Gesprächsregeln
zu halten.
2.1 Bewegungskompetenz – Koordination 3.1.2 Spielen – Spiele – Spiel Spiel: „Tanzende Reifen“ Die Pylonen und die Karten werden eingesam-
und Kondition (2) einzeln, zu zweit und in der Gruppe mit Alle Schülerinnen und Schüler zwirbeln melt, jede Schülerin/jeder Schüler nimmt sich
1. koordinative Fähigkeiten und technische Materialien, Gegenständen und unterschied- ihre Reifen verteilt im Raum und bewegen einen Reifen und sucht sich einen Platz im Raum.
Fertigkeiten entwickeln und diese anwen- lichen Spielgeräten in überschaubaren Situ- sich danach frei in der Halle. Kein Reifen Dieses lauf- und bewegungsintensive Spiel kann
den ationen auf vielfältige Art und Weise umge- darf umkippen. Kurz bevor ein Reifen am je nach zur Verfügung stehender Zeit unterschied-
hen (zum Beispiel unterschiedliche Bälle, Boden liegt, muss er durch Zwirbeln wie- lich lang gespielt werden und so auch physiologi-
Spiele mit Kleingeräten, Alltagsmaterialien, der aufgerichtet werden. Die Anzahl der sche Reize setzen.
Luftballon, Chiffontuch, Schwungtuch) Reifen wird nach und nach erhöht.Landesinstitut für Schulentwicklung
2.3 Sozialkompetenz – Gemeinschaft und 3.1.6 Bewegungskünste L PG Wahrnehmung und Empfindung
Verantwortung (1) einen Gegenstand (zum Beispiel Ballon, LPG Zentrale Lern- und Handlungsfelder
2. gemeinsam mit anderen Bewegungsauf- Reifen) entsprechend seiner Eigenschaften Ressourcenorientiert denken und Proble-
gaben bearbeiten und ausführen bewegen me lösen
Wertschätzend kommunizieren und han-
deln
Dabei müssen sie schnell reagieren, um den Rei-
fen wieder „aufzustellen“. Je nach konkretem
Arbeitsauftrag (passend zum Entwicklungsstand)
müssen die Schülerinnen und Schüler allein oder
gemeinsam eine Strategie entwickeln, um das
Umfallen von Reifen zu verhindern. Dies erfordert
die Fähigkeit, eine komplexe Situation zu struktu-
rieren, es erfordert Kommunikations- und Koope-
rationsfähigkeit sowie eine gute Wahrnehmung
des Raums mitsamt der Reifen und Personen.
2.3 Sozialkompetenz – Gemeinschaft und 3.1.9 Orientierung – Sicherheit – Hygiene Es folgt das gemeinsame Aufräumen der L PG Sicherheit und Unfallschutz
Verantwortung (3) verantwortlich mit Sportstätten und dem Reifen. Die Schülerinnen und Schüler transportieren
7. achtsam mit Geräten, Materialien und Geräteraum umgehen (zum Beispiel Ord- sachgerecht die Reifen und lagern diese je nach
Bewegungsräumen umgehen nung im Geräteraum, schonender Umgang Anweisung der Lehrkraft. Das sachgerechte Auf-
mit Sportgeräten, Sauberkeit, Aufräumen) räumen und Lagern der Reifen richtet sich nach
(4) Geräte benennen, sachgerecht aufbauen, den Gegebenheiten des Geräteraumes. Entweder
abbauen und transportieren stapeln die Schülerinnen und Schüler die Reifen
vor dem Geräteraum auf dem Boden oder hängen
sie unter Aufsicht der Lehrkraft im Geräteraum
auf.
Dadurch tragen sie zur Vermeidung von Unfällen
bei.
2.1 Bewegungskompetenz – Koordination 3.1.2 Spielen – Spiele – Spiel Spiel und Stundenabschluss „Wandern- Um das ruhige Abschlussspiel zu verkürzen, kann
und Kondition (2) einzeln, zu zweit und in der Gruppe mit der Reifen“ die Anzahl der Reifen auf zwei bis vier erhöht
1. koordinative Fähigkeiten und technische
Materialien, Gegenständen und unterschied- Die Schülerinnen und Schüler stehen mit werden, welche dann gleichzeitig im Kreis wan-
Fertigkeiten entwickeln und diese anwen-
lichen Spielgeräten in überschaubaren Situ- Handfassung im Kreis. Ein Reifen, der dern.
den ationen auf vielfältige Art und Weise umge- zwischen zwei Schülerinnen/Schülern
hen (zum Beispiel unterschiedliche Bälle, hängt, wird nun weitergereicht, ohne die L PG Zentrale Lern- und Handlungsfelder:
Spiele mit Kleingeräten, Alltagsmaterialien, Handfassung zu lösen. ressourcenorientiert denken und Probleme
2.3 Sozialkompetenz – Gemeinschaft und Luftballon, Chiffontuch, Schwungtuch) lösen
Verantwortung Es folgt ein gemeinsames Abschlussritual,
Um die gemeinsame Bewegungsaufgabe mit
2. gemeinsam mit anderen Bewegungsauf- zum Beispiel ein kurzer Sprechvers.
ständiger Handfassung zu erfüllen, müssen die
gaben bearbeiten und ausführen
Schülerinnen und Schüler zunächst die Situation
analysieren und dann unter Rückgriff auf
15Unterrichtsbeispiel für Bewegung, Spiel und Sport der Klasse 1
16
vorhandenes Wissen Handlungsmöglichkeiten
entwickeln, bewerten und erfolgreich umsetzen.
Dazu sind Kreativität, Achtsamkeit, Kooperati-
onsbereitschaft und Rücksichtnahmen insbeson-
dere in Bezug auf die direkten Nachbarn notwen-
dig. Die Schülerinnen und Schüler können verbale
und körperliche Hilfe anbieten und annehmen.
Ebenso können sie die anderen Mitspieler und
Mitspielerinnen beobachten und dadurch weitere
Lösungsmöglichkeiten finden.
L PG Selbstregulation und Lernen
Abschlussrituale fordern und trainieren je nach
Auswahl die Selbstwahrnehmung, die Fähigkeit
zuhören und abwarten zu können und damit die
Inhibition und das Arbeitsgedächtnis der Schüle-
rinnen und Schüler.Landesinstitut für Schulentwicklung
3.3 „Wo ist mein Reifen?“ – Orientierungsspiele mit dem Reifen zur Schulung der exekutiven Funktionen
ca. 1 Std.
Intentionen der Unterrichtssequenz:
Die Schülerinnen und Schüler schulen ihre Orientierungsfähigkeit sowie die exekutiven Funktionen (Arbeitsgedächtnis, Inhibition und kognitive Flexibilität)
mit dem Gymnastikreifen als Spielgerät.
Der Themenbereich „Bewegung und Entspannung“ der Leitperspektive PG lässt sich in allen Phasen der Unterrichtsplanung wiederfinden und wird daher
nicht noch einmal in der Tabelle aufgeführt.
Prozessbezogene Inhaltsbezogene Konkretisierung Hinweise, Arbeitsmittel,
Kompetenz Kompetenzen Vorgehen im Unterricht Organisation, Verweise
Die Schülerinnen und Schüler können
2.1 Bewegungskompetenz – Koordination 3.1.2 Spielen – Spiele – Spiel Freies Bewegen Die „Wartezeit“ bis alle Schülerinnen und Schüler
und Kondition (1) einzeln und gemeinsam einfache Spieli- Die Schülerinnen und Schüler bewegen umgezogen sind, wird bewegungsaktiv gestaltet,
1. koordinative Fähigkeiten und technische deen und Bewegungsformen erfinden und sich mit den Gymnastikreifen frei im zum Beispiel durch freies Spielen oder durch
Fertigkeiten entwickeln und diese anwen- abwandeln (zum Beispiel kooperative Spie- Raum. freies Bewegen zu aktivierender Musik.
den le, Symbolspiele, Freies Spiel) Auf ein Signal hin (zum Beispiel Klingel,
(2) einzeln, zu zweit und in der Gruppe mit Handzeichen) kommen die Schülerinnen L PG Zentrale Lern- und Handlungsfelder:
Materialien, Gegenständen und unterschied- und Schüler in den Sitzkreis und stapeln Kontakte und Beziehungen aufbauen und
2.2 Personalkompetenz – Persönlichkeit lichen Spielgeräten in überschaubaren Situ- die Reifen in der Mitte. halten
und Identität ationen auf vielfältige Art und Weise umge- Danach erfolgt der gemeinsame Stunden-
4. ihre Selbstregulationsfähigkeit durch die hen (zum Beispiel unterschiedliche Bälle, beginn mit bekanntem Begrüßungsritual, Im Freien Spiel können die Schülerinnen und
Schüler durch freie Partnerwahl und gemeinsa-
Förderung der exekutiven Funktionen Spiele mit Kleingeräten, Alltagsmaterialien, zum Beispiel Rhythmusklatschen (Die
mes Agieren Kontakte knüpfen. Die Lehrkraft
(Arbeitsgedächtnis, Inhibition/Impuls- Luftballon, Chiffontuch, Schwungtuch) Lehrkraft gibt einen Klatschrhythmus vor,
kontrolle, kognitive Flexibilität) stärken und die Schülerinnen und Schüler wiederholen sollte sicherstellen, dass alle Schülerinnen und
entwickeln diesen). Schüler Partner beziehungsweise Partnerinnen
finden.
3.1.6 Bewegungskünste
(1) einen Gegenstand (zum Beispiel Ballon,
2.3 Sozialkompetenz – Gemeinschaft und Reifen) entsprechend seiner Eigenschaften L PG Wahrnehmung und Empfindung
Verantwortung bewegen L PG Selbstregulation und Lernen
4. Absprachen, Regeln und Rituale in Bewe- Dieses Ritual fordert und trainiert vor allem die
gung, Spiel und Sport vereinbaren, akzep- Selbstwahrnehmung sowie die Fähigkeit zuhören
tieren und einhalten und abwarten zu können und damit die Inhibition
und das Arbeitsgedächtnis der Schülerinnen und
Schüler.
L PG Sicherheit und Unfallschutz
17Unterrichtsbeispiel für Bewegung, Spiel und Sport der Klasse 1
18
Die Schülerinnen und Schüler berücksichtigen
den sachgerechten Umgang mit dem Reifen, um
sich und andere nicht zu verletzen und Unfälle zu
vermeiden. Die Lehrkraft unterstützt und erinnert
gegebenenfalls einzelne Kinder daran.
2.1 Bewegungskompetenz – Koordination 3.1.2 Spielen – Spiele – Spiel Spiel: „Finde deinen Reifen“ Die Schülerinnen und Schüler kennen dieses Spiel
und Kondition (3) sich im Spielraum orientieren und kon- Spielbeschreibung siehe Unterrichtsstun- bereits aus der vorhergehenden Stunde. Durch
1. koordinative Fähigkeiten und technische trolliert bewegen de 1 diese Wiederholung wird der Übungseffekt ver-
Fertigkeiten entwickeln und diese anwen- stärkt, es kann weitergeführt und die Anzahl der
den „Merkreifen“ schneller erhöht werden. Dieses
Spiel eignet sich zur Vorbereitung auf das kom-
mende Spiel.
2.2 Personalkompetenz – Persönlichkeit
und Identität L PG Wahrnehmung und Empfindung
4. ihre Selbstregulationsfähigkeit durch die L PG Selbstregulation und Lernen
Förderung der exekutiven Funktionen L PG Zentrale Lern- und Handlungsfelder:
(Arbeitsgedächtnis, Inhibition/Impuls- Lösungsorientiert Konflikte und Stress be-
kontrolle, kognitive Flexibilität) stärken und wältigen
entwickeln
Die Schülerinnen und Schüler nehmen akustische
Reize wahr und setzen sie um. Sie orientieren sich
an der Lage und gegebenenfalls an der Farbe der
2.3 Sozialkompetenz – Gemeinschaft und
Reifen sowie an den Platznachbarn und Merkma-
Verantwortung
len im Raum. Sie können dabei Hilfe von anderen
4. Absprachen, Regeln und Rituale in Bewe-
gung, Spiel und Sport vereinbaren, akzep- annehmen. Sollte ein Reifen bereits besetzt sein,
muss diese Situation konstruktiv gelöst werden.
tieren und einhalten
Im ausgewählten Spiel werden sowohl die Orien-
tierungsfähigkeit, als auch das Arbeitsgedächtnis,
die Inhibition und die kognitive Flexibilität gefor-
dert und gefördert. Die Schülerinnen und Schüler
nutzen die oben genannten Orientierungspunkte,
um ihren Reifen in jeder Spielrunde wiederzufin-
den. Damit sich alle Schülerinnen und Schüler bei
diesem Spiel als selbstwirksam erleben können,
sollte die Lehrkraft ihnen – entsprechend ihres
Entwicklungsstandes – Handlungsstrategien
vermitteln.Sie können auch lesen