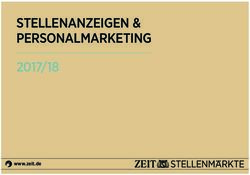Vorlesungsverzeichnis - Zwei-Fach-Bachelor - Germanistik 90 LP Prüfungsversion Wintersemester 2020/21 - PULS
←
→
Transkription von Seiteninhalten
Wenn Ihr Browser die Seite nicht korrekt rendert, bitte, lesen Sie den Inhalt der Seite unten
Vorlesungsverzeichnis
Zwei-Fach-Bachelor - Germanistik 90 LP
Prüfungsversion Wintersemester 2020/21
Sommersemester 2021Inhaltsverzeichnis
Inhaltsverzeichnis
Abkürzungsverzeichnis 5
Pflichtmodule..........................................................................................................................................................6
GER_BA_001 - Basismodul Grammatische und lexikalische Strukturen der deutschen Sprache 6
GER_BA_002 - Basismodul Text, Gespräch und Varietäten in der deutschen Sprache 6
87136 S - Deutsche Sprache der Gegenwart: Text, Gespräch und Varietäten / Teil 2 6
GER_BA_003 - Basismodul Geschichte der deutschen Sprache 6
87075 V - Geschichte der deutschen Sprache (Teil 1) 6
87137 S - Geschichte der deutschen Sprache / Teil 2 6
GER_BA_004 - Basismodul Texte und Kontexte in der deutschsprachigen Literatur 7
87100 S - Marie von Ebner-Eschenbachs Dramen und Erzählungen (Realismus) 7
87105 S - Schriftstellerinnen der Weimarer Republik 7
87112 S - Märchen deutscher Dichterinnen im Umfeld der Romantik 8
87151 SU - Autofiktionales Erzählen 9
87160 S - Literaturzeitschriften und serielles Erzählen im 19. Jahrhundert 10
87446 S - Literarischer Antisemitismus: Figurendarstellungen als Indikator? 10
GER_BA_006 - Basismodul Grundlagen der Literaturwissenschaft 10
87110 V - Grundlagen der Literaturwissenschaft 11
87143 S - Einführung in Literatur und Sprache des Mittelalters 11
87147 S - Einführung in die Literatur der Frühen Neuzeit 11
87148 S - Einführung in die Literatur von 1750 bis zur Gegenwart 12
GER_BA_016 - Aufbaumodul Literaturen, Kanon, Medien und Kulturen 12
87085 S - Mittelhochdeutsche Schwankromane 12
87086 S - Iwein wird 800. Felicitas Hoppes Jugendbuch „Iweins Löwenritter“ und seine mittelalterliche Vorlage 13
87096 V - Renaissance - Humanismus - Reformation 13
87099 S - Ost oder West? Der Balkan in der Literatur von 1500 bis heute 14
87102 S - Träume in der mittelalterlichen Literatur 15
87108 S - Iwein wird 800. Felicitas Hoppes Jugendbuch „Iwein Löwenritter“ und seine mittelalterliche Vorlage 16
87109 S - Grundfragen des Erzählens, diskutiert an der Kriminalgeschichte „Die Judenbuche“ von Annette von Droste-
Hülshoff (1842) (in Kooperation mit dem fachdidaktischen Seminar von Franziska Risse) 17
87111 S - Naturerfahrung und Naturbegriff 18
87124 S - Friedrich von Schwaben 18
87131 S - Wirnt von Grafenberg: Wigalois 19
87132 S - Goethes „Wilhelm Meisters Lehrjahre“ im Kontext: Bildung, Ästhetik, Zeitgeschichte 20
87146 S - Die Italienische Reise in der deutschen Literaturgeschichte. Mit Sommerschule in Bologna. 21
87152 S - Rhetorik der Frühen Neuzeit als Methode für die Textanalyse 21
87158 S - E.T.A. Hoffmann 22
87445 S - Kleine Literaturen – Konzepte transkultureller Schreibweisen 22
GER_BA_017 - Aufbaumodul Sprachwissenschaft 23
87078 S - Verbzweit-Phänomene 23
87079 S - Komplexe Sätze 24
87080 S - Methoden in der Linguistik 24
2
Abkürzungen entnehmen Sie bitte Seite 5Inhaltsverzeichnis
87082 S - Vorfeldbesetzung 25
87083 S - Kiezdeutsch 25
87089 S - Semantik 26
87091 S - Sprachliches Handeln 26
87092 S - Graphematik 27
87093 S - Grammatikalisierung 27
87104 S - Grammatik im Zweitspracherwerb 27
87117 SU - Deutsch als Zweitsprache in Institutionen 28
87122 S - Erinnerungskultur und Narrative – Migrationsspuren in Potsdam und Berlin 28
87126 S - Mündliche und schriftliche lernersprachliche Texte (Projektseminar) 29
Wahlpflichtbereiche (Erstfach)........................................................................................................................... 30
Spezialisierung Literaturwissenschaft 30
GER_BA_020 - Aufbaumodul Spezialisierung Literaturwissenschaft 1 30
87087 S - Heldenleben: Sigurd – Siegfried – Seyfrid 30
87116 S - Gegenwartsliteratur in Wissenschaft und Kritik. Formen und Instanzen von Darstellung und Wertung 30
88539 S - Abgründe – von Ideengeschichte(n) zu Inszenierungsformen 31
GER_BA_021 - Aufbaumodul Spezialisierung Literaturwissenschaft 2 31
87087 S - Heldenleben: Sigurd – Siegfried – Seyfrid 31
87116 S - Gegenwartsliteratur in Wissenschaft und Kritik. Formen und Instanzen von Darstellung und Wertung 32
88539 S - Abgründe – von Ideengeschichte(n) zu Inszenierungsformen 32
Spezialisierung Sprachwissenschaft 33
GER_BA_022 - Aufbaumodul Spezialisierung Sprachwissenschaft 1 33
87078 S - Verbzweit-Phänomene 33
87079 S - Komplexe Sätze 33
87080 S - Methoden in der Linguistik 34
87082 S - Vorfeldbesetzung 34
87083 S - Kiezdeutsch 35
87089 S - Semantik 35
87091 S - Sprachliches Handeln 36
87092 S - Graphematik 36
87093 S - Grammatikalisierung 36
87104 S - Grammatik im Zweitspracherwerb 37
87117 SU - Deutsch als Zweitsprache in Institutionen 37
87122 S - Erinnerungskultur und Narrative – Migrationsspuren in Potsdam und Berlin 38
87126 S - Mündliche und schriftliche lernersprachliche Texte (Projektseminar) 38
GER_BA_023 - Aufbaumodul Spezialisierung Sprachwissenschaft 2 39
87078 S - Verbzweit-Phänomene 39
87079 S - Komplexe Sätze 39
87080 S - Methoden in der Linguistik 40
87082 S - Vorfeldbesetzung 40
87083 S - Kiezdeutsch 41
87087 S - Heldenleben: Sigurd – Siegfried – Seyfrid 41
87089 S - Semantik 42
87091 S - Sprachliches Handeln 42
87092 S - Graphematik 42
3
Abkürzungen entnehmen Sie bitte Seite 5Inhaltsverzeichnis
87093 S - Grammatikalisierung 43
87104 S - Grammatik im Zweitspracherwerb 43
87116 S - Gegenwartsliteratur in Wissenschaft und Kritik. Formen und Instanzen von Darstellung und Wertung 44
87117 SU - Deutsch als Zweitsprache in Institutionen 44
87122 S - Erinnerungskultur und Narrative – Migrationsspuren in Potsdam und Berlin 45
87126 S - Mündliche und schriftliche lernersprachliche Texte (Projektseminar) 46
88539 S - Abgründe – von Ideengeschichte(n) zu Inszenierungsformen 46
Spezialisierung Deutsch als Fremd- und Zweitsprache 46
GER_BA_024 - Aufbaumodul Spezialisierung Deutsch als Fremd- und Zweitsprache 1 46
87104 S - Grammatik im Zweitspracherwerb 47
87117 SU - Deutsch als Zweitsprache in Institutionen 47
87126 S - Mündliche und schriftliche lernersprachliche Texte (Projektseminar) 48
GER_BA_025 - Aufbaumodul Spezialisierung Deutsch als Fremd- und Zweitsprache 2 48
87104 S - Grammatik im Zweitspracherwerb 48
87117 SU - Deutsch als Zweitsprache in Institutionen 49
87122 S - Erinnerungskultur und Narrative – Migrationsspuren in Potsdam und Berlin 49
87126 S - Mündliche und schriftliche lernersprachliche Texte (Projektseminar) 50
Akademische Grundkompetenzen (Erstfach)................................................................................................... 50
GER_BA_014 - Basismodul Schlüsselkompetenzen für Germanistinnen und Germanisten 1 50
87162 TU - Propädeutikum Grammatik und Orthografie 50
88867 TU - Selbstreflexion und Planung für Germanist*innen 51
GER_BA_015 - Basismodul Schlüsselkompetenzen für Germanistinnen und Germanisten 2 51
87080 S - Methoden in der Linguistik 51
87100 S - Marie von Ebner-Eschenbachs Dramen und Erzählungen (Realismus) 51
87109 S - Grundfragen des Erzählens, diskutiert an der Kriminalgeschichte „Die Judenbuche“ von Annette von Droste-
Hülshoff (1842) (in Kooperation mit dem fachdidaktischen Seminar von Franziska Risse) 52
87112 S - Märchen deutscher Dichterinnen im Umfeld der Romantik 53
87160 S - Literaturzeitschriften und serielles Erzählen im 19. Jahrhundert 53
88866 TU - Wissenschaftliches Schreiben und Präsentieren für Germanisten 54
Berufsfeldspezifische Kompetenzen (fachintegrativ)...................................................................................... 54
GER_BA_018 - Aufbaumodul Kultur, Interkulturalität, Geschlecht (A) 54
87099 S - Ost oder West? Der Balkan in der Literatur von 1500 bis heute 54
87105 S - Schriftstellerinnen der Weimarer Republik 55
87111 S - Naturerfahrung und Naturbegriff 56
87122 S - Erinnerungskultur und Narrative – Migrationsspuren in Potsdam und Berlin 57
87445 S - Kleine Literaturen – Konzepte transkultureller Schreibweisen 58
Fakultative Lehrveranstaltungen........................................................................................................................59
86952 SU - Orthografie verstehen und üben 59
88725 TU - GAT 2: Tutorium für Bachelorstudierende 60
88750 TU - Tutorium zum BM Geschichte der deutschen Sprache 60
Glossar 61
4
Abkürzungen entnehmen Sie bitte Seite 5Abkürzungsverzeichnis
Abkürzungsverzeichnis
Veranstaltungsarten Andere
AG Arbeitsgruppe N.N. Noch keine Angaben
B Blockveranstaltung n.V. Nach Vereinbarung
BL Blockseminar LP Leistungspunkte
DF diverse Formen SWS Semesterwochenstunden
EX Exkursion
Belegung über PULS
FP Forschungspraktikum
FS Forschungsseminar PL Prüfungsleistung
FU Fortgeschrittenenübung
PNL Prüfungsnebenleistung
GK Grundkurs
KL Kolloquium SL Studienleistung
KU Kurs
LK Lektürekurs L sonstige Leistungserfassung
OS Oberseminar
P Projektseminar
PJ Projekt
PR Praktikum
PU Praktische Übung
RE Repetitorium
RV Ringvorlesung
S Seminar
S1 Seminar/Praktikum
S2 Seminar/Projekt
S3 Schulpraktische Studien
S4 Schulpraktische Übungen
SK Seminar/Kolloquium
SU Seminar/Übung
TU Tutorium
U Übung
UN Unterricht
UP Praktikum/Übung
V Vorlesung
VE Vorlesung/Exkursion
VP Vorlesung/Praktikum
VS Vorlesung/Seminar
VU Vorlesung/Übung
WS Workshop
Veranstaltungsrhytmen
wöch. wöchentlich
14t. 14-täglich
Einzel Einzeltermin
Block Block
BlockSa Block (inkl. Sa)
BlockSaSo Block (inkl. Sa,So)
5Zwei-Fach-Bachelor - Germanistik 90 LP - Prüfungsversion Wintersemester 2020/21
Vorlesungsverzeichnis
Pflichtmodule
GER_BA_001 - Basismodul Grammatische und lexikalische Strukturen der deutschen Sprache
Für dieses Modul werden aktuell keine Lehrveranstaltungen angeboten
GER_BA_002 - Basismodul Text, Gespräch und Varietäten in der deutschen Sprache
87136 S - Deutsche Sprache der Gegenwart: Text, Gespräch und Varietäten / Teil 2
Gruppe Art Tag Zeit Rhythmus Veranstaltungsort 1.Termin Lehrkraft
1 S Mi 10:00 - 12:00 wöch. Online.Veranstalt 14.04.2021 Dr. Manuela Korth
2 S Mi 12:00 - 14:00 wöch. Online.Veranstalt 14.04.2021 Dr. Manuela Korth
3 S Mo 10:00 - 12:00 wöch. Online.Veranstalt 12.04.2021 Dr. Nils Bahlo
Zoom-Meeting beitreten: https://wwu.zoom.us/j/66664940258
4 S Do 10:00 - 12:00 wöch. Online.Veranstalt 15.04.2021 Constanze Lechler
Links:
Kommentar http://www.uni-potsdam.de/lv/index.php?idv=33916
Kommentar
Für weitere Informationen zum Kommentar, zur Literatur und zum Leistungsnachweis klicken Sie bitte oben auf den Link
"Kommentar".
Leistungen in Bezug auf das Modul
PNL 251121 - Seminar (unbenotet)
GER_BA_003 - Basismodul Geschichte der deutschen Sprache
87075 V - Geschichte der deutschen Sprache (Teil 1)
Gruppe Art Tag Zeit Rhythmus Veranstaltungsort 1.Termin Lehrkraft
1 V Di 16:00 - 18:00 wöch. Online.Veranstalt 13.04.2021 Prof. Dr. Ulrike Demske
Links:
Kommentar http://www.uni-potsdam.de/lv/index.php?idv=33210
Kommentar
Für weitere Informationen zum Kommentar, zur Literatur und zum Leistungsnachweis klicken Sie bitte oben auf den Link
"Kommentar".
Die Vorlesung gibt einen Überblick über die Geschichte der deutschen Sprache von ihren Anfängen bis in die Gegenwart.
Ausgehend von den historischen Rahmenbedingungen und der Überlieferungslage werden für jede Periode der deutschen
Sprachgeschichte charakteristische sprachliche Phänomene vorgestellt.
Literatur
Schmidt, Wilhelm. 2013. Geschichte der deutschen Sprache. Ein Lehrbuch für das germanistische Studium. 11. verbesserte
und erweiterte Auflage hg. v. Elisabeth Berner und Norbert Richard Wolf.
Leistungsnachweis
Prüfungsversion 2011+2014: 2 LP (unbenotet): Teilnahme + Studienleistung/Testat Testat: Bearbeitung von Online-Aufgaben
Leistungen in Bezug auf das Modul
PNL 251211 - Vorlesung (unbenotet)
87137 S - Geschichte der deutschen Sprache / Teil 2
Gruppe Art Tag Zeit Rhythmus Veranstaltungsort 1.Termin Lehrkraft
1 S Di 14:00 - 16:00 wöch. Online.Veranstalt 13.04.2021 Prof. Dr. Ulrike Demske
2 S Fr 10:00 - 12:00 wöch. Online.Veranstalt 16.04.2021 Dr. Manuela Korth
3 S Fr 12:00 - 14:00 wöch. Online.Veranstalt 16.04.2021 Dr. Manuela Korth
4 S Di 12:00 - 14:00 wöch. Online.Veranstalt 13.04.2021 Dr. Elisabeth Berner
6
Abkürzungen entnehmen Sie bitte Seite 5Zwei-Fach-Bachelor - Germanistik 90 LP - Prüfungsversion Wintersemester 2020/21
5 S Mi 10:00 - 12:00 wöch. Online.Veranstalt 14.04.2021 Dr. Elisabeth Berner
6 S Mo 12:00 - 14:00 wöch. Online.Veranstalt 12.04.2021 Isabell Jänich
Links:
Kommentar http://www.uni-potsdam.de/lv/index.php?idv=33918
Kommentar
Für weitere Informationen zum Kommentar, zur Literatur und zum Leistungsnachweis klicken Sie bitte oben auf den Link
"Kommentar".
Leistungen in Bezug auf das Modul
PNL 251221 - Seminar (unbenotet)
GER_BA_004 - Basismodul Texte und Kontexte in der deutschsprachigen Literatur
87100 S - Marie von Ebner-Eschenbachs Dramen und Erzählungen (Realismus)
Gruppe Art Tag Zeit Rhythmus Veranstaltungsort 1.Termin Lehrkraft
1 S Di 12:00 - 14:00 wöch. Online.Veranstalt 13.04.2021 Dr. Natalie Moser
Links:
Kommentar http://www.uni-potsdam.de/lv/index.php?idv=33458
Kommentar
Für weitere Informationen zum Kommentar, zur Literatur und zum Leistungsnachweis klicken Sie bitte oben auf den Link
"Kommentar".
Das Seminar widmet sich dem Werk der österreichischen Schriftstellerin Marie von Ebner-Eschenbach, das der
literarhistorischen Epoche des Realismus zugeordnet wird. Im Unterschied zum Werk von Theodor Fontane, Gottfried
Keller oder Adalbert Stifter werden Marie von Ebner-Eschenbachs erstaunlich modernen Texte wie die Erzählung „Lotti, die
Uhrmacherin”, die sich dem Leben einer berufstätigen Frau widmet, der Roman „Das Gemeindekind”, der die Entwicklung
eines armen Waisenkindes zu einem angesehenen Dorfbewohner schildert, oder die Erzählung „Krambambuli”, in der die
Mensch-Tier-Interaktion im Zentrum steht, heute inner- und außerhalb der Forschung seltener rezipiert. Dies liegt nicht an der
Qualität der literarischen Texte, sondern ist durch externe Faktoren wie Kanonisierungsprozesse etc. begründet. Marie von
Ebner-Eschenbachs Werk eignet sich besonders gut, um über Fragen der epochalen Zuordnung der psychologisierenden
Darstellungen zu diskutieren und über das Konzept weiblicher Autorschaft und Kanonisierungsprozesse zu reflektieren.
Lehr- und Lernziele des Seminars sind, dass Student*innen erstens einen Überblick über Marie von Ebner-Eschenbachs
dramatisches und episches Werk erlangen, zweitens anhand des Werkes der Autorin Merkmale der literarhistorischen Epoche
des Realismus und indirekt des Naturalismus beschreiben und drittens Konzepte wie Kanon/Kanonisierungsprozesse und
weibliche Autorschaft reflektieren können.
Format des Seminars: Das Seminar wird digital stattfinden und etwa zu zwei Dritteln aus synchronen Lehrformaten
(insbesondere Diskussionen in Kleingruppen und im Plenum via Zoom) und zu einem Drittel aus asynchronen (u.a. vertonte
Powerpointpräsentationen, Diskussionsforen und kollaborative Textdokumenten) Lehrformaten bestehen. Informationen zum
Ablauf des Seminars und das Passwort des Moodlekurses erhalten Sie nach der zentralen Zulassung zur Lehrveranstaltung.
Literatur
Primärliteratur: MvEE: Die Veilchen (Lustspiel, 1862/77) MvEE: Lotti, die Uhrmacherin (Erzählung, 1880) MvEE: Ohne Liebe
(Lustspiel und dialogisierte Novelle, 1888/91) MvEE: Das Gemeindekind (Roman, 1887) MvEE: Krambambuli (Erzählung,
1896)
Leistungsnachweis
2 LP (unbenotet): Impulsbeitrag (20 Minuten) + schriftlicher Kommentar (1 Seite) 3 LP (unbenotet): Impulsbeitrag (20
Minuten) + schriftlicher Kommentar (2 Seite) 3 LP (benotet): Hausarbeit (10–15 Seiten)/Prüfungsgespräch (30 Minuten) 6 LP:
Impulsbeitrag (20 Minuten) + schriftlicher Kommentar (2 Seite) + Hausarbeit (15 Seiten)/Prüfungsgespräch (30 Minuten)
Leistungen in Bezug auf das Modul
PL 250231 - Seminar (benotet)
87105 S - Schriftstellerinnen der Weimarer Republik
Gruppe Art Tag Zeit Rhythmus Veranstaltungsort 1.Termin Lehrkraft
1 S Di 12:00 - 14:00 wöch. Online.Veranstalt 13.04.2021 Jule Ana Herrmann
Links:
Kommentar http://www.uni-potsdam.de/lv/index.php?idv=33610
7
Abkürzungen entnehmen Sie bitte Seite 5Zwei-Fach-Bachelor - Germanistik 90 LP - Prüfungsversion Wintersemester 2020/21
Kommentar
Die Gründung der Weimarer Republik stellt eine politische und gesellschaftliche Zäsur dar, die auch die Stellung und Rolle
der Frau grundlegend veränderte. Wie wird diese neue und sich weiterhin wandelnde Rolle der Frau (und des Mannes) in der
zeitgenössischen Literatur von Autorinnen dargestellt? Wie spiegeln sich die gesellschaftlichen Umbrüche der Zeit wider?
Und welche Schreibstile werden von Autorinnen hierbei eingesetzt? Ein Fokus liegt dabei auf den Darstellungen der ‚Neuen
Frau‘, deren Lebensalltag scheinbar von beruflicher und sexueller Selbstbestimmung, modischer Kleidung, dem Nacht- und
Szeneleben, Zigaretten und Sport geprägt war.
Im Mittelpunkt des Seminars stehen Texte erfolgreicher junger Schriftstellerinnen, die in den 20er Jahren debütierten,
darunter die Romane „Das kunstseidene Mädchen” von Irmgard Keun (1932), Marieluise Fleißers „Mehlreisende Frieda Geier.
Roman vom Rauchen, Sporteln, Lieben und Verkaufen” (1931, später unter dem Titel „Eine Zierde für den Verein”) und Ruth
Landshoff-Yorcks „Die Vielen und der Eine” (1930).
Vor Seminarbeginn sollten folgende Texte bereits gelesen sein:
Irmgard Keun: Das kunstseidene Mädchen (List tb).
Marieluise Fleißer: Eine Zierde für den Verein. Roman vom Rauchen, Sporteln, Lieben und Verkaufen (Suhrkamp tb).
Die Bereitschaft zu umfassender Lektüre wird vorausgesetzt.
Leistungsnachweis
Seminar: Schriftstellerinnen in der Weimarer Republik (BM – LW 2 / GER_BA_004 / EM – LW)
Prüfungsversion 2011:
2 LP (unbenotet): Testat: Teilnahme an Expert*innengruppe (die Gruppe bereitet für je eine Sitzung vor: Impulsreferat 5-10
Min + Handout + Diskussionsleitung)
3 LP/Modulprüfung: Hausarbeit (K) oder Prüfungsgespräch (P)
Prüfungsversion 2014:
LA Deutsch: 3 LP (unbenotet): Testat: Teilnahme an Expert*innengruppe (Impulsreferat 5-10 Min + Handout +
Diskussionsleitung)
BA Germanistik: 3 LP (unbenotet): Testat: Teilnahme an Expert*innengruppe (Impulsreferat 5-10 Min + Handout +
Diskussionsleitung)
3 LP/Modulprüfung: Hausarbeit (K) oder Prüfungsgespräch (P)
Prüfungsversion 2020 (einschließlich Förderpädagogik Deutsch):
6 LP: Testat + Hausarbeit (15 Seiten) oder Prüfungsgespräch (LV)
Orientierungsstudium 2019: 3 LP (unbenotet): Testat: Teilnahme an Expert*innengruppe (Impulsreferat 5-10 Min + Handout +
Diskussionsleitung)
Bemerkung
Das Seminar wird online stattfinden und vorwiegend aus synchronen Sitzungen mit wenigen asynchronen Einheiten
bestehen. Bitte halten Sie sich den Sitzungstermin Dienstags zu 12-14 Uhr c.t. daher frei.
Leistungen in Bezug auf das Modul
PL 250231 - Seminar (benotet)
87112 S - Märchen deutscher Dichterinnen im Umfeld der Romantik
Gruppe Art Tag Zeit Rhythmus Veranstaltungsort 1.Termin Lehrkraft
1 S Fr 10:00 - 12:00 wöch. Online.Veranstalt 16.04.2021 Dr. Elke Lösel
Links:
Kommentar http://www.uni-potsdam.de/lv/index.php?idv=33644
8
Abkürzungen entnehmen Sie bitte Seite 5Zwei-Fach-Bachelor - Germanistik 90 LP - Prüfungsversion Wintersemester 2020/21
Kommentar
Für weitere Informationen zum Kommentar, zur Literatur und zum Leistungsnachweis klicken Sie bitte oben auf den Link
"Kommentar".
Das Seminarthema nimmt die Gattung Märchen aus vielfältiger Perspektive in den Blick. "Alle Märchen sind nur Träume von
jener heimatlichen Welt, die überall und nirgends ist." schreibt Novalis und stellt sich damit gegen die Märchenauffassung
der Aufklärung, aber ebenso auch in krtische Distanz zu jenem Märchenverständnis der Grimms, das eine eigene Gattung
kreiert hatte. In diesem Spannungsfeld stehen auch die Texte der Dichterinnen. Friederike Helene Ungers "Prinzessin
Gräcula" (1804) sowie Agnes Franz "Prinzessin Rosalieb" (1841) sollen mit Bezug auf die Märchentradition der Aufklärung
sowie zum französischen Feenmärchen diskutiert werden. Anhand des Märchens "Die erlöste Prinzessin" (1818) von Anna
von Haxthausen geht es um deren Aufarbeitung und Umsetzung des Grimmschen Gattungsverständnisses. Der romantische
Märchendiskurs im Sinne Novalis wird über die Figur der Undine und deren Wandel in den Geschichten von Charlotte Ahlefeld
"Die Nymphe des Rheins" (1812) und Louise Brachmanns "Das Reich der Wünsche" (1813) thematisiert. Zugleich wird es im
Seminar immer auch um das Dichtungsverständnis der Autorinnen sowie ihr dichterisches Selbstverständnis gehen.
Literatur
- Im Reich der Wünsche. Die schönsten Märchen deutscher Dichterinnen. Hrsg. von Sh. C. Jarvis. München 2012. - Grätz,
M.: Das Märchen in der deutschen Aufklärung. Vom Feenmärchen zum Volksmärchen. Stuttgart 1988. - Mayer, M./Tismar, J.:
Kunstmärchen. 4. Aufl., Stuttgart, Weimar 2003. - Pöge-Alder, K.: Märchenforschung. Theorien, Methoden, Interpretationen.
3., überarb. und erw. Aufl., Tübingen 2016.
Leistungsnachweis
Prüfungsversion 2011: 2 LP (unbenotet): 2 Thesenpapiere/Kommentierung (je 2 Seiten) + 2 Diskussionsbeiträge (je ca. 1
Seite) 3 LP/Modulprüfung: Hausarbeit (15 Seiten) oder Prüfungsgespräch (30 Minuten) Prüfungsversion 2014: LA Deutsch: 3
LP (unbenotet): 2 Thesenpapiere/Kommentierung (je 2 Seiten) + 3 Diskussionsbeiträge (je ca. 1 Seite) + ein Tafel-/Schaubild
(mit ca. 1 Seite Kommentierung) BA Germanistik: 3 LP (unbenotet): 2 Thesenpapiere/Kommentierung (je 2 Seiten) + 3
Diskussionsbeiträge (je ca. 1 Seite) + ein Tafel-/Schaubild (mit ca. 1 Seite Kommentierung) 3 LP/Modulprüfung: Hausarbeit
(15 Seiten) oder Prüfungsgespräch (30 Minuten) Prüfungsversion 2020 (einschließlich Förderpädagogik Deutsch): 6 LP
(benotet): 2 Thesenpapiere/Kommentierung (je 2 Seiten) + 3 Diskussionsbeiträge (je ca. 1 Seite) + ein Tafel-/Schaubild (mit
ca. 1 Seite Kommentierung) + Hausarbeit (15 Seiten) oder Prüfungsgespräch (30 Minuten) Orientierungsstudium 2019: 3 LP
(unbenotet): 2 Thesenpapiere/Kommentierung (je 2 Seiten) + 3 Diskussionsbeiträge (je ca. 1 Seite) + ein Tafel-/Schaubild
(mit ca. 1 Seite Kommentierung) BM – SKG2 / GER_BA_015 Prüfungsversion 2014 / BA Germanistik / nur Erstfach: 3 LP/
Variante A: 1 Thesenpapier/Kommentierung (2 Seiten) + ein Tafel-/Schaubild (mit ca. 1 Seite Kommentierung + (benotet):
Referat (ca. 20 Minuten + Arbeitsmaterial) oder Hausarbeit (8 Seiten) Prüfungsversion 2020 / BA Germanistik / nur Erstfach: 3
LP (benotet): Referat (ca. 30 Minuten + Arbeitsmaterial) + schriftliche Ausarbeitung (8 – 10 Seiten)
Bemerkung
Das Seminar findet als Online-Seminar statt. Die Mehrheit der Sitzungen ist für eine asynchrone Lehre (Thesen- und
Diskussionsforum) konzipiert. Sie werden aber ergänzt durch Sitzungen, die synchron über Zoom zum Seminartermin: Fr
10.00 - 12.00 Uhr stattfinden.
Sie erhalten nach der Zulassung zum Seminar von mir über PULS eine genaue Information zum organisatorischen Ablauf des
Semesters.
Leistungen in Bezug auf das Modul
PL 250231 - Seminar (benotet)
87151 SU - Autofiktionales Erzählen
Gruppe Art Tag Zeit Rhythmus Veranstaltungsort 1.Termin Lehrkraft
1 SU Do 14:00 - 16:00 wöch. Online.Veranstalt 15.04.2021 Christoph Winter
Links:
Kommentar http://www.uni-potsdam.de/lv/index.php?idv=34013
Kommentar
Für weitere Informationen zum Kommentar, zur Literatur und zum Leistungsnachweis klicken Sie bitte oben auf den Link
"Kommentar". Autofiktionale Romane und Erzählungen erfahren in den letzten Jahren besondere Konjunktur. Die ›Ich-Erzähl-
Exzesse‹ Karl Ove Knausgårds, Benjamin v. Stuckrad-Barres Panikherz, Tom Kummers schon nahezu exhibitionistischer
Roman Nina & Tom oder Moritz v. Uslars Erzählerfigur »Der Reporter« in den »teilnehmenden Beobachtungen«
Deutschboden und Nochmal Deutschboden, legen die Diagnose eines ›autofictional turns‹ der Gegenwartsliteratur nahe. Das
Seminar will die verschiedenen Spielarten des Erzählens der eigenen Biographie genauso untersuchen, wie Erzählerfiguren,
die mit deren Autor:innen kongruent zu sein scheinen. Darüber hinaus sollen die jeweiligen Entwürfe von Gegenwärtigkeit,
bzw. die Positionierungen der jeweiligen Autor:innen zu Phänomenen des Gegenwärtigen anhand ihrer Figuren thematisiert
werden. Das Seminar gliedert sich dafür auf: In einen theoretischen Teil, in dem die Studierenden entsprechende Primär-
und Sekundärtexte diskutieren und einen praxisnahen Teil, der die Studierenden dazu anleiten soll, mit verschiedenen
Techniken des autofiktionalen Erzählens zu experimentieren, um das angeeignete Theoriewissen in eine jeweils eigene Praxis
zu überführen. Auf diese Weise soll den Studierenden einerseits Wissen über die Theorie des Erzählens, die Konstruktion
autofiktionaler Texte und über Konzepte literarischer Gegenwärtigkeit vermittelt werden. Andererseits sollen die Studierenden
dazu angeleitet werden, die eigenen Schreibkompetenzen konzeptionell und stilistisch weiter zu entwickeln.
9
Abkürzungen entnehmen Sie bitte Seite 5Zwei-Fach-Bachelor - Germanistik 90 LP - Prüfungsversion Wintersemester 2020/21
Literatur
Arnold, Sonja [e. a.] (Hg.): Sich selbst erzählen. Autobiographie – Autofiktion – Autorschaft, Kiel: Verlag Ludwig, 2018.
Hoffmann, Torsten Kaiser, Gerhard (Hg.): Echt inszeniert. Interviews in Literatur und Literaturbetrieb, München: Fink, 2014.
Kraus, Esther: Faktualität und Fiktionalität in autobiographischen Texten des 20. Jahrhunderts, Marburg: Tectum, 2013. Moser
Natalie: »Autofiktionales Erzählen als Replik auf den (Spät-)Realismus? Zu Lange-Müllers Die Letzten«, in: Zhi, Jianhua
[e. a.] (Hg.): Akten des XIII. Internationalen Germanistenkongresses Shanghai 2015 – Germanistik zwischen Tradition und
Innovation Bd. I0, FfM: Peter Lang, 2018. Stepath, Katrin: Gegenwartskonzepte. Eine philosophisch-literaturwissenschaftliche
Analyse temporaler Strukturen, Würzburg: Könighausen & Neumann, 2006. Usf.
Leistungsnachweis
Prüfungsversion 2011: 2 LP (unbenotet): Textmappe 3 LP/Modulprüfung: Hausarbeit (K) oder Prüfungsgespräch (P)
Prüfungsversion 2014: LA Deutsch: 3 LP (unbenotet): Textmappe BA Germanistik: 3 LP (unbenotet): Textmappe 3 LP/
Modulprüfung: Hausarbeit (K) oder Prüfungsgespräch (P) Prüfungsversion 2020 (einschließlich Förderpädagogik Deutsch):
6 LP: Textmappe + Hausarbeit (15 Seiten) oder Prüfungsgespräch (LV) Orientierungsstudium 2019: 3 LP (unbenotet):
Textmappe
Leistungen in Bezug auf das Modul
PL 250231 - Seminar (benotet)
87160 S - Literaturzeitschriften und serielles Erzählen im 19. Jahrhundert
Gruppe Art Tag Zeit Rhythmus Veranstaltungsort 1.Termin Lehrkraft
1 S Do 12:00 - 14:00 wöch. 1.08.1.45 15.04.2021 Prof. Dr. Iwan-
Michelangelo D'Aprile
1 S Do 12:00 - 14:00 Einzel Online.Veranstalt 17.06.2021 Prof. Dr. Iwan-
Michelangelo D'Aprile
1 S Do 12:00 - 14:00 Einzel 1.09.2.16 15.07.2021 Prof. Dr. Iwan-
Michelangelo D'Aprile
Links:
Kommentar http://www.uni-potsdam.de/lv/index.php?idv=34034
Kommentar
Für weitere Informationen zum Kommentar, zur Literatur und zum Leistungsnachweis klicken Sie bitte oben auf den Link
"Kommentar".
In dem Seminar werden ausgewählte Literaturzeitschriften und die in ihnen erschienenen seriellen Erzählformen im Hinblick
auf den Zusammenhang von literarischem Markt, medialem Erscheinungsformat und narrativen Mustern analysiert. Ein
Schwerpunkt wird dabei auf gender-Aspekte und die Bedeutung von Autorinnen in diesem Zusammenhang gelegt.
Literatur
Manuela Günter: Im Vorhof der Kunst (2008) Lynne Tatlock: Publishing Culture and the "Reading Nation" (2012) Claudia
Stockinger: An den Ursprüngen populärer Serialität (2018)
Leistungsnachweis
Prüfungsversion 2011: 2 LP (unbenotet): Referat, 30 min mit Handout und schriftlicher Ausarbeitung von 5 Seiten 3 LP/
Modulprüfung: Hausarbeit (K) oder Prüfungsgespräch (P) Prüfungsversion 2014: LA Deutsch: 3 LP (unbenotet): Testat
BA Germanistik: 3 LP (unbenotet): Testat 3 LP/Modulprüfung: Hausarbeit (K) oder Prüfungsgespräch (P) Prüfungsversion
2020 (einschließlich Förderpädagogik Deutsch): 6 LP: Testat + Hausarbeit (15 Seiten) oder Prüfungsgespräch (LV)
Orientierungsstudium 2019: 3 LP (unbenotet): Testat BM – SKG2 / GER_BA_015 Prüfungsversion 2014 / BA Germanistik /
nur Erstfach: 3 LP/Variante A: Testat + Referat oder Hausarbeit (LV) Prüfungsversion 2020 / BA Germanistik / nur Erstfach: 3
LP: Referat + Ausarbeitung (LV)
Leistungen in Bezug auf das Modul
PL 250231 - Seminar (benotet)
87446 S - Literarischer Antisemitismus: Figurendarstellungen als Indikator?
Gruppe Art Tag Zeit Rhythmus Veranstaltungsort 1.Termin Lehrkraft
N.N. N.N. N.N. N.N. N.N. N.N. N.N. N.N.
Links:
Kommentar http://www.uni-potsdam.de/lv/index.php?idv=33834
Leistungen in Bezug auf das Modul
PL 250231 - Seminar (benotet)
GER_BA_006 - Basismodul Grundlagen der Literaturwissenschaft
10
Abkürzungen entnehmen Sie bitte Seite 5Zwei-Fach-Bachelor - Germanistik 90 LP - Prüfungsversion Wintersemester 2020/21
87110 V - Grundlagen der Literaturwissenschaft
Gruppe Art Tag Zeit Rhythmus Veranstaltungsort 1.Termin Lehrkraft
1 V N.N. N.N. wöch. N.N. N.N. PD Dr. Andreas Degen
Raum und Zeit nach Absprache
Links:
Kommentar http://www.uni-potsdam.de/lv/index.php?idv=33617
Kommentar
Für weitere Informationen zum Kommentar, zur Literatur und zum Leistungsnachweis klicken Sie bitte oben auf den Link
"Kommentar".
Die Vorlesung führt problemorientiert in die Geschichte und in grundlegende Begriffe, Fragestellungen, Methoden und
Theorien der germanistischen Literaturwissenschaft ein. Sie ist in drei Abschnitte untergliedert: I. Systematischer Zugriff:
Womit beschäftigt sich germanistische Literaturwissenschaft? II. Historischer Zugriff: Wie und warum haben sich Gegenstände
und Methoden der Germanistik verändert? III. Methodischer Zugriff: Wie geht man literaturwissenschaftlich vor? Der
Schwerpunkt der Vorlesung liegt auf der deutschsprachigen Literatur des 19. bis 21. Jahrhunderts. Sie schließt mit einer
Klausur ab, die am 7.7. um 8.30 Uhr stattfindet (90 min). Es gibt keine Teilnahmevoraussetzungen, allerdings wird zum
besseren Verständnis empfohlen, die Vorlesung nicht vor dem zweiten Semester zu besuchen. Die Vorlesung findet aufgrund
der Pandemie online und asynchron statt.
Literatur
-Heinz Drügh, Susanne Komfort-Hein, Andreas Kraß u.a.: Germanistik. Sprachwissenschaft, Literaturwissenschaft,
Schlüsselkompetenzen. Stuttgart, Weimar 2012. -Jochen Vogt: Einladung zur Literaturwissenschaft. 6. Paderborn 2002.
Leistungsnachweis
Prüfungsversion 2020 (einschließlich Förderpädagogik Deutsch): 3 LP: Klausur (LV)
Leistungen in Bezug auf das Modul
PL 254824 - Grundlagen der Literaturwissenschaft (benotet)
87143 S - Einführung in Literatur und Sprache des Mittelalters
Gruppe Art Tag Zeit Rhythmus Veranstaltungsort 1.Termin Lehrkraft
1 S Mi 10:00 - 12:00 wöch. 1.08.1.45 14.04.2021 Natalie Ann Mlynarski
1 S Mi 10:00 - 12:00 Einzel Online.Veranstalt 16.06.2021 Natalie Ann Mlynarski
2 S Di 10:00 - 12:00 wöch. 1.08.1.45 13.04.2021 Dr. Inci Bozkaya
2 S Di 10:00 - 12:00 Einzel Online.Veranstalt 08.06.2021 Dr. Inci Bozkaya
3 S Di 12:00 - 14:00 wöch. 1.08.1.45 13.04.2021 Dr. Inci Bozkaya
3 S Di 12:00 - 14:00 Einzel Online.Veranstalt 08.06.2021 Dr. Inci Bozkaya
4 S Mo 14:00 - 16:00 wöch. 1.09.2.15 12.04.2021 Dr. Judith Klinger
5 S Do 16:00 - 18:00 wöch. 1.09.1.12 15.04.2021 Dr. Judith Klinger
Links:
Kommentar http://www.uni-potsdam.de/lv/index.php?idv=33957
Kommentar
Für weitere Informationen zum Kommentar, zur Literatur und zum Leistungsnachweis klicken Sie bitte oben auf den Link
"Kommentar".
Leistungen in Bezug auf das Modul
PNL 254821 - Literatur und Literaturgeschichte von 750-1500 (unbenotet)
87147 S - Einführung in die Literatur der Frühen Neuzeit
Gruppe Art Tag Zeit Rhythmus Veranstaltungsort 1.Termin Lehrkraft
1 S Do 10:00 - 12:00 wöch. Online.Veranstalt 15.04.2021 Björn Zentschenko
2 S Di 10:00 - 12:00 wöch. Online.Veranstalt 13.04.2021 Dr. Elke Lösel
3 S Mo 16:00 - 18:00 wöch. 1.08.1.45 12.04.2021 Ronny Schulz
3 S Mo 16:00 - 18:00 Einzel Online.Veranstalt 07.06.2021 Ronny Schulz
Links:
Kommentar http://www.uni-potsdam.de/lv/index.php?idv=33999
Kommentar
Für weitere Informationen zum Kommentar, zur Literatur und zum Leistungsnachweis klicken Sie bitte oben auf den Link
"Kommentar".
11
Abkürzungen entnehmen Sie bitte Seite 5Zwei-Fach-Bachelor - Germanistik 90 LP - Prüfungsversion Wintersemester 2020/21
Bemerkung
Gruppe 2:
Das Seminar findet als Online-Seminar statt. Die Mehrheit der Sitzungen ist für eine asynchrone Lehre (Thesen- und
Diskussionsforum) konzipiert. Sie werden aber ergänzt durch Sitzungen, die synchron über Zoom zum Seminartermin: Die
10.00 - 12.00 Uhr stattfinden.
Sie erhalten nach der Zulassung zum Seminar von mir über PULS eine genaue Information zum organisatorischen Ablauf des
Semesters.
Leistungen in Bezug auf das Modul
PNL 254822 - Literatur und Literaturgeschichte von 1500-1750 (unbenotet)
87148 S - Einführung in die Literatur von 1750 bis zur Gegenwart
Gruppe Art Tag Zeit Rhythmus Veranstaltungsort 1.Termin Lehrkraft
1 S Di 16:00 - 18:00 wöch. Online.Veranstalt 13.04.2021 PD Dr. Andreas Degen
2 S Do 08:00 - 10:00 wöch. Online.Veranstalt 15.04.2021 PD Dr. Andreas Degen
3 S Mo 18:00 - 20:00 wöch. Online.Veranstalt 12.04.2021 Anna-Marie Humbert
Links:
Kommentar http://www.uni-potsdam.de/lv/index.php?idv=34002
Kommentar
Für weitere Informationen zum Kommentar, zur Literatur und zum Leistungsnachweis klicken Sie bitte oben auf den Link
"Kommentar".
Leistungen in Bezug auf das Modul
PNL 254823 - Literatur und Literaturgeschichte von 1750-heute (unbenotet)
GER_BA_016 - Aufbaumodul Literaturen, Kanon, Medien und Kulturen
87085 S - Mittelhochdeutsche Schwankromane
Gruppe Art Tag Zeit Rhythmus Veranstaltungsort 1.Termin Lehrkraft
1 S Mo 14:00 - 16:00 wöch. Online.Veranstalt 12.04.2021 Prof. Dr. Katharina
Philipowski
Links:
Kommentar http://www.uni-potsdam.de/lv/index.php?idv=33331
Kommentar
Für weitere Informationen zum Kommentar, zur Literatur und zum Leistungsnachweis klicken Sie bitte oben auf den Link
"Kommentar".
Mit dem ‚Reinhart Fuchs’ (Anfang 13. Jahrhunderts) beginnt die Tradition des mittelalterlichen ‚Schwankromans’.
Schwankromane erzählen in einer Reihe von Episoden von den ‚Streichen’ oder ‚Schwänken’ ihrer jeweiligen Helden oder
auch – wie im Falle von Ulenspiegel – seine Lebensgeschichte von der Geburt bis zum Tod. Was so einfach daherkommt,
ist jedoch in nahezu allen Dimensionen der Gattung widersprüchlich und ambivalent: so zum Beispiel die Komik der so
genannten ‚Schwänke’, die in vielen Fällen so grausam, abgeschmackt und brutal ist, dass dem Leser das Lachen im Halse
stecken bleibt. Widersprüchlich ist vor allem aber der jeweilige Held, der sich auch als ‚Schelm’ bezeichnen ließe (obwohl die
Literaturgeschichte die deutsche Schelmenliteratur meist erst mit dem ‚Simplizissimus’ beginnen lässt). Unter einem Schelm
wird ein durchtriebener, vagabundierender Spitzbube, aber auch ein liebenswürdiger Spaßmacher verstanden. Ursprünglich
allerdings bezeichnet das Wort ‚Schelm’ den Abdecker und den Henker. Auch das ahd ‚skalmo’ (Pest, Seuche) schwingt
im mhd. ‚schelm(e)’ noch mit. Offenbar hat der Schelm auch etwas mit Bedrohung, Vernichtung und Gewalt zu tun. Durch
seine Außenseiterposition steht er jenseits einer moralischen Beurteilbarkeit – er ist weder gut noch böse, oder gut und
böse zugleich. Seine Streiche und Betrügereien entlarven zwar Eitelkeit, Einfalt und Egoismus derer, die ihm auf den Leim
gehen, doch auch er selbst ist nicht frei von Lastern. Der Schelm ist kein Held und keine Identifikationsfigur, sondern vor
allem anderen einer, der jenseits jeder gesellschaftlichen Ordnung steht. Wie wird das erzählerisch entwickelt, welche Formen
nimmt das literarhistorisch an?
Literatur
Reinhart Fuchs. mhd./nhd., hrsg. von Karl-Heinz Göttert. Stuttgart 1987 [RUB 9819] Der Stricker: Der Pfaffe Amis, mhd./nhd.,
hrsg., Übers. u. Komm. von Michael Schilling. Stuttgart 2006 [RUB 658] Ein Kurtzweilig Lesen von Dil Ulenspiegel. Nach dem
Druck von 1515 hrsg. von Wolfgang Lindow. Stuttgart 1990 [RUB 1687].
12
Abkürzungen entnehmen Sie bitte Seite 5Zwei-Fach-Bachelor - Germanistik 90 LP - Prüfungsversion Wintersemester 2020/21
Leistungsnachweis
Prüfungsversion 2011 2 LP (unbenotet): Erstellung eines Schaubildes und zehn Hausaufgaben (als Gruppenaufgaben) 3
LP/Modulprüfung: Hausarbeit (15 Seiten) oder Prüfungsgespräch (30 Minuten) Prüfungsversion 2014 2 LP (unbenotet):
Erstellung eines Schaubildes und zehn Hausaufgaben (als Gruppenaufgaben) 2 LP/Modulprüfung: Hausarbeit (10 Seiten)
oder Prüfungsgespräch (30 Minuten) Prüfungsversion 2020 (einschließlich Förderpädagogik Deutsch) 3 LP (unbenotet):
Erstellung eines Schaubildes und zehn Hausaufgaben (als Gruppenaufgaben) 6 LP: Erstellung eines Schaubildes und zehn
Hausaufgaben (als Gruppenaufgaben) + Hausarbeit (15 Seiten)
Leistungen in Bezug auf das Modul
PNL 254841 - Vorlesung oder Seminar (unbenotet)
PL 254842 - Seminar mit Hausarbeit (benotet)
PNL 254921 - Seminar (unbenotet)
87086 S - Iwein wird 800. Felicitas Hoppes Jugendbuch „Iweins Löwenritter“ und seine mittelalterliche Vorlage
Gruppe Art Tag Zeit Rhythmus Veranstaltungsort 1.Termin Lehrkraft
1 S Di 10:00 - 12:00 wöch. Online.Veranstalt 13.04.2021 Prof. Dr. Katharina
Philipowski
Links:
Kommentar http://www.uni-potsdam.de/lv/index.php?idv=33332
Kommentar
Für weitere Informationen zum Kommentar, zur Literatur und zum Leistungsnachweis klicken Sie bitte oben auf den Link
"Kommentar".
Der Gegenstand des Seminars verbindet mittelalterliche Literatur und Gegenwartsliteratur: den Artusroman ‚Iwein’ von
Hartmann von Aue und seine moderne Bearbeitung durch Felicitas Hoppe: ‚Iwein Löwenritter’. Das gemeinsam von PD Dr.
Andreas Degen (Neugermanistik) und Prof. Dr. Katharina Philipowski (Altgermanistik) durchgeführte Seminar untersucht, wie
sich die Bearbeitung auf ihre berühmte Vorlage bezieht: Was hat die Autorin aus dem mittelalterlichen Stoff gemacht, was
hat sie aufgegriffen, modernisiert, übergangen, ausgeklammert, verändert? Wie hat der völlig andere kulturell-literarische
Kontext, wie die veränderte Adressierung (Artusroman - Jugendbuch) die Gestaltung des Werkes verändert? Gegenstand
dieses Seminars soll nicht nur die Auseinandersetzung mit den jeweiligen Texten, dem mittelalterlichen wie dem modernen,
sein, sondern auch die Frage, wie ein Buch oder Codex (im Mittelalter wie im 21. Jahrhundert) als Gegenstand präsentiert
wird - als Repräsentations-, als Gebrauchs- oder Konsumgegenstand. Wir bemühen uns darum, zu diesen Fragen auch einen
Vortrag von Verantwortlichen anbieten zu können, die im Fischer-Verlag an der Produktion des Buches von Felicitas Hoppe
mitgewirkt haben.
Literatur
Textgrundlage für Hartmanns ‚Iwein’ ist entweder die Reclam-Ausgabe von Rüdiger Krohn mit dem Kommentar von Mireille
Schnyder [RUB 19011] oder die Klassiker-Edition mit Übersetzung und Kommentar von Volker Mertens (in: Hartmann von
Aue: Gregorius/Der arme Heinrich/Iwein, hrsg. und übersetzt von Volker Mertens. Frankfurt a. M. 2008 [Deutscher Klassiker
Verlag Bd. 29]). Außerdem benötigen Sie Felicitas Hoppe: Iwein Löwenritter. Frankfurt a. M. 2008 (oder später).
Leistungsnachweis
Prüfungsversion 2011 2 LP (unbenotet): Erstellung eines Schaubildes und zehn Hausaufgaben (als Gruppenaufgaben) 3
LP/Modulprüfung: Hausarbeit (15 Seiten) oder Prüfungsgespräch (30 Minuten) Prüfungsversion 2014 2 LP (unbenotet):
Erstellung eines Schaubildes und zehn Hausaufgaben (als Gruppenaufgaben) 2 LP/Modulprüfung: Hausarbeit (10 Seiten)
oder Prüfungsgespräch (30 Minuten) Prüfungsversion 2020 (einschließlich Förderpädagogik Deutsch) 3 LP: (unbenotet):
Erstellung eines Schaubildes und zehn Hausaufgaben (als Gruppenaufgaben) 6 LP: Erstellung eines Schaubildes und zehn
Hausaufgaben (als Gruppenaufgaben) + Hausarbeit (15 Seiten)
Leistungen in Bezug auf das Modul
PNL 254841 - Vorlesung oder Seminar (unbenotet)
PL 254842 - Seminar mit Hausarbeit (benotet)
PNL 254921 - Seminar (unbenotet)
87096 V - Renaissance - Humanismus - Reformation
Gruppe Art Tag Zeit Rhythmus Veranstaltungsort 1.Termin Lehrkraft
1 V Mo 10:00 - 12:00 wöch. 1.08.1.45 12.04.2021 Prof. Dr. phil. Stefanie
Stockhorst
1 V Mo 10:00 - 12:00 Einzel Online.Veranstalt 07.06.2021 Prof. Dr. phil. Stefanie
Stockhorst
Links:
Kommentar http://www.uni-potsdam.de/lv/index.php?idv=33450
13
Abkürzungen entnehmen Sie bitte Seite 5Zwei-Fach-Bachelor - Germanistik 90 LP - Prüfungsversion Wintersemester 2020/21
Kommentar
Für weitere Informationen zum Kommentar, zur Literatur und zum Leistungsnachweis klicken Sie bitte oben auf den Link
"Kommentar".
Diese Vorlesung gibt einen einführenden Überblick über die Literatur des deutschen Sprachraums im 16. Jahrhundert im
weiteren kulturellen Kontext. Sie orientiert sich an drei etablierten Epochenbegriffen, mit denen sich wesentliche Tendenzen
dieser Zeit zumindest vorläufig erarbeiten lassen: Erstens an der Renaissance, d.h. die Wiederbelebung antiker Texte, die
vor allem in ihrer italienischen Ausprägung zu einem wichtigen Modell für die deutsche Gelehrtenkultur wurde. Zweitens am
Humanismus, dessen Leitsatz ad fontes! (‚zu den Quellen‘) in engem Zusammenhang damit steht, da sich entsprechende
Verfahren im Umgang mit Texten (z.B. Edition und Kommentar) aus dem Rückgriff auf die Überlieferung ergaben. Viele
davon spielen übrigens auch noch für die Textwissenschaft der Gegenwart eine Rolle. Drittens an der Reformation, die mit
Luthers programmatischem Verweis auf den Bibeltext (sola scriptura) statt auf die kirchliche Auslegungstradition sowie mit
seiner Bibelübersetzung ins Deutsche doch auch erheblichen Schrift- und Quellenoptimismus zeigt. Neben zentralen Autoren,
Gattungen und Texten werden schlaglichtartig auch verschiedene Bedeutungssysteme wie z. B. die Hermetik und Alchemie,
Die Rhetorik und Poetik, die Emblematik sowie das individualisierte Menschenbild vorgestellt.
Literatur
Achim Aurnhammer u. Nicolas Detering: Deutsche Literatur der Frühen Neuzeit. Tübingen 2019. Stephen Greenblatt: Die
Wende. Wie die Renaissance begann. Übers. v. Klaus Binder. 5. Aufl., München 2013 [amerik. EA 2011].
Leistungsnachweis
Prüfungsversion 2011: 2 LP (unbenotet): Bestehen eines Online-Lektüretests und kleine Klausur (45 Min.) 3 LP
(Modulprüfung): Bestehen eines Online-Lektüretests und große Klausur (90 Min.) (Die große Klausur besteht aus der kleinen
Klausur und zusätzlichen Aufgaben.) Prüfungsversion 2014: LA Deutsch: 3 LP (benotet): Bestehen eines Online-Lektüretests
und kleine Klausur (45 Min.) BA Germanistik: 3 LP (unbenotet): Bestehen eines Online-Lektüretests und kleine Klausur
(45 Min.) 3 LP (Modulprüfung, benotet): große Klausur (90 Min.) Prüfungsversion 2020 (einschließlich Förderpädagogik
Deutsch): 3 LP (unbenotet) Bestehen eines Online-Lektüretests und kleine Klausur (45 Min.) Orientierungsstudium 2019: 3 LP
(unbenotet) Bestehen eines Online-Lektüretests und kleine Klausur (45 Min.)
Leistungen in Bezug auf das Modul
PNL 254841 - Vorlesung oder Seminar (unbenotet)
87099 S - Ost oder West? Der Balkan in der Literatur von 1500 bis heute
Gruppe Art Tag Zeit Rhythmus Veranstaltungsort 1.Termin Lehrkraft
1 S Mo 14:00 - 16:00 wöch. Online.Veranstalt 12.04.2021 Sotirios Agrofylax
Links:
Kommentar http://www.uni-potsdam.de/lv/index.php?idv=33456
Kommentar
Für weitere Informationen zum Kommentar, zur Literatur und zum Leistungsnachweis klicken Sie bitte oben auf den Link
"Kommentar".
Nicht erst seit Peter Handke spielt der Balkan in der deutschsprachigen Literatur als Topos eine Rolle. Schon in der Frühen
Neuzeit wurden Reisen unternommen und die heterogenen Balkanvölker in Reiseberichten beschrieben. Dabei standen vor
allem die Griechen im Fokus aber auch die anderen Völker fanden Berücksichtigung. In Rahmen dieses Seminars sollen
einige Texte von 1500 bis heute betrachtet werden, in denen sich deutschsprachige Autoren von der Frühen Neuzeit bis zur
Gegenwart mit dem Balkan, seiner Geschichten und Völker beschäftigt haben. Es soll auch die Frage geklärt werden, wie
durch Texte Einfluss auf den Verlauf der Geschichte auf dem Balkan genommen wurde.
Literatur
Marie-Janine Calic: Südosteuropa. Weltgeschichte einer Region. München: C.H. Beck Verlag 2016.
Edgar Hösch: Geschichte des Balkans. München: C.H. Beck Verlag 2004.
Tanja Zimmermann: Der Balkan zwischen Ost und West. Mediale Bilder und Kulturpolitische Prägungen. Köln: Böhlau Verlag
2014.
Ulf Brunnbauer u. Klaus Buchenau: Geschichte Südosteuropas. Stuttgart: Reclam 2018.
Gabriella Schubert u. Wolgang Dahmen (Hg.): Bilder vom Eigenen und Fremden aus dem Donau-Balkan-Raum. Analysen
literarischer und anderer Texte. München: Sudosteuropa-Gesellschafft 2003 [Südosteuropa-Studien Bd. 71].
14
Abkürzungen entnehmen Sie bitte Seite 5Zwei-Fach-Bachelor - Germanistik 90 LP - Prüfungsversion Wintersemester 2020/21
Leistungsnachweis
Prüfungsversion 2011:
2 LP (unbenotet): aktive Teilnahme + Referat + Moodle-Aufgaben
3 LP: Hausarbeit (K) oder Prüfungsgespräch (P)
Prüfungsversion 2014:
2 LP (unbenotet): aktive Teilnahme + Referat + Moodle-Aufgaben
2 LP: Hausarbeit/Variante B (K) oder Prüfungsgespräch/Variante A (P)
Prüfungsversion 2020:
3 LP (unbenotet): aktive Teilnahme + Referat + Moodle-Aufgaben
6 LP: zusätzlich Hausarbeit (15 Seiten) (LV)
zusätzlich: AM - KIG
Prüfungsversion 2014 / BA Germanistik:
3 LP (unbenotet): aktive Teilnahme + Referat + Moodle-Aufgaben
3 LP/Variante A: zusätzlich Essay (ca. 5 – 8 Seiten) oder Projektbeitrag (LV)
3 LP/Variante B: Hausarbeit (K) oder Projektbeitrag (K)
Prüfungsversion 2020 / BA Germanistik:
6 LP: aktive Teilnahme + Referat + Moodle-Aufgaben + Hausarbeit (15 Seiten) oder Projektbeitrag (LV)
Leistungen in Bezug auf das Modul
PNL 254841 - Vorlesung oder Seminar (unbenotet)
PL 254842 - Seminar mit Hausarbeit (benotet)
PNL 254921 - Seminar (unbenotet)
87102 S - Träume in der mittelalterlichen Literatur
Gruppe Art Tag Zeit Rhythmus Veranstaltungsort 1.Termin Lehrkraft
1 S Di 10:00 - 12:00 wöch. Online.Veranstalt 13.04.2021 Julia Rüthemann
Links:
Kommentar http://www.uni-potsdam.de/lv/index.php?idv=33464
15
Abkürzungen entnehmen Sie bitte Seite 5Zwei-Fach-Bachelor - Germanistik 90 LP - Prüfungsversion Wintersemester 2020/21
Kommentar
Für weitere Informationen zum Kommentar, zur Literatur und zum Leistungsnachweis klicken Sie bitte oben auf den Link
"Kommentar".
Träume haben in der mittelalterlichen Literatur die unterschiedlichsten Funktionen: sie können vorausdeuten auf das
kommende Geschehen, Gefühle und Gedanken einer Figur abbilden oder einen Raum der Imagination entwerfen und die
Grenzen dessen, was erzählbar ist, überschreiten lassen.
Träume stehen nach mittelalterlicher Vorstellung in enger Verwandtschaft zu Visionen. Daher werden wir uns zunächst mit
dem mittelalterlichen Verständnis von Träumen (auch im Versuch der Abgrenzung zu Visionen) auseinandersetzen und dafür
auf mittelalterliche Theoriebildungen zum Traum (und zur Vision) zu sprechen kommen.
Vor allem aber widmen wir uns den literarischen Schilderungen von Träumen. Sie sind ein gattungsübergreifendes
Phänomen: wir finden sie in der Lyrik, in der mittelhochdeutschen Epik oder in Sonderformen wie den allegorischen Ich-
Erzählungen. Anhand von exemplarischen Textausschnitten wollen wir die Darstellung und die Funktion literarischer Träume
genauer untersuchen und diskutieren. Dafür werden wir auch auf einzelne Forschungsbeiträge zurückgreifen.
Träume in der mittelhochdeutschen Literatur bilden den thematischen Schwerpunkt dieses Seminars, doch werden literarisch
bedeutsame Träume anderssprachiger Literatur ebenso Beachtung finden.
Ziel des Seminars ist es, im gemeinsamen Austausch Ihre mediävistischen Kenntnisse zu erweitern und Ihre Fertigkeiten in
literaturwissenschaftlicher Textinterpretation zu vertiefen. Dabei sollen Sie auch lernen, erste eigene Forschungsfragen bzw. -
ansätze zu entwickeln.
Literatur
Primärtexte und Forschungsbeiträge werden über Moodle bereitgestellt.
Leistungsnachweis
Prüfungsversion 2011: 2 LP (unbenotet): Testat 3 LP/Modulprüfung: Hausarbeit (K) oder Prüfungsgespräch (P)
Prüfungsversion 2014: 2 LP (unbenotet): Testat 2 LP/Modulprüfung: Hausarbeit/Variante B (K) oder Prüfungsgespräch/
Variante A (P) Prüfungsversion 2020 (einschließlich Förderpädagogik Deutsch): 3 LP (unbenotet): Testat 6 LP: Testat +
Hausarbeit (15 Seiten) (LV)
Testat 2 LP: Kommentierte Auswahlbibliographie (4 Seiten)
Testat 3 LP: Mitgestaltung einer Sitzung im Rahmen einer Expert*innen-Gruppe und schriftliche Ausarbeitung (6 Seiten pro
Gruppe)
Testat 6 LP (+ Hausarbeit 15 Seiten): Mitgestaltung einer Sitzung im Rahmen einer Expert*innen-Gruppe und schriftliche
Ausarbeitung (6 Seiten pro Gruppe)
Leistungen in Bezug auf das Modul
PNL 254841 - Vorlesung oder Seminar (unbenotet)
PL 254842 - Seminar mit Hausarbeit (benotet)
PNL 254921 - Seminar (unbenotet)
87108 S - Iwein wird 800. Felicitas Hoppes Jugendbuch „Iwein Löwenritter“ und seine mittelalterliche Vorlage
Gruppe Art Tag Zeit Rhythmus Veranstaltungsort 1.Termin Lehrkraft
1 S Di 10:00 - 12:00 wöch. Online.Veranstalt 13.04.2021 PD Dr. Andreas Degen
Links:
Kommentar http://www.uni-potsdam.de/lv/index.php?idv=33613
16
Abkürzungen entnehmen Sie bitte Seite 5Zwei-Fach-Bachelor - Germanistik 90 LP - Prüfungsversion Wintersemester 2020/21
Kommentar
Für weitere Informationen zum Kommentar, zur Literatur und zum Leistungsnachweis klicken Sie bitte oben auf den Link
"Kommentar".
Der Gegenstand des Seminars verbindet mittelalterliche Literatur und Gegenwartsliteratur: den Artusroman ‚Iwein’ von
Hartmann von Aue und seine moderne Bearbeitung durch Felicitas Hoppe: ‚Iwein Löwenritter’. Das gemeinsam von PD Dr.
Andreas Degen (Neugermanistik) und Prof. Dr. Katharina Philipowski (Altgermanistik) durchgeführte Seminar untersucht, wie
sich die Bearbeitung auf ihre berühmte Vorlage bezieht: Was hat die Autorin aus dem mittelalterlichen Stoff gemacht, was hat
sie aufgegriffen, modernisiert, übergangen, ausgeklammert, verändert? Wie hat der völlig andere kulturell-literarische Kontext,
wie die veränderte Adressierung (Artusroman - Jugendbuch) die Gestaltung des Werkes verändert? Gegenstand dieses
Seminars soll nicht nur die Auseinandersetzung mit den jeweiligen Texten, dem mittelalterlichen wie dem modernen, sein,
sondern auch die Frage, wie ein Buch oder Codex (im Mittelalter wie im 21. Jahrhundert) als Gegenstand präsentiert wird - als
Repräsentations-, als Gebrauchs- oder Konsumgegenstand. Dazu werden wir eine Mitarbeiterin des S. Fischer Verlages, die
an der Produktion von F. Hoppes Buch beteiligt gewesen ist, als Gast in unserem Seminar befragen können. Textgrundlage
für Hartmanns ‚Iwein’ ist entweder die Reclam-Ausgabe von Rüdiger Krohn mit dem Kommentar von Mireille Schnyder [RUB
19011] oder die Klassiker-Edition mit Übersetzung und Kommentar von Volker Mertens (in: Hartmann von Aue: Gregorius/
Der arme Heinrich/Iwein, hrsg. und übersetzt von Volker Mertens. Frankfurt a. M. 2008 [Deutscher Klassiker Verlag Bd. 29]).
Außerdem benötigen Sie Felicitas Hoppe: Iwein Löwenritter. Frankfurt a. M. 2008 (oder später).
Leistungsnachweis
Prüfungsversion 2011: 2 LP (unbenotet): Vorbereitung und Präsentation eines Tafelbildes mit schriftlicher Ausarbeitung (2
Seiten) 3 LP/Modulprüfung: Hausarbeit (K) oder Prüfungsgespräch (P) Prüfungsversion 2014: 2 LP (unbenotet): Vorbereitung
und Präsentation eines Tafelbildes mit schriftlicher Ausarbeitung (2 Seiten) 2 LP/Modulprüfung: Hausarbeit/Variante B (K)
oder Prüfungsgespräch/Variante A (P) Prüfungsversion 2020 (einschließlich Förderpädagogik Deutsch): 3 LP (unbenotet):
Vorbereitung und Präsentation eines Tafelbildes mit schriftlicher Ausarbeitung (3 Seiten) 6 LP: Vorbereitung und Präsentation
eines Tafelbildes mit schriftlicher Ausarbeitung (3 Seiten) + Hausarbeit (15 Seiten) (LV)
Leistungen in Bezug auf das Modul
PNL 254841 - Vorlesung oder Seminar (unbenotet)
PL 254842 - Seminar mit Hausarbeit (benotet)
PNL 254921 - Seminar (unbenotet)
87109 S - Grundfragen des Erzählens, diskutiert an der Kriminalgeschichte „Die Judenbuche“ von Annette von
Droste-Hülshoff (1842) (in Kooperation mit dem fachdidaktischen Seminar von Franziska Risse)
Gruppe Art Tag Zeit Rhythmus Veranstaltungsort 1.Termin Lehrkraft
1 S Do 12:00 - 16:00 wöch. Online.Veranstalt 15.04.2021 PD Dr. Andreas Degen
Links:
Kommentar http://www.uni-potsdam.de/lv/index.php?idv=33614
Kommentar
Für weitere Informationen zum Kommentar, zur Literatur und zum Leistungsnachweis klicken Sie bitte oben auf den Link
"Kommentar".
Die 1842 publizierte Erzählung „Die Judenbuche“, die dem Frührealismus zugerechnet wird, spielt in einem Dorf in der
westfälischen Provinz. Sie ist vieles zugleich: Milieustudie, Kriminalfall, Dorfgeschichte und raffiniert erzählte Novelle. Annette
von Droste-Hülshoff greift bei der Niederschrift auf reale Vorgänge zurück. Das Seminar führt anhand dieses Textes in
die Grundlagen der Analyse von erzählenden Texten ein. Behandelt und geübt wird die systematische, begriffsbasierte
Analyse u.a. der Kategorien Zeit, Fokalisierung/Perspektivierung, Stimme, Motivierung, Figur, Spannung und Raum. Das
Seminar richtet sich an alle BA-Studierende der Germanistik (Zwei-Fach-BA und Lehramt), es ist inhaltlich eng mit dem
literaturdidaktischen Seminar zum gleichen Themenfeld von Franziska Risse abgestimmt. Um die – empfohlene, nicht
verpflichtende – Koppelung mit dem aufbauenden Seminar von Franziska Risse zu ermöglichen, findet das Seminar nur
während der ersten Semesterhälfte statt, dafür aber jeweils als Doppelsitzung (mit Pause). Das didaktische Seminar findet in
der zweiten Semesterhälfte zur gleichen Uhrzeit statt. Lehramts-Studierenden wird der Besuch beider Seminare nachdrücklich
empfohlen. Sofern es angesichts der Pandemie-Situation zweckmäßig erscheint, wird das Seminar zur angegebenen Uhrzeit
online stattfinden (synchrones Zoom-Webinar). Zugangsinformationen werden nach der Zulassung zum Seminar mitgeteilt.
Literatur
-Annette von Droste-Hülshoff Handbuch, hg. von Cornelia Blasberg und Jochen Grywatsch. Berlin, Boston 2018. - Silke Lahn,
Jan Christoph Meister: Einführung in die Erzähltextanalyse. 3., aktualisierte u. erweiterte Aufl. Stuttgart, Weimar 2016. (1. Aufl.
2008). (über Opac der Bibliothek kostenloser Volltext) - Matias Martinez, Michael Scheffel: Einführung in die Erzähltheorie. (7.)
München 2007.
Leistungsnachweis
Prüfungsversion 2011: 2 LP (unbenotet): Impulsreferat (10 min) mit schriftlicher Überarbeitung 3 LP/Modulprüfung: Hausarbeit
(K) oder Prüfungsgespräch (P) Prüfungsversion 2014: 2 LP (unbenotet): Impulsreferat (10 min) mit schriftlicher Überarbeitung
2 LP/Modulprüfung: Hausarbeit/Variante B (K) oder Prüfungsgespräch/Variante A (P) Prüfungsversion 2020 (einschließlich
Förderpädagogik Deutsch): 3 LP (unbenotet): Impulsreferat (10 min) mit schriftlicher Überarbeitung 6 LP: Impulsreferat (10
min) mit schriftlicher Überarbeitung + Hausarbeit (15 Seiten) (LV)
Leistungen in Bezug auf das Modul
PNL 254841 - Vorlesung oder Seminar (unbenotet)
PL 254842 - Seminar mit Hausarbeit (benotet)
17
Abkürzungen entnehmen Sie bitte Seite 5Sie können auch lesen