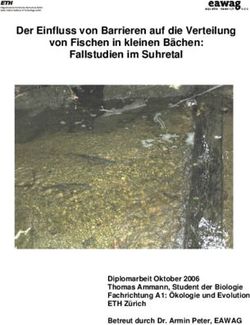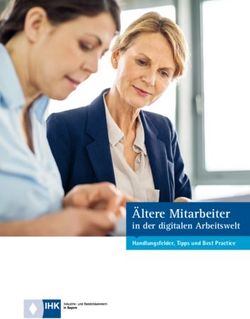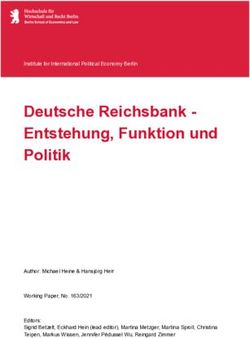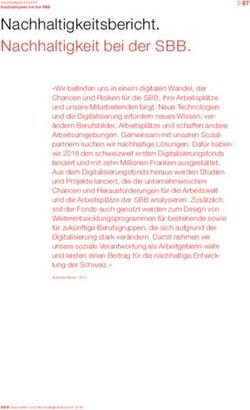Wege zu wirksamen Uferstreifen - Arbeitshilfe - Bayerisches Landesamt für Umwelt - Bayerisches ...
←
→
Transkription von Seiteninhalten
Wenn Ihr Browser die Seite nicht korrekt rendert, bitte, lesen Sie den Inhalt der Seite unten
Impressum Arbeitshilfe: Wege zu wirksamen Uferstreifen Herausgeber: Bayerisches Landesamt für Umwelt (LfU) Bürgermeister-Ulrich-Straße 160 86179 Augsburg Tel.: 0821 9071-0 Fax: 0821 9071-5556 E-Mail: poststelle@lfu.bayern.de Internet: www.lfu.bayern.de Bearbeitung/Text/Konzept: LfU, Referat 64, Dr. Thomas Henschel, Wolfgang Kraier, Eva Simone Schnippering, Martina Wand, Referat 66, Ulrich Kaul, Ab- teilung 5, Dr. Andreas Otto, Gerhard Suttner Bayerisches Staatsministerium für Umwelt und Verbraucherschutz, Referat 56, Stefan Wedding Deutscher Verband für Landschaftspflege: Beate Krettinger Landschaft + Plan Passau, Dorothee Hartmann, Thomas Herrmann Markt Diedorf, Anna Röder Wasserwirtschaftsamt Bad Kissingen, Norbert Schneider Praxisbeispiele Donautal-Aktiv e. V., Susanne Kling Landschaftspflegeverband Neumarkt e. V., Agnes Hofmann Landschaftspflegeverband Regensburg e. V., Josef Sedlmeier Wasserwirtschaftsamt Deggendorf, Christa Pantke Wasserwirtschaftsamt Kronach, Siegmund Katholing Redaktion: LfU, Referat 64, Eva Schnippering, Martina Wand Bildnachweis: Text Bayerisches Landesamt für Umwelt (LfU), Abbildung 1-4 Vortrag Dorothee Hartmann: F. 12; Thomas Hofmann (Zweckverband Gew. III): F. 25 li., Wolfgang Kraier (LfU): F. 14 u.; Landesamt für Umwelt: F. 3, 4, 6, 24 r.; Thomas Paulus (GfG): F. 14 o., 21; Norbert Schneider (WWA Bad Kissingen): F. 13 r.; Eva Simone Schnippering (LfU): F. 1, 5, 23, 26, 27 li., 30; Raimund Schoberer (Reg. d. Opf.): F. 13 li. m., 25 r., 27 r.; Gerhard Suttner (LfU): F. 7, 8; WWA Landshut: F. 28; WWA München: F. 24 li. Vortrag Anhang Amt für Ländliche Entwicklung Oberfranken: F. 9 li.; Astrid Brillen, piclease: F. 20 m.; Donautal-Aktiv e. V.: F. 13 Maßnahmen- flächen (Geobasisdaten: ©Bayerische Vermessungsverwaltung); Günther Hansbauer: F. 20 r. u.; Andreas Hartl: F. 20 r.o., li.u.; Siegmund Katholing: F. 9 r.; Landschaftspflegeverband Neumarkt i.d.Opf. e.V.: F. 15; Landschaftspflegeverband Regensburg: F. 10; Klaus Reitmeier, piclease: F. 20 li. o; Norbert Schneider (WWA Bad Kissingen): F. 8; Eva Simone Schnippering (LfU): F. 1, 3; Wasserwirtschaftsamt Deggendorf: F. 11, 12, 14 Alle weiteren Bilder und Karten: Bayerisches Landesamt für Umwelt Stand: Juli 2014 Diese Druckschrift wurde mit großer Sorgfalt zusammengestellt. Eine Gewähr für die Richtigkeit und Vollständigkeit kann den- noch nicht übernommen werden. Sofern in dieser Druckschrift auf Internetangebote Dritter hingewiesen wird, sind wir für deren Inhalte nicht verantwortlich.
Inhalt
Inhaltsverzeichnis
1 Einleitung 5
2 Definitionen 6
2.1 Gewässerrandstreifen 6
2.2 Uferstreifen 6
2.3 Entwicklungskorridor 7
3 Funktionen (Wirkung) und Bedeutung von
Uferstreifen/Entwicklungskorridoren 9
3.1 Gewässerentwicklung, Gewässerstruktur 9
3.2 Lebensraum für Tiere und Pflanzen 11
3.3 Abstands-, Puffer- und Filterwirkung; Energie- und Stoffhaushalt 13
3.4 Landschafts- und Ortsbild, Freizeit und Erholung 14
3.5 Wasserabfluss und –rückhalt 16
3.6 Gesamtübersicht zur Wirksamkeit von Gewässerrandstreifen, Uferstreifen und
Entwicklungskorridoren 17
4 Gesetzliche Vorgaben 17
4.1 Wasserhaushaltsgesetz, Bayerisches Wassergesetz 17
4.2 Nutzungsvorgaben nach sonstigen Rechtsvorschriften 18
5 Planung von Uferstreifen 20
6 Flächensicherung und Nutzungsregelungen 20
7 Praxisbeispiele 22
8 Praxishinweise zum Umgang mit Uferstreifen 23
8.1 Planungen 23
8.2 Interessensabwägung bei Nutzungskonflikten 23
9 Fazit, Ausblick 26
10 Literaturverzeichnis und weiterführende Literatur 27
Anhang 1: Förderprogramme 28
Anhang 2: Uferstreifenplanung ohne Gewässerentwicklungskonzept 33
Anhang 3: Uferstreifen-Praxisbeispiele 35
Anhang 4: Bedeutung der Uferstreifen-Funktion bei Planungen und in der
Gewässerunterhaltung 50
Anhang 5: Entscheidungsbaum „Flächensicherung und Nutzungsregelungen“ 52
Bayerisches Landesamt für Umwelt 2014 3Einleitung 1 Einleitung ► Folien 1 und 2 Uferstreifen gehören zu den artenreichsten Landschaftsbestandteilen der Kulturlandschaft. In einer intensiv genutzten, oftmals ausgeräumten Landschaft erfüllen sie viele Funktionen auf begrenztem Raum: Uferstreifen bieten Pflanzen und Tieren Lebensraum und Ausbreitungsmöglichkeiten und tra- gen so zur Erhöhung der Biodiversität bei. Sie bereichern das Landschaftsbild und leisten einen Bei- trag zum Schutz der Fließgewässer vor Stoffeinträgen. Ausreichend breite Uferstreifen ermöglichen die Entwicklung einer gewissen Eigendynamik des Gewässers. Dieser Prozess bewirkt eine Verände- rung der morphologischen Ausprägung, die daraus resultierende Struktur- und Habitat-Vielfalt führt zu einer Verbesserung des ökologischen Zustandes. Uferstreifen stellen ein langjährig bewährtes Element der Gewässerentwicklungsplanung und des Na- turschutzes dar. Dies gilt insbesondere für die staatlichen Gewässer erster und zweiter Ordnung, an den kleinen Gewässern dritter Ordnung ist das Thema bisher weniger präsent. Aus diesem Grund wurde es zum Themenschwerpunkt für die Gewässer-Nachbarschaften 2014 ausgewählt. Das neue Wasserhaushaltsgesetz (WHG) vom 31.07.2009 und das neue Bayerische Wassergesetz (BayWG) von 25.02.2010 haben die Bedeutung naturnaher oder naturnah entwickelter Gewässer ganz wesent- lich gestärkt. Gemeinden mit ihren kleinen Gewässern dritter Ordnung können entscheidend dazu bei- tragen, dass diese Vorgaben stärker als bislang umgesetzt werden und in der Fläche auch greifen. Die vorliegende Arbeitshilfe soll zur Klärung der Begriffe wie Uferstreifen oder Gewässerrandstreifen beitragen und fachliche Anforderungen sowie Umsetzungsstrategien und –möglichkeiten für die Ent- wicklung von Uferstreifen aufzeigen. Von zentraler Bedeutung ist die Bereitstellung und Sicherung der benötigten Flächen. Auch wenn mit der Energiewende vor allem wegen der verstärkten Flächenkon- kurrenz durch Bioenergiepflanzen die Verfügbarkeit von Flächen für Uferstreifen schwieriger gewor- den ist, gibt es dennoch eine Reihe von Möglichkeiten, die rechtlich gestärkte Bedeutung von Ufer- streifen auch umzusetzen. Eine Vielzahl von Fördermöglichkeiten steht bereit, um diese Ziele an den kleinen Gewässern zu unterstützen. Für die Gemeinden können sich Uferstreifen oder Entwicklungs- korridore außerdem langfristig „rechnen“, wenn der Unterhaltungs- und Pflegeaufwand geringer wird. Die Arbeitshilfe will die Gemeinden dazu ermutigen, trotz der aktuell scheinbar schwierigen Voraus- setzungen mehr Uferstreifen an Gewässern zu realisieren und das Thema aktiv anzugehen. Die Fall- beispiele in der Arbeitshilfe zeigen die Möglichkeiten auf. Mit der Arbeitshilfe wird lediglich der fachliche und administrative Sachstand aufgezeigt, es werden keine neuen Standards gesetzt. Die Umsetzung von Maßnahmen erfolgt im Rahmen der bestehenden gesetzlichen Regelungen und Fördermöglichkeiten. Darüber hinaus gelten grundsätzlich für die Bewirtschaftung von Waldflächen die Bestimmungen des Waldgesetzes für Bayern. Es wird deshalb empfohlen, für weitere Hinweise zum Umgang mit bewal- deten Uferstreifen (z. B. Vereinbarkeit von Maßnahmen mit dem Waldgesetz für Bayern) sich mit den örtlich zuständigen Ämtern für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten in Verbindung zu setzen. Bayerisches Landesamt für Umwelt 2014 5
Definitionen
2 Definitionen
Im Kontext von Uferstreifen werden eine Vielzahl von Begriffen gebraucht (Gewässerrandstreifen, Puf-
ferstreifen, Uferrandstreifen, Uferstreifen, Ufergehölzstreifen, Gewässerkorridor, Gewässersaum, Ent-
wicklungskorridor, etc.) die nur zum Teil klar definiert sind.
Für die weitere Behandlung des Themas werden folgende Begriffe definiert und verwendet:
• Gewässerrandstreifen
• Uferstreifen
• Entwicklungskorridor
Die Systematik entspricht dem DWA Merkblatt M 612-1 Gewässerrandstreifen [5].
2.1 Gewässerrandstreifen
Im Sinne des § 38 Wasserhaushaltsgesetz (WHG) beschreibt dieser Begriff einen gesetzlich normier-
ten Bereich an Fließgewässern, der im Außenbereich im Regelfall 5 Meter Breite beidseits des Ge-
wässers festgelegt ist und in dem grundsätzlich bestimmte Nutzungsauflagen bzw. Verbote, z. B. zum
Grünlandumbruch, zum Umgang mit wassergefährdenden Stoffen und zur Anpflanzung bzw. Entfer-
nen von Gehölzen gelten. Bayern hat bei der Wassergesetzgebung bei den Gewässerrandstreifen
vom Abweichungsrecht der Länder Gebrauch gemacht (Art. 21 BayWG). Deshalb gibt es in Bayern
keinen durch gesetzliche Vorgaben begründeten Gewässerrandstreifen im Sinne des § 38 WHG. Ein-
zelheiten werden im Kap. 4.1 erläutert.
2.2 Uferstreifen
Der unmittelbar an das Gewässer (Ufer- bzw. Böschungsoberkante) angrenzende Teil der Aue, der
standorttypischen naturnahen Bewuchs aufweist und mit dem Gewässer eine funktionale Einheit bil-
[2]
det. Fachliche Anhaltspunkte liefert das LfU Merkblatt Nr. 5.1/3 Gewässerentwicklungskonzepte ,
insbesondere die Bedeutung der Uferstreifen für die naturnahe Eigenentwicklung. Der Uferstreifen ist
in der Regel ungenutzt. Wenn es die Funktion erfordert, kann auch eine extensive Nutzung oder Pfle-
ge stattfinden. Eine intensive Nutzung (z. B. Ackerbau, Bebauung oder Infrastruktur) steht der Ufer-
streifenfunktion entgegen. Die Mindestbreite für funktionsfähige Uferstreifen ist in erster Linie von der
(natürlichen) Breite des Fließgewässers abhängig.
6 Bayerisches Landesamt für Umwelt 2014Definitionen Abb. 1: Uferstreifen an einem ausgebauten Gewässer Abb. 2: Uferstreifen an einem naturnahen Gewässer ► Folie 3 2.3 Entwicklungskorridor Als Entwicklungskorridor wird der Teil der Aue bezeichnet, der in Abhängigkeit vom Fließgewässertyp und der Gewässergröße eine natürliche, eigendynamische morphologische Gewässerentwicklung er- möglicht. Er beinhaltet den Uferstreifen als grundsätzlich nutzungsfreies Kernelement, beansprucht i.d.R. aber zusätzliche Flächen, maximal die gesamte Aue. Die über den Uferstreifen hinausgehenden Flächen können bis zur Inanspruchnahme durch das Gewässer durch die Laufverlagerung land- oder forstwirtschaftlich genutzt werden. Bayerisches Landesamt für Umwelt 2014 7
Definitionen
Die Ermittlung des Entwicklungskorridors ist i. d. R. Bestandteil der Gewässerentwicklungsplanung.
[8]
Methodische Hinweise finden sich u. a. in MUNLV NRW 2010 .
Abb. 3: Darstellung des Entwicklungskorridors ► Folie 4
8 Bayerisches Landesamt für Umwelt 2014Funktionen (Wirkung) und Bedeutung von Uferstreifen/Entwicklungskorridoren
3 Funktionen (Wirkung) und Bedeutung von Uferstrei-
fen/Entwicklungskorridoren
► Folie 5
3.1 Gewässerentwicklung, Gewässerstruktur
Gewässerentwicklung mit dem Ziel, naturnaher, ökologisch und morphologisch funktionsfähiger Fließ-
gewässer mit minimalem Unterhaltungsaufwand erfordert Raum. Die Bereitstellung eines Uferstreifens
an einem ausgebauten, naturfernen Gewässer ist der erste Schritt auf diesem Weg. Da im Uferstrei-
fen keine – aus Nutzersicht – hochwertigen Nutzungen stattfinden, muss das Ufer nicht mehr gesi-
chert werden und das Gewässer kann sich (ggf. nach Initialmaßnahmen) im Zuge der natürlichen Sei-
tenerosion bei bettbildenden Hochwässern verbreitern. Im Gewässer und im Uferstreifen entstehen
zunehmend naturnahe Strukturen bzw. können dort eingebracht werden (z. B. durch Initialpflanzun-
gen) und der Entwicklung überlassen werden. Der gesamte Prozess einer eigendynamischen Gewäs-
serentwicklung ist in Abbildung 4 idealtypisch für einen Bach bzw. kleinen Fluss außeralpiner Gewäs-
serlandschaften dargestellt.
Bayerisches Landesamt für Umwelt 2014 9Funktionen (Wirkung) und Bedeutung von Uferstreifen/Entwicklungskorridoren Abb. 4: Phasen einer naturnahen Gewässerentwicklung ► Folie 6 10 Bayerisches Landesamt für Umwelt 2014
Funktionen (Wirkung) und Bedeutung von Uferstreifen/Entwicklungskorridoren Die üblichen Uferstreifenbreiten reichen in der Regel allerdings nicht aus, um den vollständigen Ent- wicklungsprozess zu einem naturnahen, im Auwald pendelnden Bach oder Fluss zu gewährleisten. Dazu ist ein Entwicklungskorridor notwendig, der meist größere Flächen beansprucht. In der Kulturlandschaft kann realistischerweise diese vollständige Entwicklung nicht überall umgesetzt werden. Aber auch Teilschritte der Gewässerentwicklung, wie z.B. die Entwicklungsphase I in Abbil- dung 4, die mit einem Uferstreifen zu realisieren sind, stellen bereits erhebliche Verbesserungen im Hinblick auf die natürliche Funktionsfähigkeit bzw. den guten ökologischen Zustand eines Fließge- wässers dar. Wo an einem konkreten Gewässer welcher Entwicklungszustand angestrebt wird, ist norma- lerweise das Ergebnis eines umfangreichen Planungsprozesses, das z. B. in einem Gewässer- entwicklungskonzept (GEK) oder einem Umsetzungskonzept (UK) der Wasserrahmenrichtlinie (WRRL) dargestellt wird. Lage, Ausdehnung und Beschaffenheit von notwendigen Uferstreifen sind regelmäßig in den Maßnahmenhinweisen dieser Pläne festgehalten (vgl. Kap. 5 bzw. Kap. 8). 3.2 Lebensraum für Tiere und Pflanzen ► Folien 7 und 8 Die ökologische Bedeutung von Uferstreifen hängt maßgeblich von deren struktureller Vielfalt, deren Breite, den Standortverhältnissen und den darauf stattfindenden Nutzungsformen ab. Generell kann man sagen, dass ein ausgewogenes Verhältnis von Offenlandlebensräumen und Gehölzstrukturen – von Licht und Schatten – für eine Vielzahl von Organismen günstige Voraussetzungen bietet. Im Gegensatz zu intensiv landwirtschaftlich genutzten Flächen können Uferstreifen mit Biotopqualität entsprechend ihrer Ausdehnung als zentrale Ausbreitungsachsen und Wanderkorridore oder Rück- zugsgebiete für Tiere und Pflanzen fungieren. Aber auch kleinflächige Strukturelemente können als Trittstein einen wertvollen Beitrag zum Erhalt der Biodiversität leisten. Flächen entlang von Fließge- wässern sind in idealer Weise als Verbindungsflächen oder Verbindungselemente im Sinne des ge- setzlichen Auftrags zur Bewahrung, Wiederherstellung und Entwicklung funktionsfähiger ökologischer Wechselbeziehungen geeignet (§ 21 BNatSchG; Biotopverbund, Biotopvernetzung). Lebensräume der Uferstreifen Die Lebensräume der Uferstreifen bilden im Regelfall eine eng mit dem Fließgewässer verwobene ökologische Einheit. Anthropogene Einflüsse haben jedoch vielerorts zu einer Entkopplung der Le- bensbereiche Bach und Bachaue und damit zum Verlust lebensraumprägender Standortmerkmale, insbesondere zum Verlust regelmäßiger Überschwemmungen geführt. Die ursprüngliche Vegetation (Primärvegetation) entlang von Fließgewässern ist der Auwald. Die Ge- hölzzusammensetzung ist maßgeblich vom Gewässertyp, vom Überflutungsregime und von den Bo- denverhältnissen abhängig. Entlang kleinerer Fließgewässer dominieren oft Schwarzerle und Strauchweiden, an großen Gewässern gelangen in der Weichholzaue baumförmig wachsende Wei- den, v. a. die Silberweide zur Dominanz. Landeinwärts schließt daran die nur episodisch überflutete Hartholzaue an. Naturnah belassene Auwälder sind insbesondere aus ornithologischer Sicht beson- ders bedeutsam. Abhängig von Größe und Dynamik der Gewässer sind ursprüngliche Auwälder meist mit mehr oder weniger großen, offenen Bereichen durchsetzt. Aufgrund der vorwiegend feuchten bis nassen Standortverhältnisse in den Auen besteht die Vegetation meist aus Röhrichten, Großseggen- rieden oder Hochstaudenfluren. Entlang größerer Fließgewässer mit grobkörnigen, kiesigen Ablage- rungen können jedoch auch Flächen mit trockenheitsliebender Vegetation vorkommen. Diese werden als Brennen bezeichnet und sind naturschutzfachlich von herausragender Bedeutung. Bayerisches Landesamt für Umwelt 2014 11
Funktionen (Wirkung) und Bedeutung von Uferstreifen/Entwicklungskorridoren In Mitteleuropa sind Auwälder in weiten Bereichen landwirtschaftlichen Nutzungsformen gewichen. Ar- tenreiche Feucht- und Nasswiesen treten als Ersatzgesellschaften von Auwäldern auf, wenn die land- wirtschaftliche Nutzung extensiv betrieben wird und nur geringe standörtliche Veränderungen (z. B. Dränungen, Auffüllungen etc.) stattgefunden haben. Sie sind meist wenig ertragreich, zeichnen sich jedoch durch eine große Artenfülle aus und sind aus naturschutzfachlicher Sicht entsprechend wert- voll einzustufen. Mit zunehmender Intensivierung der Landwirtschaft verarmen diese Grünlandbestän- de und verlieren damit an naturschutzfachlicher Bedeutung. Andererseits werden die wenig ertragreichen Grünlandstandorte zunehmend aus der Nutzung ge- nommen. Wenn keine Pflege aus Naturschutzgründen erforderlich ist oder aus anderen Gründen nicht umgesetzt werden kann, entwickeln sich dort oft Röhrichte, Großseggenriede oder Hochstaudenfluren in ähnlicher Ausbildung, wie sie auch in lichten Bereichen primärer Auwälder vorkommen können. Auf nährstoffreichen und/oder standörtlich stärker veränderten Standorten stellen sich bei fehlender Nut- zung oft wenig artenreiche Bestände mit Arten wie Brennnessel oder Rohrglanzgras ein. In Landschaften mit ertragreichen Böden und intensiver Landwirtschaft sind entlang von Fließgewäs- sern oft nur schmale, ungenutzte oder extensiv genutzte Uferstreifen ausgebildet. Die Vegetation be- steht dort häufig aus ruderal geprägten Hochstaudenfluren, Altgrasbeständen oder lichten Gehölz- streifen mit nährstoffliebenden Arten im Unterwuchs. Nicht selten sind dort invasive Arten, beispiels- weise das Indische Springkraut am Vegetationsaufbau beteiligt. Arten der Uferstreifen Uferstreifen mit Biotopqualität oder ökologisch aufgewertete Uferstreifen können zahlreichen Orga- nismen als (Teil-)Lebensraum dienen. In erster Linie werden sie von kennzeichnenden Arten dieses Lebensraums besiedelt, die im Regelfall nicht nur auf entsprechend ausgestattete Uferstreifen, son- dern ebenso auf das Fließgewässer selbst als Lebensraum angewiesen sind. Kennzeichnende Arten in diesem Sinne sind demnach z. B. der Biber, die Wasseramsel oder die Helm-Azurjungfer (Libelle). Entsprechend ihrer Ausprägung bieten Uferstreifen jedoch auch denjenigen Arten Raum und Ausbrei- tungsmöglichkeiten, die andernorts vergleichbare Habitate besiedeln können, wie z. B. dem Schwarz- blauen Wiesenknopf-Ameisenbläuling (Schmetterling). Im Folgenden werden exemplarisch zwei Arten der Uferstreifen näher beschrieben: Helm-Azurjungfer (Coenagrion mercuriale) Die Helm-Azurjungfer ist eine Kleinlibellenart, deren Männchen wie bei vielen, ähnlichen Arten auch, auffällig blau gefärbt sind. Durch eine markante Zeichnung auf dem zweiten Hinterleibsegment, das als „Merkur-Helm“ gedeutet wird und der Art ihren Namen verliehen hat, können die Männchen der Art leicht von denen ähnlicher Arten unterschieden werden. Die Helm-Azurjungfer gilt in Bayern und in Deutschland als „vom Aussterben bedroht“ und ist in den Anhängen II und IV der FFH-Richtlinie gelis- tet. Entsprechend hoch sind alle Vorkommen naturschutzfachlich zu bewerten. Die Larven leben in meist grund- oder quellwasserbeeinflussten, kleinen Bächen und Gräben mit Unterwasservegetation und keiner oder nur lückiger Beschattung durch Gehölze. Die ausgewachsenen Libellen (Imagines) benötigen Uferstreifen mit kraut- oder grasreicher Vegetation. Deshalb sollten Uferstreifen an Gewäs- sern mit bekannten oder potentiellen Vorkommen der Helm-Azurjungfer überwiegend gehölzfrei ge- staltet werden. Die Ufervegetation sollte außerhalb der Flugzeit der Art abschnittweise gemäht wer- den, um Gehölzaufwuchs zu verhindern. Auf zu umfangreiche Gewässerräumungen reagiert die Art ausgesprochen empfindlich. 12 Bayerisches Landesamt für Umwelt 2014
Funktionen (Wirkung) und Bedeutung von Uferstreifen/Entwicklungskorridoren
Biber (Castor fiber)
► Koreferat Biberberater
Der Biber ist nach dem südamerikanischen Wasserschwein das zweitgrößte Nagetier der Erde. Er er-
reicht einschließlich seines typischen, beschuppten Schwanzes, der sog. Biberkelle, eine Körperlänge
von bis zu 1,3 Meter und ein Maximalgewicht von über 30 kg. Der Biber wurde im 19. Jahrhundert in
fast ganz Europa ausgerottet. Durch erfolgreiche Wiederansiedlungsprojekte und anschließende Aus-
breitung ist er heute fast überall in Bayern entlang von Fließ- und Stillgewässern wieder zuhause und
gilt in Bayern nicht mehr als gefährdet. Als Art des Anhangs IV der Fauna-Flora-Habitat-Richtlinie
(FFH-Richtlinie) genießt er jedoch europarechtlichen Schutz. Nach dem Bundesnaturschutzgesetz
(BNatSchG) gilt er als besonders und streng geschützte Art. Biber bilden Familienverbände mit zwei
Elterntieren und mehreren Jungtieren. Die Reviere werden gegen fremde Artgenossen abgegrenzt
und umfassen ca. 1-5 Kilometer Gewässerufer, an dem ca. 10-20 Meter breite Uferstreifen genutzt
werden. Typische Biberlebensräume sind Fließgewässer mit ihren Auen, aber auch Gräben, Altwäs-
ser und verschiedenen Stillgewässer. Er ist eine Schlüsselart der Gewässerlebensräume, der wie kei-
ne andere einheimische Art seinen Lebensraum durch Dammbauten und Baumfällungen selbst ge-
staltet.
3.3 Abstands-, Puffer- und Filterwirkung; Energie- und Stoffhaushalt
► Folien 9 bis 11
Aufgrund des hohen Ausbaugrades der Abwasserbehandlung nimmt die Bedeutung der diffusen stoff-
lichen Einträge in die Oberflächengewässer weiter zu. Während der Anteil des diffusen Eintrags beim
Phosphor bis 1987 in Deutschland noch bei ca. 15 % lag, so betrug er 2005 bereits ca. 50 % (UBA
2010). In Bayern wurde für 2011 ein Anteil von ca. 63 % errechnet (LfU 2013). Die größte diffuse Be-
lastungsquelle stellt dabei die landwirtschaftliche Flächennutzung dar. Die dort ausgebrachten Nähr-
stoffe wie Phosphor und Stickstoff, aber auch Pflanzenschutzmittel können in gelöster Form oder mit
Bodenpartikeln in die Gewässer eingetragen werden.
Bei den diffusen Stoffeinträgen kommen im Wesentlichen die folgenden Eintragswege vor:
• Über Bodenpartikel, ausgelöst durch niederschlagsbedingte Erosionsvorgänge,
• mit dem Oberflächenabfluss lösen sich Stoffe aus dem Oberboden und gelangen ins Gewässer,
• indirekt über Grundwasser, Dränungen und Zwischenabfluss,
• durch Windverdriftung z. B. beim Ausbringen von Pflanzenschutzmitteln oder Dünger,
• Eintrag von im Niederschlag gelösten Stoffen aus Luftverunreinigungen durch Verkehr, Haus-
brand, Landwirtschaft und Industrie.
Ausreichend breite Uferstreifen können derartige diffuse Stoffeinträge reduzieren.
Durch die Abstandswirkung werden direkte Einträge vermieden, da ergänzend zu den gültigen Ab-
standsregelungen (Pflanzenschutzgesetz, Düngeverordnung) das Gewässer durch den Uferstreifen
von der Nutzfläche getrennt wird.
Der Uferstreifen erzeugt eine Pufferwirkung, da Stoffe in ihm zurückgehalten und ihr Weitertransport
verzögert werden können. Dies gilt sowohl für die im Oberflächenabfluss gelösten Stoffe als auch für
Bodenpartikel.
Bayerisches Landesamt für Umwelt 2014 13Funktionen (Wirkung) und Bedeutung von Uferstreifen/Entwicklungskorridoren Die zurückgehaltenen Stoffe können in den Stoffkreislauf des Uferstreifens eingebaut und dort evtl. auch abgebaut werden. Dadurch entsteht eine Filterwirkung, die abhängig ist von der Breite und Ve- getation des Uferstreifens. Grundsätzlich ist festzuhalten, dass die beschriebenen Wirkungen im flachen Gelände wesentlich ef- fektiver sind als im hügeligen. Sowohl Dränungen als auch ausgeprägte Geländemulden, die auf Ufer- streifen zulaufen, vermindern das Rückhaltevermögen für Stoffeinträge erheblich. Uferstreifen sind daher kein Ersatz für Maßnahmen auf der landwirtschaftlich genutzten Fläche (gewässerverträg- liche Flächenbewirtschaftung, z. B. durch Erosionsschutzmaßnahmen, an sensiblen Stellen ggf. ver- minderte Düngung oder Extensivierung). Ist der Uferstreifen geprägt durch einen Gehölzsaum mit Bäumen und Sträuchern, kann die dadurch verursachte Beschattung bei kleinen Fließgewässern Eutrophierungserscheinungen vermindern. So wird durch die Beschattung das für die Wasserpflanzen essentielle Lichtangebot im Gewässer verrin- gert und damit auch deren Wachstum und das der Algen. Zudem erwärmt sich das Gewässer weniger stark. Die niedrigeren Wassertemperaturen ermöglichen eine höhere Sauerstoffaufnahme des Gewässers und verbessern dadurch den Abbau von organi- schen Stoffen. Die Beschattung kann aber kein Ersatz für Maßnahmen zur Reduzierung des Nähr- stoffeintrags darstellen. 3.4 Landschafts- und Ortsbild, Freizeit und Erholung ► Folien 12 und 13 Schlüssel zur schönen Landschaft Ein weithin sichtbarer Ufergehölzsaum an einem natürlich mäandrierenden Bach, der Talraum durch die schwingenden, hintereinander gestaffelten Gehölzkulissen spannungsreich in Erlebnisräume ge- teilt. Im Frühjahr weißüberschäumend blühende Traubenkirschen, Weidenkätzen und gelbe Sumpf- dotterblumen, im Sommer ein vielfältiges Mosaikband aus dunkelgrünen Rieden, weißleuchtenden Mädesüßstauden, silbergrauen Schilffahnen oder bunt blühenden, gar orchideenreichen Feuchtwie- sen und im Herbst unterschiedlichste Brauntöne und Texturen. Glitzerndes Wasser, flitzende Libel- len, Falter und auffliegende Vögel. Wie fast kein anderes Landschaftselement verkörpern Bäche in naturnahem Zustand zusammen mit ihrer typischen Begleitvegetation die Eigenart und Schönheit einer Landschaft. Aufgrund der natürli- chen Häufigkeit bilden sie das „visuelle Rückgrat“ unserer Kulturlandschaft (Ringler et al 1984), wobei die Fließgewässer je nach geologischem Untergrund, Klima, Abflussgeschehen, Pflanzen- und Tier- welt eine naturraumtypische, unverwechselbare Charakteristik aufweisen. Heute sind Bäche als Lebensadern der Landschaft oft nicht mehr wahrnehmbar und fallen als eige- nes, charakteristisches Landschaftselement vollständig aus. Manchmal beleben gerade noch die ver- bliebenen schmalen Ufergehölzsäume ausgeräumte Landschaften, wobei die meist begradigten Läufe eher langweilig erscheinen und auch hier die ursprüngliche Eigenart der Landschaft verloren ging. Mit der Anlage (oder Bewahrung) von Uferstreifen, in denen sich Bäche und ihre prägende Begleitve- getation (und Tierwelt!) naturraumcharakteristisch entwickeln dürfen, werden Bäche wieder zu leben- digen, visuell wahrnehmbaren Landschaftselementen, halten Gemeinden einen schnell wirksamen Schlüssel zur Wiederherstellung oder Stärkung einer schönen Landschaft in der Hand. Die dadurch entstehende Unverwechselbarkeit der landschaftsprägenden Talräume kommt dem menschlichen 14 Bayerisches Landesamt für Umwelt 2014
Funktionen (Wirkung) und Bedeutung von Uferstreifen/Entwicklungskorridoren Bedürfnis nach Heimat, Geborgenheit und Identität (NOHL 2001) entgegen und stiftet eine enge Ver- bundenheit der Bevölkerung mit ihrer Gemeinde. Dies scheint umso wichtiger, weil gerade jüngere Einwohner die ursprüngliche Vielfalt und Eigenart der heimatlichen Gewässerlandschaft gar nicht mehr kennen- und schätzen gelernt haben. Lebensadern eines Ortes Bäche und Flüsse beeinflussten seit jeher die Wahl der Ansiedlungen und die Siedlungsgefüge von Städten und Ortschaften. Die enge Verbundenheit von Siedlungen mit Gewässern wird allein schon durch die Aufnahme des Wortteils Bach oder gleich des Bachnamens als Ortsbezeichnung deutlich, z.B. Lohr und Lohrbach im Spessart, Aldersbach im Tertiärhügelland oder Hammerbach bei Erlangen usw.. Fließgewässer gehörten mit ihren spezifischen Nutzungen zum festen Bestandteil des Ortsbil- des: So hatten Bäche im Ort noch bis ins letzte Jahrhundert hinein oft eine befestigte Stelle zum Wä- schewaschen oder wurden im Dorfanger von Wiesen für Wäsche oder das Vieh, Enten und Gänse begleitet. Von der Nutzungsgeschichte zeugen in manchen Orten noch kulturhistorisch bedeutsame und ortsbildprägende Mühlen und Hämmer mit ihren Wehren, Triebwerks- und Mühlgräben. Noch stärker als in der freien Landschaft wurden die Gewässer v. a. in beengten Ortslagen im Laufe der Zeit für Hochwasserfreilegungen, zur Gewinnung von Bauflächen oder Verkehrswegen verbaut, in Betonkorsette gezwängt oder gar vollständig verrohrt. Manchmal weist nur noch eine Straßenbe- zeichnung auf den unsichtbar verrohrten Bach im Ort hin. Ortsbilder werden daher nicht selten von technisch geprägten Gewässern bestimmt oder der Bach ist gar ganz aus den Augen und dem Sinn verschwunden. Platz für Uferstreifen und gegebenenfalls sogar für eine weitergehende Renaturierung von Bächen im Ort zu schaffen, wandelt das Ortsbild entscheidend. Ein naturnäherer Bachverlauf und die damit verbundene Durchgrünung des Ortes mit Ufergehölzen und Krautsäumen im jahreszeitli- chen Wechsel sind immer mit einer Vitalisierung und Aufwertung des Ortsbildes verbunden. Die so revitalisierten Fließgewässer können als deutlich sichtbares Vernetzungselement zwischen Ortschaft und der sie umgebenden Landschaft erlebt werden. Naturnahe Erlebnis- und Erholungsräume Gerade naturnahe Gewässer mit ihren gehölz- oder röhrichtbestandenen Uferstreifen vermitteln eine besondere Natürlichkeit und Wildnisnähe in unserer oft von monotoner Nutzung geprägten Kulturland- schaft. Daher weisen solch erlebbaren und zugänglichen Landschaftsbereiche eine sehr hohe natürli- che Eignung für naturbezogene Erholung auf und sind bei Erholungsurlaubern und Anwohnern zum Spazierengehen, Wandern und Radfahren sehr beliebt. Hier ist intensives Naturerleben und Naturge- nuss mit allen Sinnen möglich: plätscherndes Wasser, Gesang typischer Bach- und Auenbewohner wie Rohrsänger und Heuschrecken, Windgeräusche des Schilfs, der Duft blühender Traubenkirschen, die Farben- und Formenvielfalt der Ufervegetation, Tierbeobachtungen und dergleichen mehr. Frei- zeitfischer finden hier die Ruhe für ihr naturnahes Hobby. Schön ist es, wenn man sogar im Ort entlang von vitalisierten Bächen spazieren gehen kann. Eine damit verbundene Steigerung der Freiraumqualität erhöht den Wohnwert und die Attraktivität des Or- tes und kann ausschlaggebend bei der Wohnortwahl sein. Kinder und Jugendliche sammeln ortsnah einen großen naturbezogenen Erfahrungsschatz. Bäche, ihre Tier- und Pflanzenwelt sind für die Na- turpädagogik und -bildung unserer Kinder in der von den digitalen Medien bestimmten künstlichen Welt wertvolle Bausteine für eine ganzheitliche Entwicklung. Dafür benötigen Bäche und ihre Ufer- streifen ausreichend Platz! Mit der Entwicklung von Uferstreifen inner- wie außerorts setzen Gemeinden in idealer Weise § 1, Abs. 1 BNatSchG um: Natur und Landschaft sind so zu schützen, dass die Vielfalt, Eigenart und Schönheit sowie der Erholungswert der Landschaft auf Dauer gesichert sind. Sie stellen ein lebendi- ges Element einer wirksamen Erholungsvorsorge für uns und die folgenden Generationen dar. Bayerisches Landesamt für Umwelt 2014 15
Funktionen (Wirkung) und Bedeutung von Uferstreifen/Entwicklungskorridoren 3.5 Wasserabfluss und –rückhalt ► Folie 14 Gewässerbett, Ufer, Uferstreifen und Aue bilden eine Einheit. Der Uferstreifen dient als Bestandteil der Aue bei Hochwassern natürlicherweise auch dem Wasserabfluss und bzw. Wasserrückhalt. Ab- flusswirksam sind Uferstreifen nur dann, wenn sie relativ dicht mit Gehölzen bewachsen sind, grün- landgenutzte oder mit Hochstauden bewachsene Uferstreifen(abschnitte) haben in der Regel keinen wesentlichen Einfluss auf das Abflussgeschehen bei Hochwasser. Gehölzbestandene Uferstreifen wirken insbesondere dann abflusshemmend wenn sie einen wesentlichen Teil des Abflussquerschnit- tes der Aue bei Hochwasser einnehmen. Dies ist z.B. an Engstellen eines Bach- oder Flusstales der Fall oder wenn Uferstreifen quer zur Hauptfließrichtung des Hochwasserabflusses liegen (z.B. bei stark mäandrierenden Gewässern). Diese abflusshemmende Wirkung kann im Sinne des natürlichen Rückhalts erwünscht sein, da sie die Unterlieger entlastet. Sie kann aber auch unerwünscht sein, wenn der erzeugte zusätzliche Rückstau oberhalb liegende Gebäude oder hochwertige Nutzungen gefährdet. Wenn letzteres zu befürchten ist, muss die hydraulische Wirkung eines Uferstreifens von einem Fachmann abgeschätzt oder berechnet werden. Ggf. ist dann der Gehölzbewuchs aufzulichten oder es muss abschnittsweise ganz auf Ge- hölze verzichtet werden. Wenn der Bach in seiner Eigenentwicklung die Uferstreifen in Anspruch nimmt, dann verändert er sein Abflussprofil. Im Uferstreifen kann je nach Beschaffenheit mitgeführtes Schwemm- und Treibgut im Streckenverlauf durch den Bewuchs zurückgehalten werden. Das mindert die Gefahr des Zusetzens von Durchlässen und Brücken mit „Geschwemmsel“, beugt also unerwünschten Verklausungen vor. Andererseits kann bei Hochwasser durch die Gehölze auf den Uferstreifen vermehrt Totholz in das Gewässer einge- bracht werden. 16 Bayerisches Landesamt für Umwelt 2014
Gesetzliche Vorgaben
3.6 Gesamtübersicht zur Wirksamkeit von Gewässerrandstreifen, Ufer-
streifen und Entwicklungskorridoren
► Folie 15
Tab. 1: Gesamtübersicht zur Wirksamkeit
Gewässerrand- Uferstreifen Entwicklungskorridor
streifen (WHG) (incl. Uferstreifen)
Gewässerentwick- - + ++
lung/Gewässerstruktur
Lebensraum für Pflanzen und - + +
Tiere
Biotopvernetzung - ++ ++
Abstands-, Puffer-, Filterwirkung o + +
Stoff- und Energiehaushalt - ++ ++
Landschafts- und Ortsbild - + ++
Freizeit und Erholung - o +
Wasserabfluss - - -
natürlicher Rückhalt - o +
Legende: - keine wesentliche Wirkung
o mäßig positive Wirkung
+ gute Wirkung
++ sehr gute Wirkung
4 Gesetzliche Vorgaben
4.1 Wasserhaushaltsgesetz, Bayerisches Wassergesetz
► Folie 16
► Exkurs: Folien 17 und 18 (n. B.)
Zwei Rechtsvorschriften sind derzeit für Gewässerrandstreifen in Bayern einschlägig:
• § 38 Wasserhaushaltsgesetz (WHG) „Gewässerrandstreifen“
Die bundesgesetzliche Vorschrift regelt den Zweck von Gewässerrandstreifen (Absatz 1), deren
räumliche Ausdehnung (Absätze 2 und 3), sowie die in Gewässerrandstreifen geltenden Verbote
und die Befreiung (Absätze 4 und 5). In Bayern gilt lediglich Absatz 1 des § 38 WHG. Die Absätze
2 bis 5 wurden durch den Artikel 21 des Bayerischen Wassergesetzes abweichend geregelt.
• Artikel 21 Bayerisches Wassergesetz (BayWG) „Gewässerrandstreifen“
regelt anknüpfend an die Zweckbestimmung der Gewässerrandstreifen in § 38 Absatz 1 WHG die
Festlegung von Gewässerrandstreifen in Bayern. Diese sind, abweichend von der bundesrechtli-
chen Regelung, nicht pauschal für alle Gewässer festgelegt, sondern in Abhängigkeit der fachli-
chen Erforderlichkeit und nach dem Prinzip „Freiwilligkeit vor Ordnungsrecht“. Diese Erforderlich-
Bayerisches Landesamt für Umwelt 2014 17Gesetzliche Vorgaben
keit ist nicht gegeben, wenn die Fläche in eine Fördermaßnahme einbezogen ist, die auch dem
Schutz des jeweiligen Gewässers dient.
Nach § 38 Absatz 1 WHG dienen Gewässerrandstreifen der Erhaltung und Verbesserung der ökologi-
schen Funktionen oberirdischer Gewässer, der Wasserspeicherung, der Sicherung des Wasserab-
flusses sowie der Verminderung von Stoffeinträgen aus diffusen Quellen.
Wesentliche Aussagen des Art. 21 BayWG für die Umsetzung in Bayern:
• Gewässerrandstreifen sollen dort angelegt werden, wo sie im Rahmen der Gewässerunterhal-
tungspflicht nach § 39 Abs. 1 Satz 1 WHG fachlich erforderlich sind.
• Die Anlage der Gewässerrandstreifen soll zunächst auf dem Weg der Freiwilligkeit erfolgen
(nicht über gesetzlichen Zwang, sondern vorrangig über Agrarumweltmaßnahmen wie z.B.
KULAP oder freiwillige Nutzungsvereinbarungen).
• Freiwilligkeitsphase ist bis zum Ende des zweiten WRRL-Bewirtschaftungszeitraums am
22.12.2021 vorgesehen. Danach können Gewässerrandstreifen dort, wo erforderlich, auch durch
hoheitliche Maßnahmen der Kreisverwaltungsbehörden (Anordnung im Einzelfall oder Rechtsver-
ordnung) festgesetzt werden (an Gewässern dritter Ordnung im Einvernehmen mit den Trägern
der Gewässerunterhaltungslast).
Hintergründe für diesen bayerischen Weg:
• Freiwilligkeitsprinzip entspricht dem Umsetzungsprinzip der WRRL in Bayern.
• Gewässerrandstreifen sind nicht flächendeckend erforderlich.
• Die WHG-Regelung sichert lediglich den Bestand (Schutz von bestehendem Grünland, beste-
hendes Ackerland bleibt ohne Einschränkungen) und schränkt den Einsatz von Pflanzenschutz-
mitteln und Düngemitteln nicht ein.
• 5-Meter-Streifen alleine wird Problematik der diffusen Stoffeinträge nicht lösen, sondern nur in
Verbindung mit entsprechenden Maßnahmen in der Fläche
• Agrarumweltmaßnahmen, wie z.B. KULAP oder Vertragsnaturschutzmaßnahmen bieten hier die
deutlich umfangreicheren Möglichkeiten sowohl am Gewässerrand als auch in der Fläche.
Quelle: Bayerisches Staatsministerium für Umwelt und Verbraucherschutz
Zu Uferstreifen und Entwicklungskorridoren im Sinne der Arbeitshilfe enthalten weder WHG noch
BayWG Vorschriften.
4.2 Nutzungsvorgaben nach sonstigen Rechtsvorschriften
a) Naturschutzrecht
► Folien 19 und 20
Nach § 1 Abs. 3 Nr. 3 BNatSchG sind zur dauerhaften Sicherung der Leistungs- und Funktionsfähig-
keit des Naturhaushalts insbesondere Binnengewässer vor Beeinträchtigung zu bewahren und ihre
Selbstreinigungsfähigkeit zu erhalten; dies gilt insbesondere für natürliche und naturnahe Gewässer
einschließlich ihrer Ufer, Auen und sonstigen Rückhalteflächen.
18 Bayerisches Landesamt für Umwelt 2014Gesetzliche Vorgaben Gewässer und Uferstreifen sind Elemente des Biotopverbundes. §21 Abs. 5 BNatSchG gebietet, die oberirdischen Gewässer einschließlich ihrer Randstreifen, Uferzonen und Auen als Lebensstätten und Biotope für natürlich vorkommende Tier- und Pflanzenarten zu erhalten und so weiterzuentwickeln, dass sie ihre großräumige Vernetzungsfunktion auf Dauer erfüllen können. Soweit die Anlage eines Uferstreifens geeignet ist, ein Natura 2000-Gebiet erheblich zu beeinträchti- gen, bedarf es vor der Durchführung einer Überprüfung mit den für das jeweilige Gebiet festgelegten Erhaltungszielen (vgl. § 34 Abs. 1 BNatSchG). Sind erhebliche Beeinträchtigungen des Natura 2000- Gebiets in seinen für die Erhaltungsziele maßgeblichen Bestandteilen nicht auszuschließen, ist die Anlage unzulässig (§34 Abs. 2 BNatSchG). In aller Regel werden Uferstreifen den Erhaltungszielen von Natura 2000-Gebieten nicht entgegenstehen. Auch sollten artenschutzrechtliche Verbote des §44 ff. BNatSchG nur ausnahmsweise durch die Anla- ge von Uferstreifen berührt sein, weitergehende artenschutzrechtliche Untersuchungen sind nur erfor- derlich, wenn konkrete Anhaltspunkte hierfür vorliegen. Soweit für den Verursacher eines Eingriffes nach § 15 Abs. 2 BNatSchG die Verpflichtung besteht, unvermeidbare Beeinträchtigungen auszugleichen oder zu ersetzen, kommt hierfür grundsätzlich die Anlage von Uferstreifen in Betracht. Die materiellen Anforderungen an den Ausgleich oder den Ersatz (§ 15 Abs. 2 Satz 2 BNatSchG) sind zu beachten. Uferstreifen können von einem Verursacher im Hin- blick auf zu erwartende Eingriffe auch auf Vorrat angelegt werden (Ökokonto). Entsprechend § 30 Abs. 2 Nr. 1 BNatSchG sind natürliche oder naturnahe Bereiche fließender o- der stehender Binnengewässer gesetzlich geschützte Biotope. Der gesetzliche Schutz umfasst auch deren Ufer und der dazugehörigen uferbegleitenden natürlichen oder naturnahen Vegetation. Al- le Handlungen, die zu einer Zerstörung oder einer erheblichen Beeinträchtigung der Biotope führen, sind verboten. b) Pflanzenschutzrecht Pflanzenschutzrecht ist Bundesrecht. Gemäß § 12 Abs. 2 Satz 2 PflSchG dürfen Pflanzenschutzmittel nicht in oder unmittelbar an oberirdischen Gewässern angewendet werden. Konkrete Abstandsaufla- gen sind in den einzelnen Anwendungsbestimmungen der vom Bundesamt für Verbraucherschutz und Lebensmittelsicherheit zugelassenen Pflanzenschutzmittel-Präparate vorgegeben. Diese gelten deutschlandweit. Wenn für ein Mittel kein Abstand vorgegeben ist, darf dieses in Bayern bis zur Bö- schungsoberkante des Gewässers ausgebracht werden. c) Düngeverordnung ► Koreferat AELF Die Düngeverordnung (DüV) ist landwirtschaftliches Fachrecht auf Bundesebene. Sie stellt im We- sentlichen das nationale Aktionsprogramm zur Umsetzung der EU-Nitratrichtlinie dar. Die DüV regelt die gute fachliche Praxis bei der Anwendung von Düngemitteln und ist in hohem Maße relevant für den Gewässerschutz. Neben zulässigen Obergrenzen für die Wirtschaftsdünger-Ausbringung und zeitlichen Ausbringverboten gibt die DüV insbesondere auch einzuhaltende Mindestabstände zu Ober- flächengewässern vor. Abhängig von Hangneigung, Düngerart, Beschaffenheit der zu düngenden Flä- che und Ausbringtechnik sind zwischen 1 und 20 Metern Auflagen einzuhalten. Bei an Gewässern stark geneigten Ackerflächen ist eine Düngung innerhalb eines Abstand von 20 Metern nur unter Auf- lagen zulässig. Bayerisches Landesamt für Umwelt 2014 19
Planung von Uferstreifen
d) Waldgesetz für Bayern
Uferstreifen werden im Waldgesetz für Bayern (BayWaldG) nicht ausdrücklich erwähnt. Wenn Gewäs-
ser in größeren Waldbereichen liegen, handelt es sich bis zum Ufer um Wald im Sinne des Gesetzes.
Bei gehölzbestockten Uferstreifen (z. B. „Galeriewäldern“) kommt es dagegen im Einzelfall auf die Be-
schaffenheit und Ausdehnung an, ob sie Wald im Sinne des Waldgesetzes (Art. 2 BayWaldG) darstel-
len. In diesem Falle sind alle Vorgaben dieses Gesetzes zu beachten (u. a. zu Waldfunktionen,
Walderhaltung und -bewirtschaftung, Aufforstung, Rodung, etc.).
5 Planung von Uferstreifen
Normalerweise ist die Planung von Uferstreifen keine eigenständige Planung, sondern Bestandteil von
Gewässerentwicklungskonzepten (GEK) in denen die komplexen Zusammenhänge systematisch ab-
gearbeitet werden. Das Vorgehen, die Bearbeitungsschritte und die Beteiligung im Rahmen der fachli-
chen Abstimmung sind im LfU Merkblatt Nr. 5.1/3 Gewässerentwicklungskonzepte [2] geregelt. Für
Gewässer dritter Ordnung werden Gewässerentwicklungskonzepte i.d.R. gemeindeweise aufgestellt.
Aussagen zu Lage, Ausdehnung und ggf. Beschaffenheit von notwendigen Uferstreifen finden sich in
den Maßnahmenhinweisen und Angaben zum Flächenbedarf; sie sind meist auch im Plan verortet. Da
GEK mittel- bis langfristige Planungen sind, kann es notwendig werden, für die Umsetzung Priorisie-
rungen vorzunehmen und überschaubare Umsetzungsphasen zu bestimmen, die nach und nach ab-
gearbeitet werden.
Ein Hilfsmittel hierzu können die Umsetzungskonzepte (UK) Hydromorphologie der Wasserrahmen-
richtlinie sein, in denen ggf. räumlich und zeitlich bereits stärker konkretisierte Hinweise zu Uferstrei-
fen zu finden sind.
Für den Fall, dass keines der vorgenannten Planungsinstrumente vorliegt oder in absehbarer Zeit er-
stellt werden kann, finden sich im Anhang 2 Hinweise, wie man notfalls Uferstreifen für die Gewässer
dritter Ordnung im Gemeindegebiet in vereinfachter Form planen kann.
6 Flächensicherung und Nutzungsregelungen
► Folien 21 bis 23
Es gibt in der Praxis verschiedene Möglichkeiten für die Kommunen, an Flächen für Uferstreifen an
ihren Gewässern zu kommen.
Flächensicherung (in zu prüfender Reihenfolge geordnet)
• Erfassung der bereits vorhandenen, an Gewässer angrenzenden, kommunalen Grundstücke und
Festlegung der Funktion als Uferstreifen
• Flächentausch ohne Beteiligung der Verwaltung für Ländliche Entwicklung
• Grunderwerb über Notar
• Grunderwerb im Rahmen des gemeindlichen Vorkaufsrechts nach §24 BauGB
• Grunderwerb im Rahmen des Vorkaufsrechtes nach Art. 39 BayNatschG
• Flächentausch oder Erwerb mit Hilfe der Ämter für Ländliche Entwicklung im Rahmen
► Koreferat AELF
o eines allgemeinen Flurbereinigungs- bzw. Dorferneuerungsverfahrens
20 Bayerisches Landesamt für Umwelt 2014Flächensicherung und Nutzungsregelungen
o einer Unternehmensflurbereinigung
o eines vereinfachten Flurbereinigungsverfahrens
o eines beschleunigten Zusammenlegungsverfahrens
o eines freiwilligen Landtausches
Mit diesen Maßnahmen erreicht die Gemeinde die volle Verfügbarkeit über die Flächen und kann so-
mit alle Funktionen des Uferstreifens einschließlich der Eigenentwicklung des Gewässers wirksam
werden lassen. Die entsprechenden Finanzierungsmöglichkeiten sind Anhang 1 beschrieben.
► Koreferate zu den Fördermöglichkeiten
Alternativ zur Förderung kann der Uferstreifen aber auch als Kompensationsmaßnahme (früher „Aus-
gleich und Ersatz“) dienen bzw. in das Ökokonto eingebucht werden. Jeder nicht vermeidbare Eingriff,
wie er durch die Ausweisung von Baugebieten im Rahmen der Bauleitplanung, durch den Straßen-
oder Leitungsbau oder durch viele sonstige Vorhaben entsteht, macht nach §§ 13 Satz 2, 15 Abs. 2
(BNatSchG) einen Ausgleich (bzw. Ersatz) erforderlich. Dementsprechend müssen die Gemeinden
auf anderen Flächen landschaftspflegerische und der Natur dienliche Maßnahmen durchführen, um
die ökologische Qualität dieser Flächen deutlich zu steigern.
Der Vorteil des Ökokontos liegt dabei klar auf der Hand: Durch die vorzeitige Sicherung von Flächen
und Maßnahmen wird eine flexible und effiziente Eingriffsplanung ermöglicht, die den Vorhabens- und
Planungsträgern die Anwendung der Eingriffsregelung erleichtern kann. Frühzeitig im Rahmen eines
großräumigen Konzepts geplante und durchgeführte Ausgleichsmaßnahmen können deren Wirksam-
keit erhöhen und generell dazu beitragen, die Leistungsfähigkeit des Naturhaushaltes trotz der Eingrif-
fe zu erhalten. Die Gemeinde muss nicht mehr gleichzeitig mit dem jeweiligen Vorhaben für entspre-
chende Ausgleich- oder Ersatzmaßnahmen Sorge tragen, sondern kann den aktuellen Bedarf aus ih-
rem Ökokonto "abbuchen". Mit Fördermitteln erworbene Flächen bzw. umgesetzte Maßnahmen kön-
nen nicht in ein Ökokonto eingebracht werden.
► Koreferat UNB
Sofern die angeführten Möglichkeiten der Flächensicherung nicht umsetzbar sind, kann mit Hilfe von
Nutzungsregelungen Einfluss auf den Uferstreifen genommen werden. Dabei bleiben die Eigentums-
rechte unverändert. Allerdings wird in der Regel hierbei die Möglichkeit zur Eigenentwicklung des Ge-
wässers ausgeschlossen.
Nutzungsregelungen
• Abschluss langfristiger Nutzungs- oder Pachtverträge
• Maßnahmen des Vertragsnaturschutzprogrammes (VNP)
• Maßnahmen des Kulturlandschaftsprogrammes (KULAP) ► Koreferat AELF
• Grunddienstbarkeit
In der nachstehenden Bewertungsmatrix werden die Vor- und Nachteile der verschiedenen Möglich-
keiten zur Flächensicherung und der Nutzungsregelungen aufgezeigt.
Bayerisches Landesamt für Umwelt 2014 21Praxisbeispiele
Tab. 2: Bewertungsmatrix
Positiv Negativ
Erfassung vorh. keine Kosten, ggf. Aufwand für Verwaltung
Grundstücke Übersicht über eigene Grundstücke
(Erfassung „vergessener“ Grundstücke,
die bereits am Ufer liegen)
Flächentausch kein zusätzlicher Flächenerwerb, ggf. aufwändige Suche nach Tausch-
ungünstige Grundstücke können gegen partner
bessere eingetauscht werden
Grunderwerb Grunderwerb wird rasch vollzogen ggf. aufwändige Suche nach Verkäufer;
eingeschränkte Förderung
Grunderwerb/ ALE bringt Teilnehmer zusammen, umfassende Verfahren benötigen Zeit
Flächentausch koordiniert unterschiedliche Interessen
mit ALE
Nutzungs- Kostenersparnis: kein Flächenerwerb keine eigendynamische Gewässerent-
/Pachtverträge wicklung möglich,
begrenzter Zeithorizont
VNP/KULAP Kostenersparnis: kein Flächenerwerb keine eigendynamische Gewässerent-
wicklung möglich,
begrenzter Zeithorizont
Grunddienstbar- Kostenersparnis, hoher Aufwand (Notar),
keit Rechtssicherheit (Grundbucheintrag), Laufende oder einmalige Entschädi-
dauerhafte Sicherung der Nutzung gung erforderlich
möglich
Im Anhang 5 ist in einem Entscheidungsbaum dargestellt, in welcher Reihenfolge die Instrumente der
Flächensicherung und der Nutzungsregelungen angegangen werden sollten. Die aufgezeigten Ar-
beitsschritte sind regelmäßig für alle geplanten Uferstreifenabschnitte zu prüfen.
7 Praxisbeispiele
► Folien Anhang
Die im Anhang 3 und im Anhang des PowerPoint Vortrags aufgeführten neun Praxisbeispiele zeigen
bereits über diese Wege realisierte Vorhaben. Die Bearbeiter der Beispiele stammen aus den Was-
serwirtschaftsämtern, Landschaftspflegeverbänden oder sonstigen aktiven Gruppen.
Der Schwerpunkt liegt bei den kleinen Gewässern und den Wegen, wie im konkreten Fall die Ufer-
streifen erworben oder gesichert werden konnten. Für jedes präsentierte Fallbeispiel gibt es eine aus-
führlichere Detailbeschreibung. Für weitere Fragen stehen die jeweils im Beispiel genannten An-
sprechpartner zur Verfügung.
22 Bayerisches Landesamt für Umwelt 2014Praxishinweise zum Umgang mit Uferstreifen 8 Praxishinweise zum Umgang mit Uferstreifen Die konkrete Umsetzung kann erleichtert oder beschleunigt werden, wenn zum Beispiel Uferstreifen oder Entwicklungskorridore mit wasserwirtschaftlichen oder naturschutzfachlichen Programmen ge- sondert gefordert werden. Dies ist vor allem gegeben bei • der EG-Wasserrahmenrichtlinie (WRRL) • der FFH- und VS-Richtlinie (Natura 2000) • dem Biotopschutz und dem Biotopverbundkonzept BayernNetzNatur. Details sind im Anhang 4 zusammengestellt. 8.1 Planungen ► Folie 24 Für die naturnahe Gewässerunterhaltung mit der Errichtung von Uferstreifen oder Entwicklungskorri- doren ist die Aufstellung eines Gewässerentwicklungskonzeptes eine wichtige Grundlage und wird den Gemeinden empfohlen, soweit sie noch nicht erstellt wurden. Kommunale oder gemeindeübergreifende Umsetzungskonzepte (UK) verorten die Maßnahmenpro- gramme der WRRL für die Hydromorphologie auf der Grundlage des GEK, vgl. GN-Arbeitshilfe Jah- resthema 2011. Die Aufstellung wird empfohlen und gefördert. Gewässer, die bereits die Ziele der Wasserrahmenrichtlinie erreicht haben, oder unterhalb des WRRL-Gewässernetzes (Einzugsgebiete < 10 km2) liegen, werden darin nicht behandelt. Weitere Infos zu UK: Beispiel für ein Umsetzungskonzept. Für die Verschneidung gemeindlicher Planungen mit dem Naturschutzprogramm Natura 2000 emp- fiehlt es sich für die Gemeinden, den jeweiligen Managementplan einzusehen. Betroffene Gemeinden sind bereits in der Erstellungsphase informiert und beteiligt („runde Tische“). 8.2 Interessensabwägung bei Nutzungskonflikten Bei der Einrichtung von Uferstreifen können z. B. aufgrund naturschutzrechtlicher Vorschriften oder auch durch gebietsbezogene Restriktionen konkurrierende Interessen oder andere Probleme auftre- ten. Viele dieser potentiellen Konflikte können durch räumliche Entzerrung (Zonierungskonzepte) bereits in der Planung, im Rahmen der Abwägung oder im Interessensausgleich entschärft oder gelöst werden. Sie müssen jeweils im konkreten Fall behandelt werden. Beispiele für Problemfelder: Wiederherstellung eines Gewässers: ► Folie 25 Hat ein Gewässer durch natürliche Ereignisse sein bisheriges Bett verlassen, so sind die davon Be- troffenen insgesamt oder einzeln berechtigt, den früheren Zustand auf ihre Kosten wieder herzustellen (Art.10 Abs.1 BayWG). In diesem Fall kann es aber auch sinnvoll sein, wenn die Gemeinde auf die betroffenen Anlieger zugeht und in Verhandlungen eintritt, um diese Flächen für die Uferentwicklung zu sichern. Denn der Bach hat bei dem zurückliegenden natürlichen Ereignis (z.B. kleineres Hoch- wasser) die Gelegenheit zur Eigenentwicklung genutzt und sein Bett verlagert. Bevor Anlieger und Be- Bayerisches Landesamt für Umwelt 2014 23
Sie können auch lesen