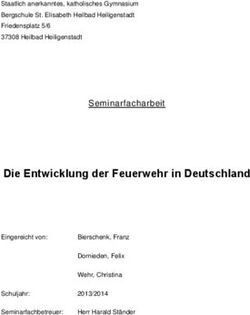Analyse und Produktion von Erkl arvideos im Chemieunterricht - Ein Unterrichtsvorhaben in einer neunten Klasse des Gymnasiums - Bildungslotse
←
→
Transkription von Seiteninhalten
Wenn Ihr Browser die Seite nicht korrekt rendert, bitte, lesen Sie den Inhalt der Seite unten
Analyse und Produktion von Erklärvideos im Chemieunterricht — Ein
Unterrichtsvorhaben in einer neunten Klasse des Gymnasiums
Schriftliche Arbeit nach § 9 der APVO-Lehr (2017)
Dr. Anne-Christin Kreutzmann, StRef’
Studienseminar Stade für das Lehramt an Gymnasien,
Vincent-Lübeck-Gymnasium Stade
Bremen, 11. Januar 2019Inhaltsverzeichnis
A. Grundlegung und Planung 1
A.1. Einleitung . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1
A.2. Grundlegung des Unterrichtsvorhabens . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1
A.2.1. Methodische Themendarstellung: Kompetenzförderung mit Erklärvideos . . . . . . . . 1
A.2.2. Fachliche Themendarstellung: Ordnung der Elemente in Elementfamilien . . . . . . . 2
A.2.3. Leitende Fragestellungen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3
A.3. Planung des Unterrichtsvorhabens . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4
A.3.1. Voraussetzungen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4
A.3.2. Formulierung und Begründung des kompetenzorientieren Unterrichtsziels . . . . . . . 5
A.3.3. Didaktische Erläuterungen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6
A.3.4. Methodische Erläuterungen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8
B. Auswertung 11
B.1. Systematische Auswertung . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11
B.1.1. Erreichen des kompetenzorientierten Unterrichtsziels . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11
B.1.2. Motivation zur Beschäftigung mit dem fachlichen Thema durch Erklärvideos . . . . . . 12
B.1.3. Festigung und Vertiefung fachlicher Inhalte . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13
B.1.4. Stärkung der Medienkompetenz . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15
B.2. Schlussfolgerungen und Optimierungsmöglichkeiten . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17
Literaturverzeichnis 18
Anhang 19
Anhang 1: Tabellarische Übersicht über die Einbettung des Unterrichtsvorhabens . . . . . . . . . . 20
Anhang 2: Elternbrief . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22
Anhang 3: Unterrichtsmaterialien und geplante Tafelbilder . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23
Anhang 4: Beurteilungskriterien der SuS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29
Anhang 5: Handouts der SuS zu technischen und methodischen Aspekten . . . . . . . . . . . . . 31
Anhang 6: Sprechtexte und Storyboards der SuS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 36
Anhang 7: Evaluationsbögen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 49
Anhang 8: Verlaufsplan zur Videopräsentation und -evaluation . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 55
Anhang 9: Schülerfragebögen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 57
Anhang 10: Exposé . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 73
Anhang 11: Digitale Medien . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 74
Versicherung der selbständigen Erarbeitung 75Abkürzungsverzeichnis AFB Anforderungsbereich BK Basiskonzept BW Bewertung DS Didaktischer Schritt EG Erkenntnisgewinnung FW Fachwissen GA Gruppenarbeit KC Kerncurriculum KK Kommunikation KOUZ Kompetenzorientiertes Unterrichtsziel LH Lernhilfe LK Lehrkraft LM Lernmaterial LS Lernschwierigkeit luM lernunterstützendes Material PSE Periodensystem der Elemente SuS Schülerinnen und Schüler UV Unterrichtsvorhaben UG Unterrichtsgespräch
A. Grundlegung und Planung
A.1. Einleitung
Ich schau einfach mal bei YouTube nach, wie das geht.
Diesen Ansatz verfolgen Jugendliche bei Themen, die so verschieden sind wie Computerspiele, Schminken
5 und das Nachbereiten von Unterrichtsinhalten (Kalt, 2017). Vier von zehn Schülerinnen und Schüler (SuS)
im Alter von 14 bis 19 Jahren nutzten bereits im Jahr 2014 Erklärvideos zu unterschiedlichen Themen
in ihrer Freizeit (BITKOM e.V., 2015, S. 56). Die große Beliebtheit dieser Videos mag zum einen in der
niedrigen Zugangsschwelle begründet sein, die mit der audiovisuellen Darstellungsform im Allgemeinen
und dem Format des Erklärvideos im Besonderen verknüpft ist. Gute Erklärvideos stellen auch komplizierte
10 Sachverhalte fokussiert und verständlich in einer Zeitspanne von wenigen Minuten dar. Für den Nutzer
bedeutet dies einen geringen Aufwand um eine Frage beantwortet zu bekommen oder eine Übersicht über
ein Thema zu erhalten. Zum anderen sind Erklärvideos mittlerweile in großer Anzahl über mobil nutzba-
re Internetportale wie YouTube leicht und nahezu ständig verfügbar. Daher kann ein Nutzer im Regelfall
davon ausgehen, nach dem on demand-Prinzip für eine aktuelle Problemstellung ein thematisch passen-
15 des Erklärvideo mit geeignetem Niveau und Stil zu finden. Die eigenständige Nutzung von Erklärvideos
bietet darüber hinaus Chancen für langsame Lerner, da diese ein Video an schwierigen Stellen stoppen
und erneut abspielen können, ohne sich die Blöße des wiederholten Nachfragens zu geben. Abhängig
vom Internetportal werden Erklärvideos mit oder, wie bei YouTube, ohne redaktionelle Qualitätsprüfung
veröffentlicht. Entsprechend groß ist das Spektrum der Beiträge mit Bezug auf ihre inhaltlich-fachliche Rich-
20 tigkeit, die didaktische und methodische Aufbereitung, die technische Umsetzung sowie die Offenlegung
der Intentionen des Produzenten.
Im schulischen Kontext ergeben sich aus der Alltagspräsenz von Online-Erklärvideos gleichermaßen
Möglichkeiten wie Anforderungen. Erklärvideos stellen ein Medium dar, mit dem die SuS vertraut sind
und das sie gerne im Unterricht nutzen würden (BITKOM e.V., 2015, S. 45). Über 70% der befragten SuS
25 gaben an, dass digitale Medien zu einem bessern Verständnis der Unterrichtsinhalte beitragen und 45% wa-
ren der Meinung, dass sie mit digitalen Medien schneller lernen (ebd., S. 34). Damit übereinstimmend zeigen
Beispiele, dass die Verschränkung eines fachlichen Themas mit der Methode des Erklärvideos die Motiva-
tion der SuS zur inhaltlichen Auseinandersetzung mit dem Unterrichtsinhalt steigern kann (Sprung, 2017).
Wie bei vielen Internet-Formaten ergibt sich durch das große Qualitätsspektrum von Online-Erklärvideos für
30 die SuS aber auch die besondere Notwendigkeit einer reflektierten Auseinandersetzung mit dem Inhalt im
Sinn der Medienkompetenz. Die Stärkung dieser Kompetenz ist eine wichtige Anforderung und gehört zum
Bildungsauftrag der Schulen (Niedersächsische Staatskanzlei, 2016). Im Rahmen der vorliegenden Arbeit
soll daher eine Unterrichtseinheit für die 9. Jahrgangsstufe des Gymnasiums entwickelt werden, in welcher
die Ordnung chemischer Elemente in Elementfamilien als fachlich-inhaltliches Thema mit der Methode des
35 Erklärvideos verknüpft wird. Dabei soll untersucht werden, inwieweit die gewählte Form der Verknüpfung
geeignet ist sowohl die Fach- als auch die Medienkompetenz bei Jugendlichen dieser Altersstufe zu fördern.
A.2. Grundlegung des Unterrichtsvorhabens
A.2.1. Methodische Themendarstellung: Kompetenzförderung mit Erklärvideos
Erklärvideos können im Unterricht sowohl auf der passiven Ebene (rezepziv-analysierend) als auch auf der
40 aktiven Ebene (produzierend) von den SuS verwendet werden. Diese Ebenen fördern unterschiedliche und
zum Teil aufeinander aufbauende Kompetenzen (Hofer und Swan, 2005; Planer, 2014; Schlegel, 2016).
Bei der passiven, rezeptiv-analysierenden Verwendung von Erklärvideos kann neben der FachkompetenzErklärvideos im Chemieunterricht 2
(die SuS befassen sich mit dem präsentierten fachlichen Inhalt) die Medienkompetenz in den Bereichen
Medien beurteilen lernen und Medien auswählen lernen (Doelker, 2005, S. 225–237) gefördert werden.
Das heißt, die SuS analysieren die inhaltliche, didaktische, gestalterische und technische und Umsetzung
in einem Beitrag sowie die Intentionen des Produzenten. Dadurch sind die SuS in der Lage, die Qualität und
5 Eignung eines Beitrags für sich zu bewerten und aus dem breiten Angebot bewusst Beiträge auszuwählen.
Der aktive, produzierende Umgang mit Erklärvideos stellt, ähnlich wie die Erstellung von Infokarten,
Lernplakaten und Referaten, eine Methode zum Wissen sammeln, systematisieren, dokumentieren und
präsentieren dar. Entsprechend ähneln Erklärvideos diesen Methoden bezüglich ihres Einsatzes im Un-
terricht und der Kompetenzen, die sie stärken. Alle sind grundsätzlich schülerzentriert und -gesteuert, da
10 sie auf der Realisierung individueller Produkte beruhen. Dabei kann das Format des Erklärvideos durch
die große Auswahl an Gestaltungselementen und -dimensionen die Kreativität der SuS in besonderem
Maße ansprechen. Diese Freiheitsgrade sollten von SuS der 9. Jahrgangsstufe bereits bewusst genutzt
werden können. Durch die hohe Alltagspräsenz von Erkärvideos ist es darüber hinaus wahrscheinlich,
dass die SuS einen stärkeren affektiven Bezug zu dieser Darstellungsform haben und die Erstellung eines
15 Erklärvideos motivierender wirkt als die anderer Produkte. Als Methode zum Wissen sammeln, aufbereiten
und präsentieren, erfordert die Produktion eines Erklärvideos eine intensive und vertiefende Auseinander-
setzung mit dem fachlichen Inhalt und fördert so die Fachkompetenz in besonderem Maße. Die SuS müssen
den Inhalt so weit verstanden haben, dass sie Kernaussagen herausarbeiten können sowie inhaltlich und
didaktisch sinnvolle Reduktionen und Strukturierungen vornehmen können. Aufgrund der vergleichsweise
20 hohen Komplexität der Erstellung eines Erklärvideos empfiehlt es sich die Produktion in Gruppenarbeit
durchzuführen. Die SuS können die unterschiedlichen Aufgaben innerhalb der Gruppe nach individuellen
Interessen und Fähigkeiten verteilen, sodass kooperatives Lernen und Sozialkompetenz gefördert werden.
Weiterhin kann durch die Produktion von Erklärvideos die Medienkompetenz der SuS in den Bereichen
Medien herstellen lernen und Medien einsetzen lernen (Doelker, 2005, S. 225–237) gefördert werden. Das
25 heißt, die SuS wenden inhaltliche, didaktische, gestalterische und technische Kriterien und Fähigkeiten an,
um sich im Format des Erklärvideos auszudrücken und ihr Wissen mit anderen zu teilen. Dadurch kann die
im Kerncurriculum (KC) für die Klassenstufen 9/10 geforderte Kommunikationskompetenz in besonderem
Maße gestärkt werden, da die SuS ihre Arbeit als Team planen, strukturieren und präsentieren, Daten re-
cherchieren sowie fachlich korrekt und aufeinander aufbauend argumentieren müssen (Niedersächsisches
30 Kultusministerium, 2015, S. 56).
A.2.2. Fachliche Themendarstellung: Ordnung der Elemente in Elementfamilien
Die Tatsache, dass sich chemische Elemente in unterschiedlichen Dimensionen ordnen lassen, ist eine wich-
tige Grundlage der Chemie, die verschiedene Basiskonzepte (BK) berührt. Die heute allgemein verwendete
Ordnung ist im Periodensystem der Elemente (PSE) dargelegt, dem der Atomhüllenbau zugrunde liegt. Da
35 dieser für Eigenschaften und Reaktionsverhalten der Elemente entscheidend ist (BK Struktur-Eigenschaft
und BK chemische Reaktion), reflektiert das PSE auch Gruppierungen, die allein aus Beobachtungen der
elementaren Stoffe erschlossen werden können (BK Stoff-Teilchen). Bei der historischen Entwicklung des
PSE im 19. Jahrhundert (u.a. Döbereiner, 1829; Newlands, 1866; Mendelejeff, 1869; Meyer, 1870) spielte
die Gruppierung von Elementen in Elementfamilien aufgrund gemeinsamer Eigenschaften und Reaktionen
40 sogar eine zentrale Rolle, da die Existenz der Atomhülle (Rutherford, 1911) zu diesem Zeitpunkt noch
nicht bekannt war. In diesem Unterrichtsvorhaben (UV) sollen die Elementfamilien der Alkalimetalle, Erd-
alkalimetalle, Halogene und Edelgase behandelt werden (Tabelle A.1). Während die ersten drei dieser
Elementfamilien schon früh – wenn auch unvollständig – beschrieben wurden (Döbereiner, 1829), wurden
die Edelgase aufgrund ihrer Reaktionsträgheit erst Ende des 19. Jahrhunderts entdeckt (Ramsay, 1904).Erklärvideos im Chemieunterricht 3
Tabelle A.1.: Kernaspekte der behandelten Elementfamilien. Viele der genannten Eigenschaften verändern sich innerhalb einer
Elementfamilie graduell mit der Atommasse.
Elementfamilie Kernaspekte
Alkalimetalle metallischer Glanz, gute Verformbarkeit, niedrige Schmelztemperaturen, geringe
Dichte, elektrische Leitfähigkeit, extreme Luftempfindlichkeit (Reaktion mit Luftsau-
erstoff als Korrosion oder durch Entzündung), heftige Reaktion mit Wasser (Bildung
von basischem Alkalimetallhydroxid und Wasserstoff), natürliches Vorkommen in
Verbindungen (Salze)
Erdalkalimetalle metallischer Glanz, höhere Härte als Alkalimetalle, geringe Dichte, gute elektrische
Leitfähigkeit, z.T. starke Luftempfindlichkeit (Reaktion mit Luftsauerstoff als Korrosi-
on oder Entzündung), Reaktion mit Wasser (Bildung von basischem Erdlkalimetall-
hydroxid und Wasserstoff), natürliches Vorkommen in Verbindungen (Salze)
Halogene zweiatomige Moleküle, farbig und riechend, starke Reaktivität (gesund-
heitsschädlich oder giftig, Verwendung als Desinfektionsmittel), Bildung von
Salzen bei Reaktion mit Metallen, Bildung von Halogenwasserstoffen bei Reaktion
mit Wasserstoff, natürliches Vorkommen in Verbindungen (hauptsächlich Salze)
Edelgase einatomige Gase, sehr reaktionsträge (Verwendung als Schutzgase), farb- und ge-
ruchlos, charakteristische Farben in Gasentladungslampen, in geringem Anteil in
der Luft enthalten
A.2.3. Leitende Fragestellungen
Das im Rahmen dieser Arbeit entwickelte UV verknüpft das inhaltliche Thema der Ordnung von chemi-
schen Elementen in Elementfamilien auf methodischer Ebene mit der passiven und aktiven Nutzung von
Erklärvideos. Aus den oben dargelegten Aspekten zum Einsatz von Erklärvideos im Unterricht ergeben
5 sich drei Leitfragen, auf die hin das durchgeführte UV analysiert werden soll:
In welchem Maße motiviert die Verwendung von Erklärvideos die SuS sich lernwirksam mit dem
fachlichen Thema zu befassen?
Inwieweit kann die Produktion von Erklärvideos dazu beitragen das Verständnis der SuS von der
Ordnung der chemischen Elemente in Elementfamilien zu festigen und zu vertiefen?
10 In welchem Maße kann durch die Verwendung von Erklärvideos im Unterricht die Medienkompetenz
der SuS in den Bereichen Medien beurteilen und auswählen lernen sowie Medien herstellen lernen
gestärkt werden?
Diese Leitfragen sollen auf Grundlage der Auswertung von Schülerfragebögen, Beobachtungen der Lehr-
kraft im Unterricht und der Analyse der produzierten Videos differenziert beantwortet werden. Mit Hilfe der
15 Schülerfragebögen (Anhang 9, S. 57), die zu Beginn und am Ende des UV eingesetzt werden, soll die
subjektive Wahrnehmung der SuS in den Bereichen Motivation, Fach- und Medienkompetenz dokumentiert
werden. Durch Beobachtungen der Lehrkraft zur Beteiligung und Leistung der SuS in den verschiedenen
Phasen des UV sowie durch die Analyse von Inhalt und Gestaltung der produzierten Videos (Anhang 7,
S. 49) lassen sich von der Selbsteinschätzung der SuS unabhängige Aussagen zu Motivation, lernwirksamer
20 Auseinandersetzung mit dem Unterrichtsinhalt und Stärkung der Medienkompetenz treffen.Erklärvideos im Chemieunterricht 4
A.3. Planung des Unterrichtsvorhabens
A.3.1. Voraussetzungen
Lerngruppe
Die Klasse 9K1 besteht aus 17 Schülerinnen und 5 Schülern und wird von mir seit Beginn des Schuljahres
5 eigenverantwortlich mit je zwei Wochenstunden in Chemie und Biologie unterrichtet. Die Lernatmosphäre
unter den SuS sowie zwischen SuS und Lehrkraft ist gut, die ungleichmäßige Geschlechterverteilung wirkt
sich aber zum Teil negativ auf die Dynamik in der Klasse aus. Aufgrund der begrenzten Interaktion zwischen
den Geschlechtern haben die wenigen, insgesamt eher leistungsschwächeren männlichen Schüler kaum
unterstützenden und anspornenden Austausch mit leistungsstärkeren SuS. Die SuS sind lernwillig und
10 folgen dem Unterricht zum größten Teil aufmerksam, wobei aber vier der Schüler häufiger abgelenkt sind.
Das Leistungsniveau in der Klasse ist durchschnittlich heterogen. Eine türkischstämmige Schülerin ist
im Laufe des Halbjahres neu in die Klasse gekommen. Sie hat noch deutliche Schwierigkeiten mit der
deutschen Sprache (DaZ-Niveau A2), zeigt sich aber überaus engagiert bei der Vor- und Nachbereitung des
Unterrichts und sucht oft nach dem Unterricht noch das direkte Gespräch mit der Lehrkraft. Sie begreift viele
15 Konzepte grundsätzlich, versteht aber häufig Fragen und Arbeitsaufträge im Unterricht nicht hinreichend
und beteiligt sich mündlich nicht am Unterricht. Leider zieht sie sich auch häufig aus dem Klassenverband
zurück und interagiert in Gruppenarbeitsphasen auch nach Aufforderung kaum mit anderen SuS.
Einbettung des Unterrichtsvorhabens in den Unterrichtszusammenhang unter Berücksichtigung
der vorrangig geförderten Kompetenzen
20 Das hier beschriebene UV gliedert sich in mehrere Abschnitte, die in unterschiedliche Unterrichtseinheiten
des Halbjahres eingebettet sind (tabellarische Übersicht in Anhang 1, S. 21). Zu Beginn des Halbjahres
setzen sich die SuS im Rahmen der Unterrichtseinheit Quantitative Betrachtungen rezeptiv-analysierend
mit Erklärvideos auseinander. Dabei werden im Rahmen einer Konsolidierung zu den Größen Stoffmen-
ge und molare Masse Erklärvideos aus dem Internet gezeigt und von den SuS analysiert (Didaktischer
25 Schritt (DS) 1). Neben der Konsolidierung des fachlichen Inhalts (Kompetenzberech Fachwissen) wird hier-
bei durch die Zusammenstellung von Bewertungskriterien für Erklärvideos insbesondere die Medienkom-
petenz in den Bereichen Medien beurteilen lernen und Medien auswählen lernen gestärkt. Im Anschluss
an die Unterrichtseinheit Quantitative Betrachtungen erhalten die SuS den Zeitplan für die Produktions-
phase des UV und den Arbeitsauftrag Handouts zu methodischen, technischen und rechtlichen Aspekten
30 der Produktion von Erklärvideos zu erstellen (DS 2). Hierbei wird insbesondere die Medienkompetenz in
dem Bereich Medien herstellen lernen gefördert. Die Produktion der Erklärvideos ist thematisch in die
nachfolgende Unterrichtseinheit Elemente lassen sich ordnen eingebettet. Nachdem der Unterricht zu den
Themen der Erklärvideos durchgeführt und die Klassenarbeit geschrieben worden ist, stellen die SuS auf
Grundlage des Unterrichts sowie eigener Recherchen die inhaltlichen Kernaussagen ihres Erklärvideos zu-
35 sammen (Kompetenzbereich Fachwissen; DS 3) und erstellen unter Zuhilfenahme der zuvor angefertigten
Handouts ein detailliertes Konzept für ihr Video (Medienkompetenz im Bereich Medien herstellen lernen;
DS 4). Im Gegensatz zu der im angelsächsischen Raum verbreiteten Methode des flipped classroom
(Sprung, 2017) erarbeiten die SuS bei diesem UV keine vollständig neuen fachlichen Inhalte. Vielmehr
soll die Videoproduktion hier dazu dienen, im Unterricht behandelte Themen zu festigen und zu vertie-
40 fen. Diese Schwerpunktsetzung erscheint notwendig, da die wenigsten SuS Erfahrung mit der Erstellung
von Erklärvideos haben werden. Die Kombination einer unbekannten Methode mit einem neuen inhaltli-
chen Thema würde mit großer Wahrscheinlichkeit dazu führen, dass der zeitliche Aufwand für die SuS
den akzeptablen Rahmen weit übersteigt. Vertiefende Inhalte sollen in Übereinstimmung mit dem KC für
die Klassenstufen 9/10 (Niedersächsisches Kultusministerium, 2015, S. 56) von den SuS allerdings selbstErklärvideos im Chemieunterricht 5
recherchiert werden. Im Anschluss an die Produktion (Kompetenzorientiertes Unterrichtsziel (KOUZ))
werden die Videos präsentiert (Kompetenzbereich Fachwissen) und von den SuS kritisch auf Basis der
eingangs zusammengestellten Bewertungskriterien reflektiert (Medienkompetenz in den Bereichen Medien
beurteilen lernen und Medien herstellen lernen).
5 Die Fachgruppe Chemie des Vincent-Lübeck-Gymnasiums hat im schuleigenen Curriculum festgelegt, dass
im epochalen Unterricht der 9. Jahrgangsstufe die Ordnung in Elementfamilien nur auf phänomenologischer
Ebene erarbeitet wird; der Atombau als Basis von Eigenschaften und Reaktionsverhalten der Elemen-
te wird erst in der 10. Jahrgangsstufe thematisiert (Vincent-Lübeck-Gymnasium, 2016b; Vincent-Lübeck-
Gymnasium, 2016a). Die im Rahmen des hier dargelegten UV produzierten Erklärvideos bieten den SuS
10 somit eine gute Möglichkeit in der 10. Klasse den dann ein halbes Jahr zurückliegenden Unterrichtsinhlat
effizient zu wiederholen und im Folgeunterricht daran anzuknüpfen.
Relevante abrufbare Lernvoraussetzungen
Hier werden fachlich-inhaltliche Lernvoraussetzungen aus dem KC Chemie (Niedersächsisches Kultusmi-
nisterium, 2015) aufgeführt. Es wird nicht angenommen, dass relevante methodische Lernvoraussetzungen
15 zur Produktion von Erklärvideos abrufbar vorhanden sind.
Inhaltliche Kompetenzen zu Beginn des Halbjahres: Die SuS unterscheiden zwischen Elementen und Ver-
bindungen sowie Metallen und Nichtmetallen (ebd., S. 53). Sie beschreiben Stoffe anhand ihrer Dichte,
Schmelz- und Siedetemperatur sowie anderer typischer Eigenschaften (ebd., S. 51, 53). Sie führen die
Eigenschaften eines Stoffes auf den Aufbau aus spezifischen Teilchen zurück und unterscheiden zwischen
20 Stoff- und Teilchenebene (ebd., S. 52). Sie beschreiben chemische Reaktionen auf Stoffebene als Bildung
neuer Stoffe aus Ausgangsstoffen und deuten sie auf Teilchenebene als Bildung neuer Teilchenverbände
unter der Erhaltung der Atom der Ausgangsstoffe (ebd., S. 59). Die SuS stellen Reaktionsgleichungen in
chemischer Symbolsprache und unter Beachtung der Atomzahlen auf (ebd., S. 60).
Zusätzliche inhaltliche Kompetenzen ab DS 3: Die SuS ordnen Elemente bestimmten Elementfamilien zu.
25 Sie vergleichen Alkalimetalle, Erdalkalimetalle, Halogene und Edelgase innerhalb einer Elementfamilie in
ausgewählten Kategorien (siehe Tabelle A.1) und stellen Gemeinsamkeiten und Unterschiede fest (Nie-
dersächsisches Kultusministerium, 2015, S. 56). Sie führen die Ergebnisse von Nachweisreaktionen auf
das Vorhandensein bestimmter Teilchen zurück (ebd., S. 57).
Prozessbezogene Kompetenzen: Die SuS beschreiben, veranschaulichen und erklären chemische Sach-
30 verhalte im BK Stoff-Teilchen fachsprachlich richtig und unter Verwendung des Dalton’schen Atommodells
(ebd., S. 54). Sie planen einfache Experimente selbständig, führen sie unter Beachtung von Sicherheits-
aspekten durch und protokollieren sie (ebd., S. 54). Sie recherchieren Daten zur Atommasse und nutzen
Tabellen zur Recherche verschiedener Schmelz- und Siedetemperaturen und Dichten (ebd., S. 53, 54).
Zusätzliche prozessbezogene Kompetenzen ab DS 3: Sie führen qualitative Nachweisreaktionen zu Alkali-
35 und Erdalkalimetallverbindungen sowie Halogeniden durch (ebd., S. 57).
A.3.2. Formulierung und Begründung des kompetenzorientieren Unterrichtsziels
KOUZ: Die SuS erläutern in einem Erklärvideo die Gruppierung chemischer Elemente in eine
Elementfamilie um die schwerpunktmäßig die Fach- und Medienkompetenz zu schulen (Anfor-
derungsbereich III; BK Stoff-Teilchen).
40 Durch die Produktion eines Erklärvideos kann die Medienkompetenz der SuS in einem zunehmend gesell-
schaftlich relevanten Bereich gefördert werden. Die SuS lernen sowohl sich kritisch mit der Qualität und Eig-
nung von Online-Erklärvideos auseinanderzusetzen als auch sich in Erklärvideos auszudrücken. DadurchErklärvideos im Chemieunterricht 6
können sie aktiver am gesellschaftlichen Diskurs teilnehmen. Das fachlich-inhaltliche Thema des KOUZ,
die Gruppierung von Elementen in Elementfamilien, ist aus historischer Sicht für die Entwicklung des PSE
maßgeblich und somit ein wichtiges Beispiel für den naturwissenschaftlichen Weg der Erkenntnisgewinnung.
Entscheidend ist aber, dass die SuS hier selbst erkennen, wie sich das zunächst unübersichtliche Sammel-
5 surium chemischer Elemente anhand verschiedener Eigenschaften der elementaren Stoffe systematisieren
lässt. Dadurch sind die SuS in der Lage, Verallgemeinerungen durchzuführen, Konzepte zu entwicklen und
Prognosen zu erstellen, die für sie vorher nicht möglich waren. Obwohl auf fachlich-inhaltlicher Ebene die
wichtigsten Kernaspekte der vier Elementfamilien zum Zeitpunkt der Videoproduktion im Unterricht behan-
delt sein werden, wird das KOUZ dem Anforderungsbereich (AFB) III zugeordnet. Der Gründe dafür sind die
10 Komplexität der Aufgabenstellung einschließlich der Auswahl und Strukturierung von Informationen sowie
die für die meisten SuS neue, aktiv-produzierende Nutzung dieses Medientyps.
A.3.3. Didaktische Erläuterungen
Didaktische Analyse
Im KOUZ wird durch den Operator erläutern definiert, dass die SuS die Gruppierung chemischer Elemente
15 in eine Elementfamilie im Medium des Erklärvideos durch zusätzliche Informationen veranschaulichen und
verständlich machen sollen (Niedersächsisches Kultusministerium, 2015, S. 104). Damit die SuS in der
Lage sind das KOUZ lernwirksam mit Blick auf Fach- und Medienkompetenz zu erreichen, müssen sie
mehrere Didaktische Schritte (DS) durchlaufen:
DS 1: Die SuS analysieren die Qualität und Eignung von Online-Erklärvideos unter inhaltlichen,
20 didaktischen, gestalterischen und technischen Gesichtspunkten (AFB II).
Der DS 1 gilt als erreicht, wenn die SuS Kriterien für die Qualität und Eignung von Erklärvieos unter
Berücksichtigung der genannten Aspekte herausgearbeitet und notiert haben. Bei diesem DS können sich
Lernschwierigkeiten (LS) insbesondere bei dem Erkennen der verschiedenen Qualitäts- und Eignungsdi-
mensionen (LS 1) sowie bei der Berücksichtigung und Abwägung individueller Bewertungsschwerpunkte
25 (LS 2) ergeben. Der DS 1 wird dem AFB II zugeordnet, da viele SuS im rezeptiven Umgang mit Erklärvideos
geübt sein werden und bereits eine, wenn vielleicht auch nicht klar formulierte, Vorstellung davon haben, was
ein gutes Erklärvideo für sie ausmacht. Diese Kritierien müssen sie hier erkennen, verbalisieren und kate-
gorisieren. Die im Rahmen des DS 1 erarbeiteten Kriterien werden als Orientierungshilfe für die Produktion
der eigenen Erklärvideos im Sinn des KOUZ als notwendig erachtet.
30 DS 2: Die SuS fassen für die Produktion von Erklärvideos relevante technische und methodi-
sche Aspekte zusammen (AFB III).
Der DS 2 gilt als erreicht, wenn die SuS technische (Aufnahme, Schnitt, Vertonung) und methodische
Aspekte (Darstellungsformen, Erstellung eines Storyboards, Urheberrecht) in Handouts zusammenfassend
beschrieben haben. Die SuS könnten bei diesem DS insbesondere Schwierigkeiten damit haben, das ge-
35 eignete Maß an Detail zu treffen, sodass die Handouts als Hilfe bei der Produktion der eigenen Videos
dienen können, aber nicht zu überfrachtet sind (LS 3). Bei den technischen Aspekten kann die Auswahl
geeigneter Programme eine weitere Lernschwierigkeit darstellen (LS 4). Der DS 2 wird dem AFB III zuge-
ordnet, da die behandelten Inhalte für die SuS wahrscheinlich neu sind und diese Inhalte recherchiert sowie
für die Verwendung im Rahmen des Unterrichtsvorhabens adäquat zusammengefasst werden müssen. Der
40 DS 2 ist für das Erreichen des KOUZ wichtig, da die SuS hier die notwendige technische und methodische
Übersicht erlangen, um den Herausforderungen des Mediums Erklärvideo bei der Produktion erfolgreich
begegnen zu können sowie dessen Möglichkeiten bewusst nutzen zu können.Erklärvideos im Chemieunterricht 7
DS 3: Die SuS entwickeln inhaltlichen Kernaussagen des zu produzierenden Videos (AFB II–III).
Der DS 3 gilt als erreicht, wenn die SuS Kernaussagen herausgearbeitet haben, indem sie ihr Wissen
aus dem Unterricht strukturiert, zielgerichtet mit weiteren recherchierten Informationen verknüpft und die
Kernaussagen schriftlich formuliert haben. Der DS 3 erfordert eine, ggf. vertiefende, Auseinandersetzung
5 mit dem fachlichen Inhalt. Dadurch können sich, abhängig vom Leistungsniveau der SuS, LSn bei dem
Verständnis sowie bei der Beurteilung von Relevanz und Eignung der inhaltlichen Informationen ergeben
(LS 5). Je nach Umsetzung durch die SuS ist der DS 3 dem AFB II–III zuzuordnen, da sich die SuS
ausschließlich auf im Unterricht behandelte Inhalte beschränken können (AFB II) aber auch neue Inhalte,
Begründungen, Folgerungen und Erkenntnisse einbinden können (AFB III). Der DS 3 stellt die Grundlage
10 für das Erreichen des fachlich-inhaltlichen Anteils des KOUZ dar.
DS 4: Die SuS entwickeln ein detailliertes Konzept zur Darstellung der Gruppierung von Ele-
menten in eine Elementfamilie im Medium des Erklärvideos (AFB III).
Der DS 4 gilt als erreicht, wenn die SuS die Darstellung der in DS 3 erarbeiteten Kernaussagen in einem
Storyboard schriftlich strukturiert und dieses um ausformulierte Sprechexte sowie den Einsatz visualisieren-
15 den Materials ergänzt haben. In diesem DS führen die SuS den fachlich-inhaltlichen und den methodischen
Anteil des KOUZ zusammen und entsprechend sind die möglichen LSn vielfältig. Diese können sowohl im
fachlichen Bereich (insbesondere Fachsprache, passendes Niveau; LS 6) als auch bei der Strukturierung
und Aufbereitung des Inhalts (insbesondere adäquate Reduktion, schlüssiger Aufbau; LS 7) sowie der Ge-
staltung (z.B. Übersichtlichkeit; LS 8) auftreten. Darüber hinaus sind LSn mit Bezug auf die zielorientierte
20 Umsetzung möglich. So könnten die SuS durch technische oder gestalterische Fragen von der lernwirksa-
men Darstellung des Inhalts abgelenkt werden (LS 9) oder die eingangs erarbeiteten Qualitätskriterien nicht
angemessen berücksichtigen (LS 10). Aufgrund der verschiedenen Dimensionen, welche die SuS bei ihrer
Planung berücksichtigen, reflektieren und abwägen müssen, stellt der DS 4 den didaktischen Höhepunkt
des Unterrichtsvorhabens dar und wird dem AFB III zugeordnet.
25 KOUZ: Die SuS erläutern in einem Erklärvideo die Gruppierung chemischer Elemente in eine
Elementfamilie (AFB III).
Das KOUZ wird als erreicht angesehen, wenn die SuS in Erklärvideos die Gruppierung chemischer Elemen-
te in Elementfamilien veranschaulicht und verständlich gemacht haben. Dies wird durch die Präsentation
und kritische Reflexion der produzierten Videos im Klassenverband überprüft. Um das KOUZ zu erreichen,
30 müssen die SuS ihre im DS 4 erstellte Planung praktisch umsetzen. Hierbei sind insbesondere technische
Schwierigkeiten bei Aufnahme und Schnitt möglich (LS 11); je nach Sorgfältigkeit der Vorbereitung können
aber auch die unter DS 4 genannten LSn eine Rolle spielen.
Analyse des Lernmaterials und lernunterstützenden Materials
Als Lernmaterial (LM) 1 werden im DS 1 drei Erklärvideos1 aus dem Internet zu den Themen Stoffmenge
35 und molare Masse gezeigt. Diese Videos wurden ausgewählt, da sie sich in Darstellungsform (Screen-
cast, Tischvideo, Personenaufnahme), Strukturierung und Aufbereitung des Inhalts, Stil und technischer
Umsetzung zum Teil deutlich unterscheiden. So wird eine Vielzahl von Aspekten angesprochen, welche die
SuS bei der Formulierung ihrer eigenen Bewertungskriterien aufgreifen können. Durch die aus zeitlichen
Gründen notwendige Begrenzung auf wenige Beispiele ergibt sich der Nachteil, dass bestimmte Aspekte
1
Mol / Molare Masse von Chemie - simpleclub, vollständig gezeigt (https://youtu.be/k0yXRRNJDvo);
Das Mol, n = m/M von chemistrykicksass, 0:00-0:40 und 1:46-6:00 (https://youtu.be/EeJMik-gYYs);
Molare Masse und molares Volumen von musstewissen Chemie, bis 4:40 (https://youtu.be/f0CcWMx1 ns)Erklärvideos im Chemieunterricht 8
gekoppelt erscheinen können (z.B. Animation und professionelle technische Umsetzung/ Tischvideo und
laienhafte technische Umsetzung). Diese Kopplungen könnten von den SuS als implizite Zusammenhänge
überbewertet werden. Das zentrale, fachlich-inhaltliche LM dieses Unterrichtsvorhabens stellt der Unter-
richt zu den Elementfamilien bzw. die Mitschriften der SuS desselben dar (LM 2; siehe Tabelle A.1, und
5 Anhang 1, S. 21). Auf eine ausführlichere Darstellung muss an dieser Stelle aufgrund des Materialumfangs
verzichtet werden.
Als lernunterstützendes Material (luM) 1 wird im DS 1 eine Folie mit Arbeitsauftrag verwendet (Abbil-
dung B.2). Der Arbeitsauftrag ist so formuliert, dass verschiedene Qualitäts- und Eignungsdimensionen
(Lernhilfe (LH) zu LS 1) sowie Abstufungen der Relevanz für Bewertungskriterien (LH zu LS 2) vorge-
10 geben werden. Obwohl die Intention des Produzenten eines Erklärvideos bei manchen Formaten (z.B.
Werbung, politische Zusammenhänge) das entscheidende Bewertungskriterium darstellt, wurde im luM 1
auf die explizite Erwähnung dieses Kriteriums aus zwei Gründen verzichtet. Zum einen lassen sich in den
präsentierten Videos selbst keine offensichtlichen Ansätze zur kritischen Diskussion der Intention der Pro-
duzenten finden. Zum anderen ist dieser Aspekt für das Erreichen des KOUZ nicht entscheidend, da die
15 generelle Intention den SuS vorgegeben wird (Produktion eines Erklärvideos für SuS der 9. Jahrgangsstufe,
welches als Vorbereitung für die Klassenarbeit verwendet werden kann). Das Handout mit den erarbeite-
ten Bewertungskriterien (Abbildung B.3) wird den SuS als luM 2 für die Produktion und abschließende
Evaluation der eigenen Videos zur Verfügung gestellt. In dem Handout werden die SuS aufgefordert, von
ihren als positiv bewertete Kriterien im Storyboard zu markieren, wenn sie diese einplanen. Dies soll die
20 SuS dabei unterstützen die von ihnen definierten Qualitätskriterien bewusst umzusetzen (LH zu LSn 7, 8,
10). Ein Zeitplan (luM 3; Abbildung B.5) wird zu Beginn des DS 2 an die SuS ausgegeben, um sie über
die Einbettung der Videoproduktion in den Unterricht (insbesondere Koordination mit der Klassenarbeit)
zu informieren und sie frühzeitig über die anstehenden Aufgaben zu informieren, damit sie diese in ihrer
Planung berücksichtigen können (LH zu LS 9). Als luM 4 wird im DS 2 eine Internetseite2 als vorgegebener
25 Startpunkt für die Recherche zu methodischen, technischen und rechtlichen Aspekten von Erklärvideos
vorgegeben. Diese Seite ist speziell als Hilfe für die Erstellung von Erklärvideos durch SuS konzipiert und
liefert übersichtlich strukturierte Informationen (z.B. zu Darstellungsformen, Storyboard, Urheberrecht, Auf-
nahmetechniken, Programme für Aufnahme und Schnitt) sowie weitere Beispiele für Erklärvideos. Diese
Internetseite bietet, zusammen mit den erstellten Handouts der SuS (luM 5; Abbildungen B.8 bis B.12),
30 LHn insbesondere zu den LSn 4, 7, 8, 11. Individuelles Feedback der Lehrkraft zu fachlich-inhaltlichen und
fachsprachlichen Aspekten der angefertigten Storyboards und Sprechtexte wird als LH zu LSn 5 und 6 ver-
wendet und den SuS als luM 6 auch schriftlich zur Verfügung gestellt (Abbildungen B.15, B.18, B.20, B.23).
Die Evaluationsbögen (luM 7; Abbildung B.6) stellen eine Strukturierungshilfe für die kritische Reflexion
der produzierten Videos dar. In den Bögen werden einige der Beurteilungskriterien aus luM 2 als mögliche
35 Aspekte aufgegriffen, um den Evaluationsgruppen ihren jeweiligen Fokus zu verdeutlichen (LH zu LS 1).
A.3.4. Methodische Erläuterungen
Begründung und Artikulation des ausgewählten Lehrverfahrens
Für dieses UV wurde das aufgebend-erarbeitende Lehrverfahren gewählt. Da die meisten SuS wahrschein-
lich noch keine Erfahrung mit der Produktion von Erklärvideos haben, werden mehrere didaktische Schritte
40 als notwendig erachtet, damit die SuS das KOUZ lernwirksam mit Blick auf Fach- und Medienkompetenz
erreichen. Das aufgebend-erarbeitende Lehrverfahren erlaubt der Lehrkraft dabei Weg- und Zieltranspa-
renz sicherzustellen, indem den SuS durch Strukturierungs- und Steuerungselemente ein inhaltlicher und
zeitlicher Bezugsrahmen gegeben wird. Das Unterrichtsvorhaben gliedert sich in folgende Schritte: Ein-
2
Erklärvideos erstellen von Andreas Kalt, (https://herr-kalt.de/arbeitsmethoden/erklaervideos)Erklärvideos im Chemieunterricht 9
stieg – Erarbeitung 1 (Qualitätskriterien) mit Zwischensicherung – Erarbeitung 2 (methodische und
technische Aspekte) mit Zwischensicherung – Erarbeitung 3 (Darstellung des jeweiligen Themas
im Erklärvideo) – Präsentation und Evaluation. Der gesetzte Bezugsrahmen ermöglicht die Öffnung des
Unterrichts insbesondere in der Erarbeitung 3, wenn die SuS über die notwendigen Lernvoraussetzun-
5 gen verfügen. Entsprechend konzentriert die Lehrkraft ihre Rückmeldung an die SuS in dieser Phase auf
die inhaltliche Richtigkeit sowie Sicherheitsaspekte bei geplanten Experimenten; Struktur, Gestaltung und
technische Umsetzung des Erklärvideos sollen von den SuS hier vollständig autonom entwickelt werden.
Methodischer Kommentar zu ausgewählten Aspekten
Aufgrund der prozessualen Komplexität und der thematischen Breite des Unterrichtsvorhabens wurde die
10 arbeitsteilige Gruppenarbeit (GA) als vorherrschende Sozialform gewählt. Ihr kooperatives Grundprinzip
ermöglicht es Fach- und Medienkompetenz effizient zu stärken und gleichzeitig eine wechselseitige, positive
Abhängigkeit zu erzeugen, die die Sozialkompetenz der SuS fördert und ihre Motivation steigert das eigene
Thema möglichst gut aufbereitet zu präsentieren. Das fachlich-inhaltliche Thema der Ordnung chemischer
Elemente in Elementfamilien eignet sich für eine arbeitsteilige GA besonders, da eine inhaltlich sinnvolle
15 und eindeutig nachvollziehbare Abgrenzung der einzelnen Themen möglich ist. Durch die arbeitsteilige
Produktion der Videos, die gemeinsam den Inhalt der ganzen Unterrichtseinheit zusammenfassen sollen,
erhält jeder einzelne Beitrag eine besondere Bedeutung für das Gesamtergebnis der Klasse und kann
entsprechend gewürdigt werden.
Zu Beginn der Erarbeitung 2 werden in einem Gruppenpuzzle Produktions- und Recherchegruppen gebil-
20 det. Dazu wird den SuS eine Matrix an der Tafel vorgegeben (Abbildung B.4), anhand derer das Gruppen-
puzzle erklärt wird. Die SuS werden anschließend gebeten sich selbständig in den verschiedenen Gruppen
zusammenzufinden, wobei sie darauf hingewiesen werden, dass sie durch die Mitgliedschaft in einer Recher-
chegruppe Verantwortung für die Umsetzung des jeweiligen Aspekts ihrer Produktionsgruppe übernehmen.
Hierbei ist anzumerken, dass die von den Recherchegruppen abgedeckten Aspekte methodisch-technischer
25 Natur sind; die inhaltliche Umsetzung liegt in der gemeinsamen Verantwortung der Produktionsgruppe. Das
Gruppenpuzzle soll primär sicherstellen, dass die Erkenntnisse aus der Erarbeitung 2 bei der Erarbei-
tung 3 in jeder Produktionsgruppe vorhanden sind sowie durch Zuteilung von Verantwortungsbereichen
unterstützen, dass die verschiedenen Aspekte bei der Produktion berücksichtigt werden. Darüber hinaus
werden durch das Gruppenpuzzle feste soziale Strukturen aus einem für die SuS nachvollziehbaren Grund
30 temporär durchbochen, sodass nicht konstant die gleichen SuS zusammenarbeiten. Letzteres erscheint
besonders in dieser Klasse wünschenswert für die soziale Dynamik. Die Erarbeitung 2 erfolgt aller Wahr-
scheinlichkeit nach in Vertretungsstunden bei Abwesenheit der Lehrkraft aufgrund der Teilnahme an einer
Kursfahrt. Da die Anwesenheit der Lehrkraft in dieser Phase nicht unbedingt erforderlich ist, kann sonst
ausgefallene Unterrichtszeit für das UV genutzt werden.
35 Die Erarbeitung 3 konzentriert sich auf die Planung und die Produktion der Erklärvideos. Für die Aufnahme
der Videos werden private Geräte der SuS verwendet, da sie im Umgang mit ihren Geräten geübt sind und
diese auch in Zukunft verwenden würden. Dadurch kann die Medienkompetenz im Bereich Medien her-
stellen lernen nachhaltiger gestärkt werden. Rechtliche Aspekte der Verwendung privater Aufnahmegeräte
werden mit der Schulleitung und den Erziehungsberechtigten abgeklärt (Anhang 2, S. 22). Dreh und Schnitt
40 der Erklärvideos in der Erarbeitung 3 stellen den methodischen Höhepunkt des Unterrichtsvorhabens dar.
Für die betreffende Doppelstunde werden den SuS zwei Räume zur Verfügung gestellt, sodass die Gruppen
möglichst ungestört arbeiten können. Die Planung für diese Doppelstunde obliegt den SuS; Chemikalien
und Versuchsmaterialien werden den SuS nur auf Anfrage zur Verfügung gestellt. Um die SuS zu rechtzeiti-Erklärvideos im Chemieunterricht 10
ger Planung anzuhalten, werden sie aufgefordert, entsprechende Bestellungen bei der Lehrkraft zwei Tage
vor dem Dreh aufzugeben.
Die abschließende Präsentation der Videos findet im Klassenverband statt (siehe Verlaufsplan in Tabelle
B.3). Die SuS werden vor der Präsentation in vier Evaluationsgruppen eingeteilt, wobei die Produktions-
5 gruppen von der Lehrkraft neu gemischt werden. Den Evaluationsgruppen werden unterschiedliche Beob-
achtungsaufträge gegeben (Abbildungen B.6 und B.7). Durch die Zuteilung von Beobachtungsaufträgen
kann eine möglichst gleichmäßige Würdigung aller Videos sowie eine kriteriengeleitete, effiziente und ggf.
zusammenfassende Evaluation besser erreicht werden. Würden alle Videos nacheinander ohne spezielle
Beobachtungsaufträge gezeigt werden, würde sich ein großer Teil der Rückmeldung wahrscheinlich auf
10 das letzte Video konzentrieren; würde jedes Video direkt nach seiner Präsentation besprochen werden,
würden die zuerst gezeigten Videos wahrscheinlich mehr Würdigung und Rückmeldungen erhalten. Von der
Veröffentlichung der Videos im Internet soll im Rahmen dieses Unterrichtsversuches abgesehen werden.
Stattdessen sollen die Videos der Klasse über die schulinterne Plattform VincWeb3 zugänglich gemacht
werden.
3
https://vincweb.vlg-stade.deB. Auswertung
B.1. Systematische Auswertung
B.1.1. Erreichen des kompetenzorientierten Unterrichtsziels
Aufgrund der Produktorientierung des UV kann das Erreichen des KOUZ vordergründig eindeutig anhand
5 der produzierten Videos überprüft werden. Da das Unterrichtsvorhaben aber kooperativ angelegt wurde
und keine Überprüfung der Einzelleistungen stattfand, lässt sich das Erreichen des KOUZ auf individueller
Ebene nur indirekt über Beobachtungen im Unterricht und die Angaben der SuS in den Fragebögen beur-
teilen (Abschnitte B.1.3 und B.1.4). Die SuS selbst bewerten die Beteiligung der Gruppenmitglieder an der
Produkterstellung durchaus divergent; acht SuS sehen eine ausgewogene Beteiligung in der GA-Phase,
10 sechs verneinen dies eher und fünf SuS äußern sich indifferent (Frage 271 ).
Die Schülergruppen Erdalkalimetalle, Halogene und Edelgase haben ihr Video in der letzten Stunde des
Unterrichtsvorhabens präsentiert und damit die Voraussetzung für das Erreichen des KOUZ erfüllt. Bei
der Schülergruppe Alkalimetalle war die Schülerin, die das Video mitbringen wollte, zum Zeitpunkt der
Präsentation erkrankt. Aufgrund der Vorleistungen dieser Gruppe (Sprechtext, Storyboard, Videodreh; Ab-
15 bildungen B.13, B.14) kann aber davon ausgegangen werden, dass hier keine signifikanten Defizite beste-
hen. Über die reine Fertigstellung des Videos hinaus, erfordert der Operator erläutern im KOUZ, dass die
SuS fachlich korrekte Informationen so auswählen, strukturieren und mit geeigneten Beispielen verknüpfen,
dass die Vermittlung des Inhalts unterstützt wird, sein Bezug zu Grundprinzipien deutlich oder seine Einord-
nung in Kontexte ermöglicht wird. Die präsentierten Videos zeigen, dass dies den Gruppen unterschiedlich
20 gut gelungen ist. Die Schülergruppen Erdalkalimetalle und Edelgase haben Informationen so ausgewählt
und strukturiert, dass die Grundlage der Gruppierung von Elementen in diese Elementfamilien deutlich
wurde. Die Schülergruppe Halogene hat in ihrem Video hingegen einige wichtige Gemeinsamkeiten der
betreffenden Elemente nicht genant und die Elementfamilie auch nicht auf der Basis gemeinsamer, spezi-
fischer Eigenschaften definiert (Abbildung B.28). Die gezeigten fachlichen Inhalte wurden in allen Videos
25 weitgehend korrekt dargestellt; besonders im fachsprachlichen Bereich aber auch bei der Unterscheidung
zwischen Stoff- und Teilchenebene sowie bei der Differenzierung zwischen Reinstoffen und Verbindungen
waren in den Videos zu Erdalkalimetallen und Halogenen jedoch Defizite zu erkennen (ebd. und Abschnitt
B.1.3). Dabei ist anzumerken, dass einige der genannten Mängel in den Sprechtexten und Storyboards der
betreffenden Gruppen besser dargestellt wurden (Abschnitt B.1.3). Mit Blick auf das Erreichen des KOUZ ist
30 hier insbesondere hervorzuheben, dass die Schülergruppe Halogene in ihrem Sprechtext – im Gegensatz
zum Video – immerhin eine knappe, zusammenfassende Definition der Elementfamilie gegeben hat (Ab-
bildung B.19). Weiterhin wurden in den Videos aller Gruppen Alltagsbeispiele angeführt (Abbildung B.29),
welche von den SuS eingangs als wichtiges Qualitätskriterium für Erklärvideos genannt worden waren und
somit zum Erreichen des KOUZ beitragen (Abbildung B.3). Gestaltung sowie technische Umsetzung haben,
35 mit Ausnahme typographischer Schwächen (Abschnitt B.1.3), in allen Videos die Vermittlung des Inhalts
unterstützt (Abbildungen B.30 und B.31). Zusammenfassend lässt sich ableiten, dass das KOUZ aus Leh-
rersicht von den Schülergruppen Erdalkalimetalle und Edelgase auf allen Ebenen im Wesentlichen erreicht
wurde. In der Schülergruppe Halogene wurde das KOUZ letztendlich im Video auf inhaltlicher Ebene knapp
verfehlt, der Umgang mit dem Medium des Erklärvideos ist auf gestalterischer und technischer Ebene aber
40 grundsätzlich gelungen.
Die SuS selbst sind mit den eigenen Videos auf inhaltlicher, gestalterischer und technischer Ebene
1
Die hier angegebenen Nummern beziehen sich auf die fortlaufende Nummerierung der Fragen in den Schülerfragebögen (siehe
Anhang 9, S. 57). Um die Übersichtlichkeit des Textes zu gewährleisten wird diese Referenz nur einmal angegeben.Erklärvideos im Chemieunterricht 12
größtenteils zufrieden (je 14/19 positive Nennungen; Fragen 39, 48, 49). Ebenfalls fiel die abschließen-
de Evaluation der drei präsentierten Videos durch die SuS grundsätzlich positiv aus (Abbildungen B.24
bis B.27), sodass davon ausgegangen werden kann, dass das KOUZ aus Schülersicht in allen Fällen
erreicht wurde. Allerdings beantworteten nur 9/19 SuS die Frage, ob sie die Videos zur Wiederholung
5 in der 10. Klasse nutzen würden, positiv (Frage 40). Als Gründe für die Verwendung der Videos wurden
im Unterrichtsgespräch (UG) genannt, dass die Mappen bis dahin nicht überleben“ oder ich zu faul bin,
” ”
die Mappe zu lesen“, während SuS, die die Videos eher nicht (ausschließlich) zur Wiederholung nutzen
würden, die Struktur ihrer eigenen Mappe bevorzugen oder angeben sich aus ihrer Mappe besser Inhalte
herausschreiben können.
10 B.1.2. Motivation zur Beschäftigung mit dem fachlichen Thema durch Erklärvideos
Die SuS geben vor und nach dem UV an, dass sie gerne durch das Anschauen von Erklärvideos lernen
(14/21 bzw. 17/19 positive Nennungen; Frage 6), sie dies dazu motiviert, sich mit dem Unterrichtsinhalt
zu befassen (14/21 bzw. 14/19, Frage 16), sie den Unterrichtsinhalt dadurch besser (20/21 bzw. 17/19;
Frage 28) und schneller (18/21 bzw. 14/19; Frage 29) verstehen und Erklärvideos den Unterricht inter-
15 essanter machen (19/21 bzw. 15/18; Frage 11). Ihre Ansicht begründen sie hauptsächlich damit, dass in
Erklärvideos Inhalte häufig besser und einfacher erklärt werden, Erklärvideos verfügbar sind, wenn die SuS
Hilfe benötigen, die Nutzung von Erklärvideos Zeit und Arbeit spart und sie neue Inhalte lernen können
(Frage 9). Daraus lässt sich ableiten, dass Erklärvideos bei passiver Verwendung durch ihre niedrige Zu-
gangsschwelle die SuS grundsätzlich dazu motivieren, sich mit dem (fachlichen) Inhalt zu befassen. Über
20 den Verlauf des UV steigt die Häufigkeit, mit der die SuS angeben Erklärvideos in ihrer Freizeit und zum
Lernen für die Schule zu nutzen, leicht an (sehr häufige bis gelegentliche Nutzung: von 10/21 auf 14/19
bzw. von 14/21 auf 16/19; Fragen 1, 2).
Da die SuS im Allgemeinen eher geringes Interesse am fachlichen Thema zeigen (3/19; Frage 18), sind
treibende Kräfte für die Motivation sich mit dem Inhalt zu auseinanderzusetzen eher in der Art und Wei-
25 se der Beschäftigung mit dem Thema zu suchen. Insgesamt hat sich gezeigt, dass die im UV geplan-
te Arbeit mit dem Medium des Erklärvideos die SuS insbesondere im sozial-kooperativen aber auch im
gestalterisch-kreativen Bereich motivieren konnte. Dabei muss allerdings die Frage unbeantwortet bleiben,
ob bei häufigerer Verwendung von Erklärvideos im Unterricht diese motivierende Wirkung erhalten bleibt,
oder ob sich das Neue und Interessante der Methode bald abnutzt. Die Umsetzung technischer Aspekte im
30 UV sowie die zur Verfügung stehende Zeit sehen die SuS kritischer und aufgrund hoher Lernschwierigkeiten
im technischen Bereich eher demotivierend (Fragen 55, 57). Da die SuS diese Schwierigkeiten im UV aber
zu einem großen Teil überwunden haben (Abschnitt B.1.4), ist davon auszugehen, dass dieser negative
Effekt bei Folgeprojekten geringer ausfallen würde.
Am Ende des UV geben verhältnismäßig mehr SuS an, dass sie Erklärvideos nicht häufiger im Unterricht
35 produzieren möchten (von 6/21 auf 10/19; Frage 8). Von vielen SuS wurde als primärer Grund dafür der
anfangs geringer eingeschätzte, letztlich aber hohe Zeitaufwand genannt (von 4/21 auf 8/18; Fragen 15,
57 und UG). Davon abgesehen äußern sich die SuS nach dem UV deutlich positiver zur motivierenden
Wirkung der Produktion von Erklärvideos im Vergleich zu Postern oder Referaten (von 5/21 auf 12/19;
Frage 12) und geben verstärkt an, dass ihnen das Anschauen und die Produktion von Erklärvideos im
40 Unterricht Spaß machen (von 13/21 auf 17/19 bzw. von 5/21 auf 9/19; Fragen 13, 14). Den SuS hat an
dem UV besonders die GA gefallen (Frage 56), wobei sie im UG mehrfach erwähnt haben, dass sie die
Möglichkeit zur Zusammenarbeit mit ihren Freunden sehr schätzen. Nur wenige SuS haben angemerkt,
dass ihnen die GA schwergefallen sei oder dass sie hier Verbesserungsmöglichkeiten sehen (Fragen 55,Erklärvideos im Chemieunterricht 13
57). In dieser Hinsicht hat sich die prozessuale Komplexität der Erklärvideoproduktion und der daraus
resultierende kooperative Ansatz des UV in Kombination mit der freien Gruppenwahl als positiv für die
Motivation der SuS erwiesen. Die Umsetzung des kooperativen Ansatzes scheint im UV gelungen, da die
Mehrzahl der SuS nach dem UV angibt, dass das Produzieren von Erklärvideos die Zusammenarbeit
5 unter den SuS fördert (15/19; Frage 24), jeder seine Stärken einbringen kann (12/19; Frage 25) und
die SuS beim Produzieren der Erklärvideos voneinander profitieren (13/19; Frage 26). Zusätzlich zu der
Arbeit in den einzelnen Gruppen wurde auch die arbeitsteilige Produktion verschiedener Videos von den
SuS positiv hervorgehoben (Frage 56 und UG). Da viele SuS angegeben haben, dass sie beim Erstellen
von Lernmaterial für andere besonders auf die Qualität achten (15/21 und 14/19; Frage 23), kann sich
10 die arbeitsteilige Aufbereitung verschiedener Themen positiv auf die sorgfältige Beschäftigung mit dem
fachlichen Inhalt auswirken. Neben der arbeitsteiligen GA wurden mehrfach Kreativität/ Gestaltungsfreiheit
sowie Abwechslung und leichtes Lernen zum Thema als positive Aspekte des UV benannt (Frage 56). Die
Möglichkeit gestalterisch-kreativ tätig zu werden (von 14/21 auf 13/19; Frage 22) motiviert die SuS dabei
grundsätzlich mehr als der Einsatz ihrer technischen Fähigkeiten (von 7/21 auf 9/19; Frage 21). Gleichzeitig
15 geben nur wenige SuS an, dass die kreative Gestaltung sie bei der Produktion abgelenkt hat (2/19; Fragen
35), während etwa die Hälfte meint, dass sie von technischen Schwierigkeiten abgelenkt worden wären
(9/19; Frage 35).
Zur Durchführung des UV geben die SuS mehrheitlich an, dass sie in der Gruppenarbeitsphase konzentriert
gearbeitet und sich nicht häufig mit anderen Dingen beschäftigt haben (16/19 bzw. 10/18; Fragen 19, 20).
20 Dies deckt sich mit den Beobachtungen der Lehrkraft während des Videodrehs, bei dem die SuS sehr
konzentriert und zielorientiert waren. Eine für die betreffenden Schülerinnen eher geringe Motivation war
insbesondere zu Beginn der Erarbeitung 3 bei der Schülergruppe Edelgase zu beobachten, zu der zwei
der leistungsstärksten Schülerinnen der Klasse gehören. Diese Gruppe konnte sich bei der Auswahl der
Themen zunächst nicht entscheiden und war schließlich enttäuscht über die eingeschränkten Möglichkeiten,
25 die das übriggebliebene Thema bot. Grundsätzlich wäre es gut gewesen, dieser Gruppe ein anspruchsvolle-
res und inhaltlich motivierenderes Thema anzubieten. Da die SuS ihr Thema aber selbst wählen sollten und
sich im fachlichen Kontext nur die vier gestellten Themen angeboten haben, war dies nicht zu realisieren. In
anderen Zusammenhängen wäre es sicher vorteilhaft ein Überangebot an Themen bereitzustellen, sodass
alle SuS wählen können.
30 Auf die direkte Frage, ob das Produzieren von Erklärvideos die SuS dazu motiviert, sich mit dem Unter-
richtsinhalt zu befassen, äußern sich die SuS divergent, nach dem UV aber entschiedener. Während sich
zu Beginn 7/21 SuS positiv und 2/21 SuS negativ zu dieser (noch hypothetischen) Frage äußern, steigen
beide Anteile nach dem UV auf 8/19 bzw. 6/19 SuS (Frage 17). Damit bejaht zwar die Hälfte der SuS
die Frage, der Anstieg über das UV fällt im negativen Bereich aber deutlicher aus. An dieser Stelle ist
35 anzumerken, dass die SuS bei dem durchgeführten UV im Allgemeinen eine stärkere Progression bei der
Medienkompetenz als bei der Fachkompetenz wahrgenommen haben (s. Abschnitte B.1.4 und B.1.3). Es
ist möglich, dass dieser Unterschied die obige Einschätzung der SuS beeinflusst hat. Um dies zu beurteilen
wäre ein Vergleich mit einem UV nötig, bei dem ein inhaltlich neues Thema bearbeitet wird. Aufgrund der
in Abschnitt A.3.1 dargelegten Gründe erscheint eine derartige Konzeption allerdings im hier gegebenen
40 Rahmen weiterhin als nicht sinnvoll.
B.1.3. Festigung und Vertiefung fachlicher Inhalte
Aufgrund der gewählten Einbettung in den Unterricht ist die inhaltliche Progression bei diesem UV von vor-
neherein als moderat einzuschätzen. Die wichtigen fachlichen Inhalte wurden vor der Erklärvideoproduktion
im Unterricht erarbeitet und waren, mit Ausnahme der Edelgase, schon Gegenstand einer KlassenarbeitErklärvideos im Chemieunterricht 14
(Tabelle B.1). Bei der Konzeption des UV erschien diese Reihenfolge wichtig, um durch die beabsichtig-
te Arbeitsteilung keine ungleichmäßigen Voraussetzungen für die Klassenarbeit zu erzeugen. Trotz ihrer
inhaltlichen Vorkenntnisse geben die SuS nach dem UV aber mehrheitlich an, dass die Produktion von
Erklärvideos zu einem besseren Verständnis der Unterrichtsinhalte beiträgt (von 7/21 zu 9/19; Frage 30),
5 sie beim Produzieren Neues zum Unterrichtsthema gelernt haben (15/19; Frage 32) und sie sich durch
das Produzieren den Inhalt besser merken können (16/19; Frage 33). Insgesamt sehen die SuS im Kompe-
tenzbereich Fachwissen – wie zu erwarten – zwar keine immense inhaltliche Progression, sie stellen aber
durchaus einen positiven Effekt der Produktion im Sinn einer Konsolidierung und Vertiefung der Fachinhalte
fest (ebd., Frage 41 und UG).
10 Mit Blick auf den Umfang der inhaltlichen Progression sind insbesondere die Schülergruppe Halogene und
eine Schülerin, die in der Unterrichtseinheit zum Thema Elementfamilien häufig gefehlt hat, hervorzuheben.
Die Schülergruppe Halogene hat ein eher oberflächliches Video produziert, das sich stark an einzelnen
Unterrichtsinhalten orientiert; insbesondere ist die im Video zentrale Tabelle eine (zum Teil fehlerhafte) Kopie
aus dem Unterricht. Allerdings besteht diese Gruppe aus generell schwachen Schülern, die im Unterricht
15 und in der Klassenarbeit zum Thema nur ausreichende bis mangelhafte Leistungen gezeigt haben. Bei der
Videoproduktion haben sich die Schüler über das übliche Niveau hinaus motiviert und konzentriert gezeigt
und den Unterrichtsinhalt zu ihrem Thema mindestens wiederholt und konsolidiert. In dem Erklärvideo
konnten die SuS so die Silbernitrat-Fällung von Halogeniden immerhin beschreiben; dies war vielen von
ihnen in der Klassenarbeit zuvor nicht oder nur schlecht gelungen. Obwohl die Schülergruppe Halogene
20 das KOUZ im Video inhaltlich verfehlt hat (Abschnitt B.1.1), ist bei ihnen somit eine inhaltliche Progression
zu erkennen. Der Lernfortschritt der Schülerin, die im Unterricht zum Thema Elementfamilien häufig gefehlt
hat, war wahrscheinlich der größte in der Klasse. Diese Schülerin hatte in der Klassenarbeit aufgrund des
verpassten Unterrichts merkliche Schwierigkeiten. Bei dem Videodreh hat sie Reaktionsgleichungen zu
Alkalimetallen an die Tafel geschrieben, ist dann plötzlich zurückgetreten, hat ihren Anschrieb betrachtet
25 und gesagt, dass sie das jetzt endlich verstanden“ habe und dass sie in der Klassenarbeit sicher besser
”
abgeschnitten hätte, wenn sie vorher das Video produziert hätte. In ihrem Fall konnte die Produktion
des Videos mehr zum Verständnis des fachlichen Inhalts beitragen, als das Lernen für die Klassenarbeit.
Ein nicht beabsichtigter, aber von zwei SuS erwähnter Effekt der Videoproduktion auf ihre inhaltlichen
Kenntnisse war auf technische Probleme zurückzuführen. Diese SuS gaben an, dass sie ihren Text aufgrund
30 von Schwierigkeiten bei der Vertonung so oft gesprochen haben, dass sie ihn schließlich auswendig konnten.
Im Bereich der Kommunikationskompetenz geben die SuS nach dem UV mehrheitlich an, dass sie für
die Produktion des Erklärvideos recherchiert haben (16/19; Frage 36), sie beim Produzieren auf korrekte
Fachsprache geachtet haben (14/19; Frage 37) und sich viele Gedanken über einen nachvollziehbaren
Aufbau gemacht haben (14/19; Frage 38). Die Recherche fiel vielen SuS nach eigener Angabe leicht (Frage
35 54) und in den Videos zu Edelgasen und Erdalkalimetallen sind tatsächlich Informationen vorhanden, die
nicht Teil des Unterrichts waren. Im Video zu Erdalkalimetallen wird sogar ein neuer Versuch gezeigt, der
im Video allerdings nur oberflächlich auf Stoffebene gedeutet wird. Mit Bezug auf die Fachsprache kann
festgestellt werden, dass das angegebene Bemühen der SuS nur bedingt erfolgreich war; die Videos zu
Erdalkalimetallen und Halogenen enthalten einige fachsprachliche Fehler. Im Video zu Erdalkalimetallen
40 ist zudem an einigen Stellen zu erkennen, dass typographische Probleme, die wahrscheinlich auf das ver-
wendete Screencast-Programm zurückzuführen sind, der fachlich korrekten Darstellung im Weg gestanden
haben. Dies wurde insbesondere deutlich als die SuS die allgemeine Formel für Erdalkalimetallhydroxide
als Me(OH)2“ dargestellt, den Index aber zur Verdeutlichung als tiefgestellte 2“ vorgelesen haben. Bei sol-
” ”
chen technischen Problemen steht die Darstellung in Screencasts der korrekten Vermittlung des fachlichen
45 Inhalts eindeutig im Weg.Sie können auch lesen