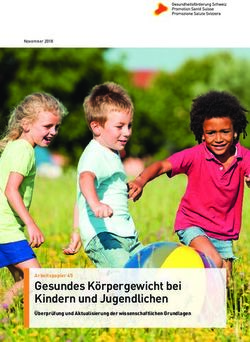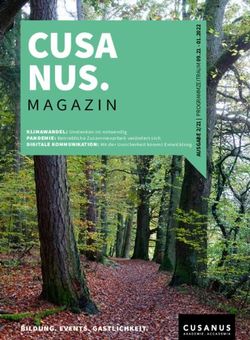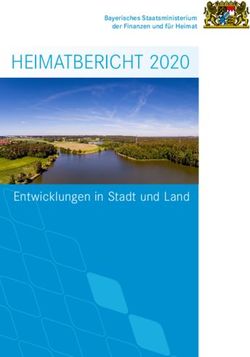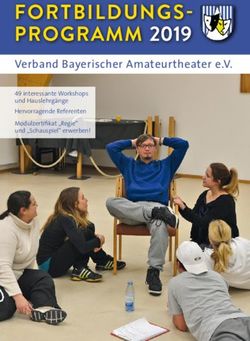Bauer sucht Zukunft - wo steht unsere Landwirtschaft?
←
→
Transkription von Seiteninhalten
Wenn Ihr Browser die Seite nicht korrekt rendert, bitte, lesen Sie den Inhalt der Seite unten
«Bauer sucht Zukunft – wo steht
unsere Landwirtschaft?
Situationsbericht 2009»
SBV Schweizerischer Bauernverband USP Union Suisse des Paysans USC Unione Svizzera dei Contadini UPS Uniun purila svizraInhaltsverzeichnis
4
Vorwort 6
Zusammenfassung 7
Teil A: Produktions- und Marktverhältnisse im Jahr 2009
A1 Die landwirtschaftliche Produktion im Jahr 2009 10
Abbildung 1: Monatliche Lufttemperatur (2005 – 2009) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10
Abbildung 2: Monatliche Niederschlagsmengen (2005 – 2009) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11
Abbildung 3: Entwicklung der Preise und Ernte von Kartoffeln (1992 – 2009) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12
Abbildung 4: Entwicklung der Preise für Ferkel und Schlachtschweine (2001 – 2009) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14
Abbildung 5: Entwicklung der Preise für Industriemilch (2005 – 2009) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15
A2 Die landwirtschaftliche Gesamtrechnung 16
Tabelle 1: Landwirtschaftliche Gesamtrechnung (2000 – 2009) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18
Teil B: Einkommenssituation der landwirtschaftlichen Betriebe
B1 Beurteilung des Arbeitsverdienstes 22
Abbildung 6: Entwicklung des Arbeitsverdienstes pro Familienarbeitskraft
und des Vergleichslohns (2000 – 2008) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23
B2 Rentabilität von Eigen- und Gesamtkapital 24
Tabelle 2: Entwicklung der Eigenkapitalrentabilität und der Gesamtkapitalrentabilität (2000 – 2008) . . . . . . . . . . . 24
B3 Fazit 245
Teil C: Bauer sucht Zukunft – wo steht unsere Landwirtschaft?
C1 Entwicklung und Status quo der Schweizer Landwirschaft 28
Abbildung 7: Anzahl Landwirtschaftsbetriebe, reales Produzentenpreisniveau und
jährliche Abnahmerate der Betriebe (1990 – 2007) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28
Abbildung 8: Strukturentwicklung nach Grössenklassen (1997 – 2007) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29
Abbildung 9: Veränderungsraten der Fläche . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29
Abbildung 10: Entwicklung der Tierhalter und der Betriebe (1998 – 2007) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30
Abbildung 11: Grösse und Viehdichte als Bestimmungsfaktoren für das Erwerbsmodell . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30
Abbildung 12: Entwicklung der ökologischen Ausgleichsflächen und
der biologisch bewirtschafteten Nutzfläche (1993 – 2007) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31
Abbildung 13: Treibhausgasemissionen nach Verursachern . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 32
Abbildung 14: Entwicklung des Exports von Produkten des Ernährungssektors (1998 – 2008) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 33
Abbildung 15: Handelsbilanz landwirtschaftlicher Produkte . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 34
Abbildung 16: Importe von pflanzlichen und Tierprodukten, je nach Herkunftsland . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 35
Abbildung 17: Importe und Exporte von Käse (inkl. Schmelzkäse), je nach Herkunft und Destination . . . . . . . . . . . . . . 35
Tabelle 3: Inlandprodukte in Prozent des Verbrauchs . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 36
C2 Vergleich mit dem Ausland 36
Abbildung 18: Produktionswert der pflanzlichen Produkte aus Baden-Württemberg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 38
Abbildung 19: Erwerbsstrukturen in Österreich . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 39
Abbildung 20: Entwicklung der Verschuldung dänischer Bauern (1996 – 2007) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40
Tabelle 4: Charakterisierung von fünf europäischen Landwirtschaften . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 42
C3 Fazit und Ausblick 44
Teil D: Anhang
Anhang 1: Abbildung zum Teil A
Entwicklung Kuhbestand (2006 – 2009) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50
Anhang 2: Abbildung zum Teil B
Berechnung des landwirtschaftlichen Einkommens . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 51
Anhang 3: Tabelle zum Teil C
Ein- und Ausfuhr von landwirtschaftlichen Produkten (2008) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 52
Impressum
Mitarbeit am Situationsbericht 54Vorwort
6
Bioland Schweiz, Ballenberglandwir tschaft, Konzentration auf eigentlich wollen. Seit fast 20 Jahren reiht sich eine agrarpolitische
ein paar wenige, international konkurrenzfähige Betriebe, totale Reform an die andere, aber das Ziel selbst bleibt unklar. «Kein Wind
Abschottung oder vollständige Liberalisierung – die Meinungen, in weht demjenigen günstig, der nicht weiss, wohin er segeln will», so
welche Richtung sich die Schweizer Landwirtschaft bewegen soll, ist es auch im Fall der Schweizer Landwirtschaft. Im Moment lassen
liegen weit auseinander. Dies nicht nur in Kreisen, die mit der Land- sich alle eingangs beschriebenen Wunschvorstellungen ausmachen,
wirtschaft keine Berührungspunkte haben. Vielmehr gibt es auch mal zieht uns die Politik in die Richtung Bioland Schweiz (Stichwort
innerhalb der Bauernschaft unterschiedliche Vorstellungen. Bauern Qualitätsstrategie), mal Richtung Konzentration und internationale
sind nicht gleich Bauern. Wir haben Bergbauern, die mit viel Einsatz Wettbewerbsfähigkeit (Stichwort Freihandelsabkommen Landwirt-
und Handarbeit unwegsames Gelände bewirtschaften, Gemüsebau- schaft mit der EU).
ern mit Dutzenden von Angestellten oder Bauern, die mit Straussen,
Bisons und anderem neue Wege eingeschlagen haben – jeder Betrieb Der Schweizerische Bauernverband hat seine Meinung gemacht:
ist anders. Es gibt sie nicht, DIE Schweizer Landwirtschaft. Stattdes- Unsere Schwäche ist gleichzeitig unsere Stärke. Sie heisst Vielfalt.
sen ist im Verlauf der stürmischen letzten Jahre eine enorme Vielfalt Wir setzen uns dafür ein, dass unsere Landwirtschaft so vielfältig
gewachsen, angepasst an die Vielfalt der Schweiz selber. Dennoch bleibt wie die Schweiz selbst. Gerade diese Mannigfaltigkeit macht
haben wir mit diesem Bericht den Versuch gewagt und eine Charak- uns agil und reaktionsfähig und damit fit für die Zukunft. Die nachhal-
terisierung der Schweizer Landwirtschaft vorgenommen. Sie zeigt tige Versorgung mit ausreichend, sicheren Lebensmitteln wird eine
Mittelwer te und weniger die individuelle Realität. Noch weniger der grössten weltweiten Herausforderungen der nächsten Jahre sein.
beantwortet sie die Frage, wohin sich die Schweizer Landwirtschaft Das ist so sicher wie das Amen in der Kirche. Dann benötigen wir
entwickeln soll. Dazu haben wir vier Vergleichsgrössen herange- eine vielfältige Landwirtschaft, die ein möglichst breites Spektrum
zogen: Baden-Württemberg und Österreich, die uns ähnlich sind, an Lebensmitteln produziert. Dieses Ziel haben wir uns gesetzt. Wir
und Dänemark sowie die französische Provinz Eure-et-Loir, die einen würden uns wünschen, dass sich Politik und Verwaltung anschliessen
Gegensatz zu uns darstellen. und wir zusammen das Schiff auf Kurs halten.
Aus diesem Vergleich lassen sich drei mögliche Wege für uns ablei-
ten: Nebenerwerbslandwirtschaft, Wachstum und Rationalisierung
sowie die bewusste Erhaltung einer abwechslungsreichen, mul-
tifunktionalen Landwir tschaft. Der erste und zweite Weg gehen
Hansjörg Walter Jacques Bourgeois
wahrscheinlich einher: im Talgebiet Wachstum, in den Randgebieten Präsident Direktor
Nebenerwerb. Alles ist möglich, wir müssten nur wissen, was wir Schweizerischer Bauernverband Schweizerischer BauernverbandZusammenfassung
7
Dieser Situationsbericht besteht aus drei Landwirtschaft ging um 5% auf 10,7 Milliar- wir tschaftliche Struktur und Produktion
Elementen: Der Teil A schilder t die Pro- den Franken zurück. Die Nettowertschöp- unterscheidet sich von Kanton zu Kanton. So
duktions- und die Marktsituation des Land- fung verringerte sich gar um rund 22% auf dominieren im Wallis vor allem kleine, oft
wir tschaftsjahrs 2009. Der Teil B widmet 1,8 Milliarden Franken. intensive Nebenerwerbsbetriebe, im Jura
sich der aktuellen wirtschaftlichen Lage der dagegen grosse, extensive Vollerwerbsbe-
Landwirtschaft respektive den Einkommen Im wir tschaftlich erfolgreicheren Vorjahr triebe. Nicht wegzureden ist die Tatsache,
der Bauernfamilien im Vorjahr. Der dritte 2008 stieg der Produktionswert der Land- dass die Schweiz ein Grasland ist. Wiesen
Teil stellt die aktuelle Schweizer Landwirt- wirtschaft noch um 2,6% . Das wirkte sich machen 70% unserer landwir tschaftlichen
schaft und Varianten zur Weiterentwicklung positiv auf den Arbeitsverdienst pro Fami- Nutzfläche aus. Einen besonderen Stellen-
vor. Ein spezielles Augenmerk gilt dabei den lienarbeitskraft aus. Das mittlere landwirt- wer t haben entsprechend die Produktion
Errungenschaften in der Ökologie und dem schaftliche Einkommen erhöhte sich im Jahr von Milch und ihre Verarbeitung zu Käse.
Tierschutz sowie der Eigenversorgung (Kapi- 2008 um 4,9% und lag damit auf einem ähn- So erstaunt es nicht, dass Milchprodukte die
tel C1). Es folgen im Kapitel C2 Kurzpräsen- lichen Niveau wie im ausgezeichneten Jahr einzigen Landwirtschaftsgüter mit einer posi-
tationen über die Landwirtschaft in Ländern/ 2000. Das landwirtschaftliche Einkommen tiven Handelsbilanz sind. Mit einem Selbst-
Regionen, die der Schweiz ähnlich sind, sowie nahm in der Talregion um 7,9% und in der versorgungsgrad von 58% müssen wir einen
solchen, die sich mit unseren Verhältnissen Hügelregion um 5,9% zu. In der Bergregion bedeutenden Teil unseres Bedarfs importie-
nicht vergleichen lassen. Im letzten Kapitel ging es dagegen um 2,9% zurück. Grund für ren, meist aus dem EU-Raum. Der Vergleich
(C3) schliesslich fliessen die beiden vorhe- den Anstieg des Produktionswerts war ins- mit ähnlichen (Österreich und das Bundes-
rigen Teile zusammen und erlauben so eine besondere das einträgliche Resultat in der land Baden-Württemberg) und unterschied-
Beurteilung, wo die Schweizer Landwirtschaft Tierhaltung (guter Milch- und Schweine- lichen Landwirtschaften (Dänemark und die
im Vergleich mit anderen steht und in welche fleischpreis). Dennoch blieben die Einkom- französische Provinz Eure-et-Loir) zeigt vor
Richtung es in Zukunft gehen könnte. men in der Landwir tschaft im Erfolgsjahr allem eines: Die Schweiz hat nach wie vor
2008 weit unter den entsprechenden Ver- einen bemerkenswert hohen Anteil an Voll-
Das Jahr 2009 zeichnete sich durch sinken- gleichseinkommen ausserhalb der Landwirt- erwerbsbetrieben und die Wertschöpfung,
de Erlöse in der pflanzlichen und tierischen schaft. Im Hügel- und Berggebiet verdiente welche die Schweizer Bauern pro Fläche
Produktion aus. Die Ursache dafür waren die man in der Landwirtschaft im Schnitt halb so erbringen, lässt die ausländischen Grossbe-
erntebedingte Marktsituation auf der einen viel wie in der restlichen Wirtschaft. triebe im Schatten stehen. Trotz anspruchs-
und agrarpolitische Entscheide auf der ande- vollen topografischen Voraussetzungen und
ren Seite. Das feuchtwarme Wetter brachte Der Schwerpunkt dieses Situationsberichts einem hohen Kostenumfeld steht die Schwei-
reihenweise Grossernten im Pflanzenbau, charakterisiert die heutige Schweizer Land- zer Landwirtschaft immer mehr mit ausländi-
was die Produzentenpreise drückte. Die wirtschaft und deren jüngste Entwicklungen. schen Betrieben in direkter Konkurrenz. Der
Aufhebung der Milchkontingentierung, die Anfang der 1990er-Jahre setzte eine grundle- Vergleich mit den ausgewählten Beispielen
Reduktion des Grenzschutzes beim Getrei- gende Reform der Schweizer Landwirtschaft im Ausland zeigt, dass sich grundsätzlich drei
de, die Anpassung des Zuckerpreises auf das ein. Die Agrarpolitik wurde konsequent auf Optionen für die Weiterentwicklung anbie-
Weltmarktniveau und weitere Folgen der eine nachhaltige und tierfreundliche Produk- ten: Richtung Nebenerwerbslandwirtschaft,
letzten Agrarreform erhöhten den Druck tion ausgerichtet. Der damit verbundene Richtung Wachstum und Rationalisierung
zusätzlich. Insbesondere der Milchpreis fiel Strukturwandel wirkte sich besonders stark oder wir bleiben auf dem eingeschlagenen
von November 2008 bis im Sommer 2009 auf Betriebe mit einer Fläche von weniger Schweizer Weg. Was wollen wir? Was wollen
um fast 20 Rappen pro Liter Milch, was zu als 20 Hektaren aus. Überproportional unter Sie, die diesen Bericht am Lesen sind? Wer
existenziellen Einbussen auf den Milchbetrie- Druck geraten ist auch die Acker f läche. sich noch nicht sicher ist, dem sei empfohlen,
ben führte. Die Wirtschafts- und Milchkrise Neben der Grösse ist der Viehbestand das den Teil C vertieft zu studieren.
liess das Schlachtviehangebot steigen und wichtigste Merkmal dafür, ob ein Betrieb als
die Preise sinken. Der Produktionswert der Vollerwerb ausreicht oder nicht. Die land-8
9 Teil A Teil B Teil C Teil D
Teil A: Produktions- und Markt-
10 verhältnisse im Jahr 2009
Das Jahr 2009 zeichnete sich insgesamt durch Hagelschläge vielen Betrieben einen Strich der Westschweiz nass und trüb. Der April
sinkende Erlöse in der pflanzlichen und tie- durch die Rechnung. Die Umsetzung der war landesweit deutlich zu warm (Abb. 1)
rischen Produktion aus: Das feucht-warme agrarpolitischen Reformen führte zudem zu und brachte je nach Landesgegend unter-
Wetter nach dem har ten Winter brachte tieferen Erlösen. Der Produktionswert der schiedliches Wetter: Auf der Alpennordsei-
reihenweise Grossernten im Pflanzenbau Landwirtschaft sank um 5% auf 10,729 Mil- te war es sonnig und trocken, im Süden zu
(zumindest dort, wo der Hagel nicht gewü- liarden Franken. Die Nettowertschöpfung trüb und im Oberwallis nass. Der Mai zeig-
tet hatte), der grosse Preisdruck bei vielen ging gar um rund 22,0% auf 1,815 Milliarden te sich zu Monatsbeginn wechselhaft und
Produk ten schmäler te jedoch das wir t- Franken zurück. kühl mit Schnee bis auf 1000 Meter über
schaftliche Resultat stark. Insbesondere der Meer. Ab dem 7. Mai herrschte eine schon
Milchpreis fiel von November 2008 bis im fast hochsommerliche Wärme mit über
Sommer 2009 um fast 20 Rappen pro Kilo A1 30 Grad Celsius im Mittelland. Ein heftiger
Milch, was zu existenziellen Einbussen auf D I E L A N D W I R T S C H A F T- Gewittersturm mit Hagel fegte am 26. Mai
den Milchbetrieben führte. Die Wirtschafts- LICHE PRODUKTION über die Schweiz und zog eine Spur verwüs-
und die Milchkrise führten dazu, dass auch IM JAHR 2009 teter Felder hinter sich her. In rund 1500
beim Schlachtvieh das Angebot stieg und Beeren-, Gemüse-, Obst- und Ackerparzel-
die Preise sanken. Einzig die Geflügel- und Der Sommer kam im August len entstand ein Schaden von 10 Millionen
Eierbranche konnte sich über ein weiteres Der Winter 2008/2009 verdiente für ein- Franken. Im Juni war es ebenfalls überdurch-
gutes Jahr freuen. Die Erträge in den Futter-, mal seinen Namen: Er war deutlich schnee- schnittlich warm und sonnig, aber mit häu-
Acker-, Obst- und Gemüsekulturen waren reicher und kälter als in den letzten Jahren. figen und intensiven Gewitterregen. Im Juli
ausserordentlich gut, allerdings machten die Der März präsentier te sich dafür wärmer war es in der ganzen Schweiz warm, aber
vielen Sommergewitter und einzelne heftige als im langjährigen Mittel und mit Ausnahme oft trüb und nass. Schwülwarme subtropi-
Abbildung 1: Das Jahr startete sehr kalt, erst im April wurde es warm.
Lufttemperatur als Monatsmittel auf Basis von 7 Mittellandstationen; Quelle: Meteo Schweiz.
2005 2006 2007 2008 2009
25
20
Monatsmittel in °C
15
10
5
0
–5
Jan Feb Mrz Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez11
sche Luft und feuchte Polarluft wechselten so weit fortgeschritten, um mit dem Heuet Obwohl zum Teil in den von Hagel betrof-
sich ab, was heftige Gewitter auslöste. Am zu beginnen. Mai und Juni brachten genug fenen Gebieten grosse Verluste verzeichnet
23. Juli verursachte ein halbstündiger Hagel- Sonne, um im Tal die Heu- und Emdernte wurden, konnten die übrigen Regionen mit
zug mit Hagelkörnern bis vier Zentimeter trocken unter Dach zu bringen. Das zwar guten bis sehr guten Erträgen kompensie-
Durchmesser verheerende Schäden an wüchsige, aber sehr oft regnerische, feucht- ren. Zur Produktionssteigerung trug auch
landwirtschaftlichen Kulturen im Mittelland. warme Juli-Wetter ohne stabile Hochdruck- die Flächenzunahme um 3000 Hektaren auf
Erst der August brachte stabiles Hochdruck- lagen verlangte von den Bauern für die Ernte gut 84 000 Hektaren bei. Die Futterweizen-
wetter und Temperaturen gegen oder über des Silograses, des Heus und des Emds viel produktion betrug rund 80 000 Tonnen, was
30 Grad Celsius. Der Herbst präsentierte Organisationstalent. Das regnerische, war- eine markante Reduktion gegenüber dem
sich sehr trocken, sonnig und mild, aber mit me Sommerwetter liess Gras und Mais aber Vorjahr von 25% bedeutet. Um den Inland-
bereits kühlen Nächten (Abb. 2). Mitte üppig wachsen. Die Heustöcke und Scheu- bedarf zu decken, mussten grossen Mengen
Oktober sackten die Temperaturen ab und nen waren im Herbst gut gefüllt und bereit importiert werden. Die Gerstenprodukti-
es gab Schnee bis in tiefe Lagen. für einen langen Winter. Dies auch im Bünd- on verzeichnet gegenüber dem Vorjahr eine
nerland, das die letzten Jahre schmerzhaft Abnahme von rund 2% und erreicht rund
Genug Futter für unter Sommertrockenheit und Futterman- 200 000 Tonnen. Die guten Erträge konnten
einen langen Winter gel gelitten hatte. den Flächenrückgang in den meisten Regio-
Ab Anfang April weidete das Vieh auf den nen ausgleichen.
Weiden und im Mai begann im Tal die Fut- Ein Viertel weniger Futterweizen
terernte. Dieses früh geschnittene Heu war 433 000 Tonnen mahlfähiger Brotweizen, Sehr gute Rapserträge
qualitativ das beste. In den höheren Lagen so die Bilanz 2009. Dies entsprach einer In den vom Hagel verschonten Regionen
war das Graswachstum im Mai noch nicht Zunahme von 4% gegenüber dem Vorjahr. waren die Hektarerträge meistens gut bis
Abbildung 2: Viel Sonne führte zu negativer Wasserbilanz im August und September.
Wasserbilanz (Niederschläge minus Verdunstung) auf Basis von 7 Mittellandstationen; Quelle: Meteo Schweiz.
2005 2006 2007 2008 2009
200
150
Wasserbilanz in mm
100
50
0
–50
–100
Jan Feb Mrz Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez12
sehr gut und lagen klar über denjenigen te führte jedoch dazu, dass nebst den Früh- Nach Rekordernte wiederum
des Vorjahrs. Die gesamte Rapsproduk- kartoffeln auch Lagersorten denaturiert und hohe Zuckerrübenernte
tion betrug rund 67 000 Tonnen. Gegen- in der Frischverfütterung eingesetzt werden Der frühe Saatzeitpunkt und die optimalen
über dem letzten Jahr entspricht dies einer mussten. Wachstumsbedingungen führ ten zu einer
Zunahme von 14% , was angesichts der stei- raschen Jugendentwicklung, wobei bereits
genden Nachfrage im Lebensmittelsektor Die Bedingungen während der Ernte waren Ende Mai die Reihen geschlossen waren.
eine positive Entwicklung ist. aufgrund der lang anhaltenden Trockenheit Nach zwei sehr guten Ernten in den letzten
nicht überall ideal, was zu Schlagschäden beiden Jahren war 2009 wiederum mit einer
Trockenheit führte führte und dazu, dass einzelne Posten nicht Rekordernte zu rechnen. Erwar tet wurde
bei Kartoffeln zu Schlagschäden übernommen wurden. Ansonsten war die ein Rübenertrag über 75 Tonnen pro Hekta-
Er freulicher weise ging die Kar toffelan- Qualität sehr gut. Nur vereinzelt kam es zu re mit einem Zuckergehalt von 18,2% , insge-
baufläche erstmals seit 2003 nicht weiter Schäden durch Drahtwürmer und Schne- samt also eine Zuckerproduktion von über
zurück (Abb. 3). Sie betrug 11 124 Hekt- cken, Pulverschorf oder Wachstumsrisse. 269 000 Tonnen. Aufgrund der drei aufein-
aren, gut 60 Hektaren mehr als im Vorjahr. Bei den Biokar toffeln lagen die Bruttoer- anderfolgenden Grossernten beschloss die
Durch die guten Wachstumsbedingungen träge ebenfalls höher als üblich, die Quali- Branche, die Quote für 2010 um 9,5% zu
lagen die Er träge rund einen Drittel über tät war jedoch weniger erfreulich. Vor allem kürzen.
dem Durchschnitt der letzten fünf Jahre. die Sorte Agria wies einen hohen Anteil an
Die Anzahl Knollen pro Pflanze war zwar Buckel- und Pulverschorf auf. Erfreuliche Gemüsemengen
gering, deren Kaliber aber umso grösser. Kar- Das milde und wüchsige Wetter im Herbst
toffeln in Raclettegrösse gab es nur halb so 2008 sowie die ausbleibenden Fröste führ-
viele wie in anderen Jahren. Die grosse Ern- ten zur Rekordernten beim Lagergemüse.
Dank dem langen und kalten Winter konnte
Abbildung 3: Sinkende Preise liessen die Kartoffelproduktion stetig zurückgehen. Verwend- dieses gut abgesetzt werden. Die Gemüse-
bare Gesamternte und gewichteter Preis für Speisekartoffeln gemäss Produzentenpreisindex. Quelle: SBV. anbauflächen 2009 waren konstant und ent-
sprachen jenen des Vorjahrs. Ab Mitte April
Kartoffeln (inkl. Saatgut) Preis Speisekartoffeln
2009 herrschten optimale Wachstumsbedin-
850 000 60
gungen für die Gemüsekulturen, was gegen-
Verwendbare Gesamternte in Tonnen
800 000 58 über 2008 zu grösseren Frischgemüseernten
750 000 56 führte. Die Preise hingegen lagen unter dem
Vorjahresniveau. Dies war einerseits die Fol-
Franken / 100 Kilos
700 000 54
ge der hohen Mengen, andererseits drückten
650 000 52 die Abnehmer den Preis. Die Zwiebelernte
endete mit sehr guten Erträgen. Auch das
600 000 50
übrige Lagergemüse entwickelte sich präch-
550 000 48 tig und es ist mit einer sehr guten Versorgung
500 000 46 für den kommenden Winter zu rechnen.
450 000 44 Viel Obst: grösste Birnenernte
400 000 42 seit 20 Jahren
Die Obstproduzenten ernteten über 50%
350 000 40
mehr Tafelkirschen als im Durchschnitt der
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
letzten zehn Jahre. Alle Kirschen der Klassen13
Extra und Premium konnten problemlos ver- Ernte sowohl in Bezug auf Menge wie Qua- mehr über 6.80 Franken für T3-Tiere und
marktet werden, die restlichen litten unter lität äusserst vielversprechend aus. Der starteten daher auch rund 80 Rappen tie-
den zahlreichen Gewittern und Absatzprob- Zuckergehalt war generell gut, der Säu- fer ins laufende Jahr. Die Preise blieben bis
lemen. Dank zeitlicher Staffelung und optima- regehalt eventuell etwas tief. Die Zeichen in die zweite Hälfte April auf knapp 6.70
ler Qualität wurden bis Mitte August 5300 standen gut, um den Weinjahrgang 2009 zu Franken. Ende April erhöhte sich das Ange-
Tonnen Walliser Aprikosen über den Handel einem grossen Erfolg werden zu lassen. bot markant und die Preise gaben entspre-
vermarktet, die doppelte Menge der letzten chend nach. Da 2009 erstmals der Stichtag
zwölf Jahre. Auch bei den Zwetschgen konn- Hohe Umsätze beim Nutzvieh wegfiel, ist dieser Effekt wohl auf die Situ-
te ein Viertel mehr geerntet werden als im Der Nutzviehmarkt 2009 lief mit hohen ation auf dem Milchmarkt und die Aufhe-
Vorjahr. Die Erträge liegen jedoch tiefer als im Umsatzzahlen gut. Im ersten Halbjahr war bung der Kontingentierung im Mai zurück-
Rekordjahr 2007. Die diesjährige Apfelernte die Anzahl expor tier ter Nutztiere etwa zuführen. Anschliessend stabilisier te sich
fiel um 4,3% über dem Mittel der letzten gleich wie im Vorjahr. Die Preise für Milch- der Markt wieder und die Preise blieben
vier Jahre aus. Allerdings eigneten sich infolge kühe waren bis Mai rückläufig bei hohem bis August bei knapp 6.90 Franken je Kilo
von Hagelschäden rund 10% der hängenden Angebot. Ab Juni zogen die Preise wieder Schlachtgewicht für T3-Kühe. Höhere Prei-
Ernte nur noch für die Verarbeitung. Inge- an. Der Juli war saisonbedingt ruhig, jedoch se wurden von den Schlachthöfen trotz der
samt werden 102 900 Tonnen verkäufliche mit guten Durchschnittspreisen von 3115 guten Nachfrage nicht bezahlt.
Tafeläpfel erwartet, was dem Wert des Vor- Franken für Milchkühe. An den ersten Auk-
jahrs entspricht. Bei den Tafelbirnen wurde tionen zeichnete sich auch für den August 10% weniger Lohn
mit 28 632 Tonnen die reichste Ernte seit 20 ein gutes Preisniveau ab. Allerdings ist das für Bankviehmäster
Jahren geschätzt. Die verkäufliche Menge an Angebot gestiegen und es hat viele milch- Die Bankviehmäster erzielten einen rund
Tafelbirnen lag bei 19 400 Tonnen und war betonte Kühe auf dem Markt. 10% tieferen Verkaufserlös als im Vorjahr.
mehr als doppelt so hoch wie im Vorjahr. Ende 2008 waren die Preise stark unter
Schlachtviehmarkt allgemein: Druck gekommen und sanken auf knapp 8.10
Vielversprechende hohe Angebote Franken je Kilo Schlachtgewicht für T3-Muni.
Weintraubenernte In der ersten Jahreshälfte war der Schlacht- Dank einer Marktentlastungsmassnahme
Der lange und kalte Winter verzögerte die viehmarkt geprägt von der Übersättigung der Proviande konnte der Markt noch vor
Entwicklung der Reben im Frühling. Einige auf dem Milchmarkt (Anh. 1). Es wurde Weihnachten abgeräumt werden und war
warme Tage um Pfingsten liessen die Pflan- rund 10% mehr Grossvieh geschlachtet als dank steigender Nachfrage ab Mitte Januar
zen aber einen Vegetationssprung nach vor- in derselben Vorjahresperiode. Die Preise wieder ausgeglichen. Bis Ende Juli blieb der
ne machen. Die Reben trieben rasch aus und lagen bis Mitte August in allen Kategorien Markt stabil, abgesehen von einem leichten
es gab eine frühe Blüte. Die Ostschweiz war um rund 10% unter den Preisen von 2008. Druck im März/April, was aber für diese
im Mai zwei Mal von Hagel betroffen. Auch Jahreszeit nicht ungewöhnlich ist. Nachdem
heftige Winde setzten dieser Region zu. Im Tiefere Preise für Schlachtkühe die Alpen bestossen waren und dadurch das
Juli kam es in der Region «La Côte» und spe- trotz guter Nachfrage Angebot an Rindern deutlich kleiner wurde,
ziell um Morges zu heftigen Hagelschlägen, Die Zunahme der Schlachtungen war beim stiegen die Rinderpreise ab Mai langsam an.
welche die Reben stark schädigten. Ansons- Verarbeitungsvieh besonders markant. Bis Ende Juli zogen saisongemäss auch die Muni-
ten war das trockene, mit Bise durchsetzte Ende Juli wurden 19% mehr Kühe geschlach- preise wieder an.
Wetter für das Wachstum gesunder Reben tet als im Jahr zuvor. Obwohl der Markt das
ideal. Offiziell begann die Traubenernte um grössere Angebot meist problemlos auf- Unruhiger Kälbermarkt
den 21. September, mit einem Vorsprung nahm, waren die Preise deutlich tiefer. Nach Der Bankkälbermarkt verlief sehr unruhig.
gegenüber dem Mittel der Jahre von vier- der Preisanpassung durch die Schlachthöfe Schon kleine Änderungen in der Marktsi-
zehn Tagen. Zu diesem Zeitpunkt sah die im Herbst 2008 stiegen die Preise nicht tuation hatten meist Preisänderungen zur14
Folge. Am höchsten waren die Preise in der frage war schlecht und der Verkauf stock- Ferkel
ersten Kalenderwoche mit 15.71 Franken je te. Glücklicherweise normalisierte sich der Der Jagermarkt verlief zu Beginn des Jah-
Kilo Schlachtgewicht. Im Vorjahr war dieses Absatz wieder, sodass ab Mitte März wieder res erfreulich und die Preise lagen beinahe
Niveau nie erreicht worden. Doch schon ab ein Preis von 4.80 Franken je Kilo Schlacht- auf dem Niveau des Vorjahrs. Saisongemäss
Mitte Januar stieg das Angebot, während die gewicht bezahlt wurde. Der Import von Teil- stieg die Preiskurve bis April an. Dann dreh-
Nachfrage sank. In der Folge brachen die stücken aus der EU blieb durch den grossen te der Markt, die Nachfrage nahm ab, wäh-
Preise innerhalb von wenigen Wochen auf Preisunterschied weiterhin attraktiv. Diese rend das Angebot grösser wurde. Bis Ende
unter 13 Franken ein. Die Osterschlachtun- konkurrenzierten das inländische Schweine- August waren stets Überhänge vorhanden
gen brachten eine kurze Erholung. Zwischen fleisch im Billigsegment und in der Gastro- und die preisliche Talsohle war noch nicht
Mitte April und Mitte Juni waren jedoch Ent- nomie. Leider fiel der Beginn der Grillzeit erreicht.
lastungsmassnahmen nötig, um den Markt mit den ersten Meldungen zur neuen Grip-
zu stabilisieren. Die Preise lagen im Schnitt pe zusammen. Die Konsumenten waren ver- Weniger Lämmer geschlachtet
mehr als 1.30 Franken tiefer als im Vorjahr. unsichert. Dazu kam das schlechte Wetter Auch die Schlachtlämmer lösten einen rund
Die Schlachtzahlen waren Anfang Jahr noch zu Beginn des Sommers, sodass statt eines 10% geringeren Preis, obwohl die Schlach-
tiefer als 2008, im dritten Quartal hingegen Preisaufschlags einige Wochen sogar ein tungen deutlich kleiner waren. Die Preise
wurden 6% mehr Kälber geschlachtet. Gleich- tieferer Preis bezahlt wurde. Ab Ende Juni lagen bis Mitte August zirka einen Franken
zeitig stiegen die Schlachtgewichte an. erhöhte sich der Druck aufgrund des höhe- unter dem Vorjahresniveau. Am meisten
ren Angebots und eines Absatzes, der die Bewegung zeigte der Markt wie üblich vor
Schlachtschweine Erwartungen nicht erfüllte. Die Preise zer- Ostern. Sobald sich das Angebot durch die
Gleich zu Beginn des Jahres f ielen die fielen bis im Oktober auf 3.70 Franken je Kilo Alpung verringer te, stiegen die Preise an
Schweinepreise ab (Abb. 4). Die Nach- Schlachtgewicht. und lagen ab Mai sehr stabil bei 11.00 Fran-
ken je Kilo Schlachtgewicht für T3-Lämmer.
Abbildung 4: Der Schweinepreis schwankt stark. 2009 war kein gutes Jahr. Mit der Rückkehr von der Alpung kamen die
Produzentenpreise in Franken pro Kilo Lebendgewicht für Jager und Schlachtschweine. Quelle: Proviande, SBV. Preise sehr stark unter Druck.
Ferkel SGD-A 20 kg Schweine QM ab Stall
Schweizer Poulets sehr gefragt
10.00 6.00
Schlachtschweine QM in Franken / Kilo SG
Die inländische Pouletproduktion lief 2008
und im ersten Halbjahr 2009 auf Hochtou-
9.00 5.50
ren. Der Pro-Kopf-Konsum an Gef lügel-
Ferkel in Franken / Kilo LG
fleisch war sehr gut und erreichte 2008 einen
8.00 5.00
neuen Höchststand von 17 Kilo Schlachtge-
wicht bzw. von 10,9 Kilo verkaufsfer tigem
7.00 4.50 Fleisch. Die Anzahl der auf Schweizer Mast-
betrieben eingestallten Küken erhöhte sich
6.00 4.00 im ersten Halbjahr 2009 um weitere 3,6%
und die Ställe waren ausgelastet. Einige
5.00 3.50 Vermarktungsorganisationen suchen sogar
neue Betriebe. Die Geflügel-Importe waren
4.00 3.00 im ersten Halbjahr 2009 leicht rückläufig,
was auf einen leichten Anstieg des Inland-
3.00 2.50 anteils hoffen lässt. Anfang und Mitte 2009
2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 fand zudem eine Reduktion der Futterpreise15
statt, was sich positiv auf die Produktions- zudem über die vermehrte Verwendung von renden Mechanismus zur Mengensteuerung
kosten im Inland auswirkte. billigeren Ersatzprodukten in der Lebensmit- gefunden hatte. Auch das Projekt, auf Pro-
telbranche (z. B. Analogkäse) gesenkt. Der duzentenseite einen Milchpool zu gründen,
Erneut stabiler Eiermarkt Milchpreis ging daraufhin weltweit drastisch hatte nicht realisier t werden können. Die
Die Schweizer Eierproduktion umfasste im zurück. Wegen der immer stärkeren Ver- Diskussionen und Verhandlungen zwischen
Jahr 2008 rund 686 Millionen Stück und lag flechtung mit dem Ausland – insbesondere und innerhalb von Produzenten und Abneh-
damit 2,4% über dem Vorjahr. Bis Ende des über den Käseexport – kamen zwangsläu- mern gestalteten sich weiterhin schwierig.
Jahres 2009 zeigt die auf Grund der Küken- fig auch die Schweizer Produzentenpreise Am 29. Juni 2009 wurde deshalb in Bern
einstallungen erstellte Produktionsprognose für Milch ab Herbst 2008 zunehmend unter unter Federführung des SBV die Branchen-
eine weitere Mehrproduktion von rund 6% Druck und wurden schliesslich im Oktober organisation Milch mit Nationalrat Hansjörg
gegenüber 2008 an. Trotz dieser Produkti- ein erstes Mal gesenkt. Die Milchproduktion Walter als Interimspräsidenten gegründet.
onsausdehnung war der Markt vor allem zu blieb aber auf dem hohen Niveau bestehen, Die Organisation umfasst gut 50 Mitglie-
den absatzstarken Zeiten eher knapp mit weshalb sich Anfang 2009 der Zerfall der der, welche den grössten Teil der Schwei-
Schweizer Eiern versorgt – eine Situation, Preise fortsetzte und diese unter das Niveau zer Milchproduktion abdecken. Durch den
die den Eiermarkt seit Ende 2006 prägt. von 2007 fielen (Abb. 5). Ab August war paritätischen Aufbau der Gremien wurde
Auch die Eiermengen, die im Rahmen der auf den internationalen Märkten eine gewis- eine ausgewogene Vertretung der Interes-
alljährlichen Marktentlastungsmassnahmen se Erholung zu beobachten. sen der ganzen Branche gewährleistet. Am
im Sommer aufgeschlagen und zu Eiproduk- 10. Juli 2009 legte die Branchenorganisation
ten verarbeitet werden, waren auch im Som- Es rächte sich, dass die Branche vor Ende der erstmals einen Richtpreis fest. Dieser soll-
mer 09 vergleichsweise gering. Der Import Milchkontingentierung keinen funktionie- te für die Periode Juli bis September und
von Schaleneiern lag im ersten Halbjahr 2009
leicht unter dem Vorjahr – auch das könnte
Abbildung 5: Der Milchpreis war im Juli 2009 20 Rappen tiefer als im Jahr zuvor.
ein Hinweis sein, dass ein Teil des Mehrbe-
Realisierter Produzentenpreis für Industriemilch in Rappen pro Kilo Milch. Quelle: BLW.
darfs mit Schweizer Eiern gedeckt wurde.
2005 2006 2007 2008 2009
Ende der Milchkontingentierung 86
Am 1. Mai 2009 ging die Zeit der Milch- 84
kontingentierung in der Schweiz definitiv zu 82
Ende. Der grösste Teil der Milchlieferanten 80
war jedoch bereits vorher aus der Milchkon-
Rappen pro Kilo Milch
78
tingentierung ausgestiegen und die Milch-
76
produktion stieg 2008 aufgrund der grossen
74
Nachfrage gegenüber dem Vorjahr um 5% ,
72
von 3,233 Millionen Tonnen auf 3,396 Millio-
nen Tonnen. Im Jahr 2009 ging die Milchpro- 70
duktion auf diesem hohen Niveau weiter. 68
Allerdings hatte sich inzwischen das Umfeld 66
radikal veränder t: Im Herbst 2008 hat- 64
te die Finanz- und Wirtschaftskrise einge- 62
setzt. Zusammen mit dem weltweit hohen 60
Preisniveau führte dies zu einem Rückgang 58
der Nachfrage. Der Milchverbrauch wurde Jan Feb Mrz Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez16
für 90% der Industriemilch gelten. Mit 61,6 bei Getreide wurde reduziert. Dies führte terproduktion wurde wie in den zwei Vor-
Rappen pro Kilo (franko Verarbeiter) wur- zu wesentlich tieferen Getreidepreisen. Der jahren durch die idealen Wetterverhältnisse
de der Milchpreis damit auf tiefem Niveau Wer t der Getreideernte 2009 lag 14,5% begünstigt. So konnte der grössere Rind-
vorerst stabilisiert. unter jenem im Vorjahr. Der Zuckerpreis viehbestand mit genügend Futter versorgt
wurde auf Weltmarktniveau gesenkt und die werden. Wegen des guten Futterbaujahrs
Die Situation in der Milchbranche zeigte Produzentenpreise für Zuckerrüben sack- und der teilweise leicht höheren Preise wer-
einmal mehr, dass bescheidene Überschüs- ten ab. Die Anbaubeiträge für Ölfrüchte und den höhere Kosten für die innerbetrieblich
se bei Landwirtschaftsprodukten den Preis Körnerleguminosen wurden reduziert. Die er zeugten Futtermittel er war tet. Diese
übermässig nach unten drücken. Wenn die Exportsubventionen für Mostobstprodukte Position ist eine Gegenbuchung aus dem
Milchmenge nicht den Absatzmöglichkeiten und die Beiträge für die Überschussverwer- Produktionswert.
angepasst wird, drohen Verhältnisse wie in tung bei den Kartoffeln fielen weg und die
der Schweineproduktion, wo sich das Ange- jeweiligen Branchen nahmen die Marktstüt- Die Preise für Erdöler zeugnisse sanken
bot und die Preise zyklisch auf und ab bewe- zung mit einem Rückbehalt auf die Preise gegenüber den Vorjahren wesentlich, sodass
gen. selber in die Hand. viele Vorleistungen günstiger wurden. Die
Position Energie und Schmierstoffe sank im
Trotz den idealen Witterungsverhältnissen, Vergleich zum Vorjahr um 14,3% . Nach der
A2 die zu guten Ernten führten, wies der pflanz- sehr starken Teuerung der Düngemittel im
D I E L A N D W I R T- liche Produktionswert aufgrund der geän- Jahre 2008 gaben die Preise teilweise wie-
SCHAFTLICHE der ten Rahmenbedingungen im Vergleich der nach. Im Vorjahr wurde mengenmässig
GESAMTRECHNUNG zum Vorjahr ein Minus von 1,8% aus. Die wesentlich weniger Ware zugekauft, und
tierische Produktion musste gar ein Minus eine deutliche Zurückhaltung wurde noch
Der Produktionswer t der Landwir tschaft von 8,9% verkraften. im ersten Semester 2009 beobachtet. Der
betrug im Jahre 2009 gemäss Schätzung Nachholbedarf erhöhte die Ausgaben für
des Bundesamts für Statistik 10,729 Milliar- Die Einnahmen aus der Erzeugung landwirt- Düngemittel gegenüber dem Vorjahr. Der
den Franken. Das sind rund 5% weniger als schaftlicher Dienstleistungen, wie Lohnar- Bedar f an tierärztlichen Leistungen und
im Vorjahr. Davon stammten 47,7% aus der beiten für Dritte (z. B. Saat und Ernte), und Medikamenten blieb hoch, da die Tierbe-
tierischen und 42,8% aus der pflanzlichen der Wer t der nicht trennbaren nichtland- stände bereits im Jahr 2008 angestiegen sind.
Produktion. Die restlichen 9,5% brachten wirtschaftlichen Nebentätigkeiten, wie die Das schlechte Landwirtschaftsjahr führte zu
die landwir tschaftlichen Dienstleistungen Verarbeitung von Mostobst, Fleisch oder einer gewissen Zurückhaltung der Landwirt-
und die nichtlandwirtschaftlichen Nebentä- Milch auf dem Hof oder Dienstleistungen, schaftsbetriebe gegenüber Zukäufen. Somit
tigkeiten ein (Tab. 1). wie Strassenrand- und Landschaftspflege, waren die Ausgaben für den Unterhalt der
die Haltung von Pensionstieren (Pferde) Maschinen und Gebäude nicht höher als im
Das Jahr 2009 war durch einschneidende sowie die Übernachtungen von Touristen Vorjahr.
Änderungen der Marktbedingungen, ausge- (Schlafen im Stroh), haben in den letzten
löst durch die Umsetzung der agrarpoliti- Jahren kontinuierlich etwas zugelegt. Die leicht tieferen Ausgaben für die Vorleis-
schen Reformen, gekennzeichnet. Die seit tungen (–1,0%) konnten die starke Abnah-
1977 eingeführ te Milchkontingentierung Die Ausgaben für Futtermittel waren tiefer me des Produktionswer tes der Landwir t-
wurde aufgehoben, was eine Ausdehnung als im Vorjahr. Der Zukauf von Futtermitteln schaft (–5,0 %) nicht auffangen. So sank
der Milchmenge und einen starken Preis- wurde mengenmässig höher, jedoch zu tie- die Bruttowertschöpfung im Jahr 2009 um
rückgang zur Folge hatte. Der Produktions- feren Preisen als im Vorjahr erwartet. Die 10,8% auf 4,112 Milliarden Franken.
wert der Milch fiel 2009 um rund 13,5% tie- Futtergetreidefläche ist weiterhin rückläufig.
fer aus als im Jahr zuvor. Der Grenzschutz Das führte zu Mehrimporten. Die Raufut-17 Da die Abschreibungen zu Anschaffungs- preisen (Wiederbeschaffungspreise) bewer- tet werden, spielt die Preisentwicklung der Investitionsgüter eine wichtige Rolle. In den letzten Jahren sind die Preise für Bauten und Ausrüstungen (Fahrzeuge und Maschinen) deutlich gestiegen. Obwohl die Neuinvestiti- onen mengenmässig eine sinkende Tendenz aufweisen, wird diese Entwicklung durch die steigenden Preise wenigstens teilweise kom- pensiert. Die Nettower tschöpfung sank um rund 22,0% auf 1,815 Milliarden Franken. Wer- den von diesem Wert weitere Produktions- kosten wie Löhne und Aufwendungen für die Pacht- und Bankzinsen abgezogen sowie die Transferzahlungen an die Landwirtschaft dazugezählt, gelangt man zum Nettounter- nehmenseinkommen. Dieses belief sich im Jahr 2009 auf 2,869 Milliarden Franken. Das entspricht einer Abnahme gegenüber dem Vorjahr von 7,6% . Kaufkraftbereinigt ging das Nettounternehmenseinkommen von 2000 bis 2009 um 2,5% pro Jahr oder total um 22,1% zurück.
18
Tabelle 1: Der Produktionswert der Landwirtschaft ging 2009 um rund 5% auf 10,729 Milliarden Franken zurück.
Landwirtschaftliche Gesamtrechnung (2000 – 2009), gerundet auf Millionen Franken. Quellen: BfS, SBV.
Veränderung in %
b b c
2000 – 2009 2000 – 2009 2008 – 2009
a
Rubrik 2000 2005 2008 2009 (Periode) (jährlich) (jährlich)
Produktionskonto
Getreide 620 448 459 393 -41,5 -4,6 -14,5
davon: Weizen, Roggen 361 263 302 257 -34,4 -3,8 -15,0
Handelsgewächse 263 285 317 248 -12,8 -1,4 -21,7
davon: Ölsaaten und Ölfrüchte 66 88 111 75 6,2 0,7 -32,0
Zuckerrüben 166 155 168 146 -18,7 -2,1 -13,2
Futterpflanzen 1 351 1 348 1 253 1 280 -12,4 -1,4 2,2
davon: Futtermais 164 171 187 188 5,6 0,6 0,1
Erzeugnisse des Gemüse- und Gartenbaus 1 332 1 270 1 421 1 410 -2,2 -0,2 -0,8
davon: Frischgemüse 468 530 588 563 11,0 1,2 -4,3
Pflanzen und Blumen 864 740 834 848 -9,3 -1,0 1,7
Kartoffeln 207 177 184 173 -22,8 -2,5 -6,0
Obst 643 496 539 563 -19,1 -2,1 4,4
davon: Frischobst 365 283 305 319 -19,4 -2,2 4,5
Weintrauben 278 214 234 245 -18,7 -2,1 4,3
Wein 438 413 459 478 0,9 0,1 4,2
Total pflanzliche Erzeugung 4 883 4 466 4 676 4 589 -13,1 -1,5 -1,8
Tiere 2 529 2 425 2 752 2 601 -5,0 -0,6 -5,5
davon: Rinder 1 190 1 177 1 299 1 212 -5,9 -0,7 -6,7
Schweine 1 083 975 1158 1087 -7,3 -0,8 -6,2
Geflügel 183 206 229 240 21,4 2,4 4,8
Tierische Erzeugnisse 2 753 2 524 2 870 2 522 -15,4 -1,7 -12,1
davon: Milch 2 569 2 336 2 678 2 316 -16,6 -1,8 -13,5
Eier 178 180 185 194 0,8 0,1 5,2
Total tierische Erzeugung 5 283 4 949 5 621 5 122 -10,4 -1,2 -8,9
Erzeugung landwirtschaftlicher Dienstleistungen 560 638 650 664 9,6 1,1 2,1
Nichtlandwirtschaftliche Nebentätigkeiten
(nicht trennbar) 358 294 347 353 -8,9 -1,0 1,9
davon: Verarbeitung landwirtschaftlicher Erzeugnisse 187 194 214 215 6,3 0,7 0,3
Gesamttotal Erzeugung des
landwirtschaftlichen Wirtschaftsbereichs (a) 11 084 10 347 11 294 10 729 -10,5 -1,2 -5,0
a Schätzung b in % , Rubrik zu laufenden Preisen mit LIK (Mai 2000 = 100) kaufkraftbereinigt c in % , zu laufenden Preisen19
Tabelle 1 (Fortsetzung)
Veränderung in %
b b c
2000 – 2009 2000 – 2009 2008 – 2009
a
Rubrik 2000 2005 2008 2009 (Periode) (jährlich) (jährlich)
Produktionskonto
Gesamttotal Erzeugung des
landwirtschaftlichen Wirtschaftsbereichs (a) 11 084 10 347 11 294 10 729 -10,5 -1,2 -5,0
Vorleistungen insgesamt (b) 6 254 6 264 6 683 6 617 -2,2 -0,2 -1,0
davon: Saat- und Pflanzgut 343 304 345 354 -4,5 -0,5 2,6
Energie; Schmierstoffe 402 433 512 439 0,9 0,1 -14,3
Dünge- und Bodenverbesserungsmittel 142 184 203 212 38,3 4,3 4,4
Pflanzenbehandlungs- und
Schädlingsbekämpfungsmittel 133 126 124 128 -10,8 -1,2 3,4
Tierarzt und Medikamente 161 181 216 222 27,7 3,1 3,1
Futtermittel 2 873 2 675 2 776 2 724 -12,4 -1,4 -1,9
Instandhaltung von Maschinen und Geräten 381 462 503 485 17,9 2,0 -3,4
Instandhaltung von baulichen Anlagen 121 189 195 195 49,4 5,5 0,2
Landwirtschaftliche Dienstleistungen 560 638 650 664 9,6 1,1 2,1
Bruttowertschöpfung zu
Herstellungspreisen (c=a–b) 4 830 4 083 4 611 4 112 -21,3 -2,4 -10,8
Abschreibungen (d) 1 989 2 155 2 283 2 297 6,7 0,7 0,6
davon: Ausrüstungsgüter 1 009 1 077 1 141 1 190 8,9 1,0 4,3
Bauten 872 954 1 009 975 3,4 0,4 -3,3
Nettowertschöpfung zu Herstellungspreisen (e=c–d) 2 842 1 929 2 328 1 815 -41,0 -4,6 -22,0
Arbeitnehmerentgelt (f) 1 166 1 193 1 276 1 278 1,3 0,1 0,2
Sonstige Produktionsabgaben (g) 107 141 138 145 25,7 2,9 5,5
Sonstige Subventionen (h) 2 220 2 571 2 655 2 895 20,5 2,3 9,0
Faktoreinkommen (i=e–g+h) 4 955 4 359 4 845 4 565 -14,9 -1,7 -5,8
Nettobetriebsüberschuss /
Selbstständigeneinkommen (j=e–f–g+h) 3 788 3 165 3 569 3 286 -19,8 -2,2 -7,9
Unternehmensgewinnkonto
Gezahlte Pachten (k) 209 201 202 203 -10,5 -1,2 0,2
Gezahlte Zinsen (l) 212 211 279 228 -0,6 -0,1 -18,3
Empfangene Zinsen (m) 35 11 18 13 -66,8 -7,4 -28,5
Nettounternehmenseinkommen (n=j–k–l+m) 3 403 2 764 3 106 2 869 -22,1 -2,5 -7,6
Elemente des Vermögensbildungskontos
Bruttoanlageinvestitionen (o) 1 658 1 535 1 590 1 609 -10,3 -1,1 1,2
Nettoanlageinvestitionen (p=o–d) -331 -620 -693 -688
Bestandesveränderungen 21 30 96 40
Vermögenstransfers 106 104 114 111 -3,8 -0,4 -3,3
Netto-Kompensation der MWSt -54 -73 -74 -79
a Schätzung b in % , Rubrik zu laufenden Preisen mit LIK (Mai 2000 = 100) kaufkraftbereinigt c in % , zu laufenden Preisen20
21 Teil A Teil B Teil C Teil D
Teil B: Einkommenssituation der
22 landwirtschaftlichen Betriebe
Die landwirtschaftliche Gesamtrechnung im Die Einkommenssituation kann anhand des B1
Teil A2 stellt die wirtschaftlichen Ergebnis- landwir tschaftlichen Einkommens in den B E U RT E I L U N G D E S
se der Landwir tschaft in einem volkswir t- Buchhaltungen der Zentralen Auswertung ARBEITSVERDIENSTES
schaftlichen Kontext dar. Teil B richtet sein der ART Tänikon analysiert werden (siehe
Augenmerk auf die wirtschaftliche Situation Kasten). Dieses erhält man, wenn von der Zur Beurteilung des Arbeitsverdienstes in
der einzelnen Landwirtschaftsbetriebe, aus- totalen Rohleistung eines Betriebes sämtli- der Landwir tschaft ziehen wir die beiden
gehend von deren Buchhaltungsergebnis- che Fremdkosten in Abzug gebracht wer- Kenngrössen Arbeitsverdienst je Familien-
sen. Ein Vergleich des landwirtschaftlichen den. Zur Beurteilung der Einkommenssitua- arbeitskraft aus der Zentralen Auswertung
Arbeitsverdienstes mit dem statistischen tion muss die Frage gestellt werden: Reicht und das vom Bundesamt für Statistik (BfS)
Vergleichseinkommen zeigt, dass Landwir- das landwirtschaftliche Einkommen aus, um er fasste regionale Vergleichseinkommen
te nach wie vor zwischen 30% (Talgebiet) familieneigene Arbeitskräfte und das ein- heran. Der Arbeitsverdienst der Familienar-
und 60% (Berggebiet) weniger verdienen als gesetzte Kapital zu entschädigen? Für die beitskräfte wird berechnet, indem man vom
die übrige Bevölkerung – dies auch in den Antwort ist man auf kalkulatorische Grös- landwirtschaftlichen Einkommen den kalku-
beiden überdurchschnittlichen Jahren 2007 sen angewiesen. Bei diesen kalkulatorischen latorischen Zinsanspruch für das Eigenkapi-
und 2008. Die Kapitalrendite ist so tief, dass Grössen handelt es sich um den Lohnan- tal in Abzug bringt. Der Zinsanspruch sollte
viele Betriebe die Kosten nur dank einem spruch für die Familienarbeit oder den Zins- dem Ertrag entsprechen, den man für lang-
grossen Anteil unverzinslicher Darlehen und anspruch für das eingesetzte Kapital. fristige, konservative Anlagen ausserhalb des
privatem Konsumverzicht tragen können. eigenen Betriebes erwarten dürfte. Die ART
setzt in der zentralen Auswertung für den
Einkommensbeurteilung mit Daten der Zentralen Auswertung Zinsanspruch des Eigenkapitals den Kassa-
Die Zentrale Buchhaltungsauswertung ist eines der wichtigsten Instrumente zur Beur- zinssatz für Bundesobligationen mit 10 Jah-
teilung der wirtschaftlichen Situation in der Landwirtschaft. In ihr werden von der For- ren Laufzeit ein. Für das Jahr 2008 betrug
schungsanstalt AGROSCOPE ART Tänikon jährlich die Buchhaltungsabschlüsse von etwa dieser Satz für Bundesobligationen 2,93% 1.
3300 sogenannten Referenzbetrieben ausgewertet und die Ergebnisse meist in Form von Während der Arbeitsverdienst der Fami-
Mittelwerten für alle Betriebe und auch für Betriebsgruppen mit definierten Merkmalen lienarbeitskräfte den Verdienst für alle auf
präsentiert. Die Gruppierung für die Auswertung beruht auf der Zuordnung jedes Refe- dem Betrieb beschäftigten nicht entlöhnten
renzbetriebes zu einem definierten Betriebstyp, zu einer bestimmten Flächenklasse und Familienarbeitskräfte repräsentier t, setzt
einer Region (Tal, Hügel, Berg). Die von der ART publizierten Mittelwerte des Arbeits- der Arbeitsverdienst je Familienarbeitskraft
verdienstes, die für den Einkommensvergleich mit der übrigen Bevölkerung herangezogen diese Grösse ins Verhältnis zu den auf dem
werden, sind gewichtete Mittelwerte. Bei der Aggregation der Resultate erhält jeder Betrieb beschäftigten Familienarbeitskräften.
einzelne Betrieb ein Gewicht gemäss seiner Repräsentativität in der Grundgesamtheit. Damit ist er eine geeignete Grösse, um sie
Die Gewichte für den einzelnen Betrieb leiten sich aus Grösse des Betriebes und weiteren mit dem Lohn eines Arbeitnehmers ausser-
Kriterien zur Gruppierung der Betriebe ab. In diesem Bericht verwenden wir für den Ein- halb der Landwirtschaft zu vergleichen.
kommensvergleich zwischen Landwirtschaft und übriger Bevölkerung Medianwerte, nicht
zuletzt deshalb, weil es sich auch bei den Vergleichseinkommen um Medianwerte handelt. Das Bundesamt für Statistik berechnet in der
Der Median ist ein statistischer Lageparameter und bezeichnet im Fall von Einkommen Lohnstrukturerhebung jährlich Vergleichs-
einen Wert, sodass jeweils die Hälfte der gewichteten Betriebe ein tieferes beziehungs- löhne von Arbeitnehmern ausserhalb der
weise ein höheres Einkommen ausweisen. Da Einkommensverteilungen normalerweise Landwirtschaft für die Regionen Tal-, Hügel-
schief sind, eignet sich der Median besser für Vergleiche als das arithmetische Mittel. Der
Median für den Arbeitsverdienst je Familienarbeitskraft liegt im Jahr 2008 etwa 3000
1 Quelle: Schweizerische Nationalbank (http://
Franken tiefer als das arithmetische Mittel. www.snb.ch/de/iabout/stat/statpub/akziwe/stats/
akziwe). Siehe auch Tabelle 2 auf Seite 24.23
und Bergregion. Es liefert damit eine wichtige stärker zugenommen als derjenige in der wird die Freude über diese Verbesserung im
Referenzgrösse zur Beurteilung der landwirt- übrigen Wirtschaft, Letzteres gilt jedoch nur gegenwärtigen Zeitpunkt von düsteren Aus-
schaftlichen Einkommenssituation, wie sie im für die Tal- und die Hügelregion. Angesichts sichten getrübt. Heute ist bereits absehbar,
Landwirtschaftsgesetz Art 5. vorgesehen ist: der gewaltigen Einkommensunterschiede dass die Betriebsergebnisse für 2009 diesen
«Mit den Massnahmen dieses Gesetzes wird zwischen der Landwirtschaft und der übri- gewünschten Aufholtrend nicht fortsetzen
angestrebt, dass nachhaltig wirtschaftende gen Bevölkerung kann diese Verbesserung werden. Waren die landwir tschaftlichen
und ökonomisch leistungsfähige Betriebe im jedoch nur als ein bescheidener Schritt in die Abschlüsse der Jahre 2007 und 2008 noch
Durchschnitt mehrerer Jahre Einkommen richtige Richtung gewertet werden. Weiter von guten Er trägen und insbesondere im
erzielen können, die mit den Einkommen
der übrigen erwerbstätigen Bevölkerung in Abbildung 6: Entwicklung des Arbeitsverdienstes je Familienarbeitskraft
der Region vergleichbar sind.» und des Vergleichslohnes vom Bundesamt für Statistik zu Preisen 2008.
Vergleich pro Jahr und Region für die Jahre 2000 bis 2008 (Median, inflationsbereinigt mit
Abbildung 6 stellt die Entwicklung des dem Landesindex der Konsumentenpreise [2008=100]). Quellen: BfS, ART Tänikon.
Arbeitsverdienstes pro Familienarbeitskraft
Tal: Arbeitsverdienst Hügel: Arbeitsverdienst Berg: Arbeitsverdienst
in der Landwir tschaft derjenigen des Ver- pro Familienarbeitskraft pro Familienarbeitskraft pro Familienarbeitskraft
gleichslohnes des Bundesamts für Statistik
Tal: Vergleichseinkommen Hügel: Vergleichseinkommen Berg: Vergleichseinkommen
gegenüber. Gewisse Unterschiede zwischen
beiden Gruppen gilt es dabei zu berück- 80 000
sichtigen im Wissen, dass der Vergleich
Franken pro Familienarbeitskraft
zwischen Lohnempfängern und Landwirten 70 000
als Unternehmern nicht ganz unproblema-
tisch ist. Landwirte profitieren im Vergleich 60 000
mit der übrigen Bevölkerung im Allgemei-
50 000
nen von günstigerem Wohnraum, kurzen
Arbeitswegen und einer gewissen Selbst-
40 000
versorgung mit Nahrungsmitteln; auf der
anderen Seite nehmen sie längere Arbeits- 30 000
und Präsenzzeiten, stärkere Schwankungen
im Arbeitsauf kommen und ein höheres 20 000
Unternehmensrisiko als ein durchschnittli-
cher Lohnempfänger in Kauf. 10 000
Die Zahlen machen eklatante Unterschiede 0
sichtbar. Ein Bauer im Talgebiet verdient rund 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008
30 % weniger als ein ähnlich qualifizier ter 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008
Arbeiter in anderen Branchen. Im Berggebiet Tal: AVFAK Landwirtschaft
a
48 483 37 336 38 371 45 300 50 803 43 444 40 693 47 612 50 668
ist die Lage mit einem Lohnunterschied von Tal: Vergleichseinkommen 69 263 70 928 71 713 71 916 71 977 71 882 71 903 72 817 72 561
a
60% noch unbefriedigender. Die landwirt- Hügel: AVFAK Landwirtschaft 36 068 28 686 27 607 32 764 36 248 33 226 32 434 34 014 36 325
schaftlichen Einkommen schwanken von Jahr Hügel: Vergleichseinkommen 62 527 65 576 66 302 66 391 66 447 65 778 65 797 66 085 65 854
a
zu Jahr wesentlich stärker als die Vergleichs- Berg: AVFAK Landwirtschaft 24 884 19 920 19 643 26 391 26 768 28 001 25 261 27 205 24 292
löhne. Im Trend der letzten acht Jahre hat Berg: Vergleichseinkommen 58 495 59 376 60 033 60 543 60 594 60 672 60 690 61 665 61 448
der Verdienst in der Landwirtschaft etwas a AVFAK: Arbeitsverdienst pro Familienarbeitskraft24
tierischen Bereich ansprechenden Absatz- Entwicklung der durchschnittlichen Eigenka- jahresschnitt von 2005 bis 2008 schafften sie
preisen geprägt, so stellt sich unterdessen pitalrentabilität in der Zentralen Auswertung eine leicht positive Jahresgesamtkapitalren-
die Situation auf vielen Märkten wesentlich seit 2000. tabilität von 0,6% . Vergleicht man diese mit
unfreundlicher dar. Speziell gilt dies für den der durchschnittlichen Rendite von Bundes-
für die Schweiz wichtigen Milchsektor: 2009 Mit der Gesamtkapitalrentabilität wird ge- obligationen, kann nicht einmal dieses beste
können hier weder die Mengen noch die messen, wie das gesamte eingesetzte Kapi- Ergebnis aller Betriebstypen befriedigen. Alle
Preise der vorangehenden Jahre realisier t tal (also das Eigen- und das Fremdkapital) anderen an der ART Tänikon analysierten
werden. entschädigt wird. Auch dies ist eine kalku- Betriebstypen wiesen während dieser Jah-
latorische Grösse. Die Gesamtkapitalren- re negative und zum Teil deutlich negative
tabilität setzt den betrieblichen Reinertrag Gesamtkapitalrentabilitätsraten aus. Die
B2 ins Verhältnis zu den gesamten Aktiven des Finanzierung mit Fremdkapital zu marktüb-
R E N TA B I L I T Ä T Betriebes. Als Benchmark für die Gesamt- lichen Zinsen ist also für einen Grossteil der
VO N E I G E N - U N D kapitalrentabilität kann die Rendite konser- Betriebe nicht möglich, sofern gleichzeitig
G E S A M T K A P I TA L vativer, langfristiger Investitionen ausserhalb Eigenkapital und eigene Arbeit angemessen
der Landwirtschaft herangezogen werden. entschädigt werden sollen. Diese Feststel-
Die Kenngrösse Arbeitsverdienst je Fami- Die Gesamtkapitalrentabilität sollte positiv lung unterstreicht die grosse Bedeutung
lienarbeitskraf t beschreibt, wie gut die sein, weil sonst ein Kapitalverzehr stattfindet. zinsfreier Investitionskredite aus dem Struk-
unternehmerische Tätigkeit den Produkti- Im Durchschnitt der landwirtschaftlichen Be- turförderungsfond des Bundes und zinsgüns-
onsfaktor «eigene Arbeit» entgelten kann, triebe sind sowohl die Eigen- als auch die Ge- tiger Darlehen aus dem Familienkreis für den
nachdem das eigene Kapital (kalkulatorisch) samtkapitalrentabilität seit Jahren negativ. grössten Teil der Betriebe.
angemessen entschädigt wurde. Analog kann
die Rentabilitätsfrage auch für den Produk- Im überdurchschnittlich guten Jahr 2007
tionsfaktor «eigenes Kapital» gestellt wer- erreichten nur 29% der Betriebe eine posi- B3
den. Die Eigenkapitalrentabilität gibt an, zu tive Gesamtkapitalrentabilität, 2006 waren FA Z I T
welchem Zinssatz sich das eigene im Betrieb es 24% . Betriebe der Talregion weisen mit
eingesetzte Kapital verzinsen lässt, nachdem – 0,8 % Gesamtkapitalrentabilität für die Die Einkommenssituation in der Landwirt-
der kalkulierte Lohnanspruch für die eige- Jahre 2005 bis 2008 etwas bessere Werte schaft ist ungenügend. Die meisten Betriebe
ne Arbeit gedeckt ist. Die Vergleichslöhne aus als die Betriebe der anderen Regionen erwir tschaften weder ein mit der übrigen
des Bundesamts für Statistik bieten sich als (–2,6% Hügel-, –4,7% Bergregion). Bei der Bevölkerung vergleichbares Einkommen,
Referenz für den Lohnanspruch der Fami- Gliederung nach Betriebstypen schneiden noch kann das eigene, im Betrieb angelegte
lienarbeitskräfte an. Tabelle 2 zeigt die die Ackerbaubetriebe am besten ab. Im Vier- Kapital zu marktüblichen Zinsen entschädigt
Tabelle 2: Entwicklung der Eigenkapitalrentabilität und der Gesamtkapitalrentabilität 2000 bis 2008.
Quellen: Zentrale Auswertung ART Tänikon, Lohnstrukturerhebung BfS, Schweizerische Nationalbank.
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2000/08
Eigenkapitalrentabilität % -3,2 -6,8 -7,0 -5,9 -4,7 -6,2 -6,6 -4,8 -4,4 -5,5
Gesamtkapitalrentabilität % -0,6 -2,7 -2,4 -2,3 -1,6 -2,5 -2,7 -1,7 -1,4 -2,0
Referenzzinssatza % 3,9 3,4 3,2 2,6 2,7 2,1 2,5 2,9 2,9 2,9
Bezahlter Zins für Fremdkapitalb % 2,7 2,8 2,8 2,3 2,1 2,1 2,0 2,1 2,2 2,4
a Kassazinssätze für Obligationen der Eidgenossenschaft, Laufzeit 10 Jahre (http://www.snb.ch/de/iabout/stat/statpub/akziwe/stats/akziwe).
b Der effektiv bezahlte Zinssatz für Fremdkapital wird aus den Buchhaltungsergebnissen der ZA berechnet: Schuldzinsen / Fremdkapital.Sie können auch lesen