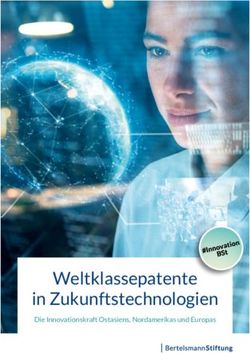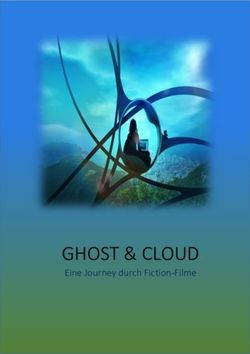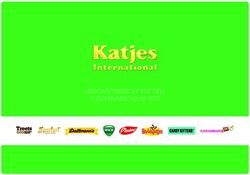Die Bereitstellung der Schnellladeinfrastruktur für die Elektromobilität in Deutschland - Eine ökonomisch-juristische Analyse zentraler Frage...
←
→
Transkription von Seiteninhalten
Wenn Ihr Browser die Seite nicht korrekt rendert, bitte, lesen Sie den Inhalt der Seite unten
IKEM Working Paper
Die Bereitstellung der
S chnellladeinfrastruktur für die
Elektromobilität in Deutschland
Eine ökonomisch-juristische Analyse zentraler Frage-
stellungen und alternativer Organisationsmodelle
1 2019 Beckers | Gizzi | Hermes | WeißIKEM Working Paper: Die Bereitstellung der S
chnellladeinfrastruktur für die Elektromobilität in Deutschland
IKEM Working Paper Nr. 1
Die Bereitstellung der Schnellladeinfrastruktur
für die Elektromobilität in Deutschland
Eine ökonomisch-juristische Analyse zentraler Frage-
stellungen und alternativer Organisationsmodelle
Prof. Dr. Thorsten Beckers
Dr. Florian Gizzi
Prof. Dr. Georg Hermes
Dr. Holger Weiß, LL.M.
Diese Studie ist im Rahmen des vom Bundesministerium
für Verkehr und Digitale Infrastruktur (BMVI) beauftragten Projektes
„Rechtliche Rahmenbedingungen für ein integriertes Energiekonzept
2050 und die Einbindung von EE-Kraftstoffen“ erstellt worden.
Zitiervorschlag:
Beckers, Thorsten; Gizzi, Florian; Hermes, Georg; Weiß, Holger: Die Bereitstellung der Schnell-
ladeinfrastruktur für die Elektromobilität in Deutschland – Eine ökonomisch-juristische Analyse
zentraler Fragestellungen und alternativer Organisationsmodelle. IKEM Working Paper, 2019.
September 2019
IKEM – Institut für Klimaschutz, Energie und Mobilität e.V.
Magazinstraße 15-16 +49 (0) 30 408 18 70-10
10179 Berlin info@ikem.de
Weitere Informationen zu Projekten und Publikationen des IKEM unter www.ikem.de
IIKEM Working Paper: Die Bereitstellung der S
chnellladeinfrastruktur für die Elektromobilität in Deutschland
Inhaltsverzeichnis
Vorbemerkungen 1
1. Einleitung 2
2. Grundlagen 5
2.1. Grundlegende institutionenökonomische Erkenntnisse als
Grundlage für die Analyse von (Politik- und Regulierungs-)Eingriffen 5
2.2. Idealtypische Nachfragearten sowie Angebotsarten und Angebotskonzepte 9
3. Grundzüge eines Soll-Angebotskonzeptes unter Berücksichtigung von
Finanzierungsaspekten aus ökonomischer Sicht 12
4. Ökonomische und juristische Analyse von vier alternativen (Organisations-)Modellen
ohne Berücksichtigung von Pfadabhängigkeiten 16
4.1. Unregulierte Marktwirtschaft (mit mehr oder weniger Wettbewerb) 16
4.2. (Zentrale) Bereitstellung durch eine Bundesgesellschaft und
Vertragslösungen mit privaten Akteuren bei der Umsetzung 21
4.3. (Zentrale) öffentliche Bereitstellung sowie Rückgriff auf Vertragslösungen
mit privaten Akteuren bei Umsetzung durch Bund und Länder 41
4.4. Wettbewerbs-Modell mit umfassender zentraler Regulierung 46
4.5. Fazit 52
5. Einordnung des Status quo 54
6. Ersteinschätzungen aus ökonomischer und juristischer Sicht zu den betrachteten
Organisationsmodellen bei Berücksichtigung von Pfadabhängigkeiten 56
6.1. Ökonomische Analyse grundsätzlicher Fragestellungen
bezüglich der Implikationen von Pfadabhängigkeiten 56
6.2. Juristische Analyse bezüglich der betrachteten Organisationsmodelle 59
6.3. Fazit 63
7. Literaturverzeichnis 68
IIIKEM Working Paper: Die Bereitstellung der S
chnellladeinfrastruktur für die Elektromobilität in Deutschland
Vorbemerkungen
Dieses Working Paper basiert auf einer Studie, die im Rah- so ist dieser Sachverhalt bei der Veröffentlichung kenntlich
men des vom Bundesministerium für Verkehr und digitale zu machen.“) erklären diejenigen Autoren der vorliegenden
Infrastruktur (BMVI) beauftragten Projekts „Rechtliche Studie, die Mitglied des Vereins für Socialpolitik sind bzw.
Rahmenbedingungen für ein integriertes Energiekonzept als Ökonomen tätig sind und damit einhergehend sich dem
2050 und die Einbindung von EE-Kraftstoffen“ erstellt wor- Ethikkodex des Vereins für Socialpolitik verpflichtet fühlen,
den ist. Dieses Projekt ist unter anderem von Becker Büttner Folgendes:
Held (BBH, als Hauptauftragnehmer) und dem Institut für
Klimaschutz, Energie und Mobilität e.V. (IKEM, als ein – Da die Vertragstexte den Autoren dieser (im Endef-
Unterauftragnehmer von BBH) bearbeitet worden. An der fekt) im Auftrag des BMVI erstellten Studie keine
vorliegenden Studie haben neben dem IKEM (und seinen Veröffentlichungsrechte zugestanden haben, bedürfen
Unterauftragnehmern in diesem Projekt) auch die Kanzlei Veröffentlichungen grundsätzlich der Zustimmung
W2K und Prof. Dr. Georg Hermes (als weitere Unterauftrag- des BMVI. Es ist jedoch – ohne an dieser Stelle eine
nehmer des IKEM) mitgewirkt. detaillierte (informations-)rechtliche Analyse durch-
führen zu können – davon auszugehen, dass nach dem
Da die Studie vom IKEM und dessen Unterauftragnehmern Informationsfreiheitsgesetz des Bundes (IFG) eine
verantwortet wurde, erfolgt nun eine Zweitveröffentlichung Zugänglichkeit zu dieser Studie ohnehin gegeben und
als IKEM Working Paper. infolgedessen eine Verbreitung auch ohne eine Zustim-
mung des BMVI möglich wäre. Dies ist seit längerem
Für die ökonomischen Analysen in der vorliegenden Studie bekannt und somit für Autoren zu antizipieren.
sind Prof. Dr. Thorsten Beckers und Dr. Florian Gizzi verant-
wortlich. Dr. Holger Weiß (Kanzlei W2K) und Prof. Dr. Ge- – Die Darstellungen und Aussagen in dieser Studie
org Hermes haben die juristischen Analysen durchgeführt.1 basieren vollständig auf den Analysen der Autoren
Die ökonomischen Analysen basieren – und dabei an einigen und werden von diesen vollumfänglich vertreten.
Stellen auch wortgleich – auf Beckers / Gizzi / Kreft / Hilde-
brandt (2015), Hildebrandt (2016) und Reinke (2014) sowie Im Übrigen können Angaben gemäß Punkt II.4 des Ethikko-
Gizzi / Kreft / Beckers (2018). Diese Vorarbeiten werden in dexes des Vereins für Socialpolitik („In wissenschaftlichen
der vorliegenden Studie regelmäßig nicht gesondert zitiert. Arbeiten sind Sachverhalte zu benennen, die auch nur
Die ökonomischen Analysen sind im September 2018 abge- potentiell zu Interessenskonflikten oder Befangenheit des
schlossen worden und empirische Erkenntnisse konnten in Autors/der Autorin führen könnten.“) den persönlichen
diesem Zusammenhang in den entsprechenden Abschnitten Homepage-Seiten derjenigen entnommen werden, die Mit-
nur bis August 2018 berücksichtigt werden. glied des Vereins für Socialpolitik sind bzw. als Ökonomen
tätig sind und damit einhergehend sich dem Ethikkodex
Vor dem Hintergrund der Regelungen in Punkt II. 7 des des Vereins für Socialpolitik verpflichtet fühlen (siehe ht-
Ethikkodexes des Vereins für Socialpolitik („Darf eine wis- tps://www.wip.tu-berlin.de/menue/kontakt_mitarbeiter/
senschaftliche Arbeit, ein Bericht oder ein Gutachten nicht prof_dr_thorsten_beckers/, https://www.wip.tu-berlin.de/
ohne vorherige Einwilligung Dritter veröffentlicht werden, menue/kontakt_mitarbeiterinnen/florian_gizzi/).
1 Die Autoren dieser Studie danken Johannes Pallasch (NOW GmbH) und Dr. Roman Ringwald (Kanzlei BBH) für kritische Anmerkungen und
konstruktive Hinweise hinsichtlich der in dieser Studie durchgeführten Analysen im Rahmen gemeinsamer Diskussionen.
1IKEM Working Paper: Die Bereitstellung der S
chnellladeinfrastruktur für die Elektromobilität in Deutschland
1. Einleitung
Bedeutung der Ladeinfrastruktur, vorliegende effektive Berücksichtigung von Nutzerpräferenzen und eine
ökonomische Forschungserkenntnisse Erhöhung der Effizienz bei der Bereitstellung von Ladeinfra-
und Hinweise auf Reformbedarf struktur im Mittelpunkt stehen. In diesem Zusammenhang
Die Bereitstellung von Ladeinfrastruktur (LI) im öffent- dürfte u.a. der Erhöhung der Nutzerfreundlichkeit – oder
lichen Bereich im Allgemeinen und von Schnellladeinfra- anders formuliert einer Reduktion von Transaktionskosten
struktur im Speziellen, die in dieser Studie im Fokus steht, ist an der Schnittstelle zwischen den Unternehmen, die in die
für einen erfolgreichen Markthochlauf der Elektromobilität Ladeinfrastrukturbereitstellung involviert sind, und den
in Deutschland von hoher Bedeutung.2 Von der Bundesre- Nutzern – eine besondere Bedeutung zukommen.
gierung sind bereits vielfältige Maßnahmen, insbesondere
im Bereich der finanziellen Förderung aus Haushaltsmitteln, Fokus, Ziele und Zielsystem
getroffen worden, die für positive Impulse hinsichtlich des Konzepte zum Angebot von Ladeinfrastruktur, die auf die
Aufbaus der Ladeinfrastruktur sorgen sollen. Es gibt jedoch Nachfrage durch Nutzer rein batterieelektrischer Fahrzeuge
Hinweise darauf, dass die Bereitstellung von Ladeinfra- (Battery Electric Vehicle (BEV)) im Bereich des motorisier-
struktur in Deutschland im Allgemeinen und von Schnell- ten Individualverkehrs (MIV) ausgerichtet sind, können
ladeinfrastruktur im Speziellen aus Sicht von Nutzern und anhand verschiedener Kriterien systematisiert werden.
potentiellen Nutzern der Elektromobilität aktuell nur in ei- In diesem Kontext können folgende Arten von Ladeinfra-
ner suboptimalen und dabei auch ineffizienten Weise erfolgt. struktur unterschieden werden, die (auch) im öffentlichen
In diesem Kontext ist jüngst vom Bundesverkehrsministe- Bereich bereitgestellt werden:
rium (BMVI) u.a. entschieden worden, durch den Einsatz
eines so genannten „Standorttools“ die finanzielle Förderung – Tankstellen-Ladeinfrastruktur (T-LI): Zunächst ist
von Ladeinfrastruktur unter Berücksichtigung räumlicher die Schnellladeinfrastruktur zu nennen, die auf die
Aspekte zu reformieren. Damit greift die öffentliche Hand Gleichstrom (DC)-Technologie zurückgreift und in An-
nun (wenn auch nur indirekt) in die Standortplanung von lehnung an das von den konventionellen Kraftstoffen
Ladeinfrastruktur ein und überlässt diese nicht mehr aus- her bekannte Tankstellenkonzept bereitgestellt wird,
schließlich den im Wettbewerb stehenden Unternehmen weshalb sie vereinfach auch als „Tankstellen-Schnell-
und sonstigen Akteuren. ladeinfrastruktur“ oder „Tankstellen-Ladeinfrastruk-
tur“ (abgekürzt als „T-LI“) bezeichnet werden kann.
Vorliegende ökonomische Forschungsergebnisse – vgl. dazu
z.B. BECKERS ET AL. (2015) – deuten darauf hin, dass – Basis-Ladeinfrastruktur (B-LI): Im öffentlichen
durch weitere wirtschaftspolitische und regulatorische Straßenraum platzierte Normalladeinfrastruktur, die
Aktivitäten des Bundes – und damit durch eine Anpassung auf die Wechselstrom (AC)-Technologie zurückgreift,
der Rahmenbedingungen für die Aktivitäten privater Unter- stellt für einzelne Nutzer insofern eine „Basis-Ladein-
nehmen und weiterer relevanter Akteure (wie insbesondere frastruktur“ (abgekürzt als „B-LI“) dar, als sie das
Kommunen) – noch erhebliche Verbesserungen bei der regelmäßige Beladen des Fahrzeugs während einer
Bereitstellung der Ladeinfrastruktur möglich sein dürften. mehrmals wöchentlich (und dabei vielfach nahezu
Dabei sollten gemäß den vorliegenden Forschungsergebnis- täglich) vorliegenden längeren ohnehin anfallenden
sen – wie bereits bei der Anwendung des o.g. Standorttools Stand- und Parkzeit ermöglicht. Daher kann sie
vorgesehen – nicht unbedingt finanzielle Förderungen aus verkürzt auch als „öffentliche Basis-Ladeinfrastruktur“
dem Haushalt (bzw. zumindest keine zusätzlichen Förde- (abgekürzt als „ö-B-LI“) bezeichnet werden.
rungen), sondern vielmehr Maßnahmen im Hinblick auf eine
2 In diesem Papier wird die Bezeichnung „Elektromobilität“ in einem engen Sinne verwendet und nur auf rein batterieelektrische Fahrzeuge
bezogen. Elektromobilität im weiten Sinne beinhaltet zudem auch die Wasserstoffmobilität.
2IKEM Working Paper: Die Bereitstellung der S
chnellladeinfrastruktur für die Elektromobilität in Deutschland
– Ergänzungs-Ladeinfrastruktur (E-LI): Wenn Nutzer Vorgehen und Rückgriff auf vorliegende
Wegeketten „abfahren“, parken Fahrzeuge oftmals, Forschungserkenntnisse sowie wesentliche
und dabei besteht die Möglichkeit, entsprechend (Untersuchungs-)Grenzen dieser Studie
geeignet platzierte Ladeinfrastruktur quasi „nebenbei“ In dieser Studie greifen – wie vorstehend dargestellt – öko-
zu nutzen und zu laden. Hierauf ausgerichtete nomische und juristische Analysen ineinander. Bei den öko-
Ladeinfrastruktur kann die B-LI und die T-LI nomischen Analysen werden teilweise vornehmlich (Analy-
ergänzen und daher als „Ergänzungs-Ladeinfra- se-)Ergebnisse dargestellt, und dabei werden umfangreich
struktur“ (E-LI) bezeichnet werden. Durch E-LI in Beckers / Gizzi / Kreft / Hildebrandt (2015), Hildebrandt
kann ggf. die Nutzung von T-LI unterbleiben und (2016) und Reinke (2014) generierte Forschungsergebnisse
entsprechend Zeit eingespart werden. Bei E-LI berücksichtigt. Der Rückgriff auf grundlegende ökono-
können verschiedene Ladegeschwindigkeiten und mische Forschungserkenntnisse insbesondere aus den
damit einhergehend auch Ladetechnologien (AC 1 Bereichen der Wohlfahrts-, der Institutionen- sowie der In-
und AC 3 sowie auch DC) sinnvoll einsetzbar sein. dustrie- und dabei auch der Netzwerkökonomik sowie deren
Anwendung auf die sich aus den technisch-systemischen
In dieser Studie wird die Bereitstellung von öffentlich Besonderheiten der Elektromobilität im Allgemeinen und
zugänglicher Schnellladeinfrastruktur nach dem Tankstel- der Ladeinfrastruktur im Speziellen ergebenden konkreten
lenkonzept, also von „T-LI“, untersucht. Dabei werden für Fragestellungen erfolgt in diesem Kontext in dieser Studie
diese Ladeinfrastrukturart in dieser Studie mit Bezug zu oftmals lediglich implizit. Auf juristischer Seite werden
verschiedenen (Organisations-)Modellen für die Bereit- neben den verfassungsrechtlichen Fragestellungen im Be-
stellung („Bereitstellungsmodelle“) und die Umsetzung von reich des Unionsrechts vor allem beihilfe- und vereinzelt
Bereitstellungsentscheidungen („Umsetzungsmodelle“) auch wettbewerbsrechtliche Themen betrachtet sowie die
ökonomische und juristische Analysen durchgeführt. Ins- speziell für die Ladeinfrastrukturbereitstellung relevante
besondere wird für die verschiedenen betrachteten Modelle Richtlinie 2014/94/EU berücksichtigt.
untersucht, ob und inwieweit bestehende verfassungs- und
unionsrechtliche Regelungen eine „Sperrwirkung“ hin- Aufgrund von Ressourcenrestriktionen werden insbeson-
sichtlich der Implementierung dieser Modelle (und somit dere die folgenden Themengebiete und Aspekte in dieser
hinsichtlich entsprechender Reformen bei den rechtlichen Studie zur T-LI nicht untersucht bzw. allenfalls kurz ange-
Rahmenbedingungen und der Regulierung bezüglich T-LI) schnitten:
darstellen.3 Dabei wird insofern vornehmlich der Bund als
Adressat der Analysen angesehen, als Handlungsoptionen – Aktuelle Entwicklungen auf Seiten der Marktteil-
und vor allem gesetzgeberische Optionen auf Bundesebene nehmer, wie z.B. die kürzlich gestarteten Aktivitäten
im Fokus der Betrachtungen stehen. von Automobilherstellern bei der Bereitstellung
von (Schnell-)Ladeinfrastruktur, die dafür das
Das Zielsystem bei Bewertungen im Rahmen ökonomischer Unternehmen „IONITY“ gegründet haben.
Analysen umfasst zunächst das Ziel der grundsätzlich unter
Berücksichtigung der Präferenzen der Nutzer erfolgenden – Die Nutzung von LI durch Fahrzeuge, die nicht den Kfz
Bereitstellung von Ladeinfrastruktur. Ferner wird das Ziel des MIV zuzuordnen sind (wie Flottenfahrzeuge, Car
verfolgt, Bereitstellungsentscheidungen auf eine aus wohl- Sharing-Fahrzeuge und Taxis sowie Lkw und Busse).
fahrtsökonomischer Sicht vorteilhafte Weise umzusetzen
und dafür (Umsetzungs-)Modelle auszuwählen, die aus – Besonderheiten, die sich aus der Nutzung von
Sicht von Nutzern und Steuerzahlern als (kosten-)effizient LI durch Plug-in-Hybrid-Fahrzeuge (= Plug-in
anzusehen sind. Hybrid Electric Vehicle (PHEV)) ergeben.
3 Sich aus Investitionsschutzabkommen ergebende Fragestellungen werden in dieser Studie nicht berücksichtigt.
3IKEM Working Paper: Die Bereitstellung der S
chnellladeinfrastruktur für die Elektromobilität in Deutschland
Auf die Bereitstellung von T-LI speziell auf den Bundes- – In Kapitel 3 werden Grundzüge eines Soll-An-
fernstraßen und dort insbesondere auf verkonzessionierten gebotskonzeptes für T-LI herausgearbeitet, das
Tank- und Rastanlagen der Bundesautobahnen wird ledig- grundsätzliche Empfehlungen zur Ausgestaltung
lich kurz eingegangen. Die Auswirkungen von Pfadabhän- der Bereitstellung bzw. – anders formuliert – des
gigkeiten auf die Eignung von Reformmodellen bezüglich der Angebots von T-LI enthält und außerdem
Bereitstellung von T-LI werden thematisiert, aber bedürfen auf Finanzierungsoptionen hinweist.
(in besonderer Weise) noch vertiefter juristischer Analysen.
Auf Interdependenzen zwischen der Bereitstellung von T-LI – In Kapitel 4 werden anschließend alternative
und den weiteren Arten von Ladeinfrastruktur wird – ins- Organisationsmodelle aus ökonomischer und
besondere mit Bezug zur Bepreisung und der Ausgestaltung rechtlicher Perspektive untersucht, nach denen
von Nutzungsregeln – lediglich hingewiesen, diese werden Bereitstellungsentscheidungen gefällt und diese
jedoch nicht (vertieft) untersucht. Aufgrund des begrenzten dann umgesetzt werden können, wobei vom Status
Umfangs dieser Studie muss auch bei verschiedenen weite- quo abstrahiert wird und damit einhergehend auch
ren Fragestellungen auf vertieften Analysebedarf verwiesen Pfadabhängigkeiten ausgeklammert werden.
werden.
– In Kapitel 5 wird sodann der Status quo der Be-
Struktur dieser Studie reitstellung von Ladeinfrastruktur kurz dargestellt
Diese Studie ist wie folgt aufgebaut: und aus ökonomischer Sicht eingeordnet.
– Kapitel 2 enthält zunächst (in Abschnitt 2.1) grundle- – In Kapitel 6 werden kurz die Implikationen
gende Überlegungen bezüglich zentraler Aspekte bei von Pfadabhängigkeiten bezüglich der Eig-
institutionenökonomischen Analysen zur Anwendung nung der bereits in Kapitel 4 betrachteten
und Ausgestaltung wirtschaftspolitischer und Organisationsmodelle thematisiert.
regulatorischer Eingriffe, mit denen vom Ansatz einer
unregulierten Marktwirtschaft abgewichen wird und – In Kapitel 7 wird ein kurzes Fazit gezogen.
die (auch) für die Bereitstellung sowie die Umsetzung
der Bereitstellungsentscheidungen bei der Ladeinf-
rastruktur von Relevanz sind. Anschließend werden
(in Abschnitt 2.2) die Systematisierung der Nachfrage
nach und des Angebots von Ladeinfrastruktur (aus-
führlicher als in dieser Einleitung) thematisiert.
4IKEM Working Paper: Die Bereitstellung der S
chnellladeinfrastruktur für die Elektromobilität in Deutschland
2. Grundlagen
2.1. Grundlegende institutionenökonomische (formaler mikro-)ökonomischer Modelle zu einer effizienten
Erkenntnisse als Grundlage für die Analyse Ressourcenallokation. Auch wenn diesen ökonomischen
von (Politik- und Regulierungs-) Modellen auf sehr vielen unrealistischen Annahmen basie-
Eingriffen ren, dürften sie dennoch auf relevante Aspekte der Koor-
dination in einer Marktwirtschaft und der Vorteile dieser
2.1.1. Institutionenökonomische (Grundsatz-) Koordination hinweisen. JENSEN / MECKLING (1995), die
Frage des angemessenen Umfangs öffentlicher dabei (Vor-)Arbeiten in HAYEK (1945) aufgreifen, zeigen
(Politik- und Regulierungs-)Eingriffe mit auf einfachen Modellierungen basierenden Überlegun-
gen, dass insbesondere über den Preismechanismus in einer
Die öffentliche Hand kann durch (Politik- und Regulie- Marktwirtschaft auch Wissen effizient allokiert und genutzt
rungs-)Maßnahmen bzw. (Markt-)Eingriffe die Aktivitäten werden kann, während in einer Planwirtschaft das Problem
der Akteure in einem ansonsten grundsätzlich marktwirt- bzw. die Herausforderung besteht, dass das für die zentrale
schaftlichem im Wirtschaftssystem (und dabei insbesondere Planung erforderliche Wissen bei dem zentralen Planer
der privaten Unternehmen) beeinflussen. Im Hinblick auf auch tatsächlich vorliegt. Allerdings weisen ökonomische
die Erreichung definierter Ziele stellen sich die Fragen des Erkenntnisse auch auf Ineffizienzen im Rahmen einer Ko-
angemessenen Umfangs und der Ausgestaltung derartiger ordination der wirtschaftlichen Aktivitäten der Akteure in
öffentlicher Aktivität durch die Politik in der Legislative, einem wettbewerblichen Kontext in einer Marktwirtschaft
die als „wirtschaftspolitische Eingriffe“ eingeordnet werden hin.
können, und durch Regulierer bzw. die Verwaltung, die als
„regulatorische Eingriffe im engen Sinne“ angesehen wer- Vor diesem Hintergrund sind bei der Befassung der öffent-
den können. Übergreifend können derartige Eingriffe in das lichen Hand – und somit auch von Wissenschaftlern/innen
Wirtschaftssystem als „regulatorische Eingriffe im weiten und sonstigen Analytikern/innen, die die öffentliche Hand
Sinne“ (bzw. verkürzt als „regulatorische Eingriffe“), als (gefragt oder ungefragt) beraten – mit Bezug zum Einzelfall
„öffentliche Eingriffe“ oder „öffentliche Maßnahmen“ be- und zu konkreten Fragestellungen im Wirtschaftssystem
zeichnet werden. Derartige für das gesamte Wirtschaftssys- Vergleiche zur Eignung unterschiedlicher öffentlicher
tem relevante Fragen sind im weiteren Verlauf dieser Studie (politischer und regulatorischer) Eingriffsumfänge und
mit Bezug zur Ladeinfrastruktur für die Elektromobilität im -ausgestaltungen durchzuführen. Einen vollkommenen
Allgemeinen und zur T-LI im Speziellen unter Berücksichti- Verzicht auf öffentliche Eingriffe und eine somit vollkom-
gung des im einleitenden Kapitel 1 vorgestellten Zielsystems men unregulierte Marktwirtschaft, in der der Staat lediglich
zu betrachten. Die wesentliche Grundlage für die diesbezüg- Eigentumsrechte garantiert, gibt es in der Praxis quasi nicht.
lichen Analysen stellt die Institutionenökonomik und dabei Aber relativ wenig regulierte (markt-)wirtschaftliche Berei-
insbesondere die Neue Institutionenökonomik (NIÖ) dar. che haben durchaus eine hohe empirische Relevanz.
Eine unregulierte Marktwirtschaft und eine Bei der Analyse der Eignung von öffentlicher Planungsakti-
Planwirtschaft als Extremformen für öffentliche vität ist zu berücksichtigen, dass dabei nicht nur die bereits
Eingriffe sowie die Bedeutung von Wissen erwähnten Herausforderungen des Wissensmanagements
gemäß JENSEN / MECKLING (1995) bestehen, damit der öffentliche zentrale Planer über das
Extremformen öffentlicher Eingriffe und Aktivität im erforderliche Wissen zur adäquaten Aufgabenwahrnehmung
Wirtschaftssystem stellen einerseits eine unregulierte verfügt, sondern dass sich in einer Demokratie (aber – dann
Marktwirtschaft und andererseits eine (vollumfassende) in anderer Weise – auch in anderen Gesellschaftssystemen)
Planwirtschaft mit dem Staat als (einzigem und) zentralem mit Bezug zu öffentlicher Planungsaktivität spezielle An-
Akteur dar. In einer Marktwirtschaft, in der Unternehmen reiz- und Kontrollprobleme im öffentlichen und nicht zuletzt
in einem wettbewerblichen Kontext agieren, führt die Ko- im politischen Bereich stellen. Diese Probleme stehen im
ordination der wirtschaftlichen Aktivität unter Nutzung Übrigen im Mittelpunkt der Betrachtungen der Neuen Poli-
des Preismechanismus gemäß den Aussagen (einfacher)
5IKEM Working Paper: Die Bereitstellung der S
chnellladeinfrastruktur für die Elektromobilität in Deutschland
tischen Ökonomie (NPÖ), die dabei auf diverse Erkenntnisse bei Infrastrukturen im Einzelfall, die etwa beim
der Prinzipal-Agent-Theorie zurückgreift. Netzentwicklungsplan für die Stromübertragungsnetze
und bei der Bundesverkehrswegeplanung vorliegen,
Unterschiedliche Arten und Ebenen öffentlicher stellen Beispiele für Governance-Mechanismen dar.
Planungsaktivität im Kontext von öffentlichen
(Politik- und Regulierungs-)Maßnahmen – Frage der Planungsebene im technisch-systemischen
Bei Vergleichen unterschiedlicher öffentlicher Eingriffs- Sinne (und damit der Output- bzw. Input-Orientierung
umfänge und -ausgestaltungen ist zu berücksichtigen, dass der Planung): Planungsaktivität zu technisch-syste-
öffentliche Planungsaktivität in vielfältiger Form erfolgen mischen Maßnahmen kann – beispielsweise wenn das
kann, die sich insbesondere durch die Art und die Ebene der Ziel besteht, den Kohlendioxidausstoß (CO2-Ausstoß)
öffentlichen Planung unterscheiden kann: in einer Volkswirtschaft zu reduzieren – in einer mehr
oder weniger „Output-orientierten“ bzw. „Input-orien-
– Frage der Planungsart: Die öffentliche Planung kann tierten Weise“ erfolgen. Mit Bezug zum aufgeführten
sich auf technisch-systemische Maßnahmen und Beispiel kann der Einsatz von CO2-Zertifikaten als ein
damit direkt auf die Ressourcen-Allokation beziehen, sehr Output-orientierter Ansatz angewendet werden
z.B. durch den Beschluss eine bestimmte Autobahn und dabei werden die konkreten Maßnahmen im
zu errichten (und der damit – das sei hier angenom- technisch-systemischen Sinne im Wirtschaftssystem
men – direkt einhergehenden Umsetzung dieses im Rahmen von diversen Koordinationsaktivitäten auf
Beschlusses). Öffentliche Planung muss aber nicht Märkten durch einzelne (dezentrale) Unternehmen
direkt auf das technische System einwirken, sondern und sonstige Akteure festgelegt. Alternativ könnten
kann sich auch auf die Gestaltung von Institutionen durch zentrale Planung auch eher Input-orientiert
beziehen, die mehr oder weniger direkt (und damit konkrete technisch-systemische Entscheidungen
i.d.R. einhergehend früher oder später) dann die im Hinblick auf eine Reduktion des CO2-Ausstoßes
Ressourcenallokation im technischen System (mehr getroffen werden, z.B. durch die Vorgabe von
oder weniger) beeinflussen. Dies weist darauf hin, dass CO2-Ausstoß-Reduktionszielen in einzelnen Sektoren
regulatorische Eingriffe in das Wirtschaftsgeschehen (wie im Energiesektor, im Verkehrssektor oder
zentral erfolgen und somit ebenfalls Ergebnis einer in der Landwirtschaft) oder – noch Input-orien-
zentralen Planung sind. Zunächst können Institutionen tierter – durch die konkrete Beschlussfassung zur
durch die öffentliche Hand gestaltet werden, die recht Errichtung von einer bestimmten Windenergiean-
direkt die Ressourcenallokation beeinflussen, z.B. lagenkapazität in einem bestimmten Zeitraum.
durch die Ausgestaltung eines Vergabeverfahrens, in
dem Akteure das Recht und die Pflicht ersteigern, an Je nachdem auf welcher Ebene (und damit in einer mehr
einem von ihnen ausgewählten Ort in Deutschland oder weniger Input- oder Output-orientierten Weise)
Windenergieanlagen zu erreichten. Eine vergleichswei- öffentliche technisch-systemische Planungsaktivitäten
se indirekte Beeinflussung der Ressourcenallokation ansetzen, sind dann regelmäßig direkt anschließend weitere
kann erfolgen, indem der Gesetzgeber Institutionen in Planungsaktivitäten bezüglich von Institutionen erforder-
Form von Governance-Mechanismen definiert und da- lich, die im direkten Anschluss an die planerisch getroffene
mit festlegt, wie in bestimmten Bereichen planerische technisch-systemische Entscheidung die Grundlage dafür
Entscheidungen zukünftig zustande kommen. Beispiele bilden, dass die zur Umsetzung dieser Entscheidung von den
hierfür sind diverse Kompetenzübertragungen an die Wirtschaftssubjekten (und dabei insbesondere Unterneh-
Bundesnetzagentur als Regulierer, die u.a. (Vor-)Ent- men) durchzuführenden Maßnahmen stattfinden können.
scheidungen über den Bau bestimmter Infrastrukturen Beispielsweise kann an einen gesetzlichen Beschluss mit
treffen darf und Erlaubnisse oder Verbote bezüglich einem technisch-systemischen Charakter hinsichtlich der
der Stilllegung von Kraftwerken aussprechen kann. Errichtung von einer bestimmten Windenergieanlagenkapa-
Auch durch legislative (Grundsatz-)Entscheidungen zität in einem bestimmten Zeitraum ein Beschluss zur Aus-
etablierte (Vor-)Festlegungen zur späteren legislativen gestaltung der Institutionen anknüpfen, mit denen die Orte
Involvierung in Bedarfsplanungsentscheidungen und die Akteure auszuwählen sind, wo bzw. durch welche
6IKEM Working Paper: Die Bereitstellung der S
chnellladeinfrastruktur für die Elektromobilität in Deutschland
die Windenergieanlagen zu errichten sind (was im Übrigen Wissensstand der für Planungsaktivitäten zuständigen
aktuell in Deutschland durch Auktionsverfahren erfolgt). öffentlichen Stellen, die dortigen Möglichkeiten zur (kurz-
oder zumindest mittel- bzw. langfristigen) Aneignung und
Die Bedeutung von Wissen beim Vergleich von zum Einbezug von bereits verfügbarem Wissen sowie zum
alternativen (mit unterschiedlichen öffentlichen (i.d.R. eher mittel- oder langfristig möglichem) Aufbau von
Planungsaktivitäten einhergehenden) öffentlichen neuem (bislang nirgendwo im Wirtschaftssystem verfüg-
(Politik- und Regulierungs-)Maßnahmen barem) Wissen zu betrachten. Dies betrifft sowohl techni-
Bei den diversen (bzw. eigentlich nahezu „unendlich vielen“) sches-systemisches als auch institutionelles Wissen.
bestehenden Möglichkeiten öffentlicher Planung, die sich
nicht zuletzt durch die Art und Ebene der Planung unter- Bei der Untersuchung der Alternative einer weitgehend
scheiden, ist unterschiedliches Wissen dafür bedeutsam, unregulierten Marktwirtschaft hat nicht unbedingt in einem
dass eine „gute Planung“ durchgeführt wird. Für sich direkt analogen Ausmaß eine Befassung mit Wissensständen und
auf die Ressourcenallokation beziehende Planungsentschei- deren Veränderbarkeit bei den relevanten Akteuren (und
dungen ist technisch-systemisches Wissen von Bedeutung, dabei insbesondere bei den in den entsprechenden Wirt-
über welches vielfach Ingenieure/innen verfügen, während schaftsbereichen tätigen Unternehmen) zu erfolgen. Denn
institutionelles Wissen hierfür grundsätzlich unwichtig ist. es ist gerade ein großer Vorteil von weitgehend unregulierten
Für die Gestaltung von Institutionen und dabei auch von Marktwirtschaften, dass es – von der Planung der allgemei-
Governance-Mechanismen wird institutionelles Wissen nen (Restriktionen für die Akteure etablierenden) Rahmen-
benötigt, welches insbesondere bei Institutionenökonomen/ bedingungen im Rahmen einer (weitgehend unregulierten)
innen und Rechtswissenschaftlern/innen vorliegt. Ferner ist Marktwirtschaft abgesehen – keines öffentlichen Planers
i.d.R. aber auch (in einem mal mehr und mal weniger großen Bedarf. Nichtsdestotrotz kann es auch mit Bezug zu einer
Ausmaß) technisch-systemisches Wissen von Relevanz, weitgehend unregulierten Marktwirtschaft geboten sein,
um die Eignung der Anwendung bestimmter institutio- Wissensstände zu betrachten. Dies gilt speziell dann, wenn
neller Lösungen in einem bestimmten, nicht zuletzt auch der Verdacht besteht, dass durch öffentliche Eingriffe in das
durch technisch-systemische Besonderheiten bedingten Wirtschaftsgeschehen Ziele besser erreicht werden könnten
Kontext beurteilen zu können. Je nachdem auf welcher als in einer weitgehend unregulierten Marktwirtschaft.4 In
technisch-systemischen Ebene die öffentliche Planung dieser Situation bietet sich vielfach eine Prognose der Wir-
erfolgt und die öffentlichen (Politik- oder Regulierungs-) kungen des fortgesetzten Nicht-Eingreifens zum einen und
Maßnahmen ansetzen, unterscheidet sich das erforderliche der Alternative des öffentlichen Eingreifens in die (bislang)
technisch-systemische Wissen und hat – anders formuliert – weitgehend unregulierte Marktwirtschaft zum anderen an.
eine stärkere Output- oder Input-Orientierung aufzuweisen. Für die Prognose der Wirkungen des Nicht-Eingreifens sind
dann Erkenntnisse über Markt- und Wettbewerbsprozesse
Wenn auf Seiten bzw. aus dem Blickwinkel der öffentlichen erforderlich, welche insbesondere in der Industrieökonomik
Hand unterschiedliche Optionen für den Umfang und die und der dieser zurechenbaren Netzwerkökonomik eine
Ausgestaltung öffentlicher Planungsaktivität untersucht Rolle spielen.5 Insofern ist für die Analyse der Alternative
und die damit einhergehenden Wirkungen prognostiziert des öffentlichen Nicht-Eingreifens in eine weitgehend un-
(und dann auf Basis eines Zielsystems regelmäßig auch regulierte Marktwirtschaft ebenfalls institutionelles Wissen
bewertet) werden, sind nicht zuletzt auch der verfügbare
4 Z.T. wird – Erkenntnisse einfacher formaler mikroökonomischer Modelle berücksichtigend – die Position vertreten, dass öffentliche Eingriffe
in das Wirtschaftsgeschehen insbesondere dann erfolgen bzw. in Betracht gezogen werden sollten, wenn Marktmachtprobleme, externe
Effekte oder Informationsasymmetrien vorliegen und in diesem Zusammenhang von „Marktversagen“ gesprochen werden kann. Dazu ist
anzumerken, dass mit diesem „Marktversagens-Ansatz“ eine durchaus geeignete grobe Daumenregel vorliegt, wann regulatorische Maß-
nahmen (i.w.S.) untersucht werden sollten. Allerdings kommt es dabei sehr auf das Ausmaß von Marktversagens-Tatbeständen an und selbst
dann, wenn dieses berücksichtigt wird, kann dieser Ansatz letztendlich doch lediglich als eine Daumenregel dafür angesehen werden, wann
(u.a.) öffentliche Eingriffe in Betracht zu ziehen und genauer zu untersuchen sind.
5 Da sich die Industrieökonomik mit der Wirkung der Institution „Marktwirtschaft“ befasst, kann diese auch einer im weiten Sinne verstandenen
Institutionenökonomik zugerechnet werden.
7IKEM Working Paper: Die Bereitstellung der S
chnellladeinfrastruktur für die Elektromobilität in Deutschland
bzw. – enger formuliert – industrieökonomisches Wissen 2.1.2. Herausforderung bei der zielgerichteten
erforderlich. Entwicklung und Analyse alternativer
öffentlicher (Eingriffs-)Maßnahmen als
Zu beachten ist, dass bestimmtes Wissen regelmäßig dezent- „institutioneller Ingenieursaufgabe“
ral im Wirtschaftssystem bei „irgendwelchen“ Akteuren (wie
Unternehmen) vorhanden ist; dann wird auch von „dezent- Die Entwicklung und Analyse von alternativen öffentlichen
ralem Wissen i.e.S.“ gesprochen. Anderes Wissen hingegen (Politik- und Regulierungs-)Maßnahmen, die zur Erreichung
kann „von der Natur der Sache her“ als „zentrales Wissen“ vorgegebener Ziele beitragen sollen, weist Ähnlichkeiten zu
bezeichnet werden, z.B. der öffentlich bekannte Forschungs- Entwicklungsaufgaben im technisch-systemischen Bereich
stand zu einer bestimmten Fragestellung. Neben „irgendwo“ auf. Daher kann – Einordnungen und Überlegungen von
im Wirtschaftssystem vorliegendem dezentralen Wissen COLANDER (1992) und COLANDER (2017) berücksich-
i.e.S. (im Folgenden nur als „dezentrales Wissen“ bezeichnet) tigend – auch von einer „institutionellen Ingenieursaufgabe“
kann sich dezentrales Wissen i.w.S. auch speziell auf örtliche gesprochen werden. Die Identifikation optimaler Lösungen
Gegebenheiten beziehen und wird dann als „lokales Wissen“ bei dieser institutionellen Ingenieursaufgabe ist dabei quasi
eingeordnet. Je nachdem, ob für bestimmte wirtschaftliche nicht möglich und die Analysen weisen Besonderheiten auf,
Aktivitäten zentrales, dezentrales oder lokales Wissen von die so bei ökonomische Analysen zu anderen Fragestel-
Bedeutung ist, können sich unterschiedliche öffentliche lungen (wie z.B. bei empirischen Analysen sowie formalen
(Politik- und Regulierungs-)Maßnahmen tendenziell mehr mikroökonomischen Modellierungen zur Erklärung beob-
bzw. weniger eignen. achtbarer Sachverhalte) nicht vorliegen.
Angemerkt sei ferner, dass im öffentlichen Bereich in Als eine wesentliche Grundlage für die Erfüllung des
Deutschland – aber analog auch in mehr oder weniger Anspruchs der Wissenschaftlichkeit kann bei derartigen
ähnlichen Ausgestaltungsweisen in anderen Ländern – ein Analysen zu institutionellen Ingenieursaufgaben die Ge-
Mehrebenensystem existiert, in dem – hier vereinfachend währleistung der intersubjektiven Nachvollziehbarkeit bzw.
von einem genau zwei Ebenen umfassenden Mehrebenen- das Anstreben dieses Ziels angesehen werden, wobei dieses
system ausgehend (und damit die institutionelle Realität in Ziel vollumfassend faktisch niemals erreichbar sein wird. In
Deutschland ignorierend) – die Zuordnung von Aufgaben diesem Zusammenhang beeinflussen die für Analysen und
und die Koordination zwischen der zentralen Ebene und deren Darstellung zur Verfügung stehenden Ressourcen auf
der dezentralen Ebene sowie auf der dezentralen Ebene eine nicht unerhebliche Weise, inwieweit dem (unerreichba-
z.T. gemäß zentral definierter Regeln erfolgt. Dabei kann es ren) Ziel der Gewährleistung intersubjektiver Nachvollzieh-
regelmäßig als eine große Stärke der Gebietskörperschaften barkeit nahegekommen werden kann.
auf der dezentralen Ebene gegenüber der zentralen Ebene
angesehen werden, dass sie über lokales Wissen verfügen.
Zu berücksichtigen ist jedoch, dass u. U. auch „vor Ort“ 2.1.3. Schlussfolgerungen für
tätige Unternehmen über lokales Wissen verfügen werden. die institutionenökonomischen
Aufgaben die zentrales Wissen erfordern, können in einem Analysen in dieser Studie
staatlichen Mehrebenensystem oftmals von der zentralen
Ebene besser wahrgenommen werden als von der dezentra- Die vorstehenden dargestellten Erkenntnisse zu insti-
len Ebene. tutionenökonomischen Analysen bezüglich öffentlicher
(wirtschaftspolitischer und regulatorischer) Eingriffe in das
Wirtschaftsgeschehen werden bei den Untersuchungen im
weiteren Verlauf dieser Studie – zumindest implizit – umfas-
send berücksichtigt. Dies bedeutet u.a., dass Wissensstände
bei der öffentlichen Hand bzw. bei den diese – gefragt oder
ungefragt – durch Analysen unterstützenden Akteuren
sowie Prognosen über die Entwicklung von Wissensstän-
den (z.B. bei der öffentlichen Hand, der infolge legislativer
8IKEM Working Paper: Die Bereitstellung der S
chnellladeinfrastruktur für die Elektromobilität in Deutschland
Beschlüsse eine Planungsaufgabe zugeordnet wird) eine jeder dieser drei Ladeinfrastrukturarten sollte jeweils einem
erhebliche Relevanz für die Analyseergebnisse aufweisen. speziellen Konzept folgen. Diese Konzepte können als Be-
reitstellungskonzepte oder Angebotskonzepte bezeichnet
Im Hinblick auf das Anstreben der intersubjektiven Nach- werden und enthalten grundsätzliche Gestaltungsüberle-
vollziehbarkeit ist anzumerken, dass in dieser Studie – auf- gungen bezüglich der einzelnen Bereitstellungsparameter
grund sehr begrenzter Ressourcen bei ihrer Erstellung – bei (wie insbesondere Kapazitäten und Standorte, Ladege-
den Analysen oftmals Untersuchungsgänge nicht umfassend schwindigkeiten, Nutzungsregeln und Bepreisung etc.).
erläutert und diverse Analyseschritte vielmehr implizit vor- Im Einzelnen sind vor diesem Hintergrund die folgenden
genommen werden, wobei in den im einleitenden Kapitel 1 Ladeinfrastrukturarten zu berücksichtigen (vgl. dazu auch
genannten bereits vorliegenden ökonomischen Vorarbeiten, Abbildung 1):
die in dieser Studie aufgegriffen werden, z.T. die intersub-
jektive Nachvollziehbarkeit in einem wesentlich größeren – Basis-Ladeinfrastruktur (B-LI): Auf die regelmäßig
Ausmaß als in dieser Studie sichergestellt sein dürfte. erfolgende Beladung zu Zeiten, in denen ein Fahrzeug
ohnehin für einen längeren Zeitraum eines Tages parkt,
ist die so genannte Basis-Ladeinfrastruktur (B-LI)
2.2. Idealtypische Nachfragearten sowie ausgerichtet. Diese dürfte bei den derzeit üblichen bzw.
Angebotsarten und Angebotskonzepte den zu erwartenden Batteriekapazitäten und unter
Berücksichtigung durchschnittlicher täglicher Fahrt-
Vor dem Hintergrund, dass – wie im einleitenden Kapitel 1 weiten, bei denen Elektrofahrzeuge hinsichtlich der
bereits thematisiert – durch wirtschaftspolitische und regu- „Total Cost of Ownership“ (TCO) relativ vorteilhaft
latorische Eingriffe des Bundes erhebliche Verbesserungen abschneiden, mehrfach pro Woche (und dabei wohl
bei der Bereitstellung der Ladeinfrastruktur (im Lichte des oftmals vor bzw. an den meisten (Arbeits-)Tagen) bzw.
den Analysen in dieser Studie zugrunde liegenden Zielsys- zumindest häufiger als andere Ladeinfrastrukturarten
tems) möglich sein dürften, ist für die weiteren Analysen ein genutzt werden. B-LI kann im Hinblick auf ein i.d.R.
gewisses Wissen über das technische System der Ladeinfra- nächtliches Laden im privaten Bereich („p-B-LI“) auf
struktur von Relevanz. Hierzu gehört auch Wissen und somit dem Grundstück bzw. in der (Tief-)Garage des Nutzers
ein Verständnis über die Nachfrage nach Ladeinfrastruktur. verortet sein.7 Im Wohnumfeld kann die Ladeinf-
rastruktur auch im öffentlich zugänglichen Bereich
Die Nachfrage nach Ladeinfrastruktur erfolgt in quasi und dabei insbesondere im öffentlichen Straßen- und
unendlich vielen verschiedenen Konstellationen, die aber Parkraum („ö-B-LI“), aber auch im halböffentlichen
letztendlich – gemäß der Eingrenzung des Untersuchungs- Bereich („hö-B-LI“, z.B. in Parkhäusern) platziert
gegenstandes im einleitenden Kapitel 1 in erster Linie auf sein. Weiterhin kann R-LI auch beim Arbeitgeber
„normale“ private Nutzer von BEV und nicht auf Flotten, verortet sein („AG-B-LI“). An B-LI können Nutzer
Car Sharing, Taxis etc. Bezug nehmend – drei verschiedenen ihre Fahrzeuge in der Regel ohne Inkaufnahme von
Ladebedürfnissen zugeordnet werden können, die auch als Einschränkungen ihres Mobilitätsverhaltens über
(Ladeinfrastruktur-)Nachfrage-Arten bezeichnet werden eine längere Zeit und damit auch mit geringeren
können.6 Zur Befriedigung dieser Ladebedürfnisse eignen Leistungen laden und dabei oftmals vollladen,
sich – (wohlfahrts-)ökonomische Erkenntnisse auf die weshalb der Rückgriff auf Schnellladetechnologie
Besonderheiten des Elektromobilitätssystems anwendend grundsätzlich nicht erforderlich bzw. nicht sinnvoll
– wiederum drei verschiedene Arten von Ladeinfrastruktur. ist und sich vielfach die AC 1-Technologie (und
Diesen drei Ladeinfrastrukturarten kann jeweils ein Lade- ansonsten ggf. die AC 3-Technologie) eignen wird.
bedürfnis zugeordnet werden und die Bereitstellung gemäß
6 Vgl. BECKERS ET AL. (2015) und HILDEBRANDT (2016).
7 Dabei kann zwischen p-B-LI im alleinigen Verfügungsbereich des Nutzers („private Garagen-LI“ bzw. „p-G-B-LI“) und p-B-LI bei Mehrfamili-
enhäusern („private Tiefgaragen-LI“ bzw. „p-TG-B-LI“) unterschieden werden.
9IKEM Working Paper: Die Bereitstellung der S
chnellladeinfrastruktur für die Elektromobilität in Deutschland
– Tankstellen-Ladeinfrastruktur (T-LI): Öffentlich – Ergänzungs-Ladeinfrastruktur (E-LI): Wenn Nutzer
zugängliche Tankstellen-Schnellladeinfrastruktur – Wegeketten „abfahren“, parken Fahrzeuge oftmals und
oder verkürzt Tankstellen-Ladeinfrastruktur – (T-LI) dabei besteht die Möglichkeit, entsprechend geeignet
entspricht in ihrer Funktion z.T. den Tankstellen für platzierte Ladeinfrastruktur quasi „nebenbei“ zu
konventionellen Kraftstoff und die Bereitstellung nutzen und zu laden. Hierauf ausgerichtete Ladeinfra-
lehnt sich in diesem Zusammenhang in gewisser struktur kann die Basis- und Tankstellen-Ladeinfra-
Hinsicht an das Konzept von Tankstellen an. Entfernte struktur ergänzen und daher als „Ergänzungs-Ladein-
Reiseziele können jenseits der maximalen Reichweite frastruktur“ (E-LI) bezeichnet werden. Durch E-LI
von Elektrofahrzeugen liegen, was insbesondere den kann ggf. die Nutzung von T-LI unterbleiben und
Fernverkehr betrifft. Die maximale Reichweite kann entsprechend Zeit eingespart werden. Bei E-LI
außerdem bereits durch Fahrten in einer Region können verschiedene Ladegeschwindigkeiten und
überschritten werden („Regionenverkehr“), z.B. wenn damit einhergehend auch Ladetechnologien (AC 1 und
nicht während der normalen Standzeit geladen werden AC 3 sowie auch DC) sinnvoll einsetzbar sein. E-LI
kann (wie beispielsweise an einem Urlaubsort, wo dürfte insbesondere im so genannten halböffentlichen
ggf. kein Rückgriff auf B-LI möglich ist, und somit in Bereich und dort z.B. auf Parkflächen von Einzel-
einer „Urlaubsregion“) oder wenn an einem Tag – ggf. handelsgeschäften (Supermärkten, Möbelhäusern
auch in der „Heimatregion“ – längere Fahrten statt- usw.) und von Freizeitanbietern (Sportstudio etc.) zu
finden, welche die von einer vollgeladenen Batterie finden sein. Anzumerken ist, dass Ladeinfrastruktur,
ermöglichte Reichweite übersteigen. Da in diesen die zu bestimmten Zeiten durch ein entsprechendes
Fällen Fahrten zum Laden unterbrochen werden Angebotskonzept als B-LI einzuordnen ist (z.B. ö-B-LI
müssen, eignet sich zur Abdeckung dieser Nachfrage für eine regelmäßige nächtliche Beladung) sich zu
öffentlich zugängliche Gleichstrom (DC)-Schnell- anderen Zeit in Verbindung mit einem entsprechend
ladeinfrastruktur. Denn bei der Nutzung fallen bei den anderen Angebotskonzept als E-LI eignen kann
Nachfragern Zeitkosten an, wobei diesen (Brutto-) (im aufgeführten Beispiel dann als ö-E-LI, die z.B.
Kosten etwaige Nutzen aus während der Ladezeit tagsüber vom Einkaufsverkehr genutzt werden kann).
durchgeführten Aktivitäten gegenüberzustellen sind
(z.B. „Kaffeetrinken“ oder „Einkaufen im Tankstel- Für eine überwiegende Anzahl der potentiellen Nutzer
lenshop“). Um die Nachfrage adäquat zu befriedigen der Elektromobilität dürfte die Verfügbarkeit von für sie
und dabei auch die durch T-LI generierbaren Mobili- nutzbarer B-LI dafür bedeutsam sein, dass sie in die Elek-
tätsoptionen zu berücksichtigen, ist es unentbehrlich, tromobilität einsteigen. Für die (wohl nur wenigen) Nutzer
dass ein T-LI-Netzwerk existiert. Dieses muss sich der Elektromobilität, die über keine B-LI verfügen, weist
auszeichnen durch eine ausreichende räumliche T-LI dann eine umso größere Bedeutung auf.8 Ein gewisses
Abdeckung (an Fernverkehrsadern und außerdem Nachfragesegment kann im privaten Bereich unkompliziert
gewisse Flächendeckung) und eine hohe Verfügbarkeit und (mehr oder weniger) eigenständig die Verfügbarkeit von
gewährleistende Kapazität an einzelnen Standorten B-LI sicherstellen, was insbesondere für Eigenheimbesitzer
(und insofern eine entsprechend große Anzahl an und – wenn auch mit Einschränkungen – bei Mehrfamili-
Ladesäulen insbesondere an „Hot-Spots“ der Nach- enhäusern (und somit für p-B-LI) gilt.9 Mit diesen Nach-
frage) sowie durch hohe Lade-Geschwindigkeiten an frageschichten dürfte in den folgenden Jahren relevante
den Säulen (DC-Laden deutlich jenseits von 50 kW). Fortschritte beim Markthochlauf für die Elektromobilität
in Deutschland zu erreichen sein. Allerdings werden auch
8 Zu beachten ist, dass die Verfügbarkeit von B-LI für die Nutzer der Elektromobilität auch aus gesamtsystemischer Sicht von Bedeutung ist,
da die Nutzer (bzw. von den Nutzern beauftragte Dienstleister (wie z.B. Stromvertriebe) oder gesetzlich bzw. regulatorisch damit beauftragte
Akteure (wie z.B. Verteilnetzbetreiber)) die Beladung der Fahrzeuge während ihrer Standzeiten an der B-LI insbesondere dann durchführen
können, wenn der Strompreis niedrig und somit tendenziell aus fluktuierenden erneuerbaren Energien erzeugter Strom „übrig“ ist und in den
Elektrofahrzeugen bzw. deren Batterien gespeichert werden kann.
9 Vgl. im Übrigen BECKERS / GIZZI (2019) zu Fragen der Bereitstellung von ö-B-LI.
10IKEM Working Paper: Die Bereitstellung der S
chnellladeinfrastruktur für die Elektromobilität in Deutschland
diese (potentiellen) Nutzergruppen der Verfügbarkeit malen Ausmaß gewährleistet ist.10 In diesem Kontext erfolgt
von T-LI eine große Bedeutung beimessen, sodass sie sich in dieser Studie ein Fokus auf die Analyse der Bereitstellung
vermutlich in einem nicht nur geringen Umfang gegen den sowie der Umsetzung von Bereitstellungsentscheidungen
Kauf von Elektrofahrzeugen entscheiden werden, wenn die bei öffentlich zugänglicher T-LI.
Bereitstellung von T-LI nicht bzw. in einem recht subopti-
Angebotsarten
LI in Tiefgaragen etc. p-TG-B-LI
LI im privaten Bereich p-B-LI
Basis- LI in Garagen etc. p-G-B-LI
B-LI
Ladeinfrastruktur LI im öffentlichen Bereich ö-B-LI
Nachfragearten
LI beim Arbeitgeber AG-B-LI
Tankstellen- LI im halböffentlichen Bereich hö-B-LI
T-LI
Ladeinfrastruktur
Ergänzungs- LI im halböffentlichen Bereich hö-E-LI
E-LI
Ladeinfrastruktur LI im öffentlichen Bereich ö-E-LI
Abbildung 1: Nachfrage- und Angebotsarten bei der Ladeinfrastruktur für BEV im MIV
10 In diesem Kontext ist darauf hinzuweisen, dass die Verfügbarkeit eines T-LI-Netzwerkes auch die relative Attraktivität von BEV und PHEV
beeinflusst. Sofern kein geeignetes T-LI-Netzwerk existiert, erhöht sich die relative Attraktivität von PHEV. Dies bedeutet aber auch, dass
dann aus einer relativ hohen Nachfrage nach PHEV nicht geschlossen werden kann, dass die Nachfrager nicht an BEV interessiert sind.
11IKEM Working Paper: Die Bereitstellung der S
chnellladeinfrastruktur für die Elektromobilität in Deutschland
3. Grundzüge eines Soll-Angebotskonzeptes unter Berücksichtigung
von Finanzierungsaspekten aus ökonomischer Sicht
Aufgrund des diesbezüglich recht guten Wissens- (z.B. auf Flughäfen, die nachts geschlossen sind
standes der ökonomischen Forschung können o.ä.). Da die durch das T-LI-Netzwerk generierten
– grundlegende (insbesondere wohlfahrts-)ökonomische Mobilitätsoptionen für sehr viele (potentielle)
Erkenntnisse berücksichtigend – deutliche Hinweise Käufer von Elektrofahrzeugen eine hohe Bedeutung
dahingehend abgeleitet werden, wie zentrale Bereitstel- aufweisen, sind – zur Lösung des so genannten
lungsentscheidungen bei T-LI gefällt werden und wie somit „Henne-Ei-Problems“ – die Investitionen in ein
die Grundzüge eines Angebotskonzepts für T-LI aussehen flächendeckendes Netzwerk durchzuführen, bevor die
sollten, um die im einleitenden Kapitel 1 definierten Ziele Nachfrage nach Elektrofahrzeugen „Fahrt aufnimmt“.
zu erreichen und sich in diesem Zusammenhang an den
Präferenzen der Nutzer zu orientieren. Zunächst Aspekte – Ladegeschwindigkeit: Wie bereits in Abschnitt 2.2
der Bepreisung und Finanzierung ausklammernd sollte das erläutert, kommen bei T-LI nur auf die DC-Technolo-
Angebotskonzept für T-LI bzw. ein Netzwerk von T-LI vom gie zurückgreifende Schnellladesäulen in Betracht, bei
Grundsatz her wie folgend dargestellt ausgestaltet sein, denen die Lade-Geschwindigkeit deutlich jenseits von
wobei dabei auch die bereits in Abschnitt 2.2 dargestellten 50 kW zu liegen hat. Den aktuellen technologischen
konstitutiven Charakteristika dieser Ladeinfrastrukturart Entwicklungsstand berücksichtigend, könnte es sich
aufgegriffen werden: ggf. anbieten, für die T-LI-Säulen Ladegeschwindigkei-
ten von zumindest 250 und ggf. 350 kW vorzusehen.11
– Verortung, Kapazität und physische Zugänglichkeit: Zu
berücksichtigen ist, dass durch T-LI Mobilitätsoptio- – Gestaltung der Schnittstelle zum Nachfrager und
nen und somit Optionsnutzen generiert werden, sodass institutionelle Zugänglichkeit: Die Gestaltung der
die Bedeutung von T-LI (im Sinne des durch diese Schnittstelle zwischen den Nutzern und dem bzw.
generierten Nutzens) keinesfalls nur mit dem Umfang den Betreibern von T-LI, die u.a. die Abwicklung von
von deren tatsächlicher Nutzung korrespondiert. Zahlungsvorgängen und Informations- und Daten-
In diesem Zusammenhang ist eine flächendeckende austausche umfasst, sollte in einer Weise erfolgen, die
Bereitstellung von T-LI im Hinblick auf die Erzielung Komplexität und damit auch Transaktionskosten für
von Abdeckungs- und damit einhergehend Netzwer- die Nutzer minimiert und in diesem Zusammenhang
keffekten zu empfehlen. Insofern sollte T-LI sowohl im gesamten T-LI-Netzwerk für die Anwendung
in Ballungsräumen und Regionen mit vielen Nutzern eines (nicht nur technischen sondern auch eines
sowie an Fernverkehrsstrecken als auch – wenn institutionellen) Standards sorgt. Ferner sollte die
auch natürlich in einem geringeren Ausmaß – „in der Zugänglichkeit für sämtliche Nutzer identisch sein,
Fläche“ angeboten werden. Die Kapazität in Form wobei lediglich im Zusammenhang mit Abrechnungs-
der Ladesäulen an den Standorten sowie die Anzahl prozessen sowie denkbaren unterschiedlichen Formen
der Standorte sollte bedarfsorientiert gewählt und der Beteiligung an der T-LI-Finanzierung gewisse
nachfrageorientiert ausgebaut werden, damit eine Unterschiede zwischen Nutzern in Deutschland und
ausreichende Ad-hoc-Verfügbarkeit gewährleistet ist. nicht in Deutschland zugelassener Kraftfahrzeuge
Die Standorte sollten grundsätzlich rund um die Uhr (Kfz) denkbar sind, die jedoch – auch aus unions-
und an allen Tagen physisch zugänglich sein, wobei rechtlichen Gründen – keinesfalls diskriminierend
Ausnahmen in Einzelfällen denkbar sein können zulasten der Nutzer nicht in Deutschland zugelassener
11 Genauer zu prüfen wäre ggf., ob für in entlegeneren Regionen und selten genutzte Ladesäulen aus Kostengründen systematisch geringere
Ladegeschwindigkeiten ausreichend bzw. sinnvoll wären (z.B. lediglich 150 kW oder 200 kW).
12Sie können auch lesen