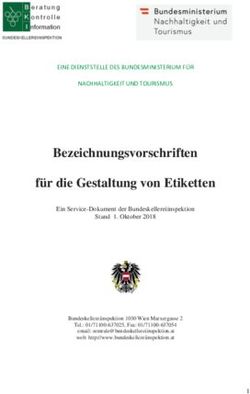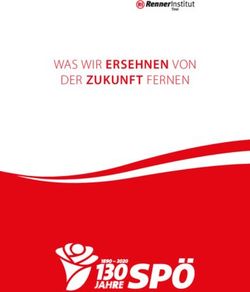Die Österreichische Mindestsicherungsreform 2010: Von der Armutszur Arbeitsmarktpolitik
←
→
Transkription von Seiteninhalten
Wenn Ihr Browser die Seite nicht korrekt rendert, bitte, lesen Sie den Inhalt der Seite unten
Research Article Die Österreichische Mindestsicherungsreform 2010: Von der Armuts- zur Arbeitsmarktpolitik Marcel Fink1, *, Bettina Leibetseder2, ** 1 Institut für Höhere Studien (IHS) Wien 2 HAW Landshut, Landshut * fink@ihs.ac.at, ** bettina.leibetseder@haw-landshut.de Zusammenfassung Gegen den europäischen Mainstream war die originäre Zielsetzung der in den 2000er Jahren in Österreich verhandelten Sozialhilfereform eine einheitliche und armutsfeste Leistung zu schaffen. Die inhaltliche Ausgestaltung der im Jahr 2010 beschlossenen Bedarfsorientierten Mindestsicherung (BMS) erfüllte diese Bestrebungen jedoch schlussendlich nicht. Der Beitrag analysiert den gegenständlichen Prozess ausgehend vom bis in die 1980er Jahre zurückgehenden und sich wiederholt wandelnden Agendasetting bis zum Beschluss im Nationalrat im Jahr 2010. Als zentral kristallisiert sich dabei, vor dem Hintergrund unterschiedlicher theoretischer Erklärungsansätze, die sich mehrfach verändernde strategische und inhaltliche Positionierung der Sozialdemokratischen Partei (SPÖ) heraus. Ungeachtet dessen, dass ein Eintreten für vergleichsweise generöse Mindestsicherungsleistungen bei politischen AkteurInnen, die ein breites WählerInnenspektrum anzusprechen versuchen, generell eher unwahrscheinlich ist, wird am österreichischen Fall ersichtlich, dass sozialdemokratische Parteien – unter bestimmten „günstigen“ Rahmenbedingungen und mobilisiert von individuellen AkteurInnen – auch proaktiv die Interessen von (potentiellen) MindestsicherungsbezieherInnen und damit von so genannten „Outsidern“ vertreten. Ändert sich der Kontext jedoch in eine Richtung, die ein solches Engagement aus strategischen Überlegungen heraus fragwürdig erscheinen lässt, so besteht eine hohe Wahrscheinlichkeit, vom ursprünglichen Kurs bzw. der früheren Argumentationsbasis abzurücken. Letzteres erleichtert es anderen politischen Kräften wiederum die gegenständliche Debatte dominant in einen gänzlich anderen inhaltlichen Rahmen, im gegenständlichen Fall jenen von „Sozialmissbrauch und Leistungsgerechtigkeit“, zu verschieben. Schlüsselwörter Sozialhilfe, Mindestsicherung, Österreich, Parteiendifferenzhypothese, SPÖ The 2010 Reform of the Minimum Income Scheme in Austria: From Poverty Alleviation to Labour Market Policy Abstract Against the European tide, the original objective of a social assistance reform, negotiated in Austria as from the 2000s, was to create a uniform and poverty-proof benefit. However, the Means-tested Minimum Income Scheme (MMS) adopted in 2010 did not fulfil these aims. This article discusses the challenges and factors that transformed the reform from the agenda setting in the 1980s to the adoption of the legislation in the parliament in 2010. Against the backdrop of various explanations, the strategic position and problem-framing of the Austrian Social Democratic Party as the main actor, is pivotal. Political actors that attempt to address a wide range of voters are generally unlikely to advocate comparatively generous minimum benefits. However, the Austrian case exemplifies that Social Democrats can proactively represent the interest of (potential) minimum income recipients and thus of so-called ‘outsiders’ under specific favourable conditions and in case of the the mobilization of individual actors. Yet, whenever the context changes in a direction that makes such commitment questionable for strategic reasons, there is a high likelihood to move away from the original course and the related dominating reasoning. The latter, in turn, makes it easier for other political forces to entirely re-frame the debate – in the present case towards issues like ‘benefit fraud’ and ‘meritocracy’. Keywords Social Assistance, Minimum Income, Austria, Social Democrats, Hypothesis on Party Differences May 10, 2019 I innsbruck university press, Innsbruck OZP – Austrian Journal of Political Science I ISSN 2313-5433 I http://oezp.at/ Vol. 48, issue 1 I DOI 10.15203/ozp.2714.vol48iss1 OPEN ACCESS
20 M. Fink, B. Leibetseder: Die Österreichische Mindestsicherungsreform 2010 I OZP Vol. 48, Issue 1
1. Einleitung, Fragestellung und Methode naus kam es vielfach zu einem Rückbau (Nelson 2013).
Zugleich wurden die Konditionalitäten für die Betrof-
Mindestsicherungssysteme standen in den hoch ent- fenen schrittweise ausgebaut und über sogenannte Ak-
wickelten Wohlfahrtsstaaten lange Zeit nicht im Fokus tivierungsprogramme zunehmend an über soziale Be-
sozialpolitischer Auseinandersetzungen1 und Analysen. dürftigkeit hinausgehende Voraussetzungen gebunden
Jedoch sehen sich Mindestsicherungssysteme seit den (vgl. z.B. Clasen/Clegg 2012; Weishaupt 2011), was einen
1980er Jahren international mit wachsenden Heraus- substanziellen Wandel hinsichtlich sozialer Rechte in
forderungen konfrontiert. Reformen der Systeme und Mindestsicherungssystemen einleitete (vgl. Bahle et al.
vergleichende Forschung zu den Ausgestaltungsformen, 2011). Und auch der steigende Bedarf an Mindestsiche-
Wirkungen und Entwicklungen der Mindestsicherungs- rungsleistungen aufgrund der internationalen Finanz-
systeme folgten (Gough et al. 1997; Bahle et al. 2011; Fi- und Wirtschaftskrise veränderte diesen Trend sozialpo-
gari et al. 2013). litischer Steuerung nicht (vgl. Marchal et al. 2014).
Die wachsende Nachfrage nach Leistungen der Min- Der Reform des österreichischen Mindestsiche-
destsicherungssysteme kann auf ein Bündel an Ursa- rungssystems, bei der die traditionelle „Sozialhilfe“ ab
chen zurückgeführt werden. Aufgrund von struktureller Herbst 2010 durch die so genannte „Bedarfsorientier-
Arbeitslosigkeit und der Postindustrialisierung der Ar- te Mindestsicherung“ (BMS) abgelöst wurde, ging eine
beitsmärkte können insbesondere niedrig qualifizierte mehr als zehnjährige Debatte voraus (Pfeil/Otter 2011).
Personen dem Ziel kontinuierlicher Beschäftigung ver- Im internationalen Vergleich stellt Österreich dabei ei-
mehrt nicht mehr entsprechen. Deren Erwerbseinkom- nen abweichenden Fall dar. Zuerst standen nämlich pri-
men werden immer weniger „armutsfest“. Des Weiteren mär armutspolitische Fragen im Fokus der gegenständ-
veränderten sich die „üblichen“ Formen des familiären lichen Reformdebatten (Tálos 2008a; Dimmel 2008). Es
Zusammenlebens und es differenzierten sich die Er- erfolgte keine sonst weit verbreitete (vgl. z.B. Clasen/
werbschancen und -risiken auf Haushaltsebene. Al- Clegg 2012) Verengung auf die Arbeutsmarkteinbin-
leinstehende und Alleinerziehende sind dadurch mit dung von LeistungsbezieherInnen. Erst in der letzten
ungleich höheren sozialen Risiken und Problemen kon- Phase des Reformprozesses kam es zu einer maßgebli-
frontiert als Personen in – ebenfalls stärker verbreiteten chen Erosion von inhaltlichen Elementen, die ursprüng-
– Haushalten mit mehreren Erwerbstätigen (Lødemel/ lich entgegen dem europäischen Trend in einen breiten
Moreira 2014; Marx/Nelson 2013). Die Interaktion zwi- Ausbau sozialer Rechte gemündet hätten. Letzteres,
schen diesen ökonomischen und soziodemografischen obwohl ein für die gegenständliche Reform relevanter
Trends bzw. ihr Zusammentreffen führte vielfach zu zu- politischer Akteur – nämlich die Sozialdemokratische
nehmenden sozialen Problemen, die durch den „Kern“ Partei Österreichs (SPÖ) – dies lange Zeit als fundamen-
der sozialen Sicherungssysteme, im gegenständlichen tale Reformbestrebung ventiliert hatte. Die zuerst do-
Zusammenhang insbesondere die Arbeitslosenversi- minierenden explizit armutspolitischen Ziele wurden
cherung, nicht oder nur unzureichend abgesichert sind. schlussendlich hinter die arbeitsmarktpolitischen ge-
Insgesamt sind breitere Bevölkerungsgruppen von post- stellt (vgl. Leibetseder/Woltran 2011).
industriellen „neuen sozialen Risiken“ (Bonoli 2007; Der vorliegende Beitrag geht erstens der Frage nach,
Taylor-Gooby 2004) betroffen, was sich in einem wach- warum und mit welcher Zielorientierung die Frage so-
senden Bedarf an residualen Leistungen manifestiert. zialer Mindestsicherung auf die Österreichische poli-
In den meisten Ländern wurden dabei die vorgela- tische Agenda gesetzt wurde. Zweitens werden wesent-
gerten Sozialversicherungssysteme nicht ausgebaut. liche Schritte und Einflussfaktoren der nachfolgenden
Im Gegenteil, Reformen in der Arbeitslosenversiche- Reformdebatte untersucht, um drittens Erklärungen für
rung erschwerten ab den 1990er Jahren vielfach den den Inhalt und die Ausgestaltung der schließlich durch-
Leistungszugang, verkürzten die -dauer und/oder das geführten Reform zu generieren. Die Analyse orientiert
-niveau. Dies stimulierte den Zustrom zu sozialen Min- sich dabei an unterschiedlichen konzeptionellen Erklä-
destsicherungssystemen zusätzlich (Clasen/Clegg 2011). rungsfaktoren, wodurch auch ein Beitrag zur internati-
Was die Systemausgestaltung betrifft, so ist in Bezug onalen – bisher noch wenig ausdifferenzierten – polito-
auf diesen Zweig sozialer Sicherung international kein logischen Debatte über die Erklärung der Reformpfade
expansiver Entwicklungspfad evident. Wie in vorge- von Mindestsicherungssystemen geliefert wird (vgl.
lagerten Leistungen und manchmal sogar darüber hi- dazu insb. Clegg 2014; Jessoula et al. 2014; Madama 2011;
Madama et al. 2014; Natili 2018).
1 Dies gilt jedenfalls für die – gemäß der Typologie von Esping-
Andersen (1990) – „sozialdemokratischen“ Sozialstaaten
in Nordeuropa und die „konservativ-korporatistischen“
in Kontinentaleuropa. Im Gegensatz dazu wird die Rolle
bedarfsgeprüfter Leistungen als traditionelles und definitorisches
Merkmal des „liberalen“ Sozialstaatstypus angesehen.M. Fink, B. Leibetseder: Die Österreichische Mindestsicherungsreform 2010 I OZP Vol. 48, Issue 1 21
Methodisch handelt es sich um eine Einzelfallstudie, 2. Ansätze zur Erklärung von Mindestsiche-
die den gegenständlichen Reformprozess mittels pro- rungsreformen
cess tracing nachzeichnet und analysiert.2 Process tracing
eignet sich zur Analyse von komplexen Phänomenen. Arbeiten zur Entwicklung von Mindestsicherungssys-
Es werden dabei kausale Prozesse zwischen den unab- temen sind häufig deskriptiv und konzentrieren sich
hängigen Variablen bzw. erklärenden Faktoren und der zumeist auf den Inhalt der jeweiligen Reformen bzw.
abhängigen Variable, in unserem Fall die in den ein- ihre unmittelbaren – insbesondere verteilungspoliti-
zelnen Phasen dominante inhaltliche Entwicklung der schen – Implikationen (Gough et al. 1997; Bahle et al.
Reformdebatte und das sich schließlich zeigende Re- 2011; Lødemel/Moreira 2014; Marchal/van Mechelen
formergebnis, identifiziert. Explizit zielt process tracing 2015; Wang/van Vliet 2016). Nur wenige Analysen liegen
auf die Identifizierung von theoretischen Erklärungen bisher international vor, die auf ein generelles Verständ-
ab, die über eine reine Prozessbeschreibung hinausge- nis der politischen Logik von Reformprozessen und auf
hen. Es wird der Hergang eines Prozesses rekonstruiert, mögliche diesbezügliche erklärende Faktoren abzielen
um verallgemeinerbare Erklärungen zu finden bzw. zu (vgl. insb. Clegg 2014; Jessoula et al. 2014; Madama 2011;
überprüfen (vgl. George/Bennett 2005; Collier 2011). Madama et al. 2014; Natili 2014; 2018). Im folgenden Ka-
Aus einer breiteren Perspektive ist eine Einzelfall- pitel werden unterschiedliche theoretische Ansätze zur
studie zu Österreich zum gegenständlichen Politikbe- Erklärung von Mindestsicherungsreformen diskutiert.
reich aus dem Grund besonders interessant, dass es sich Zuerst werden der klassische funktionalistische Ansatz
hier – wie oben bereits angeschnitten – aus international und der Machtressourcenansatz sowie die Erweiterung
vergleichender Perspektive um einen abweichenden Fall durch die Parteiendifferenzhypothese skizziert. Danach
handelt, weil im Gegensatz zu vielen anderen Ländern werden diese durch (neo-)institutionalistische Ansatz-
ursprünglich ein substantieller Ausbau sozialstaatli- punkte sowie durch Überlegungen über die Bedeutung
cher Leistungen für Outsider vorgesehen war bzw. diese von Ideen und „policy-entrepreneurs“ erweitert. Dabei
Zielsetzung ursprünglich im Fokus der gegenständli- gehen wir grundsätzlich davon aus, dass einzelne Fakto-
chen Reformdebatte stand. Abweichende Fälle verspre- ren alleine, wie sie klassischen Theorieschulen entspre-
chen generell weiterführende Erkenntnisse, weil bei chen, den Fort- und Ausgang politischer Prozesse nur
deren Analyse dargelegt werden kann, warum gerade ungenügend erklären können. Und um einen bestim-
für sie gängige Erklärungen nicht ausreichen. Damit menden Einfluss erkennen zu können, sind potentielle
eignen sich abweichende Fälle einerseits zur Hypothe- Erklärungsfaktoren zu einander in Bezug zu setzen (Guy
sengewinnung, andererseits können ebenso bestehen- Peters 2011).
de Hypothesen und konzeptionelle Überlegungen und Aus einer funktionalistischen Perspektive wäre grund-
Theorien verfeinert werden (vgl. Lijphart 1971; Mahoney sätzlich zu erwarten, dass ein wachsender Bedarf an
2007). Der Beitrag ist wie folgt strukturiert: Abschnitt sozialer Sicherung eine Expansion von Sozialleistungen
2 präsentiert konzeptionelle Überlegungen zur Erklä- nach sich zieht (Wilensky/Lebeaux 1958). Hinsichtlich
rung der „Politik von Mindestsicherungsreformen“. Ab- der rezenten Nachfrage nach Mindestsicherungsleis-
schnitt 3 skizziert die erste Phase des gegenständlichen tungen kann jedoch argumentiert werden, dass hier ein
Reformprozesses, also das ursprüngliche Agendaset- kontingenter Effekt wirtschaftlicher Dynamik auf die
ting und den Problemhintergrund. In Abschnitt 4 ana- Sozialpolitik (vgl. Siegel 2002, 44) einwirkt. Geringe-
lysieren wir die inhaltlich bestimmende Phase des ge- res Wirtschaftswachstum, steigende Arbeitslosigkeit
genständlichen Reformprozesses ab dem Jahr 2005 bis und eine Ausdifferenzierung von Chancen und Risiken
zur Beschlussfassung im Jahr 2010, wo die Reform der auf den Arbeitsmärkten erhöhen auf der einen Seite die
Mindestsicherung in Österreich zu einem dominanten Nachfrage nach Mindestsicherungsleistungen. Auf der
sozialpolitischen Projekt stilisiert wurde. In Abschnitt anderen Seite können aber wirtschaftliche Stagnation
5 erfolgt eine Diskussion und Zusammenfassung und und ihre Rückwirkung auf öffentliche Haushalte kon-
der Beitrag schließt mit einem Ausblick, der auch kurz traktive (also den Geldfluss mindernde oder bremsende)
rezente Entwicklungen im gegenständlichen Politikfeld sozialpolitische Maßnahmen befördern.
anspricht. Der soziale Problemdruck und die budgetären Ver-
hältnisse stellen mit Sicherheit wichtige Bedingungen
2 Für diese Studie wurden verschiedenste schriftliche Datenquellen für den jeweiligen sozialpolitischen Entwicklungspfad
verwendet. Systematisch wurden Partei- und Wahlprogramme dar. Für sich genommen erklären sie aber unzureichend,
betrachtet. Inhalte von Datenbanken über Parlamentsprotokolle,
Pressemeldungen und Zeitungsberichte wurden nach den warum wann welche sozialpolitischen Entscheidungen
Stichwörtern, Sozialhilfe, Grundsicherung und Mindestsicherung getroffen werden, die eben auch von politischen Dyna-
durchsucht und analysiert, wobei der Schwerpunkt auf die miken und Institutionen abhängen (Flora/Alber 1981).
Jahre 2005 bis 2010 gelegt wurde. Weiters wurden Berichte des
Sozialministeriums und von Interessenorganisationen sowie Zu den bestimmenden Erklärungsfaktoren gehört aus
Sekundärliteratur einbezogen. Sicht der klassischen Parteiendifferenzhypothese die Zu-22 M. Fink, B. Leibetseder: Die Österreichische Mindestsicherungsreform 2010 I OZP Vol. 48, Issue 1
sammensetzung der jeweiligen Regierung (Hibbs 1977; tribute, die mit einer vergleichsweise geringen eigenen
Schmidt 1982), in der die Machtverteilung unterschied- politischen Organisationsfähigkeit in Verbindung ge-
licher Klassen zum Ausdruck kommt. bracht werden (ibid.). Wichtig ist im gegenständlichen
Demnach forcieren vor allem sozialdemokratische Zusammenhang darüber hinaus, dass diese Gruppen
Parteien eine sozialstaatliche Expansion, speziell wenn vielfach nicht zur traditionellen Stammklientel von Ge-
die Interessen der Arbeiterbewegung zugleich im außer- werkschaften gehören, die sich in ihrer Vertretung häu-
parlamentarischen Bereich, sprich durch Gewerkschaf- fig auf vergleichsweise stabil beschäftigte „Normalar-
ten, stark vertreten sind (Korpi 1983). Ausgehend von beitnehmer“ konzentrieren (vgl. Ebbinghaus 2006; für
der Debatte über die „New Politics of the Welfare Sta- Österreich: Flecker/Herrmann 2009).
te“ (Pierson 1994; 2001) wurden solche Befunde ab den Eine Reihe internationaler Untersuchungen deuten
1990er Jahren – bezogen auf die nunmehrige Phase des in die Richtung, dass sozialstaatlicher Rückbau, der ab
„permanenter Austerität“ (Pierson 2001) – zunehmend den 1990er Jahren in praktisch allen hoch entwickelten
in Zweifel gezogen. Die „politics of blame avoidence“ (d.h. Wohlfahrtsstaaten auf der Agenda stand, unter sozial-
der Schuldvermeidung) sorgen demnach dafür, dass ein demokratischen Regierungen sogar stärker ausgefallen
breiter Rückbau von sozialpolitischen Leistungen von ist als unter anderen Regierungskonstellationen (vgl.
politischen Parteien aller Couleur vermieden wird, um vgl. Ross 2000; Green-Pedersen 2002). Die „politischen
sich Chancen auf eine Wiederwahl aufrecht zu erhalten. Kosten“ (im Sinne nachfolgender Stimmverluste), so die
Zudem modifiziere das einmal etablierte Politikerbe die These, fielen nämlich für sozialdemokratische Parteien
Präferenzen von Interessensorganisationen und Wäh- geringer aus, weil diese nicht im Verdacht stünden, so-
lerInnen und ebne durch unterschiedliche Parteien ver- zialpolitische Leistungen aus ideologischen Gründen
folgte sozialpolitische Strategien tendenziell ein. zu reduzieren, sondern weil es aus budgetären Gründen
Hinsichtlich der Politiken zur Mindestsicherung gibt oder Erhalt der Wettbewerbsfähigkeit „notwendig“ sei.
es jedoch Argumente dafür, dass die Parteiendifferenz- Um einem drohenden Vertrauensverlust zu entkommen,
hypothese bzw. der Machtressourcenansatz nicht in können solche Maßnahmen zusätzlich auf wahlstrate-
ihrer klassischen Form zutreffen. Betreffend sozialde- gisch wenig bedeutende Personengruppen beschränkt
mokratische Parteien und Gewerkschaften kann argu- werden (Pierson 1994). Dies ist – neben anderem – Ge-
mentiert werden, dass sich deren strategische Position – genstand der These einer „Dualisierung“ der Generosität
selbst in den Ländern, wo sie noch einen vergleichsweise sozialstaatlicher Leistungen, die eine Ausdifferenzie-
großen Einfluss haben – vor dem Hintergrund sozioöko- rung von Chancen und Risiken auf den Arbeitsmärkten
nomischer Veränderungen grundlegend gewandelt hat. fortschreibt (Emmenegger et al. 2012). Outsider seien
Insbesondere Rueda (2007; 2005) und King und Rueda demnach nicht nur mit dem Problem konfrontiert, ar-
(2008) haben eingewandt, dass sich die historische Kli- mutsfeste Erwerbseinkommen zu generieren. Darüber
entel von sozialdemokratischen Parteien in nunmehrige hinaus werde für diese Gruppe der Zugang zu Sozi-
„Insider“ und „Outsider“ aufspalte. Folglich stellt sich altransfers zunehmend erschwert, an zusätzliche Kon-
die Frage, welche dieser beiden Gruppen in erster Linie ditionalitäten gebunden und/oder das Leistungsniveau
vertreten werden soll. gesenkt (Bothfeld/Betzelt 2013; Nelson 2013; Marchal et
Maßnahmen, die den Interessen von Insidern ent- al. 2014).
sprechen, sind solche, die deren arbeitsrechtliche und Die klassische Parteiendifferenzhypothese hingegen
sozialpolitische Situation absichern und deren finanzi- geht davon aus, dass in diese Richtung deutende politi-
elle Belastungen für andere Gruppen zumindest nicht sche Entscheidungen im Falle von (Mitte-)rechts-Regie-
erhöhen. Outsider bedürfen hingegen gut bzw. weiter rungen noch drastischer ausfallen würden. Allerdings
ausgebauter sozialer Dienstleistungen und Mindest- erscheint hier gleichfalls eine weitere Differenzierung
sicherungssysteme sowie qualitativ hochwertiger ar- allgemeiner Annahmen notwendig.
beitsmarktpolitischer Maßnahmen. Die Kosten dafür Generösen Sozialleistungen stehen liberale Rechtspar-
gingen aber zulasten der Insider. Sozialdemokratische teien einerseits generell kritisch gegenüber. Zugleich ist
Parteien und Gewerkschaften vertreten, so die These, aber durchaus zu erwarten, dass sie im Gesamtgefüge
tendenziell die Interessen von Insidern nachhaltiger sozialstaatlicher Absicherung für eine größere Bedeu-
als jene von Outsidern. Letzteres besonders dann, wenn tung von Mindestsicherungssystemen eintreten, aller-
die sogenannten Outsider, etwa die BezieherInnen von dings verbunden mit einem Plädoyer für geringer ausge-
Mindestsicherung, eine noch vergleichsweise kleine und baute andere sozialstaatliche Interventionen (vgl. Clegg
darum wahlstrategisch nicht besonders wichtige Grup- 2013; Natili 2014, 6; Jessoula et al. 2014). Dabei wird ein
pe darstellen (Bonoli 2007). Darüber hinaus setzt sich Modell der residualen Sozialpolitik mit geringen sozial-
diese Gruppe überproportional aus jüngeren Personen, staatlichen Ausgaben vertreten. Die Mindestsicherung
Frauen, Personen mit Migrationshintergrund oder ge- ist in einem solchen Konzept für einen großen Teil der
ring Qualifizierten zusammen. Dies sind allesamt At- Arbeitslosen zuständig, wobei ein niedriges Leistungs-M. Fink, B. Leibetseder: Die Österreichische Mindestsicherungsreform 2010 I OZP Vol. 48, Issue 1 23
niveau und eine rigide Verpflichtung zu Erwerbs- und/ und die sich daraus ergebenden Rahmenbedingungen
oder gemeinnütziger Arbeit die sozialen Rechte auf ein in den Blick. Dabei spielt die Kompetenzverteilung zwi-
Minimum beschränkt. schen dem Nationalstaat und der subnationalen Sphä-
Konservative christlich-soziale Parteien verfolgen gemäß re eine Rolle, da lokale und/oder regionalen AkteurIn-
der Parteiendifferenzhypothese vor allem eine starke nen und Institutionen in der Mindestsicherung häufig
soziale Absicherung des klassischen male-breadwin- Schlüsselfunktionen innehaben und somit mehr oder
ner-Modells durch Sozialversicherungsleistungen nach minder Vetopunkte bilden bzw. als Vetospieler agie-
dem Äquivalenzprinzip, wobei sie zugleich die Bedeu- ren können (Pierson 1995). Inwiefern sich subnationale
tung des Subsidiaritätsprinzips betonen (vgl. Huber/ Kompetenzen in der Mindestsicherung auf einschlägige
Stephens 2000). Vor dem Hintergrund einer starken Reformprozesse auswirken, wurde bislang jedoch kaum
Einbindung von christlichen Gewerkschaften sind ge- in theoriegeleiteten und empirisch gesättigten Analysen
neröse Sozialversicherungslohnersatzleistungen und untersucht. Bonoli/Champion (2015) gehen davon aus,
ein hoher Arbeitnehmerschutz für diese Parteien ide- dass subnationale Kompetenzen in Zeiten eines erhöh-
altypischer Weise häufig ein Anliegen. Des Weiteren ten Reformdrucks mannigfache Effekte zeigen können.
stehen sie jedoch der Zentralisierung sozialer Leistun- Diese reichen von dezentraler Innovation über Versu-
gen grundsätzlich kritisch gegenüber (Kersbergen van/ che einer wechselseitigen Verschiebung von Leistungs-
Stahis 2010). Noch verstärkt gilt dies nach einschlägigen bezieherInnen (Kosten und Verantwortung) zwischen
Überlegungen für nationale Mindestsicherungssyste- unterschiedlichen Ebenen bis zu offen ausgetragenen
men mit eher generösen Zugangsregelungen, weil die- Kompetenzkonflikten. Letzteres wird hier als Ausdruck
se aus ihrer Sicht Praktiken und Werte familiärer und eines innerstaatlichen Wettbewerbs interpretiert, um
dezentraler gemeinschaftsbasierter sozialer Sicherung über Möglichkeiten zu verfügen, Problemlösungsfähig-
unterwandern könnten (vgl. Jessoula et al. 2014). keit zu signalisieren und damit politisches credit-claiming
Radikale Rechtsparteien forcieren besonders häufig zu betreiben.
eine Unterscheidung in „würdige“ („deserving“) und „un- Betrachtet man diese verschiedenen Erklärungsan-
würdige“ („undeserving“) soziale Gruppen. BezieherInnen sätze, so kann davon ausgegangen werden, dass im poli-
von Mindestsicherungsleistungen (außer etwa alte oder tischen Aushandlungsprozess immer ein Gemenge von
kranke Personen) werden dabei oft dem Generalver- Faktoren zum Tragen kommt. Gleichzeitig weisen ein-
dacht ausgesetzt, arbeitsunwillig zu sein. Es ist demnach zelne Zugänge Schwachstellen auf, die wiederum einer
wahrscheinlich, dass solche Parteien breit ausgebaute Erweiterung durch andere Ansätze bzw. Überlegungen
Mindestsicherungssysteme in besonderem Maß ableh- bedürfen. Gelten funktionalistische und machtressour-
nen werden (vgl. Natili 2014). centheoretische Erklärungen vor allem für eine wohl-
Für das faktisch sozialpolitische Agieren der Partei- fahrtsstaatliche Expansion, so begründen sich neo-ins-
en ist zudem die Parteienkonstellation prägend. Konkret titutionalistische oftmals in der Betrachtung eines etab-
geht es dabei um die Frage, mit welchen anderen Kräften lierten sozialpolitischen Arrangements und von dessen
politische Parteien in einem Mehrparteiensystem um Stabilität. Andere Überlegungen fokussieren auf Verän-
WählerInnenstimmen konkurrieren (vgl. Ferrera 1993; derungen und rücken den Wandeln in politischen Ideen
Häusermann et al. 2010). Wenn sozialdemokratische und relevante Einflussnahmen von Entscheidungsträ-
Parteien mit der Konkurrenz anderer Linksparteien ger/innen in den Vordergrund.
konfrontiert sind, werden sie eher auch die Interessen Solche Ansätze mittlerer Reichweite bringen neben
von sogenannten Outsidern auf die Agenda setzen (An- „structure“ auch vermehrt „agency“ ins Spiel, um sozialpo-
derson/Beramendi 2012). Wenn der Wettbewerb hinge- litische Veränderungen erklären zu können (insb. Mada-
gen vor allem mit einer christlich-sozialen Partei statt- ma 2011). Nach unserer Lesart sind diese Überlegungen
findet, dann treten sozialdemokratische Parteien beim gegenüber „klassischen“ Ansätzen, wie etwa dem Funk-
Schutz von Insidern in Konkurrenz mit den Christlich- tionalismus, dem Parteiendifferenz- und Machtres-
Sozialen, und stellen die Interessen von Outsidern hint- sourcenansatz oder dem (Neo-)Institutionalismus, an-
an: „The only viable avenue for social democratic parties schlussfähig.
is to moderate and effectively abandon their poor (‚radi- Deshalb berücksichtigen wir überdies die Rolle von
cal‘) constituencies” (Iversen/Sodkice 2009, 12). individuellen AkteurInnen, so genannten „policy entre-
Für Positionen und Strategien von politischen Par- preneurs“, die politische Prozesse bei einem gegebenen
teien, Interessensgruppen und anderen AkteurInnen „window of opportunity“ beschleunigen oder in eine andere
ist auch die institutionelle Ausgestaltung des tradierten Richtung lenken können (Kingdon 1984). Zweitens be-
Systems sozialer Mindestsicherung wesentlich. (Neo-) halten wir die Entwicklung inhaltlich dominanter „Ide-
institutionalistische Überlegungen verweisen einerseits auf en“ im Auge. Interessen und Strategien von AkteurInnen
das Phänomen der Pfadabhängigkeit und nehmen an- können sich aus der Perspektive des diskursiven Neo-
dererseits die Verteilung von politischen Kompetenzen Institutionalismus vor dem Hintergrund gewandelter24 M. Fink, B. Leibetseder: Die Österreichische Mindestsicherungsreform 2010 I OZP Vol. 48, Issue 1
Interpretationsrahmen ändern. Und sich wandelnde Durch die Veränderungen in der Familien- und Beschäf-
Ideen können damit entscheidend zu institutioneller tigungsstruktur entstanden „neue soziale Risiken“, die
Transformation beitragen (Béland 2005; Schmidt 2008; von vorgelagerten Sicherungssystemen nur teilweise
Hay 2004). abgedeckt wurden. Oder es wurde durch gesetzliche Än-
Eine wesentliche Rolle kann dabei – so der gängige derungen, insbesondere in der Arbeitslosenversiche-
Befund – bei der Diffusion und Verfestigung bzw. un- rung, sogar deren Risikoabdeckung reduziert (Obinger/
ter Umständen selbst bei der Transformation von Ideen Tálos 2010; Tálos/Mühlberger 1999). Die Daten zur Ent-
unterschiedlichen nationalen und insbesondere auch wicklung der Zahl der Sozialhilfebezieherinnen wäh-
internationalen Akteursnetzwerken zukommen (Hall rend der ersten Hälfte der 1990er Jahre bilden diese er-
1993; Sabatier/Jenkins-Smith 1993). Zudem können sich höhte Nachfrage nicht ausreichend ab (Bock-Schappel-
verändernde dominante Ideen und „policy entrepreneurs“ wein 2004), vor allem weil der Zugang zur Sozialhilfe in
in Kombination zu ungewöhnlichen Koalitionen füh- dieser Zeit vielfach restriktiver gestaltet wurde (Dimmel
ren, die unter Umständen sogar eine Pfadabweichung 2008). Grundsätzlich standen die Länder einer Reform
ermöglichen. So genannte „coalition magnets“ entstehen der offenen Sozialhilfe seit Mitte der 1990er Jahre offen
dann, wenn eine Idee, wie etwa soziale Ausgrenzung, gegenüber, da sie sich ähnlich wie bei der 1993 imple-
von einem politischen Entrepreneur so forciert wer- mentierten Pflegereform (Einführung des Pflegegeldes)
den kann, dass ein soziales Problem in einem anderen unter anderem eine gewisse finanzielle Entlastung er-
Zusammenhang gesehen wird. Entscheidungsrelevant hofften.
kann eine solche Konstellation dann werden, wenn sich Die Initiative zu einer Reform der Sozialhilfe ging
wichtige Akteur/innen im politischen Prozess für die jedoch ursprünglich nicht von den Bundesländern aus.
Idee begeistern, wobei diese bis dahin keinen gemein- Bereits in der zweiten Hälfte der 1980er Jahre fand eine
samen Handlungsbedarf gesehen haben (Béland/Cox öffentlichkeitswirksame Diskussion über ein „Grund-
2016). einkommen ohne Arbeit“ statt, deren Ausgangspunkt
Im folgenden Abschnitt wird der politische Prozess das gleichnamige Buch (Wohlgenannt/Büchele 1985) der
vom Agendasetting bis zum Beschluss im Parlament Katholischen Sozialakademie war. Die Thematik wur-
dargestellt. Induktiv werden für jede Phase prägende de in der Folge von zivilgesellschaftlichen AkteurInnen
Faktoren eruiert und erläutert, um im Diskussionsteil und zwei parlamentarischen Oppositionsparteien, den
aus dem nachgezeichneten Prozess und mit Bezug auf Grünen und dem Liberalen Forum (LIF), aufgegriffen.
die oben skizzierten Erklärungsansätze Hypothesen zu Die „Armutskonferenz“4 kurbelte die Debatte weiter an:
generieren. Sie wurde 1995 als Netzwerk gegen Armut und soziale
Ausgrenzung gegründet und band neben zivilgesell-
schaftlichen Organisationen WissenschafterInnen ein.
3. Agendasetting: Armutspolitik und/oder Ihre zweite jährliche Tagung, die im Jänner 1997 in Salz-
Arbeitsmarktpolitik? burg stattfand, wurde unter das Thema „Soziale Grund-
sicherung“ gestellt. Sie zeigte in dem Sinn einen dauer-
Grundsätzlich erfolgte die legistische Regelung und haften Effekt, dass der bedarfsgerechte Ausbau sozialer
Implementierung der Sozialhilfe in Österreich in den Mindestleistungen im Anschluss daran bei zentralen
1970er Jahren auf Ebene der Bundesländer. Davor hatte zivilgesellschaftlichen Organisationen in Österreich zu
der Bund 1968 explizit auf die verfassungsrechtlich vor- einer – bzw. vielfach sogar der – zentralen armutspoliti-
gesehene Grundsatzgesetzgebung verzichtet, nachdem schen Forderung avancierte.
mit den Bundesländern – trotz wiederholt ausformu- Wie schon oben erwähnt, wurde die Reformdiskus-
lierter Entwürfe – über eine solche keine Einigkeit er- sion zuerst von zwei Oppositionsparteien in den par-
zielt werden konnte (Melinz 1996). Danach intensivier- lamentarischen Raum eingeführt. Die Grünen stellten
te sich die Debatte um eine Reform monetärer sozialer 1995 ein Pensionsmodell vor, das eine Grundsicherung
Mindestleistungen (in Form der damaligen Sozialhilfe) unabhängig von Arbeit und Familienstand enthielt.
in Österreich auf breiter Basis erst wieder seit Mitte der Im Oktober 1998 folgte ein umfassendes Konzept einer
1990er Jahre, was eine Reihe von Ursachen hat und auf „Grünen Grundsicherung“, das ein generöseres Leis-
Bestrebungen sehr unterschiedlicher AkteurInnen fußt. tungsniveau, umfassende Möglichkeiten der Karenzie-
Zu Beginn der 1990er Jahre waren die Länder mit ei- rung und universelle Leistungen für Kinder vorsah (Die
ner steigenden Nachfrage nach Leistungen der offenen Grünen 1998). Das LIF (1997) hatte bereits 1997 das Mo-
Sozialhilfe33 konfrontiert, wobei dies für Wien schon dell einer „Bedingungslosen Grundsicherung“ präsen-
früher zutraf (Köppl/Steiner 1989; Pfeil/Otter 2011). tiert, und zwar in Form einer Negativsteuer von monat-
3 Damit sind Leistungen gemeint, die nicht im Rahmen der intramu- 4 In der Armutskonferenz sind mehr als 30 soziale Organisationen
ralen Betreuung wie etwa Pflegeheimen gewährt werden. sowie Bildungs- und Forschungseinrichtungen aktiv.M. Fink, B. Leibetseder: Die Österreichische Mindestsicherungsreform 2010 I OZP Vol. 48, Issue 1 25
lich ca. 750 EUR. Dieses Modell sah, anders als jenes der Ausgleichszulage der Pensionsversicherung sollte als
Grünen, von der Bereitschaft zur Erwerbstätigkeit ab. einheitlicher Referenzwert für bedarfsgeprüfte Unter-
Andere Sozialleistungen, etwa Arbeitslosenversiche- stützungen herangezogen werden. Zugleich sollten ein-
rung, sollten jedoch gestrichen werden. kommensgeprüfte Leistungen (wie Notstandshilfe, Aus-
Mit explizitem Bezug auf die vorangegangene Ver- gleichszulage, Zuschuss zum Karenzgeld) armutsfester
anstaltung der Armutskonferenz brachte das LIF am 29. gestaltet werden. Weiters wurde empfohlen die Sozial-
Jänner 1997 im Parlament einen Entschließungsantrag hilfe durch eine „Bedarfsorientierte Mindestsicherung“
„betreffend Schaffung eines Bundessozialhilfegesetzes“ (BMS) zu ersetzen. Diese sollte weiterhin residual zu an-
ein,5 da ein „bundeseinheitliches Sozialhilfegesetz […] deren Sozialleistungen bleiben, aber wesentlich leichter
eine wichtige und dringende Voraussetzung für die Si- zugänglich sein, bundesweit vereinheitlicht werden und
cherung sozialer Grundrechte jedes Menschen in diesem eine höhere Rechtssicherheit garantieren sowie eine
Land“ sei. Es sollte Richtsätze für Einzelpersonen und Betreuungskomponente durch soziale Dienste und eine
Haushaltsgemeinschaften vereinheitlichen, Leistungen Absicherung in der Kranken- und Pensionsversicherung
mit Rechtsanspruch und klar ausgestalteten Bedingun- beinhalten. Wichtig ist, dass im Bericht der ExpertIn-
gen (Erfordernis und Zumutbarkeit des Einsatzes der ei- nenarbeitsgruppe ein armutspolitischer gegenüber ei-
genen Arbeitskraft) festhalten, Schonvermögen bestim- nem arbeitsmarktpolitischen Standpunkt überwiegt:
men und den Regress beschränken. Die Verhandlungen „Armut wurde nicht nur als Ergebnis fehlender/einge-
wurden im Ausschuss für Arbeit und Soziales weiterge- schränkter Erwerbsarbeit angesehen, sondern als mul-
führt. Seitens der ÖVP und der SPÖ wurde ein gemein- tidimensionaler Prozess, dem ebenso zu begegnen sei“
samer Abänderungsantrag eingebracht und von diesen (Dimmel 2008, 31). Ohne dass die Ergebnisse dieser Ar-
beschlossen.6 Neben der ÖVP und der SPÖ stimmte das beitsgruppe vorerst breiter aufgegriffen worden wären,
LIF dem abgeänderten Entschließungsantrag im Natio- wurde 1999 mit dem Ziel einer Vereinheitlichung der
nalrat zu, nicht jedoch die Grünen, weil sie diesen An- Qualitätsstandards in der Sozialhilfe eine weitere Ar-
trag als inhaltlich zu schwach empfanden. Auch die FPÖ beitsgruppe bestehend aus den Landessozialhilferefe-
(Freiheitliche Partei Österreich), von der in der gegen- rentInnen unter Leitung des Sozialministeriums instal-
ständlichen Nationalratsdebatte keine Wortmeldung er- liert (Pfeil/Otter 2011).
ging, stimmte nicht zu.7 Inhaltlich weniger weitreichend Inzwischen hatte sich auf Bundesebene die Regie-
als der Vorstoß des LIF wurde in der Entschließung rungskonstellation geändert. Statt mit der SPÖ regierte
„(d)ie Bundesregierung, insbesondere die Bundesminis- die ÖVP ab dem 4. Februar 2000 in einer Koalition mit
terin für Arbeit, Gesundheit und Soziales, […] ersucht, der FPÖ. Im Regierungsprogramm wurde angekündigt,
mit den Ländern Gespräche über die Weiterentwicklung dass die Leistungen von Bund und Ländern hinsichtlich
der Sozialhilfe aufzunehmen“. der Existenzsicherung besser aufeinander abgestimmt
Dem parlamentarischen Auftrag nachkommend werden sollten und für BezieherInnen an einer Stelle
wurde 1998 beim Sozialministerium eine mehr als zugänglich sein sollten. Ein One-Desk-System sollte für
40-köpfige ExpertInnenarbeitsgruppe (ohne Beteili- die Vermittlung in den Arbeitsmarkt und die Auszah-
gung der Länder) eingerichtet, die später den Bericht lung von Leistungen beim Arbeitsmarktservice (AMS)
„Einbinden statt Ausgrenzen“ vorlegte (Haberbauer et eingeführt werden. Sozialhilfe- und Notstandshilfebe-
al. 1999). Explizit wird im Vorwort hervorgehoben, dass zieherInnen sollten dazu verpflichtet werden, „Gemein-
die dargelegten Reformoptionen die Sichtweisen der wesensarbeit“ zu verrichten, und dafür ein „Bürgergeld“
ExpertInnen wiedergeben, und nicht mit Stellungnah- in Form eines bis zu 20-prozentigen Aufschlages erhal-
men von Organisationen gleichzusetzen sind (neben ten (Bundeskanzleramt 2000). Nach den vorgezogenen
wissenschaftlichen Einrichtungen etwa von Sozialmi- Nationalratswahlen vom November 2002 wurde erneut
nisterium, Arbeiterkammer, Gewerkschaft oder Ar- eine Koalitionsregierung aus ÖVP und FPÖ gebildet.
beitsmarktverwaltung). Der Bericht der Arbeitsgruppe Das neue Regierungsprogramm sah nunmehr vor, die
kam zum Schluss, dass Leistungen, die auf sozialversi- Notstandshilfe in eine per Vereinbarung gemäß Art. 15a
cherungsrechtlichen oder universalistischen Prinzipi- B-VG8 oder per Sozialhilfegrundsatzgesetz harmoni-
en basieren, ausgebaut werden sollten, um die Bedeu- sierte „Sozialhilfe neu“ überzuführen, die weiterhin bei
tung bedarfsgeprüfter Leistungen hintanzuhalten. Die den Ländern angesiedelt bleiben sollte. Parallel sollte
5 Vgl. 388/A XX.GP; http://www.parlament.gv.at/PAKT/VHG/XX/
A/A_00388/index.shtml. 8 Bei Vereinbarungen gemäß Artikel 15a der Bundesverfassung (B-VG)
6 Vgl. Vgl. 880 der Beilagen XX. GP; http://www.parlament.gv.at/ handelt es sich dabei um einen innerstaatlichen Vertrag zwischen
PAKT/VHG/XX/I/I_00880/fname_139756.pdf. dem Bund und den Ländern, die dabei über Angelegenheiten ihres
7 Vgl. Stenographisches Protokoll, 88. Sitzung des Nationalrates jeweiligen Wirkungsbereichs Übereinkünfte treffen, die verbindlich
der Republik Österreich, XX. Gesetzgebungsperiode, Mittwoch, 8. sind. Solche Vereinbarungen sind jedoch in der Regel nicht mit
Oktober 1997, Internet: http://www.parlament.gv.at/PAKT/VHG/ unmittelbaren Sanktionierungsmöglichkeiten ausgestattet, die im
XX/NRSITZ/NRSITZ_00088/fname_114165.pdf. Fall eines Zuwiderhandelns wirksam werden würden.26 M. Fink, B. Leibetseder: Die Österreichische Mindestsicherungsreform 2010 I OZP Vol. 48, Issue 1
ein kollektivvertraglicher Mindestlohn von 1.000 Euro 4. Die Mindestsicherung als zentrales sozial-
im Monat etabliert werden (Bundeskanzleramt 2003). politisches Projekt und dessen schrittwei-
Die Länder wollten weitergehenden Veränderungen ser inhaltlicher Wandel
nur unter der Voraussetzung zustimmen, dass der Bund in
seinem Verantwortungsbereich, insbesondere Arbeits- Damit existierte zwischen dem Bund und den Ländern
losenversicherung, Leistungsverbesserungen durch- betreffend eine weitreichende Reform der Sozialhil-
führt (Pfeil/Otter 2011), was aber im Regierungspro- fe eine Art Pattsituation. Zugleich standen die SPÖ wie
gramm nicht vorgesehen war. Dessen ungeachtet er- auch die Gewerkschaften einer umfassenderen Reform
arbeitete die Arbeitsgruppe „Weiterentwicklung des der Sozialhilfe lange ursprünglich skeptisch gegenüber
Sozialhilferechts“ der LandessozialhilfereferentInnen (Tálos 2008a, 160; 2003, 169ff.). Soziale Risiken sollten
in Kooperation mit dem Experten Walter J. Pfeil einen aus Sicht der Sozialdemokratie in erster Linie durch das
Entwurf für eine Art. 15a-B-VG-Vereinbarung zwischen Sozialversicherungssystem bearbeitet werden. Im Zuge
Bund und den Ländern, die im März 2004 im Rahmen der parteiinternen Vorbereitungsphase zum National-
einer Enquete der Volksanwaltschaft vorgestellt wurde. ratswahlkampf 2006 änderten sich jedoch die diesbe-
Wesentliche Eckpunkte waren die Anhebung der Sozi- züglichen Signale, als zur Schärfung des inhaltlichen
alhilferichtsätze auf das Niveau der Ausgleichszulage, Profils der SPÖ ab Anfang 2005 von politikfeldspezi-
die Etablierung eines One-Desk-Prinzips beim AMS, die fischen „Kompetenzteams“ Maßnahmenvorschläge
Integration nicht versicherter SozialhilfebezieherInnen erarbeitet wurden. Das Kernteam im Sozialbereich bil-
in die reguläre Krankenversicherung und eine Erhöhung deten zwei damalige Sozial-LandesrätInnen, nämlich
von Leistungen der Arbeitslosenversicherung. Im Juni Gabriele Schaunig aus Kärnten und Erwin Buchinger
2004 forderte die LandessozialreferentInnenkonferenz aus Salzburg, sowie Richard Leutner (Österreichischer
den Bund auf, seine grundsätzliche Position vorzulegen.9 Gewerkschaftsbund, ÖGB) und Heidrun Silhavy (Sozial-
Seitens des Bundesministeriums für Soziale Sicherheit sprecherin im Nationalrat). Beim ersten öffentlichkeits-
und Generationen und des Bundesministeriums für wirksamen Auftritt des Kompetenzteams wurde im Jän-
Wirtschaft und Arbeit wurde keine offizielle Stellung- ner 2004 unter anderem gefordert, die Sozialhilfe durch
nahme abgegeben. Der von den Ländern monierte Ver- eine neue „bedarfsorientierte Grundsicherung“ zu erset-
besserungsbedarf im Bereich der Ausgleichszulagen- zen.10 Im Mai 2005 lautete eines von zehn präsentierten
richtsätze, des Arbeitslosengeldes sowie der Notstands- Zielen des Kompetenzteams, die „Armut in Österreich
hilfe war dort offensichtlich kein Thema (vgl. Dimmel [zu] beseitigen (bedarfsorientierte Mindestsicherung)“11.
2008, 32). Nur das Bundesministerium für Gesundheit Seitens der SPÖ wurde das Thema jedoch vorerst
und Frauen (BMGF) errechnete die finanziellen Mehr- nicht weiter öffentlich forciert. Weit präsenter waren
belastungen durch eine Einbeziehung nicht versicherter diesbezüglich die Grünen, die im Wahlkampf für die
SozialhilfebezieherInnen in die Krankenversicherung Wiener Landtags- und Gemeinderatswahl vom Oktober
(Pfeil/Otter 2011). 2005 die Forderung nach einer neuen Mindestsicherung
Diese Entwicklungen indizieren eine weitgehende als eines ihrer Kernthemen präsentierten.12 Die Sozial-
Politikblockade zwischen Bund und Ländern. Der Bun- demokratInnen brachten ihr Konzept einer „bedarfs-
desregierung waren weder die Verbesserung bei Min- orientierten Grundsicherung“ erst in der Hochphase des
destsicherungsleistungen noch der Leistungsausbau nächsten Nationalratswahlkampfes ab dem Spätsom-
in den vorgelagerten Sozialversicherungsleistungen mer 2006 in diesen ein. Allerdings gab es kaum öffentli-
ein Anliegen. Vielmehr sollte die „Beschäftigungswil- che Stellungnahmen seitens der SPÖ dazu,13 wohingegen
ligkeit“ von LeistungsbezieherInnen im Rahmen einer die Grünen abermalig ihr Modell der Grundsicherung
ausreichenden Anreizkompatibilität von Sozialleistun- als maßgebliche sozialpolitische Forderung platzier-
gen sichergestellt werden (vgl. Fink 2006). Umgekehrt ten.14 Insgesamt verdichtet sich vor diesem Hintergrund
sahen sich die Länder mit einer Sozialhilfereform ohne
10 APA Presseaussendung, 2APA708 II 12.01.2005, „SP-Konferenz:
Einbindung der Betroffenen in das AMS-System über- Sozialteam stellt Ziele vor“.
fordert, zumal sie keine zusätzlichen eigenen Budget- 11 OTS Presseaussendung, OTS167 II 02.05.2005., „Kompetenzteam
mittel aufwenden wollten (Tálos 2008a). Zugleich war Soziales: SPÖ will Modernisierung und Stärkung des Sozialstaats“.
12 Das dort im Anschluss getroffene Arbeitsübereinkommen
für den Bund die ursprünglich geplante Überführung zwischen SPÖ und den Grünen über eine „projektbezogene
der Notstandshilfe in die Sozialhilfe wegen eines diesbe- Zusammenarbeit“ beinhaltet keine Reform der Wiener Sozialhilfe
züglichen Widerstandes der Länder keine durchsetzbare in Richtung einer neuen Grund- oder Mindestsicherung, wobei
seitens der SPÖ argumentiert wurde, dass ein solcher Schritt einer
Option. „bundespolitischen Mitarbeit“ bedürfe (vgl. OTS104 II 13.01.2006).
13 Vgl. z.B. OTS Presseaussendung, OTS291 II 29.09.2006: „SPÖ-
9 Inhaltlich sollte der Bund dabei nach den Vorstellungen der Länder Wahlkampfabschluss: Ein Kanzler, der Wort hält, statt eines
vor allem auf Fragen finanzieller Mindeststandards, auf die Kanzlers der gebrochenen Versprechen“.
Weiterentwicklung der Notstandshilfe und die Krankenversicherung 14 Vgl. APA Presseaussendung, APA623 II 18.09.2006, „NR-Wahl:
für SozialhilfeempfängerInnen eingehen. Grüne starten Intensivwahlkampf“.M. Fink, B. Leibetseder: Die Österreichische Mindestsicherungsreform 2010 I OZP Vol. 48, Issue 1 27
der Eindruck, dass die angestrebte Reform der Sozial- Die monatliche Höhe der Mindestsicherung sollte, bei
hilfe innerhalb der SPÖ kein von einer breiten Basis ge- 14 jährlichen Auszahlungen, dem Ausgleichszulagen-
tragenes Kernthema war. Die nur punktuelle öffentliche richtsatz der Pensionsversicherung entsprechen, was
Hervorhebung deutet darüber hinaus darauf hin, dass als neue administrative „Armutsgefährdungsgrenze“
wohl einige Zweifel über die Wahlkampftauglichkeit des dargelegt wurde. Zur Implementierung der Mindestsi-
Themas existierten. cherung wurde vereinbart, in einem ersten Schritt den
Als stärkste Kraft aus den Wahlen am 1. Oktober her- Ausgleichszulagenrichtsatz anzuheben. Überdies sollte
vorgehend startete die SPÖ in Folge Koalitionsverhand- ein Mindestlohn auf Basis eines Generalkollektivver-
lungen mit der ÖVP. Sozialpolitische Themen wurden bei trags in Höhe von 1000 Euro sichergestellt werden. Als
der SPÖ von der damaligen Salzburger Landeshauptfrau weitere flankierende Maßnahme wurde „unter dem Vor-
Gabi Burgstaller, dem Gewerkschafter Friedrich Haber- behalt der Umsetzung einer bedarfsorientierten Min-
zettel und von Erwin Buchinger verhandelt.15 Letzterer destsicherung in den Bundesländern“ (ibid., 110) im Re-
hatte zuvor beim Entwurf des SPÖ-Modells einer be- gierungsprogramm vorgesehen, dass die Notstandshilfe
darfsorientierten Grundsicherung mitgearbeitet (vgl. der Arbeitslosenversicherung bei niedrigen Leistungen
Buchinger 2006). Erst zu diesem Zeitpunkt wurde die angehoben wird.19 Zugleich sollten in der Notstandshil-
Reform der Sozialhilfe in Form einer Mindestsicherung fe Partnereinkommen nur dann berücksichtigt werden,
zum Gegenstand einer intensiven und breit geführten wenn dies nicht zu einem Haushaltseinkommen unter
öffentlichen politischen Debatte.16 Die SPÖ betonte da- dem Familienausgleichszulagenrichtsatz (zuzüglich
bei, dass das von ihr forcierte Modell kein bedingungs- Kinderzuschläge) führt. Die Verbesserungen in der Not-
loses Grundeinkommen darstelle und im Wesentlichen standshilfe verfolgten dabei auch das Ziel, die Nachfrage
auf einer Vereinheitlichung der Sozialhilfe basiere. Am nach Leistungen aus der Sozialhilfe bzw. der Mindestsi-
20.12.2006 wurde schließlich öffentlich, dass ÖVP und cherung zu reduzieren.
SPÖ eine Übereinkunft erzielt hatten, deren Umsetzung Für arbeitsfähige Personen sollte Arbeitswilligkeit
mit einer Vereinbarung gemäß Art. 15a B-VG zwischen weiterhin eine Voraussetzung zum Leistungsbezug blei-
dem Bund und den Ländern von Anfang an erst für das ben, im Falle von Langzeitarbeitslosigkeit verbunden
Jahr 2010 angepeilt war.17 Die Konzessionen der SPÖ mit einer Verpflichtung zu Weiterbildungsmaßnahmen
in den Verhandlungen mit der ÖVP waren einerseits und mit der Einbindung in „gemeinnützige Arbeitspro-
die Zustimmung zum sogenannten Flexicurity-Paket jekte“. Die Einkommens- und Vermögensüberprüfung
200718, die weitreichende Verschlechterungen für Ar- sollte weiterhin durch die Sozialhilfeträger stattfinden.
beitslose hinsichtlich von Wegzeiten und betreffend Die Antragsverwaltung, die Leistungsauszahlung und
der Verfügbarkeit und Teilnahme an gemeinnützigen die Betreuung zur Reintegration in den Arbeitsmarkt
Beschäftigungsprojekten umfasste, sowie andererseits sollten hingegen für arbeitsfähige BezieherInnen – „mit
die anhaltende Zuordnung der Arbeitsmarktagenden zu dem Ziel der Erreichung eines One-Stop-Shops“ (ibid.,
einem Wirtschafts- und Arbeitsministerium unter Lei- 111) – durch das AMS getätigt werden. Das Regierungs-
tung der ÖVP. programm sah vor, dass Vermögen mit wenigen Aus-
Das Regierungsprogramm 2007 benannte „eine wei- nahmen weiterhin verwertet werden müssen. Zur Frage
tere Verstärkung der Armutsbekämpfung zur Senkung der Zahl der Krankenversicherung finden sich im Regierungs-
der Armutsgefährdeten und akut Armen“ (Bundeskanzler- programm keine Hinweise, obwohl dies Teil der Regie-
amt 2007, 109) als explizites Ziel, wobei ausgeführt wur- rungsverhandlungen gewesen war.20
de, dass „das Instrument dafür […] die Einführung einer Die Ausführungen im Regierungsprogramm ent-
bedarfsorientierten Mindestsicherung sein [soll]“ (ibid.). sprechen damit in weiten Teilen dem zuvor durch die
SPÖ vorgestellten Mindestsicherungskonzept (vgl.
15 Vgl. APA Presseaussendung, APA756 II 19.10.2006, „Koalition: Buchinger 2006). Von den Grünen und von einer Rei-
Gruppenphase eröffnet - Soziales tagte ergebnislos“. he sozialer NGOs wurde kritisiert, dass diese Reform
16 Vgl. z.B.: APA Presseaussendungen: APA093 II 19.11.2006,
für sich genommen nicht weit genug gehe, um Armut
„Grundsicherung für die IV ‚nicht vorstellbar‘“; APA334 II
24.10.2006, „Koalition: Grüne pochen auf Grundsicherung. Utl.: und Armutsgefährdung nachhaltig und substanziell zu
Öllinger: ‚SPÖ bei Verhandlungen unverbindlich‘ – ‚SPÖ-Modell
mangelhaft‘“; AP428 II 22.10.2006, Grundsicherung - Bischof
Schwarz: SPÖ-Konzept ‚guter Ansatz‘; APA326 II 22.11.2006,
„Koalition: VP-Leitl kann sich Grundsicherung vorstellen“; APA352
II 24.11.2006, „Koalition: Bartenstein legt Gegenmodell zur SPÖ-
Grundsicherung vor“.
17 Vgl. APA Presseaussendung APA044 II 21.12.2006, „Koalition: 19 Erhöhte Nettoersatzrate des Arbeitslosengeldes von bis zu 60
Grundsicherung wird Thema beim Finanzausgleich; Utl.: Länder Prozent bzw. im Fall von Familienzuschlägen von bis zu 80 Prozent
wollen Beitrag des Bundes - Verhandlungen über einheitliche als Bezugsgröße zur Berechnung der Notstandshilfe.
Sozialhilfe“. 20 Vgl. APA Presseaussendung: APA370 II 04.12.2006,
18 Vgl. https://www.parlament.gv.at/PAKT/VHG/XXIII/I/I_00298/ „Landeshauptleute: Ja, aber ... zur Grundsicherung. Utl.:
index.shtml Verhandlungen über finanzielle Aufteilung gefordert“.28 M. Fink, B. Leibetseder: Die Österreichische Mindestsicherungsreform 2010 I OZP Vol. 48, Issue 1
reduzieren,21 und dass die Gefahr bestehe, dass die Min- wurden, z.B. in Deutschland mit dem ‚Hartz IV’-Modell“. Über
destsicherung nur eine unzureichend adaptierte Version die Leistungshöhe der Mindestsicherung, definiert als
der alten Sozialhilfe werde.22 Mindeststandard (und nicht wie davor als Richtsatz, der
Jene Teile des Paketes, die nicht unmittelbar die So- im Einzelfall unter- und überschritten werden konnte),
zialhilfe betrafen, konnten relativ rasch umgesetzt wer- 14 jährliche Zahlungen, einen höheren Leistungssatz für
den. Noch bevor es zwischen SPÖ und ÖVP zu einem Alleinerziehende, Ausnahmen für den Einkommens-
Regierungsübereinkommen kam, wurde einstimmig einsatz sowie Regelungen zum Einsatz der Arbeitskraft
der Ausgleichszulagenrichtsatz für das Jahr 2007 auf konnte zügig Übereinstimmung hergestellt werden
726 Euro angehoben.23 Mitte 2007 beschlossen die So- (Pfeil/Otter 2011). Zugleich verzichteten die Länder und
zialpartner in einer Grundsatzvereinbarung zwischen Gemeinden weder auf die Möglichkeit der Reduktion
ÖGB und Wirtschaftskammer, die Branchenkollektiv- der Mindestsicherung bei niedrigeren Wohnkosten noch
verträge für die niedrigsten Lohngruppen bis 2009 auf auf eine grundbücherliche Sicherstellung der Unterstüt-
mindestens 1000 Euro brutto anzuheben.24 Im Rahmen zungsleistung. Der sogenannte Regress wurde dahinge-
des so genannten „Flexicurity-Paketes“25 vom Dezember hend reformiert, dass BezieherInnen selbst die vorheri-
2007 wurden so genannte „Freie DienstnehmerInnen“ ge Mindestsicherungsleistung im Fall späterer Einkünfte
in die Arbeitslosenversicherung einbezogen und für nicht mehr zurückzahlen müssen. Unterhaltspflichten
Selbstständige wurde eine freiwillige Versicherung in für nahe Angehörige nach dem Allgemeinen Bürgerli-
der Arbeitslosenversicherung ermöglicht (BMSK 2009). chen Gesetzbuch blieben aber bestehen. Dadurch wurde
Im Gegenzug wurden (s.o.) unter anderem die Zumut- die Zielsetzung, dass die Mindestsicherung einem zeit-
barkeitsbestimmungen in der Arbeitslosenversicherung gemäßen Verständnis von Unterhaltsverpflichtung ent-
verschärft. Zwar forderten ArbeitnehmerInnenvertre- sprechen soll (Pfeil 2008), nur teilweise erfüllt.
terInnen zugleich eine sofortige Erhöhung der Nettoer- Zugleich wurde der „One-Stop-Shop“ für arbeits-
satzrate in der Arbeitslosenversicherung (Tálos 2008b), fähige LeistungsbezieherInnen sukzessive verwässert.
aber die Regierung argumentierte, dass dies ein Teil der Das AMS hätte dabei nach den ursprünglichen Plänen
Mindestsicherungsvereinbarung mit den Ländern sein die Entgegennahme von Anträgen, deren Überprüfung
müsse. sowie die Berechnung und die Überweisung der Leistung
Die unmittelbare Reform der Sozialhilfe und damit getätigt. Die Bestimmung zur Einkommens- und Ver-
die Einführung der bedarfsorientierten Mindestsiche- mögensüberprüfung wäre überdies stark an die der Not-
rung wurde dagegen nicht rasch umgesetzt, obwohl be- standshilfe oder der Ausgleichszulage angelehnt worden
reits Anfang 2007 eine diesbezügliche Arbeitsgruppe (Pfeil/Otter 2011). Die Länder wehrten sich jedoch gegen
aus VertreterInnen des Bundes, der Länder, der Städte den Verlust der Kontroll- und Weisungsrechte ohne eine
und Gemeinden sowie der Sozialpartner eingerichtet gleichzeitige Kostenübernahme durch den Bund. Die
worden war. Anders als unter der Vorgängerregierung Bundesländer Vorarlberg und Niederösterreich stimm-
von ÖVP und FPÖ war dabei die Zusammenlegung von ten in einer ersten internen Abstimmungsrunde gegen
Sozial- und Notstandshilfe kein Thema, unter anderem eine umfassende Übertragung der Kompetenzen für die
weil die vorangegangenen und in diese Richtung deu- Zahlung der Mindestsicherungsleistung an das AMS.26
tenden Reformen in Deutschland jedenfalls für manche In beiden Bundesländern wurden neben den Landes-
Beobachter ihren Glanz schon verloren hatten. So mein- hauptmännern auch die Soziallandesrätinnen durch die
te der damalige Sozialminister Buchinger (2008, 8), dass ÖVP gestellt. Man einigte sich schließlich darauf, dass
„Fehler [zu] vermeiden [seien], die in anderen Ländern gemacht das AMS nur mehr vorüberprüfen solle.27
Mit April 2008 wurde ein Ministerialentwurf über
21 Vgl. z.B. die folgenden APA- und OTS-Presseaussendungen: APA263
II 26.02.2007, „Grüne über Buchingers Erbe in Salzburg: Viel Schein, eine Art.-15a-B-VG-Vereinbarung zwischen Bund und
wenig Sein“; OTS 022 II 10.01.2007, „Attac: Große Koalition setzt Ländern zur Stellungnahme ausgesandt (vgl. 188/ME,
neoliberalen Kurs fort“; APA 240 II 05.01.2007, „Koalition – Grüne XXIII Gesetzgebungsperiode). Das AMS wandte ein, dass
warnen vor ‚Koalition der Lippenbekenntnisse‘“.
22 Vgl. z.B. APA Presseaussendung: APA272 II 22.12.2006, „Koalition: es hoheitsrechtliche Aufgaben von einer Landesbehörde
Diakonie sieht in Mindestsicherung kaum Verbesserungen. übernehmen würde, wenn es Vorüberprüfungen durch-
Chalupka: Ohne Glitzerpapier ist Mindersicherung nur alte führen sollte (19/SN-188/ME, XXIII. Gesetzgebungspe-
Sozialhilfe“.
23 Vgl. APA Presseaussendung: APA223 II 15.12.2006, „Nationalrat: riode). In Folge wurde die Rolle des AMS dahingehend
Mindestpension angehoben – Rot-Schwarzer Knatsch“. modifiziert, dass es in Sachen Mindestsicherung als
24 Dies betraf aber nur noch wenige Beschäftigte, da die Anzahl der reine Informations- und Antragsstelle fungiert und die
Vollzeiterwerbstätigen, die weniger verdienten, schon zuvor von
243.000 im Jahr 2003 auf 30.000 im Jahr 2007 zurückgegangen
war (vgl. Hermann 2009). 26 Vlg. Der Standard, 27. 2. 2008, „Warten auf Mindestsicherung“;
25 Vgl. APA-Presseaussendung: APA0711 II, WI 04.12.2007, Der Standard, 3. 4. 2008, „Länder machen Weg frei für
„Nationalrat: Schärfere Zumutbarkeitsbestimmungen für Mindestsicherung“.
Arbeitslose Utl.: Freie Dienstnehmer bekommen künftig 27 Vgl. Der Standard, 9. 1. 2008, „Unsichere Mindestsicherung“; Der
Arbeitslosengeld“. Standard, 11. 4. 2008, „Bund und Länder erzielten Einigung“.Sie können auch lesen