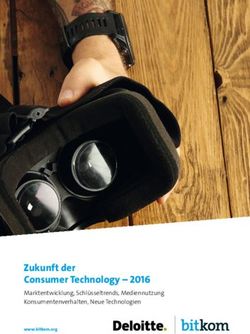Magnier, Aline Soziale Netzwerke StudiVZ, Facebook und Xing; Konzepte und Chancen der kommerzieller Nutzung - Bachelorarbeit
←
→
Transkription von Seiteninhalten
Wenn Ihr Browser die Seite nicht korrekt rendert, bitte, lesen Sie den Inhalt der Seite unten
Fachbereich Medien
Magnier, Aline
Soziale Netzwerke StudiVZ, Facebook und Xing;
Konzepte und Chancen der kommerzieller
Nutzung
- Bachelorarbeit -
Hochschule Mittweida – University of Applied Sciences (FH)
Berlin - 2009Magnier, Aline
Soziale Netzwerke StudiVZ, Facebook und Xing;
Konzepte und Chancen der kommerzieller
Nutzung
- eingereicht als Bachelorarbeit-
Hochschule Mittweida – University of Applied Science (FH)
Erstprüfer
Prof. Dr. Otto Altendorfer
Zweitprüfer
Dr. Dirk Radtke
Berlin- 2009
21. Einleitung ......................................................................................................4
2. Begriffliche Grundlagen...............................................................................5
2.1 Soziale Netzwerke im Internet................................................................................ 5
2.1.1. Soziologische Perspektive .................................................................................. 6
2.1.2 Technische Perspektive ....................................................................................... 9
2.2 Internetökonomie ................................................................................................. 12
2.2.1 Geschäftsmodell Commerce .............................................................................. 13
2.2.1.1 Online-Werbung............................................................................................. 14
2.2.1.2 Targeting in der Online-Werbung ................................................................... 15
2.2.1.3 Affiliate-Marketing......................................................................................... 17
2.2.1.4 Micro-Payment und Benutzungsgebühren....................................................... 20
2.2.2 Geschäftsmodell Content................................................................................... 21
2.2.2.1 Content-Sponsoring........................................................................................ 23
2.2.2.2 Content-Syndication....................................................................................... 24
2.2.3 Geschäftsmodell Context................................................................................... 26
2.2.4. Geschäftsmodell Connection ............................................................................ 26
3. Soziale Netzwerke im Internet ...................................................................28
3.1 StudiVZ (Studentenverzeichnis)........................................................................... 30
3.1.1 Charakterisierung und technische Umsetzung.................................................... 31
3.1.2 Geschäftsmodell................................................................................................ 33
3.2 Facebook.............................................................................................................. 36
3.2.1 Charakterisierung und technische Umsetzung.................................................... 37
3.2.2 Geschäftsmodell................................................................................................ 39
3.3 Xing..................................................................................................................... 43
3.3.1 Charakterisierung und technische Umsetzung.................................................... 44
3.3.2 Geschäftsmodell ................................................................................................ 46
4. Vergleichende Analyse der ökonomischen Konzepte ............................49
5. Entwicklungsperspektiven ........................................................................53
5.1 Social Commerce ................................................................................................. 54
5.2 Soziale Netzwerke für Unternehmen .................................................................... 57
5.3 Wrap up – Thesen ................................................................................................ 59
6. Resümee .....................................................................................................60
7. Literaturverzeichnis ...................................................................................63
Abbildungsverzeichnis……………………………………………………………………..65
31. Einleitung
Die sozialen Netzwerke im Internet, die auch häufig mit der englischen
Bezeichnung Social Networks beschrieben werden, gehören seit einigen Jahren
zu den am schnellsten wachsenden Applikationen im Internet.1
Die vorliegende Arbeit beschäftigt sich mit der bereits realisierten und
perspektivisch möglichen kommerziellen Nutzung der sozialen Netzwerke.
Um dieser Aufgabe gerecht zu werden, müssen im Vorfeld die Begriffe und
Dimensionen definiert werden, die die sozialen Netzwerke ausmachen. Das gilt
auch für die Konkretisierung der kommerziellen Nutzung der sozialen
Netzwerke. Das Kapitel 2. dieser Arbeit wird sich folgerichtig, sowohl mit den
Grundlagen und Funktionen der sozialen Netzwerke beschäftigen, als auch den
kommerziellen Aspekt, hier die Internetökonomie, definieren.
Nach den notwendigen Definitionen der verwendeten Termini und deren
Funktionsweise unter Einbeziehung der ökonomischen Ausrichtung werden drei
Beispiele sozialer Netzwerke dargestellt, die auf dem deutschen Markt große
Bedeutung haben. Für die Darstellung wurden die Portale StudiVZ, Facebook
und Xing gewählt. Bei dieser Auswahl spielt es eine wichtige Rolle, dass der
Anbieter auf den deutschen Markt agiert und eine bestimmte Ausrichtung
vorweist, die wiederum auf weitere Anbieter der Branche übertragbar wäre. Auf
diese Weise sollte ein Abbild der Marktstrukturen der sozialen Netzwerke in
Deutschland wiedergegeben werden. Die einzelnen Beispiele werden
hinsichtlich ihrer Charakterisierung und technischer Umsetzung vorgestellt und
anschließend anhand ihrer Geschäftsmodelle analysiert.
Im Anschluss im Kapitel 4. werden die einzelnen Geschäftskonzepte mit
einander verglichen, daraufhin werden generelle Tendenzen in der
kommerziellen Verwendung sozialer Netzwerke herausgearbeitet. Im Kapitel 5.
werden Vorschläge und Denkansätze vorgestellt, die zukünftig bei der
Kommerzialisierung der sozialen Netzwerke Verwendung finden können. Der in
die Zukunft der sozialen Netzwerke weisende Abschnitt schließt, die hier
vorliegende Untersuchung ab.
1
Vgl. Patalong Frank: Communitys krempeln Netz-Nutzung um. In:
http://www.spiegel.de/netzwelt/web/0,1518,druck-612124,00.html Zugriff am 09.03.09
42. Begriffliche Grundlagen
2.1 Soziale Netzwerke im Internet
Mit dem Thema der sozialen Netzwerke beschäftigen sich viele Disziplinen wie
die Kommunikationswissenschaften oder die Ökonomie, um nur zwei von
diesen zu nennen. Doch was steckt dahinter? Was ist ein soziales Netzwerk?
Keupp und Röhrle bezeichnen soziale Netzwerke als „..die spezifischen
Webmuster alltäglicher sozialer Beziehungen..“2 Detaillierter beschreibt es
Diewald, indem er sagt, dass ein soziales Netzwerk: “… die Gesamtheit der
sozialen Beziehungen einer Person (...) gängigerweise unterteilt in
Familienbeziehungen, Beziehungen zur Verwandtschaft, zu Nachbarn,
Freunden, Bekannten und eventuell Arbeitskollegen..“3, wobei er das
Individuum selbst in den Mittelpunkt der Beziehungen rückt. Es gibt zwei
Blickwinkel auf ein soziales Netzwerk. Das erste untersucht das Individuum
selbst und stellt dieses mit all seinen Verknüpfungen in das Zentrum des
Netzwerkes. Es wird als persönliches Netzwerk bezeichnet. Die zweite
Möglichkeit besteht darin, das Gesamtnetzwerk zu analysieren mit all seinen
unterschiedlichen Personen und deren Verknüpfungen in ihm.4 Beiden
Blickwinkeln gemein ist, dass der Mensch als Knotenpunkt gesehen wird von
dem aus Verbindungen zu anderen Menschen ausgehen, die ihrerseits
wiederum als Knotenpunkte in Erscheinung treten.5
2
Keupp/Röhrle: Soziale Netzwerke, New York 1987. S. 7
3
Diewald Martin: Soziale Beziehungen: Verlust oder Liberalisierung?, Berlin 1991. S. 61
4
vgl. Gräf, Lorenz, In Soziologie des Internet, Frankfurt/Main 1997. S. 99ff
5
vgl. Keupp/Röhrle 1987, S. 12
52.1.1. Soziologische Perspektive
Will man sich der soziologischen Perspektive von sozialen Netzwerken im
Internet nähern; bedarf es einer Beleuchtung der Beziehungen, in der
Menschen zueinander stehen können. So bezeichnet Schenk die kleinste
mögliche Gesellschaftsform, nämlich die, zweier Menschen untereinander, als
Dyade.6 Als Beispiel mag die Partnerbeziehung oder das Mutter-Kind-
Verhältnis gelten. Wird dieser Kreis um eine oder mehrere Personen erweitert,
die zueinander in einer Beziehung stehen, spricht man von einer Gruppe.
Häusler definiert die Gruppe als: “ ... ein in seiner Mitgliederanzahl begrenztes
Beziehungsgeflecht, in dem die einzelnen Beteiligten in hohem Maß
untereinander interaktiv verbunden sind, und sich dieser Gruppe zugehörig
fühlen.“7 Der Begriff des sozialen Netzwerkes wird dem Begriff der Gruppe
nahe gestellt. So bemerkt Wellmann, eine „Gruppe ist ein soziales Netzwerk
(...) dessen Bindungen eng auf einen abgegrenzten Bereich beschränkt und
dicht verknüpft sind, so dass fast alle Netzwerkmitglieder direkt miteinander in
Verbindung stehen“8 Granovetter unterscheidet in seinem bekannten Aufsatz „
The Strength of Weak Ties“ nach Kontakten zu entfernten Bekannten, den „
Weak Ties“ und nach Beziehungen zu engen Freunden, den „Strong Ties“.9
6
vgl. Wellmann Barry: Die elektronische Gruppe als soziales Netzwerk, Wiesbaden 2000. S.
134
7
Häusler Sascha: Soziale Netzwerke im Internet: Entwicklung, Formen und Potenziale zu
kommerzieller Nutzung, Siegen 2007. S. 3
8
Wellmann 2000, S. 135
9
vgl. Beck, Christoph, In: Rekrutieren in sozialen Netzwerken, Koblenz 2008. S. 4
6Abbildung 1.: Funktionsweise sozialer Netzwerke. In: Beck 2008, S. 4
Fasst man all diese Definitionen und Ansätze zusammen definiert sich ein
soziales Netzwerk als ein soziologisches Konstrukt mit einer abgegrenzten
Menge an Personen, die über soziale Beziehungen miteinander verbunden sind.
Der Nutzen eines solchen sozialen Netzwerks für den Einzelnen wird in der
Soziologie als Sozialkapital bezeichnet. Gräf konstatiert in diesem
Zusammenhang, dass dieses persönliche Netzwerk oder auch
Beziehungsreservoir eine Anzahl von Personen darstellt, auf die: „ ... Ego als
eine Art Ressource bei der Verfolgung eigener Ziele zurückgreifen kann, und die
ihm in irgendeiner Weise bei der Erreichung seiner Ziele behilflich sind ... “.10
Beck listet die hauptsächlichen Funktionen von sozialen Netzwerken
folgendermaßen auf:
Information
Tausch und Transfer von Ressourcen
Soziale Unterstützung
10
Gräf 1997, S. 104
7(materiell, kognitiv, emotional)11
und zitiert das Sozialkapital folgendermaßen:
„ Das Sozialkapital ist die Gesamtheit der aktuellen und potentiellen Ressourcen, die mit
dem Besitz eines dauerhaften Netzes von mehr oder weniger institutionalisierten
Beziehungen gegenseitigen Kennens und Anerkennens verbunden sind; oder anders
ausgedrückt, es handelt sich dabei um Ressourcen, die auf der Zugehörigkeit einer
12
Gruppe beruhen“.
Es geht also um Austauschbeziehungen, die ein Geben und Nehmen zu
beiderseitigem Vorteil voraussetzen. Dies kann nur entstehen, wenn sich die
Mitglieder untereinander Zugang gewähren, was nur gewährleistet ist, wenn sie
Vertrauen zueinander haben. Das Kapital, welches der Mensch allgemein
angestrebt, listet Beck in folgenden Unterpunkten auf:
Physisches Kapital: Pflanzen, Tiere, Menschen
Finanzkapital: Geld, Wertpapiere
Humankapital: Wissen, Bildung, Erfahrung
Kulturelles Kapital: Kenntnisse und Benutzung der dominanten Symbole
und Bedeutungen
Sozialkapital: a) „gute“ Beziehungen (Mikroebene)
b) Netzwerke, Normen und Vertrauen (Makroebene)13
Das Sozialkapital mit seiner Mikro- und Makroebene ist hier ein wichtiger Faktor,
um soziale Beziehungen zu schaffen oder zu erhalten, die früher oder später den
unmittelbaren Nutzen versprechen können, weitere Kapitalarten zu
erwirtschaften. Die Risiken von Sozialen Netzwerken sieht Beck beispielsweise
darin, dass der Einzelne durch das Netzwerk in Abhängigkeiten geraten kann
oder ein Partner mehr nimmt als er gibt. Weiterhin besteht die Gefahr der
Korruption und des Entstehens von Differenzen zwischen Mitgliedern und Nicht-
Mitgliedern. Die Chancen von Sozialen Netzwerken sieht er darin, dass mit ihrer
11
vgl. Beck 2008, S. 4
12
Ebd., S. 6
13
vgl. Ebd., S. 6
8Hilfe neue Kontakte geknüpft oder wiederbelebt werden können, sie die
Koordination und Kommunikation erleichtern und gegenseitiges Vertrauen
fördern.14
2.1.2 Technische Perspektive
Wie bereits im vorhergehenden Kapitel dargelegt wurde, können durch den
Kommunikationskanal Internet neue Kontakte aufgebaut und bestehende
Kontakte intensiviert und gepflegt werden. Das Netz ist also eine geeignete „ ...
Option, um den Kreis möglicher Beziehungen über den unmittelbaren sozialen
und geographischen Raum hinaus zu erweitern ...“15 Geschehen kann dies
mittels Internet-Telefon oder E-Mail auf eine schnelle und zunehmend
kostengünstige Weise selbst über große Entfernungen hinweg. Vorteilhaft für
den Nutzer ist dabei vor allem, dass die Kommunikation untereinander zeitlich
versetzt geschehen kann. Den Nutzen dieser Dienste genießen hauptsächlich
Interessengruppen, die gemeinsame Neigungen oder Interessen verfolgen. Sie
schließen sich in virtuellen Gemeinschaften, z.B. zu sogenannten Foren oder
Communities zusammen, um sich über ihre gemeinsamen Interessen
auszutauschen. So finden sich im Netz Gemeinschaften von Sportarten, ebenso,
wie die von Reiseinteressierten, Kochliebhabern, Wirtschafts- und
Politikinteressierter und Fans prominenter Persönlichkeiten. Einer ARD/ZDF-
Onlinestudie aus dem Jahr 2007 zufolge besitzen mittlerweile über die Hälfte der
deutschen Haushalte einen Internetanschluss, Tendenz steigend. Döring
konstatiert jedoch, dass das Internet hauptsächlich „ ... lockere sachbezogene
Beziehungen ...“16 herstellt, die nur dann eine engere Bindung erfahren, wenn
nach dem Erstkontakt im Internet eine Interaktion in der realen Welt erfolgt.17
Der bisher dargestellte Aspekt der Kommunikation zur Nutzung eines
14
vgl. Beck 2008, S. 8
15
Heintz Bettina: Gemeinschaft ohne Nähe? Virtuelle Gruppen und reale Netze In: Thiedeke
(Hrsg.):Virtuelle Gruppen, Wiesbaden 2000. S. 208
16
Döring Nicola: Sozialpsychologie des Internet, In: Die Bedeutung des Internet für
Kommunikationsprozesse, Identitäten, soziale Beziehungen und Gruppen, Göttingen 1999. S.
364
17
vgl. Ebd., S. 355ff
9persönlichen Netzwerks durch das Internet kann erweitert werden durch
sogenannte Social Networking Sites (SNS). Diese bieten dem Nutzer die
Möglichkeit, über die Beziehungspflege hinaus indirekte Beziehungen
aufzudecken und Zugriffe darauf zu erleichtern.
Für den Begriff Social Software, der den Social Networking Sites vorausgeht,
gibt es noch keine endgültig klärende Definition. Für Alby unterscheidet sich
diese Software in zwei Kategorien. Zum ersten in die beschriebene gewünschte
kommunikationslastige Anwendung und weiterhin in Dienste, bei denen die
eingestellten Inhalte von größerer Bedeutung für den Nutzer sind.18 Beispiele
hierfür sind Webblogs, Foren oder Wikis. Was sie alle verbindet, ist die
Tatsache, dass der einzelne Teilnehmer einen kleinen Beitrag zur
Gesamtleistung erbringt. Somit profitieren letztendlich alle Nutzer von dem
gemeinsam erstellten Endprodukt. Dies kann beispielsweise mittels
Kommentare geschehen. Es kann gesagt werden, dass es sich bei Social
Software um eine Internetanwendung handelt, auf deren Grundlage viele
Individuen durch gemeinschaftliche Kooperation einen höheren persönlichen
Nutzen erzielen.19 Ein Begriff, der erstmals 2004 durch den Verleger Tim
O´Reilly im Zusammenhang mit Social Software aufkam, war der Begriff „Web
2.0“. Der Verleger entwickelte in dem Zusammenhang sieben viel beachtete
Kernkompetenzen, wovon ein im „Web 2.0“ tätiges Unternehmen seiner Meinung
nach mindestens eine aufweisen sollte:
„Nutzung des Internets als Plattform für das Angebot von Diensten
Ausnutzung individueller Nischennachfrage nach dem System des „Long
Tail“
Nutzung der kollektiven Intelligenz bzw. des kollektiven Wissens der
Anwender
Zugriff auf eine exklusive Datenbank, die als Einkommensquelle fungiert
Betriebsabläufe, die die ständige Pflege und fortlaufende Entwicklung der
Software ermöglichen und dies auch durch die Nutzer
18
vgl. Alby Tom: Web. 2.0 Konzepte, Anwendungen, Technologien, Seite 90, München 2007, S.
90
19
vgl. Ebd., S. 230
10 Entwicklung von „Leigthweight Models“, die auf Einfachheit und
Koppelbarkeit beruhen und sich auf die Ebenen Programmierung,
Benutzerschnittstellen und Geschäftsmodellen beziehen können
Entwicklung von Software, die über das einzelne Endgerät Computer
hinaus geht.“20
Laut Alby haben neue Technologien, wie beispielsweise diejenigen, zur
Erhöhung der Zugangsgeschwindigkeit oder eine einfachere Nutzbarkeit des
Internets, wesentlich dazu beigetragen, dass „Web 2.0“ überhaupt möglich
gemacht werden konnte. Durch die neu entstandene verstärkte
Wettbewerbssituation konnten Gebühren gesenkt und weitere Privatkunden und
Internet-Nutzungsszeiten gewonnen werden.21 Zudem stieg das Vertrauen in das
Medium Internet, welches zuvor mit Anonymität gleichgesetzt wurde, da die
Preisgabe der Identität eines Nutzers Voraussetzung dafür wurde, von der
Anwendung zu profitieren.22
Ein weiterer Begriff in diesem Zusammenhang ist der Begriff „User generated
Content“. Hierbei handelt es sich um „ ... massenmediale Inhalte, die von
Konsumenten ohne direkte Gewinnerzielungsabsicht bereitgestellt werden ... .“23
Der Nutzer stellt sich bei dieser Anwendung nicht nur als Konsument dar,
sondern produziert selbst. Das kann geschehen, indem er Musik, Fotos oder
Filme publiziert, aber auch in Foren diskutiert. Zu den User generated Content
gehören beispielsweise youtube.com oder wikipedia.org. Die Motivationen der
Anwender sind unterschiedlicher Art. Die Bereitstellung der Produkte kann aus
Hilfsbereitschaft geschehen, aber auch für den eigenen Identitätsaufbau,
Gewinnabsichten oder Aufbau von Sozialkapital genutzt werden. Als Plattform
können Seiten von Unternehmen dienen, die damit eine kostengünstige Variante
erschaffen, ihre Seite mit Inhalten zu füllen, bei der ein Mehrwert entstehen
kann. So kann User generated Content durchaus zur Verbesserung des Images
eines Unternehmens beitragen oder als Marktforschungsinstrument dienen.24
20
Häusler 2007, S. 19
21
vgl. Alby 2007, S. 3ff
22
vgl. Szugat/Gewehr/Lochmann: Social Software, Paderborn 2006. S. 83
23
Stöckl/Grau/Hess: User generated Content, In: Medienwirtschaft 4/2006, Seite 47
24
vgl. Schweiger/ Quiring: User generated Content auf massenmedialen Websites- eine Spielart
der Interaktivität oder etwas völlig anderes?, In: Friedrichsen/Mühl-Benninhaus/Schweiger:
Neue Technik, neue Medien, neue Gesellschaft?, München 2007. S. 105f
11Dies zeigt eine deutliche Verbesserung des Prinzips des sozialen Netzwerks im
Internet, zu welchem „Web 2.0“ wesentlich beigetragen hat.
2.2 Internetökonomie
Als Grundlage der Internetökonomie vor dem Hintergrund der sozialen
Netzwerke wurden die begrifflichen Grundlagen des Geschäftsmodells nach
Mörl/Groß verwendet. Demnach ist ein Geschäftsmodell ein Abbild dessen was
als Ressource in den Leistungsprozess einfließt und in vermarktungsfähige
Formen wie Information, Produkt oder Dienstleistung transformiert wird.25
Die Bestandteile eines Geschäftsmodells teilen sich in die Value Proposition, die
Architektur der Leistungserstellung und das Ertragsmodell. Bei der Value
Proposition handelt es sich um den Nutzen den das angebotene Produkt oder
Dienstleistung spendet. Dabei geht es sowohl um den subjektiven Nutzen des
Kunden im Sinne der Bedürfnisbefriedigung, als auch um den
Wertschöpfungspartner der ein Teilbestand des Geschäftsmodells sein kann.
Zur Architektur der Leistungserstellung zählen hingegen Entwürfe des Produktes
und die Differenzierung des Marktes in dem das Unternehmen agiert. Darüber
hinaus beinhaltet die Architektur der Leistungserstellung eine interne und eine
externe Komponente. Die interne Architektur bezieht sich auf die intern
genutzten Ressourcen, die Wertschöpfungsstufen, interne
Kommunikationskanäle und Mechanismen der Koordination im Betrieb. Bei der
externen Architektur tritt das Unternehmen seinen Kunden gegenüber. An dieser
Stelle wird mit der Kundschaft kommuniziert, die Waren werden vertrieben, die
Preise festgelegt und Wertschöpfungspartner identifiziert. Schließlich gehört zum
Geschäftsmodell auch ein Ertragsmodell, das die Erlöse generiert und die
Einkommensquellen des Unternehmens nennt. Der Ertrag gibt den Wert an, der
für die Eigentümer des Unternehmens als Gewinn bereitgestellt wird.26
25
vgl. Mörl Christoph/Groß Mathias: Soziale Netzwerke im Internet. Analyse der
Monetarisierungsmöglichkeiten und Entwicklung eines integrierten Geschäftsmodells.
Boizenburg 2008. S. 84
26
vgl. Ebd., S. 84f
12Im Bereich der Internetökonomie stützen sich die Geschäftsmodelle im
wesentlichen auf die folgenden vier Bereiche des Internets:
In:
Abbildung 2: Ansatzbereiche der Internetökonomie.
http://www.medientage.de/mediathek/archiv/2001/schlegel_praesentation.pdf
Zugriff 17.04.09
2.2.1 Geschäftsmodell Commerce
Der Bereich des Geschäftsmodells Commerce stützt sich auf direkte
Geschäftstransaktionen im Internet. Ziel des Geschäftsmodells ist es, den
traditionellen Handel durch den Einsatz des Internets zu unterstützen bzw.
auszuweiten. Diese Unterstützung erfolgt in drei Phasen: Attraction,
Bargaining/Negotiation und Transaction. Zur Phase Attraction zählt vor allem
die Werbung, die den Kunden auf ein Produkt bzw. eine Dienstleistung
aufmerksam macht. Bargaining/Negotiation betrifft den Vorgang der sich im
direkten Vorfeld des Handelsabschlusses befindet, d.h. die Vertragsbedingung,
Lieferkonditionen, Preisvereinbarungen, Kaufformen oder andere Spezifika. Die
13Transaction-Phase bezieht sich hingegen auf die Auslieferung und
Zahlungsabwicklung.27
2.2.1.1 Online-Werbung
Die Online-Werbung bezeichnet die Platzierung von Werbebotschaften, auch
Bannerwerbung genannt, auf den Webseiten. Die Werbebotschaften können in
unterschiedlichen technischen und gestalterischen Formen dargeboten werden.
Es gibt sowohl die Möglichkeit die Banner als statische, animierte oder auch
interaktive Flächen zu präsentieren. Ferner haben sich inzwischen
unterschiedliche Größen, Erscheinungsbilder und Herstellungsarten etabliert.
Die Berechnung des Preises für die Bereitstellung der Werbefläche wird ähnlich
wie bei den klassischen Medien entweder auf der Basis der Sichtkontakte oder
in Abhängigkeit von der Dauer der Präsentation berechnet. Dabei wird in der
Regel ein fester Preis für jeweils 1000 Sichtkontakte oder für einen bestimmten
Buchungszeitraum vereinbart. Die Festsetzung des Preises für die eben
aufgeführten Einheiten variert je nach Format, Anordnung auf der Website und
der Marktstellung der Seite.28
Den größten Anteil an der Online-Werbung hat die reichweitenorientierte
Bannerwerbung. Trotz der großen Bedeutung der Bannerwerbung muss
gleichzeitig aber auch auf zwei Tendenzen hingewiesen werden, die gerade in
den letzten Jahren immer wichtiger geworden sind. So hat sich einerseits die
Nutzung des Internets immer weiter spezifiziert, so dass ein zielloses Surfen
konstant abnimmt. Andererseits sinkt damit auch die Bereitschaft der
Internetnutzer Werbebotschaften überhaupt aufzunehmen.29 Ferner werden
vielfach gerade auch in sozialen Netzwerken Meinungen vertreten, die sich
lautstark gegen Werbung wehren und diese immer weniger tolerieren. Die
Anzahl der Klicks auf die Banner sinkt kontinuierlich seit mehreren Jahren. Die
Werbeindustrie reagierte auf diese Entwicklung mit einer Verstärkung der
27
vgl. Habann Frank: Innovationsmanagement in Medienunternehmen. Theoretische
Grundlagen und Praxiserfahrungen. Wiesbaden 2003. S. 98
28
vgl. Mörl/Groß 2008, S. 90
29
vgl. Ebd., S. 91
14Werbefrequenzen und dem Ausweichen auf andere Werbeformen, die weniger
Streuverluste aufweisen.30
2.2.1.2 Targeting in der Online-Werbung
Beim Targing in der Onlinewerbung handelt es sich um Werbeformen, die
gezielt konkrete Nutzer ansprechen und daher den Streuverlust der sonstigen
traditionellen Werbeformen minimieren. Diese Werbeform ist derzeit nicht weit
verbreitet, da sie häufig auf Kritik der Konsumenten stößt. Sie wird als
besonders massiv und aufdringlich empfunden.
In der Werbebranche ist der Reiz des Targetings vor allem darin enthalten,
dass es die Relation zwischen dem Werbenden und den Konsumenten bei
Targeting eine 1:1 Kommunikationssituation bedeutet, anders dagegen bei der
reichweitenorientierten Online-Werbung die eine Kommunikationssituation 1:n
herstellt. Die Größe n bleibt in dem Zusammenhang variabel und kann daher
nicht eindeutig den Werbebotschaften zugeordnet werden.31 Für das Targeting
sind die sozialen Netzwerke gerade deshalb so interessant, da sie ihre Nutzer
bereits nach bestimmten Merkmalen selektiert haben und daher sehr konkrete
und leicht zuzuschreibende Datenbestände vorweisen. Streng genommen
bilden die Selektionsformen der sozialen Netzwerke in ökonomischer Hinsicht
Zielgruppen. Diese Zielgruppeneinordnung lässt sind einerseits über die
Profildaten herstellen. So sind Angaben über Studienort, Alter und Geschlecht
leicht zu zuordnen. Darüber hinaus haben die Betreiber der Netzwerke auch
Informationen über die Logfiles und Klickpfade der Nutzer innerhalb des
Netzwerkes, die noch genauere Angaben über das Verhalten und die
Interessen des Nutzes enthalten. Diese Informationen, d.h. die Profildaten aber
auch die Verhaltens- und Interessenmerkmale in den Netzwerken sind für die
Targeting-Werbelösungen von größter Bedeutung.32 Die Autoren Mörl und Groß
haben in der folgenden Abbildung die vier häufigsten Möglichkeiten des
30
vgl. Mörl/Groß 2008, S. 91
31
vgl. Ebd., S. 96
32
vgl. Ebd., S. 96f
15Targeting angeführt. So ist es möglich Werbeinhalte nach den dem Nutzer
bevorzugten Inhalten zu senden oder die Werbebotschaft nach dem Verhalten
des Nutzers auszurichten. Ferner bieten demographische Daten, wie Bildung,
Geschlecht und Alter oder auch Angaben zur Wohnregion samt IP-Adresse
hervorragende Ausgangspunkte für das Targeting.33
Contextual Targeting Behavioral Targeting
- Werbung erscheint im Kontext - Auswertung nicht
des Inhalts personenbezogener Daten in
- z.B. Google Adwords Kombination mit
Nutzungsverhalten
- z.B. Wunderloop, nugg.ad
Demographic Targeting Geographic Targeting
- Werbung anhand von - Schaltung regional
demographischen Daten wie differenzierter Werbung auf
Alter, Geschlecht, Bildung Basis der IP-Adresse
- z.B. Google, Doubleclick
Abbildung 3: Möglichkeiten des Targeting. In: Mörl/Groß 2008, S. 97
Neben diesen vier meist genutzten Möglichkeiten gibt es auch noch das
Daypart-Targeting, das die Werbebotschaften je nach Tageszeit zuordnet. Hier
würden z.B. Frühstückscerealien am Morgen und Partylocationangebote am
Abend gesendet werden können. Hinzu kommt auch noch die Möglichkeit des
Purchased-Based-Targeting, das sich auf die Suchanfragen des Nutzers
konzentriert und diese ins Verhältnis zu Artikelempfehlungen setzt. Bei dieser
Form des Targetings zeigt insbesondere der Onlinebuchhändler
www.amazon.de seine führende Rolle. Die Kunden können bei der Ansicht
33
vgl. Mörl/Groß 2008, S. 97
16eines Produkts die Information bekommen, welche weiteren Artikel von Kunden
angesehen wurde, die diese Artikel gekauft haben.34
2.2.1.3 Affiliate-Marketing
Unter dem Begriff des Affiliate wird die Bewerbung von Produkten und
Dienstleistungen eines Unternehmens, auch Merchant genannt, auf einer
seperaten Website, d.h. auch auf Portalen der sozialen Netzwerke verstanden.
Wird durch die Präsentation der Artikel auf der Website ein bestimmter Umsatz
generiert, so wird die präsentierende Website finanziell vom Merchant honoriert.
Seitens des Websiteanbieters, in dem Zusammenhang auch Affiliate genannt,
werden für die Präsentation spezielle Instrumente angeboten. Im Zentrum steht
dabei der sgn. Partnercode, der bei der Weiterleitung des Nutzers auf das
kommerzielle Angebot mit Eindeutigkeit den Pfad vom Affiliate zum Merchant
nachzeichnet und auf diese Weise eine provisionsanhängige Beteiligung des
Affiliate am Geschäft des Merchant ermöglicht.35 Dabei sind drei
Entgeldungsformen üblich:
- „pay-per-click“ – Die Provision wird auf der Basis der erfolgten
Klickzahlen berechnet
- „pay-per-lead“ – Die Provision wird auf der Basis von angegebenen
Kundendaten berechnet, z.B. Abonnent, Adressangaben, Download
- „pay-per-sale“ – Die Provision wird auf der Basis des Verkaufsumsatzes
und eines vereinbarten Provisionsprozentsatzes berechnet.36
Die Werbemöglichkeiten des Affiliate-Marketing als Merchant nutzt
insbesondere der Onlinebuchhändler Amazon mit großem Erfolg.
34
vgl. Mörl/Groß 2008, S. 98
35
vgl. Ebd., S. 104
36
vgl. Ebd., S. 104
17„Die Idee des Affiliate Programms war geboren und ist heute eine der entscheidenden
Säulen für Amazons Bekanntheit und Erfolg. Heute verkauft Amazon seine Bücher und
37
CDs auf über 500.000 Partner-Websites weltweit.“
Abbildung 4: Affiliate Networks. In:
Tamble: In:
http://www.contentmanager.de/magazin/artikel_127-
print_einfuehrung_affiliate_marketing.html
Die Rolle der sozialen Netzwerke als Affilate-Vermarkter ist insofern besonders
attraktiv, als dass gerade hier sowohl hohe Nutzerzahlen, zielgruppengerechte
Zuordnung und eine zuverlässige technische Umsetzbarkeit vorhanden sind. In
den letzten Jahren hat sich gleichzeitig mit dem Boom der sozialen Netzwerke
auch das Affiliate-Marketing ausgeweitet. Da hier ideale Vorraussetzungen
einer Zusammenarbeit für beide Affiliatepartner bestehen:
“Ein wichtiges Kriterium für die erfolgreiche Umsetzung eines Affiliate Programms ist die
Integration in die Gesamtstrategie der Vertriebs- und Vermarktungsprozesse von
Anbieter und Partnern. Um mit einem Affiliate Programm relevante Umsätze zu
erwirtschaften, kommt es auf die richtige Strategie, professionelle Partner und ein gutes
Beziehungs-Management gegenüber dem Partner-Netzwerk an.(…) Tatsächlich
bewegen sich mehr als 85% der Webuser außerhalb der großen der Webportale und
Marktplätze. Sie steuern primär Websites an, die ihren speziellen Interessen
37
Tamble Melanie: Einführung ins Affiliate Marketing. In:
http://www.contentmanager.de/magazin/artikel_127_einfuehrung_affiliate_marketing.htm
Zugriff: 15.04.09
18entsprechen, die sogenannten Content- und Community-Websites. Aus diesem Grunde
spielt der themen- und zielgruppenspezifische Content der Partner Websites im Affiliate
Marketing eine besondere Rolle. Mit Hilfe vieler spezieller Themenwebsites können
Online-Unternehmen ihre redaktionelle Expertise in Bereiche ausdehnen, die für das
einzelne Unternehmen selbst nicht erreichbar wären und somit Zielgruppen in der
38
gesamten Tiefe des Internets erreichen.“
Vertriebstheoretisch erweist sich gerade das Affiliate-Marketing als eine der
erfolgreichsten Vertriebsmethoden. Durch die Präsentation der Produkte und
Dienstleistung mit wenigen Streuverlusten und sogar in Nischenbereichen, die
sonst kaum mit den gängigen Werbemitteln erreicht werden könnten, kann
durch das sgn. Long-Tail-Prinzip die gängige Pareto-Verteilung des
Einzelhandels überwunden werden. Das Long-Tail-Prinzip wurde erstmals 2004
von Chris Anderson formuliert und untermauerte wirtschaftswissenschaftlich die
Verrtriebschancen, die das Affiliate-Marketing bietet.39 40
„Das Pareto-Prinzip besagt, dass ein Unternehmen mit 20% seiner Kunden, Produkte
bzw. Zielmärkte – d.h. den größten Kunden, besten Produkten (Bestseller) und
ertragreichsten Zielmärkten – 80% seines Gewinns bzw. Absatzes erzielt. Da
Unternehmen über beschränkte Ressourcen in den Bereichen Kapital, Mitarbeiter und
Infrastruktur (bspw. Lagerfläche) verfügen, werden diese Mittel vorrangig für diejenigen
Aktivitäten eingesetzt, die einen hohen Ertrag versprechen. Mit Hilfe neuester
Technologien lassen sich jedoch auch weniger gängige Produkte gut verkaufen und die
41
80% der Kunden, die lediglich 20% des Umsatzes generieren, effizienter bedienen.“
Nach der Einschätzung von Wirtschaftsexperten wird das Affiliate-Marketing
gerade bei den sozialen Netzwerken in nächster Zeit stark wachsen.
Gleichzeitig wird es aber auch bei dieser Werbeform, wie bereits bei der
traditionellen Bannerwerbung, auch hier einen Grenznutzeneffekt geben. Der
Nutzer wird vom Einsatz der vielen Werbebotschaften überfordert werden und
wird damit beginnen diese sowohl mental als auch physisch auszublenden.
Folgerichtig wird diese Entwicklung weitere Lösungsansätze nach sich ziehen
38
Tamble, Zugriff 15.04.2009
39
vgl. Mörl/Groß 2008, S. 105
40
vgl. Rymarczyk Zbigniew: Die Long-Tail-Theorie. In:
http://www.comarch.eu/de/industries/smb/articles/longtail Zugriff: 16.04.09
41
Rymarczyk, Zugriff: 16.04.2009
19müssen, um den Nutzer intelligenter auf Produkte und Dienstleistungen
aufmerksam zu machen.42
2.2.1.4 Micro-Payment und Benutzungsgebühren
Die Vermarktungsmodelle Micro-Payment und Benutzungsgebühren im Umfeld
der sozialen Netzwerke dienen vor allem der Monetarisierung bestimmter
Funktionen oder auch der Finanzierung durch die massenhafte
Vertriebstätigkeit von niedrigpreisigen Produkten und Dienstleistungen.43
Abbildung 5: Anforderungen an das Micro-Payment. In:
http://de.wikipedia.org/wiki/Micropayment Zugriff: 20.04.09
Anforderungen Käufer: Anforderungen Anbieter:
Hohe Sicherheit Hoher Sicherheitsstandard
Absicherung im Schadensfall Verlässlichkeit, Schutz vor Missbrauch
Kostenfreiheit Geringe Transaktionskosten
Stornomöglichkeit Minimierung der Zahlungsausfälle
Hohe Verbreitung und Akzeptanz des
Viele Akzeptanzstellen
Systems
Benutzerfreundlichkeit Einfache Handhabung
Warenerhalt vor Zahlung Schnelligkeit des Bezahlvorgangs
Anonymität Eindeutige Identifizierung
unkomplizierte Software- und kostengünstige Implementierung im
Hardwareanforderungen Unternehmen
Das Beispiel der Benutzergebühren für die Funktionserweiterungen der
Basisausstattungen ist in Deutschland in sozialen Netzwerken durchaus
bekannt und gängig (siehe Beispiel Xing). Weniger hingegen die Generierung
42
vgl. Mörl/Groß 2008, S. 106
43
vgl. Ebd., S. 106f
20des Umsatzes durch Micro-Payment. Die Verwirklichung dieser Idee scheint am
besten beim asiatischen sozialen Netzwerk Cyworld gelungen zu sein. Hier
haben die Nutzer die Möglichkeiten ihr übliches Profil durch den Erwerb
bestimmter Güter kostenpflichtig zu erweitern. So können sie z.B. Güter wie
virtuelle Möbel oder Kleidung im Micropayment-Bereich kaufen. Das Modell
bewährt sich allerdings allein im asiatischen Raum, wo Cyworld mit der
Micropayment-Strategie allein in Süd-Korea im Jahr 2006 einen Umsatz von
120 Millionen Dollar erzielt hat.44
2.2.2 Geschäftsmodell Content
Das Geschäftsmodell Content basiert auf der Wertschöpfung durch Inhalte. Das
Content-Modell zeichnet sich dadurch aus, dass die Komplexität des im Internet
befindlichen Inhalts durch Sortierung und Einklassifizierung verringert wird.
Dadurch kommt es zur verbesserten Zurechnungsmöglichkeit jeweiliger Inhalte
und ihrer potenziellen kommerziellen Verwendung. Ferner wird auf diese Weise
auch eine Orientierung ermöglicht die sowohl Web-Pages nach Inhalt einordnet,
als auch die Möglichkeit schafft die Kundschaft entsprechend der
45
Orientierungsvorgaben zu lenken.
Diese Inhalte werden aber nicht mehr durch die traditionellen Inhaltslieferanten,
wie Nachrichtenagenturen, Journalisten und Verlage geliefert, sondern durch
die Nutzer selbst. Dadurch sind die Inhalte nicht mehr vom Sender zum
Konsumenten ausgerichtet, sondern zunehmend vom Konsumenten zum
Konsumenten. Die Nutzer, die den Inhalt der sozialen Netzwerke erschaffen
haben innerhalb der Plattformen bestimmte Strukturen geschaffen und vertieft,
die die Verbreitung von Inhalten maßgeblich verstärken. Dazu zählen vor allem
die themenbasierten Gruppen. Der innerhalb dieser Gruppen entstehende
Inhalt obliegt keiner qualitativen Regulierung oder Steuerung, sondern stellt
lediglich den Austausch zwischen den Nutzern dar. Der auf diese Weise
44
vgl. Mörl/Groß 2008, S. 108f
45
vgl. Habann 2003, S. 98f
21entstehende Inhalt wird im Geschäftsmodellansatz Content zum Fundament für
darauf basierende Ertragsmodelle.46
Die ökonomische Verwertung des Geschäftsmodells Content lässt sich nur
bedingt in seiner ganzen Bandbreite beziffern, da es nur ausgesprochen wenige
direkte Content-Ertragsmodelle gibt. Die meisten Content-Ertragsmodelle
funktionieren indirekt. Als eines der ersten direkten Content-Ertragsmodelle ist
der Verkauf der Artikel des Wall Street Journal via Internet bekannt geworden.
Das Modell wird auch als Pay-Content–Modell bezeichnet. Die Schwierigkeit
der ökonomischen Nutzung des Contents liegt vor allem darin, dass die
Mehrheit der Internetnutzer bis heute Inhalte im Internet als öffentliches Gut
empfindet und nicht bereit ist für diese Inhalte direkt zu zahlen.47
Seitens der Betreiber der sozialen Netzwerke werden auf Contentbasis
Möglichkeiten der ökonomischen Nutzung gesucht, die mit externen Partnern,
d.h. interessierten Fremdunternehmen verwirklicht werden. Derartige
Zusammenarbeit wird in der Regel mit der Bezeichnung Online-Kooperation
beschrieben. So werden den Nutzern die Ressourcen der externen
Kooperationspartner bereitgestellt, die wiederum vom externen
Kooperationspartner wirtschaftlich genutzt werden können. Daraus folgt eine
Strategie der Produkt- und Inhaltsverbindung.48
46
vgl. Mörl/Groß 2008, S. 113
47
vgl. Habann 2003, S. 98
48
vgl. Mörl/Groß 2008, S. 113f
22Abbildung 6: Content-basierende Geschäftsmodelle im Internet. In:
http://www.kecos.de/script/21busimodcont.htm Zugriff 17.04.09
2.2.2.1 Content-Sponsoring
Beim Content-Sponsoring handelt es sich um die Finanzierung bestimmter
Contentformen durch Kooperationspartner.
„Content-Sponsoring bedeutet, dass ein Werbetreibender die Präsentation von Content
(Inhalten) auf der Website eines Medienanbieters unterstützt. Das kann zum Beispiel in
Form eines redaktionell aufbereiteten Schwerpunktthemas sein, welches als „Special“
auf der Seite eingebunden wird. Generell wird Content-Sponsoring von den Besuchern
einer Seite als positiv bewertet und nicht als Werbung angesehen, auch wenn die
Inhalte von einem Werbetreibenden präsentiert werden. Die Leser nehmen die Beiträge
ernst, weil sie der Website vertrauen. Dies ist demzufolge eine gute Möglichkeit, sich
über „Specials“ im eigenen Kompetenzbereich bei dem Verbraucher positiv
49
darzustellen.“
Das externe Unternehmen erwartet sich durch dieses Sponsoring die
Verbreitung der Markenbekanntheit und eine Verbesserung des Images.
Darüber hinaus wird sich durch solche auf Content basierende Kooperation um
49
. http://www.mundo-marketing.de/mundo_tipp_i33.html Zugriff 17.04.09
23die Neukundengewinnung bemüht, das in der Folge auch mit positiven Effekten
auf die Umsatzentwicklung wieder zu erkennen ist.50
2.2.2.2 Content-Syndication
Das generelle Prinzip auf das sich die Idee des Content-Syndication stützt geht
auf das folgende Verständnis der Inhalte im Internet ein:
„Im WWW wird unter Content-Syndication die Verbindung von Inhalten verschiedener
Websites verstanden. Besonders interessant ist Content-Syndication für Websites, die
ihr Angebot mit business- und branchenrelevanten Informationen aufwerten wollen. So
zum Beispiel Börsenkurse, aktuelle Nachrichten, aber auch speziell ausgewählte
Inhalte anderer Webseiten. Dies kann durchaus die kommerzielle Vermarktung von
Inhalten umfassen.Die Benutzerseite kann so mit aktuellen Inhalten aufgewertet werden
und sich einen Portalcharakter aneignen. Der Anbieter des Contents kann seine
Reichweite erhöhen, seine Reputation verbessern und evtl. sogar seine Zugriffszahlen
51
steigern.“
Die Content-Syndication kann in zweierlei Formen umgesetzt werden. Die eine
Form bedient sich der Technologie der Widgets und die andere der Mashups.
Das soziale Netzwerk Myspace bedient sich der Technologie des Widgets. Hier
werden auf den Profilseiten des Nutzers mit Hilfe der Widgets eigenständige
Webanwendungen integriert. Praktisch bedeutet dies, dass innerhalb des
Myspace-Netzwerkes auch Anwendungen von Youtube zur Darstellung von
Videos und der mp3player des Portals Beatport bereitgestellt werden.
Folgerichtig wird das Profil des Mitgliedes um interessante Funktionen und
Anwendungen bereichert und erweitert, somit stößt dieses Verfahren selten auf
Kritik. Seitens des externen Unternehmens z.B. Beatport bedeutet dies eine
Mehrfachverwendung der eigenen Inhalte, die nun an mehreren Orten im Netz
Verwendung finden.52 Die Technologie der Mashup wird hingegen vom sozialen
50
vgl. Mörl/Groß 2008, S. 114
51
http://de.wikipedia.org/wiki/Content-Syndication Zugriff: 20.04.09
52
vgl. Mörl/Groß 2008, S. 117
24Netzwerk Facebook genutzt. Bei der Mashuptechnologie handelt es sich um
das Zusammenwirken zweier Systeme mit Unterstützung sgn. APIs:
„Das kollaborative Zusammenarbeiten von mehreren Anwendungen online wird über
die API-Technologie ermöglicht. Ein API ist wörtlich übersetzt ein Application
Programming Interface, zu deutsch: Schnittstelle zur Anwendungsprogrammierung. Mit
ihr kann an ein Softwaresystem ein anderes Programm angebunden werden. Sie
ermöglichen den Austausch von Daten und Interaktionen zwischen zwei
unterschiedlichen Systemen. Zum Beispiel bietet Google seine geografischen Karten
online über eine API an. Damit können eigene Internetanwendungen entstehen, die auf
Googles Kartendaten zurückgreifen und diese sogar mit weiteren Funktionen ergänzen.
Werden zwei Anwendungen über eine API-Schnittstelle kombiniert und bilden eine
53
neue Anwendung, spricht man von einem Mashup.“
Die Nutzung der Content-Syndication wirkt sich positiv auf die Value Proposition
aus und führt so indirekt zu Netzeffekten. Die Nutzer haben ihrerseits eine
erhöhte Vielfalt der Möglichkeiten das eigene Profil zu gestalten. Auch im
Bereich der Gruppengestaltung bieten Mashup- und Widgetstechnologien
Chancen eines unterhalternden Auftritts. Es können Identitätsaspekte mit der
Unterstützung audiovisueller Programme ausgeweitet und verfeinert werden.
Diese zusätzlichen Vorzüge eines sozialen Netzwerks werden auch als value
added content bezeichnet und steigern den Wert des sozialen Netzwerkes.54
Für den Anbieter externer APIs ist die Idee des Content-Syndication gleichfalls
mit Vorteilen verbunden. Die Content-Syndication erlaubt es nämlich den
eigenen Content, z.B. Karthografie von GooglerMap, zu verbreiten ohne dabei
auf die üblichen Marketingwege zurückgreifen zu müssen. Dies ist insofern
interessant als dass die herkömmlichen Marketingwege zunehmend ihre
Effektivität verlieren und hohe Streuverluste vorweisen, was sich in der Zukunft
des Internets vermutlich noch weiter verstärken wird. Content-Syndication
eröffnet damit einen zusätzlichen Weg für die „Customer-to-customer“ –
Kommunikation.55
53
http://www.weandx.de/apis-und-mashups Zugriff 20.04.09
54
vgl. Mörl/Groß 2008, S. 123
55
vgl. Ebd., S. 123
252.2.3 Geschäftsmodell Context
Das Geschäftsmodell des Context funktioniert durch die Aggregation,
Klassifizierung und Systematisierung unterschiedlicher Inhalte, die in den vielen
verschiedenen Internetquellen bereitgestellt werden. Im Zentrum dieses
Geschäftsmodells stehen die Webkataloge und die Suchmaschinen. Diese
Anbieter haben sich auf die Aggregation, Klassifizierung und Systematisierung
von Inhalten spezialisiert und bieten ihre Dienstleistungen auch im Rahmen der
sozialen Netzwerke an.56
Abbildung 7: Contextanwendungen. In: http://www.inf-wiss.uni-
konstanz.de/CURR/winter0102/ec/geschaeftsmodelle.pdf
2.2.4. Geschäftsmodell Connection
Das Geschäftsmodell Connection charakterisiert die Möglichkeit Inhalte und
Informationen in Netzwerken auszutauschen und diesen Vorgang auch
kommerziell zu nutzen. In dem Zusammenhang wird vom viralen Marketing
gesprochen. Die Viralität bezeichnet die gezielte und geplante Verbreitung einer
Information mit dem Ziel ihrer ökonomischen Nutzung. Gerade im Umfeld der
sozialen Netzwerke ist das Einspeisen von Informationen je nach Zielgruppe
sehr effektiv umsetzbar. Ferner bieten die in sozialen Netzwerken vorhandenen
Technologien, Innovationen und Mechanismen eine ausgesprochen günstige
56
vgl. Mörl/Groß 2008, S. 123
26Voraussetzung für Werbekampagnen mit dem Ziel bestimmte Marken bekannt
zu machen oder Dienstleistungen in den Markt einzuführen.57 Am Bespiel des
Netzwerkes Myspace wurde eine Untersuchung vorgenommen, die die
Mechanismen des Geschäftsmodells-Connection aufzeigte und untersuchte.
Dabei wurde die Bedeutung des sgn. „Momentums Effects“ herausgestellt58:
„Er beschreibt die starke Wirkung auf einzelne Nutzer, die sich ergibt, wenn dieser ein
Unternehmen oder eine Marke als „Referenz“ bzw. „Symbol“ in seinem persönlichen Profil
59
angibt und diese als Information an andere Nutzer weitergegeben wird.“
Neben dem positiven Effekt der Werbung einzelner Produkte und
Dienstleistungen können darüber hinaus auch Informationen zur Änderungen
der Produktstrategie oder die Vermittlung von Komplementärleistungen über die
sozialen Netzwerke der Öffentlichkeit nahe gebracht werden bzw. erklärt
werden.60
Schließlich werden die sozialen Netzwerke auch in Sinne des sgn.
Crowdsourcing wirksam. Das Crowdsourcing bezeichnet die Nutzerbeiträge, die
auf bestimmte Produkte oder Dienstleistungen eingehen. Diese Beiträge wirken
gleichsam der kommerziellen Werbung auf die Kaufentscheidungen der Nutzer
ein. Besonders wichtig sind hier spezialisierte Gruppen bzw. Foren. Die
Werbeinteressierten können zwar nur beschränkt absoluten Einfluss auf den
Inhalt solcher Beiträge ausüben, gleichzeitig ist es aber auch möglich in
Verbindung mit dem Geschäftsmodell Content-Sponsoring Befragungen
durchzuführen oder auch die Konsumenten nach eigenen Produktideen und
deren Entwicklungen zubefragen.61
57
vgl. Mörl/Groß 2008, S. 126f
58
vgl. Ebd., S. 128
59
Mörl/Groß 2008, S. 128
60
vgl. Ebd., 128
61
vgl. Ebd., S. 128f
273. Soziale Netzwerke im Internet
Für die vorliegende Untersuchung die die Thematik der sozialen Netzwerke im
Internet mit der Internetökonomie verbindet, wurden als Beispiele sowohl zwei
privatorientierte Plattformen StudiVZ, Facebook ausgesucht, als auch die
Plattform Xing, die eine geschäftliche Ausrichtung vertritt.
Abbildung 8: Soziale Netzwerke und ihre Nutzungsintention. Quelle: Richter/Koch:
Funktionen von Social-Networking-Diensten. München 2008. S. 12
Damit sollte gewährleistet werden, dass die Geschäftskonzepte der Plattformen
insgesamt untersucht werden und nicht ausschließlich die privaten Netzwerke.
„Was sich allerdings nun schnell ändern könnte, denn 2008 war offensichtlich nicht nur in
den Schlagzeilen der hiesigen Medien das Jahr der Networks: Nielsen verzeichnet in der
Nutzung von Social Networks und Blogs (von den Marktforschern zusammenfassend als
"membership services" bezeichnet) hierzulande einen Zuwachs von 39 Prozent von 2007
auf 2008. Inzwischen, behauptet Nielsen, seien 51 Prozent der deutschen Internetnutzer in
62
Social Networks oder Blogs engagiert (weltweit sollen es 67 Prozent sein).“
62
Patalong, Zugriff: 09.03.09
28Abbildung 9: Besucherstatistik der sozialen Netzwerke in Deutschland. In: http://faz-
community.faz.net/blogs/netzkonom/archive/2009/03/09/nielsen.aspx Zugriff: 20.04.09
Die neusten Entwicklungen der sozialen Netzwerke in Deutschland zeichnen
ein deutliches Bild, demnach stagnieren gerade seit dem Ende des Jahres 2008
die bisherigen Marktführer StudiVZ und wer-kennt-wen in ihrer Entwicklung.
Zuwachsraten verzeichnet hingegen seit kurzem das sehr international
ausgelegte Portal Facebook, ohne an die hohen Mitgliederzahlen von StudiVZ
annährend heranzureichen.63
Diese Entwicklung bestätigt auch Von der Burchard in seiner Analyse und geht
in seiner Einschätzung für die Zukunft noch einen weiter Schritt:
„StudiVZ… (ist)…. auf dem absteigendem Ast: Das Studentennetzwerk verliert
kontinuierlich Nutzer an Facebook, schon in diesem Jahr könnte der US-Konkurrent die
Nummer eins in Deutschland werden. Dafür gibt es viele Ursachen. Zum Beispiel, dass
64
sich StudiVZ noch immer auf dem Entwicklungsstand von 2006 befindet.“
63
vgl. “Web 2.0 auf der Überholspur im Internet“ vom 09.03.09. In:
http://faz-community.faz.net/blogs/netzkonom/archive/2009/03/09/nielsen.aspx Zugriff:
10.03.09
64
Von der Burchard Hans: Warum Facebook besser als das StudiVZ ist. In:
http://www.welt.de/webwelt/article3350226/Warum-Facebook-besser-als-das-StudiVZ-ist.html
Zugriff: 10.09.09
293.1 StudiVZ (Studentenverzeichnis)
Die Internetplattform StudiVZ besteht seit Ende Oktober des Jahres 2005. Die
Anmeldung und Teilnahme am Netzwerk stützt sich auf die Ausbildungsorte
bzw. Ausbildungsstätten der Teilnehmer. Zu Beginn bestand der Kreis der im
StudiVZ angemeldeten Teilnehmer aus Studenten. Mittlerweile dehnt sich
dieser Kreis auch auf andere soziale und berufliche Gruppen aus.
Das Konzept dieser Plattform wurde auch in anderen europäischen Staaten
angeboten, so z.B. in Spanien, Frankreich und Polen. Konnte sich aber in
keinem dieser Länder bewähren und wurde am 20. Januar 2009 eingestellt, so
dass derzeit die Plattform StudiVZ als ein speziell deutsches soziales Netzwerk
bezeichnet werden kann. StudiVZ stellt mit 5,5 Millionen Mitgliedern (Stand 1.
Quartal 2008) das größte Onlinemedium dar.65 66
Neben StudiVZ gibt es das
Portal SchülerVZ, das zwar kleiner ist, aber der Funktionsweise und der
Charakteriesierung von StudiVZ gleicht.67 Derzeit sind knapp fünf Millionen
Schüler im Alter ab 12 Jahren bei SchülerVZ gemeldet.68 SchülerVZ
(Schülerverzeichnis) richtet sich allerdings anders als StudiVZ nicht an
Studenten, sondern an Schüler. Es ist anzunehmen, dass die Verantwortlichen
der Plattform StudiVZ das schülerorientierte Netzwerk eingeführt haben, um
den Einstieg ins StudiVZ zu erleichtern, so bald Schüler ins Studentenalter
kommen. Für Postgraduierte gibt es seit 28. Februar 2008 die Plattform meinVZ
in deutscher und englischer Sprache, deren Zugriff sowohl direkt auf StudiVZ
als auch vom StudiVZ auf meinVZ möglich ist.69 Dieser Community gehören
etwa 2,7 Millionen Nutzer an.70
65
vgl. Ness Jorit: Marketingpotenziale von Community-Gruppen am Beispiel der
Studentenplattform StudiVZ. S. 4
66
vgl. http://de.wikipedia.org/wiki/StudiVZ#Geschichte Zugriff: 20.04.2009
67
vgl. Ebd.
68
vgl. Köster Klaus: Internet der Zukunft ist nichts für Stubenhocker. In: http://www.stuttgarter-
nachrichten.de/stn/page/detail.php/1956334/r_article_print Zugriff: 10.03.09
69
vgl. http://de.wikipedia.org/wiki/StudiVZ#Geschichte Zugriff: 20.04.2009
70
vgl. Köster, Zugriff: 10.03.09
30Abbildung 10: Startseite von StudiVZ. In: www.studivz.net Zugriff: 20.04.09
Gegen StudiVZ sind vielfach Vorwürfe laut geworden, die StudiVZ unterstellen
die amerikanische Internetplattform Facebook im Design, in technischer
Umsetzung oder auch im Sprachgebrauch und Funktion zu kopieren.71
3.1.1 Charakterisierung und technische Umsetzung
Bei der sozialen Netzwerkplattform StudiVZ handelt es sich um ein an
Studenten ausgerichtetes Angebot, dem sich zwar auch andere Gruppen
anschließen können und dies auch machen, aber grundsätzlich sind die
Funktionen deren sich die Mitglieder im Netzwerk bedienen können auf
Bedürfnisse von Studenten ausgerichtet.
71
vgl. http://de.wikipedia.org/wiki/StudiVZ#Geschichte Zugriff: 20.04.2009
31Abbildung 11: Funktionen bei StudiVZ. In: www.studivz.net/nutzen.php Zugriff: 20.04.04
Die oben dargestellten Funktionen des Netzwerkes erfüllen beim Nutzer
vielseitige Bedürfnisse, wie z.B. Begegnungen im virtuellen Raum,
Informationen zur Personen. Dies ist insbesondere für die
zwischenmenschlichen Kontakte wichtig, die sowohl an der Uni oder jenseits
von ihr aber unter der betreffenden Gruppe stattfinden. Jede betreffende
Person kann durch StudiVZ gefunden werden und womöglich leichter als in der
Realität kontaktiert werden. StudiVZ ist somit eine Kontaktbörse ohne dabei
allein den Aspekt der Flirtplattform anzunehmen. Alle Kontaktebenen sind
möglich und werden auch dementsprechend verwirklicht.
Die Funktion Kontaktbuch erlaubt es direkt mit einzelnen Personen zu
kommunizieren. Die Profile der Mitglieder sagen viel über die Person aus, da
sie sowohl allgemeine Informationen, als auch Interessen und soziale Kontakte
offenbaren. Die Funktionen, wie Blog, Pinnwand etc. sagen auch viel über den
derzeitigen Gefühlszustand bzw. aktuelle Lage des Mitglieds aus, was
zusätzlich den sozialen Austausch unter den Mitgliedern fördert.
Daraus folgt eine Vertiefung der eigentlichen Netzwerkfunktion, da bei Ansicht
eines Profils das soziale Netzwerk des Mitglieds sichtbar wird, können
Überschneidungen von Kontakten und Interessen leicht nachvollzogen werden.
Die Community bietet die Möglichkeit „Gruppen“ zu bilden. Diese Gruppen
haben ein gemeinsames Anliegen bzw. einen Interessenschnittpunkt, z.B.
32Sie können auch lesen