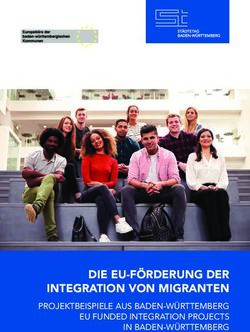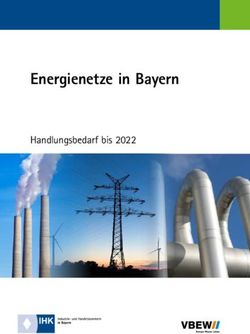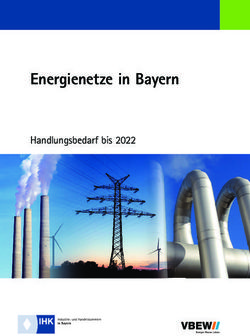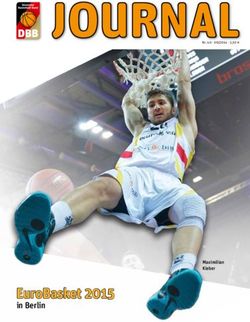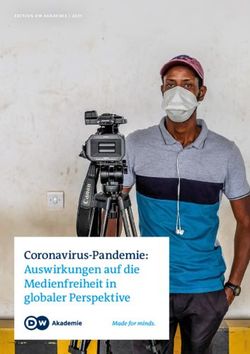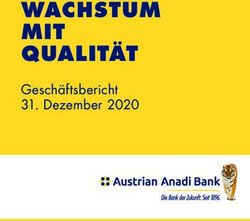Migrations- und Integrationsforschung - Forschungszentrum Migration, Integration und Asyl - BAMF
←
→
Transkription von Seiteninhalten
Wenn Ihr Browser die Seite nicht korrekt rendert, bitte, lesen Sie den Inhalt der Seite unten
Forschungszentrum
Migration, Integration und Asyl
Migrations- und
Integrationsforschung
Jahresbericht 2018 des Forschungszentrums
Migration, Integration und Asyl im Bundesamt für Migration und Flüchtlinge
ForschungMigrations- und Integrationsforschung Jahresbericht 2018 des Forschungszentrums Migration, Integration und Asyl im Bundesamt für Migration und Flüchtlinge Bundesamt für Migration und Flüchtlinge 2019
4 Vorwort
Vorwort
Renate Leistner-Rocca
Leiterin des Forschungszentrums
Migration, Integration und Asyl
Liebe Leserinnen und Leser,
natürlich haben uns auch im Jahr 2018 die Folgen der Zu den Großprojekten gehören insbesondere auch die
hohen Fluchtmigration in 2015/2016 immer noch be- „Evaluation der Integrationskurse“ (EvIK) und die Stu-
schäftigt. die „Muslimisches Leben in Deutschland“, mit der wir
das Standardwerk aus dem Jahr 2009 aktualisieren.
Wie in den Vorjahren stand hier die gemeinsam mit
dem Institut für Arbeitsmarkt- und Berufsforschung Die 2017 angekündigte wissenschaftliche Beglei-
(IAB) und dem Deutschen Institut für Wirtschafts- tung der „Beratungsstelle Radikalisierung“ hat in 2018
forschung Berlin (DIW) durchgeführte „IAB-BAMF- große Fortschritte erzielt; Schwerpunkte lagen hier
SOEP-Befragung von Geflüchteten“ im Mittelpunkt. u.a. auf dem Aufbau eines Netzwerks wissenschaftli-
Mit den Befragungen in 2016 und 2017 steht nun der cher Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter bei den zivilge-
zentrale Datensatz der wissenschaftlichen Öffentlich- sellschaftlichen Partnern vor Ort sowie der Schaffung
keit zur Verfügung, mithilfe dessen sich Fragen zur In- einer Fachtagreihe „InFoEx – International Forum for
tegration der in den letzten Jahren nach Deutschland Expert Exchange on Islamist Extremism“, gemeinsam
gekommenen schutzsuchenden Menschen beantwor- mit der Deutschen Gesellschaft für Auswärtige Politik
ten lassen. Im Forschungszentrum wurden auf dieser e. V.
Basis Studien zu den Aspekten Deutscherwerb/Alpha-
betisierung, Wohnsituation sowie Nutzung von Bera- Im Jahresbericht 2017 hatte ich ebenfalls auf einige
tungsangeboten erstellt. interessante Studien hingewiesen, die wir im Rahmen
des EMN (Europäisches Migrationsnetzwerk) bereits
Gleichzeitig stellen wir aber fest, dass andere Aspekte geplant hatten. Bei der Lektüre dieses Jahresberich-
aus dem Bereich Migration und Integration wieder tes werden Sie u.a. einen Hinweis auf die Studie „Die
eine größere Bedeutung erlangten. Die so behandel- veränderte Fluchtmigration 2014 bis 2016: Reaktionen
ten Fragen reichten vom Familiennachzug und den und Maßnahmen in Deutschland“ finden, die einen
Arbeitsmarktpotenzialen in dieser Gruppe von Zuge- sehr guten Überblick enthält. Auch die Themen Visa-
wanderten, der Arbeitsmarktintegration von Dritt- liberalisierung, internationale Studierende und Reisen
staatsangehörigen bis hin zu möglichen Unterschieden von Schutzberechtigten in ihr Herkunftsland wurden
im Integrationsstand von Deutschen mit türkischem im Rahmen des EMN behandelt.
Migrationshintergrund im Vergleich zu Personen mit
türkischer Staatsangehörigkeit. Mit der Neuorganisation des Bundesamtes zum 1. Ok-
tober 2018 haben sich auch Veränderungen im For-
schungszentrum ergeben. So haben wir die inhaltlicheVorwort 5 Ausrichtung des Forschungsfeldes III hin zur Beob- achtung und Dokumentation längerfristiger Trends, beispielsweise im Rahmen des jährlichen Migrations- berichtes der Bundesregierung, verändert. Der frühere Schwerpunkt Erwerbs- und Bildungsmigration bleibt dabei jedoch weiter mit im Blick, vor allem mit dem halbjährlichen Wanderungsmonitoring. Der Bedarf an wissenschaftlicher Fachexpertise ist in den letzten Jahren deutlich gestiegen, wie die zahl- reichen Informationsanfragen und Einladungen zu Tagungen und Workshops in Ministerien, Stiftungen, Verbänden und an Universitäten zeigen, die an die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Forschungszen- trums ergingen. Diese Anfragen zeigen auch, dass das Forschungszentrum des Bundesamts ein national und international anerkannter Partner in der Migrations- und Integrationsforschung sowie in der Politikbera- tung ist. Diese Mischung aus fundierter Forschung und evidenzbasierter Beratung und Information von Politik und Öffentlichkeit wird auch in Zukunft unsere Arbeit prägen. Ich wünsche Ihnen eine anregende Lektüre! Renate Leistner-Rocca Leiterin des Forschungszentrums Migration, Integration und Asyl
6 Inhalt
Inhalt
1 Forschungszentrum Migration, Integration und Asyl 9
1.1 Auftrag 9
1.2 Organisatorischer Aufbau (2018) 11
1.3 Die Forschungsfelder 12
1.4 Wissenschaftsmanagement 15
1.5 Wissenschaftlicher Beirat 15
1.6 Doktorandenprogramm 16
1.7 Praktikum 17
2 Forschungsschwerpunkte18
2.1 Forschungsschwerpunkt Zu- und Abwanderung,
Zuwanderungssteuerung18
Die veränderte Fluchtmigration in den Jahren 2014 bis 2016: Reaktionen und Maßnahmen
in Deutschland 18
Entwicklungen in Deutschland im Kontext von Visaliberalisierung 19
Resettlement (Neuansiedlung): Aufnahme- und Integrationserfahrungen
von besonders schutzbedürftigen Flüchtlingen 20
Flüchtlingsaufnahme durch das Pilotprogramm „Neustart im Team“ (NesT):
Evaluation des staatlich-gesellschaftlichen Aufnahmeprogramms für Schutzbedürftige 21
Unbegleitete Minderjährige in Deutschland. Herausforderungen und Maßnahmen
nach der Klärung des aufenthaltsrechtlichen Status 22
Anwerbung und Bindung von internationalen Studierenden in Deutschland 23
Evaluation des Bundesprogramms „StarthilfePlus“ zur Förderung der freiwilligen Rückkehr 24
Reisen von Schutzberechtigten in ihr Herkunftsland – Berechtigungen,
Meldewege und Widerrufsverfahren 25
2.2 Forschungsschwerpunkt Integration 27
Evaluation der Integrationskurse (EvIk) 27
IAB-BAMF-SOEP-Befragung von Geflüchteten 29
Integration von Geflüchteten in ländlichen Räumen 32
Forced Migration and Transnational Family Arrangements – Eritrean and Syrian Refugees in Germany
(TransFAR)33Inhalt 7
Integration in den deutschen Arbeitsmarkt für nichtakademische Fachkräfte 33
Arbeitsmarktintegration von Drittstaatsangehörigen in Deutschland 34
Repräsentativuntersuchung ausgewählte Migrantengruppen in Deutschland (RAM 2015) 34
2.3 Forschungsschwerpunkt Dauerbeobachtung von
Migrations- und Integrationsprozessen 36
Migrationsbericht 36
Wanderungs- und Freizügigkeitsmonitoring 37
Analyse „Soziale Komponente“: Qualifikation von Asylerstantragstellenden 38
2.4 Forschungsschwerpunkt Muslime in Deutschland 40
Muslimisches Leben in Deutschland 2019 (MLD 2019) 40
Evaluation der Beratungsstelle „Radikalisierung“ 40
Wissenschaftliche Begleitforschung zur Beratungsstelle „Radikalisierung“ 41
3 Publikationen 44
3.1 Publikationen in den Schriftenreihen des BAMF-FZ 44
Im Rahmen des Europäischen Migrationsnetzwerkes 45
3.2 Externe Publikationen 46
Beiträge in Sammelbänden 46
Beiträge in nationalen bzw. internationalen Zeitschriften 46
Beiträge in sonstigen Medien (Online, Zeitungen, Broschüren etc.) 46
4 Wissenstransfer 48
4.1 Besuchte Veranstaltungen(Auswahl) 48
Mit Vortrag (auf Einladung) 48
Mit Vortrag (öffentliche Ausschreibung/Call for Papers) 49
Teilnahme an Podiumsdiskussionen 50
Teilnahme an Fachgremien und Expertenworkshops 50
4.2 Lehrveranstaltungen 51
4.3 Mitgliedschaften in Beiräten und Jurys 52
4.4 Kolloquien des Forschungszentrums 52
4.5 Sonstige Veranstaltungen 53
Tagung „Unbegleitete Minderjährige in Deutschland und Europa“ der deutschen nationalen
Kontaktstelle des Europäischen Migrationsnetzwerks (EMN), Berlin, 14.06.2018 53
Tag der offenen Tür der Bundesregierung, Bundesministerium des Innern, für Bau und Heimat,
Berlin, 24.-26.08.2018 548 Inhalt
4.6 Mediales Angebot 55
Downloadzahlen von Forschungsstudien 55
Online Präsentation EMN 56
Erfolgsprodukt Working Paper 56
Soziale Medien 57
5 Vernetzung 58
5.1 Europäisches Migrationsnetzwerk (EMN) 58
5.2 Gesprächskreis „Migration und Integration in der Ressortforschung“ 59
6 Abkürzungsverzeichnis 61Forschungszentrum Migration, Integration und Asyl 9
1
Forschungszentrum Migration,
Integration und Asyl
1.1 Auftrag
Das Bundesamt für Migration und Transparenz
Flüchtlinge hat den gesetzlichen Veröffentlichung der Ergebnisse
(hard copy, online), das Forschungs-
Auftrag, wissenschaftliche For- zentrum stellt sich auf eigenen
schung zu Migrations- und und externen Tagungen dem
Integrationsthemen zu be- (öffentlichen/wissenschaftlichen)
Diskurs Vernetzung
treiben (§ 75 Nr. 4 und 4a Eingebunden in die
AufenthG). Ziel ist die universitäre und
Gewinnung von Daten außeruniversitäre
Migrations- und
zur Steuerung des Integrationsforschung
Migrationsgesche-
hens. Um diesen
Auftrag sachge- Berichterstattung
Bewertung und
recht erfüllen zu Berichterstattung
können, wurde zu externen Studien
2005 die Gruppe
Forschung im Bun-
desamt eingerichtet.
Das Forschungszent-
rum leistet mit seiner Erstellen von
Arbeit einen wichtigen
wissenschaftlichen
Beitrag zu einer objekti-
Studien
ven, faktenbasierten Poli- Politikberatung Grundlagenstudien,
tikberatung. Informationen/Analysen für das Begleitung und
BMI, weitere Ressorts sowie die Evaluation von
Fachbereiche im Bundesamt zu Maßnahmen,
Wir begleiten den Prozess der Migrations- und Integrationsfragen EMN-Studien
Integration von Ausländerinnen
und Ausländern und Personen mit Mi-
grationshintergrund in Deutschland. Das
Forschungszentrum trägt mit seinen Erkennt-
nissen entscheidend zur Weiterentwicklung von In- Unsere Forschung verfolgt einen interdisziplinären
tegrationsmaßnahmen auf Bundesebene bei. Weitere Ansatz, der von Methodenvielfalt gekennzeichnet ist.
Forschungsschwerpunkte sind die Erwerbs- und Bil- Mitarbeiter aus Disziplinen wie Soziologie, Ökonomie,
dungsmigration, die Auswirkungen der Zuwanderung, Politikwissenschaften, Geographie, Geschichte, Psy-
Fluchtmigration, Rückkehr und sicherheitsrelevante chologie, Statistik und Migrationsstudien sind vertre-
Aspekte der Zuwanderung. ten. Aufgabenfelder der Forschung im Bundesamt las-10 Forschungszentrum Migration, Integration und Asyl sen sich unter den Begriffen Analyse, Evaluierung und Beratung zusammenfassen. Analyse: Migrations- und Integrationsprozesse in Deutschland werden beobachtet und datenge- stützt beschrieben sowie bei Bedarf in den interna- tionalen Kontext eingeordnet. Evaluierung: Maßnahmen zur Steuerung der Mig- ration und Integration sowie die Verwaltungspra- xis im BAMF werden begleitend untersucht und bewertet. Beratung: Gewonnene Erkenntnisse dienen der Po- litikberatung und fließen so in die Steuerung der Migration und Integration ein. Zur Erfüllung dieser Aufgaben arbeitet das For- schungszentrum mit wissenschaftlichen Einrichtungen im In- und Ausland zusammen. Als wichtige staatliche Stelle für Fragen der Migrations- und Integrationsfor- schung leistet es einen grundlegenden Beitrag zum Informationstransfer zwischen Wissenschaft, Verwal- tung, Politik, Wirtschaft und Öffentlichkeit. Die Arbeit des Forschungszentrums wird seit 2008 jährlich in Tätigkeitsberichten dokumentiert.
11
1.2 Organisatorischer Aufbau (2018)
Abteilung 10 – Forschung
Forschungszentrum Migration, Integration und Asyl
Renate Leistner-Rocca
Migrations- und Integrationsforschung
Forschungsfeld I
Internationale Migration und Migrationssteuerung
Dr. Axel Kreienbrink
Forschungsfeld II
Integration und gesellschaftlicher Zusammenhalt
Dr. Nina Rother
Forschungsfeld III
Migration und Integration: Dauerbeobachtung und Berichtsreihen
Dr. Susanne Worbs
Referat FZ 1
Wissenschaftsmanagement,
Geschäftsstelle Wissenschaftlicher Beirat
Christoph Walz
Die Leiterin des Forschungszentrums mit den Leitungen der Referate
von links sitzend: Dr. Christian Babka von Gostomski, Dr. Axel Kreienbrink, Renate Leistner-Rocca
von links stehend: Dr. Susanne Worbs, Susan Schulz, Tatjana Baraulina, Christoph Walz, Barbara Heß,
Dr. Nina Rother12 Forschungszentrum Migration, Integration und Asyl
1.3 Die Forschungsfelder taktstelle benannt worden ist. In diesem Rahmen wer-
den in jedem Jahr mehrere Spezialstudien erarbeitet,
Forschungsfeld I: die in der Regel Steuerungsfragen in den Bereichen
„Internationale Migration und Migrationssteuerung“ Migration und Asyl betreffen. Die Ergebnisse der deut-
schen Teilstudien gehen anschließend in europäische
Leitung: Dr. Axel Kreienbrink Syntheseberichte ein.
Das Forschungsfeld I bearbeitet ein vielfältiges The- Schließlich gehört seit Jahren die Beschäftigung mit
menspektrum mit den Schwerpunkten internationale der Präsenz und Integration muslimischer Zuwande-
Migration und Migrationssteuerung. Wesentliches rer in Deutschland zum Aufgabenbereich, teilweise in
Ziel der Forschungsarbeiten ist es, weiterführende Er- Kooperation mit dem Forschungsfeld II. Hier führt das
kenntnisse über Ursachen und Wirkungen von Migra- Forschungszentrum seit 2006 regelmäßig im Auftrag
tionsbewegungen im nationalen und internationalen der Deutschen Islam Konferenz (DIK) flankierende
Rahmen zu gewinnen, die entsprechend des gesetzli- Studien durch, wie z.B. zum „Muslimischen Leben in
chen Auftrages für die Begleitforschung zur Steuerung Deutschland“. Aber auch Fragen der Deradikalisie-
der Zuwanderung dienen können. rung von sich (potentiell) islamistisch radikalisierenden
Menschen spielen im Kontext der im Bundesamt ange-
Dafür werden vor allem gegenwärtige und zukünftige siedelten Beratungsstelle Radikalisierung eine Rolle.
Migrationsbewegungen nach Deutschland und Europa
und ihre Folgen in den Blick genommen – von der Zu- Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des
wanderung über die Aufnahme von Schutzsuchenden Forschungsfeldes I:
(z.B. im Rahmen des Resettlements) bis hin zu Abwan-
derung und Rückkehr. Vor diesem Hintergrund war Tatjana Baraulina
auch die Erstellung des jährlichen Migrationsberichts Maria Bitterwolf
der Bundesregierung im Forschungsfeld I verortet, die Janne Grote (EMN)
dann in Forschungsfeld III verlagert wurde. Paula Hoffmeyer-Zlotnik (EMN)
Özlem Konar (bis 30.09.2018)
Das Aufgabenfeld umschließt weiterhin die For- Katrin Pfündel (ab 15.03.2018)
schungstätigkeit für das von der Europäischen Kom- Julian Tangermann (EMN) (bis 31.10.2018)
mission kofinanzierte Europäische Migrationsnetzwerk Milena Uhlmann
(EMN), für welches das Bundesamt als nationale Kon- Marieke Volkert (bis 28.02.2018)
von links sitzend: Dr. Axel Kreienbrink, Janne Grote, Özlem Konar
von links stehend: Tatjana Baraulina, Nicolas Bodenschatz (Praktikant), Katrin Pfündel, Martin Schmitt (IOM),
Maria Bitterwolf, Milena Uhlmann13
Forschungsfeld II: därdatenanalyse). Die Aufgabe der Beobachtung und
„Integration und gesellschaftlicher Zusammenhalt“ Begleitung der Entwicklung von Integrationsindika-
toren auf kommunaler, nationaler und internationa-
Leitung: Dr. Nina Rother ler Eben wurde im Laufe des Jahres 2018 vom For-
schungsfeld II zum Forschungsfeld III verlagert.
Das Forschungsfeld „Integration und gesellschaftli-
cher Zusammenhalt“ gliedert sich in zwei Aufgaben- Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des
bereiche. Hauptarbeitsgebiet ist die Durchführung ei- Forschungsfeldes II:
gener empirischer Studien, vorwiegend zu Fragen der
Integration. Daneben wird Integrationsberichterstat- Dr. Christian Babka von Gostomski
tung betrieben und fortgeschrieben. Andreea Baier (Doktorandin)
Axel Böhm (bis 30.06.2018)
Im Aufgabenbereich „Empirische Studien“ werden Pri- Johannes Croisier (ab 01.03.2018)
märdatenerhebungen zu verschiedenen gesellschafts- Cristina de Paiva Lareiro (ab 01.05.2018)
politisch relevanten Themenbereichen durchgeführt. Lars Ninke (ab 15.02.2018)
Ziel ist die Beschreibung und Analyse von Migrations- Dr. Giuseppe Pietrantuono (ab 01.03.2018)
und Integrationsprozessen und der dadurch hervorge- Nadine Ranger (von 01.04. bis 07.12.2018)
rufenen gesellschaftlichen Entwicklungen in Deutsch- Jana Scheible (bis 30.06.2018)
land. Daneben werden auch staatliche Maßnahmen Dr. Susanne Schührer
der Integrationsförderung begleitet und evaluiert. Dr. Manuel Siegert
Dr. Anja Stichs
Der zweite Aufgabenbereich des Forschungsfeldes be- Michael Wolf (bis 30.09.2018)
schäftigt sich schwerpunktmäßig mit der Sichtung und Dr. Anna Wieczorek (ab 15.02.2018)
Auswertung amtlicher Daten und Geschäftsstatistiken, Dr. Susanne Worbs (bis 31.05.2018)
von Daten aus eigenen Erhebungen sowie von Befra-
gungsdaten anderer Forschungsinstitutionen (Sekun-
Michael Wolf, Dr. Giuseppe Pietrantuono, Axel Böhm
Lars Ninke, Johannes Croisier, Nadine Ranger, Jana Scheible
Dr. Susanne Schührer, Cristina de Paiva Lareiro
Dr. Nina Rother, Andreea Baier, Dr. Anna Wieczorek, Dr. Anja Stichs14 Forschungszentrum Migration, Integration und Asyl
Forschungsfeld III: Die Integrationsberichterstattung auf allen födera-
Migration und Integration: Dauerbeobachtung und len Ebenen Deutschlands wird im Referat begleitet
Berichtsreihen und analysiert. Auch Forschungsprojekte im engeren
(bis 01.10.2018: Erwerbs- und Bildungsmigration) Sinne werden weiterhin durchgeführt, so die laufende
Studie zur Integration von Geflüchteten in ländlichen
Leitung: Dr. Susanne Worbs (ab 01.06.2018) Räumen sowie ein im Oktober 2018 gestartetes Pro-
jekt zur Integration in den deutschen Arbeitsmarkt für
Mit der Neuorganisation des Bundesamtes zum nichtakademische Fachkräfte.
01.10.2018 hat auch das Forschungsfeld III seine Be-
zeichnung und seine inhaltliche Ausrichtung verändert. Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des
Der Schwerpunkt der Tätigkeit lag ursprünglich auf Forschungsfeldes III:
ökonomischen Aspekten der Migration, ist nunmehr
aber vor allem auf die Beobachtung und Dokumenta- Johannes Graf (ab 01.10.2018)
tion längerfristiger Trends ausgerichtet, beispielsweise Barbara Heß
im Rahmen des jährlichen Migrationsberichtes der Özlem Konar (ab 01.10.2018)
Bundesregierung, dessen Erarbeitung aus dem For- Tabea Rösch (bis 31.12.2018)
schungsfeld I übernommen wurde. Die Erwerbs- und Hans-Jürgen Schmidt (bis 01.06.2018)
Bildungsmigration bleibt jedoch weiterhin im Blick, Hanne Schneider (bis 31.03.2018)
u.a. mit dem halbjährlich aktualisierten Wanderungs- Johannes Weber (ab 01.08.2018)
und Freizügigkeitsmonitoring. Zudem werden regel- Hannelore Werzinger (bis 30.09.2018)
mäßig die Daten aus der „Sozialen Komponente“-Be-
fragung von Asylerstantragstellenden ausgewertet und
ebenfalls in halbjährlich erscheinenden Analysen ver-
öffentlicht.
von links: Tabea Rösch, Johannes Weber, Dr. Susanne Worbs, Johannes Graf, Barbara Heß,
Benjamin Göttel (Praktikant), Özlem Konar15
1.4 Wissenschaftsmanagement 1.5 Wissenschaftlicher Beirat
Das Referat „Wissenschaftsmanagement, Geschäfts- Der Wissenschaftliche Beirat trägt seit 2005 zur Un-
stelle Wissenschaftlicher Beirat“ nimmt Querschnitts- terstützung der Qualitätssicherung des Forschungs-
aufgaben für das Forschungszentrum wahr. Es berät zentrums bei. Der Beirat versteht sich als Beratungs-
die Leitung des Zentrums in strategischen Belangen gremium und unterstützt über seine Netzwerke den
und übernimmt administrative Aufgaben. Hierzu zäh- Informationsaustausch mit der wissenschaftlichen
len beispielsweise Planung und Bewirtschaftung des Öffentlichkeit. Er ist multidisziplinär mit anerkann-
Haushaltes, Beratung und Unterstützung in Rechtsan- ten Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern der
gelegenheiten, Aufstellung der jährlichen Forschungs- Migrations- und Integrationsforschung besetzt. Die
vorhabenplanung und Unterstützung der Forschungs- Berufung in das Gremium erfolgt für die Dauer von
bereiche u.a. in deren Öffentlichkeitsarbeit. In diesem zwei Jahren, eine Verlängerung der Berufungsdauer ist
Referat erfolgt auch das Projektcontrolling. möglich. Die Beratungen des Wissenschaftlichen Bei-
rates finden zweimal im Jahr statt.
Zudem hat das Referat per 01.10.2018 aus dem For-
schungsfeld III die Aufgaben nach § 75 Nr. 1 AufenthG Der Wissenschaftliche Beirat hat die Aufgabe:
(Koordinierung der Informationen über den Aufenthalt
zum Zweck der Erwerbstätigkeit zwischen den Aus- zu Forschungskonzepten und -schwerpunkten
länderbehörden, der Bundesagentur für Arbeit und der fachliche Empfehlungen zu geben,
für Pass- und Visaangelegenheiten vom Auswärtigen in methodischen und theoretischen Fragen der Mi-
Amt ermächtigten deutschen Auslandsvertretungen) grations- und Integrationsforschung sowie bei der
sowie die Aufgabe nach § 75 Nr. 10 AufenthG (Aner- Evaluierung der Arbeitsergebnisse das Bundesamt
kennung von Forschungseinrichtungen zum Abschluss zu unterstützen,
von Aufnahmevereinbarungen nach § 20 AufenthG) die Zusammenarbeit mit Wissenschaftlerinnen und
mit dem dazugehörigen Beirat für Forschungsmi- Wissenschaftlern und Forschungseinrichtungen
gration übernommen, die nicht der originären For- gleicher und verwandter Wissensgebiete und mit
schungsarbeit zugehörig waren. der Praxis zu fördern und
Impulse bei der Ausweisung neuer Forschungsfel-
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Referats FZ1 der und bei der Diskussion methodischer Neuerun-
Wissenschaftsmanagement, gen zu geben.
Geschäftsstelle Wissenschaftlicher Beirat:
Seit September 2015 setzt sich der
Leitung: Christoph Walz Wissenschaftliche Beirat wie folgt zusammen:
Jana Burmeister
Susan Schulz Prof. Dr. Petra Bendel, Professorin für Politische Wis-
Sigrid Tratz (ab 01.10.2018) senschaft und Geschäftsführerin des Zentralinstituts
Hannelore Werzinger (01.10.2018 bis 31.12.2018) für Regionenforschung der Friedrich-Alexander-Uni-
Michael Wolf versität Erlangen-Nürnberg sowie stellvertretende
Vorsitzende des Sachverständigenrates deutscher Stif-
tungen für Integration und Migration (SVR) (Vorsit-
zende),
Prof. em. Dr. Kay Hailbronner, Professor für öffentli-
ches Recht, Völkerrecht und Europarecht an der Uni-
versität Konstanz, Gründer und Direktor des For-
schungszentrum Ausländer- & Asylrecht (FZAA),
Prof. Dr. Elke Jahn, Professorin für Arbeitsmarktöko-
nomie an der Universität Bayreuth und Senior Re-
searcher am Institut für Arbeitsmarkt- und Berufsfor-
schung (IAB), Nürnberg,
von links: Michael Wolf, Christoph Walz, Sigrid Tratz,
Jana Burmeister, Susan Schulz16 Forschungszentrum Migration, Integration und Asyl
Prof. Dr. Ruud Koopmans, Professor für Soziologie 1.6 Doktorandenprogramm
und Migrationsforschung an der Humboldt-Universität
zu Berlin und Direktor der Forschungsabteilung „Mig- Zur Förderung des wissenschaftlichen Nachwuchses
ration, Integration, Transnationalisierung“ am Wissen- eröffnet das Bundesamt für Migration und Flüchtlinge
schaftszentrum Berlin für Sozialforschung (WZB) und Doktorandinnen und Doktoranden in einem Doktoran-
denprogramm die Möglichkeit, bei Forschungsprojek-
Prof. em. Dr. Klaus J. Bade, Professor für Neueste ten der Behörde mitzuwirken. Dieses Programm bie-
Geschichte, Gründer des Instituts für Migrationsfor- tet die Gelegenheit, neben der Dissertation die Arbeit
schung und Interkulturelle Studien (IMIS) der Univer- einer Forschungseinrichtung des Bundes kennenzu-
sität Osnabrück und Gründungsvorsitzender (2009- lernen, deren Tätigkeit einen unmittelbaren Bezug zur
2012) des Sachverständigenrates deutscher Stiftungen Migrationspolitik der Bundesrepublik aufweist.
für Integration und Migration (SVR).
Ein solches Engagement bietet für beide Seiten einen
Im Berichtsjahr wurden zwei Sitzungen durchgeführt. großen Gewinn. Dem Bundesamt kommt die Leis-
Beide Sitzungen haben sich zum einen schwerpunkt- tung von jungen Wissenschaftlerinnen und Wissen-
mäßig mit der Diskussion und Bewertung ausge- schaftlern zugute, die eine zum Forschungsauftrag des
wählter Forschungsprojekte zur Aufstellung der For- BAMF themennahe Doktorarbeit fertigen. Die Dokto-
schungsvorhabenplanung beschäftigt. Zum anderen randinnen und Doktoranden profitieren ihrerseits von
war die Neuausrichtung des Forschungszentrums in den Ressourcen, den praktischen Erfahrungen und der
der Forschungslandschaft zentrales Thema bei der Sit- Betreuung im Bundesamt. Sie können Berufserfah-
zungen. rung in enger Zusammenarbeit mit erfahrenen Wis-
von links: Prof. em. Dr. Klaus J. Bade, Prof. Dr. Petra Bendel, Prof. Dr. Ruud Koopmans, Prof. Dr. Elke Jahn,
Prof. em. Dr. Kay Hailbronner17
senschaftlerinnen und Wissenschaftlern sammeln. Da- Bisher abgeschlossene und publizierte Disserta-
neben werden den Doktorandinnen und Doktoranden tionen:
weitere Kenntnisse vermittelt und ihre Fähigkeiten
individuell gefördert, u. a. durch die Möglichkeit, an Worbs, Susanne (2014): Bürger auf Zeit. Die Wahl der
Fortbildungen und Fachkonferenzen teilzunehmen. Staatsangehörigkeit im Kontext der deutschen Op-
tionsregelung, Beiträge zu Migration und Integra-
Freie Doktorandenstellen werden öffentlich ausge- tion, Band 7, Nürnberg: Bundesamt für Migration und
schrieben. Die Stellen werden grundsätzlich für drei Flüchtlinge.
Jahre besetzt. Die Promotion erfolgt in der Regel an
einer von den Doktorandinnen und Doktoranden be- Lochner, Susanne (2016): Integrationskurse als Motor
stimmten Universität bei einem für das Dissertations- für gesellschaftlichen Zusammenhalt. Interethnische
thema geeigneten Betreuer. Das Thema der Doktor- Kontakte und nationale Verbundenheit von Migrantin-
arbeit soll dabei einen engen Bezug zu dem Projekt nen in Deutschland, Opladen/Berlin/Toronto: Budrich
des Bundesamtes aufweisen, für das die Stelle ausge- UniPress Ltd.
schrieben wurde. An der methodischen Konzipierung
und Durchführung dieses Projektes arbeitet die Dok- Obergfell, Johannes (2016): Abwanderung von
torandin/der Doktorand auf einer halben Stelle mit. Deutschland in die Türkei. Absichten, Ursachen, (Hin-
ter-)Gründe, Diss. phil., Friedrich-Alexander-Universi-
Im Berichtsjahr 2018 war eine Doktorandin im For- tät Erlangen-Nürnberg,
schungszentrum tätig. Die wissenschaftliche Mitarbei- Online: http://d-nb.info/1097753719/34.
terin Andreea Baier hat eine sozialwissenschaftliche
Dissertation begonnen, die der Frage nach der Wirk-
samkeit von integrationspolitischen Maßnahmen für Weitere Informationen zum Doktorandenpro-
geflüchtete Personen nachgeht. Das Dissertationspro- gramm werden auf der Internetseite des
jekt stellt eine Evaluation der Maßnahmen zur Sprach- Bundesamtes für Migration und Flüchtlinge
förderung und arbeitsmarktpolitischen Integration dar, unter: www.bamf.de/doktorandenprogramm
die anhand quantitativer Auswertungen mit Daten der veröffentlicht.
IAB-BAMF-SOEP-Befragung von Geflüchteten durch-
geführt wird.
1.7 Praktikum
Das Forschungszentrum des
Bundesamtes bietet Studentin-
nen und Studenten die Möglich-
keit, ein Pflichtpraktikum zu ab-
solvieren. Die Praktikantinnen
und Praktikanten arbeiten aktiv
in einzelnen Forschungsprojek-
ten mit und haben die Gelegen-
heit, die Arbeit in einem behör-
deninternen Forschungszentrum
kennenzulernen und erste Be-
rufserfahrung zu sammeln.
Im Jahr 2018 wurde zwölf Prakti-
kantinnen und Praktikanten diese
Möglichkeit eröffnet.18 Forschungsschwerpunkte
2
Forschungsschwerpunkte
2.1 Forschungsschwerpunkt gung sowie Integrationsmaßnahmen vor Beendigung
der Asylverfahrens. Dabei wurde eine Auswahl an 100
Zu- und Abwanderung, Maßnahmen getroffen, die einen möglichst breiten
Zuwanderungssteuerung Überblick geben sollen. Sie reichen von erweiterten
Regelstrukturen, der Digitalisierung von Verwaltungs-
prozessen, der Ehrenamtskoordinierung, über einen
Die veränderte Fluchtmigration in den Jah- früheren Zugang zu Integrationskursen und zum Ar-
ren 2014 bis 2016: Reaktionen und Maßnah- beitsmarkt für bestimmte Herkunftsgruppen, bis hin
men in Deutschland zu restriktiven Maßnahmen für Asylantragstellende
aus sicheren Herkunftsstaaten und die Einschränkung
(EMN-Studie, siehe auch 5.1) des Familiennachzugs für subsidiär Schutzberechtigte.
Projektverantwortlicher: Janne Grote
Zwar ging ab Frühjahr 2016 die Anzahl neuankom-
Von 2014 bis Juni 2017 kamen circa 1,5 Millionen mender Asylsuchender stark zurück, für zahlreiche Be-
Schutzsuchende nach Deutschland, ein Großteil davon reiche hielt die hohe Arbeitsbelastung aufgrund der
im Zeitraum Juli 2015 bis Februar 2016. Die hohe An-
zahl der Einreisen in verhältnismäßig kurzer Zeit führte
zu einer deutlichen Überlastung auf vielen Ebenen,
beispielsweise bei der Unterbringung, der Annahme
J A H R E
Europäisches Migrationsnetzwerk
und Bearbeitung der Asylanträge oder beim Zugang zu
Integrationskursen.
Die veränderte Fluchtmigration
Die Studie zeichnet zunächst wichtige flüchtlingspoli-
in den Jahren 2014 bis 2016:
tische Entwicklungen nach, die sich sowohl auf natio- Reaktionen und Maßnahmen
naler als auch in Bezug auf weitere EU-Mitgliedstaaten in Deutschland
und Drittstaaten vollzogen haben. Das umfasst unter Fokusstudie der deutschen nationalen Kontaktstelle
für das Europäische Migrationsnetzwerk (EMN)
anderem die Grenzschließungen entlang der Balkan-
route, die EU-Türkei-Erklärung, das EU-Relocation- Working Paper 79 Janne Grote
Verfahren, die Unterstützung der EU-Außengrenzkon-
trollen sowie Frontex-Einsätze insbesondere durch die
Bundespolizei.
Innerhalb Deutschlands wurden wiederum Dutzende
bundesweite, Hunderte regionale und Tausende lo-
kale Maßnahmen und Projekte staatlicher und nicht-
staatlicher Akteure initiiert. Die Studie konzentriert
sich auf die entstandenen Herausforderungen und die
ergriffenen Maßnahmen in insgesamt acht Themen-
feldern: Grenzkontrollen, Unterbringung, erste Un-
terstützungsleistungen, Registrierung, Asylverfahren, Kofinanziert durch die
Infrastruktur und Personal, Sicherheit und Strafverfol-
Europäische UnionForschungsschwerpunkte 19
nachgelagerten Prozessschritte und des Rückstaus al- Rechtlich hat sie keine Auswirkungen auf die Voraus-
lerdings auch 2017 an. Die Arbeit in den Bereichen, in setzungen etwa für längerfristige Zuwanderung.
denen bereits eine Entlastung zu verzeichnen war, war
wiederum dadurch geprägt, dass Prozesse konsolidiert, Es kann jedoch angenommen werden, dass sich mit
neu geschaffene Strukturen stabilisiert, Mitarbeitende der Erleichterung von Kurzzeitaufenthalten auch an-
und ehrenamtlich Tätige entlastet, Abläufe vereinheit- dere migrationsrelevante Änderungen ergeben, bei-
licht, Qualitätsstandards (wieder-)eingeführt, Beschäf- spielsweise durch einen Anstieg der längerfristigen le-
tigte nachgeschult und der Austausch unter den ein- galen Migration oder auch der irregulären Migration.
zelnen Akteuren intensiviert wurden Um dies zu untersuchen, wurden in dieser Studie In-
dikatoren zur Darstellung der Entwicklung im Bereich
Zahlreiche Akteure ziehen aus den Erfahrungen der der legalen Migration und der irregulären Migration
vergangenen Jahre erste Lehren, wie sie mit einer ausgewertet.
möglichen Zunahme der Fluchtmigration nach
Deutschland zukünftig umgehen können. Ein Teil der Hierbei konnte kein direkter kausaler Zusammenhang
geplanten Maßnahmen zielt beispielsweise darauf ab, zwischen der Visaliberalisierung und den skizzierten
geschultes Personal und die asylspezifischen Qualifi- Entwicklungen festgestellt werden. Allerdings wur-
kationen dauerhaft sicherstellen zu können (z. B. ‚at- den im betrachteten Zeitraum in Deutschland parallel
mende Behörde‘), andere Maßnahmen zielen wie- zahlreiche Maßnahmen zur Steuerung der stark gestie-
derum darauf ab, Strukturen und Prozesse weiter zu genen Asylzuwanderung seit 2014 getroffen, die auch
reformieren und das Verwaltungshandeln künftig wei- die besagten Staaten betrafen: Die Bearbeitung von
ter zu flexibilisieren (z. B. Digitalisierung des Asylver- Asylanträgen aus den Westbalkanstaaten wurde priori-
fahrens). siert, die visumbefreiten Westbalkanstaaten wurden in
den Jahren 2014 und 2015 zu sicheren Herkunftsstaa-
Veröffentlichung ten erklärt und die Möglichkeiten zur Verhängung von
Wiedereinreisesperren wurden erweitert. Ferner wurde
Grote, Janne (2018): Die veränderte Fluchtmigration eine Reihe an Maßnahmen getroffen, die für Personen
in den Jahren 2014 bis 2016: Reaktionen und Maßnah- mit ‚geringer Bleibeperspektive‘ den Zugang zum Ar-
men in Deutschland. Studie der deutschen nationa- beitsmarkt und zu Integrationsleistungen einschrän-
len Kontaktstelle für das Europäische Migrationsnetz- ken und sich auch auf die Unterbringung während des
werk (EMN). Working Paper 79, Nürnberg: Bundesamt
für Migration und Flüchtlinge (liegt auch in englischer
Sprache vor).
J A H R E
Europäisches Migrationsnetzwerk
Entwicklungen in Deutschland im Kontext Entwicklungen in Deutschland im
von Visaliberalisierung Kontext von Visaliberalisierung
Studie der deutschen nationalen Kontaktstelle
(EMN-Studie, siehe auch 5.1) für das Europäische Migrationsnetzwerk (EMN)
Projektverantwortliche: Paula Hoffmeyer-Zlotnik Working Paper 83
Paula Hoffmeyer-Zlotnik
Die Studie untersucht Entwicklungen in Deutschland
im Zusammenhang mit der Visaliberalisierung für fünf
Westbalkanstaaten sowie für Georgien, die Repub-
lik Moldau und die Ukraine im Zeitraum von 2007 bis
2017. Die Aufhebung der Visumpflicht für die genann-
ten Staaten erfolgte nach Zustimmung des Europäi-
schen Parlamentes und des Rates der EU. Die Aufhe-
bung war an den erfolgreichen Abschluss der zuvor
erfolgten Visaliberalisierungs-Dialoge mit der Euro-
päischen Kommission gekoppelt. Für die betreffenden
Drittstaatsangehörigen bedeutet die Aufhebung der
Visumpflicht für Kurzaufenthalte im Schengen-Raum
vor allem eine Erleichterung der kurzfristigen Mobili- Forschung
tät, zum Beispiel für touristische Aufenthalte, Besu-
Kofinanziert durch die
che von Familienangehörigen oder für Geschäftsreisen. Europäische Union20 Forschungsschwerpunkte
Asylverfahrens auswirken. Daneben wurden Maßnah- gefährdet sind. Für diese Personen erscheint also der
men ergriffen, um die Zahl der geförderten Ausreisen dauerhafte Verbleib in den Erstzufluchtsstaaten nicht
und der Abschiebungen von irregulär aufhältigen Per- zumutbar. Es besteht aber auch keine Möglichkeit zur
sonen aus den visumbefreiten Staaten zu erhöhen. Mit Rückkehr in das Herkunftsland. Der Bund nimmt seit
der Westbalkanregelung wurden auch die Möglich- 2012 jährlich ein festes Kontingent an Resettlement-
keiten zur legalen Zuwanderung aus den Westbalkan- Flüchtlingen im Einvernehmen mit den Bundesländern
staaten in Form von Erwerbsmigration erweitert. auf. Dieses Kontingent ist seitdem kontinuierlich ge-
stiegen.
Veröffentlichung
Das Forschungszentrum begleitet das deutsche Re-
Hoffmeyer-Zlotnik, Paula (2019): Entwicklungen in settlement-Programm seit Beginn an. Ergebnisse aus
Deutschland im Kontext von Visaliberalisierung. Studie dem Projekt, beispielsweise zu den Aufnahme- und In-
der deutschen nationalen Kontaktstelle für das Euro- tegrationserfahrungen von Resettlement-Flüchtlingen,
päische Migrationsnetzwerk (EMN). Working Paper 83, sind in den letzten Jahren regelmäßig veröffentlicht
Nürnberg: Bundesamt für Migration und Flüchtlinge worden. Im Rahmen der Begleitforschung werden ad-
(liegt auch in englischer Sprache vor). ministrative Daten des Resettlement-Programms aus-
gewertet. Darüber hinaus basieren die Ergebnisse auf
qualitativen Interviews, die in den Jahren 2012 und
Resettlement (Neuansiedlung): Aufnahme- 2014 mit 112 Resettlement-Flüchtlingen bundesweit
und Integrationserfahrungen von besonders durchgeführt wurden.
schutzbedürftigen Flüchtlingen
Anlässlich der jährlichen internationalen Konferenz
Projektverantwortliche: „Annual Tripartite Consultations on Resettlement
Tatjana Baraulina, Maria Bitterwolf (ATCR)“, die 2018 unter deutschem Vorsitz stattfand,
veröffentlichte das Forschungszentrum eine Kurz-
Resettlement ist ein internationales Instrument zur analyse, die eine Bilanz zum bisherigen deutschen
Lösung langanhaltender Fluchtsituationen. Es soll Ge- Resettlement-Programm zieht. Unter dem Titel „Re-
flüchteten Schutz bieten, wenn ihr Leben, ihre Frei- settlement in Deutschland – was leistet das Aufnah-
heit, Sicherheit, Gesundheit und andere fundamentale meprogramm für besonders schutzbedürftige Flücht-
Rechte in den Staaten, in die sie bereits geflohen sind linge?“ wird für die Jahre 2012 bis 2017 analysiert,
– in den sogenannten Erstzufluchtsstaaten, weiterhin welche Grundprinzipien dem deutschen Resettlement-
Abbildung 1: Resettlement-Aufnahmen nach Deutschland 2012-2017 nach Erstzufluchtsstaaten
Türkei
1458
Syrien
Tunesien Libanon 207
202 177
Ägypten
556
Sudan
180
Indonesien
114
Quelle: BAMF, Referat Resettlement. Humanitäre Aufnahme, Relocation, eigene Berechnung und Darstellung.Forschungsschwerpunkte 21
Programm zugrunde liegen. In dem Analysezeitraum befinden, in denen solche Konflikte ausgetragen wer-
sind insgesamt 2.780 Personen umgesiedelt worden. den (Türkei, Libanon, Ägypten, Tunesien und Indone-
sien)
Die Kurzanalyse zeigt, dass sich das Resettlement-Ver-
fahren, so wie es in Deutschland umgesetzt wird, kon- Veröffentlichungen
sequent auf die Grundsätze des Flüchtlingshilfswerks
der Vereinten Nationen (UNHCR) stützt. So nimmt Bitterwolf, Maria/Baraulina, Tatjana/Stürckow,
Deutschland Flüchtlinge auf, die in den Erstzufluchts- Inara/Daniel, Judith (2016): Wanderungsziel Europa?
staaten besonders gefährdet sind und sich in prekären Migrationsentscheidungen afrikanischer Resettle-
Lebenslagen ohne Perspektiven auf Besserung befin- ment-Flüchtlinge, Ausgabe 2|2016 der Kurzanalysen
den. Beispielsweise werden Personen mit besonderem des Forschungszentrums Migration, Integration und
medizinischem Behandlungsbedarf, Opfer von Gewalt Asyl des Bundesamtes für Migration und Flüchtlinge,
und Folter oder Frauen, die aufgrund ihres Geschlechts Nürnberg.
von spezifischen Schutz- beziehungsweise Sicherheits-
problemen betroffen sind, aber auch Kinder und äl- Baraulina, Tatjana/Bitterwolf, Maria (2016): Resett-
tere Personen vorrangig aufgenommen. Die Mehrheit lement: Aufnahme- und Integrationserfahrungen von
der Personen, die über das Resettlement-Programm in besonders schutzbedürftigen Flüchtlingen. Qualitative
Deutschland aufgenommen wurden, erfüllen mehr als Studie, Working Paper 70, Nürnberg: Bundesamt für
ein Kriterium der „besonderen Schutzbedürftigkeit“. Migration und Flüchtlinge.
Zudem zeigt die Kurzanalyse, dass Deutschland mit Baraulina, Tatjana/Bitterwolf, Maria (2018): Resettle-
seinem Resettlement-Programm die von der Flucht ment in Deutschland – was leistet das Aufnahmepro-
stark betroffenen Erstzufluchtsstaaten unterstützt. gramm für besonders schutzbedürftige Flüchtlinge?
Deutschland hat im Untersuchungszeitraum bis Ende Ausgabe 04|2018 der Kurzanalysen des Forschungs-
2017 Geflüchtete aus sieben Erstzufluchtsstaaten in zentrums Migration, Integration und Asyl des Bundes-
verschiedenen Weltregionen aufgenommen. Darunter amtes für Migration und Flüchtlinge, Nürnberg (liegt
sind sowohl Länder, die selbst von fluchtauslösenden auch in englischer Sprache vor).
Konflikten betroffen sind (Syrien, Sudan), aber auch
Staaten, die sich in Nachbarschaft zu den Regionen
Flüchtlingsaufnahme durch das Pilotpro-
gramm „Neustart im Team“ (NesT):
Evaluation des staatlich-gesellschaftlichen
Aufnahmeprogramms für Schutzbedürftige
Projektverantwortliche:
Maria Bitterwolf , Tatjana Baraulina
Die Bundesregierung pilotiert ab dem Jahr 2019 ein
humanitäres Programm, das die Aufnahme von 500
besonders schutzbedürftigen Flüchtlingen mit un-
terstützendem Engagement privater Akteure (Bürger,
NGOs, Firmen etc.) vorsieht. Die Aufnahme erfolgt zu-
sätzlich zu 9.200 Aufnahmeplätzen, die der Bund im
Rahmen des EU-Resettlement-Programms bereitge-
stellt hat. Private Mentorengruppen sollen den aufge-
nommenen besonders schutzbedürftigen Flüchtlingen
zwei Jahre materiell (Bereitstellung und Finanzierung
einer angemessenen Unterkunft) sowie ein Jahr ideell
- mit Rat und Tat – zur Seite stehen und sie unterstüt-
zen. Mit dem Piloten wird zum einen beabsichtigt, eine
umfassendere Unterstützung vor Ort und somit eine
schnellere Integration der Aufgenommenen zu bewir-
ken. Zum anderen soll das Engagement der privaten
Akteure zu einer höheren Akzeptanz des Flüchtlings-
schutzes in der deutschen Gesellschaft beitragen.22 Forschungsschwerpunkte
Aufbauend auf Erfahrungen anderer Staaten (z.B. Ka- Unbegleitete Minderjährige in Deutschland.
nada und Vereinigtes Königreich) und mit Unterstüt- Herausforderungen und Maßnahmen nach
zung durch die EU-Kommission wird mit NesT ein für der Klärung des aufenthaltsrechtlichen Sta-
Deutschland neues migrationspolitisches Schutzins- tus
trument geschaffen. Das Programm wird gemeinsam
vom Bundesministerium des Innern, für Bau und Hei- (EMN-Studie, siehe auch 5.1)
mat, der Beauftragten der Bundesregierung für Mig- Projektverantwortliche:
ration, Flüchtlinge und Integration sowie dem Bun- Julian Tangermann, Paula Hoffmeyer-Zlotnik
desamt für Migration und Flüchtlinge verantwortet.
Das Konzept für das Pilotprogramm wurde in enger Mit der hohen Anzahl an Geflüchteten in den Jah-
Zusammenarbeit mit nationalen und internationalen ren 2015 und 2016 kam auch eine Vielzahl unbeglei-
Akteuren der Zivilgesellschaft erarbeitet. Für die ad- teter Kinder und Jugendlicher nach Deutschland. Dies
äquate Vorbereitung und Unterstützung der Mento- brachte eine Reihe an Herausforderungen sowohl für
rengruppen wurde eigens die Zivilgesellschaftliche die jungen Geflüchteten selbst als auch für die zustän-
Kontaktstelle (ZKS), bestehend aus Vertretern der Ca- digen Behörden, Organisationen, Schulen und Betriebe
ritas, des Deutschen Roten Kreuzes und der Evangeli- mit sich.
schen Kirche von Westfalen geschaffen.
Die EMN-Studie beleuchtet, wie die verschiedenen Le-
bensbereiche unbegleiteter Minderjähriger in Deutsch-
land gesetzlich geregelt sind und wie sich das auf ihre
Lebensumstände auswirkt. Im Mittelpunkt stehen
die Bereiche der vorläufigen und regulären Inobhut-
NesT nahme, Unterbringung, Versorgung und Betreuung,
Integration in Schule und Ausbildung sowie Fragen
der Rückkehr, des Verschwindens und der Familienzu-
sammenführung. Ebenso werden die wichtigsten sta-
tistischen Erkenntnisse zu unbegleiteten Minderjähri-
gen präsentiert.
Das Forschungszentrum wurde mit der Evaluation des
Pilotprogramms – aufgrund seiner Expertise in der
wissenschaftlichen Begleitung humanitärer Aufnah- J A H R E
Europäisches Migrationsnetzwerk
men, insbesondere des Resettlement-Programms der
Bundesregierung – beauftragt. Im Jahr 2018 haben die Unbegleitete Minderjährige
Vorbereitungen bereits begonnen: Die Evaluation wird
in Deutschland
zunächst die Umsetzung des Programms in den Blick
Herausforderungen und Maßnahmen nach der Klärung
nehmen (Prozessanalyse). Im Fokus stehen das BAMF- des aufenthaltsrechtlichen Status
Auswahlverfahren in den Drittstaaten, die Aufnahme Fokusstudie der deutschen nationalen Kontaktstelle
für das Europäische Migrationsnetzwerk (EMN)
der Geflüchteten in Deutschland sowie die Unterstüt-
zung durch die Mentorengruppen. Aufbauend darauf Working Paper 80 Julian Tangermann
Paula Hoffmeyer-Zlotnik
sollen in einer weiterführenden wissenschaftlichen
Begleitung des Programms Erkenntnisse gewonnen
werden, inwieweit die angestrebten Ziele des Aufnah-
meprogramms erreicht werden können (Wirkungsana-
lyse).
Im Auftrag von:
Kofinanziert durch die
Europäische UnionForschungsschwerpunkte 23
Prinzipiell steht im Umgang mit unbegleiteten Min- Verschiedene Akteure werben durch Informationsan-
derjährigen stets das Kindeswohl an erster Stelle. Die gebote und Marketing-Maßnahmen für ein Studium
Unterbringung, Versorgung und Betreuung der unbe- in Deutschland. Herausforderungen bei der Anwer-
gleiteten Minderjährigen verläuft daher größtenteils bung internationaler Studierender sind vor allem lange
unabhängig von ihrem Aufenthaltsstatus. Nichtsdesto- Vorlaufzeiten bei der Bewerbung und die komplexen
trotz spielt dieser eine große Rolle, etwa bei der Inte- Regelungen bei der Hochschulzulassung und im Vi-
gration in den Arbeitsmarkt oder für die Möglichkeiten sums- und Aufenthaltsrechtsverfahren. Auch die zwar
der Familienzusammenführung oder des Familien- deutlich gestiegene, aber im Vergleich mit anderen
nachzugs. Mit der Volljährigkeit sind Unterbringung wichtigen Zielstaaten noch geringe Zahl der englisch-
und Integration dann wesentlich vom aufenthalts- sprachigen Studiengänge stellt eine Herausforderung
rechtlichen Status geprägt. dar. Bewährte Maßnahmen in Bezug auf den Über-
gang in den Arbeitsmarkt sind die Ermöglichung und
Veröffentlichung Förderung von praktischen Erfahrungen und der Auf-
bau von privaten und beruflichen Netzwerken bereits
Tangermann, Julian/Hoffmeyer-Zlotnik, Paula (2018): während des Studiums, das Anbieten von Informati-
Unbegleitete Minderjährige in Deutschland. Heraus- onsveranstaltungen, spezifischen Trainingsangeboten
forderungen und Maßnahmen nach der Klärung des und Lerntandems sowie Deutschkurse, die fest in den
aufenthaltsrechtlichen Status. Studie der deutschen Studienverlauf integriert sind. Auch die Förderung und
nationalen Kontaktstelle für das Europäische Migra- erfolgreiche Vermittlung von internationalen Studie-
tionsnetzwerk (EMN). Working Paper 80, Nürnberg: renden in den Engagementbereich wird zunehmend
Bundesamt für Migration und Flüchtlinge (liegt auch als bedeutender Faktor für Teilhabe und Stärkung der
in englischer Sprache vor). Bleibeperspektive erachtet.
Anwerbung und Bindung von internationa-
len Studierenden in Deutschland J A H R E
Europäisches Migrationsnetzwerk
(EMN-Studie, siehe auch 5.1)
Anwerbung und Bindung von
Projektverantwortliche:
internationalen Studierenden
Paula Hoffmeyer-Zlotnik, Janne Grote
in Deutschland
Die Studie stellt den politischen und rechtlichen Rah- Studie der deutschen nationalen Kontaktstelle
für das Europäische Migrationsnetzwerk (EMN)
men der Anwerbung und Bindung internationaler Stu-
Working Paper 85
dierender dar und benennt die wichtigsten Akteure Paula Hoffmeyer-Zlotnik / Janne Grote
sowie Herausforderungen, Maßnahmen und Strategien
auf Bundes-, Landes- und Hochschulebene im Bereich
der Internationalisierung.
Internationale Studierende werden in der Fachöf-
fentlichkeit vor allem als potenzielle Fachkräfte the-
matisiert. Auf politischer Ebene werden die Anwer-
bung und Bindung von internationalen Studierenden
einerseits im Zusammenhang mit einer allgemeinen
Internationalisierung der Hochschulen und des Wis-
senschaftssystems in Deutschland gesehen und an-
dererseits ebenfalls unter dem Aspekt der Fachkräf- Forschung
tesicherung diskutiert. In den letzten Jahren wurden
deshalb die aufenthaltsrechtlichen Bestimmungen Kofinanziert durch die
Europäische Union
für internationale Studierende in Deutschland deut-
lich erleichtert. So wurde unter anderem ein Anspruch
auf eine Aufenthaltserlaubnis eingeführt, die Mobili-
tät von internationalen Studierenden innerhalb der EU
erleichtert und die Bleibemöglichkeit zur Arbeitssuche
nach dem Studienabschluss eingeführt und verlängert.24 Forschungsschwerpunkte
Veröffentlichung förderprogramme REAG/GARP und StarthilfePlus
umstrukturiert, wobei die wesentlichen Elemente des
Hoffmeyer-Zlotnik, Paula/Grote, Janne (2019): An- StarthilfePlus-Programms bestehen bleiben.
werbung und Bindung von internationalen Studieren-
den in Deutschland. Studie der deutschen nationalen Das Programm StarthilfePlus wird durch IOM und das
Kontaktstelle für das Europäische Migrationsnetz- Forschungszentrum des Bundesamts für Migration
werk (EMN). Working Paper 85, Nürnberg: Bundesamt und Flüchtlinge (BAMF) wissenschaftlich begleitet. Im
für Migration und Flüchtlinge (liegt auch in englischer Jahr 2018 wurden in der Studie 1.339 Personen, die
Sprache vor). im Rahmen von StarthilfePlus ausgereist sind, zu den
Umständen und Motiven ihrer Rückkehrentscheidung
und zu ihren ersten Schritten der Reintegration be-
Evaluation des Bundesprogramms „Start- fragt. Ergänzend zur quantitativen Befragung wurden
hilfePlus“ zur Förderung der freiwilligen mithilfe von Experteninterviews vertiefende Erkennt-
Rückkehr nisse über ausgewählte Aspekte des Rückkehrpro-
zesses – insbesondere zu den Themen Rückkehrent-
Projektverantwortliche: scheidung und Reintegration – gewonnen. Die zwölf
Maria Bitterwolf, Tatjana Baraulina Länder, aus denen Rückkehrer an der Befragung teil-
genommen haben, decken einerseits die wichtigsten
Vor dem Hintergrund der hohen Zahl ausreisepflich- Herkunftsländer von im Programm geförderten Perso-
tiger Personen führte die deutsche Bundesregierung nen ab und sind zugleich relevant im Asylzugangsge-
im Februar 2017 das Rückkehrförderprogramm Start- schehen. Die Studie stellt die erste größere Befragung
hilfePlus ein. Dieses Programm bietet insbesondere von Rückkehrenden dar, die in Deutschland in den
für Personen mit geringen Erfolgschancen im Asyl- letzten Jahren Asyl gesucht haben.
verfahren einen finanziellen Anreiz für die frühzei-
tige Entscheidung zur freiwilligen Rückkehr. Darüber Das Forschungsprojekt zielt darauf, Erkenntnisse zu
hinaus wurden unter bestimmten Voraussetzungen Rückkehrprozessen zu erlangen, die für die Weiterent-
auch Personen gefördert, die vollziehbar ausreise- wicklung von StarthilfePlus und für die Ausrichtung
pflichtig, geduldet oder nach deutschem Recht schutz- der Rückkehrförderung insgesamt relevant sind. Aus
berechtigt sind. Anfang 2019 wurden die Bundes- der Befragung geht unter anderem hervor, dass die
Abbildung 2: Rückkehrmotive der Befragten
Deutschland Rückkehrland
Aufenthaltsrechtliche Unsicherheit
„Ich wusste nicht, ob ich langfristig in Deutschland bleiben kann.“ „Ich wollte in der Nähe von Familie
(23,0 %) oder Freunden sein.“
„Ich wollte nicht abgeschoben werden.“ 41,6 %
(28,8 %)
Motive für
Nicht „zuhause“ gefühlt die Rückkehr
Bessere Bedingungen
„Ich habe mich nicht willkommen gefühlt in
Deutschland.“ (14,5 %) „Ich hatte keine Angst mehr um
„Ich habe mich in meiner Wohnung/ Unterkunft meine Sicherheit dort.“ (4,0 %)
nicht wohlgefühlt.“ (11,3 %) „Ich dachte, dort leichter eine Arbeit
„Ich konnte mich in Deutschland schlecht zu finden.“ (4,5 %)
verständigen.“ (7,9 %) Andere Gründe
17,8 %
„Ich
habe Geld für die
Rückkehr bekommen.“
4,3 %
Quelle: BAMF-IOM-Rückkehrstudie, Mehrfachantworten möglich, n=1.288, gewichtet.Forschungsschwerpunkte 25
gewährte finanzielle Hilfe nur in seltenen Fällen die Reisen von Schutzberechtigten in ihr Her-
grundsätzliche Rückkehrbereitschaft der Studienteil- kunftsland – Berechtigungen, Meldewege
nehmenden befördert. Bei Personen, die eine Rück- und Widerrufsverfahren
kehr bereits aus anderen Motiven – vor allem aufgrund
einer mangelnden Bleibeperspektive und dem Wunsch (EMN-Studie, siehe auch 5.1)
in der Nähe der Familie zu sein – in Betracht ziehen, Projektverantwortlicher: Janne Grote
trägt die finanzielle Unterstützung aber wesentlich zur
letztendlichen Entscheidung bei. Insbesondere Per- Die Studie beschreibt individuelle Beweggründe von
sonen mit hohen Ausreisekosten (z.B. solche, die in Schutzberechtigten für Reisen in ihr Herkunftsland,
größeren Familienverbänden ausreisen) werden durch den internationalen und nationalen Rechtsrahmen
die Förderung bei ihrer Entscheidung unterstützt. Eine sowie die behördlichen Meldewege und das anlassbe-
mindestens genauso wichtige Rolle wie die finanzielle zogene Widerrufsverfahren.
Förderung spielt im Entscheidungsprozess die Rück-
kehrberatung, die im Rahmen des Programms in An- Auslandsreisen und Reisen von Schutzberechtigten in
spruch genommen werden kann. ihre Herkunftsländer sind in den vergangenen Jahren
wiederholt kontrovers diskutiert worden. Hintergrund
Die finanzielle Förderung fungiert nach der Rückkehr ist die Frage, inwiefern Reisen in das Herkunftsland
als eine wichtige Unterstützung. Sie wird vor allem zum Verlust des Schutzes führen, den das Bundesamt
für die Deckung der täglichen Bedarfe in der ers- für Migration und Flüchtlinge den Personen im Rah-
ten Zeit verwendet. Diese Funktion der Förderung ist men ihres Asylverfahrens erteilt hat. Schutzberechtigte
sehr wichtig, da die meisten Rückkehrer in den ersten haben grundsätzlich das Recht auf Bewegungsfreiheit,
Monaten kein ausreichendes eigenes Einkommen er- wie sie auch anderen Drittstaatsangehörigen zusteht,
wirtschaften. Mit der Förderung können sie die öko- die sich legal im Land aufhalten. Dies schließt Reisen
nomisch unsichere Zeit überbrücken und dabei eine ins Ausland mit ein. Anders verhält es sich mit Reisen
individuelle Reintegrationsstrategie entwickeln. in das Herkunftsland. Diese sind nur unter spezifischen
Voraussetzungen erlaubt bzw. können unter bestimm-
Da sich der Großteil der in dieser Studie befragten ten Voraussetzungen zum Widerruf des Schutz- und
Rückkehrer zum Zeitpunkt der Befragung erst rela- Aufenthaltsstatus führen.
tiv kurz – sechs bis acht Monate – in den Rückkehrre-
gionen aufgehalten hat, sind zum jetzigen Zeitpunkt Bei der Prüfung von Widerrufsgründen im Falle von
valide Aussagen zur Nachhaltigkeit der Rückkehr auf Reisen in das Herkunftsland berücksichtigt das BAMF
Grundlage der bisher gewonnenen Befragungsdaten zunächst drei grundsätzliche Voraussetzungen: die
nur eingeschränkt möglich. Eine Wiederholungsbe- Frage nach der Freiwilligkeit der Reise, nach der Ab-
fragung der bisherigen Studienteilnehmer wird daher sicht und der tatsächlichen erneuten Inanspruch-
2019 durch IOM und das BAMF-Forschungszentrum nahme des Schutzes des Herkunftsstaates. Zu den
durchgeführt.. weiteren Prüfkriterien gehören unter anderem die
Dauer der Reise, der Anlass, die Art der Einreise sowie
In Kooperation mit: der Ort des Aufenthaltes.
Die Studie beschreibt zudem die einzelnen Verfahrens-
schritte im Widerrufsverfahren, die Mitwirkungspflich-
ten der schutzberechtigten Person sowie mögliche
aufenthaltsrechtliche Folgen, wenn der Schutzstatus
widerrufen wird.
Für die Studie wurde eine Infografik gefertigt, die
neben der Studie auf der Homepage des BAMF-FZ
heruntergeladen werden kann.Sie können auch lesen