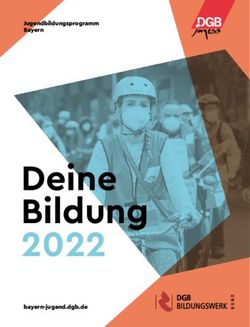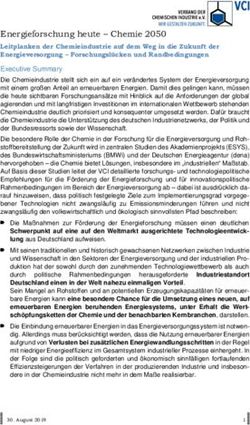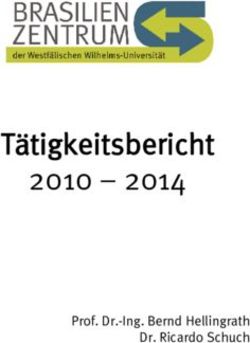Perspektive Landwirtschaft - Agrarpolitische Standortbestimmung
←
→
Transkription von Seiteninhalten
Wenn Ihr Browser die Seite nicht korrekt rendert, bitte, lesen Sie den Inhalt der Seite unten
INHALT
1 5
Attraktive ländliche Räume Wälder nachhaltig pflegen
gestalten und nutzen
SEITE 11 SEITE 25
2 6
Agrarstandort Deutschland Gewässer bewahren
wettbewerbsfähig halten SEITE 28
SEITE 14
7
3 Innovationen und
Verantwortung für natürliche Digitalisierung stärken
Lebensgrundlagen übernehmen SEITE 30
SEITE 19
8
4 Ernten sichern,
Mehr Tierwohl fördern Hunger weltweit beenden
SEITE 22 SEITE 32
3„Landwirtschaft ist Lebenswirtschaft.
Ohne sie verlieren wir unsere
Grundlagen und die ländlichen
Regionen. Das verdient mehr
Wertschätzung !“
4VORWORT
Liebe Leserinnen
und Leser,
unsere deutsche Landwirtschaft ist vielfältig und breit Wo erforderlich, fördert das BMEL den Wandel und die
aufgestellt. Ihre Hauptaufgabe ist und bleibt, unsere Anpassung in der Landwirtschaft, um Anreize zu bieten
Mittel zum Leben zu erzeugen. Dabei ist die moderne und Ziele schneller zu erreichen. Denn zum Beispiel
Landwirtschaft ökonomisch rentabel, ökologisch sinn- Tierwohl, Umwelt- und Klimaschutz sind gesamtgesell-
voll und sozial stabilisierend. schaftliche Aufgaben, mit denen wir die Landwirtschaft
nicht alleine lassen dürfen. Sonst ist ihre Zukunftsfähig
Unsere Bäuerinnen und Bauern stehen täglich im Wett- keit gefährdet. Unter anderem mit Forschung und der
bewerb mit ihren europäischen und internationalen Anwendung moderner Techniken wie der Digitalisie
Kolleginnen und Kollegen. Unter diesen Bedingungen rung können wir viele der Zielkonflikte zumindest
müssen sie ein angemessenes Einkommen für sich, abmildern. Und gleichzeitig ressourcenschonender
ihre Familien und Beschäftigten sowie für Investitionen arbeiten.
in die Zukunftsfähigkeit ihrer Betriebe erwirtschaften.
Die Landwirtschaft leistet ihren Beitrag zu Umwelt- Das ist umso wichtiger, da die Weltbevölkerung weiter
und Klimaschutz, sie soll ihn noch erhöhen sowie wächst. Alle wollen satt werden und haben ein Recht
unsere Kulturlandschaft pflegen. Sie soll die gestiegenen darauf. Bei steigender Beanspruchung von Agrarflächen
gesellschaftlichen Anforderungen an den Umgang mit für andere Zwecke wie Siedlungen und Verkehr sowie
unseren Nutztieren erfüllen und das Tierwohl ver bei der Konkurrenz um Ressourcen wie Wasser müssen
bessern. Gleichzeitig ist die Landwirtschaft einer der wir dafür Sorge tragen, dass ausreichend Lebensmittel
vom Klimawandel am stärksten betroffenen Bereiche. produziert werden und alle Menschen Zugang zu diesen
haben. Es gilt, das Menschenrecht auf Nahrung umzu-
Große Anpassungsleistungen werden aktuell von der setzen. Denn Hunger kann ein Auslöser für politische
Landwirtschaft gefordert. Die Bauern sind zur Ver- Instabilität sein. Auch bei der Krisenprävention spielt
änderung bereit und das ist nichts Neues: Sie haben deshalb die Landwirtschaft eine Schlüsselrolle.
sich schon immer verändert, zum Beispiel in ihren
Produktionsweisen und Strukturen. Auch die Qualität Diese Broschüre soll Ihnen, liebe Leserinnen und Leser,
unserer Lebensmittel hat sich nachweislich enorm ver- zeigen, woran ich meine Agrarpolitik ausrichte und was
bessert, und das, obwohl wir viel weniger dafür ausgeben unsere Landwirte täglich leisten. Ich wünsche Ihnen eine
müssen als früher. Gleichzeitig brauchen wir auch bei interessante Lektüre!
den Verbraucherinnen und Verbrauchern Offenheit für
eine moderne, innovative und digitalisierte Landwirt- Herzlichst
schaft. Wir brauchen einen realistischen statt roman
tisierten Blick auf die Bauern von heute und den Ihre
Dialog miteinander.
Die zum Teil sehr unterschiedlichen Erwartungen
und Herausforderungen lösen Zielkonflikte aus. Durch Julia Klöckner
die Erfüllung eines Ziels kann mitunter ein anderes Ziel Bundesministerin für Ernährung
weniger erreicht werden. Diese Zielkonflikte ehrlich zu und Landwirtschaft
benennen und sie dann entschieden zu lösen, ist eine
der Hauptaufgaben meiner Politik. Dafür setze ich die
erforderlichen Rahmenbedingungen etwa im Bereich
des Tierschutzes und des Insektenschutzes, der Dün-
gung, des Pflanzenschutzes und bei der Gestaltung der
Gemeinsamen Agrarpolitik der EU.
5 6
AGRARPOLITISCHE THESEN
Unsere Agrarpolitik
… steht für eine bäuerliche Landwirtschaft,
die ökologisch, ökonomisch und sozial aus
gerichtet und regional verwurzelt ist.
… steht für eine Aussöhnung zwischen land
wirtschaftlicher Praxis und gesellschaftlichen
Ansprüchen.
… steht für Verlässlichkeit, Verantwortungs
bewusstsein und Innovation.
… belebt ländliche Räume und hat die regio
nalen Bedürfnisse und Stärken im Blick.
Wir stellen die Weichen für eine Landwirt
schaft im Wandel, die eine wachsende Welt
bevölkerung ernähren muss, sich an den
Klimawandel anpasst und zum Klimaschutz
beiträgt, das Tierwohl verbessert, die Arten
vielfalt erhält und fruchtbare Böden sowie
saubere Luft und Gewässer für nach-
kommende Generationen bewahrt.
7A GRARPOLITISCHE THESEN
Agrarpolitische Thesen
1. Wir gestalten attraktive und zukunftsfähige ländliche Räume
Wir wollen die ländlichen Räume und unsere dezentrale Akteuren an gesicherter Grundversorgung, modernen
Siedlungs- und Wirtschaftsstruktur weiter stärken und Infrastrukturen und einer besseren Förderung von
gleichwertige Lebensverhältnisse auf dem Land und in Engagement und Ehrenamt. Mit der Bevölkerung,
der Stadt herstellen. Die Vielfältigkeit der ländlichen Kommunen und Unternehmen vor Ort entwickeln wir
Räume wollen wir bewahren. Wir wollen sie als eigen Ideen, um die besondere Lebensqualität der Dörfer,
ständige und attraktive Lebens- und Wirtschaftsräume Städte und ländlichen Regionen besser zur Geltung
zukunftsfest aufstellen. Dafür arbeiten wir mit anderen zu bringen.
Bundesressorts, den Ländern, Kommunen und vielen
2. Wir sichern den wettbewerbsfähigen Agrarstandort Deutschland
Wir wollen die vielfältige Agrarstruktur im Land erhal Schutz der Umwelt, der Biodiversität, des Klimas,
ten und mit den Bäuerinnen und Bauern einen gemein des Tierwohls und der natürlichen Ressourcen stär
samen Weg in die Zukunft einer erfolgreichen Landwirt ker honoriert und einen wichtigen Beitrag zum Erhalt
schaft gehen. Wir setzen dabei auf die familiengeführte attraktiver und vitaler ländlicher Räume leistet. Damit
Landwirtschaft, auf Waldbauern, Winzer, Gartenbaube die kleineren und mittleren Betriebe weiterhin wett
triebe und eine Fischerei, die von Familienunternehmen bewerbsfähig bleiben, wollen wir die Einkommens
getragen wird, die in den Regionen verwurzelt sind. sicherung über das bewährte Zwei-Säulen-System der
Mit unserer Agrarpolitik gestalten wir den Rahmen so, GAP der Europäischen Union (EU) beibehalten. Bei den
dass notwendige Veränderungen von den Landwirt Direktzahlungen wollen wir die kleineren Betriebe
innen und Landwirten leistbar sind, um eine vielfältige, noch stärker unterstützen. Für eine gute Zukunft der
nachhaltige, wettbewerbsfähige und bodengebunde Landwirtschaft und damit für eine gute Zukunft der
ne Landwirtschaft in bäuerlicher Hand zu bewahren. Bäuerinnen und Bauern in Deutschland und Europa ist
Die Wertschätzung für die Arbeit unserer Landwirte es weiterhin erforderlich, dass für die GAP angemessene
müssen wir zurückgewinnen und in Zukunft erhalten. Haushaltsmittel zur Verfügung stehen. Daher treten wir
Wir wollen eine Landwirtschaft, die gesehen wird – für eine Beibehaltung des EU-Agrarbudgets in bisheri
und sich sehen lassen kann. ger Höhe ein. Zudem setzen wir uns für eine deutliche,
Bei der Weiterentwicklung der Gemeinsamen Agrar spürbare Vereinfachung für unsere landwirtschaftlichen
politik (GAP) nach 2020 setzen wir uns dafür ein, dass Betriebe und die Verwaltungen ein.
diese die Mehrleistungen der Landwirtschaft zum
3. Wir tragen die Verantwortung für unsere natürlichen Lebensgrundlagen
Wir machen gemeinsam mit den Bauernfamilien die bessern. Landwirtinnen und Landwirte, die wertvolle
Landwirtschaft noch nachhaltiger und ressourcen Ökosystemleistungen für die Gesellschaft erbringen,
schonender und erreichen so die Klimaziele für 2050. müssen deshalb für ihre Arbeit einen Ausgleich erhal
Wir wollen den Boden, das Wasser und die Luft ten. Landwirtschaft und Umweltschutz betrachten wir
schützen. Hinzu kommen der Erhalt und die verant nicht als Gegensätze, sondern als Partner. Darum setzen
wortungsvolle Nutzung der vielfältigen Tier- und wir neben dem Ordnungsrecht vor allem auf Koopera
Pflanzenwelt in der Agrarlandschaft. Wir wollen die tion und Anreize.
Umweltwirkungen des Agrarsektors noch weiter ver
8AGRARPOLITISCHE THESEN
4. Wir fördern das Tierwohl
Wir wollen die Tierschutzstandards in der Tierhaltung und Verbraucher nach mehr Tierwohl nach. Mit dem
in Deutschland und in Europa weiter verbessern. positiven Tierwohlkennzeichen bieten wir beim Fleisch
Wir wollen, dass die wirtschaftlich bedeutende Nutz einkauf eine klare Orientierung. Denn wir wollen, dass
tierhaltung in Deutschland weiterhin eine Perspektive sich das Mehr an Tierwohl für die Landwirtinnen und
hat. Wir kommen dem Wunsch der Verbraucherinnen Landwirte auszahlt.
5. Wir schützen den Wald durch nachhaltige Nutzung
Wir stärken eine nachhaltige, verantwortungsvolle Ziel der deutschen Waldpolitik: Durch den Schutz der
Waldbewirtschaftung, um unsere natürlichen Res Wälder, ihre Aufforstung und nachhaltigen Nutzung
sourcen auch künftig nutzen zu können. Dabei ist das werden wir die Folgen des Klimawandels eindämmen
Leitbild einer naturnahen Waldwirtschaft ein erklärtes und die biologische Vielfalt schützen.
6. Wir bewahren die Gewässer
Wir müssen die natürlichen Ressourcen der Gewässer Meeresumwelt. Dazu setzen wir uns auch künftig für
erhalten. Besonderen Wert legen wir auf die nachhaltige wissenschaftlich fundierte Fangquoten ein.
Bewirtschaftung der Fischbestände und den Schutz der
7. Wir stärken Innovationen und Digitalisierung im Dienste der Landwirtschaft
Wir unterstützen Innovationen im Bereich der Land Präzisionslandwirtschaft können dazu beitragen, viele
wirtschaft und schaffen gute Rahmenbedingungen Zielkonflikte zu entschärfen und gleichzeitig die Wett
für den verantwortlichen Einsatz neuer Technologien. bewerbsfähigkeit unserer Landwirtschaft zu sichern.
Wir wollen, dass die deutsche Landwirtschaft ihren Sta Wir begreifen den digitalen Wandel deshalb als Chance,
tus als Pionier der angewandten Digitalisierung ausbaut. wollen ihn gestalten und klammern auch sensible The
Denn durch die Digitalisierung wird die Landwirtschaft men wie die Hoheit der Landwirtinnen und Landwirte
noch stärker ihrem Anspruch gerecht, effizient und über ihre Daten nicht aus.
ressourcenschonend zu arbeiten. Digitalisierung und
8. Wir tragen dazu bei, dem weltweiten Hunger ein Ende zu setzen
Das Recht auf Nahrung ist ein Menschenrecht. mittelproduktion auf der Welt unterschiedlich verteilt.
Wir wollen dazu beitragen, die Ernährung weltweit Deshalb unterstützen wir einen freien und fairen Handel
zu sichern, und unterstützen deshalb die nachhaltige als wichtige Voraussetzung zur globalen Ernährungs
Landwirtschaft in Entwicklungsländern. Wir wollen sicherung. Wir setzen uns für mehr Transparenz auf den
eine leistungsfähige, nachhaltige und lokal angepasste Agrarmärkten ein, für den gesicherten Zugang zu Land
Landwirtschaft. Als globale Gunstregion kommt uns und anderen natürlichen Ressourcen sowie für mehr
dabei eine besondere Verantwortung zu. Denn auf Investitionen im Agrarbereich und auf Wissensvermitt
grund unterschiedlicher klimatischer und natürlicher lung.
Voraussetzungen sind die Möglichkeiten zur Nahrungs
910
ATTRAKTIVE LÄNDLICHE RÄUME GESTALTEN
1 Attraktive ländliche Räume gestalten
Etwa 90 % Rund 47 Mio. Circa 46 %
der Fläche Deutschlands Menschen leben auf dem Land. der Bruttowertschöpfung
sind ländlich geprägt. Das ist mehr als die Hälfte unserer Deutschlands wird im ländlichen
Bevölkerung. Raum erwirtschaftet.
Quelle: BMEL, 2019
In unserem Land leben über 50 Prozent der Bevölkerung stellung der Mobilität der Menschen vor Ort und
in ländlichen Orten und Regionen. So vielfältig wie die deren Daseinsvorsorge. Lebendige Ortsgemeinschaften
Menschen und Landschaften, so unterschiedlich sind müssen erhalten und das ehrenamtliche Engagement
Wirtschaftskraft, Alters- und Infrastruktur sowie Kultur gefördert werden.
der ländlichen Regionen. Für alle gilt: Auch in Zukunft
wollen Menschen dort leben und arbeiten. Es ist deshalb Eine wichtige Aufgabe unserer Politik ist es deshalb,
ein Ziel unseres Ministeriums, die Dörfer, Kleinstädte und die gleichwertigen Lebensverhältnisse sicherzu
ländlichen Räume mit ihren vielfältigen Potenzialen als stellen. Denn ob in der Großstadt oder auf dem Land:
eigenständige und attraktive Lebens- und Wirtschafts So unterschiedlich das Leben in Deutschland ist,
räume weiter zu stärken. keiner soll wegziehen müssen, weil in seinem Wohn-
ort grundlegende Infrastrukturen oder Einrichtungen
Ländliche Orte sind wichtige Kraftzentren unseres nicht vorhanden oder von dort nicht erreichbar sind.
Landes, sie sind die Heimat unserer mittelständischen Die Bundesregierung hat ein Maßnahmenpaket für
Wirtschaft, in ihnen wird gesellschaftlicher Zusam- gleichwertige Lebensverhältnisse in Stadt und Land
menhalt gelebt und gelernt. Um dies auch in der beschlossen. Durch gezielte Maßnahmen wollen wir als
Zukunft zu gewährleisten, brauchen die ländlichen BMEL wieder mehr Leben in die Dörfer bringen. Damit
Räume künftig entsprechende Unterstützung und eine regionale Unterschiede nicht zu Nachteilen werden,
umfassende Infrastruktur. Dabei sind der Breitband- wird die Struktur- und Regionalförderung künftig
ausbau und die Versorgung mit schnellem, flächen noch stärker eine Frage des Bedarfs sein. Wir wollen
deckendem Mobilfunk genauso wichtig wie die Sicher die Fördersysteme künftig breiter aufstellen, damit die
11Attraktive ländliche Räume gestalten
Entwicklung und Unterstützung der ländlichen Räume sind durchschnittlich 1,35 Milliarden Euro pro Jahr).
als gemeinschaftliche Aufgabe von Bund und Ländern Diese EU-Mittel müssen mit nationalen Mitteln von
aktiver und bedarfsgerecht gestaltet werden kann. Bund, Ländern oder Kommunen kofinanziert werden
und entfalten dadurch eine erhebliche Hebelwirkung.
Zentrales Förderinstrument der Europäischen Union Die Förderschwerpunkte reichen dabei von nachhalti-
(EU) zur Entwicklung ländlicher Regionen ist der ger Landwirtschaft über Dorferneuerung bis hin zum
Europäische Landwirtschaftsfonds für die Entwick- Hochwasserschutz. Wir setzen uns in den Beratungen
lung des ländlichen Raums (ELER). Im Zeitraum 2014 zur Gemeinsamen Agrarpolitik (GAP) 2020 für gute,
bis 2020 stehen Deutschland aus dem ELER rund nachhaltige Rahmenbedingungen für die Landwirt-
9,44 Milliarden Euro an EU-Mitteln zur Verfügung (das schaft und die ländlichen Räume ein.
Einsatz der ELER-Fördermittel und nationalen Kofinanzierungsmittel 2014–2020
nach Maßnahmen in Deutschland
8%
Sonstige
21%
Agrarumwelt- und
Klimaschutzmaßnahmen
12 %
LEADER
Regionalentwicklung
4%
Hochwasser- /
Küstenschutz
11%
Ökolandbau
15 %
Basisdienstleistungen
und Dorferneuerung in
ländlichen Gebieten
12 %
Ausgleichszulage in natürlich
benachteiligten Gebieten
17 %
Investitionen
Quelle: BMEL, 2019
12Attraktive ländliche Räume gestalten
Bereits jetzt haben wir die Gemeinschaftsaufgabe zur Durch das Bundesprogramm Ländliche Entwicklung
Verbesserung der Agrarstruktur und des Küstenschutzes (BULE) können wir innovative Lösungen mit ländlichen
(GAK) auf die verstärkte Förderung der ländlichen Initiativen und Akteuren entwickeln und erproben.
Entwicklung durch den Sonderrahmenplan Ländliche Im Jahr 2019 stehen dafür 70 Millionen Euro bereit.
Entwicklung ausgerichtet. Insgesamt stehen vom Bund Viele dieser Initiativen und Aktivitäten in Feldern
im Jahr 2019 900 Millionen Euro für alle Förderbereiche wie Sport, Kultur, Pflege und Gesundheit wären ohne
der GAK bereit, für den Sonderrahmenplan Ländliche ehrenamtliches Engagement nicht denkbar. Die Bereit-
Entwicklung sind davon allein 150 Millionen Euro vor- schaft, sich ehrenamtlich zu engagieren, ist gerade in
gesehen. Bundes- und Landesmittel betragen zusammen den ländlichen Regionen besonders hoch. Mit dem im
rund 1,5 Milliarden Euro, die über die GAK verausgabt Rahmen des BULE geförderten Aktionsbündnis „Leben
werden können und den ländlichen Räumen zugute- auf dem Land“ werden ehrenamtliche Tätigkeiten durch
kommen. Die Investitionsförderung zur ländlichen die Stärkung hauptamtlicher Begleitstrukturen weiter
Entwicklung wollen wir stärker auf eine erreichbare gefördert.
Grundversorgung, attraktive und lebendige Ortskerne
und die Behebung von Gebäudeleerständen fokussieren.
Unser Ministerium unterstützt die Dörfer und länd
lichen Regionen schon jetzt durch vielfältige Förder
programme, Initiativen, Modellvorhaben und Wettbe-
werbe. Darüber hinaus werden wir über die bestehenden
Aktivitäten hinaus neue Modelle entwickeln, um den
Herausforderungen auch in Zukunft gerecht zu werden.
So sollen eigene Potenziale der ländlichen Räume akti-
viert und die Regionen zukunfts- und wettbewerbsfähig
gemacht werden.
13Agrarstandort Deutschland wettbewerbsfähig halten
2 Agrarstandort Deutschland
wettbewerbsfähig halten
Landwirtschaft produziert unsere Lebensmittel und ist –
zusammen mit der Ernährungswirtschaft – ein wichtiger
Wirtschaftsmotor in Deutschland. Sie muss heute aber
mehr können, als nur zu ernähren: Moderne Landwirt-
schaft ist nachhaltig und wirtschaftlich tragfähig.
Etwa die Hälfte der Fläche unseres Landes wird land-
wirtschaftlich genutzt.
Flächennutzung
Nach dem Amtlichen Liegenschaftskataster- Sonstige Flächen (7,8 %)
Informationssystem (ALKIS, Nutzungsartenkatalog)
Erholungsfläche (1,4 %)
Industrie- und Gewerbefläche (1,7 %)
Wasserfläche (2,3 %)
Verkehrsfläche (5 %)
Bodenfläche nach
Landwirtschaftsfläche (51,1 %) Nutzungsarten 2016 Waldfläche und Gehölze (30,7 %)
(in %)
Quelle: Statistisches Bundesamt/
BMEL, 2017
Unsere landwirtschaftlichen Betriebe leisten einen versorgung. Immer wichtiger wird es deshalb, die Ver-
Beitrag dazu, dass die Verbraucherinnen und Verbrau- luste an wertvollen Agrarflächen zu begrenzen. Und die
cher gut gefüllte Regale in Supermärkten vorfinden. Landwirtinnen und Landwirte gestalten und pflegen das
Sie leisten auch einen wichtigen Beitrag zur weltweiten Gesicht unseres Landes. Damit sind sie ein Anker in den
Ernährungssicherung und zur Energie- und Rohstoff- ländlichen Regionen.
14Agrarstandort Deutschland wettbewerbsfähig halten
Wirtschaftliche Entwicklung der Lebensmittelversorgungskette
Vorgelagerte Nachgelagerte
Wirtschaftsbereiche¹ Wirtschaftsbereiche²
21,8 21,7 21,6 208 212 216
Landwirtschaft
(einschließlich Fischerei)
135,1 142,4 150,2 3.751 3.813 3.875
16,3 17,5 22,0 599 581 578
Insgesamt
173,2 181,6 193,8 4.558 4.606 4.669
Bruttowertschöpfung Erwerbstätige ¹ Unter anderem Herstellung von
2015 2016 2017
Mrd. € 1.000 Personen Landmaschinen, Agrarhandel
² Unter anderem Ernährungsgewerbe,
Groß- und Einzelhandel mit
Nahrungsmitteln
Quelle: Statistisches Bundesamt/Fachhochschule Südwestfalen
Die Landwirtschaft hat im Jahr 2018 Waren und Dienst- zentrieren uns mit hochwertigen Produkten auf kauf
leistungen von über 53 Milliarden Euro bereitgestellt. kräftige, wachstumsstarke Märkte. Für unser Land be-
Rund 275.000 Betriebe erzeugten 2016 hierzulande deutet der Agrarexport Wertschöpfung, Wohlstand und
unsere landwirtschaftlichen Produkte. Und etwa Arbeitsplätze – insbesondere in den ländlichen Räumen.
940.000 Menschen arbeiteten 2016 haupt- oder neben- Deshalb wollen wir den Agrarexport verantwortungs
beruflich in der Landwirtschaft – das entspricht fast bewusst nutzen.
der Einwohnerzahl der Stadt Köln. Die deutsche Land-
wirtschaft zählt zu den vier größten Erzeugern in der Die Einkommen der Landwirtinnen und der Landwirte
Europäischen Union (EU). sind starken Schwankungen unterworfen. Schon jetzt
zeichnet sich ab, dass ihre Einkommen für das Wirt-
Die deutschen Unternehmen der Ernährungswirtschaft – schaftsjahr 2018/19 insgesamt unterhalb des Durch-
viele von ihnen Mittelständler – erlösen jeden dritten schnitts der sehr guten beiden Vorjahre liegen werden.
Euro im Export. Wir unterstützen sie dabei und kon
15Agrarstandort Deutschland wettbewerbsfähig halten
Gewinn plus Personalaufwand je Arbeitskraft der Haupterwerbsbetriebe (in €)
Euro
60.000
50.000
40.000
30.000
20.000
2013/14 2014/15 2015/16 2016/17 2017/18
Ackerbau Milch Veredlung Gemischt (Verbund) insg. Insgesamt
Ackerbau Milch Veredlung Gemischt (Verbund) insgesamt Insgesamt
Quelle: BMEL, 2019
Der Strukturwandel macht sich bemerkbar: Sowohl die Dafür brauchen die Betriebe verlässliche Rahmen
landwirtschaftliche Fläche als auch die Zahl der Betriebe bedingungen und Planungssicherheit, damit sie weiter
gehen weiter zurück. in die Entwicklung und Modernisierung ihrer Betriebe
investieren können. Und sie brauchen vor allem Zu-
Wir als BMEL wollen eine flächendeckende, bäuerliche, gang zu ihrem wichtigsten Produktionsfaktor Boden.
familiengeführte Landwirtschaft erhalten, die nachhaltig Deshalb unterstützen wir die Länder dabei, großteilige
wirtschaftet und regionale Produkte erzeugt. Wir brau- Flächenaufkäufe außerlandwirtschaftlicher Investoren
chen dazu sowohl die konventionelle als auch die öko- zu beschränken. Gemeinsam mit den Ländern wollen
logische Bewirtschaftung. Beide leisten einen wichtigen wir den ständigen Verbrauch an Agrarflächen für andere
Beitrag dazu, die ländlichen Regionen attraktiv und Nutzungen reduzieren.
lebenswert zu erhalten, indem sie mit Landwirtschaft
einen Beitrag zu regionalen Wirtschaftskreisläufen
leisten und Landschaftspflege betreiben. Ein Wechsel
zu Konzernstrukturen auf der Erzeugerstufe wäre unter
agrarpolitischen Gesichtspunkten von Nachteil. Um die
bäuerlichen Betriebe auch für kommende Generationen
zu erhalten, ist es erforderlich, dass die bäuerlichen
Familien von dem Erwirtschafteten leben und ihr
Beschäftigten bezahlen können.
16Agrarstandort Deutschland wettbewerbsfähig halten
Landwirtschaftliche Sozialpolitik 2019 (in Mio. €)
4.032
Landwirtschaftliche Sozialpolitik, davon:
2.350
Alterssicherung
1.456
Krankenversicherung
177 49
Unfallversicherung Sonstiges
Quelle: BMEL, 2019
Unser Ziel ist es, die Land- und Ernährungswirtschaft Unser Ministerium unterstützt die Idee der Kommis
wettbewerbsfähig und nachhaltig zu erhalten. Dabei sion, die Direktzahlungen stärker an die Einhaltung von
spielt die Gemeinsame europäische Agrarpolitik (GAP) Umwelt- und Klimavorgaben zu binden, weil dies für die
eine zentrale Rolle. Die Verhandlungen auf EU-Ebene Zukunftsfähigkeit der Landwirtschaft entscheidend ist.
zur GAP nach 2020 sowie zum künftigen mehrjährigen Wir arbeiten zurzeit daran, wie die konkrete Ausgestal-
Finanzrahmen sind in vollem Gange. Viele Fragen zur tung der neuen Förderung von Umweltleistungen, die
Ausgestaltung des Regelungsrahmens der GAP sowie „Grüne Architektur“, aussehen könnte. Dabei gelten für
zu deren Finanzierung sind derzeit noch offen. alle die neuen Öko-Regelungen („eco-schemes“) in der
ersten Säule sowie die Maßnahmen und Mittel für den
Wir brauchen eine flexiblere und einfachere Agrar Agrarumwelt- und Klimaschutz. Auf europäischer Ebene
politik. Die Marktausrichtung der GAP bleibt eine brauchen wir verbindliche Leitplanken für Umwelt- und
wesentliche Richtschnur im Rahmen der GAP 2020. Klimaregelungen bei der vorgesehenen Konditionalität
Die Instrumente der GAP müssen mit Blick auf ihre der Direktzahlungen, damit aus „Flexibilität“ kein „Um-
Funktion der Einkommenssicherung und der Stärkung welt-Standard-Dumping“ wird.
der Wettbewerbsfähigkeit der landwirtschaftlichen
Betriebe weiterentwickelt werden. Dazu zählt unter Kappung und Degression dürfen wir nicht standort
anderem die zielorientierte Ausgestaltung der Direkt- gefährdend umsetzen. Wir befürworten ein fakultatives
zahlungen, um eine stärkere Förderung kleinerer und Vorgehen, damit die Mitgliedstaaten selbst über eine
mittlerer Betriebe – und damit viehhaltender Betriebe – eventuelle nationale Kappung oder Degression ent-
zu erreichen. Wir stehen zum Zwei-Säulen-Modell: scheiden können. Es ist zu berücksichtigen, dass größere
Die Direktzahlungen brauchen wir zur Absicherung und Betriebe deutliche Kostenvorteile gegenüber kleineren
Zukunftssicherung der Landwirtinnen und Landwirte. Betrieben haben. Mit steigender Hektarzahl ergeben sich
Wir treten dafür ein, dass die GAP die Leistungen der zum Beispiel Größenvorteile beim Einkauf und bei den
Landwirtschaft zum Schutz der Umwelt, der Biodiversi Maschinenkosten. Deshalb ist es richtig, dass die ersten
tät, des Klimas, des Tierwohls und der natürlichen Hektare stärker gefördert werden und somit kleinere
Ressourcen stärker honoriert. Dies ist erforderlich, um und mittlere Betriebe davon auch profitieren. Wir möch-
die Nachhaltigkeit der landwirtschaftlichen Produktion ten auch keine Nachteile für den klassischen Mehr
zu fördern. Im Hinblick auf die Wettbewerbsfähigkeit familienbetrieb, der sich bewusst für ein kooperatives
unserer Betriebe erteilen wir Forderungen nach einer Wirtschaften entschieden hat. Für nicht landwirtschaft-
Ausweitung gekoppelter Direktzahlungen eine klare liche Investoren gilt es hingegen, Begrenzungsmöglich-
Absage. Zudem muss die GAP zukünftig einfacher, keiten bei den Direktzahlungen zu formulieren.
aber zeitgleich in ihrer Zielerreichung konkreter und
effektiver werden.
17Agrarstandort Deutschland wettbewerbsfähig halten
Um die Ziele der GAP zu erreichen, brauchen wir eine
ausreichende Finanzierung. Es dürfen nicht immer mehr
öffentliche Leistungen von den Bäuerinnen und Bauern
gefordert werden bei gleichzeitiger Kürzung der öffent
lichen Mittel.
Landwirtschaftliche Betriebe nach Größenklassen
80.000
70.000
60.000
50.000
40.000
30.000
20.000
10.000
unter 5¹ 5 – 10 10 – 20 20 – 50 50 – 100 100 – 200 200 – 500 500 – 1.000 1.000 und mehr
Betriebsgröße in ha landwirtschaftlicher Fläche
2010 2016
Durchschnittsgröße Betrieb
Anzahl Betriebe (in Tausend) (in ha landwirtschaftlicher Fläche)
299,1 275,4 55,8 60,5
¹ Landwirtschaftliche Betriebe mit Tierbeständen oder Spezialkulturen, die für sich eine
Auskunftspflicht begründen (einschließlich Betrieben ohne landwirtschaftliche Fläche).
Quelle: Statistisches Bundesamt
18Verantwortung für natürliche Lebensgrundlagen übernehmen
3 Verantwortung für natürliche
Lebensgrundlagen übernehmen
Landwirtschaft hat eine Verantwortung gegenüber den Die Fördermöglichkeiten für klimafreundliche Maß-
nachfolgenden Generationen. Dazu gehört, dass Land nahmen in der Landwirtschaft sollen auch im Rahmen
wirtinnen und Landwirte unsere natürlichen Lebens- der Gemeinsamen Agrarpolitik (GAP) der Europäischen
grundlagen wie Wasser, Boden und Luft schonend nutzen Union (EU) ausgeweitet werden. Dünger wird immer
und die vielfältigen Pflanzen- und Tierarten schützen. effizienter und bedarfsgerechter eingesetzt, Emissionen
Das BMEL wird seine Agrarpolitik noch stärker an den von Ammoniak werden durch technische Lösungen re-
nationalen und internationalen Nachhaltigkeitszielen duziert und der Energieverbrauch wird durch moderne
ausrichten. Technik gesenkt – unter anderem unterstützt durch die
Digitalisierung und die Präzisionslandwirtschaft. Das ist
Die moderne Landwirtschaft steht vor der Heraus technischer Fortschritt, der die Landwirtschaft effizien-
forderung, gleichermaßen ökonomisch wie ökologisch ter macht – auch im Umgang mit unseren natürlichen
nachhaltig zu wirtschaften. Unser Ministerium wird der Ressourcen. Dauergrünland und humusreiche Böden
Landwirtschaft dazu langfristige Fahrpläne mit unseren sollen besonders geschützt werden. Denn landwirt-
Strategien für Nutztiere, Ackerbau, Grünland und öko schaftliche Böden sind ein voluminöser und weltweit
logischen Landbau an die Hand geben. Bereits heute der wichtigste Kohlenstoffspeicher.
fördern wir an vielen Stellen, etwa mit dem Agrarinves
titionsförderungsprogramm (AFP), moderne Lösungen Wir wollen die Emissionen aus der Tierhaltung, redu-
für Wettbewerbsfähigkeit und Nachhaltigkeit. zieren. So sollen beispielsweise Wirtschaftsdünger wie
Gülle und andere Reststoffe aus der Landwirtschaft auch
Die Land- und Forstwirtschaft ist stark vom Klima energetisch genutzt werden. Wir fördern hierzu die Ver-
wandel betroffen. Gleichzeitig ist sie Teil der Lösung. wertung in Biogasanlagen. Das ist ein bedeutender
Zwischen dem Schutz des Klimas und der Produktion Beitrag zur Erreichung unserer Klimaziele. Denn allein
von Nahrungsmitteln gibt es enge Wechselwirkungen durch eine Steigerung der Güllevergärung von 30 auf
die nicht gegeneinander ausgespielt werden dürfen. 60 Prozent kann die Emission des Klimagases Methan
Es sollte jedem klar sein: Eine emissionsfreie Nahrungs um mehr als 4 Millionen Tonnen CO -Äquivalente re
²
mittelproduktion ist nicht möglich. Ziel ist aber, den duziert werden.
Ausstoß zu reduzieren, wo immer es möglich ist.
Die Klimaschutzziele der Bundesregierung sind im
Klimaschutzplan 2050 und in den Eckpunkten für das
Klimaschutzprogramm 2030 festgeschrieben. Der Klima-
schutzplan sieht vor, die jährlichen Emissionen aus der
Landwirtschaft bis 2030 gegenüber 2014 um 11 bis
14 Millionen Tonnen CO -Äquivalente zu reduzieren.
²
Wir haben ein Maßnahmenpaket entwickelt, das sicher
stellen soll, diese Klimaziele zu erreichen. Die Schwer-
punkte der Klimaschutzanstrengungen in der Land-
wirtschaft liegen darin, Emissionen zu mindern und
Ressourcen effizienter einzusetzen und damit nach-
haltiger zu produzieren.
19Verantwortung für natürliche Lebensgrundlagen übernehmen
Die zehn Maßnahmen zum Klimaschutz
Maßnahme Minderungspotenzial (CO -Äquivalente)
²
1. Senkung der Stickstoffüberschüsse 3,5 bis 7,5 Mio. t
2. Energetische Nutzung von Wirtschaftsdüngern 2,0 bis 2,4 Mio. t
3. Ausbau des Ökolandbaus 0,4 bis 1,2 Mio. t
4. Emissionsminderungen in der Tierhaltung 0,3 bis 1,0 Mio. t (jährlich)
5. Erhöhung der Energieeffizienz 0,9 bis 1,5 Mio. t (jährlich)
6. Humusaufbau im Ackerland 1,0 bis 2,0 Mio. t (jährlich)
7. Erhalt von Dauergrünland –
8. Schutz von Moorböden/Reduktion von Torfeinsatz 3,0 bis 8,5 Mio. t (jährlich)
in Kultursubstraten
9. Erhalt und nachhaltige Bewirtschaftung der Wälder und Laut Wissenschaftlichem Beirat für Waldpolitik haben Wald,
Holzverwendung nachhaltige Forstwirtschaft und die damit verbundene Holz
nutzung im Jahr 2014 rund 127 Mio. t CO gebunden bzw.
²
durch Substitutionseffekte reduziert.
10. Vermeidung von Lebensmittelabfällen 3,0 bis 6,0 Mio. t (jährlich)
Pflanzenschutz ist wichtig. Er schützt unsere Nutzpflan- Nährstoffverteilung fördern. Unter anderem soll durch
zen vor Krankheiten und Schädlingen und sichert somit die Förderung der Verarbeitung von Gülle die Transport-
die Ernten. Unser Nationaler Aktionsplan zur nachhalti- würdigkeit in die Ackerbauregionen verbessert werden.
gen Anwendung von Pflanzenschutzmitteln trägt dazu Ein weiteres wichtiges Gut ist die reine Luft. Auch hier
bei, Risiken für Umwelt und Gesundheit, die mit der sollen unter anderem die geplanten Änderungen der
Anwendung von Pflanzenschutzmitteln verbunden sein Düngeverordnung wirken. Sie trägt dazu bei, dass zum
können, zu reduzieren. Wir begrüßen die Überlegungen Beispiel durch die direkte Einarbeitung von Dünge
aus der Agrarwirtschaft, im integrierten Pflanzenschutz mitteln weniger Ammoniak in die Luft gelangt.
von der bislang üblichen wirtschaftlichen Schadens-
schwelle zu einer ökologischen Schadensschwelle Zum Schutz der natürlichen Lebensgrundlagen trägt
überzugehen. Wir werden die Glyphosat-Minderungs- auch der besonders ressourcenschonende Ökolandbau
strategie verfolgen, die einerseits die Anwendung von bei. Die Zukunftsstrategie ökologischer Landbau (ZöL)
glyphosathaltigen und wirkungsgleichen Pflanzen- beschreibt, mit welchen politischen Aktivitäten und
schutzmitteln drastisch reduziert, andererseits weitere Instrumenten wir der Biobranche in Deutschland
Ziele wie den Schutz erosionsgefährdeter Böden nicht Wachstumsimpulse geben. Bis zum Jahr 2030 streben
aus den Augen lässt. Eine grundsätzliche Beendigung der wir an, dass 20 Prozent der landwirtschaftlichen Fläche
Anwendung ist ab 2022 möglich. So lange ist Glyphosat ökologisch bewirtschaftet werden. Dazu haben wir unter
in der EU zugelassen. anderem die Fördermittel für das Bundesprogramm
Ökologischer Landbau und andere Formen nachhalti-
Wir wollen das Wasser schützen. Dazu haben wir das ger Landwirtschaft (BÖLN) deutlich aufgestockt: zum
Düngerecht angepasst, werden es weiterentwickeln und Beispiel in den Jahren 2018 und 2019 von 20 auf jähr-
noch strenger an den Umweltschutz anpassen. Das ver- lich 30 Millionen Euro. Damit unterstützen wir unter
langt auch die EU. In besonders mit Nitrat belasteten anderem die Forschung für den Ökolandbau, den Aufbau
Regionen ist die Düngung weiter einzuschränken, um regionaler Wertschöpfungsketten und kompetente
Nitrateinträge in die Gewässer zu vermindern. Als Be- Beratungs-, Weiterbildungs- und Informationsangebote.
gleitmaßnahme zu den Änderungen bereitet unser Hierzu gehören Aktivitäten zum Wissenstransfer von der
Ministerium ein Bundesprogramm Nährstoffmanage- Forschung zur Praxis, Fachveranstaltungen für land-
ment vor. Damit wollen wir Verfahren und Vorhaben zur wirtschaftliche und verarbeitende Betriebe, Beratung
weiteren Steigerung der Düngeeffizienz und besseren von Unternehmen der Außer-Haus-Verpflegung (zum
20Verantwortung für natürliche Lebensgrundlagen übernehmen
Beispiel Kantinenbetreiber, Caterer), die Bioprodukte in Eine stärkere Biobasierung unserer Wirtschaft kommt
ihr Verpflegungsangebot aufnehmen möchten, sowie dem Klima zugute und ist ein starkes Werkzeug zum Er-
Informationen für Verbraucherinnen und Verbraucher reichen der nachhaltigen Entwicklungsziele. Im Rahmen
über Bioproduktion. der Bioökonomiepolitik setzen wir uns für die Nutzung
nachhaltig erzeugter Rohstoffe ein. Richtschnur für un-
Uns ist der Schutz der biologischen Vielfalt ein wichtiges sere Aktivitäten wird hierbei die Bioökonomiestrategie
Anliegen. Das Vorkommen vieler Tier- und Pflanzen der Bundesregierung sein.
arten ist eng mit der Landwirtschaft verknüpft. Ein Ende
der landwirtschaftlichen Nutzung bedeutet auch das Aus Die Herstellung von Lebensmitteln beansprucht wert-
für diese Arten. Mit dem Aktionsprogramm Insekten- volle Ressourcen wie Boden, Wasser und Energie und ist
schutz (API) möchten wir das Insektensterben stoppen mit Emissionen von Treibhausgasen verbunden. Daher
und die Artenvielfalt schützen, denn die Landwirtschaft sollten Lebensmittel nicht unnötig verloren gehen oder
ist auf die Ökosystemdienstleistungen der Insekten verschwendet werden. Die Reduzierung der Lebens
angewiesen. Die Umsetzung des Programms wird der mittelverschwendung ist eine große Herausforderung,
Land- und Forstwirtschaft einiges abverlangen. Bei der der wir uns stellen. Deshalb haben wir unter anderem
konkreten Umsetzung des Insektenschutzprogramms die Nationale Strategie zur Reduzierung der Lebens
werden wir vor allem die Verhältnismäßigkeit jeder mittelverschwendung vorgelegt, die vom Bundes
einzelnen Maßnahme sorgfältig prüfen. Aus diesem kabinett verabschiedet wurde.
Grund setzen wir uns dafür ein, dass das API mit gestärk-
ten Fördermaßnahmen begleitet wird – zum Beispiel im Ziel ist es, bis 2030 die Lebensmittelverschwendung auf
Rahmen der Gemeinschaftsaufgabe zur Verbesserung Einzelhandels- und Verbraucherebene in Deutschland
der Agrarstruktur und des Küstenschutzes (GAK). Hier pro Kopf zu halbieren und die entlang der Produktions-
beabsichtigen wir, 50 Millionen Euro im Jahr durch und Lieferkette entstehenden Lebensmittelabfälle
Umschichtung und Erhöhung der Mittel für einen einschließlich Nachernteverlusten zu verringern.
Sonderrahmenplan zur Verfügung zu stellen, mit dem Die Reduzierung der Lebensmittelverschwendung ist
wir Landwirtinnen und Landwirte unterstützen, neue eine gesamtgesellschaftliche Aufgabe. Daher werden alle
Anforderungen umzusetzen und gegebenenfalls not- Akteure der Zivilgesellschaft, Wirtschaft und Forschung
wendige Einschränkungen abzumildern. in den Prozess zur Entwicklung von Maßnahmen und
Zielmarken gegen Lebensmittelverschwendung einbe
Die Vielfalt auf dem Acker und in der umgebenden zogen. In Dialogforen pro Sektor sollen konkrete Maß-
Landschaft soll wachsen. Dazu wird die neue Ackerbau nahmen zur Reduzierung der Lebensmittelverschwen-
strategie beitragen. Sie wird unter anderem Vorschläge dung erarbeitet, Zielmarken definiert und geeignete
für erweiterte Fruchtfolgen, die Züchtung von wider- Formate zur Umsetzungs- und Erfolgskontrolle ver
standsfähigen Kulturpflanzen und die Forschung an einbart werden.
nicht chemischen Pflanzenschutzverfahren beinhalten.
21Mehr Tierwohl fördern
4 Mehr Tierwohl fördern
Fragen des Tierschutzes und der Tierhaltung werden Für die deutsche Landwirtschaft sind Tierzucht und
kontrovers und emotional diskutiert. Uns interessiert und Tierhaltung wichtige Standbeine. 67 Prozent der land-
bewegt der Umgang mit und das Verhältnis zu unseren wirtschaftlichen Betriebe halten Tiere. Auf tierische Pro-
Tieren. Auch für das BMEL hat eine tiergerechte Nutzung dukte entfielen 2017 in Deutschland rund 63 Prozent der
und Haltung von Tieren, die von der Gesellschaft akzep- Verkaufserlöse und fast 50 Prozent des gesamten Produk-
tiert und mitgetragen wird, hohe Priorität. Der Schutz von tionswertes der Landwirtschaft.
Nutztieren, Versuchstieren und Heimtieren ist ein zen
trales Anliegen des BMEL. Wir möchten auf dem gesetz- Unser agrarpolitisches Ziel lautet: eine besonders am
lichen Tierschutzstandard aufbauen und den Tierschutz Tierwohl orientierte Nutztierhaltung zu ermöglichen,
weiterentwickeln. Wir wollen die Nutztierhaltung als die sowohl wirtschaftlich als auch gesellschaftlich trag
hoch entwickelten Sektor weiter verbessern. Gleichzeitig fähig ist. Wir wollen, dass die Tierhaltung in der Hand
möchten wir den tierhaltenden Betrieben in Deutschland und im Eigentum bäuerlicher Familienbetriebe bleibt.
eine stabile Zukunftsperspektive bieten. Tierische Produktion und Flächenbewirtschaftung wollen
Struktur der Tierhaltung 2016
Gesamtzahl Durchschnittliche Anteil Tiere in Große Bestände
von Tieren in Bestandsgröße großen Beständen gibt es ab …
Deutschland Tiere/Betrieb % des Gesamt- Tieren
(in Tausend) bestandes
Rinder 12.354 102 49,4 % 200 und mehr
Milchkühe 4.276 62 49,2 % 100 und mehr
Schweine 27.978 695 75,3 % 1.000 und mehr
Zuchtsauen 2.036 171 75,1 % 200 und mehr
Jung- und Mastschweine¹ 16.850 451 62,3 % 1.000 und mehr
Geflügel
173.574 3.600
Legehennen 51.936 1.200 89,0 % 10.000 und mehr
Masthühner 93.791 28.200 99,3 % 10.000 und mehr
Truthühner 12.360 6.700 91,6 % 10.000 und mehr
¹ Einschließlich Zuchtebern und ausgemerzten Zuchtsauen Quelle: Statistisches Bundesamt/BMEL, 2017
22Mehr Tierwohl fördern
wir stärker zusammenführen. Unser Leitbild ist eine weites verpflichtendes Tierwohlkennzeichen zu schaffen.
flächengebundene Tierhaltung. Denn Tierwohl endet nicht an Landesgrenzen.
Bürgerinnen und Bürger hinterfragen zunehmend gän Mit aller Kraft werden wir nun auf nationaler Ebene
gige landwirtschaftliche Produktionsweisen, insbesondere weiterarbeiten, damit so schnell wie möglich die ersten
solche, die die Tierhaltung betreffen. Das BMEL ist der för- gekennzeichneten Produkte in den Ladenregalen liegen –
dernde, aber auch fordernde Partner der Landwirtinnen die Markteinführung unterstützen wir mit 70 Millionen
und Landwirte in diesem gesellschaftlich gewünschten Euro. Zudem wollen wir Stallumbauten zugunsten des
Weiterentwicklungsprozess. Vieles wurde bereits auf den Tierwohls fördern und erleichtern. Mit unserer Weiter
Weg gebracht: Die betäubungslose Ferkelkastration wird entwicklung der Nutztierstrategie setzen wir den
2021 beendet, der Ausstieg aus dem Kükentöten wird künftigen Rahmen so, dass das Geforderte für die
marktreif und der Antibiotikaeinsatz in der Nutztier- landwirtschaftlichen Betriebe leistbar ist. Gleichzeitig
haltung hat sich insbesondere bei Mastschweinen und unterstützen wir die Stellung der Landwirtinnen und
Mastferkeln deutlich reduziert. Landwirte in der Wertschöpfungskette, damit ihre Arbeit
angemessen honoriert wird.
Weitere Schritte sind jetzt zu gehen. Umfragen zeigen
immer wieder, dass Verbraucherinnen und Verbraucher Wir stärken die Innovationen und die Forschung für
bereit sind, für mehr Tierwohl auch mehr Geld aus- mehr Tierwohl. So bündelt das Bundesprogramm
zugeben. Unser mehrstufiges Tierwohlkennzeichen Nutztierhaltung, das Teil der Nutztierstrategie ist, die
wird herausstellen, was über den gesetzlichen Standard Neuerungen beim Tierwohl mit den Maßnahmen zum
hinausgeht – das Mehr an Tierwohl. Über die individu- Umweltschutz. Das Ziel ist, die Haltungsbedingungen in
elle Kaufentscheidung kann das dann auch finanziell den Ställen zu verbessern. In Tierwohlkompetenzzentren
honoriert werden. Die höheren Erlöse zahlen sich auch können sich Rinder-, Schweine- und Geflügelhalter bei-
für die Landwirtinnen und Landwirte aus. So wird ein spielhaft informieren. Damit stellen wir sicher, dass neue
Anreiz geschaffen, mehr in Tierwohl zu investieren. Erkenntnisse in die Praxis gelangen. Landwirtinnen und
Landwirtschaftliche Betriebe, die mehr Tierwohl umset- Landwirte, die vor Investitionsentscheidungen stehen,
zen, können dafür auch höhere Preise am Markt erlösen. brauchen eine solche Orientierung.
Gleichzeitig setzt sich das BMEL dafür ein, ein europa-
Abnahmerate 2016 gegenüber 2010 der viehhaltenden Betriebe (in %)
–16 Rinder insgesamt
–23 Milchkühe
–33 Schweine insgesamt
–43 Zuchtsauen
–19 Geflügel
–12 Schafe
-50 % -40 % -30 % -20 % -10 % 0%
Quelle: Statistisches Bundesamt/BMEL, 2017
23Mehr Tierwohl fördern
Struktur und Entwicklung des Viehbestandes (Großvieheinheiten)
Schleswig-Holstein -16,6 -5,0 Mecklenburg-Vorpommern
1.015.024 537.856
-0,4 -0,6
Niedersachsen Brandenburg
3.170.580
-13,9
+9,6 535.512
-8,0 -4,8
Nordrhein-Westfalen -2,3 Sachsen-Anhalt
1.835.480 +2,6 424.301
-11,1
Hessen +4,0 Sachsen
440.880 462.920
-15,2 -6,1 -0,7 -4,7
-6,1 -5,1
Rheinland-Pfalz Thüringen
306.501 344.949
-19,0 -8,9
Bayern
Saarland
-16,3 -5,2 2.818.180
42.566
-14,4 -6,5
Baden-Württemberg
1.002.741 -16,4 -4,8
Veränderung 2016 gegenüber 2010 (in %) Besatzdichte (GV je ha landwirt
schaftlicher Nutzfläche)
Anzahl der Betriebe Großvieheinheiten (GV) < 0,4 ≥ 0,7 < 1,0
≥ 0,4 < 0,5 ≥ 1,0
Quelle: Statistisches Bundesamt/BMEL, 2017 ≥ 0,5 < 0,7
24Wälder nachhaltig pflegen und nutzen
5 Wälder nachhaltig pflegen und nutzen
Wälder sind ein prägender Teil unserer Kulturlandschaft. In den Jahren 2018 und 2019 haben mehrere große
Mit rund 11,4 Millionen Hektar bedecken Wälder ein Kalamitäten (Stürme, extreme Dürre und Hitzewellen,
Drittel der Fläche unseres Landes. Der Wald erfüllt massenhafte Vermehrung von Borkenkäfern) den Wäl-
vielfältige Funktionen. Er ist die grüne Lunge unserer dern in Deutschland schwere, unübersehbare Schäden
Gesellschaft, Ökosystem, Lebensraum, Kohlenstoff- zugefügt. Auf rund 180.000 Hektar sind die Wälder neu
speicher, Naturerlebnis- und Erholungsraum sowie ein aufzubauen. Insbesondere Fichte und Buche wurden
bedeutender Rohstofflieferant. Nicht zuletzt sichert die schwer geschädigt. Für die Jahre 2018 und 2019 wird
Bewirtschaftung der Wälder Einkommen und Arbeit ins- von einer Menge an Kalamitätsholz von ca. 105 Millio
besondere in den ländlichen Räumen. Doch die Folgen nen Festmetern ausgegangen. Die Holzlager sind über-
des Klimawandels hinterlassen deutliche Spuren in den füllt. Teilweise kann das Holz nicht mehr abgesetzt
Wäldern. Wir müssen deshalb in Deutschland unseren werden.
Wald erhalten und ihn nachhaltig bewirtschaften.
Deshalb haben wir uns dafür eingesetzt, dass das
Der deutsche Wald steht vor großen Herausforde- Klimaschutzprogramm 2030 der Bundesregierung
rungen: Die wachsende Beanspruchung des Waldes zusätzliche substanzielle Finanzmittel für den Wald
in den Bereichen Klima-, Natur- und Umweltschutz vorsieht. Auf dem von uns einberufenen Nationalen
sowie Erholung und Jagd führt mancherorts bereits Waldgipfel im September 2019 haben wir gemeinsam
heute zu Zielkonflikten, die sich künftig – in regional mit Verbänden, Ländern, Städte- und Gemeindebund
unterschiedlicher Ausprägung – verschärfen könnten. sowie Vertretern des BMU intensiv beraten, wie die
Und auch der Klimawandel erfordert zunehmend neue Umsetzung der Förderung konkretisiert werden soll,
Lösungsansätze von Waldbesitzern und Forstwirtschaft. damit sie wirksam in den geschädigten und umzubau-
enden Wäldern ankommt.
Die Anpassung der Wälder an den Klimawandel und
der Klimaschutz im Rahmen einer nachhaltigen Be- Der Waldklimafonds der Bundesregierung unterstützt
wirtschaftung stehen an erster Stelle. Daneben gilt es, bereits mit jährlich rund 25 Millionen Euro Maßnah-
die biologische Vielfalt des Natur- und Lebensraums men zur Anpassung der Wälder an den Klimawandel
Wald zu erhalten, die nachhaltige und ressourcen und zum Erhalt und Ausbau des CO -Minderungs
²
effiziente Holzverwendung zu fördern und auch inter- potenzials von Wald und Holz. Dabei sollen – wo
national eine nachhaltige Waldbewirtschaftung und möglich – Synergien zwischen Klimaschutz, Anpas-
einen entsprechenden Waldschutz sicherzustellen. Der sung der Wälder an den Klimawandel und Erhalt der
Wald ist neben dem Boden der wichtigste terrestrische biologischen Vielfalt genutzt werden. Die Ergebnisse
CO -Speicher. Mit dem Erhalt des Waldes, seiner nach- dieser Politik- und Demonstrationsvorhaben sind eine
²
haltigen Bewirtschaftung und mit der Verwendung wichtige Hilfe bei der Bewältigung der aktuellen Dürre-
von Holz verfügen wir über ein immenses CO -Minde- schäden in den Wäldern.
²
rungs- und Speicherpotenzial. Wenn es den Wald, die
Forstwirtschaft und die Holzverwendung nicht gäbe,
hätten wir (bezogen auf das Jahr 2014) 14 Prozent mehr
CO -Ausstoß in Deutschland.
²
25Wälder nachhaltig pflegen und nutzen
Vom Rohstoff Holz geprägte Wirtschaftsbereiche
in Deutschland im Jahr 2014
1,1 Mio. 184 Mrd. € 57 Mrd. €
Beschäftigte erwirtschafteter Umsatz Bruttowertschöpfung
Quelle: BMEL, 2017
Bereits im vergangenen Jahr wurden auf unsere Initia Die Charta für Holz 2.0 unseres Ministeriums ist ein
tive hin neue Fördermaßnahmen in der Gemeinschafts- Meilenstein in dem von der Bundesregierung im
aufgabe zur Verbesserung der Agrarstruktur und des November 2016 beschlossenen Klimaschutzplan 2050.
Küstenschutzes“ (GAK) auf den Weg gebracht, um Schä- Im Rahmen der Charta werden Maßnahmen entwickelt,
den zu bewältigen. Hilfen gibt es: die den Beitrag nachhaltiger Holzverwendung zur Er-
reichung der Klimaschutzziele stärken. Die Umsetzung
→→ zur bestands- und bodenschonenden Räumung von der Charta für Holz 2.0 erfolgt im Dialog mit relevanten
Schadflächen und zur Lagerung von Schadholz Interessengruppen aus Wissenschaft, Wirtschaft, Politik
→→ zur Überwachung, Vorbeugung und Bekämpfung von und Gesellschaft, darunter Nichtregierungsorganisa-
Schadorganismen tionen sowie Verbraucherinnen und Verbrauchern.
→→ zur Prävention und Bekämpfung von Waldbränden Klimabewusstes Verbraucherverhalten wird mittels
→→ für Maßnahmen zur Wiederaufforstung Informationen und Aufklärung über die nachhaltige
Waldbewirtschaftung und intelligente Holzverwendung
Der Bundestag stellte dafür zweckgebunden in einem mit den Erfordernissen der Material- und Ressourcen
Zeitraum von fünf Jahren zusätzlich insgesamt 25 Mil- effizienz unterstützt.
lionen Euro bereit. Dieses Geld verstärkt die bereits
bestehenden GAK-Mittel für den Wald, die sich im Jahr Mit der Einrichtung des Kompetenz- und Informations
2018 auf etwa 30 Millionen Euro pro Jahr beliefen. Im zentrums Wald und Holz (KIWUH), das 2019 seine Arbeit
Regierungsentwurf zum Haushalt 2020 und zur Finanz- aufgenommen hat, werden im Auftrag unseres Ministe
planung bis 2023, der am 26. Juni 2019 vom Kabinett riums Förderprogramme im Bereich Wald und Holz
verabschiedet wurde, ist vorgesehen, die zweckgebunde- gebündelt. Hauptaufgaben des KIWuH sind die Fach-
nen Mittel zur Bewältigung von Extremwetterfolgen im und Verbraucherinformation zu den Themen Wald,
Wald in der GAK von derzeit 5 auf 10 Millionen Euro im nachhaltige Forstwirtschaft und Holzverwendung sowie
Jahr zu verdoppeln. Bundesministerin Klöckner erreich- die Unterstützung von Forschung und Entwicklung in
te zudem steuerliche Erleichterungen für betroffene den Themenbereichen Wald und Holz.
Waldeigentümer und eine neue Waldfördersparte bei
der Landwirtschaftlichen Rentenbank.
26Wälder nachhaltig pflegen und nutzen
Der Anteil von Wald in Deutschland
(bezogen jeweils auf die Fläche der einzelnen Bundesländer)
Deutschland
35.720.780 Landesfläche
32 % 11.419.124 Waldfläche
Alle Flächenangaben in ha
Schleswig-Holstein Mecklenburg-Vorpommern
11 %
1.579.957 2.319.318
173.412 558.123
24 %
12 % Hamburg und Bremen
Niedersachsen 115.907
4.769.942 13.846
12 %
1.204.591
Berlin und Brandenburg
3.037.573
37 % 1.130.847
25 %
Nordrhein-Westfalen
3.409.772
Sachsen-Anhalt
909.511
26 % 2.045.029
532.481
Hessen 27 %
Sachsen
2.111.480 1.842.002
894.180 533.206
29 %
34 % Thüringen
Rheinland-Pfalz 42 % 1.617.250
1.985.406 549.088
839.796 42 %
Bayern
7.055.019
Saarland 2.605.563
256.977 40 %
102.634
37 %
Baden-Württemberg 38 %
3.575.148
1.371.847
Wald
Quelle: Bundeswaldinventur, 2012
27Gewässer bewahren
6 Gewässer bewahren
Die deutsche Fischerei und Fischwirtschaft stellt einen Auch Meere und Ozeane sind ökologisch vielfältige,
leistungsfähigen, hochmodernen Wirtschaftsfaktor natürliche Lebensräume und zugleich Quelle für Roh-
im Binnenland und an Deutschlands Küstenregionen stoffe, Energie und Nahrung. Um sie zu bewahren und
dar, der dort Leben und Kultur prägt. Ihre nachhaltige künftigen Generationen die Möglichkeit zu erhalten,
Ausrichtung trägt zum Erhalt von Naturräumen und sich mit hochwertigen und gesunden Lebensmitteln aus
Artenvielfalt bei. Die mehr als 40.000 Menschen, die in dem Meer zu versorgen, sind der Schutz und die nach-
diesem Sektor beschäftigt sind, tragen dazu bei, dass haltige Nutzung der globalen Bestände unverzichtbar.
die Verbraucherinnen und Verbraucher jährlich mit rund Denn nur ausreichende Fischbestände sichern langfristig
1,1 Millionen Tonnen qualitativ hochwertigen Fischerei- Wertschöpfung und Arbeitsplätze.
erzeugnissen versorgt werden. Die direkt oder indirekt
mit der Fischerei verbundenen Arbeitsplätze bilden das Der Klimawandel macht auch vor der deutschen Fische-
Rückgrat vieler Regionen an der deutschen Ost- und rei nicht halt. Der Klimawandel und die dadurch hervor-
Nordseeküste. gerufenen Veränderungen der Ökosysteme in Flüssen,
Umsatz von Fisch und Fischereierzeugnissen nach Sparten (in Mio. €)
Veränderung zum Vorjahr
5.201 +10,9 %
5.000
4.690
4.692 +3,1 %
4.458 4.533
4.351
4.000
3.779 3.877 +2,6 %
3.688
3.000
2.165 2.129 2.222 +4,4 %
2.000
1.000
418 451 451 0%
223 250 259 +3,6 %
0
2015 2016 2017
Fischgroßhandel1,2 Fischimport1 Fischeinzelhandel1 Fischindustrie Fischrestaurants / Imbisse3 Seefischerei
1
Berichtigt. 2 Schätzung für 2017. 3 Schätzung für alle Jahre.
Quelle: Fisch-Informationszentrum e. V., 2017
28Sie können auch lesen