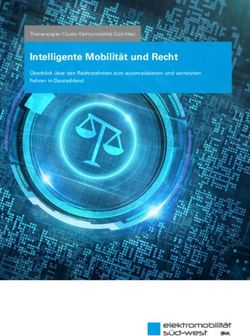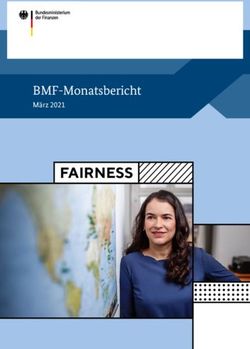PERSPEKTIVEN FÜR DIE TELEMEDIZIN - VORAUSSETZUNGEN DER SKALIERUNG UND MARKTPOTENZIAL
←
→
Transkription von Seiteninhalten
Wenn Ihr Browser die Seite nicht korrekt rendert, bitte, lesen Sie den Inhalt der Seite unten
PERSPEKTIVEN FÜR DIE TELEMEDIZIN — VORAUSSETZUNGEN DER SKALIERUNG UND MARKTPOTENZIAL Eine Studie im Auftrag des Bundesministeriums für Wirtschaft und Energie im Rahmen der Begleitforschung zum Technologieprogramm „Smarte Datenwirtschaft“
PERSPEK TIVEN FÜR DIE TELEMEDIZIN IMPRESSUM Die Studie wurde im Auftrag des Bundesministeriums für Wirtschaft und Energie im Rahmen der Begleitforschung zum Technologieprogramm „Smarte Datenwirtschaft“ erstellt. AUTOR:INNEN Dr. Stefanie Demirci Dr. Martina Kauffeld-Monz Dr. Samer Schaat HERAUSGEBER Peter Gabriel Begleitforschung Smarte Datenwirtschaft Institut für Innovation und Technik (iit) in der VDI / VDE Innovation + Technik GmbH Steinplatz 1 10623 Berlin gabriel@iit-berlin.de VERÖFFENTLICHUNG Mai 2021 GESTALTUNG LoeschHundLiepold Kommunikation GmbH Hauptstraße 28 10827 Berlin BILDER wvihr (Titel), agenturfotografin (S. 4), metamorworks (S. 37), insta_photos (S. 48) – stock.adobe.com 2
INHALT Executive Summary 5 1 Einleitung 10 2 eHealth, digitale Gesundheit & Telemedizin: Begriffsdefinitionen & Abgrenzungen 16 3 Der Status Quo 22 3.1 Die Perspektive der Versorgung 22 3.2 Die technische Perspektive 25 3.2.1 IKT-Tools zur Datenerfassung und -übertragung 25 3.2.2 Datenmanagement 26 3.3 Die ökonomische Perspektive 30 4 Voraussetzungen für die Skalierung der Telemedizin 40 5 Das wirtschaftliche Potenzial der Telemedizin 46 5.1 Marktpotenzial für Telekonsultationen 49 5.1.1 Einflussfaktoren 49 5.1.2 Schätzung der Inanspruchnahme 51 5.1.3 Schätzung des Umsatzvolumens 53 5.2 Marktpotenzial für Telekonsilien 55 5.2.1 Einflussfaktoren 56 5.2.2 Schätzung der Inanspruchnahme 58 5.2.3 Schätzung des Umsatzvolumens 59 5.3 Marktpotenzial für das Telemonitoring 61 5.3.1 Einflussfaktoren 63 5.3.2 Schätzung der Inanspruchnahme 64 5.3.3 Schätzung des Umsatzvolumens 65 5.4 Hochrechnung: Marktpotenzial für die Telemedizin 68 6 Literatur 72 Anhang 76 Liste der in dieser Kurzstudie betrachteten Telemedizin-Projekte 78 Glossar 82 3
PERSPEK TIVEN FÜR DIE TELEMEDIZIN EXECUTIVE SUMMARY Die Covid-19-Pandemie hat der Telemedizin, d.h. der medizini- Telemonitoring als hemmend darstellen, da die beteiligten schen Versorgung über eine räumliche Distanz mittels digitaler Akteure aus unterschiedlichen Marktsegmenten mit teilweise Kommunikation, einen enormen Schub gegeben. Im Laufe der wenig kompatiblen Verwertungsstrategien zusammenkommen. letzten Jahrzehnte gab es bereits eine Vielzahl an Telemedizin- Der Innovationspfad einer telemedizinischen Anwendung ist in Projekten, die es jedoch zumeist nicht in die breite Umsetzung Deutschland in der Regel auf die Mitwirkung der gesetzlichen geschafft haben. Im Programm Smarte Datenwirtschaft (SDW) Krankenversicherung als Interessengemeinschaft der Ver- des Bundesministeriums für Wirtschaft und Energie (BMWi) sicherten angewiesen, auch weil die Zahlungsbereitschaft der befindet sich dagegen mit Telemed50001 ein Pilotprojekt, das Privatpersonen/-haushalte vergleichsweise gering ist. Passt ein gerade diese Skalierung telemedizinischer Anwendungen auf Geschäftsmodell jedoch nicht in die Logik angemessener Nut- große Patientenkohorten zum Thema hat. Im Rahmen der Be- zen-Kosten-Relationen der gesetzlichen Kranken- und Pflege- gleitforschung zum Programm SDW betrachtet diese Kurzstu- kassen, hat es wenig Realisierungschancen. Die Überführung in die daher begleitend und ergänzend zentrale Einflussfaktoren geeignete Vergütungs- und Erstattungsformen ist insbesondere für die Skalierung der Telemedizin und schätzt zusätzlich das deshalb notwendig, um die Chancen der Digitalisierung gerade Marktpotenzial für die Telemedizin in Deutschland im Jahr 2030 jetzt in der Pandemielage zu nutzen. Obwohl derzeit die Tele- ab. Basis sind eine eingehende Literaturrecherche und Inter- medizin noch nicht im Fokus der neuen Regulatorik rund um views mit Expert:innen aus Telemedizin-Projekten. eHealth steht, kann aufgrund des iterativen Charakters jedoch von einer Anpassung dahingehend ausgegangen werden. Die Telemedizin kann in ihren unterschiedlichen Ausprägungen grundsätzlich in viele medizinische Fachgebiete integriert Techno-strukturelle Integration: werden. Das Potenzial der jeweiligen Anwendung stellt sich Eine breite Nutzung der Telemedizin steht und fällt mit einer allerdings in sehr differenzierter Art und Weise dar und muss möglichst flächendeckenden Breitbandverfügbarkeit mit neben den spezifischen Versorgungs- und technischen Aspek- akzeptablen Datenraten. Gerade in ländlich geprägten Regionen, ten, immer auch die ökonomische Sichtweise im Blick haben. die per Definition am meisten von der Telemedizin und ihren Für eine erfolgreiche und breite Umsetzung lassen sich folgende breiten Möglichkeiten profitieren würden, ist diese aufgrund Einflussfaktoren identifizieren: unzureichender Bandbreiten nicht umsetzbar. Eine gute Daten- übertragung beeinflusst zudem die Akzeptanz auf Seiten der NUTZEN & EVALUATION: Leistungserbringer wie auch der Patient:innen. Es sind vor Aussagekräftige, belastbare Evaluationsergebnisse mit dem allem einheitliche Standards, die einer vollständigen Interope- Nachweis des Nutzens für die Patienten und weitere Stake- rabilität von Daten förderlich sind. Dazu wurden bereits diverse holder entsprechend ihrer Perspektiven und Bedarfe, gelten als Standards festgeschrieben, die von vielen Projekten umgesetzt wesentliche Voraussetzungen telemedizinischer Anwendungen. bzw. integriert werden können. Damit sind die Projekte grund- Um eine Wirksamkeit in der Breite erzielen zu können, bedarf es sätzlich für eine Anbindung an eine zentralisierte Infrastruktur eines repräsentativen Einsatzes unter realistischen Bedingun- vorbereitet. Allerdings fehlen dazu derzeit noch klar definierte gen. Derzeitige Anstrengungen mit Blick auf Ökosysteme und IT-Schnittstellen und -Dienste, was aber die Umsetzbarkeit tele- Erprobungsplattformen für Produkte der digitalen Gesundheits- medizinischer Anwendung nicht grundlegend hindert. Die Pro- wirtschaft können auch für telemedizinische Anwendungen eine jekte behelfen sich zumeist mit eigener Infrastruktur, verfolgen durchaus interessante Option sein, den Nutzen zu erkunden und aber die Geschehnisse rund um die Telematik-Infrastruktur und belastbare Evaluationen vorzubereiten. können, bei Bedarf, die notwendigen Schnittstellen anpassen. GESCHÄFTS-/BETREIBERMODELL: Die Berücksichtigung der jeweiligen Perspektiven der beteilig- NUTZEREINBINDUNG & BEGLEITUNG: ten Akteursgruppen und Stakeholder aus ihren eigenen An- Positive Nutzenerfahrungen sind für telemedizinische Anwen- reizstrukturen heraus ist maßgeblich erfolgskritisch. Häufig dungen die Grundlage dafür, dass die Akzeptanz auf Seiten der bedarf es zur Lösung anspruchsvoller Aushandlungsprozesse Nutzenden – Leistungserbringer und Patient:innen – und der und eines Interessenausgleichs. Dies kann sich vor allem beim Kostenträger weiter steigt. Die Unterstützung der Leistungser- 1 Telemed5000, ein intelligentes System zur telemedizinischen Mitbetreuung von großen Kollektiven kardiologischer Risikopatienten - https://www.telemed5000.de/ [14.11.2020] 5
PERSPEK TIVEN FÜR DIE TELEMEDIZIN bringer bei der Patienteninformation-/aufklärung zu Telemedizin Datenmanagement: und die Förderung der Digitalisierungskompetenz mit Bezug zu Es ist absehbar, dass vor allem im Gesundheitswesen weitere Gesundheit im Allgemeinen, spielen hierzu eine übergeordnete standardisierte Zertifizierungen für datengetriebene Modelle Rolle. Die aktuellen regulatorischen Neuerungen im Bereich und Systeme verpflichtend werden, sodass bereits heute ein eHealth werden sich vermutlich sehr förderlich dahingehend sicheres, transparentes Datenmanagement und die Gewährleis- erweisen, dass Patientengruppen mit geeigneten Indikationen tung des Datenschutzes im Rahmen der DSGVO großen Einfluss Erfahrungen sammeln und Nutzen erlebbar wird. Ob dieser auf die breite Umsetzbarkeit von Telemedizin hat. Dies ist vor Nutzen nachhaltiger Natur sein wird, muss erst noch erprobt und allem dort wichtig zu beachten, wo ein Austausch von Patien- erwiesen werden. Die Aufklärung und ggf. Weiterentwicklung der tendaten stattfindet. Zudem braucht es für eine Skalierung der rechtlichen Rahmenbedingungen gilt verstärkt der Umsetzung Anzahl an zu betreuenden Patient:innen den Einsatz intelligenter von Telemonitoring-Anwendungen als Treiber, damit dies nicht Methoden zur adäquaten Datenvorverarbeitung um medizini- wegen vermeintlicher Haftungsrisiken als Behandlungsformat sche Ressourcen zu schonen. Zukünftige forschungskompa- zu stark ausgeblendet wird. Auch bei den anderen Anwendungs- tible Interoperabilitätsstandards bieten sich für eine weitere arten von Telemedizin sind ähnliche Risiken möglich, allerdings Datennachnutzung an, setzen aber bei der Umsetzung unter aufgrund des niedrigschwelligen Einsatzes an Medizinprodukten anderem einen Datenmanagementplan voraus. Die im Zuge der eher wenig wahrscheinlich. Das Fehlen ausreichender rechtlicher Telemedizin erfassten bzw. generierten Daten sollten im Sinne Rahmenbedingungen, etwa bei Abrechnungs- und Haftungs- der Datensouveränität den Patient:innen, nach freiwilliger Bereit- fragen, könnte sich jedoch zunehmend als Hemmnis erweisen. stellung, in aggregierter Form zur Verfügung gestellt werden. Je nachdem, wie sich diese Faktoren in der Praxis gestalten, ist das wirtschaftliche Potenzial der Telemedizin größer oder kleiner, so dass wir unsere Schätzung in drei Szenarien vorneh- men: S (small: pessimistische Grundannahmen), M (medium: realistische Annahmen) und L (large: optimistische Annahmen). Auch das pessimistische Szenario S geht aber davon, dass das die durch Covid-19-Pandemie bewirkte Wachstum der Teleme- dizin weiter anhält, wenn auch auf geringem Niveau. Grundlage für unsere Berechnung des wirtschaftlichen Potenzials sind Schätzungen der Investitionskosten für IT-Hardware, -Software und -Dienstleistungen, die Leistungserbringer gegebenenfalls zum sachgerechten Einsatz telemedizinischer Anwendungen anschaffen müssen. Damit entsteht ein Markt, den Anbieter aus der IKT-Branche bedienen können. Die Schätzungen stellen wir für die drei wichtigsten Kategorien telemedizinischer Anwen- dungen an: Telekonsultationen zwischen Arzt und Patient:in, Telekonsilien zwischen Ärzt:innen untereinander sowie das Tele- monitoring von Patient:innen, und extrapolieren die Ergebnisse dann auf die gesamte Telemedizin. 6
ZUSAMMENFASSUNG Damit ergibt sich ein Marktpotential für die Telemedizin in zu den drei Kategorien telemedizinischer Anwendungen stellt eine Deutschland im Jahr 2030 von ca. 1,4 Mrd. Euro (bei konser- Vereinfachung dar, um eine Aussagefähigkeit zu ermöglichen. vativen Grundannahmen), ca. 2 Mrd. Euro (bei realistischen Nichtsdestotrotz wird erstmals ein wertvoller Anknüpfungspunkt Grundannahmen) und ca. 3,6 Mrd. Euro (bei optimistischen für weitere Untersuchungen auf gesamtstaatlicher Ebene und Grundannahmen). Die Hochrechnung der Detailuntersuchung entlang medizinisch validierter Behandlungspfade gegeben. 3.614 Mio. € 1.446 Mio.€ 2.028 Mio. € 811 Mio. € 1.424 Mio. € 1.460 Mio. € 570 Mio. € 730 Mio. € 548 Mio. € 526 Mio. € 355 Mio. € 234 Mio. € 132 Mio. € 182 Mio. € 72 Mio. € SZENARIO S SZENARIO M SZENARIO L Telekonsultation Telekonsilien Telemonitoring Andere telemedizinischen Anwendungen Abbildung 1: Marktpotenzial für die Telemedizin und ausgewählte telemedizinische Anwendungen in Deutschland im Jahr 2030 7
01 9
PERSPEK TIVEN FÜR DIE TELEMEDIZIN DIE COVID-19-PANDEMIE HAT DER DIGITALISIERUNG DER GESUND- HEITSVERSORGUNG UND DER ENTSPRECHENDEN REGULATORIK EINEN GROSSEN SCHUB GEGEBEN. ZIEL DIESER STUDIE IST DAHER, EINE EINORDNUNG DER TELE- MEDIZIN VOR DEM HINTERGRUND DES AKTUELLEN GESCHEHENS. 10
PERSPEK TIVEN FÜR DIE TELEMEDIZIN 1 EINLEITUNG Die Digitalisierung im Gesundheitswesen hat nicht zuletzt aufgrund der Covid-19-Pandemie und den damit verbundenen Gefahren und Beschränkungen deutlich an Fahrt aufgenommen. Die Hoffnung war bereits zuvor groß, dass mit einer umfassenden Digitalisierung eine flächendecken- de Breitenversorgung, insbesondere in ländlichen Regionen, eine vernetzte, datengetriebene Ge- sundheitswirtschaft und mögliche Kosteneinsparungen bei Krankenhaustagen einhergehen (vgl. Szecsenyi et al. 2018). Teilweise waren diese Effekte für vereinzelte Anwendungen auch schon belegt worden (vgl. Köhler et al. 2018). Die Tatsache, dass durch die Pandemie in kürzester Zeit eine Vielzahl von Menschen die Herausforderungen der medizinischen Versorgung direkt erfahren mussten, hat der Akzeptanz von digitalen Gesundheitsanwendungen durch die Bevölkerung großen Aufwind beschert. Laut einer Umfrage von doctolib (2020), im Zuge derer insgesamt 1.026 Personen im Alter zwischen 18 und 75 Jahren befragt wurden, gaben mehr als die Hälfte (55 %) der Teilnehmer an, seit der Corona-Pandemie aufgeschlossener gegenüber digitalen Gesundheits- angeboten zu sein, als zuvor. Unter den 65- bis 75-Jährigen erklärten sogar 75 % der Befragten, sie hätten den Nutzen digitaler Produkte erkannt. Dabei ist der Begriff Telemedizin nicht neu und historisch gesehen auch nicht unbedingt der Digitalisierung der Medizin zuzuordnen. Als erster Anwendungsfall wird ein Ereignis aus dem Jahr 1876 gesehen, als der britische Erfinder Alexander Graham Bell seine neueste Erfindung „Telefon- apparatur“ dazu benutzte, um seinen im Nebenzimmer anwe- senden Kollegen Thomas A. Watson zur Hilfe zu rufen, da er — sich versehentlich Säure über den Anzug geschüttet hatte (vgl. Deter et al. 2011). Dieser erste Telenotruf basierte noch auf DER BEGRIFF TELEMEDIZIN analoger Technologie und hat mit unserem heutigen Verständ- nis von „Telemedizin“ nur sehr wenig zu tun. Der älteste, noch GEHT EIGENTLICH AUF DIE im Einsatz befindliche telemedizinische Dienst Deutschlands ist der Telemedical Maritime Assistance Service (TMAS), der ANFÄNGE DER ANALOGEN eine weltweite notfallmedizinische Hotline zur direkten und sofortigen Funk-ärztlichen Beratung durch in der maritimen TELEFONIE ZURÜCK Medizin besonders erfahrene Fachärzte im 24-Stunden-Be- — trieb anbietet (vgl. Paulus et al. 2009). Im Laufe der vergan- genen Jahrzehnte hat es immer wieder Vorstöße in Form von öffentlich bzw. privatwirtschaftlich geförderten Forschungs- und Entwicklungsprojekten gegeben. Und dennoch haben es bislang nur sehr wenige telemedizinische Anwendungen in die Regelversorgung geschafft. Ziel der vorliegenden Studie ist es zum einen der Frage nachzugehen, welche Faktoren die breite Umsetzung von telemedizinischen Anwendungen noch immer hemmen. Andererseits beleuchten wir auch jene Faktoren, die sich besonders günstig auf eine mögliche Verstetigung der Projekte jenseits einer initialen Förderung hinaus, auswirken. Gerade aufgrund der Covid-19-Pandemie hat es einige große Veränderungen hinsichtlich der Digitalisierung der Gesundheit und der entsprechenden Regulatorik gegeben. Wir möchten mit dieser Studie auch eine Einordnung des aktuellen Geschehens erreichen und liefern daher eine Bestandsaufnahme der Telemedizin in Deutschland aus Versorgungs-, technischer und ökono- mischer Perspektive. Dabei gehen wir auch auf die Frage ein, ob die aktuellen regulatorischen und technischen Entwicklungen das Potenzial haben, den Stand der Telemedizin nachhaltig zu beeinflussen. 11
PERSPEK TIVEN FÜR DIE TELEMEDIZIN Für die breite Umsetzung von telemedizinischen Anwendungen braucht es entsprechende wirtschaftliche Akteure, die die Verwertung der Projektergebnisse vorantreiben. Anders als bei Produkten der industriellen Digitalwirtschaft stellt sich der Gesundheitsmarkt divers dar. Im Fokus steht dort immer die Erstattungsfähigkeit durch die sogenannten Kostenträger, d.h. insbesondere die Kranken- und Pflegekassen. Bei telemedizinischen Anwendungen ist typischerweise eine Vielzahl an Akteuren aus unterschiedlichen Marktsegmenten beteiligt. Dies macht es besonders schwierig, den potenziellen Markt für Telemedizin abzustecken. Darum stellen wir in dieser Studie erstmalig Perspektiven für eine Marktdurchdringung in differenzierter Form dar und liefern dadurch eine Abschätzung des Marktpotenzials telemedizinischer Anwendungen. Die methodische Grundlage der Studie ist ein mehrstufiger Ansatz aus Projekt- bzw. Literatur- recherche und strukturierter Diskussion mit Vertretern aus Wirtschaft und Wissenschaft. Projektrecherche: Für die Bestandsaufnahme des Standes der Telemedizin in Deutschland und deren wirtschaftliche Perspektiven wurden Daten zu Telemedizin-Projekten und deren Kosten recherchiert. Ausgangspunkte für die Recherche telemedizinischer Projekte waren das vesta Informationsportal2, die Liste der geförderten Projekte im Bereich „Neue Versorgungsformen“ des Innovationsfonds3 (Gemeinsamer Bundesausschuss; G-BA), der Förderkatalog des Bundes4 sowie Informationswebseiten einiger Initiativen der Länder Baden-Württemberg5, Bayern6, Nordrhein- Westfalen7, Schleswig-Holstein8 und Sachsen9. Aus allen Portalen wurden nur solche Projekte ausgewählt, die tatsächlich unter den in dieser Kurzstudie definierten Begriff der Telemedizin (vgl. Kapitel 2) fallen. Das Ergebnis unserer Recherchen findet sich im Anhang dieser Kurzstudie. Literaturanalyse: Es wurde empirische und theoretisch-konzeptionelle Literatur in die Analysen einbezogen. Die empirischen Studien berücksichtigten Daten zur Akzeptanz von eHealth- Lösungen und zur Gesundheitsökonomie. Die konzeptionelle Literatur umfasste vor allem Quellen zu klinischen Nutzennachweisen von telemedizinischen Anwendungen sowie zu Methoden und Konzepten des Gesundheitsdatenmanagements. Anhand der Literatur und dem Ergebnis der Projektrecherche wurden Einflussfaktoren mit Blick auf eine breite Umsatzbarkeit (Skalierung) von telemedizinischen Anwendungen identifiziert und diese zu Kategorien verdichtet. Zudem wurden drei erfolgreiche Anwendungsarten der Telemedizin für die nähere Betrachtung der Einflussfaktoren unter spezifischen Bedingungen bestimmt. Qualitative Interviews: Im Rahmen der Studie wurden zehn Expert:inneninterviews geführt. Die Auswahl dieser Gesprächspartner war zum einen durch den Ausschnitt der eingehender betrach- teten Telemedizin-Projekte begründet. Zum anderen erfolgte die Auswahl basierend auf einschlä- giger Literatur. Die Interviewpartner haben jeweils die Umsetzung von Telemedizin-Projekten (mit) verantwortet bzw. sind durch einschlägige Publikationen als Expert:innen im Bereich der Teleme- dizin und ihrer Überführung in die Regelversorgung ausgewiesen. 2 vesta Informationsportal der gematik GmbH - https://www.informationsportal.vesta-gematik.de [15.11.2020] 3 Liste der geförderten Projekte, Neue Versorgungsformen, Innovationsfonds des G-BA - https://innovationsfonds.g-ba.de/projekte/neue-versorgungsformen/ [14.11.2020] 4 Förderkatalog des Bundes - https://foerderportal.bund.de/foekat/jsp/StartAction.do [14.11.2020] 5 Koordinierungsstelle Telemedizin Baden-Württemberg - https://www.telemedbw.de/ [14.11.2020] 6 Bayerische Telemedallianz - https://www.telemedallianz.de/ [14.11.2020] 7 Landesinitiative eGesundheit.nrw - https://egesundheit.nrw.de/ [14.11.2020] 8 Telemedizin in Schleswig-Holstein - https://www.schleswig-holstein.de/DE/Fachinhalte/G/gesundheitsland/gesundheitsland_Telemedizin.html [14.11.2020] 9 vital digital, Fachportal des Freistaates Sachsen - https://www.vital.digital.sachsen.de/ [14.11.2020] 10 AIR_PTE, KI-Methoden zur Prognose von Behandlungserfolgen - https://www.digitale-technologien.de/DT/Redaktion/DE/Kurzmeldungen/Aktuelles/2020/SDW/2020_10_06_SDW_AIR_PTE.html [17.11.2020] 12
EINLEITUNG Die Autor:innen bedanken sich herzlich bei den Expert:innen für die Teilnahme an den Interviews: Dr. Jörg Caumanns, fbeta GmbH Prof. Dr. med. Friedrich Köhler, Charité Berlin Carsten Lehberg / Stefanie Springer, BANSBACH ECONUM Unternehmensberatung GmbH Prof. Dr. Guido Noelle, gevko GmbH Prof. Dr. med. Oliver G. Opitz / Florian Burg / Dr. Armin Pscherer - Koordinierungsstelle Telemedizin Baden-Württemberg Dr. Arsanush Rashid, ZTM Bad Kissingen GmbH Veronika Strotbaum, ZTG Zentrum für Telematik und Telemedizin GmbH Prof. Dr. Sylvia Thun, Berlin Institute of Health Prof. Dr.-Ing. Thomas Zahn, bbw Hochschule / DCC Risikoanalytik GmbH Projektkonsortium Telemed50001 (Charité Berlin, SYNIOS Document & Workflow Management GmbH, GETEMED Medizin- und Informationstechnik AG, Fraunhofer IAIS, Hasso-Plattner-Institut, AIT Austrian Institute of Technology GmbH) Abschätzung des Marktpotenzials: Das Marktpotenzial für die Telemedizin in Deutschland schätzen wir anhand der dafür notwendigen Investitionen der Leistungserbringer, also insbesondere der Ärzte und Krankenhäuser, ab. Als Zeithorizont wählen wir das Jahr 2030, zu dem ein regulärer Betrieb telemedizinischer Anwendung (TMA) erwartbar ist. Grundlage der Abschätzung ist eine Betrachtung der großen TMA-Kategorien Telekonsultation, Telekonsilium und Telemonitoring, die heute und in absehbarer Zeit einen Großteil der Anwendungen in der Telemedizin stellen werden. Die Studie geht im Folgenden in Kapitel 2 zunächst näher auf den Begriff Telemedizin und ihre Abgrenzung zum Feld des eHealth bzw. der digitalen Gesundheit ein. In Kapitel 3 erfolgt eine Be- standaufnahme derzeitiger telemedizinischer Anwendungen in Deutschland entlang der Aspekte Versorgung, Technik und Ökonomie. Diese Themen sind anwendungsübergreifend und stellen die in Kapitel 4 präsentierten Voraussetzungen für eine erfolgreiche Skalierung der Telemedizin dar, die im Zuge einer Recherche bestehender Literatur und im Gespräch mit unserem Expert:innen- kreis identifiziert wurden. Abschließend, in Kapitel 5, wird anhand der drei TMA-Kategorien Tele- konsultation, Telekonsilium und Telemonitoring das Marktpotential der Telemedizin abgeschätzt. Die Studie wurde im Rahmen der Begleitforschung zum BMWi-Technologieprogramm Smarte Datenwirtschaft (SDW) erstellt. In SDW arbeiten Unternehmen und Forschungseinrichtungen in 20 anwendungsnahen Verbundprojekten an der Konzeption und Erprobung innovativer Daten- produkte und Datendienste. Zwei der Projekte, Telemed50001 und AIR_PTE10, sind in der Gesund- heitswirtschaft angesiedelt, und die prototypische Telemedizin-Anwendung des Projekts Tele- med50001 realisiert eines der drei Beispielszenarien dieser Studie. Wir bedanken uns sehr herzlich bei Dr. Fabian Werner (BMWi), Dr. Regine Gernert (DLR Projektträger), Hanna Kolkmann (DLR Projektträger) und Louisa Wagner (DLR Projektträger) für die Unterstützung und wertvollen Hinweise im Verlauf der Kurzstudie. 13
02 15
PERSPEK TIVEN FÜR DIE TELEMEDIZIN 2 eHEALTH, DIGITALE GESUNDHEIT UND TELEMEDIZIN: BEGRIFFS- DEFINITIONEN UND ABGRENZUNGEN Die Unübersichtlichkeit der Begrifflichkeiten im Bereich der Digitalisierung im Gesundheitswesen wurde bereits vielfach angemerkt (Leppert et al. 2016), besteht aber weiterhin, leider auch auf der regulatorischen Ebene. In diesem Abschnitt unternehmen wir daher eine Einordnung der Begriffe von eHealth über digitale Gesundheit bis Telemedizin, auf die wir im späteren Verlauf der Studie zurückgreifen werden (vgl. Abbildung 2). eHEALTH DIGITALE GESUNDHEIT/ GESUNDHEITSTELEMATIK DIGITAL HEALTH TELEKONSILIEN GESUNDHEITS-IT TELEKONSULTATION TELEMONITORING TELETHERAPIE DiGA Telemedizin mHealth med. Sensorik /Aktuatorik Abbildung 2: Hierarchisierung von eHealth und weiteren digitalen Anwendungsfeldern, in Anlehnung an Leppert (2016) Die Bundesärztekammer definiert den Begriff eHealth (electronic Health) als den kostengünstigen und sicheren Einsatz von Informations- und Kommunikationstechnologien (IKT), um die allgemeine Gesundheit und gesundheitsbezogene Bereiche (Gesundheitssysteme, Gesundheitsberichterstat- tung, Gesundheitsförderung sowie Allgemeinwissen und Forschung) zu fördern (vgl. Bundes- ärztekammer 2015). Darunter fällt ein „breites Spektrum von IKT-gestützten Anwendungen, in denen Informationen elektronisch verarbeitet, über sichere Datenverbindungen ausgetauscht und Behandlungs- und Betreuungsprozesse von Patientinnen und Patienten unterstützt werden können“ (Bundesministerium für Gesundheit 2020). eHealth dient somit der Verbesserung der Gesundheit und Unterstützung der Gesundheitsversorgung inklusive aller einbezogenen medizini- schen und nicht-medizinischen Dienstleistungen (vgl. Leppert 2016). Reine Verwaltungsaufgaben, die durch IKT unterstützt werden, sind jedoch nicht unter eHealth eingeordnet. 16
eHE ALTH, DIGITALE GESUNDHEIT UND TELEMEDIZIN: BEGRIFFSDEFINITIONEN UND ABGRENZUNGEN Gesundheits-IT beschreibt sämtliche IT-Systeme für den ambulanten und klinischen Sektor. Sie umfasst die Gesamtheit der IT-Infrastruktur und stellt vorwiegend die technischen Komponenten und Dienstleistungen bereit. Zudem zählen auch entsprechende Softwareanwendungen zur Visu- alisierung, Analyse, Erfassung und Manipulation von Daten dazu. Im Bereich Digitale Gesundheit (engl. digital Health), einer Unterkategorie von eHealth, gilt es Personen in ihrer eigenen Verantwortung der Gesunderhaltung zu unterstützen, indem eine Über- wachung, ein Management sowie eine Verbesserung des Gesundheitszustands ermöglicht und erlaubt wird (vgl. Meister et al. 2017). Spezielle Ausprägungen der digitalen Gesundheit sind digitale Gesundheitsanwendungen (DiGA), die seit 2019 im Digitale-Versorgung-Gesetz (DVG) und der Digi- tale-Gesundheitsanwendungen-Verordnung (DiGAV) gesetzlich verankert sind (vgl. Krüger-Brand et al. 2020). Ausgenommen sind laut DiGAV hiervon jedoch sämtliche Anwendungen, die ausschließ- lich eine direkte Kommunikation zwischen Leistungserbringer und Leistungsempfänger realisieren. Unter dem Begriff mHealth (mobile Health) wird der Einsatz mobiler Endgeräte zur Unterstützung der Gesundheitsversorgung durch die Verbesserung der Datenverfügbarkeit (Erfassung, Kommu- nikation und Visualisierung) verstanden (vgl. Meister et al. 2017). Damit ist das Konzept einerseits der digitalen Gesundheit zuzuordnen. Andererseits lassen sich durch die Anbindung entsprechen- der mobiler Endgeräte an eine Datenaustauschinfrastruktur per Eingabe erfasste (Gesundheits-) Daten auch an Leistungserbringer, Kostenträger und als Analysen bzw. Handlungsempfehlungen auch wiederum zurück an die Versicherten übertragen. Ein gewisser Teil des mHealth-Konzeptes ist also auch der Gesundheitstelematik zuzuordnen. Bei manchen telemedizinischen Anwendungen kommt zudem spezielle, sich am oder im Körper der Patient:innen befindende medizinische Sensorik zum Einsatz, die deren Vitalparameter (u.a. Blutdruck, EKG, Puls, Sauerstoffsättigung, Körpergewicht, Lungenfunktion, Temperatur, Blutzu- cker und Augeninnendruck) kontinuierlich erfassen. Zudem kann spezielle Kamerasensorik dazu verwendet werden, definierte Bewegungsabläufe der Patient:innen aufzunehmen. Die erfassten Daten können dann wiederum als Eingabe für medizinische Aktuatorik, beispielsweise ein aus der Distanz bzw. per Signal steuerbares Implantat, wie eine Insulinpumpe, dienen. Hierunter fallen auch spezielle Roboter(arme), die vor allem im Pflege- bzw. Rehabilitationsbereich automatisiert oder aus der Ferne gesteuert zum Einsatz kommen. Der Aspekt von eHealth, der sich mit einer direkten, digitalen Kommunikation zwischen Leistungs- erbringern und Leistungsempfängern befasst, wird durch die Unterkategorie der Gesundheits- telematik abgedeckt. Sie umfasst sämtliche IKT-Anwendungen im Gesundheitswesen zur Überwindung räumlicher und ggf. auch zeitlicher Distanzen unter sicheren Bedingungen (vgl. Leppert 2016). Grundlage für die standardisierte und gesicherte Kommunikation im deutschen Gesundheitswesen bildet u.a. die sog. Telematikinfrastruktur (TI), die einen sicheren Kommu- nikationskanal zwischen Leistungserbringern, Kostenträgern und Versicherten ermöglichen soll. Da die umfassende Einführung der TI noch einige Hürden überwinden muss, werden auch solche telematischen Anwendungen mit Gesundheitsbezug unter Gesundheitstelematik gelistet, die (noch) keine Anbindung an die TI realisieren und auf eigene Kommunikationswege bauen (siehe Infobox auf S. 29). Telemedizin ist eigentlich ein Sammelbegriff für verschiedenartige ärztliche Versorgungskonzepte, die als einzige Gemeinsamkeit die Erbringung (kern-) medizinischer Leistungen in Diagnostik, 17
PERSPEK TIVEN FÜR DIE TELEMEDIZIN Therapie und Rehabilitation über räumliche Entfernung unter Einsatz von Informations- und Kommunikationstechnologie haben (vgl. Bundesärztekammer 2015). Sie beschreibt kein eigen- ständiges Fachgebiet, sondern kann vielmehr als die Integration bzw. Anwendung der Gesund- heitstelematik in Gebiete der Medizin begriffen werden, wobei je nach Eigenart der Disziplin un- terschiedliche Anwendungsfälle entstehen (vgl. Gigerenzer et al. 2016). Die Bundesärztekammer sieht die Telemedizin als integralen Bestandteil nahezu jedes medizinischen Fachgebiets und betrachtet sie im Allgemeinen komplementär zur Präsenzversorgung (vgl. Bundesärztekammer 2015). Wir werden daher im weiteren Verlauf dieser Studie von telemedizinischen Anwendungen (TMA) sprechen. doc2pat doc2doc doc2pop Abbildung 3: Kommunikationsformen in der Telemedizin Im Fokus der Kommunikation stehen dabei Leistungserbringer – also sämtliche medizinische Personengruppen wie Vertragsärzte, Krankenhäuser, Apotheken, Fahrdienste, etc., die eine medizinische Leistung erbringen – und Patient:innen als Leistungsempfänger. Unter TMA werden üblicherweise sowohl solche verstanden, die den Austausch zwischen Leistungserbringern (doc- 2doc) ermöglichen, als auch solche, bei denen eine medizinisch-therapeutische Kommunikation zwischen Ärzt:innen und Patient:innen (doc2patient) stattfindet (vgl. Abbildung 3). Diese Einteilung erweitern wir um den Begriff doc2pop, also die Kommunikation eines Leistungserbringers mit einer Vielzahl von Patient:innen (Patient:innenpopulation). Dieser Aspekt ist für die organisatori- sche und technische Umsetzung von TMA besonders relevant, wie wir im weiteren Verlauf der Studie aufzeigen werden. 18
eHE ALTH, DIGITALE GESUNDHEIT UND TELEMEDIZIN: BEGRIFFSDEFINITIONEN UND ABGRENZUNGEN Damit lassen sich die unterschiedlichen Anwendungsarten von Ursprünglich wurde der Begriff für die Strahlentherapie TMA in die folgenden Kategorien einteilen: eingesetzt und beschreibt dort eine spezielle Form der Radiotherapie. Im Laufe der Zeit und mit zunehmender Be- Telekonsilium: Die Nutzung von IKT bietet hier die Mög- deutung der Gesundheitstelematik wurde aus den Wörtern lichkeit eine räumlich getrennte Beratung zweier oder meh- Telematik und Therapie der Begriff Teletherapie. Einzelan- rerer Leistungserbringer über die Diagnose oder Therapie wendungen bestehen u.a. in der Chirurgie (Telechirurgie), eines individuellen Patienten durchzuführen (doc2doc). Logopädie, Psychologie/Psychotherapie, Physiotherapie Den Anfang nahm dieses Anwendungsfeld bereits in den und Rehabilitation (Telereha). 90er Jahren des letzten Jahrhunderts mit der sog. Tele- radiologie, also der radiologischen Fern-Befundung durch Grundlage für die Umsetzung einer TMA ist eine mehr oder Fachärzte aus der Distanz mittels IKT. weniger umfassend strukturierte Infrastruktur, die alle Beteilig- ten im Gesundheitswesen wie Ärzte, Zahnärzte, Psychothera- Telekonsultation: Hierunter wird weitestgehend die doc- peuten, Krankenhäuser, Apotheken, Krankenkassen miteinander 2patient-Kommunikation zwischen Arzt bzw. Ärtz:in und vernetzt und eine digitale Kommunikation und einen Gesund- Patient:in verstanden. Die aktuellste Ausprägung ist die heitsbezogenen Datenaustausch ermöglicht (vgl. Nolting et al. Video-Sprechstunde. Durch die Änderung der ärztlichen 2017). Diese Infrastruktur vernetzt üblicherweise eine Applika- (Muster-)Berufsordnung (MBO-Ä) ist prinzipiell auch eine tion bei den Leistungsempfängern mit der Gesundheits-IT der ausschließliche Behandlung über Kommunikationsmedien Leistungserbringer, die die telemedizinische Leistung erbringen. im Einzelfall erlaubt, wenn dies ärztlich vertretbar ist und Optional kommen bei manchen telemedizinischen Anwendun- die erforderliche ärztliche Sorgfalt gewahrt und zudem der gen auch spezielle Medizintechnikgeräte oder Sensorik und Patient entsprechend aufgeklärt wird (vgl. Kassenärztliche Aktuatorik zum Einsatz, die ebenfalls innerhalb der Infrastruktur Bundesvereinigung et al. 2016b). Der Bereich der Telekon- vernetzt sind. sultation umfasst in dieser Studie auch das Teilgebiet der Telediagnostik, bei der die IKT-Kommunikation zwischen In Anlehnung an die Definition des Spitzenverbands der gesetz- Leistungserbringer und Patient:in auch zur Diagnoseerstel- lichen Kranken- und Pflegekassen (GKV-SV), beziehen sich die lung genutzt wird. hier betrachteten TMA ausschließlich auf konkret patienten- bezogene Versorgungsinhalte (vgl. GKV-Spitzenverband 2016). Telemonitoring: Hierunter fallen Einzelanwendungen zur Nicht betrachtet werden Anwendungen, die ausschließlich den IKT-gestützten Messung, Überwachung und Kontrolle nicht‐professionellen Kontext für die individuelle gesundheits- von patientenindividuellen Vitalfunktionen über räumliche bezogene Nutzung fokussieren. Hierzu zählen beispielsweise Distanzen hinweg. Das Telemonitoring (engl. Remote auch digitale Anwendungen aus dem mHealth‐Markt, welche Patient Monitoring, RPM) kann dabei sowohl im häus- keinerlei (kern-) medizinische Leistungen von ärztlichen oder lichen als auch im klinischen Setting (z.B. Intensivstation) psychologischen Fachkräften umsetzen oder integrieren. Im geschehen. Zudem kommen heutzutage vermehrt mobile Rahmen des E-Health-Gesetzes und des Digitale-Versorgung- Endgeräte (z.B. Sensorik) zum Einsatz, was den Bezug Gesetzes (DVG) besteht eine, mitunter auch fließende Trennung zu mHealth wiederum verdeutlicht. Da es hier vor allem von DiGA und TMA. Während TMA die Erbringung einer (kern-) darum geht, eine ganze Patientenpopulation zu betreuen, medizinischen Leistung zum Inhalt haben und deshalb ein findet beim Telemonitoring eine doc2pop-Kommunikation ähnliches Erstattungsmuster verfolgen, fallen DiGA unter Heil- statt. Die Datenzusammenführung findet in der Regel in und Hilfsmittel, die per Rezept verordnet und dadurch anders einem Telemedizinzentrum (TMZ) statt, an das sämtliche erstattet werden. Aus gleichem Grund werden auch keine Patientendaten aus dem häuslichen oder klinischen Um- Anwendungen aus dem Bereich des Ambient Assisted Living feld gesandt werden. (AAL) betrachtet, die pflegerische Aspekte fokussieren, da auch hier keine (kern-) medizinische Leistung im Fokus steht. Gleich- Teletherapie: Hierunter wird die Erbringung der medizini- wohl existieren aber auch vielfältige Überschneidungen und die schen bzw. physiotherapeutischen oder psychologischen Übergänge, vor allem zwischen DiGA und TMA, sind fließend Therapieleistung mittels Unterstützung von IKT verstanden. (vgl. Infobox auf S. 36). 19
03 21
PERSPEK TIVEN FÜR DIE TELEMEDIZIN 3 DER STATUS QUO Es gibt bereits eine größere Anzahl an Telemedizin-Projekten in 3.1 Die Perspektive der Versorgung Deutschland, die meisten allerdings noch im Prototyp-Stadium. Die Vielzahl der Förderer und der beteiligten Akteure macht Telemedizinische Anwendungen erbringen ihren Nutzen, indem eine Übersicht allerdings schwierig. Eine vergleichsweise um- die Ortsabhängigkeit gesundheitlicher Versorgungsleistungen fassende Sammlung findet sich im vesta Informationsportal2. reduziert wird. Dadurch wird eine gezieltere Versorgung ange- Anfangs von Fraunhofer FOKUS im Zuge der eHealth-Initiative strebt, die zum richtigen Zeitpunkt die nötige Gesundheitsversor- des Bundesministeriums für Gesundheit erstellt, war der initiale gung durch den richtigen Leistungserbringer ermöglicht. Dieses Gedanke die Etablierung einer Plattform, um bereits entwickelte Ziel wird erreicht, indem durch TMA Versorgungslösungen bekannt zu machen und einen Transfer hinzu anderen Indikationen oder Regionen zu unterstützen der Zugang zu Versorgungsleistungen niederschwellig (vgl. Nolting et al. 2017). Zudem müssen alle telemedizinischen und mobil gestaltet wird, Projekte, die aus Mitteln der gesetzlichen Krankenversicherung die Kompetenz zum Selbstmanagement bei Patienten (GKV) finanziert werden, eine Aufnahme in dieses Informa- gestärkt wird, tionsportal beantragen (vgl. Schnee 2019). Derzeit werden Therapiemaßnahmen frühzeitig eingeleitet, 127 telemedizinische Projekte gelistet (Stand: August 2020). Kompetenzen gebündelt und Kooperationen gestärkt, Die Aktualität des Portals lässt sich jedoch nur schwer ein- Versorgungsprozesse teilautomatisiert, sowie schätzen (vgl. Lehmann et al. 2018). Zudem hat es bislang nur technologische und Prozessinnovationen eingeführt ein geringer Anteil der bereits beendeten Projekte in die Regel- werden. versorgung geschafft. Das liegt zum Teil wohl auch an einer fehlenden wissenschaftlichen Evaluation (vgl. Schnee 2019). Im Ergebnis soll auch ein effektiverer Einsatz medizinischer Dieser Aspekt soll von den derzeit im Innovationsfonds unter Ressourcen (Personal, Geräte, Räumlichkeiten usw.) Zielgrößen Regie des Innovationsausschusses des Gemeinsamen Bundes- der medizinischen Versorgung beeinflussen. Das sind einer- ausschusses (G-BA)11 geförderten Projekten eine zentrale Rolle seits objektiv messbare Größen des Gesundheitssystems, wie spielen. Der Anteil an Telemedizin-Projekten im Innovationsfonds die Behandlungskosten je Patient:in (z. B. für Krankenhausauf- beträgt derzeit ungefähr 10 %, Tendenz steigend. enthalte), die Mortalität oder die Wartezeit auf Behandlungen. Andererseits sind das aber auch subjektive Zielgrößen bei Ein Überblick zu den aktuellen Entwicklungen bei telemedizini- Patient:innen, wie die Steigerung der Patientenzufriedenheit, schen Anwendungen lässt sich am besten aus den drei Blick- z. B. durch eine Stärkung des Betreuungsverhältnisses und des winkeln der Versorgung, Technik und Ökonomie geben. Eine Sicherheitsgefühls von Patienten, aber auch andere Zielgrößen zentrale Rolle nimmt dabei die Perspektive der Gesundheitsver- der gesundheitsbezogenen Lebensqualität. sorgung ein, um den Nutzen von TMA aufzuzeigen. Durch die technische Sicht werden Aspekte ihrer Umsetzung aufgezeigt. Gerade in der Einführungsphase sollte eine TMA kontinuier- Die ökonomische Sicht berücksichtigt Geschäftsmodelle und lich an ihren Zielen gemessen und bei nicht erwünschten Vergütungswege. Abschließend fassen wir die Faktoren zusam- Effekten angepasst werden. Beispielsweise bestand anfangs men, die für die Skalierung der heutigen, meist prototypischen die Tendenz, vorhandene Netzwerke (primär in der Radiologie, Telemedizinanwendungen in die breite Regelversorgung wichtig Kardiologie, Neurologie), die ein Fachklinikum mit kleineren sind. Eine Übersicht zu aktuellen Telemedizinprojekten findet Krankenhäusern vernetzen, zu stärken, statt weitere Gesund- sich im Anhang. heitsdienstleister, wie Hausärzte – besonders in ländlichen Regionen – einzubeziehen und dadurch eine flächendeckende Gesundheitsversorgung durch Telemedizin zu ermöglichen (vgl. Schnee 2019). Diesem Aspekt wird nun vor allem durch 11 Der G-BA ist das Spitzenorgan der Selbstverwaltung im deutschen Gesundheitssystem. Vertreten sind Ärzt:innen, Zahnärzt:innen, Krankenhäuser und Krankenkassen über ihre Bundesverbände sowie ohne Stimmrecht Patient:innenvertreter. 22
DER STATUS QUO entsprechende Projekte, deren Zielsetzung eine möglichst behandelt. Dieses erfolgreiche Konzept wird nun als Virtuelles breite Vernetzung von Akteuren (z.B. im Bereich der Telekon- Krankenhaus15 weitergeführt und in die breite Anwendung silien, vgl. TELnet@NRW12) ist, entgegengewirkt. Ein weiterer gebracht. Eine Steigerung der flächendeckenden Versorgung nicht erwarteter und nachteiliger Effekt kann eine Steigerung mittels Telemedizin kann auch im notärztlichen Bereich be- des Versorgungsaufwands aufgrund des niederschwelligen obachtet werden. In einigen Bundesländern gibt es bereits eine Zugangs sein. In dieser Hinsicht könnten Leistungen von Pa- etablierte telenotärztliche Versorgung (vgl. Die Landesregierung tient:innen oder Leistungserbringern im Zuge von Telekonsilien Nordrhein-Westfalen 2020). Neben der Reduktion der therapie- häufiger abgerufen werden. Dementsprechend können durch freien Zeit durch eine schnellere notärztliche Versorgung wird eine häufigere Registrierung von Indikationen Behandlungen durch die strukturierte telemedizinische Anleitung eine leitlinien- ausgelöst werden, die möglicherweise keine Intervention be- treue notärztliche Versorgung gewährleistet. TMA erbringen nötigen, beispielsweise beim Telemonitoring von Patient:innen ihren Nutzen auch in der Nachsorge, indem sie, beispielsweise mit Herzerkrankungen (vgl. GKV-Spitzenverband 2016). im Projekt NTx360°16, durch eine fallbasierte Versorgung durch niedergelassene Ärzt:innen und Nachsorgezentren die Chancen Auch wenn TMA den genannten Nutzen über die gesamte des Transplantatüberlebens erhöhen und Begleiterscheinungen, Versorgungskette des Gesundheitssystems erbringen können, wie kardiovaskuläre und immunologische Risiken, reduzieren besteht die 2016 erkannte Dominanz des Telemonitorings (vgl. Pape et al. 2017). Durch die telemedizinische Anwendung und der Telekonsilien (vgl. GKV-Spitzenverband 2016), auch von Standard Operation Procedures (SOP) können durch die weiterhin (Schnee, 2019). Dabei lassen sich 55 % der 2019 jeweiligen Expert:innen (Nephrologen, Psychosomatiker, Sport- im vesta Informationsportal2 gelisteten TMA der Diagnostik mediziner, Fallmanager) regelmäßige Einschätzungen von zuordnen und 48 % der Therapie (Schnee, 2019). Auch bei den Risiken getroffen und App-unterstützte Therapiemaßnahmen Indikationen besteht eine klare Tendenz: 38 % der behandelten eingeleitet werden. Ein generell prominentes Anwendungsge- Krankheiten betreffen das Kreislaufsystem (v.a. Herzinsuffizienz biet von TMA ist die Begleitung von Patienten mit chronischen und Schlaganfall) und 17 % den stärker werdenden Bereich der Erkrankungen, u. a. um ihre Krankenhausaufenthalte zu redu- psychischen Erkrankungen (Schnee, 2019). zieren und Therapieanpassungen möglichst früh durchzuführen. Beispielsweise setzen einige telemedizinische Versorgungs- Konkrete Beispiele von TMA können entlang der Versorgungs- programme von Herzkrankheiten Methoden des Telemonito- kette beschrieben werden. Der prominenteste Bereich ist die rings (z.B. Telemed50001) und des Selbstmanagements ein. seit 2017 innerhalb der gesetzlichen Krankenversicherung Diese werden teilweise von einzelnen Krankenkassen vergütet vergütete Videosprechstunde niedergelassener Ärzt:innen. (z.B. HerzConnect17). Andere TMA, wie AppDoc13, bieten eine telemedizinische Ersteinschätzung von dermatologischen Indikationen per Eine zentrale Herausforderung von TMA liegt häufig in deren Smartphone-App ohne vorherigen Arztbesuch an, wodurch Evaluation. In einer Rahmenvereinbarung zur Überprüfung des eine schnellere Erstdiagnose (i.d.R. innerhalb von 24 Stunden) Einheitlichen Bewertungsmaßstabes gemäß § 87 Abs. 2a Satz ermöglicht wird. Neben etlichen Beispielen telekonsiliarisch 8 SGB V zum Umfang der Erbringung ambulanter Leistungen verbundener Kliniken, z.B. zur Abklärung möglicher Schlagan- durch Telemedizin (vgl. Kassenärztliche Bundesvereinigung fallpatient:innen im Projekt TEMPiS14, zeigen andere Projekte et al. 2013) betonen die Kassenärztliche Bundesvereinigung den Nutzen einer konsiliarischen Anbindung von Hausärzten: (KBV) und der GKV-SV, dass im Vergleich zur herkömmlichen Im Projekt TELnet@NRW12 werden durch Telekonsilie zwischen Versorgung ohne Telemedizin, die Versorgung mit Telemedizin, Unikliniken, Krankenhäusern und niedergelassenen Ärztinnen einen Vorteil ergeben oder mindestens gleichwertig sein muss. und Ärzten im Bereich der Infektiologie und Intensivmedizin u. a. Blutvergiftungen frühzeitig erkannt und leitliniengerecht 12 TELnet@NRW, ein intersektorales digitales Gesundheitsnetzwerk - https://www.telnet.nrw/ [15.11.2020] 13 AppDoc, der Online Hautarzt - https://online-hautarzt.net [13.10.2020] 14 TEMPiS, Telemedizinisches Schlaganfallnetzwerk Südostbayern - https://tempis.de/ [13.10.2020] 15 Virtuelles Krankenhaus NRW - https://virtuelles-krankenhaus.nrw/ [15.11.2020] 16 NTx360°, Innovationsprojekt zur Weiterentwicklung der Versorgung nach Nierentransplantation - https://ntx360grad.de [13.10.2020] 17 HerzConnect, Telemedizinische Versorgungbei Herzschwäche in Nordrhein-Westfalen und Niedersachsen - https://www.dak.de/dak/kontakt/herzconnect-telemedizinische-versorgung-bei-herzschwaeche-in-nordrhein-westfalen-und-niedersachsen-2227216.html#/ [14.11.2020] 23
PERSPEK TIVEN FÜR DIE TELEMEDIZIN Dieser Aspekt kann der Nutzen von TMA häufig gesondert und belastbar belegt werden muss, sofern es sich nicht um weniger komplexe TMA, im Sinne patientenrelevanter Endpunkte wie Morbidität, wie z.B. die Videosprechstunde, handelt. Hier gibt es deutliche Mortalität, sowie Lebensqualität und/oder Unterschiede zwischen den unterschiedlichen Ausprägungen einer verbesserten Wirtschaftlichkeit bei Betrachtung der von TMA aber auch in ihren Anwendungsfeldern zu verzeichnen. Kosten, die bei einer Versorgung mit bzw. ohne Telemedizin So gibt es gerade im Bereich der Herzerkrankungen belastbare entstehen, Studien zum Nutzen von Telemonitoring. In zahlreichen Studien konnte eine deutliche Reduktion der Krankenhausaufenthalte nachgewiesen werden. Welche Studienform gefordert ist, ergibt bei telemedizinisch betreuten Patient:innen mit Herzinsuffizienz sich aus folgender Kategorisierung (vgl. GKV-Spitzenverband (vgl. Köhler et al. 2018) sowie eine Reduktion der Gesamtsterb- 2016; Beckers et al. 2015): lichkeit (vgl. Yun et al. 2018) nachgewiesen werden. In anderen Anwendungsbereichen ist die Studienlage nicht so eindeutig. (I) TMA zur Optimierung von Kommunikations- und Ver- Den hohen Anforderungen können die mangelnden Angaben zur sorgungsprozessen, die etablierte und bereits evidenzba- Evaluierung in Telemedizinprojekten gegenübergestellt werden sierte medizinisch‐therapeutische Prozesse unterstützen, (vgl. Lehmann et al. 2018). Die Zwischenevaluation des Innova- erfordern „nur“ einen Nachweis der Wirtschaftlichkeit (ggf. tionsfonds weist zudem darauf hin, dass ein erhöhter Hand- sind zusätzlich noch Machbarkeits‐ und Akzeptanzstudien lungsbedarf besteht, den Transfer möglichst vieler Projekt- vorzulegen). ergebnisse in die Regelversorgung sicherzustellen (vgl. Astor et al. 2019). Allerdings besteht die noch größere Herausforderung (II) TMA, bei denen bestehende medizinischen Leistungen darin, tragfähige Versorgungskonzepte zu entwickeln, was mittels IKT erbracht werden sollen und die dadurch etab- nicht in jedem Fall auf Basis der erzielten Evaluationsergebnisse lierte medizinisch‐therapeutische Prozesse erweitern oder möglich ist. graduell auf Basis eines evidenzbasierten medizinischen Modells verändern, erfordern dagegen zusätzlich einen Qualitätssicherung und -entwicklung sind zentrale Säulen der Nachweis der medizinischen Wirksamkeit. Patientenversorgung und sind auch von TMA-Anbietern bzw. -Herstellern sicherzustellen (vgl. Szecsenyi et al. 2018). Für (III) TMA, die neue Untersuchungs- und Behandlungsfor- eine einheitliche Betrachtung der Qualität von TMA wird der- men (NUB) darstellen, da sie maßgebliche Änderungen an zeit der internationale Standard ISO/DIS 1313118 von Experten der bisherigen diagnostischen und therapeutischen Vorge- ausgearbeitet. Dieser enthält Empfehlungen zur Entwicklung hensweise beinhalten, benötigen zusätzlich den Nachweis von Qualitätszielen und Leitlinien für Telehealth Services unter einer positiven Beeinflussung patientenrelevanter Endpunkte Verwendung eines Risikomanagementprozesses und soll auch über randomisierte klinische Studien. dazu dienen die Evaluationslage speziell für TMA zu verbes- sern. Der Standard legt dabei besonderes Augenmerk auf das Während Telekonsultation und Telekonsilium vorwiegend in Management von Qualitätsprozessen durch Gesundheitsorga- Kategorie (I) und (II) fallen – je nachdem auf welcher Basis und nisationen, das Management der finanziellen Ressourcen zur in welchem Umfang diese Kommunikation stattfindet – ist vor Unterstützung von Telehealth Services, die Prozesse in Bezug allem bei Telemonitoring-Verfahren genau zu prüfen, ob diese auf Ressourcenplanung und Festlegen von Verantwortlich- neue Untersuchungs- und Behandlungsformen darstellen und keiten, die Bereitstellung benötigter Infrastruktur und Ausstat- somit gemäß Kategorie (III) randomisierte klinische Studien tungsressourcen sowie die Verfügbarkeit und das Management erfordern. Die Kategorisierung macht jedenfalls deutlich, dass ausreichender (Informations-)technologischer Ressourcen. 18 International Organization for Standardization - https://www.iso.org/standard/75962.html [23.9.2020] 24
DER STATUS QUO 3.2 Die technische Perspektive heben ist hier die nach Datenschutzgrundverordnung geltende Bestimmung, dass die Verarbeitung von Daten auch im Auftrag 3.2.1 IKT-TOOLS ZUR DATENERFASSUNG UND nur im Inland, in einem Mitgliedsstaat der Europäischen Union -ÜBERTRAGUNG oder in einem diesem nach § 35 Absatz 7 des Ersten Buches Der Einsatz von TMA ist auf eine ortsunabhängige Verfüg- Sozialgesetzbuch gleichgestellten Staat, oder, sofern ein Ange- barkeit von digitalen Daten angewiesen. Um das zu erreichen, messenheitsbeschluss gemäß Artikel 45 der Verordnung (EU) werden unterschiedliche Informations- und Kommunikations- 2016/679 vorliegt, in einem Drittstaat erfolgen darf. technologien eingesetzt. Software zur Übertragung von Bild und Tondaten (zur Videotelefonie, Videokonferenzen) sind dabei Abhängig von den spezifischen medizinischen Leistungen, die besonders prominent und kommen verstärkt in den TMA-Aus- über eine TMA erbracht werden sollen, kommen, oft auch zu- prägungen Telekonsultation und Telekonsilium zum Einsatz. sätzlich zur Videotelefonie, spezifische Software und Geräte für In der Regel ist dies eigens für telemedizinische Bedingungen die Datenerfassung zum Einsatz. Das ist insbesondere bei Tele- entwickelte Software, wie bspw. doccura19 oder jameda20, die die monitoring-Anwendungen der Fall. Hierzu werden Daten aktiv von Nutzenden eingegeben oder passiv von speziellen Geräten — erfasst. Die eingesetzten Geräte reichen von bereits etablierter NEBEN DER VIDEOTELEFONIE Medizintechnik und Smartphones, bis zu neuartigen Wearables wie beispielsweise einem in-ear Sensor (z.B. cosinuss° Two21). WERDEN SPEZIFISCHE SOFT- Beispielsweise kommen beim Telemonitoring von kardiologi- schen Risikopatienten auch mobile EKG-Rekorder zum Einsatz & HARDWARE FÜR DIE DATEN- (z.B. in den Projekten HerzConnect17 und Telemed50001). Auch in der pädiatrischen Onkologie werden die Vitaldaten durch eine ERFASSUNG EINGESETZT. Vielzahl an unterschiedlichen medizinischen Geräten aufgenom- men (z.B. KULT-SH22). Immer stärker in den Vordergrund treten — auch Acceloremeter zur Bewegungserfassung, die in gängigen Smartphones und Wearables standardmäßig integriert sind, KBV-Anforderungen an die Videosprechstunde (vgl. Kassenärzt- und Aufschluss über die Bewegungstätigkeiten der Patient:innen liche Bundesvereinigung et al. 2016b) erfüllen. Diese betreffen liefern können (z.B. in den Projekten Telemed50001 und Active vor allem Datenschutz und IT-Sicherheit, legen aber auch Ver- Body Control23). Die Tonaufnahmefunktion gängiger Smartphones haltensregeln für Teilnehmer, Ärzte und Anbieter fest. Zur Ge- bietet die sehr effektive und effiziente Möglichkeit, mithilfe von währleistung der Datensicherheit, der Informationssicherheit Sprach- und Stimmanalysen Erkrankungen z. B. aufgrund von Ver- und eines störungsfreien Ablaufes hat die Videosprechstunde änderungen des Sprach- bzw. Stimmverhaltens zu erkennen und in geschlossenen Räumen stattzufinden, die eine angemesse- damit deren Diagnose sowie mögliche relevante therapeutische ne Privatsphäre sicherstellen, wobei Aufzeichnungen jeglicher Maßnahmen zu unterstützen (z.B. Telemed50001 und i-PROGNO- Art während der Videosprechstunde nicht gestattet sind. Die SIS24). Auch der Kinect-Sensor, der eigentlich von Microsoft für den Übertragung der Videosprechstunde soll dabei nach den KBV- Gaming-Bereich entwickelt wurde, findet Einzug in die sogenannte Richtlinien (vgl. Kassenärztliche Bundesvereinigung et al. 2016b) Telereha, einer Unterkategorie der Teletherapie in der Physio- über eine Ende-zu-Ende verschlüsselte Peer-to-Peer-Verbindung therapie und Rehabilitation. Mit der integrierten Kombination aus zwischen den Computern der Gesprächsteilnehmer, ohne Nut- Bildkamera und Tiefenmesssensorik können die Bewegungen der zung eines zentralen Servers, erfolgen. Ein zentraler Server darf Patient:innen während der Rehabilitationsübungen aufgezeichnet lediglich zur Gesprächsvermittlung genutzt werden. Hervorzu- und überwacht werden (z.B. MeineReha25). 19 doccura, Online-Videosprechstunde - https://www.doccura.de/ [14.11.2020] 20 jameda, Software für digitalen patientenkontakt - https://www.jameda.de/fuer-aerzte/ [13.1.2021] 21 cosinuss°, Sensortechnologie zur mobilen Vitalparameter-Messung im Ohr - https://www.cosinuss.com/de/ [25.11.2020] 22 KULT-SH, medizinische Versorgung von Kindern und Jugendlichen mit Krebserkrankungen - https://www.uksh.de/paediatrie-kiel/kultsh.html [10.9.2020] 23 ABC-Programm (Active Body Control), ein innovatives, telemedizinisches und sehr wirksames Programm zur Reduktion von Übergewicht - http://www.abcprogramm.de/ [10.9.2020] 24 i-PROGNOSIS, intelligente, frühzeitige Detektion von Parkinson durch innovative telemedizinische Anwendungen - http://www.i-prognosis.eu/ [14.11.2020] 25 MeineReha®, Teleassistenzsystem für die Rehabilitation - https://www.meinereha.de/ [14.11.2020] 25
Sie können auch lesen