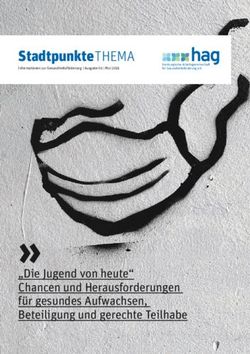Pflegepolitik gesellschaftspolitisch radikal neu denken - Gestaltfragen einer Reform des SGB XI Grundlagen, Kontexte, Eckpunkte, Dimensionen und ...
←
→
Transkription von Seiteninhalten
Wenn Ihr Browser die Seite nicht korrekt rendert, bitte, lesen Sie den Inhalt der Seite unten
Frank Schulz-Nieswandt
Pflegepolitik
gesellschaftspolitisch
radikal neu denken
Gestaltfragen einer Reform des SGB XI
Grundlagen, Kontexte, Eckpunkte, Dimensionen und AspekteFrank Schulz-Nieswandt Pflegepolitik gesellschaftspolitisch radikal neu denken Gestaltfragen einer Reform des SGB XI Grundlagen, Kontexte, Eckpunkte, Dimensionen und Aspekte
Zum Verfasser Univ.-Prof. Dr. Frank Schulz-Nieswandt, *1958, Erster Prodekan der Wirtschafts- und Sozialwissenschaftlichen Fakultät der Universität zu Köln, lehrt dort im Institut für Soziologie und Sozialpsychologie So- zialpolitik, Methoden der qualitativen Sozialforschung und ist ferner Direktor des Seminars für Genossenschaften. Er lehrt als Honorarpro- fessor für Sozialökonomie der Pflege in der Pflegewissenschaftlichen Fakultät der Philosophisch-Theologischen Hochschule Vallendar. Der- zeit ist er u. a. Vorsitzender des Vorstands des Kuratorium Deutsche Al- tershilfe (KDA) e. V. in Berlin sowie Ehrenvorsitzender der Gesellschaft für Sozialen Fortschritt e. V. Impressum Herausgeber Kuratorium Deutsche Altershilfe Wilhelmine-Lübke-Stiftung e. V. (KDA) Michaelkirchstraße 17-18 10179 Berlin www.kda.de info@kda.de Autor Prof. Dr. Frank Schulz-Nieswandt ©Frank Schulz-Nieswandt, alle Rechte vorbehalten. Abdruck, Vervielfältigung und Veröffentlichung – auch auszugsweise – nur mit ausdrücklicher Genehmigung des Autors Berlin, Januar 2020 Gesamtgestaltung: H. J. Wiehr, Mainz Fotos: © H. J. Wiehr, Mainz
Inhalt Seite Vorwort 4 Einleitung: Reformen radikal denken 6 Exkurs: Zum Entstehungshintergrund und zum redaktionspolitischen Charakter des vorliegenden Textes 6 I. Grundsätzliche Vorfragen 10 1. Pflegepolitik, Sozialpolitik, Gesellschaftspolitik 10 1.1 Privater Reichtum bei öffentlicher Armut: Was ist Wohlfahrt? 11 1.2 Was ist wann eine Reform? Überlegungen zur Gestaltauffassung 13 1.3 Zur Logik einer Reform 13 1.4 Zur Grammatik einer Reform 13 2. Der einbettende Boden des Rechts 14 II. Reform entlang eines Systems konzentrischer Kreise 14 3. Die kleine Welt: die Mikroebene 15 4. Die mittlere Welt: die Mesoebene 16 5. Die große Welt: die Makroebene 18 5.1 Ordnungspolitisches Umdenken: Grundüberlegungen 18 5.2 Optimale Regulierung angesichts von Marktversagen 18 5.3 Unternehmenstypenvielfalt als Element der Wirtschafts- und Sozialordnung 18 5.4 Befreiung vom obligatorischen Kontrahierungszwang im SGB XI 19 5.5 Fachkräftemangel als Investitionshemmnis? 19 5.6 De-Institutionalisierung (Sozialraumöffnung) und Hybridbildung durch „Stambulantisierung“ als Fachkräfteanreiz! 20 6. Systemfinanzierung: exogene oder endogene Variable der Reformidee? 21 III. Fundamentalkonstitutive Frage der Reformdebatte: Was verstehen wir unter Subsidiarität? 22 7. Vom Menschenbild zum „Geist der Gesetze“ 23 7.1 Ideen und Interessen 23 7.2 Das Menschenbild unserer Rechtsregime 23 7.3 Trans-kapitalistische Sektorgestaltung 24 8. Daseinsvorsorge und Wohlfahrtpluralismus 25 9. Familialismus und Pflegegeld 25 IV. Fazit: Dimensionen als Eckpunkte einer echten Sozialreform 27 V. Validierender Ausblick auf die Schweiz 28 VI. Die moralökonomische Verfasstheit Deutschlands 2040? 29 VII. Träumen und Politik 32 Literaturverzeichnis 34
Vorwort „Wehe, Du bist alt und wirst krank. Missstände in
der Altersmedizin und was wir dagegen tun können“
(Schmid, 2017). Wir brauchen eine andere Medizinkul-
tur. Gleiche Herausforderungen bestehen mit Blick
auf die Pflege alter Menschen. Wir brauchen eine an-
dere pflegepolitische Kultur. Ja, wir können etwas tun:
Wir benötigen radikale Reformen als Umbau unserer
Wohnlandschaften und der daran geknüpften Care-
Landschaften. Wir haben es immer noch nicht ver-
standen, dass wir mit der Dynamik der Hochaltrigkeit
mit einer zivilisationsgeschichtlich ganz neuen Her-
ausforderung konfrontiert werden. Da die Welt keine
Free Lunch-Veranstaltung ist, müssen wir auch über
Geld reden. Aber wir müssen zunächst und vor allem
auch darüber reden, für was wir (mehr) Geld ausgeben
wollen. Für welche Haltung der Professionen? Für wel-
che Organisationsphilosophie von Einrichtungen? Für
welche Systemlogik (Schulz-Nieswandt, 2019d)?
Die Probleme werden sich nicht mehr im Rahmen des
Weltbildes von Sozialingenieuren, von Changemana-
gern, von ministerialbürokratischen Handwerkern,
von ökonomischen Behavioristen, von Politik ohne
Phantasie und Mut verstehen und sodann bewältigen
lassen.
Schon den Studierenden des ersten Semesters brin-
gen wir an der Universität bei: Man müsse zunächst
die richtigen Fragen stellen. Damit beginnt der Er-
kenntnisprozess. Die Findung der richtigen Antworten
ist damit zwar nicht gesichert, weil es sich um einen
Suchprozess handelt, um eine Reise, auf der man sich
verlaufen oder gar – wie einst Odysseus – verirren
kann. Man wird aber nie die richtigen Antwortpfade
finden können, wenn die Fragen bereits falsch, zum
Beispiel verkürzt, gestellt werden.
Das KDA hat neben seinen Aufgaben im Kontext inno-
vativer Projekte Satzungszwecke zu erfüllen, die nicht
an Marktinteressen und an politische Parteiorientie-
rungen gebunden sind.
4Das KDA ist Werte-orientiert einer Rechtsphilosophie
eines Menschenbildes verpflichtet, die die Persona-
lität des Menschen in den Mittelpunkt aller Betrach-
tungen und Erwägungen zu stellen hat. Die Würde der
menschlichen Person ist unantastbar und der trans-
zendentale Fluchtpunkt aller Positionierungen.
Inklusion ist als Bezugspunkt der Vermessung sozialer
Wirklichkeit nicht beschränkt auf die Lebenssituation
von Menschen mit Behinderungen. Zu fragen ist nach
der sozialen Ausgrenzung von Menschen in verschie-
densten Lebenslagen. Inklusion meint Überwindung
von Exklusion. Ein Leben in Inklusion meint das Aus-
schöpfen des Potenzials der Selbstbestimmung in
möglichster Selbstständigkeit in Formen der Teilha-
be, also der Partizipation am Gemeinwesen des so-
zialen Miteinanders in einer Welt der Diversität, also
der Vielfalt der Geschlechter, der Altersgruppen, der
Kulturen, der Begabungen, der sozialen Herkunft, der
phänotypischen Merkmale. Die Ausschöpfung des Po-
tenzials meint dann aber auch die Anerkennung der
unausweichlichen Abhängigkeit, denn Autonomie ist
immer relativ, eingelassen in soziale Beziehungen (die
begrenzt [belastbar] oder gar fehlen können) in Kon-
texten (als Umwelten des Handelns) stehend. Absolu-
te Autonomie gehört nicht zur conditio humana.
Ungeachtet dieser sich aus der Seinsverfassung des
Menschen ergebenden Relativität gilt für Kritische
Wissenschaft, um an einen Satz von Theodor W. Ador-
no aus Minima Moralia (1952, dort Nr. 143) anzuknüp-
fen: Soziale Phantasie „ist die Magie, befreit von der
Lüge, Wahrheit zu sein.“
5Einleitung:
Reformen radikal denken
Das Kuratorium Deutsche Altershilfe Wilhelmine- plexe – Positionspapiere zur Kenntnis genommen
Lübke-Stiftung e. V. (KDA) beteiligt sich an der worden. Diesbezüglich gibt es daher auch mehr oder
Debatte zur grundlegenden Erneuerung der Pfle- weniger große Schnittmengen. Insbesondere sind die
geversicherung. Vorgestellt werden Ideen zu einer Vorschläge zu einer Finanzierungsreform bereits so
Reform der Pflegepolitik, die die Pflege gesell- weit vorangeschritten und in szenarischen Variatio-
schaftspolitisch in einen breiteren sozialpolitischen nen einzelner Bausteine durchgerechnet, dass diese
Kontext stellt und fundamentaler und radikaler Überlegungen im vorliegenden Papier vorausgesetzt
als sonst üblich diskutiert: als sozialraumbildende werden, ohne im Detail aufgegriffen zu werden. Der
Daseinsvorsorge (Schulz-Nieswandt, 2017a) infra- Stand dieses Diskurses wird hier nicht referiert. Wir
strukturbezogen (Richter, 2018) kommunal gesteu- gehen davon aus, dass das vorliegende Papier trotz
ert, auf lokale sorgende Gemeinschaften achtsamer der angedeuteten Schnittflächen einen eigenständi-
Nachbarschaften basierend, weniger marktgläubig, gen Beitrag zur Gestaltfrage einer Reform der Pflege-
nachhaltig solidarisch gerecht finanziert, weniger politik, nicht nur der Pflegeversicherung im engeren
risikoprivatisierend, in innovativer Differenzierung Sinne des SGB XI, in den Diskurs einbringen kann.
der Wohnformenlandschaft eingebettet (Schulz- Hierbei weiß man nie, ob man zu früh oder zu spät ist –
Nieswandt, 2020a). nach der Reform ist vor der Reform. Das KDA versteht
sich als ständiger kritischer Begleiter: Eine Sozialre-
form ist nie abgeschlossen, weil Reformen zum Wesen
Exkurs: Zum Entstehungshintergrund und der modernen Gesellschaft in ihrem beschleunigten
zum redaktionspolitischen Charakter des Wandelcharakter (Wirtschaft, Politik, Kultur und die
vorliegenden Textes Individuen umfassend) gehören. Pflegepolitik ist gera-
de in der Mitte dieses verflochtenen Wandels der Teil-
Der Text beruht auf einigen Arbeitssitzungen einer bereiche moderner Gesellschaft eingelassen. Es gibt
vom KDA organisierten Steuerungsgruppe und einer kaum etwas, was hier nicht von Bedeutung ist: Poli-
Fachkommission und hat zentrale Diskussionen die- tik und die Rechtssysteme, Zivilgesellschaft, Familie
ser Sitzungen aufgenommen. Der vorliegende Text und andere Formen sozialer Netze, Wohnen, Märkte,
selbst ist allein vom Verfasser (als Vorsitzender des neue Technologien, Berufswelten, Stadt, Gemeinde
Vorstands des KDA eben auch in der Funktion des Vor- und Land, Infrastrukturen, Migration, Normen, Werte,
sitzes der genannten zwei Gremien) erstellt1 und da- Geschlechterverhältnisse und Generationenbeziehun-
mit zu verantworten. Der vorliegende Text gibt aber gen, Klimawandel etc. etc.
keinesfalls “die“ KDA-Position wieder, da das Kura-
torium im engeren Sinne die Mitgliederversammlung Die übergreifende These ist: Wir benötigen ein Leitbild
des KDA e. V. ist und ein Konsensbildungsprozeß mit zur Pflegereformpolitik als Teil der trans-sektoral und
allen Kurator*innen kaum möglich und daher nicht somit integriert betrachteten Sozialpolitik im Rahmen
beabsichtigt ist. Im vorliegenden Text glaubt sich der der gestaltenden Gesellschaftspolitik, was nicht ohne
Verfasser dennoch in vollständiger Übereinstimmung Menschenbild, daraus abgeleiteter Werte-Orientie-
mit den Wertgrundlagen des KDA e. V., die auch den rung und Ideen zur künftigen Gesellschaftsordnung
allgemeinen Wertgrundlagen des Völkerrechts, des unserer Wirtschaft2 geht (Schulz-Nieswandt, 2020b).
Europäischen und bundesdeutschen Verfassungs- Es muss radikaler als bislang über die Pflegepolitik
rechts und des Systems der bundesdeutschen So- nachgedacht und diskutiert werden. Keine Finanzie-
zialgesetzbücher entsprechen, bis hin zur Eigenge- rungsreform ohne Reform der Strukturen, für die Geld
setzlichkeit der Bundesländer, etwa in Bezug auf das ausgegeben werden soll!
Menschenbild und auf die Werteorientierungen der
WTG (Schulz-Nieswandt, 2018c). Dabei muss es um die Förderung der Lebensqualität
der Menschen mit Pflegebedürftigkeit gehen, auch
Soweit zur Verfasserschaft des Textes. Dabei sind und gerade um die Belastungssituation der sozialen
natürlich verschiedene – mehr oder weniger kom- Netze dieser betroffenen Menschen. Die Finanzie-
6rung neu strukturierter Pflegeversorgungslandschaf- bilität, verstehen wir nicht als eine Kann-Perspektive,
ten muss sich an die Bildung integrierter Sozialräume sondern als ein Soll-Konzept angesichts der zwingen-
knüpfen, womit die Wohnarrangements, ihre Bar- den normativ-rechtlichen Vorgaben.
rierefreiheit bzw. -armut sowie die für die Teilhabe Die angesprochene Normativität kann nicht beliebig
konstitutiven Mobilitätschancen in das Zentrum der und willkürlich gesetzt werden, sondern muss anth-
Betrachtung rücken. Über die neuerdings diskutier- ropologisch fundiert aus der Rechtsphilosophie kom-
ten „stambulanten“ Formen der Pflege hinaus zeigen men. Letzter Fluchtpunkt aller Überlegungen muss
die ersten Überlegungen des KDA mit Blick auf das die Würde des Menschen in seiner Personalität sein.
Konstrukt Wohnen „6.0“, dass die Visionen in eine
Richtung weisen, die mit „ambulant vor stationär“ gar Das Projekt verweist uns auf den Inklusionsdiskurs
nicht mehr zu fassen sind. Es zeichnet sich der Bedarf (Schulz-Nieswandt, 2016a), der längst im Völkerrecht
ab, das Ordnungs-, Leistungs- und Vertragsrecht ra- und im europäischen Grundrechtsdenken der Unions-
dikal anzupassen. Die Sektorengrenzen lösen sich in bürgerschaft, aber, vor dem Hintergrund der bundes-
dieser Vision auf und die Strukturen verflüssigen sich. deutschen Verfassung des GG, auch in den hier rele-
Es handelt sich um den Typus des Cluster-Wohnens: vanten Sozialgesetzbüchern Eingang gefunden hat
Ein Wohngebäude oder eine Streuung von Wohn- und die eigengesetzlichen Aktivitäten der Bundeslän-
gebäuden verschiedener Art werden durch vielfälti- der prägt. Unter Inklusion ist (nicht auf die Problema-
ge, die Komplexität der An- und Herausforderungen tik der Behinderung i. e. S. reduzierbar) im Sinne der
optimierend, angepasste pflegerische und soziale Sozialraumorientierung die Ermöglichung der selbst-
Dienstleistungen professioneller und informeller Art bestimmten und selbstständigen Teilhabe am Ge-
im Hilfe-Mix (einschließlich digitaler technischer Un- meinwesen gemeint, definiert als die um das Wohnen
terstützungssysteme) als vernetzter Sozialraum im und um die Mobilität zentrierte lokale Lebenswelt im
Quartier (Kremer-Preiß & Mehnert, 2019) versorgt. Kontext regionaler Infrastrukturlandschaften.
Diese neuen Strukturen werden die Kooperation ge- Diese Infrastrukturidee (Richter, 2018; Foundational
teilter Verantwortlichkeiten in einem Netzwerk mit Economy Collective, 2019) muss existenziell begriffen
einer zentralen Kümmererfunktion benötigen. Diese werden. Die Kommune ist daher der Raum, auf den sich
Vision geht weit über Formen der Ambulantisierung die Sorgepolitik des Gewährleistungsstaates (Bund und
stationärer Einrichtungen oder auch über die sektor- Länder sowie die Sozialversicherungen und die dazu
übergreifenden Gesamtversorgungsverträge gemäß geförderte Zivilgesellschaft) im Sinne der Daseinsvor-
§ 72 (2) SGB XI hinaus. sorge (Kersten, Neu & Vogel, 2019) beziehen muss.
Es wird im „Cluster-Wohnen“ einerseits die Versor- Zwei Stufen der Themenausdehnung werden einge-
gungssicherheit gewährleistet, die auf die unter- bracht: Anvisiert wird keine Engführung der Pflege-
schiedlichen Bedarfe flexibel angepasst werden kann. reformdebatte auf Fragen der Systemfinanzierung.
Es wird andererseits ein hohes Ausmaß an Alltags- Es soll ferner eine ganzheitliche (kohärent vieldimen-
normalität und individueller Lebensgestaltung durch sionale) SGB XI-Reformdiskussion sein, die aber das
Stärkung der Selbstbestimmung im Rahmen der Teil- SGB XI grenzüberschreitend zu den Themenfeldern
habechancen ermöglicht. Die vom Hilfebedarf Be- im Umfeld einbettet.
troffenen und ihre Angehörigen und Partner bleiben
in die Umsetzungsverantwortung eingebunden, und Die SGB XI-Reformdiskussion muss hierbei aber nicht
insofern werden die Unterstützungsarrangements in nur eingebettet werden in die Verflechtung der ver-
geteilter Verantwortung sichergestellt. schiedenen Sozialgesetzbücher. Das BTHG als Inte-
gration des SGB IX mit den Eingliederungsleistungs-
Im Zentrum radikalen Denkens einer Pflegepolitikre- strukturen des SGB XII steht insofern in analoger
form steht ein Bekenntnis zur öffentlichen und, dabei Patenschaft, weil die Idee wohnortunabhängiger Fi-
inkludiert, zivilgesellschaftlichen Daseinsvorsorge nanzierung der Pflegeleistungen im SGB XI anvisiert
(Kersten, Neu & Vogel, 2019): Die integrierte Sicht- werden muss. Die Pflegeproblematik muss als Teil der
weise der Sozialraumentwicklung, zentriert um die umfassenden Sozialpolitikdiskussionen und diese wie-
Daseinsthemen von Wohnen, Infrastruktur und Mo- derum zugleich als ein integrierter Teil einer Gesell-
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
1 Die Verweise auf vertiefende Studien des Verfassers im Literaturverzeichnis dokumentieren die
Quellen dieses Denkens, das den Hintergrund auch des vorliegenden Textes fundiert.
2 Art. 20 GG i. V. m. Art. 3 (3) EUV im Lichte sozialer Gerechtigkeit (vgl. § 1 SGB I).
7schaftsgestaltungspolitikdebatte verstanden werden. gensverteilung, die mit darüber entscheiden, was sich
Exemplarisch ist die neuere Studie der Bertelsmann Menschen heute und in Zukunft an Pflegearrange-
Stiftung zur Neuordnung des Krankenhauswesens an- ments leisten können. Es erstaunt, unter welches Ni-
zusprechen. Hier verliert der Blick trotz berechtigter veau katholischer Soziallehre der Neuordnungsnach-
Erwägungen der Optimierung klinikinterner Aspekte kriegszeit die Christdemokratie zurückgefallen ist und
(optimale Betriebsgröße, Mindestleistungsmengen es erstaunt, auf welches Niveau die deutsche Sozial-
zur Erhöhung der Outcome-Qualität) u. a. den Sozial- demokratie angesichts der Tradition des Godesberger
raumbezug im Kontext raumordnungspolitischer Er- Programms intellektuell zurückgefallen ist. Zudem ist
wägungen aus den Augen. Ohne Ausbau von Primary es erstaunlich, wie die FDP ihre sozialliberale Traditi-
Health Care and Nursing Center ist eine solche Kon- on der 1970er Jahre aufgegeben hat. Die versammelte
zentration problematisch. bürgerliche Mitte scheint nicht mehr bereit und/oder
fähig zu sein, radikale Sozialreform zeitgemäß zu den-
Es wurde betont, dass eine Reformdiskussion nur Wer- ken und anzugehen. Polarisierungen zeichnen sich im
te-orientiert möglich ist. Weiter wurde konstatiert, Zuge der Spaltung unserer Gesellschaft ab, wobei der
dass die Rechtsregime (vom Völkerrecht, über die Rechtsruck im Lichte der Deutschen Geschichte eine
europäische Grundrechtsentwicklung, dem Grundge- geistige und moralische Katastrophe darstellt.
setz, der Sozialgesetzbücher bis hinein in die Landes-
gesetze und deren Implementationsverordnungen) Eine (erneut) einzuführende Vermögenssteuer könn-
kohärente Vorgaben eines Leitbildes im Sinne eines te einen Vorsorgefonds aufbauen. Der Reichtum der
die Reformdiskurse fundierenden Menschenbildes oberen Mittelschichten und der Oberklasse könnte
und von entsprechenden Werteorientierungen teilha- so einen solidarischen Gabe-Beitrag für die nachhalti-
bender Selbstbestimmung in möglichst ausgeprägter ge Finanzierung einer alternden Gesellschaft leisten.
Selbstständigkeit beinhalten, wenngleich mehr Ope- Auch die Erbschafts- und/oder Schenkungssteuer
rationalisierung zur Skalierung der Innovativität sozia- könnte hier einfließen. Aber der Reichtum kennt be-
ler Innovationen3 (mit Auswirkungen auf die Praktiken kanntlich meist kein Vaterland und ist fluide.
des Ordnungsrechts) erforderlich ist. Es fehlen aber
im Vertragsrecht (im Zusammenhang mit Fragen zum Einzige Konstante von moderner Gesellschaft sei ihre
effektiven Governance) der Kommunen Regelungen ständige Veränderung – ein bekannter (logisch ge-
zu den Instrumenten einer Infrastrukturplanung. Die sehen: pseudo-paradoxer) Spruch, nicht falsch, aber
Notwendigkeit funktionseffektiver regionaler Konfe- auch nicht hilfreich, wenn und insofern er unkommen-
renzkulturen wird weiterhin zu diskutieren sein. Der tiert und undifferenziert analysiert bleibt. Was für ein
obligatorische Kontrahierungszwang im SGB XI muss Wandel ist gemeint? Wohin geht die Reise? Wer fährt
problematisiert werden: Ich meine, er muss abge- warum, wie und wohin? Jede Reform hat Akteure,
schafft werden. (mehr oder weniger gute) Gründe und (mehr oder we-
niger gute) Ziele, eine (erst noch hinreichend zu defi-
Auch fehlen für die Förderung der Sozialraumbildung nierende) Ausgangslage (Startpunkt), bahnt sich den
Finanzierungsparagraphen im Sozialrecht. Fluchtpunkt der Bewegung des Dahin, geht sodann
bestimmte Wege und wählt (mehr oder weniger ge-
Zur Diskussion eines Leitbildes einer neuen Gesell- eignete) Transportmittel zur Zielerreichung. Viel zitiert
schaftspolitik für die Pflegeregimeentwicklung zählen (wie oben schon) ist auch: Nach der Reform ist vor der
die Fragen der Pflichten einer kommunalen sozialen Reform. Doch was ist eine Reform? Wann skaliert sich
Daseinsvorsorge4 und die Fragen der dazu notwen- eine Reform in ihrer Substanz als passungsoptimal zur
digen Kooperationen der Sozialversicherungen und Herausforderung des sozialen Wandels?
der Kommunen im Rahmen der eigengesetzlichen
Verantwortlichkeiten der Gewährleistungspflichten Das Leitbild des SGB XI ist im Kern, zumindest mit Blick
der Länder. Dazu gehören die Fragen nach den Mög- auf einige Strukturelemente, zukunftsfähig: Anvisiert
lichkeiten einer Infrastruktursteuerung, die nicht ohne ist es, nach Stand der Fachlichkeit, eine moderne Ver-
Diskurs der Überwindung ideologischer Blockaden sorgungslandschaft zu entwickeln, die wohnortnah,
der Fetisch-artigen Marktorientierung im Sinne ord- netzwerkzentriert, abgestuft (ambulant, teilstationär,
nungspolitischer Grundsatzentscheidungen denk- stationär) und Wohnen und Mobilität sowie Soziale
bar sind. Dazu gehört ferner im Hintergrund (auch Dienste, Pflege, Medizin integrierend ist.
im Sinne der hier angemahnten Gesellschaftspolitik)
das Aufgreifen der problematischen und zu proble- Es besteht jedoch eine – schmerzhafte – Differenz
matisierenden Konzentrationseffekte in der Vermö- zwischen Idee und sozialer Wirklichkeit. Reform meint
8hier Minimierung der Differenz oder Optimierung der letzt wird. Johann Galtung sprach in seiner Theorie
Konvergenz der Wirklichkeit an die Idee. der „strukturellen Gewalt“ von Vernachlässigung. Das
Problem stellt sich nicht anders im Alter dar. Einsam-
Das soziale Drama des Alter(n)s ist in den Blick zu neh- keit kann in allen Lebenslagen in allen Altersphasen
men. Dabei spielen verschiedene Daseinsthemen eine auftreten: Einsamkeit von Jugendlichen im Lichte der
bedeutsame Rolle. Die ökonomische Armut und die Suizidversuche, Einsamkeit im Studium, Einsamkeit
Spreizungen in der Einkommens- und Vermögenssi- im fortgeschrittenen mittleren Erwachsenenalter im
tuation im Alter werden zunehmen. Das reduziert die Kontext z. B. von Trennungen, Verlusterfahrungen und
Chancen auf ein Leben in sozialer Teilhabe im Alter. anderen kritischen Lebensereignissen. Auch unbewäl-
Auch ist, mit der ökonomischen Ressourcensituation tigte Belastungen in der Arbeitswelt spielen hier eine
verbunden, die Problematik bezahlbarer Wohnraum Rolle.
entwicklung ein Daseinsthema geworden. Die Lohn- Ins Zentrum der Diagnostik und der Interventionen
ersatzfunktion als älterer Mythos der Alterssicherung rückt das Phänomen der depressiven Grundgestimmt-
steht schon gar nicht mehr auf der Tagungsordnung heit. Doch wird man nicht nur am Subjekt ansetzen
der Prognosen; es geht um Armutsvermeidung, die können: Menschen stehen immer in Wechselwirkung
nicht mehr gelingt. Die individuelle Perspektive der mit ihrer sozialen Umwelt und sind in ihrer diesbezüg-
Betroffenheit (das personale Erlebnisgeschehen) ist lichen Einbettungsbedürftigkeit zu verstehen. Damit
nur die eine Seite: Die andere Seite ist die gesamtge- wird das Thema der Teilhabechancen evident.
sellschaftliche Problematik der Erosion des sozialen
Zusammenhalts. Eine Kultur der Spaltung breitet sich Aktuell nehmen viele Akteure zur Entwicklungsdy-
aus, die komplex ist, nicht nur Oben und Unten the- namik Stellung. Man konnte erneut das Problemfeld
matisiert, sondern Teilräume der Insider und Outsider, der Einsamkeit als Daseinsthema im höheren Alter
der Gewinner und Verlierer, in Bezug auf ein Wir als ein im Rahmen der Evaluation des Projekts Gemeinde-
Uns und die Anderen, Identität und das Fremde der schwesterplus in den Modellkommunen des Landes
Alterität usw. (Collier, 2019) Rheinland-Pfalz (Schulz-Nieswandt, 2019a) prägnant
wiederfinden. Zuletzt hat das Deutsche Zentrum für
Ein anderes Beispiel ist das Daseinsthema „Einsam- Altersfragen (DZA) mit Daten aus dem Alterssurvey
keit“ (KDA, 2019c). Einsamkeit ist ein bzw. kann ein zum Thema beigetragen. Das KDA findet den Zu-
Thema im ganzen Lebenszyklus des Menschen sein. gang zum Thema über die Sozialraumorientierung:
Allein-Sein muss nicht Einsam-Sein bedeuten. Auch Einsamkeit ist eine Frage der Sozialraumbildung und
innerhalb der Familie (und in anderen primären Ver- gerade in der Hochaltrigkeit ist Netzwerklosigkeit
gemeinschaftsformen) können Kinder einsam sein, der zentrale Risikofaktor in der Vulnerabilität dieser
auch ein Elternteil. Immer dann, wenn der einzelne Menschen.
Mensch, in Gemeinschaft lebend, nicht vom Mitmen-
schen erreicht wird oder sich abkapselnd verschließt Doch ein anderer Aspekt im Zugang zu diesem exis-
und seine soziale Mitwelt dessen inneres Leiden nicht tenziellen Komplex sei offen angesprochen: Auch der
erfährt. Mensch in seiner individuellen Personalität ist gefor-
dert: Hochaltrigkeit ist immer auch eine jemeinige
Das UN-Völkerrecht zu den Grundrechten der Kinder Entwicklungsaufgabe, der sich der Mensch stellen und
(auch das Europäische Grundrechtsdenken) sieht das die er bewältigen muss. Dazu braucht er sicherlich
Leitbild der Familie als eine Atmosphäre der Liebe, „Hilfe zur Selbsthilfe“. Doch ist er – in Wechselwirkung
des Vertrauens und der Empathie vor. Einsamkeit zu seiner Umwelt stehend – auch gefordert und muss
kann entstehen, wenn ein Kind diese Atmosphäre ver- selbst mobil sein.
missen muss. Im Grunde ist es eine Verletzung des in
der Würde der Person (Art. 1 GG) naturrechtlich (UN: Mobilität meint hier durchaus auch z. B. Umzugsbe-
dignity is inherent) verankerten Kindeswohls, das ver- reitschaft, aber auch innere – geistige und seelische –
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
3 Obwohl es eine zunehmende Dynamik der Publikationen über soziale Innovationen gibt (und sich hierbei erste Beiträge auch an
Fragen sozialraumorientierter Politik der [pflegerischen] Sorgearbeit für ältere und alte Menschen im Kontext von Wohnen und
Mobilität abzeichnen), fehlt es an einer normativ fundierten Skalierung, die es ermöglicht, wann und inwieweit man von einer
Innovativität der Innovationen sprechen kann. Zwar gibt es erste Ansätze zur Skalierung der Inklusivität des Wohnens von Men-
schen mit Behinderung (aus denen ein Transferertrag [auf den Sektor der Langzeitpflege] denkbar ist). Und im Feld der inklusi-
ven Schule haben sich Skalen zur Messung der inklusiven Einstellung der Professionen entwickelt.
4 Art. 28 GG i. V. m. Art. 72 GG vor dem Hintergrund von Art. 36 Grundrechtscharta der EU, mit Protokoll Nr. 29 von Lissabon im
EUV und AEUV verankert.
9Offenheit zur Öffnung hin zu neuen Wegen, denn auch Das ist seine Mitverantwortung. Einerseits. Anderer-
im hohen Alter ist ein weiteres Werden und Wachstum seits: Oftmals konturiert die abgründige Dunkelheit
der Person möglich. Viele gerontologische Studien des Erlebnisgeschehens das hohe Alter, die depressive
von Andreas Kruse haben davon gehandelt. Gewiss, Grundgestimmtheit neigt zur Suizidalität. Die Sozial-
diese Fähigkeit des Menschen ist nicht jenseits sozia- raumbildung muss den Menschen auch innerlich errei-
ler Ungleichheit zu verstehen. Deshalb ist ja auch das chen. Die sozialpolitische Herausforderung verweist
Postulat der Notwendigkeit der „Hilfe zur Selbsthilfe“ auf die Grenzen reiner soziologischer Betrachtung:
als gesellschaftliche Mitverantwortung zu verstehen, Mit dem Menschen in seiner Subjektivität ist „zu rech-
weil sichder Mensch eben nicht „am eigenen Schopfe nen“, er ist (in seinen endogenen Blockaden) abzuholen
aus dem Sumpf ziehen kann“. Doch die Hilfe muss auch und mitzunehmen auf die Reise zur Überwindung der
angenommen werden. Wenn die Umwelt zur Weiter- Einsamkeit, die ihn daran hindert, am Projekt des gelin-
entwicklung des Menschen anregend ist, so muss sich genden Lebens als Daseinsaufgabe teilzunehmen.
der Mensch diesem Möglichkeitsraum auch öffnen:
I. Grundsätzliche Vorfragen
Wenn man vom Abstrakten zum Konkreten bis hin Daseinstechniken bzw. Alltagskompetenzen, kogniti-
zum Exemplarischen voranschreiten will, beginnt ver Funktionsfähigkeit einerseits und Qualifikationen
man mit grundsätzlichen und übergreifenden Fragen. sowie Zertifikaten mit Blick auf Employability ande-
rerseits) und e) mit Gesundheitskapital als körperliche
Funktionsfähigkeit (also mit Blick auf Workability der
1. Pflegepolitik, Sozialpolitik, menschlichen Person, um die Entwicklungsaufgaben,
Gesellschaftspolitik z. B. Statuspassagen bzw. kritische Lebensereignisse,
als Herausforderungen im Lebenslauf zu bewältigen).
Pflegepolitik ist Teil der Alter(n)spolitik im Rahmen Die Frage nach den rechtlichen Ressourcen als Schlüs-
einer Politik des Generationengefüges, der Genderpo- selfrage zeichnet sich ab. § 1 SGB I betont im Lichte
litik und der Engagementförderpolitik als Teil der Sozi- von Art. 2 GG vor dem Hintergrund von Art. 1 GG die
alpolitik (der Bevölkerung im Lebenszyklus) als Teil der soziale Gerechtigkeit (der Chancengleichheit der frei-
Gesellschaftspolitik. Gesellschaftspolitik ist Lebensla- en Entfaltung der Person im Lebenslauf) im Sozial-
gengestaltungs- und Lebenslagenverteilungspolitik. recht.
Lebenslagen sind, im Sinne einer (nicht neo-liberal Gesellschaftspolitik ist Politik der Gestaltung der Ge-
verkürzt verstandenen) investiven Sozialpolitik, per- sellschaft. Infolge der Örtlichkeit des menschlichen
sonenzentriert5 definierte Ressourcenräume. Anzu- Daseinsvollzuges ist Gesellschaftspolitik immer auch
führen sind die Ausstattungen a) mit ökonomischem Raumordnungspolitik im Sinne der Siedlungsstruk-
Kapital (also Arbeitseinkommen, Transfereinkommen turgestaltung und somit des Wohnens im Kontext der
und Vermögen), b) mit Sozialkapital (also Unterstüt- Mobilität im lokalen, regionalen, trans-regionalen, na-
zungs- und Integrationswirkungen von sozialen Netz- tionalen, trans-nationalen) Umfeld des Wohnens. Wo-
werken, in denen Menschen, der universalen sozialen rum geht es also?
Logik der Gabe und der daraus resultierenden Rezi-
prozität als Systeme des sozialen Austausches von Es geht um das Sozialraumdenken der Zukunft. Der
Ressourcen auf der Grundlage der Gegenseitigkeit fol- Sozialraum ist nicht einfach da (das wäre das Contai-
gend, gebend wie nehmend eingebunden sind), c) mit ner-Denken eines physischen Raumbegriffs); er muss
Infrastrukturkapital (also der Dichte, Verfügbarkeit, überhaupt erst gebildet werden. Der Raum – genau-
Zugänglichkeit, Akzeptanz von Einrichtungen, Ange- so wie die Zeit – beruht auf Aktivitäten, wird also erst
boten und Diensten im Raum), d) mit Kultur- und Hu- durch Aktivitäten gebildet. Er ist mehr als eine aus
mankapital (also Haltungen und Tugenden, Bildung, der Verwaltungsperspektive rein territorial definierte
10wirtschaftliche und administrative Steuerungsgröße, Themenfeld: Huldigungsriten werden abverlangt an-
sondern er ist eine individuelle Lebenswelt, die ihre gesichts der Bereitschaft der transnationalen Kapital-
Definition und Bedeutung von den Menschen selbst Anleger-Modelle (Schulz-Nieswandt, 2020a), den de-
erfährt und für sie je subjektive Bedeutung hat. Es mografischen Wandel durch Investition in den Bau von
geht sodann um die Gestaltung des Wohnens in ver- Pflegeheimen zu bewältigen, die sodann angesichts
netzten Quartieren im Rahmen einer Versorgungsin- der Dichte des Wohnens reguliert werden als Orte von
frastrukturlandschaft als Gewährleistungsauftrag der Hygieneregimen der klinischen Welt (KDA, 2019b). Die
Daseinsvorsorge. Pflegepolitik ist daher Teil der per- private Häuslichkeit wird ohne hinreichende Proble-
sonenbezogenen Lebenslagenförderungspolitik und matisierung zum heiligen Ort gelingender Autonomie
der auf die Sozialstruktur abstellenden Lebenslagen- erklärt, obwohl angesichts mangelnder Vernetzung
verteilungspolitik. Beide Dimensionen sind lebens- erhebliche Lebensqualitätsprobleme bestehen und
laufbezogen zu verstehen. die traditionelle Moral der Aufgabenzuschreibung
der Angehörigen eigentlich eine unmoralische Risi-
koprivatisierung darstellt und letztendlich versteckte
1.1 Privater Reichtum bei öffentlicher Genderkämpfe verkörpert. Die innovativen Wohnfor-
Armut: Was ist Wohlfahrt? men jenseits dieses relativ primitiven dualen Weltbil-
des (Privathaushalt und Heim) sind im Spektrum der
In welche Entwicklungssackgasse ist unsere Gesell- Wohnformen im Alter eher von randständiger Bedeu-
schaft eigentlich geraten? Die Infrastruktur ist in vie- tung. Es fehlt an sozialer Phantasie und an politischem
len Sektoren (Brücken in NRW; Nah-und Fernverkehr Mut, die tradierten Strukturen aufzubrechen. Wollen
der Deutschen Bahn) marode; der Investitionsstau wir wirklich im Rahmen einer Finanzierungsreform nur
im Gesundheits- und Bildungswesen in baulicher mehr Geld in das System (quasi wie eine Ablasszah-
Hinsicht ist ebenso anzuführen wie der Skandal der lung) pumpen, ohne die Strukturen aufzubrechen und
Größe unserer Schulklassen. Geld für Privatschulen in neue Formenlandschaften zu überführen? Hier ist
und private Hochschulen ist im Wettbewerbskampf Reform wieder einmal als Reformation der etablierten
der Eltern um den zukünftigen Platz ihrer Kinder im heiligen Ordnung zu begreifen. Die Kritik der Verhält-
Leben offensichtlich reichlich da. Der Kampf um die nisse ist die Kritik des falschen Spieles, das nicht mehr
knappen Statusgüter im Flaschenhals unserer Sozial- mitgespielt werden darf.
struktur wird hier ausgetragen. Die Zahl der Bildungs-
verlierer prekärer Familien am Boden der Flasche Die kulturgeschichtlich überholten Strukturen benö-
führt zu Spaltungen in der politischen Landschaft; das tigen eine Mutation. Das Wort muss begrifflich ernst
Zentrum-Peripherie-Muster in der Sozialstruktur der genommen werden. Es geht nicht mehr um Tapeten-
Insider und Outsider setzt sich auch in der Geogra- wechsel, sondern es geht um den Bauplan der Welt, in
phie der Wohlstandsverteilung einer sich spaltenden der wir uns eingerichtet und in der wir alte Menschen
Bundesrepublik Deutschland fort. Deutschland – aber eingefügt haben. Die vorliegende Analyse geht aus
nicht nur Deutschland – hat Rassismus- und Rechts- von der Schlussfolgerung: keine Finanzierungsreform
extremismusprobleme generiert, was nicht bedeutet, ohne Strukturreform.
man solle das Prinzip der Toleranz falsch (als repressi-
onsfördernde Toleranz) auslegen und darauf verzich- Strukturproblem meint hier: Wir haben in unserem So-
ten, andere Gesellschaften zu kritisieren, wenn sie zialstaat ein Kulturproblem. Gemeint ist keine Kritik
die Würde als die uns heilige Ordnung des Menschen der „Hochkultur“ (Symphoniebauten) versus „Volks-
(„Sakralität der Person“: Schulz-Nieswandt, 2017b) kultur“ (Grundsicherung im SGB XII). Beides muss im
verletzen und die Idee des Rechtsstaates als Hüterin gesellschaftlichen Leben Platz haben. Gemeint ist die
von Freiheit, Gleichheit und Solidarität mit den Stie- Kultur der Versorgungswelten als Geschehensorte so-
feln treten. zialer Praktiken, die nicht kosten-effektiv sind und die
die gesundheits-, pflege- und sozialpolitischen Ziele
Die Logistikprobleme der Bundeswehr sind ange- verfehlen. Gemeint sind die Geschehensprozesse, die
sichts unserer internationalen Rollenverpflichtungen auf der Bühne der Sektoren inszeniert sind, die Dreh-
nur noch peinlich. Und mit Blick auf das vorliegende bücher der Filme, die in den Institutionen ablaufen
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
5 Die Präferenzenwelt der Person muss jedoch unter den „kritizistischen“ Vorbehalt der höchsten Wohlbedachtheit bei tiefster
Selbstbesinnung (Achtsamkeitsethik) und der dialogischen, auf gegenseitige Anerkennung verweisenden Aushandlung im Sinne
kommunikativen Handelns (Bedürfnis trifft auf Bedarf, unmittelbar oder mittelbar [Angehörige] Betroffene auf Professionen),
z. B. in Fallkonferenzen und Teilhabe-, Hilfe- und Therapieplanung, gestellt werden.
11und die Haltungen der Professionen als Rollenspieler die unzivilisierten Teile des sittenwidrigen Turbo-Kapita-
sowie auch die Einstellungen des Publikums (der Ge- lismus) nicht angemessen in den Griff.
sellschaftsmitglieder), die z. B. das St. Floriansprinzip
praktizieren, wenn es um De-Institutionalisierungen, Das Thema der Pflegepolitikreform muss so verstan-
Ent-Hospitalisierungen und um die Bildung und Ent- den werden: Denn die Idee des Hilfe-Mix auf lokaler
wicklung inklusionsfreundlicher Kommunen geht. und regionaler Ebene betrifft auf der Makroebene die
Frage unserer Wirtschaftssozialordnung: Welchen Mix
In einer Affektkultur der Angst und des Ekels gegen- von (starkem/schwachem) sozialem Rechtsstaat, For-
über dem Ganz Anderen des leidenden Menschen Profit- sowie Non-for-Profit-Marktwirtschaft und der
gelingt das soziale Miteinander nicht. Rechtsrefor- Lebenswelten der primären Vergemeinschaftungen,
men müssen Hand in Hand gehen mit der Arbeit an der Nachbarschaften und der Zivilgesellschaft wollen
einer neuen gelebten Kultur des Sozialstaates. Die wir? Wie gestalten wir diesbezüglich die Möglichkei-
reine Geldpumpe ohne Mut zum Kulturwandel hin ten des Mit-, Neben- und Gegeneinanders?
zu innovativen Strukturen ist eher eine Signatur des
Schuldgefühls und der Schuldabtragung, indem sich „Wohlstand für wen?“ Und „Wohlstand für was?“:
die Gesellschaft vor ihrer eigenen Veränderung drückt Das waren Diskursfragen in der Soziologie schon der
und ihre Verantwortung der Arbeit am eigenen Iden- 1960er und frühen 1970er Jahre. Auch die Diagno-
titätsverständnis – „In welcher Republik wollen wir se „Privater Reichtum bei öffentlicher Armut“ war
eigentlich leben?“ – zur Finanzspritze sublimiert. Su- ein Thema in der kritischen heterodoxen Volkswirt-
blimierung ist ein durchaus passender Begriff: Man schaftslehre schon vor Jahrzehnten. Das Thema ist
verdrängt (verschweigt) nicht, man wird tätig (Finan- aktuell wie eh und je: Wie wollen wir wohnen, leben,
zierung), aber die Problemlösung gelingt letztendlich arbeiten, konsumieren? Wie teilen wir uns über den
nicht, weil das eigentliche Problem in der Tiefe der Lebenslauf hinweg unsere Lebenszeit (auf Erwerbs-
Sache nicht gelöst wird: Keine „Mehr Geld“-Finanzie- arbeit, der Konsumarbeit, Familiensorgearbeit, der
rungsreform ohne radikale Strukturreform! Struktur- sozialen Engagementarbeit und mit Blick auf die Be-
reform ist jedoch Politik eines Identitäts-relevanten deutung der Zeit, die wir der Göttin der Muse spenden
(Wer bin ich, was will ich wirklich, wo will ich hin: Was wollen) auf? Arbeitest Du (für den Privatkonsum) nur
ist eigentlich die „Reise“) Kulturwandels. Nochmals: oder lebst Du auch? Für was will der Mensch mitver-
Pflegepolitik ist Teil der Sozialpolitik und muss in eine antwortlich sein im Gefüge der jemeinigen Selbstsor-
kohärente Gesellschaftspolitik eingebettet werden: ge, der lebensweltlichen Mitsorge und der Fremdsor-
Wie wollen wir nachhaltig miteinander leben? Wir: ge für die Ganz Anderen der weiten Sozialwelt?
Das sind die Kinder, die Jüngeren und die Älteren, die
Frauen und die Männer und die anderen Diversen, die Ohne Strukturreform der Wohn- und Versorgungs-
Reich(er)en und die Ärmeren sowie die Mittelschich- landschaft gelingt es unserer Gesellschaft nicht, der
ten, die Menschen mit oder ohne ihre diversen Migrati- personalen Würde des Alters eine angemessene Form
onshintergründen und Multi-Zugehörigkeitsrollen etc. des Wohnens und der gelingenden Teilhabe am nor-
malen sozialen Miteinander zu geben. Wie Kinder
Warum fällt es uns so schwer, die sozialen Kosten in grundrechtlich ein Recht auf Umwelten des gelin-
Gegenwart und Zukunft unserer Selbstkonzepte nicht genden Aufwachsens haben, so hat der alte Mensch
angemessen einzubeziehen in die Sozialbilanz unserer grundrechtlich ein Recht auf Umwelten der gelingen-
Verhaltensmuster? Wir haben – außer bei einigen Prä- den Personalität, der eine passungsfähige Form gege-
sidenten relevanter Länder, wobei sich wohl Reichs- ben werden muss. Es fehlt der sozialen Wirklichkeit in
idee-bezogene Machtvisionen, militärisch-wirtschaft- diesem Sinne die Gestaltwahrheit (Schulz-Nieswandt,
liche Interessen und Wahrnehmungspathologien mit 2017a). Wir handeln entgegen der Philosophie unserer
Charakterneurosen mischen – kein Erkenntnispro- Rechtsregime und verletzen die dort verankerten Wer-
blem. Wir haben ein Handlungsproblem. te der Selbstbestimmung, Selbstständigkeit und Teil-
habe. Statt inklusives Gemeindeleben praktizieren wir
Wir – eine Mehrheit der Gesellschaftsmitglieder – willi- soziales Ausgrenzen: Exklusion statt Inklusion.
gen in die Imagination der Wunschmaschine unendlicher Ja, sicher: Die soziale Wirklichkeit ist, im Lichte der
neuer Märkte der Digitalisierung (Schulz-Nieswandt, Befunde der Erfahrungswissenschaften, differenzier-
2019b) eines globalen Kapitalismus 4.0 weitgehend re- ter. Und dies kann daher positiv zur Geltung gebracht
lativ problemlos ein. Aber unsere öffentlichen Aufgaben werden: „Es geht doch“, es gibt – pädagogisch in
und die Lösung der Kollektivgutprobleme bekommen einfacher Weise wirksam – Vorbilder, gute Modelle,
wir (der Gewährleistungsstaat, die Zivilgesellschaft und Leuchtturmkommunen, Vorzeigeunternehmen, ver-
12änderungsfähige Landesministerien, vertrauenswür- len Lernprozesse, die erforderlich sind. Dieses syste-
dige Politiker*innen, spendenbereite Reiche usw. mische Denken muss in einer Politik der Reform im-
mer mitgedacht werden.
1.2 Was ist wann eine Reform?
Überlegungen zur Gestaltauffassung 1.3 Zur Logik einer Reform
Wann ist eine Reform (der Ordnung der Gestaltung ei- Zur Logik gehören die grundlegenden ordnungspo-
nes sozialen Feldes oder gar der ganzen Gesellschaft) litischen Vorentscheidungen, wie sie sodann in den
eine Reform, die den Namen einer Reform, abge- Wohlfahrtsstaatsregimetypen auf Policy-Felder-Ebene
grenzt vom Verständnis einer (eher eruptiven) Revolu- zum Ausdruck kommen.7 Im Zentrum steht der im Uni-
tion6 verdient? Verortet sich im Kontinuum zwischen versalismusgrad der Zugangschancen zum Ausdruck
Reform und Revolution der Typus der revolutionären kommende Grad der „Dekommodifizierung“ (Versor-
Reform? Meint Reform Arbeit am Phänotypus, revo- gung in Abkoppelung von der Arbeitsmarkt- und Ein-
lutionäre Reform eine Transformation der DNA eines kommenslage der Menschen). Zu rekurrieren ist viel
Systems, also Arbeit am Genotypus des Systems? eher auf den grundrechtlichen Status der Menschen als
Sozialbürger*innen (social citizenship). So gibt das Eu-
Reformen haben eine unterschiedliche Form im Sin- ropäische Grundrechtsdenken im EUV/AEUV den frei-
ne einer Gestaltqualität. Es geht hier, was seit langer en Zugang zu den Dienstleistungen von allgemeinem
Zeit politisch praktiziert wird, nicht (mehr nur) um Interesse (DAI) als Teil des Sozialmodells der sozialen
parametrische Reformen. Parameteranpassungen im Marktwirtschaft des Art. 3 (3) EUV vor, wodurch der Art.
sozialen Wandel sind durchaus wichtig, hier aber nicht 28 GG vor dem Hintergrund der Sozialstaatsbestim-
das Thema. Was ist dann die Kernfrage? mung in Art. 20 GG europarechtlich – zudem auch und
besonders völkerrechtlich – zusätzlich gestärkt wird.
Es geht nunmehr um die ausstehende und überaus Versteht man die 5 W-Fragen als konstitutiv für das
drängende Frage einer Reform des Systems. System Verständnis von Sozialpolitik (Wer bekommt Was,
von was? Was ist mit System gemeint? Es geht um Wie, Wo und Warum?), so betrifft die Logik des Systems
eine Reform a) der Logik (Funktionslogik aus einem den Begründungsrahmen des Warums. Hier ist § 1 SGB
System von Annahmen zur konstitutionellen Rah- I in seiner organischen Verbindung zu Art. 2 GG vor dem
mung einer Verrechtlichung der institutionellen Archi- Hintergrund von Art. 1 GG zu verstehen.
tektur eines Leistungsgeschehens [als „Versorgung“],
b) und der Grammatik (System von Regeln zum Pro-
zessgeschehen innerhalb des Rahmens) des Dreh- 1.4 Zur Grammatik einer Reform
buchs der Bühnenaufführungen des Systems der SGB.
Bekanntlich spielen wir (so eine Metapher in der so- Die Grammatik als das System der Regeln, nach de-
ziologischen Theoriegeschichte) alle Theater. Bei ei- nen die Leistungsgeschehensprozesse in den Ver-
ner Reform geht es darum, das Drehbuch des Films, sorgungslandschaften zu verstehen sind, betrifft die
der da ablaufen soll, zu verbessern, damit die Laufzeit anderen 4 W‘s in ihrem inneren Funktionszusammen-
möglichst lang ist, aber auch darum, souveräne und hang: z. B. mit Blick auf das SGB XI und das SGB V:
kompetente Schauspielakteure auf der Bühne zu be- Wer: Versichertenkreis, Was: Leistungskatalog, Wo:
fähigen, das Stück qualitativ gut aufzuführen. Einrichtungen (z. B. Pflegeheim, Tagespflege, priva-
Eine Reform ersetzt hierbei nicht die längeren sozia- te Häuslichkeit oder Akutkrankenhaus, Hospiz etc.),
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
6 Die Revolution ist hier nicht das Thema, obwohl fundamentale, nach wie vor „revolutionäre“, weil unverwirklichte, die Wünsche
und Träume vieler Menschen bewegende Werte eine konstitutive Rolle spielen und einen Übergang zum vollständig Ganz An-
deren anvisieren, z. B. eine grundrechtstheoretisch fassbare inklusive Gemeindeordnung als Rechts- und Hilfegenossenschaft
(Schulz-Nieswandt, 2018a), geprägt von optimierter De-Institutionalisierung, Vielfalt der Wohnformen im Rahmen einer trans-
sektoral integrierten Cure- und Care-Landschaft, eine soziale Welt der Passungsoptimierung einer selbstbestimmt teilhabenden
Person und aktualgenetischer (das Wachsen und Werden der Person förderlichen, also aktivierender) Umwelt. Das ist nahe an
dem modernen Capability-Ansatz orientiert, der das Völkerrecht der UN-Grundrechtskonventionen prägt.
7 In der internationalen Wohlfahrtsstaatstypen- und Policy-Forschung wird die Pflegepolitik der Bundesrepublik Deutschland
auf Grund des deutlich risikoprivatisierenden Familialismus dem südeuropäischen Typus zugerechnet. Aus der Forschung ist zu
entnehmen, dass dies der habitualisierten Einstellung von Menschen mit türkischem Migrationshintergrund, aber auch deutsch-
stämmigen Übersiedler*innen aus Osteuropa entspricht. Dabei darf man sich bei bundesdeutschen Privathaushalten bei der
Pflegegeldfinanzierung familialer Selbsthilfe nicht täuschen: Hier siedelt sich auch das Thema der schattenwirtschaftlichen
Beschäftigung von Pflegekräften aus Osteuropa an.
13Wie: Pflegekonzepte (z. B. Primary Nursing) sowie alltagsbegleitende Kümmererfunktionen) ebenso ein-
Betriebsformen der Sektoren (z. B. pflegepräventi- ordnen wie z. B. die Einsetzung von AAL-Technologien.
ver Hausbesuch, ein trans-sektorales MVZ oder ein Neben diesen individuellen Faktoren steht die Sozial-
Triage-orientierter Hausarzt statt Direktinanspruch- raumidee für eine andere Haltung des Miteinanders: i. S.
nahme von Facharztpraxen) und Versorgungspfade einer Koproduktion im Welfaremix, die der Versäulung
(Krankenhausentlassung nach § 11 [4] SGB V) und de- der Sektoren in der Versorgungslandschaft entgegen-
ren Managementpraktiken (z. B. Case Management wirkt und im Sinne des Empowerments die Ressourcen
als Brückenfunktion durch Hausbesuch). der Betroffenen und im Quartier einbezieht. Aus dieser
Befähigung entsteht eine andere Verantwortungskul-
Zur vertiefenden Erläuterung sei z. B. folgende Pro tur bei der Sicherstellung der Versorgungsinfrastruktur.
blemanzeige (Schulz-Nieswandt, 2019c) eingebracht:
Die Bedeutung der nachhaltigen Vernetzung der Le- Es gäbe noch eine weitere W-Dimension: Wann (z. B.
benswelt im Kontext privater Häuslichkeit wird ange- Altersgrenzen, Sequenzmanagement in Leitlinien-
sichts der Probleme in der Krankenhausentlassung in orientierter Versorgung etc.) bekommt man eine Leis-
der vulnerablen Hochaltrigkeit („transitional planning“: tung? Aber hier soll kein Spiel aus dieser Grammatik-
„bridging the gap“ angesichts von No Care-Zonen: lehre gemacht werden.
Schulz-Nieswandt, 2018d) ebenso deutlich wie die
Bedeutung der Sozialraum-orientierten Öffnung der
Wohnsettings stationärer Langzeitpflege („von Innen 2. Der einbettende Boden des Rechts
nach Außen“ und „von Außen nach Innen“), die u. a.
vor dem Hintergrund der Gewährleistung aktivieren- Das ganze „System“ kann in nunmehr umgekehr-
der Umwelten (im Sinne der Aktualgenese) für ein ge- ter Richtung als rechtliches (Mehr-Ebenen-)Regime
lingendes Altern mit hoher Lebensqualität bedeutsam durchdekliniert werden: kohärent und System-bil-
sind. Fehlende Verfügbarkeit von Netzwerken bzw. be- dend absteigend vom Völkerrecht, über Europarecht,
grenzte Belastbarkeit von Netzwerken erweisen sich als nationales Verfassungsrecht, Sozialgesetzbuchrecht,
wichtigste Risikofaktoren für die Vulnerabilität im Alter Gesetzes- und Verordnungswesen der Länder. Für ein
und auch als Prädikator für die Heimübersiedlung. Im kohärentes – zugleich breites wie tiefes – Ausrollen
Kontext privater Häuslichkeit lassen sich vor diesem der völkerrechtlichen und verfassungsrechtlichen Ar-
Hintergrund die aktuellen Entwicklungen zu präven- tikel- und sozialrechtlichen, aber u. a. auch zivilrechtli-
tiven Hausbesuchen („Fall“-steuernde Beratung und chen Paragraphen-Welt ist hier nicht der Ort.
II. Reform entlang eines
Systems konzentrischer Kreise
Rindenförmig (um im Bild der konzentrischen Kreise dung (inklusive Professionenpolitik) → zu Fragen der
zu formulieren) gedacht, und dies könnte die Kern- Systemfinanzierung (anreizkompatible Wohnortun-
überlegung der Reformdebatte bezeichnen, von der abhängigkeit und Förderung bedarfswirtschaftlicher
Personenzentrierung und Passungsoptimierung der Solidarität).
individuellen Pflegearrangements (in partizipativer
Hilfeplanung und Case Management eingebunden) → Wiederum umgekehrt kann nun eine Art von Geome-
über die Aufgabe der Sozialraumbildung (Wohnen in trie der Architektur des „Systems“ definiert werden:
einer Kultur der lokalen sorgenden Gemeinschaften) Gemeint ist ein analytischer Gang von der Mikro-Ebe-
→ über eine Politik der regionalen Infrastrukturbil- ne über die Meso-Ebene zur Makro-Ebene. Diesem
14dramaturgischen Drehbuch soll hier gefolgt werden. Versorgungs-Landschaften durch die Einrichtungs-
Wir werden die verschiedenen Ebenen durchschreiten träger, die mit diesen Kapazitätswelten ihre wirt-
und darlegen, worum es jeweils geht. schaftliche Wertschöpfung status- und machtbewusst
betreiben, verteidigt. Nach wie vor ist der Sektor in
dominanter Weise relativ primitiv strukturiert: private
3. Die kleine Welt: die Mikroebene Häuslichkeit (als vermeintliche Inseln der Glückselig-
keit) und Heime (als Orte des vermeintlichen Schre-
Worum geht es auf der Mikroebene? Menschen leben ckens) stehen sich dual gegenüber. Die diesbezügliche
ihren Alltag in ihren Lebenslagen, definiert über das Zu- soziale Wirklichkeit wird binär codiert. Die hybriden
sammenspiel von Entwicklungsaufgaben als Heraus- Formen im Zwischenraum entwickeln sich erst lang-
forderungen, Ressourcensituationen und lebensweltli- sam, wohl auch, weil sie für beide Pole des binären
chen Routinen der sozialen Praktiken der Bewältigung Raums der Wohnformen eine relevante Bedrohung
innerhalb ihrer habituellen (Haltungs-abhängigen) darstellen können, denn hier geht es um die Über-
Existenzführung im Lebenslauf (zwischen Pränatalität windung des primitiven „entweder/oder“-Denkens.
sowie Geburt und Sterben und Tod). Letztendlich ist Offensichtlich handelt es sich um ein Kulturproblem,
das Leben in dieser Auffassungsperspektive ein Zusam- das in mentalen Modellen des Denkens verankert ist.
menspiel von Stress (Aufgaben, die erledigt werden Mentalität meint hier aber mehr als rationales Den-
müssen) einerseits und Stressbewältigungsressourcen ken: Es geht um Phantasie, Mut zum schöpferischen
andererseits. Kann die Sozialpolitik dem Menschen Aufbruch, auch als Tabu-Bruch, Selbsttranszendenz,
grundsätzlich die Stressseite des Geschehens nicht ab- Zukunftsoffenheit, dynamische Visionen von Ideen
nehmen, denn dann würde sich das Leben abschaffen, statt statische Verfolgung von status quo-Interessen:
so kann sie doch dem Menschen helfen, seine Entwick- eine nicht triviale und eher vertrackte Geschichte.
lungsaufgaben im Lebenslauf zu meistern. Dann gilt:
Mit den Aufgaben wächst der Mensch. Wohnen ist nun also in unserem Verständnis der Mi-
krokosmos der personalen Daseinsführung, verweist
Die Konstruktion von individuellen Pflegearrange- aber sofort auf die Kontexte, in denen die Existenz ab-
ments ist ein organischer Teil dieser Mikrogesche- laufend geschieht.
hensordnung.
Wir überschreiten damit nunmehr den Übergang zur
Diese allgemeine Daseinsdiagnostik mit Blick auf die Meso-Ebene. Die Unterscheidung der Ebenen ist ja
Existenzführung des Menschen gilt auf allen Ebenen, auch nur eine Welt der Abstraktion. Zu analytischen
die hier zu unterscheiden sind. Ich bleibe zunächst auf Zwecken kann man diese Unterscheidungen treffen.
der Mikroebene. Mag sie auch eingebettet sein in die In der „wirklichen Wirklichkeit“ ist immer alles hoch-
anderen (höheren) Ebenen, so ist sie doch die Ebene gradig komplex verschachtelt.
des eigentlichen Lebens. Hier spielt die Musik, hier
läuft der Alltag des Lebens als Film ab. Es geht nunmehr um das unmittelbare Wohnumfeld
(der Nachbarschaft des Stadtteiles oder des Dorfes)
Eine Reform hat analysearchitektonisch und somit im Rahmen einer – formalen, professionellen – Infra
topographisch hier anzusetzen: Ankerfunktion dieser strukturlandschaft. Infrastrukturen sind Angebote,
analytischen Lokalisierung (Verortung der Fragestel- Einrichtungen und Dienste im Raum, hier nun betrach-
lung, der Problemlagen und der Sicht auf die Din- tet unter (auf Blockaden und Barrieren multi-dimensi-
ge des Geschehens) ist real und somit empirisch das onal abstellenden) Aspekten der verfügbaren Dichte
Wohnen. Das ist eine originäre KDA-Thematik (Kre- (Quantität und ihre Raumverteilung), der Erreichbar-
mer-Preiß, 2020). keit (Raumüberwindungskosten der Nutzung) und der
Zugänglichkeit (baulich, technisch, informations- und
Die Wohnformen im Alter im gesellschaftlichen Diver- transparenzbezogen, aber auch habituell und mental)
sitätsgefüge befinden sich in einem sich (allerdings sowie der Akzeptanz (Qualität). Diese Welt der Infra-
sehr langsam) differenzierenden Wandel, der die Fra- strukturen sind die Angebotsseite des Geschehens,
ge aufwirft, ob § 3 SGB XI („ambulant vor stationär“) die sich als Möglichkeitsräume aus der Perspektive der
wohnmorphologisch nicht differenziert neu formuliert Person (Nachfrage- bzw. Nutzungsseite des Gesche-
werden muss, um die sich etablierenden hybriden So- hens) verstehen lassen.
zialgebilde der Übergangs- oder Zwischenräume ad-
äquat abzubilden. Der Wandel läuft schleppend und Der Mensch als Subjekt braucht also auch Kompeten-
wird durch die Betonierung der vorhandenen Wohn- zen zur zugänglichen Erkennung und sodann zur ef-
15Sie können auch lesen