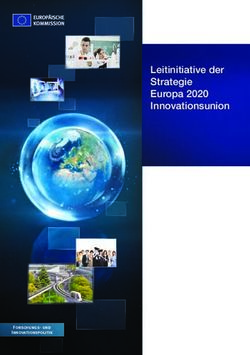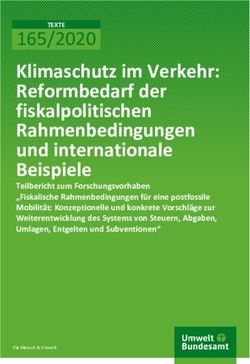Pricing-Strategien in der Kfz-Versicherung - synpulse
←
→
Transkription von Seiteninhalten
Wenn Ihr Browser die Seite nicht korrekt rendert, bitte, lesen Sie den Inhalt der Seite unten
4| synpulse synpulse |5
Vorwort Die Disziplin des Pricings hat sich in den letzten Jahren von
einer stark aktuariell dominierten Tätigkeit in eine interdiszi-
Auch bei dieser Ausgabe der Studie haben wir den Fokus auf die
Kraftfahrzeugversicherung gelegt, da die Erfahrung der letzten
plinäre Zusammenarbeit von Produktmanagern, dem Vertrieb, Jahre zeigt, dass Trends im Pricing häufig in dieser Branche
dem Marketing, dem Aktuariat und weiteren Abteilungen ent- ihren Ursprung haben. Aus diesem Grund sind wir überzeugt,
wickelt. Hinzu kam, dass auch die verschiedenen Branchen- dass auch Spezialisten aus anderen Branchen interessante Er-
sichten zusammengeführt werden mussten – beispielsweise kenntnisse aus dieser Studie gewinnen können.
durch Kundenwertmodelle.
Wir freuen uns, hier den aktuellen Stand aus akademischer
Dabei hat sich die Komplexität enorm erhöht. Auch neue Be- Sicht und praktischer Anwendung präsentieren zu dürfen.
rufsbilder entstanden, z.B. der Pricing-Aktuar oder der Produkt-
parametrierer. Diese spannende Entwicklung hat zu tiefgrei- Ganz herzlich bedanken wir uns bei allen Unternehmen und
fenden Veränderungen in Organisation und Prozesslandschaft Mitwirkenden, die durch ihre Teilnahme zur Realisierung der
geführt. Studie beigetragen haben.
Diese Veränderungen sind auf neue Marktanforderungen zu-
rückzuführen. Rein bedarfsorientierte Preisfestsetzungen sind
nicht mehr marktgängig und unterstützen die meist unter dem
Titel «profitables Wachstum» zusammenzufassenden strategi-
schen Vorgaben nicht ausreichend.
Diese Entwicklungen erfordern eine aktuelle Analyse des heu-
tigen Stands bezüglich Umsetzung und Trends der verschiede-
nen Pricing-Tätigkeiten.
Bereits 2006 führten das Institut für Versicherungswirtschaft
der Universität St. Gallen und Synpulse Schweiz eine ähnlich ge-
lagerte Studie zum Thema «Pricing-Strategien in der Motorfahr-
zeug-Versicherung» [1] durch. Das Thema hat uns seitdem fort- Prof. Dr. Hato Schmeiser Dr. Christoph Nützenadel
dauernd beschäftigt und viele neue spannende Erkenntnisse Lehrstuhlinhaber und Partner
gebracht. Die starke Weiterentwicklung war Anlass für uns, eine Geschäftsführender Synpulse Schweiz AG
neue Studie zu diesem Thema aufzulegen. Dabei wurden vertie- Direktor I.VW-HSG
fende Analysen durchgeführt, Entwicklungen der letzten Jahre
aufgegriffen sowie aktuelle Themen und Trends einbezogen.6| synpulse synpulse |7
Inhaltsverzeichnis
Management Summary 8 4.5.1 Auslöser 43 21 Datengrundlagen im Pricing 37 Verzeichnis der Thesenboxen
1. Umfrage und Teilnehmer 10 4.5.2 Häufigkeit der Überprüfung und Anpassung der Tarife 45 22 Prämienspielräume nach Ländern
2. Pricing-Framework 13 4.5.3 Zeitdauer und Aufwand 46 (maximale Ab-/Zuschläge in % der Prämie) 39 These 1 34
2.1 Drei-Ebenen-Modell 13 4.5.3.1 Zeitdauer 46 23 Prämienspielräume nach Unternehmensgröße 40 «Peak Car» ist im DACH-Raum erreicht.
2.1.1 Ebene 1 Ressourcenfundament 13 4.5.3.2 Aufwand (Personentage, PT) 47 24 Auslöser Tarifanpassung nach Ländern 44
2.1.2 Ebene 2 Pricing-Bausteine 14 4.5.3.3 Ländervergleich 48 25 Auslöser Tarifanpassung nach Unternehmensgröße 44 These 2 41
2.1.3 Ebene 3 Strategische Ebene 14 4.5.3.4 Größenvergleich 47 26 Häufigkeit von Tarifüberprüfung und Tarifanpassung 45 Das Zusammenspiel zwischen Vertrieb, Marketing und
2.2 Pricing-Prozess 15 4.5.3.5 Zusammenfassung/Fazit 48 27 Dauer Tarifanpassungen 46 Aktuariat gewinnt zunehmend an Bedeutung.
2.2.1 Prozessziele 15 4.6 Tarifierungsmerkmale 50 28 Dauer Tarifeinführungen 46
2.2.2 Operative Prozesse 16 4.6.1 Anzahl an Merkmalen 50 29 Aufwand Tarifanpassung 47 These 3 54
2.3 Methoden zur Preisfindung 17 4.6.2 Tarifierungsmerkmale 51 30 Aufwand Tarifeinführung 47 Telematik wird die Regeln verändern.
2.3.1 Kernprozess Rate-Assessing 17 4.6.3 Unisex 55 31 Korrelation Aufwand vs. Dauer Tarifanpassungen 48
2.3.2 Prozessdokumentation 18 4.7 Kundenbewertung 58 32 Korrelation Aufwand vs. Dauer Tarifeinführungen 49 These 4 57
3. Entwicklungen im Kfz-Versicherungsmarkt 20 4.8 Zukunftserwartungen 61 33 Mittlerer Zeitbedarf (in Tagen) 49 Neben der Nutzung des Geschlechtermerkmals zu
3.1 Vergleich Marktstrukturen 20 4.8.1 Wettbewerbsbedingungen 61 34 Mittlerer Aufwand (Personentage, PT) 50 Tarifierungszwecken könnten Kunden auch noch weitere
3.1.1 Anzahl Marktteilnehmer 20 4.8.2 Entwicklung von Prämien und Schäden 62 35 Anzahl erhobener Tarifmerkmale 51 Merkmale als diskriminierend wahrnehmen.
3.1.2 Konzentration der Marktteilnehmer 21 4.8.3 Entwicklung der Marktbearbeitung 66 36 Anzahl verwendeter Tarifmerkmale 52
3.2 Kfz-Markt Deutschland 22 4.8.4 Entwicklung weiterer Aspekte 67 37 Einfluss von Tarifmerkmalen 53 These 60
3.2.1 Marktplayer 22 5. Anhang 70 38 Verwendung weiterer Tarifmerkmale Was im Durchschnitt richtig ist, ist im Einzelfall oft
3.2.2 Fahrzeugbestand 22 5.1 Literaturhinweise 71 (Versicherungsnehmer) 53 grundfalsch: von der Kundensegmentierung zur
3.2.3 Prämien 22 5.2 Autoren 72 39 Verwendung weiterer Tarifmerkmale (Fahrzeug) 54 Verkaufsfallsegmentierung.
3.2.4 Schadenseite 22 Impressum 73 40 Veränderungen von Wertschöpfung und
3.2.5 Zusammenfassung 23 Geschäftslogik durch Telematik 55 These 6 65
3.3 Kfz-Markt Österreich 24 41 Einschätzung zu Unisex Das Kfz-Prämienvolumen wird sich in die Sparte
3.3.1 Marktplayer 24 Abbildungen (Sicht Deutschland und Österreich) 56 Produkthaftpflicht verschieben.
3.3.2 Fahrzeugbestand 24 42 Einschätzung zu Unisex (Sicht Schweiz) 56
3.3.3 Prämien 24 1 Aufteilung der Stichprobe nach Ländern 11 43 Merkmale zur Kundenbewertung 59
3.3.4 Schadenseite 25 2 Aufteilung der Stichprobe nach Unternehmensgröße 11 44 Entwicklung der Wettbewerbsbedingungen
3.3.5 Zusammenfassung 25 3 Drei-Ebenen-Modell des Pricings 13 nach Ländern 61
3.4 Kfz-Markt Schweiz 26 4 Prozesslandkarte und Wertschöpfungskette 15 45 Erwartete Änderungen zu Prämien und Schäden 62
3.4.1 Marktplayer 26 5 Preisfindungsmethoden 17 46 Durchschnittlich erwartete Änderungen von Prämien
3.4.2 Fahrzeugbestand 26 6 Marktkonzentration 20 und Schäden nach Ländern 64
3.4.3 Prämien 26 7 Entwicklung Prämienvolumen Deutschland 22 47 Durchschnittlich erwartete Änderungen von
3.4.4 Schadenseite 26 8 Entwicklung Schadenvolumen Deutschland 23 Prämien und Schäden nach Unternehmensgröße 64
3.4.5 Zusammenfassung 27 9 Entwicklung Schadenquoten Deutschland 23 48 Entwicklung der Marktbearbeitung 66
4. Studienergebnisse 28 10 Entwicklung Prämienvolumen Österreich 24 49 Entwicklungserwartungen zu weiteren Aspekten 67
4.1 Pricing-Bausteine 28 11 Entwicklung Schadenvolumen Österreich 25
4.1.1 Vergangene Entwicklung 28 12 Entwicklung Schadenquoten Österreich 25
4.1.2 Weiterentwicklungsbedarf 29 13 Entwicklung Prämienvolumen Schweiz 26
4.2 Strategische Pricing-Vorgaben und -Instrumente 14 Entwicklung Schadenvolumen Schweiz 27
im Pricing-Management 32 15 Entwicklung Schadenquoten Schweiz 27
4.2.1 Strategische Pricing-Vorgaben 32 16 Entwicklung Pricing-Bausteine nach Ländern 29
4.2.2 Instrumente im Pricing-Management 35 17 Weiterentwicklungsbedarf nach Ländern 30
4.3 Datengrundlagen im Pricing 36 18 Weiterentwicklungsbedarf nach Unternehmensgröße 31
4.4 Prämienspielräume 39 19 Strategische Pricing-Vorgaben nach Ländern 33
4.5 Tarifanpassungen 43 20 Verfügbare Instrumente im Pricing-Management 358| synpulse synpulse |9
Management Summary Zunehmende Komplexität, erhöhter Wettbewerb durch
mehr Markttransparenz und neue technische Möglichkeiten
Tarifgestaltung: Tarifüberprüfungen und -anpassungen fin-
den deutlich häufiger statt als noch 2006. Häufigster Auslöser
beeinflussen das Pricing in der Versicherungswirtschaft maß- für Tarifanpassungen sind neue Rentabilitätsberechnungen.
geblich. Vor diesem Hintergrund wurde die vorliegende Die Außensicht (Wettbewerbstarife, Zahlungsbereitschaft
Studie aufgesetzt, die sich auf die Kraftfahrzeugversicherung Kunden) ist deutlich weniger relevant. Zugenommen hat auch
(Kfz-Versicherung) im DACH-Raum fokussiert, da hier die die Anzahl der Tarifierungsmerkmale, und zwar sowohl dieje-
höchste Dynamik zu beobachten ist und sich daraus folglich nige der erhobenen Merkmale als auch diejenige der im Tarif
am frühesten neue Trends herauslesen lassen. verwendeten. Dominant sind dabei nach wie vor lenker- und
fahrzeugbezogene Merkmale. Kundenbezogene Merkmale
Die Studie wurde neu aufgesetzt, setzt aber auf der Struktur wie z.B. weitere Policen des Versicherungsnehmers, Cross-
der ersten Studie aus dem Jahr 2006 an, damit Vergleiche zur Selling-Potenzial oder Kundenwert fließen dagegen kaum in
Marktsituation von 2006 möglich sind. Insgesamt sind in die die Tarifkalkulation mit ein.
Auswertung Antworten von 31 Unternehmen eingeflossen.
Zukunftserwartungen: Bei der Einschätzung der Zukunftser-
Märkte: Die Marktstrukturen in allen drei DACH-Ländern sind wartungen zeichnen sich deutliche Unterschiede zwischen
etwa gleich geblieben. Trotz der Sättigung der Märkte fand ent- den einzelnen Ländern ab. Befragt nach den Wettbewerbsbe-
gegen der allgemeinen Erwartung keine Konsolidierung statt. dingungen erwarten die deutschen Teilnehmer eine Zunahme
Im Gegenteil: Es konnten sogar einzelne Markteintritte beob- von Prämienvolumen und Rentabilität und zugleich eine stär-
achtet werden. Die höchste Marktkonzentration weist die kere Marktkonzentration. Die Teilnehmer aus der Schweiz und
Schweiz auf, knapp gefolgt von Österreich. In Deutschland ver- Österreich schätzen den Markt so ein, dass sich die Prämien-
einen die größten fünf Gesellschaften nur ein Drittel des Markts. volumina zwar ebenfalls erhöhen werden, denken aber, dass
Die Fahrzeugbestände sind überall noch leicht gewachsen. Die die Rentabilität weiter abnehmen wird. Die Teilnehmer aus der
Prämieneinnahmen haben sich seit 2006 ebenfalls gleichver- Schweiz prognostizieren zusätzlich sogar einen Rückgang der
laufend entwickelt: Das nominelle Wachstum war von 2007 bis Marktkonzentration.
etwa 2010 rückläufig oder gegen 0% und steigt seither wieder,
wobei Österreich den höchsten Anstieg verzeichnet und die Bezogen auf die Marktbearbeitung geht der Trend dahin, dass
Schweiz den geringsten. Die Schadenquoten sind generell die Dauer der Kundenbeziehung künftig abnehmen wird, weil
leicht gestiegen. In Österreich und in der Schweiz liegt das die Bereitschaft zu einem Wechsel des Kfz-Versicherers zu-
Niveau zwischen 60% und 70%, in Deutschland beinahe bei nimmt. Dies auch, weil erwartet wird, dass die Preissensitivität
100%. Dies zeigt, wie stark der Preiswettbewerb in Deutsch- bzgl. Kfz-Versicherung und die Intensität des Preiswettbe-
land nach wie vor dominiert und wieso viele der Befragten werbs in der Branche zunehmen werden. Damit verbunden
einen künftigen Prämienanstieg für sehr wahrscheinlich halten. sagt die überwiegende Mehrheit einen zunehmenden Markt-
anteil sowohl des Direktvertriebs als auch alternativer Ver-
Strategische Vorgaben und Instrumente: Der strategische triebskanäle voraus.
Fokus liegt klar auf der Rentabilität. Bestandserhaltung und
Wachstum folgen mit deutlichem Abstand auf den Plätzen In der Abschätzung der weiteren Marktentwicklung fällt auf,
zwei und drei. Bei der Entwicklung der Pricing-Bausteine zeigt dass sich die Teilnehmer mehrheitlich einig sind, dass das Pri-
sich, dass die versicherungstechnische Bedarfstarifierung am cing künftig noch spezifischer und die Tarife noch mehr auf das
meisten vorangetrieben wurde. Die weiteren Bausteine Markt- individuelle Risiko ausgerichtet sein werden. Es ist zu erwarten,
zu- und -abschläge, Kundenzu- und -abschläge sowie Under- dass die Entwicklung der Telematik einen Einfluss auf diese Er-
writing/Vertriebsrabatt haben sich deutlich weniger stark wei- wartungshaltung hat. Damit verbunden ist die Einschätzung der
terentwickelt. Der Blick auf die Instrumente für das Pricing- Mehrheit der Teilnehmenden, dass künftig auch Automobilher-
Management bestätigt dieses Bild: Während strategische Inst- steller als Anbieter von Kfz-Versicherungen auftreten werden.
rumente fast bei allen Befragten mindestens teilweise umge-
setzt sind, sind Instrumente zum Market Based Pricing und vor
allem zum Kundenwert und zur Einbindung des Vertriebs erst
bei etwa 20% der Teilnehmer vollständig implementiert.10 | synpulse synpulse | 11
1. Umfrage und Teilnehmer
Der Fragebogen wurde insgesamt an 312 Verantwortliche von Um eine möglichst große Anzahl an Teilnehmenden zu errei-
72 Kraftfahrzeugversicherern (Kfz-Versicherer) verschickt und chen, wurden in den meisten Unternehmen mehrere Personen
im Zeitraum zwischen Ende März 2013 und April 2013 von 47 angeschrieben. Im Fall mehrerer Antworten pro Gesellschaft
Personen aus 31 Unternehmen vollständig beantwortet. Hier- wurden die Einzelantworten bei der Analyse entsprechend ge-
Schweiz 42% Klein 19%
bei handelt es sich um 13 Kfz-Versicherer aus der Schweiz, 10 wichtet bzw. Durchschnittswerte auf Unternehmensebene
aus Deutschland und 8 aus Österreich. In der Schweiz decken verwendet. Dadurch ist sichergestellt, dass jeder Kfz-Versiche-
die teilnehmenden Unternehmen gemessen am Bruttoprä- rer in gleichem Maß zur Studie beitragen kann.
mienvolumen über 90% und damit fast den gesamten Kfz-Ver-
sicherungsmarkt ab.
Mittel 39%
Verglichen mit der 2006 durchgeführten Befragung (Pricing-
Strategien in der Motorfahrzeug-Versicherung) wurde der Fra-
gebogen in der aktuellen Befragung von deutlich weniger Ver-
sicherern aus Deutschland vollständig ausgefüllt. Dies ist aber
vor allem darauf zurückzuführen, dass sich einige kleine Versi-
Deutschland 32%
cherer nicht mehr beteiligt haben. Die Branchenführer haben
auch 2013 an der Studie teilgenommen, ebenso in Österreich.
Letzteres wird auch deutlich, wenn man 2 betrachtet. Wäh-
rend weniger als ein Fünftel der Teilnehmenden unter 100 000
Groß 42%
Kfz-Versicherte (nachfolgend als «kleine Versicherer» bezeich-
net) zählt, verfügen jeweils etwa 40% der Gesellschaften über
100 000 bis 500 000 (mittlere Versicherer) bzw. mehr als 500 000
Kunden (große Versicherer) in der Kfz-Sparte. Eine ähnliche
Größenverteilung ergibt sich, wenn man die teilnehmenden Österreich 26%
Gesellschaften hinsichtlich ihrer Prämienvolumina im Kfz-Be-
reich kategorisiert. Gegenüber 2006 hat der Anteil an Kleinun-
ternehmen in der Stichprobe deutlich abgenommen, der Anteil
an Großunternehmen dagegen zugenommen.
1: Aufteilung der Stichprobe nach Ländern 2: Aufteilung der Stichprobe nach Unternehmensgröße12 | synpulse synpulse | 13
2. Pricing-Framework
In gesättigten Märkten stellt das Pricing eines der wesentli- 2.1.1 Ebene 1 – Ressourcenfundament
chen Elemente für den langfristigen und nachhaltigen Un- Um das Pricing überhaupt auf ein zeitgemäßes Niveau
ternehmenserfolg dar. Pricing hat sich daher im DACH-Raum zu bringen, werden zunächst die relevanten Grundlagen benö-
mittlerweile zu einer komplexen Disziplin entwickelt, die tigt, die das Fundament des Hauses darstellen. Die Grundlagen
Fähigkeiten auf unterschiedlichen Ebenen erfordert. Folg- bestehen dabei aus vier zentralen Elementen:
lich verzichtet die Studie an dieser Stelle auch auf eine wis-
senschaftliche Definition des Pricing-Begriffs. Vielmehr 1 Fähigkeiten: Als Erstes müssen entsprechende Ressourcen
zeigt sie anhand eines Frameworks auf, welche teilweise in- (Kapazität) und die notwendigen Fähigkeiten vorhanden
terdisziplinären Anforderungen heutzutage an das Pricing sein, um die komplexen Anforderungen des Pricings zu
gestellt werden. Im ersten Teil dieses Kapitels zeigt die Stu- bewältigen.
die anhand des Drei-Ebenen-Modells, welche Elemente für
ein umfassendes Pricing benötigt werden. Im zweiten Teil 2 Prozess: In einem nächsten Schritt des Grundlagen-
zeigt die Studie auf, wie diese Elemente in einem Best- aufbaus muss ein Pricing-Prozess etabliert sein, der
Practice-Prozess miteinander verknüpft werden. so in die Organisation integriert ist, dass alle beteiligten
Akteure Einfluss auf die Preisgestaltung nehmen können
und rechtzeitig Informationen dazu erhalten.
2.1 Drei-Ebenen-Modell
3. Tools: Zur Erweiterung der Fähigkeiten sind entsprechende
Umfassendes Pricing basiert auf drei Ebenen, die aufeinander Tools gefordert, die die Entscheidungsfindung zur Preisge-
aufbauen (vgl. 3). In der Folge wird auf jede einzelne Ebene staltung unterstützen.
eingegangen.
Strategische Ebene
Rentabilitätsvorgabe Pricing-Strategie
Pricing-Bausteine
Versicherungs- Loading Marktzu-/ Kundenzu-/ Underwriting und
technischer Bedarf/ -abschläge -abschläge Vertriebsrabatt
Tarifierung
Ressourcenfundament
Fähigkeiten Prozesse und Organisation Tools Datenbasis (intern/extern)
3: Drei-Ebenen-Modell des Pricings14 | synpulse synpulse | 15
4. Datenbasis (intern/extern): Der letzte fundamentale Bau- 5. Underwriting-/Vertriebsrabatt: In einem letzten Schritt 2.2 Pricing-Prozess 1. Klares Marktwissen: Wer ist der Kunde und verhält sich der
stein betrifft die Datenbasis. In erster Linie werden hier erfolgt die Kalkulation der Freiräume in der Rabattierung, Versicherer gegenüber den Wettbewerbern vorteilhaft?
Schadendaten gesehen. Die Entwicklungen im Pricing die direkt vom Vertrieb oder im zentralen Underwriting Pricing ist keine isolierte, in sich geschlossene Tätigkeit. Viel-
zeigen aber, dass zunehmend weitere Datenquellen be- gewährt werden können. Die Freiheit des Vertriebs ist mehr handelt es sich um einen Prozess, der in enger Abstim- 2 Optimale Produkte: Erfüllen die Produkte die Bedürfnisse
nötigt werden, die sowohl aus anderen internen Systemen dabei von genau so großer Bedeutung wie die Steuerung mung mit der Produktentwicklung iterativ durchlaufen wird. Die der Zielkunden und antwortet der Versicherer schlagkräf-
(z.B. Kundenwertmodell, Abwanderungsmodell etc.) als der Marktprämie über systematische Rabattkontingentie- Studie definiert den Pricing-Prozess auf drei Ebenen, die Ziele, tig auf die Anforderungen des Wettbewerbs?
auch aus externen Quellen (z.B. Bonität) stammen. rungen. Prozesse und Methoden beschreiben.
3 Optimale Preise: Orientiert sich der Versicherer in der
2.1.2 Ebene 2 – Pricing-Bausteine 2.1.3 Ebene 3 – Strategische Ebene 2.2.1 Prozessziele Preissetzung ausgewogen zwischen Rentabilitätsvor-
Ist das Fundament gelegt – dies ist allerdings nie abschließend, Wie bereits in den Ebenen 1 und 2 angedeutet, ist die Vorgabe Bei der Betrachtung des Pricing-Prozesses sind zunächst die be- gaben und Marktfähigkeit?
erfolgt das eigentliche Pricing. Dieses basiert auf der Konfigura- einer Pricing-Strategie für das Pricing unerlässlich. Diese Strate- stehenden Prozesse auf ihre Konformität mit der Zielsetzung zu
tion von fünf Bausteinen: gie muss folgende Punkte abdecken: prüfen. Das Setzen dieser Ziele wurde bereits im Drei-Ebe- 4. Durchschlagende Salesstories: Kommuniziert der
nen-Modell – insbesondere auf der strategischen Ebene – aus Versicherer seine Verkaufsargumente nutzenorientiert,
1. Versicherungstechnischer Bedarf: Die Grundlage des 1. Pricing-Grundlagen: Mit den Pricing-Grundlagen werden verschiedenen Perspektiven angesprochen. Diese Zielsetzung einfach und gemäß der angestrebten Positionierung für
Pricings war schon immer der versicherungstechnische die wesentlichen Leitplanken für die Tarifkalkulation kann über zentrale Fragestellungen noch differenzierter be- den Kunden verständlich?
Bedarf, der die künftige Schadenerwartung inklusive vorgegeben. Sie umfassen beispielsweise Wachstums- trachtet werden:
Risikozuschlag basierend auf historischen Schaden- und Rentabilitätsziele sowie deren kalkulatorische 5. Optimale Vertriebsprozesse: Sind die Produkte des
daten darstellt. Grundlagen oder die Regeln zur Akzeptanz von Risiken. Versicherers nahtlos in die Vertriebsprozesse integriert?
2. Loading: Das Loading umfasst die fixen und variablen 2. Marktpositionierung: Neben den internen Zielsetzungen
Kostenteile. Diese werden oft linear auf die Risikoprämie werden Zielsetzungen bezüglich des Markts festgelegt.
aufgeschlagen. Flexiblere Kostenmodelle, z.B. in Form Diese betreffen beispielsweise die Verteilung des Produktemanagement Produkteentwicklung
degressiver, variabler Kostenloadings in Abhängigkeit Bestands, die Definition von Wachstumssegmenten
zur Vertragsprämie, werden noch selten angewendet, heruntergebrochen auf einzelne Zielgruppen, die Aus-
Strategie und Inputquellen Koordination Konzeption und Umsetzung und Markteinführung
dürften aber in Zukunft vermehrt eingesetzt werden. gestaltung der Produkte (Premium- vs. Billiganbieter) Prozess
Vorgaben und -sammlung und Beurteilung Spezifikation Implementierung
sowie die Kanal- und Zugangsstrategie im Vertrieb.
3. Marktzu- und -abschläge: Die interne Sicht auf den
Schadenbedarf ist seit der Deregulierung nicht mehr 3. Unternehmensweite Abstimmung: Die Pricing-Strategie
ausreichend. Sie muss um eine externe Marktdaten- kann nicht isoliert betrachtet werden, sondern bedarf
Vorbereitung Produktentwicklung Durchführung Produktentwicklung
sicht erweitert werden, die die relevanten Wettbewerber einer unternehmensweiten Abstimmung mit anderen
Methoden
widerspiegelt. Darauf basierend werden – in Abstim- Organisationseinheiten. Insbesondere muss sie an der
mung mit der Pricing-Strategie (Ebene 3) – spezifische Unternehmens-, der Marketing- und der Vertriebsstrate-
Marktintelligenz
Anpassungen im Pricing vorgenommen. gie ausgerichtet sein.
4. Kundenzu- und -abschläge: Nach der Ausrichtung des
Pricings auf die Wettbewerbssituation erfolgt eine Durchschlagende Optimale
Ziele Klares Marktwissen Optimale Produkte Optimale Preise
Salesstories Vertriebsprozesse
weitere Ausrichtung – ebenfalls abgestimmt mit der
Pricing- und Marketingstrategie – auf einzelne Kunden-
segmente, Zielgruppen oder Vertriebswege. Portfoliotransparenz
Aktuarielles Pricing Rate Assessing Tarifierungstool
Strategie und Basisprämie Tarifprämie Marktprämie
Preismonitoring Preisdurchsetzung
Vorgaben (Bedarf ) (Tarif ) (Verkauf )
Pricing Controlling und Reporting
4: Prozesslandkarte und Wertschöpfungskette16 | synpulse synpulse | 17
2.2.2 Operative Prozesse Rolle und Aufgaben des Aktuariats: 2.3 Methoden zur Preisfindung 1. Definitionen des Ausschnitts im Produktportfolio für die
Auf Basis der definierten Ziele und der somit ausdifferenzier- 1. Das Aktuariat richtet seinen Blick vorerst nach innen Pricing-Analysen basierend auf der Identifikation des
ten Betrachtung der strategischen Positionierung erfolgt eine (Portfoliotransparenz) und bestimmt die Sollprämie Diese Ausgewogenheit mündet schließlich auch in der best- Handlungsbedarfs zur Sicherstellung der Rentabilität
Umlage auf die bestehenden operativen Prozesse. Der Fokus gemäß messbarem Risiko (aktuarielles Pricing und möglichen Nutzung entsprechender Methoden und Tools. Für oder der Verbesserung der Marktfähigkeit.
sollte dabei auf die Systematisierung der gesamten Produkt- Bedarfsprämienbestimmung) und zur Einhaltung von die Preisfindung respektive den Pricing-Prozess von zentraler
portfoliopflege gelegt werden. Darunter versteht die Studie Rentabilitätsvorgaben. Bedeutung sind die Portfoliotransparenz und die Marktintel- 2. Abbildung des Bestands gemäß dieser Ausschnittsdefini-
die Betrachtung des Produkt- und Preismanagements als ge- ligenz als Inputquellen. Darauf basierend erfolgen das aktua- tion, d.h. Analyse der auf der Datenbank verfügbaren
meinsam interagierende Disziplinen mittels aufeinander ab- 2. Um die Zielsetzungen und die damit einhergehende rielle Pricing und die eigentliche Preisoptimierungsphase, das Merkmale und Aufbau der Datengrundlagen für Pricing-
gestimmter und harmonisierter Rollen und Aufgaben des Pro- Auslotung der Zahlungsbereitschaft sicherzustellen, Rate Assessing. Simulationen, z.B. in Form eines Stichtagsbestands mit
duktmanagements und des Aktuariats. gilt es, bereits auf der nächsten Stufe der Preisfindung allen Tarif- und Risikokriterien.
(Tarifprämienbestimmung) den Blick nach außen zu
Rolle und Aufgaben des Produktmanagements: richten und die entsprechende Koordination mit dem 2.3.1 Kernprozess Rate Assessing 3. Risikomodellierungen und Festsetzung der Bedarfsprä-
1. In der Planung richtet das Produktmanagement seinen Produktmanagement aufzusetzen. Die Definition des Pricing-Prozesses kann als Leitfaden se- mienmodelle. Bestimmt werden dabei (a) die Risikoprä-
Blick stark nach außen (Marktintelligenz) und benötigt quenziell veranschaulicht werden, die Durchführung der Preis- mien aus der Betrachtung zur Schadenlast und -anfällig-
primär Markt-, Wettbewerber- und Kundeninformationen. Auf der dritten Stufe der Preisfindung und hinsichtlich der Si- findung erfolgt jedoch iterativ und kann somit auch als mittel- keit und (b) die Loadings mittels Kostenanalyse und
cherstellung der Preisdurchsetzung unterstützt das Aktuariat und langfristig ausbaufähiger Lernprozess gestaltet werden. -allokation. Im Anschluss erfolgt die Zusammenführung
2. In der Konzeption steht das Produktmanagement das Produktmanagement beim Controlling und bei der Regel- der Modelle zur Abbildung der Bedarfsprämientarife.
stark in der Pflicht der Koordination von Inputquellen, definition für die Marktprämienbestimmung, d.h. beim Ab- Der Kernprozess des Pricings – das Rate Assessing – umfasst
der Sammlung von Informationen und der Eskalation gleich der Markt- mit der Tarif- und der Bedarfsprämie sowie folgende Schritte:
für die Umsetzung – dies oftmals als Gefäß für Input zu bei der Definition von Controllingwerten respektive Rabatt-
Produkt- und Preisaspekten aus dem gesamten Umfeld. kontingenten. Mit einer Vernetzung dieser Rollen und Aufgaben
wird im Rahmen der systematisierten Produktportfoliopflege
3. In der Umsetzung bedarf es aus dem Produktmanage- sichergestellt, dass durch die optimale Nutzung der bestehen-
ment des nahtlosen Anstoßes zur Produktentwicklung den Ressourcen und Fähigkeiten während der Konzeptions- und
und der Pflege der Schnittstellen zu den Produkt- und Umsetzungsphase die Einflussfaktoren Rentabilität und Markt-
Preisentwicklungsplattformen. fähigkeit sowie die gesamte Innen- und Außensicht optimal ge-
wichtet und schließlich ausgewogen in die Preisoptimierung
4. Mit und nach der Markteinführung zeichnet das Produkt- und die Vertriebsprozesse überführt werden.
management dafür verantwortlich, die Erkenntnisse und
Resultate der Produkt- und Tarifüberarbeitungen in die Portfoliotransparenz Marktintelligenz
strategische Planung und das operative Controlling
zurückzuführen, um einen lückenlosen Zyklus in der
Bestandteile Bestandteile
Produktportfoliopflege sicherzustellen.
Aktuarielles Modelling zu Risiko-, Kosten- Markt- und Trendbeobachtung
und Bedarfsprämien
Monitoring der Mitbewerber
Versicherungstechnisches Controlling
Analyse von Kundenaspekten
Closing und Betriebsrechnungen
Zielbild Zielbild
Monitoring des Bestands in seiner gesamten Kontinuierliche und systematische Transparenz über
Entwicklung sowie seiner Verschiebungen innerhalb Marktbearbeitung und Qualitätsunterschiede im
von Branchen, Produkten und Sparten Wettbewerb
Aufschluss über die Segmentierungen und deren Monitoring der Tarifpreise und des realisierten Preisniveaus
Entwicklungen
Aufschluss über die eigene «echte» Position im Markt
Messung des Produkterfolgs und der Effizienz
in den Prozessen Watchlist für Markt- und Trendentwicklung
5: Preisfindungsmethoden18 | synpulse synpulse | 19
4. Abbildung aller übrigen Modelle und Tarife zur Innen- 2.3.2 Prozessdokumentation
und Außensicht. Diese werden abgeleitet aus der Der Kernprozess Rate Assessing wird mit den Umprozessen
Input- und Indiziensammlung der Portfoliotransparenz verknüpft und dementsprechend in die bestehende Prozess-
und Marktintelligenz unter Abbildung aktueller Tarife, landkarte eingefügt. Zwischen den Hauptprozessen werden
von Marktprämien- und Preiselastizitätsmodellen, Kontrollevidenzen definiert, und der Prozessablauf wird über
Ageing-Modellen sowie des vorläufigen Tarifvorschlags. die Pricing-Strategie und die Vorgaben zur Prozessgover-
nance gesteuert.
5. Definitionen von Berechnungen und Reports. Dies
bedeutet den Aufbau des Datenmodells und der Die Abbildung des Gesamtprozesses erfolgt auf der Zeitach-
Algorithmen für die strukturierte Pricing-Analyse se und unter entsprechender Berücksichtigung von Schnitt-
und für Grundsatzdefinitionen zum Tarif - respektive stellen- und Release-Abhängigkeiten. Die einzelnen Prozess-
zum Modellabgleich. schritte werden mittels Beschreibungen und Checklisten
definiert sowie mit der Nennung von Verantwortlichkeiten
6. Definitionen von Ergebnisbildern, d.h. Festlegen einer und notwendigen Funktionen vervollständigt.
einheitlichen Betrachtung der Berechnungen und
Reports zur Analyse der Rentabilität, der Quersubven- Abschließend werden je Prozessschritt die anzuwendenden
tionierungen und der Marktfähigkeit respektive zur Tools und Werkzeuge beschrieben. Zwecks Vertiefung des
Messung von Auswirkungen und von Veränderungen für das gesamte Nichtlebengeschäft generischen Prozesses
zwischen aktuellem Tarif und Tarifvorschlag. findet die spartenspezifische Dokumentation zu den Daten-
grundlagen statt. Mit jeder Tarifrunde respektive bei jedem
7. Definitionen der Ergebniszusammenführung zwecks Pricing-Projekt werden das Vorgehen und die Dokumenta-
Bestimmung des neuen Tarifs. Darunter versteht die tionen auf den Prüfstein gestellt und fortlaufend optimiert.
Studie risikodifferenzierte respektive segmentspezifi-
sche Tarifsteuerungsanalysen aus kombinierten
Rentabilitäts- und Marktfähigkeitsbetrachtungen,
portfolio- oder spartenspezifische Tarifauswirkungs-
analysen auf dem tangierten Bestand sowie Ableitun-
gen in Zeitreisenanalysen zwecks Planung und
Reporting.20 | synpulse synpulse | 21
3. Entwicklungen im Kfz-Versicherungsmarkt anzumerken, dass mit der Sympany 2009 erstmals ein Kran-
kenversicherer unter eigenem Namen in das Sachversiche-
3.1.2 Konzentration der Marktteilnehmer
Wie unter 3.1.1 erwähnt, ist die Anzahl der Marktteilnehmer im
rungsgeschäft eingestiegen ist und seither ebenfalls Kfz-Versi- deutschen Kfz-Markt am größten. Entsprechend liegt auch die
cherungen anbietet. Vermutung nahe, dass die Marktkonzentration angesichts der
hohen Anzahl gering ist. Tatsächlich zeigt sich, dass die Konzen-
Nachdem der Fragebogen der Studie so aufgesetzt ist, dass Im österreichischen Kfz-Versicherungsmarkt hat sich die tration im Vergleich zu den anderen beiden Märkten tiefer ist.
eine teilweise Vergleichbarkeit mit den Werten aus der Umfra- Anzahl der Marktteilnehmer im Beobachtungszeitraum dage-
Die Marktkonzentrationen haben sich Dennoch ist beachtenswert, dass die Top-Ten-Gesellschaften
ge von 2006 möglich ist, sollen zunächst einmal die Entwick- gen um zwei Gesellschaften auf 24 erhöht. Neu hinzugekom-
kaum verändert. In Deutschland ist am gemessen am Bruttobeitragsvolumen einen Marktanteil von
lungen in den einzelnen Märkten seit 2006 betrachtet werden. men sind 2008 Call Direct und 2009 Muki. Die Anteile dieser
ehesten mit einer zunehmenden 50% vereinen. Im Vergleich zu 2006 entspricht dies einer Zunah-
Diese können bereits erste Hinweise für eine Interpretation beiden neuen Versicherungsgesellschaften am österreichi-
Konzentration zu rechnen. me um drei Prozentpunkte (vgl. 6).
der Ergebnisse aus der Umfrage liefern. Die Betrachtung er- schen Markt sind jedoch noch gering.
folgt nach Ländern getrennt und untersucht sowohl die Prä- Als Fazit kann gefolgert werden, dass die Kfz-Versicherungs- In Österreich ist die Marktkonzentration deutlich höher als
mienseite als auch die Schadenseite. Zugleich werden auch märkte in allen Ländern gesättigt zu sein scheinen. Entgegen in Deutschland. Die Top-Ten-Gesellschaften repräsentieren
Die Kfz-Märkte sind in allen betrachteten
die Marktstrukturen miteinander verglichen, da sich hier teil- den Erwartungen fand aber keine größere Konsolidierung 86% des Markts, die Top-Five-Gesellschaften ganze 66%. Die
Ländern gesättigt. Aber entgegen
weise deutliche Unterschiede zeigen. statt. Deutschland als Markt mit der größten Anzahl an leichte Erhöhung der Zahl der Marktteilnehmer kann jedoch ein
den Erwartungen fand keine größere
Marktteilnehmern ist im Verhältnis zur Größe mit einem Grund sein, dass – anders als in Deutschland – die Marktkon-
Konsolidierung statt.
Rückgang von knapp 4% am stabilsten geblieben. Der öster- zentration mit minus einem Prozentpunkt gegenüber 2006
3.1 Vergleich Marktstrukturen reichische Markt ist absolut gesehen sogar noch gewachsen, leicht abgenommen hat.
Im Schweizer Kfz-Versicherungsmarkt hat sich die Anzahl der und in der Schweiz sind mit dem Eintritt von zwei neuen Di-
Bevor die Studie auf die einzelnen Spezifika der jeweiligen Marktteilnehmer seit 2006 ähnlich wie in Deutschland leicht rektversicherungen sowie der Expansion eines Krankenversi- Die Anzahl der Marktteilnehmer ist in der Schweiz beinahe
Märkte eingeht, vergleicht sie diese zunächst miteinander und reduziert. Der absolute Rückgang beträgt zwei Versicherungs- cherers ebenfalls neue Player in den Markt eingetreten, gleich hoch wie in Österreich. In der Marktkonzentration zeigen
legt das Augenmerk auf die Anzahl der Marktteilnehmer und gesellschaften. Im Total ergibt das 21 aktive Marktanbieter. wenngleich auch einige Anbieter vom Markt verschwunden sich jedoch deutliche Unterschiede. Die Top-Five-Gesellschaf-
deren Konzentration. Speziell zu erwähnen sind zwei Ereignisse: Zum einen die gro- sind. Interessant ist, dass diese neuen Marktplayer versu- ten vereinen einen Marktanteil von 78%, der sich seit 2006 auch
ße Übernahme der Winterthur durch die AXA 2006, die den chen, sich über innovative Konzepte und alternative Ver- nicht verändert hat. Damit liegen sie mehr als zehn Prozent-
3.1.1 Anzahl Marktteilnehmer Markt nachhaltig geprägt hat, sowie der Kauf und die Integra- triebskanäle zu positionieren. Aktuell reichen diese Konzepte punkte über der Marktkonzentration von Österreich. Die
Im deutschen Kfz-Versicherungsmarkt hat sich die Anzahl der tion der beiden kleineren Gesellschaften Alba und Phenix noch nicht aus, um große Umwälzungen im Markt zu erzeu- Top-Ten-Gesellschaften besitzen bereits einen Marktanteil von
Unternehmen in den letzten sechs Jahren um vier Versiche- durch die Helvetia 2010. Im Direktversicherungsgeschäft ist die gen. Es zeigt aber, dass die Eintrittsbarrieren relativ gering 99%, so dass die restlichen zwölf Gesellschaften ein Marktvolu-
rungsgesellschaften reduziert. Insgesamt bieten im deutschen Anzahl der Marktplayer mit dem Markteintritt von Allianz24 sind, und mit der Entwicklung und Verbreitung weiterer Tech- men von 1% unter sich ausmachen.
Kfz-Markt nun 99 Gesellschaften Versicherungslösungen an. 2008 sowie von iDirect24 2012 auf fünf gewachsen. Weiter ist nologien, wie zum Beispiel der Versicherungstelematik, ist
absehbar, dass neue Nischenplayer mit spezifischen Pricing- Zusammenfassend lässt sich sagen, dass sich keine wesentli-
und Produktangeboten in die Märkte eintreten werden. chen Veränderungen in der Marktkonzentration abzeichnen.
Deutschland verzeichnet den größten Zuwachs in der Markt-
konzentration. Dies deutet darauf hin, dass in diesem Markt am
ehesten mit weiteren Konsolidierungen zu rechnen ist.
Deutschland (DE)
34 16 50 %
2011
32 15 53 %
2006
Österreich (AT) 66 20 14 %
2011
67 20 13 %
2006
Schweiz (CH) 78 21 1 %
2011
78 19 3 %
2006
Top-5 Top-6–10 Rest
6: Marktkonzentration22 | synpulse synpulse | 23
3.2 Kfz-Markt Deutschland den Jahren des Beobachtungszeitraums wieder etwas erholt Moment zu bewältigen hat. Die starken Ausschläge im Scha- Das steigende Schadenvolumen kann durch
und entspricht dem Stand von 2007 (vgl. 7). denwachstum resultieren aus den übrigen Kfz-Versicherun- das ebenfalls gestiegene Prämienvolumen
3.2.1 Marktplayer gen. Die Haftpflichtschäden sind zwischen 2006 und 2011 nur nicht kompensiert werden. Die Branche
Gemessen am verdienten Bruttobeitrag ist die Allianz die klare In den Branchen Kfz-Haftpflicht respektive übrige Kfz-Versi- um EUR 120 Mio. gestiegen. arbeitet nach wie vor unprofitabel.
Nummer eins in Deutschland. Im sonst stark fragmentierten cherungen ist der oben beschriebene Trend ebenfalls sicht-
Markt hat sie ihren Marktanteil sogar noch um zirka einen Pro- bar. Jedoch liegt das Wachstum der übrigen Kfz-Versicherun- Die Schadenquote ist im Beobachtungszeitraum total um über
zentpunkt auf 14.5% ausgebaut. Die HUK Coburg (Allgemeine gen immer über dem Wachstum der Kfz-Haftpflicht. Zudem neun Prozentpunkte gestiegen (vgl. 9). Sie ist mit 98% sehr
und VVaG) folgt an zweiter Stelle mit einem Marktanteil von sind die Ausschläge im Wachstum in der Kfz-Haftpflichtversi- hoch. Haupttreiber sind die übrigen Kfz-Branchen, bei denen 3.2.5 Zusammenfassung
9.7%. Sie konnte ihren Marktanteil im Beobachtungszeitraum cherung deutlich größer. die Schadenquote um über 15 Prozentpunkte gestiegen ist. Der deutsche Kfz-Versicherungsmarkt zeichnet sich seit Jahren
nicht ausbauen und hat 0.3 Prozentpunkte verloren. Im weite- Der Anstieg im Haftpflichtbereich ist dagegen mit fünf Pro- durch einen starken Wettbewerb unter den Gesellschaften aus,
ren Ranking folgen AXA (5.6%), VHV (4.3%), R+V (3.8%) und LVM Die Durchschnittsprämien der Haftpflicht, Vollkasko und Teil- zentpunkten relativ moderat. Solche Schadenquoten sind auf der sich vor allem über den Preis definiert. Die Verschlechterung
(3.8%). Aufgrund der geringfügigen Unterschiede bei den kasko sanken von 2006 bis 2011 im Schnitt um 9.5%. Die die Dauer nur über Quersubventionen durch andere Bran- der Rentabilität um über neun Prozentpunkte lässt die Gesamt-
Marktanteilen gab es leichte Verschiebungen im Ranking ge- Reduktion der Durchschnittsprämie betrifft die einzelnen chen aufrechtzuerhalten. Werden die Kosten für den Ab- branche unrentabel werden und kann auf die Dauer nicht auf-
genüber 2006, wobei, abgesehen von LVM, alle Gesellschaften Deckungen gleichermaßen. Als Grund dafür kann der harte schluss und den Betrieb hinzuaddiert, bleibt die Sparte rechterhalten werden. Zusätzlich haben sich die Ertragsmög-
einen leichten Marktanteilszuwachs verzeichneten. Auf den Preiswettbewerb angeführt werden, der zwischen den einzel- Kfz-Versicherung unprofitabel. lichkeiten am Finanzmarkt über die letzte Krise hinweg
weiteren Rängen der Top Ten folgen DEVK (3.1%), ERGO (3.0%) nen Gesellschaften geführt wurde. erschwert. Die nächsten Jahre werden zeigen, ob der Zyklus
und Generali (2.7%). Ein Versicherungszyklus ist in Deutschland insofern nicht er- durchbrochen werden kann oder ob eine Konsolidierungswelle
Im deutschen Markt werden gut 60% der Prämien für die kennbar, als sich die Schadenquote nur in eine Richtung ent- in der deutschen Assekuranz bevorsteht.
3.2.2 Fahrzeugbestand Kfz-Haftpflicht und 40% für die übrigen Kfz-Versicherungen wickelt hat. Die kommenden Jahre werden weisen, ob sich
Der Personenwagen-Fahrzeugbestand hat sich in den letzten eingenommen. Der Trend zeigt aber eine leichte Verschie- eine Beruhigung im deutschen Versicherungsmarkt einstellt
vier Jahren trotz Wirtschaftskrise gemessen an der Anzahl zu- bung der Prämieneinnahmen zulasten der Haftpflichtbran- oder ob sich der Trend aus den letzten Jahren fortsetzen wird.
gelassener Fahrzeuge noch weiter entwickelt. Mit einer Aus- che. Im Beobachtungszeitraum ging der Anteil um 1.6 Pro-
nahme im Jahr 2007 betrug das nominelle Wachstum jeweils zentpunkte zurück.
mindestens 0.75%. Somit ist der Fahrzeugbestand im Schnitt
um über 300 000 Fahrzeuge pro Jahr gestiegen. 3.2.4 Schadenseite
Die Schadenentwicklung hat mit Ausnahme von 2006 und 24 12%
3.2.3 Prämien 2009 stetig zwischen 1.6% und 3.3% pro Jahr zugenommen
Schadenvolumen in Mrd. EUR
21 10%
Nominelles Wachstum
Die deutsche Kfz-Versicherungswirtschaft schaffte den Prämi- (vgl. 8). Insgesamt stiegen die Schäden zwischen 2006 und 18 8%
en-Turnaround 2010. Nach einem deutlichen Rückgang im Prä- 2011 um EUR 1.7 Mrd. Die Kombination von sinkenden Durch- 15 6%
mienvolumen um EUR 2 Mrd. auf EUR 20.05 Mrd. in den Jahren schnittsprämien und steigenden Schadenkosten ist eine der 12 4%
2006 bis 2009 hat sich das Prämienvolumen in den letzten bei- größten Herausforderungen, die die deutsche Assekuranz im
9 2%
6 0%
3 –2%
0 –4%
2006 2007 2008 2009 2010 2011
Kfz Total Kfz Haftpflicht Kfz Übrige Kfz Total Kfz Haftpflicht Kfz Übrige
8: Entwicklung Schadenvolumen Deutschland
24 4%
21 3%
Prämienvolumen in Mrd. EUR
18
Nominelles Wachstum
2% 110%
15 1% 105%
100%
12 0%
95%
9 –1%
90%
6 –2% 85%
–3% 80%
3
75%
0 –4%
2006 2007 2008 2009 2010 2011 70%
2006 2007 2008 2009 2010 2011
Kfz Total Kfz Haftpflicht Kfz Übrige Kfz Total Kfz Haftpflicht Kfz Übrige Total Haftpflicht Übrige
7: Entwicklung Prämienvolumen Deutschland 9: Entwicklung Schadenquoten Deutschland24 | synpulse synpulse | 25
3.3 Kfz-Markt Österreich 3.3.3 Prämien 3.3.4 Schadenseite Der Anstieg der Schadenquote wird mehrheitlich durch die Ver-
Nach moderaten Wachstumsjahren bis 2007 nahm das Prä- Die Schadenentwicklung verlief im Beobachtungszeitraum schlechterung des versicherungstechnischen Resultats der üb-
3.3.1 Marktplayer mienvolumen zwischen 2008 und 2010 ab. 2011 stiegen die sehr volatil, wobei ein Trend zu höheren Schadenaufwendun- rigen Kfz-Versicherungen getrieben. Die Schadenbelastung in
Gemessen am Prämienvolumen ist die Generali mit einem Prämieneinnahmen im Kfz-Versicherungsmarkt wieder stark gen erkennbar ist. Insgesamt hat die Schadenlast über beide diesen Branchen nahm im Beobachtungszeitraum um knapp
Marktanteil von 19.1% mit deutlichem Abstand die Marktfüh- um 4.7 Prozentpunkte (vgl. 10). Branchen hinweg um 8.9 Prozentpunkte über die letzten zehn Prozentpunkte zu. Die Haftpflichtschäden dagegen sind
rerin im österreichischen Kfz-Versicherungsmarkt. Dahinter sechs Jahre zugenommen (vgl. 11). Die Zunahme resultiert mit 1.1 Prozentpunkten nur moderat gewachsen (vgl. 12).
folgen UNIQA Sach und Allianz Elementar mit einem Marktan- Aufgeteilt auf die Branchen Kfz-Haftpflicht respektive übrige aus den übrigen Kfz-Versicherungsbranchen. Die Schaden-
teil von 14.4% respektive 14.5%. Alle drei Versicherer konnten Kfz-Versicherungen ist der oben beschriebene Trend insbe- kosten stiegen in dieser Branche überproportional zu den 3.3.5 Zusammenfassung
ihren Marktanteil im Beobachtungszeitraum nicht halten und sondere in der Kfz-Haftpflichtversicherung sichtbar. Die übri- Prämieneinnahmen. Der österreichische Kfz-Markt präsentiert sich in einem aus-
verloren zwischen 0.8 und 1.4 Prozentpunkte. Unter den Top- gen Kfz-Versicherungen verzeichneten zwar ebenfalls einen gesprochen guten Zustand bezogen auf Rentabilität und
Ten- Versicherungsgesellschaften steigerten über die Jahre Wachstumsrückgang, blieben aber im positiven Bereich. 2011 Wachstum. Ein ausgeprägter Versicherungszyklus mit stark
Die Schadenkosten der übrigen Kfz-
einzig die Donau Versicherung (+3.2 Prozentpunkte) und die war das Wachstum in beiden Branchen praktisch identisch. fluktuierenden Schadenquoten ist nicht erkennbar. Die in der
Versicherungen stiegen überproportional
Zürich (+1.4 Prozentpunkte) ihren Marktanteil. Das untere Ende Branche oft geäußerten Bedenken eines ausgeprägten Preis-
zu den Prämieneinnahmen.
bildet das Quartett Grawa (4.1%), Wüstenrot (3.3%), Oberöster- Im österreichischen Markt werden gut 60% der Prämien für die wettbewerbs sind aufgrund der Analyse der vorliegenden
reichische (3.1%) und die HDI Versicherung (3.1%). Ihr Marktan- Kfz-Haftpflicht und 40% für die übrigen Kfz-Versicherungen Zahlen widerlegt.
teilsverlust betrug zwischen 0.1 und 0.9 Prozentpunkte. eingenommen. Der Trend zeigt aber eine stärkere Verschie- Die Schadenquote ist im Beobachtungszeitraum total um 4.3
bung der Prämieneinnahmen zu Lasten der Haftpflichtbran- Prozentpunkte gestiegen. Sie ist mit 67.2% weiterhin relativ tief.
3.3.2 Fahrzeugbestand che. Im Beobachtungszeitraum ging der Anteil um 3.8 Prozent-
Der Personenwagen-Fahrzeugbestand hat seit 2006 trotz punkte zurück.
Wirtschaftskrise gemessen an der Anzahl zugelassener Fahr- 3.0 17.5%
zeuge weiter zugenommen. Mit Ausnahme von 2007 und 2008
2.7 15.0%
betrug das nominelle Wachstum immer über 1.5%. Somit stieg
2.4
Schadenvolumen in Mrd. EUR
12.5%
der Fahrzeugbestand im Schnitt absolut um etwa 54 000 Fahr-
Nominelles Wachstum
2.1 10.0%
zeuge pro Jahr.
1.8 7.5%
1.5 5.0%
1.2 2.5%
0.9 0%
0.6 –2.5%
0.3 –5.0%
0.0 –7.5%
2006 2007 2008 2009 2010 2011
Kfz Total Kfz Haftpflicht Kfz Übrige Kfz Total Kfz Haftpflicht Kfz Übrige
11: Entwicklung Schadenvolumen Österreich
3.0 7%
2.7 6%
90%
2.4 5%
Nominelles Wachstum
85%
Prämien in Mrd. EUR
2.1 4%
1.8 80%
3%
75%
1.5 2%
1.2 1% 70%
0.9 0% 65%
0.6 –1% 60%
0.3 –2% 55%
0.0 –3% 50%
2006 2007 2008 2009 2010 2011 2006 2007 2008 2009 2010 2011
Kfz Total Kfz Haftpflicht Kfz Übrige Kfz Total Kfz Haftpflicht Kfz Übrige Kfz Total Kfz Haftpflicht Kfz Übrige
10: Entwicklung Prämienvolumen Österreich 12: Entwicklung Schadenquoten Österreich26 | synpulse synpulse | 27
3.4 Kfz-Markt Schweiz lung des Fahrzeugbestands abgeleitet werden, andererseits punkte gestiegen. Mit 65% ist sie weiterhin relativ tief. Durch 3.4.5 Zusammenfassung
hat sich der Preiswettbewerb nach den guten Jahren bis 2007 die stetige Verbesserung der Haftpflichtschadenquote rentiert Im Gegensatz zu den anderen europäischen Ländern ist der
3.4.1 Marktplayer erheblich verschärft. Im Jahr 2011 nahmen die Prämienein- die Branche seit 2010 insgesamt wieder besser als 2009 Versicherungszyklus in der Schweiz moderat und es wurden
Gemessen an der verdienten Bruttoprämie ist die AXA Wintert- nahmen im Kfz-Versicherungsmarkt wieder um 2% zu. (vgl. 15). Der Versicherungszyklus mit stark fallenden res- im Beobachtungszeitraum keine negativen Versicherungsre-
hur mit einem Marktanteil von 22.7% Marktführerin im Schwei- pektive steigenden Schadenquoten ist in der Schweiz nur sultate geschrieben. Mögliche Gründe dafür sind einerseits
zer Kfz-Versicherungsmarkt. Dahinter folgt die Zurich mit leicht ausgeprägt. mangelnder Wettbewerb aufgrund der Einsicht, dass sich mit-
Die Schadenquote liegt konstant zwischen
19.8%. Der Marktanteil der Zurich ist im Beobachtungszeit- tels eines reinen Preiswettbewerbs keine signifikanten Markt-
60% und 70% und ermöglicht damit einen
raum um rund 1.3 Prozentpunkte zurückgegangen. Somit ist Ausschlaggebend für die Schwankungen sind die übrigen Ver- anteile gewinnen lassen. Andererseits ist der Schweizer Markt
profitablen Markt.
sie die große Verliererin. Die drittplatzierte Allianz Suisse sicherungsleistungen. Mit großer Wahrscheinlichkeit sind Un- dominiert von Gesellschaften mit großem Geschäftsanteil im
(Marktanteil 14.8%) wird bedrängt von der Mobiliar (13.5%). Die wetterkatastrophen wie Hagel oder strenge Winter dafür ver- Ausland. Die Schweizer Ländergesellschaft fungiert in diesen
Mobiliar gehört neben der Helvetia mit einem Marktanteilzu- In den einzelnen Branchen Kfz-Haftpflicht respektive übrige antwortlich. Die Entwicklung in den Haftpflichtschäden ist im Gesellschaften als Cashcow und steuert im Vergleich zum Prä-
wachs von 1.5 Prozentpunkten respektive einem Prozentpunkt Kfz-Versicherungen ist der oben beschriebene Trend ebenfalls Beobachtungszeitraum bis auf das Jahr 2009 abnehmend. Die mienanteil einen beachtlichen Anteil an den Reingewinn die-
zu den Gewinnerinnen. Mit rund halb so großen Anteilen fol- sichtbar. Jedoch sind die übrigen Kfz-Versicherungsleistungen Aufwendungen für Haftpflichtschäden gingen um über CHF ser Gesellschaften bei. Der Wachstumsdruck wird zugunsten
gen Basler (7.5%) sowie Generali (7.1%). Die vier kleinsten Play- ab 2009 mit knapp 0.5 Prozentpunkten deutlich stärker ge- 200 Mio. zurück. Dies ist vor allem auf eine Veränderung der von höheren Margen in diesen internationalen Gesellschaften
er unter den Top-Ten-Versicherern, Vaudoise (4.9%), Nationale wachsen als die Haftpflichtversicherung. Im Gegensatz zu Gerichtspraxis für Entschädigung bei Halswirbelsäulen-Verlet- gemindert.
Suisse (4.3%), Helvetia (4.0%) und Emmentalische (0.2%), sind Deutschland und Österreich werden im Schweizer Markt zungen zurückzuführen.
zusammen knapp so groß wie die Mobiliar. knapp gleich viele Prämien für Kfz-Haftpflicht und übrige
Kfz-Versicherungen eingenommen, wobei die übrigen Kfz-Ver-
3.4.2 Fahrzeugbestand sicherungen sogar jeweils leicht überwiegen. Über den gesam-
Der Personenwagen-Fahrzeugbestand ist in den letzten vier ten Beobachtungszeitraum hat sich an dieser Verteilung kaum
Jahren gemessen an der Anzahl zugelassener Fahrzeuge ge- etwas verändert. Dies zeigt, wie stabil der Schweizer Kfz-Markt
4.0 35%
stiegen. Mit Ausnahme von 2008 und 2009 lag das nominelle insgesamt ist.
3.6 30%
Wachstum jeweils zwischen 1% und 2%. Der absolute Fahr-
Schadenvolumen in Mrd. CHF
3.2 25%
zeugbestand stieg damit im Schnitt um etwa 50 000 Fahrzeuge 3.4.4 Schadenseite
Nominelles Wachstum
2.8 20%
pro Jahr. Die Schadenentwicklung verläuft mit Ausnahme eines starken
2.4 15%
Anstiegs 2009 relativ konstant. Die Wachstumsraten sind 2006,
2.0 10%
3.4.3 Prämien 2007 und 2010 sogar negativ (vgl. 14).
1.6 5%
Nach starken Wachstumsjahren bis 2007 kam das Prämien-
1.2 0%
wachstum zwischen 2008 und 2010 praktisch zum Erliegen Im Beobachtungszeitraum ist die Schadenquote aufgrund ei-
0.8 –5%
(vgl. 13). Einerseits kann dies aus der schlechten Entwick- nes starken Anstiegs im Jahr 2009 total um rund fünf Prozent-
0.4 –10%
0.0 –15%
2006 2007 2008 2009 2010 2011
Kfz Total Kfz Haftpflicht Kfz Übrige Kfz Total Kfz Haftpflicht Kfz Übrige
14: Entwicklung Schadenvolumen Schweiz
6.0 4.0%
5.4 3.5%
4.8 3.0%
Nominelles Wachstum
Prämien in Mrd. CHF
4.2 2.5%
80%
3.6 2.0%
75%
3.0 1.5%
70%
2.4 1.0%
65%
1.8 0.5%
60%
1.2 0.0%
55%
0.6 –0.5%
–1.0% 50%
0.0
2006 2007 2008 2009 2010 2011 45%
Kfz Total Kfz Haftpflicht Kfz Übrige Kfz Total Kfz Haftpflicht Kfz Übrige 40%
2006 2007 2008 2009 2010 2011
Kfz Total Kfz Haftpflicht Kfz Übrige
13: Entwicklung Prämienvolumen Schweiz 15: Entwicklung Schadenquoten Schweiz28 | synpulse synpulse | 29
4. Studienergebnisse In der Weiterentwicklung des «Competitive Pricing» gibt es
starke länderspezifische Unterschiede. So war das «Competiti-
4.1.2 Weiterentwicklungsbedarf
In der vorliegenden Studie wurden die Versicherungsunter-
ve Pricing» für 45% der Schweizer Versicherungsunternehmen nehmen zudem gefragt, in welchem der Faktoren sie den größ-
der Baustein mit der größten oder zweitgrößten Weiterent- ten Weiterentwicklungsbedarf in der Zukunft sehen. Erwar-
wicklung und für weitere 35% gab es zumindest mittlere oder tungsgemäß nennt die große Mehrheit der Teilnehmenden
Die Struktur der Studie ist etwa gleich aufgebaut wie 2006 und und von kundenspezifischen Zu- und Abschlägen kaum Be- geringfügige Fortschritte. Dagegen haben 55% der Unterneh- Bausteine, die in ihrem Unternehmen in den vergangenen Jah-
orientiert sich am Drei-Ebenen-Modell gemäß Kapitel 2.1. achtung geschenkt. 49% bzw. 35% vergeben diesen beiden men in Deutschland die Methoden zur Berechnung der markt- ren nur wenig oder gar nicht weiterentwickelt wurden, es gibt
Eingegangen wird dabei zunächst auf das Zusammenspiel der Bausteinen sogar gar keinen Rang, d.h. sie beziehen die Fakto- bezogenen Zu- und Abschläge gar nicht weiterentwickelt, was aber auch einzelne Ausnahmen. Am häufigsten wird das «Com-
Pricing-Bausteine und auf die strategische Ebene, während ren nicht in ihre Ordnung mit ein. Dies kann daran liegen, dass angesichts des harten Preiswettbewerbs umso mehr erstaunt. petitive Pricing» genannt (37% der Teilnehmenden), gefolgt
einzelne Bausteine – Versicherungstechnik, Marktsicht und es in diesen Bereichen keine Veränderungen gab. Außerdem In Österreich ist das Bild zweigeteilt: Einerseits sagen 43% der von der «versicherungstechnischen Bedarfsermittlung» und
Kundensicht – im Anschluss folgen. Abgeschlossen werden die illustriert es, dass viele Gesellschaften noch nicht alle Möglich- Gesellschaften aus, dass sie das «Competitive Pricing» am der «Berücksichtigung von Kundenwerten» (26% bzw. 23%).
Studienergebnisse mit den Erwartungen der Teilnehmenden keiten verwenden, die ein modernes Pricing bieten würde. stärksten oder zweitstärksten weiterentwickelt haben, ande-
an die künftige Entwicklung dieser Bausteine. rerseits bekennen 45%, keinerlei Verbesserungen vorgenom-
men zu haben.
70% der Versicherer haben in den letzten
4.1 Pricing-Bausteine Jahren vor allem in die klassischen
Werkzeuge des Pricings investiert.
4.1.1 Vergangene Entwicklung Versicherungstechnischer Bedarf / Tarifierung (Aktuariat) Marktzu-/-abschläge (Competitive Pricing)
Um ein Bild von den jüngsten Entwicklungen im Pricing-Pro- Das Ergebnis der starken Weiterentwicklung im Bereich der
71 16 3 5 5 % 15 18 18 12 5 32 %
zess zu bekommen, wurden die Unternehmen zunächst gebe- versicherungstechnischen Bedarfsermittlung ist überra-
Alle Alle
ten, die einzelnen Faktoren danach zu ordnen, wie stark sie in schend, da es impliziert, dass die große Mehrheit der Gesell-
89 11 % 11 23 11 11 44 %
den letzten Jahren weiterentwickelt wurden. Wie in 16 schaften vor allem in den Baustein investiert hat, der bereits
DE DE
ersichtlich ist, wurde die versicherungstechnische Bedarfser- am stärksten entwickelt und optimiert ist. Es zeigt, dass die
71 7 7 15 % 14 29 5 7 45 %
mittlung bei über 70% der Versicherer am stärksten vorange- Tarifierung von den meisten Versicherern auch in den letzten
AT AT
trieben, und bei weiteren 16% war dies der Faktor mit der Jahren als der mit Abstand wichtigste Faktor in der Preisge-
58 25 3 2 12 % 28 17 22 13 4 16 %
zweitstärksten Veränderung. Außerdem hat knapp die Hälfte staltung betrachtet wurde. Dieses Resultat deckt sich mit dem
CH CH
der Unternehmen erhebliche Fortschritte bezüglich der Ein- Ergebnis der Erhebung 2006, als – in einer etwas anderen Fra-
bindung des Vertriebs in den Prozess der Preisgestaltung er- gestellung – 77% der Teilnehmenden die aktuarielle Bedarfs-
zielt, und zumindest ein Drittel der Gesellschaften hat den ermittlung als wichtigsten Bestandteil im Prozess der Preisfin-
Loading (Aufschlagen von Kosten/Sollmarge) Kundenzu-/-abschläge (Einbeziehung Kundenwertmodelle)
Faktor «Competitive Pricing» – damit ist der Einbezug von dung angaben. Obschon 2006 zwei Drittel der Unternehmen
Markt- und Wettbewerbsdaten in die Preisgestaltung gemeint den Marktpreis als erst- oder zweitwichtigste Preisdetermi- 2 9 13 11 16 49 % 5 14 12 16 18 35 %
– stark weiterentwickelt. Dagegen hat die große Mehrheit der nante genannt haben, hat lediglich ein Drittel der Gesellschaf- Alle Alle
Unternehmen den Methoden zur Berechnung des Loadings ten das «Competitive Pricing» nennenswert verbessert. 22 11 67 % 11 11 22 56 %
DE DE
7 5 12 33 7 36 % 7 21 15 7 26 24 %
AT AT
2 25 6 24 43 % 8 13 12 13 27 27 %
CH CH
Rang 1 Rang 2 Rang 3 Rang 4 Rang 5 kein Rang Underwriting/ Vertriebsrabatt
6 42 29 12 5 6 %
Alle
11 44 33 12 %
DE
38 43 7 7 5 %
AT
6 42 15 25 12 %
CH
16: Entwicklung Pricing-Bausteine nach LändernSie können auch lesen