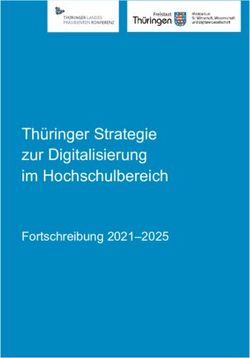Projektauftrag IT-Bildungsoffensive: Schwerpunkt III "Kompetenzzentrum Angewandte Digitalisierung"
←
→
Transkription von Seiteninhalten
Wenn Ihr Browser die Seite nicht korrekt rendert, bitte, lesen Sie den Inhalt der Seite unten
RRB 2020/421 / Beilage Projektauftrag IT-Bildungsoffensive: Schwerpunkt III «Kompetenzzentrum Angewandte Digitalisie- rung» Auftraggeberin: Regierung Datum des Projektauftrags: 26. Mai 2020 Verfasserin: OST – Ostschweizer Fachhochschule
RRB 2020/421 / Beilage
Inhaltsverzeichnis
1 Zusammenfassung 4
2 Vorgeschichte und Ausgangslage 4
3 Problem- und Aufgabenstellung 5
4 Anspruchsgruppen 7
5 Ziele 7
5.1 Rahmenbedingungen 7
5.1.1 Politische Rahmenbedingungen 7
5.1.2 Rechtliche Rahmenbedingungen 7
5.1.3 Finanzielle Rahmenbedingungen 8
5.1.4 Personelle Rahmenbedingungen 8
5.2 Projektziele 8
5.2.1 Ziele Teilprojekt 1: «Innovative Lehr- und Lernumgebung» 8
5.2.2 Ziele Teilprojekt 2: «Markterweiterung Informatikangebot» 10
5.2.3 Ziele Teilprojekt 3: «Interdisciplinary Center for Artificial Intelligence» (ICAI) 10
6 Berührungspunkte zu anderen Projekten und Vorhaben 11
7 Projektabwicklung 12
7.1 Projektorganisation und -controlling 12
7.1.1 Organigramm 12
7.1.2 Organe 12
7.1.3 Verantwortlichkeiten und Aufgaben Projekt-Auftraggeberin 13
7.1.4 Verantwortlichkeiten und Aufgaben Projektausschuss 13
7.1.5 Verantwortlichkeiten und Aufgaben Projektleitung 13
7.1.6 Verantwortlichkeiten und Aufgaben Teilprojektleitungen 14
7.1.7 Verantwortlichkeiten und Aufgaben der Stelle Qualitätssicherung und
Risikomanagement 14
7.2 Zeitplan 14
7.3 Projektumfang und -struktur 16
7.3.1 Teilprojekt 1: «Innovative Lehr- und Lernumgebung» 16
7.3.2 Teilprojekt 2: «Markterweiterung Informatikangebote» 20
7.3.3 Teilprojekt 3: «Interdisciplinary Center for Artificial Intelligence» (ICAI) 20
7.4 Kosten und erforderliche Ressourcen 21
2/27RRB 2020/421 / Beilage
7.5 Projektmarketing und -kommunikation 24
7.6 Projekt- und Change-Management 24
7.7 Übergang in die Betriebsphase 24
8 Risiken 25
8.1 Ergebnis der initialen Risikoanalyse 25
8.2 Risikomanagement während dem Projekt 26
9 Wirtschaftlichkeit 26
10 Support für das Projekt 27
11 Auftragserteilung 27
3/27RRB 2020/421 / Beilage
1 Zusammenfassung
Im Rahmen der IT-Bildungsoffensive des Kantons St.Gallen (ITBO) hat die OST – Ostschweizer
Fachhochschule ein Konzept für den Schwerpunkt III «Kompetenzzentrum Angewandte Digitali-
sierung» erstellt. Es basiert auf einer übergeordneten Strategie zur Integration der Digitalisierung
in allen Bereichen der Lehre, der angewandten Forschung und der Dienstleistungen. Für dieses
Projekt (Schwerpunkt III) des Programms ITBO hat die OST drei Teilprojekte erarbeitet, welche
die drei, im Kantonsratsbeschlusses über einen Sonderkredit für die IT-Bildungsoffensive (sGS
211.73) aufgeführten Massnahmenpakete aufnehmen, weiterentwickeln und entsprechende Lie-
ferobjekte festlegen. Diese drei Teilprojekte sind:
1. Teilprojekt 1: «Innovative Lehr- und Lernumgebung»:
‒ Handlungsfeld 1a: Aufbau einer IT-basierten innovativen Umgebung für Lehre und Lernen in
allen Departementen für die Leistungsbereiche Lehre und Weiterbildung;
‒ Handlungsfeld 1b: Aufbau einer standortübergreifenden digitalen Lernfabrik, einer «Smart Fac-
tory» für die produzierende Industrie;
‒ Handlungsfeld 1c: Aufbau von weiteren ausgewählten digitalen Labs («DigiLabs») im IT-Um-
feld in verschiedenen Studiengängen und Leistungsbereichen.
2. Teilprojekt 2: «Markterweiterung Informatikangebote»
Ausweitung des Studienangebots Informatik in St.Gallen und Wirtschaftsinformatik in Rappers-
wil.
3. Teilprojekt 3: «Interdisciplinary Center for Artificial Intelligence» (ICAI)
Aufbau eines interdisziplinären Zentrums für künstliche Intelligenz «Interdisciplinary Center for
Artificial Intelligence» (ICAI).
2 Vorgeschichte und Ausgangslage
Die Regierung des Kantons St.Gallen hat am 13. März 2018 die Botschaft und den Entwurf für
den Kantonsratsbeschluss über einen Sonderkredit für die IT-Bildungsoffensive verabschiedet
und dem Kantonsrat zugeleitet. Der Kantonsrat hat den Beschluss über den Sonderkredit für die
IT-Bildungsoffensive am 19. September 2018 erlassen. In der obligatorischen Volksabstimmung
vom 10. Februar 2019 wurde der Sonderkredit mit 69.8 Prozent Ja-Stimmen angenommen.
Der vorliegende Projektauftrag beschreibt den Schwerpunkt III der ITBO an der Fachhochschule
OST. Die OST bzw. zuvor die Fachhochschule Ostschweiz (FHO) hat standortübergreifend in
den Jahren 2018 und 2019 eine strukturierte, mehrstufige Strategie erarbeitet, wie die Fachhoch-
schule mit den Herausforderungen der Digitalisierung umgehen soll und sie zum Nutzen von
Wirtschaft und Gesellschaft umsetzen kann. Grundlage ist die Befähigung aller Beteiligten mit di-
gitalen Inhalten und Methoden umgehen zu können, damit sich in der Folge in jedem Fachbe-
reich innovative Lösungen entwickeln können. In der folgenden Abbildung ist dies graphisch zu-
sammengefasst:
4/27RRB 2020/421 / Beilage
Abbildung 1: Strategie der OST für die Umsetzung der Digitalisierung an der Fachhochschule.
In dieser Übersicht zur Digitalisierungsstrategie der OST lassen sich die Zielsetzungen des
Schwerpunkts III der ITBO gut einordnen und positionieren. Diese stellen im Kern die digitalen
Kompetenzen von Studierenden und Dozierenden dar, sowie verschiedene Formen der digital
unterstützten Lehre und des Lernens mit starkem Praxisbezug. Inhalt des Projekts und Abgren-
zungen zu anderen Bereichen der digitalen Strategie der Hochschule (Infrastrukturen, Schulver-
waltung u.a.) lassen sich anhand dieser Graphik klar verorten. Sie verdeutlicht auch, dass durch
die ITBO keinerlei Infrastrukturen finanziert werden.
Die ITBO soll dabei einen esseniellen Beitrag zur raschen Umsetzung der vorgeschlagenen Mas-
snahmen leisten, fokussiert auf den Aufbau und die Erweiterung digitaler Kompetenzen von Stu-
dierenden und Dozierenden, auf die Markterweiterung des Informatikangebots, und auf den Auf-
bau bzw. die Weiterentwicklung der vorhandenen «Smart Factory» und neuer «DigiLabs» für die
Lehre. Neu kommt ein besonderer Fokus auf das für die OST strategisch und übergreifend ange-
legte Thema «Artificial Intelligence» (AI) hinzu.
3 Problem- und Aufgabenstellung
Die OST steht an der Schnittstelle zwischen Hochschule und Wirtschaftspraxis. Ihre Absolventin-
nen und Absolventen und ihre Dozierenden sind ein wichtiger Faktor bei der direkten Umsetzung
neuer Erkenntnisse in innovative und markttaugliche Lösungen für alle Wirtschaftsbereiche des
Kantons St.Gallen.
Gemäss Botschaft vom 13. März 2018 zum Kantonsratsbeschluss über einen Sonderkredit für
die ITBO wird das Gesamtziel für die OST (damals noch drei Fachhochschulen innerhalb der
FHO) folgendermassen umschrieben:
«Die drei Fachhochschulen im Kanton St.Gallen richten gemeinsam ein standortübergreifendes
Kompetenzzentrum für Angewandte Digitalisierung ein. In der Ausbildung betreibt dieses Kompe-
tenzzentrum den «Digitalen Campus» und expandiert Studiengänge, die heute an einzelnen
Hochschulstandorten bestehen und profiliert sind, nachfrageorientiert auf andere, bisher nicht ab-
gedeckte Hochschulstandorte. Damit leistet es einen direkten Beitrag zum Abbau des Fachkräfte-
mangels.»
5/27RRB 2020/421 / Beilage
Der Fokus liegt demnach auf der Befähigung, digitale Instrumente und Prozesse gezielt in der
Lehre anzuwenden und sie für den spezifischen Einsatz in praxisnahen Lösungen weiter zu ent-
wickeln. Dies wird im Titel des Projekts (Schwerpunkt III) «Kompetenzzentrum Angewandte Digi-
talisierung» zum Ausdruck gebracht.
Die nachfolgende Abbildung stellt die Strukturierung des Projektes der OST graphisch dar:
Abbildung 2: Übersicht ITBO Schwerpunkt III, Projekt «Kompetenzzentrum Angewandte Digitalisierung».
Das Projekt wird in drei Teilprojekte gegliedert. Diese sind folgendermassen aufgestellt:
‒ Teilprojekt 1: «Innovative Lehr- und Lernumgebung»
Dieses Teilprojekt besteht aus drei Handlungsfeldern, die eng miteinander verknüpft sind. Das
digital unterstützte Lehren und Lernen wird standortübergreifend ausgebaut und mit der «Hyb-
riden Lernfabrik» (Buchs) und dem bestehenden «DigitalLab» (Rapperswil) ergänzt. In dieser
«Smart Factory», mit unmittelbarem Praxisbezug zur MEM-Branche, werden die notwendigen
Kompetenzen für den digitalen Wandel erworben und trainiert. Dazu gehört die Befähigung von
Dozierenden und Studierenden in relevanten Bereichen der Digitalisierung, wie Produktions-
systementwicklung und Produktionstechnik / -prozesse, Produktionsmanagement, Fertigungs-
technologien sowie Business Software Development. Es werden digitale Verfahren, Methoden
und Instrumente bereitgestellt, die den Anforderungen der modernen Lehre entsprechen.
Künftig sollen weitere sogenannte «DigiLabs» in diversen Fachbereichen und Departementen
zur Unterstützung der Lehre eingerichtet werden.
‒ Teilprojekt 2: «Markterweiterung Informatikangebote»
Es entspricht dem expliziten Auftrag, das Angebot an bestehenden Lehrangeboten der Infor-
matik an weiteren Standorten nachfrageorientiert einzuführen und auszubauen. Dies betrifft die
bisherigen Studiengänge Informatik in Rapperswil und Wirtschaftsinformatik in St.Gallen, die
neu jeweils in St.Gallen bzw. Rapperswil angeboten werden sollen.
‒ Teilprojekt 3: «Artificial Intelligence»
Das Differenzierungsmerkmal der OST im Themenfeld Digitalisierung soll mit «Artificial Intelli-
gence» (AI) erreicht werden: Abheben kann sich die OST im Vergleich zu anderen Institutio-
nen, indem AI sowohl inhaltlich über alle zentralen Themen und Departemente, also in der
Breite, als auch mit einem klaren Praxisbezug angewendet wird. Mittels AI kann die nächste
Generation der digitalen Kompetenz aufgebaut werden. Die koordinative Struktur dafür wird
das neu aufzubauende «Interdisciplinary Center for Artificial Intelligence» (ICAI) sein.
6/27RRB 2020/421 / Beilage
4 Anspruchsgruppen
Durch die Nähe von Fachhochschule und Wirtschaft ergibt sich ein umfangreiches Netzwerk an
Anspruchsgruppen. Diese sind:
Hauptanspruchsgruppen
‒ Studierende: Die heutigen Studierenden sind den sogenannten «Digital Natives» zuzuordnen.
Die neuen Technologien werden selbstverständlich und auf breiter Basis für Arbeit, Freizeit,
und soziale Kommunikation verwendet. Das Studium befähigt sie zur tieferen Einsicht in die
technischen Aspekte, sowie zur sachlichen Abschätzung von Chancen und Risiken in potenzi-
ellen Anwendungsgebieten.
‒ Dozierende und Lehrbeauftragte: Auch hier nimmt der Anteil von «Digital Natives» kontinuier-
lich zu. Die digitale Herausforderung besteht hierbei die Lerninhalte auch zeitgemäss und in
optimaler Lehrmethodik zu vermitteln.
‒ Forschende: Sie benutzen am Konsequentesten bestehende digitale Verfahren und Hilfsmittel
und beteiligen sich an neuartigen Anwendungen. Relevant ist hier nicht nur die Entwicklung
zeitnah, sondern auch über die eigene Spezialdisziplin hinaus, zu beobachten und sie fundiert
sowie rasch für die eigenen Ziele beurteilen zu können.
Übergeordnete Anspruchsgruppen
‒ Wirtschaft: Die Wirtschaft des Kantons St.Gallen ist sowohl im Programm ITBO und insbeson-
dere im vorliegenden Projekt (Schwerpunkt III) direkte Nutzniesserin der Resultate. Die Förde-
rung der benötigten Fachkräfte und der Innovation stehen im Zentrum der ITBO.
‒ Gesellschaft: Die Bevölkerung des Kantons St.Gallen profitiert von einer gesunden Wirtschaft.
Sie erwartet auch, dass der Mehrwert von Innovation und Wissen in die Gesellschaft zurück-
fliesst und dass gesellschaftliche Auswirkungen offen und transparent gemacht werden.
‒ Öffentliche Hand: Der Kanton St.Gallen muss sich im Konkurrenzverhältnis zu den benachbar-
ten Kantonen und Ausland behaupten. Die Politik unterstützt mit der ITBO die Vorreiterrolle
des Kantons. Die Gemeinden und umliegende Regionen der drei Standorte der OST sind
ebenfalls Teil dieser Anspruchsgruppe.
Weitere Anspruchsgruppen
OST als Institution: die OST positioniert sich sichtbar, differenziert und in einer herausragenden
Stellung in der Schweizer Hochschullandschaft und darüber hinaus.
5 Ziele
5.1 Rahmenbedingungen
5.1.1 Politische Rahmenbedingungen
Die ITBO und das vorliegende Projekt leiten sich aus einem politischen Auftrag ab. In der Volks-
abstimmung vom 10. Februar 2019 wurde die ITBO angenommen. Grundlage für den vorliegen-
den Projektauftrag bildet die Botschaft zur ITBO, die von der vorberatenden Kommission und an-
schliessend vom Kantonsrat ohne Gegenstimme verabschiedet wurde, sowie der daraus erstellte
Programmauftrag.
5.1.2 Rechtliche Rahmenbedingungen
Die ITBO ist wie folgt rechtlich verankert:
‒ Kantonsratsbeschluss über einen Sonderkredit für die IT-Bildungsoffensive (sGS 211.73);
‒ Verordnung über die Umsetzung der IT-Bildungsoffensive (sGS 211.731);
‒ Programmauftrag IT-Bildungsoffensive vom 2. Juli 2019 (RRB 2019/504)
7/27RRB 2020/421 / Beilage
‒ Die Programm- und Projektabwicklung orientieren sich, wo dies sinnvoll bzw. sachgemäss
scheint, an der Methode HERMES 5.1.
5.1.3 Finanzielle Rahmenbedingungen
Aufgrund der von der OST aufgestellten Finanzplanung sind 11,3 Mio. Franken aus dem Gesamt-
budget der ITBO für den Schwerpunkt III «Kompetenzzentrum Angewandte Digitalisierung» vor-
gesehen. Der Betrag enthält eine sogenannte Agilitätsreserve von 10 Prozent.
5.1.4 Personelle Rahmenbedingungen
Die personellen Ressourcen zur Umsetzung der drei Teilprojekte werden von der Lead-Organisa-
tion OST gestellt. Deren Finanzierung erfolgt aus den Projektmitteln.
5.2 Projektziele
Das «Kompetenzzentrum Angewandte Digitalisierung» wird in drei Teilprojekte gegliedert. Diese
besitzen jeweils eigene Teilprojektziele und teilweise weitere Handlungsfelder, welche Massnah-
menpakete gruppieren und die folgendermassen zusammengefasst werden:
5.2.1 Ziele Teilprojekt 1: «Innovative Lehr- und Lernumgebung»
Das erste Teilprojekt «Innovative Lehr- und Lernumgebung» umfasst das eigentliche «Leben
auf dem Digitalen Campus». Dazu gehören insbesondere die Kernprozesse der Lehre mit
den jeweils benötigten Applikationen unter Nutzung digitaler Services sowie die dafür erfor-
derlichen – bereits vorhandenen oder noch zu erwerbenden – Kompetenzen.
Um dieses Ziel erreichen zu können, werden drei Handlungsfelder definiert, die zwar sepa-
rat, aber in engem Austausch, entwickelt werden.
5.2.1.a Handlungsfeld 1.a – Digital unterstütztes Lehren und Lernen
Dieses erste Handlungsfeld (HF1a) bildet den Rahmen für eine innovative Lehr- und Lernumge-
bung.
Ziele Ergebnisse
Digital gestütztes standortübergreifendes Leh- Befähigung aller am Lehr- / Lernprozess Betei-
ren und Lernen ligten zum nutzenbringenden Einsatz und zur
Anwendung digitaler Hilfsmittel und Methoden;
Bewährte und neue digitale Ansätze der Didak-
tik und der «Educational Technologies» werden
wo sinnvoll genutzt.
Die Teilnehmenden werden selbstbestimmte Die gelernten Methoden und Kompetenzen er-
Mitglieder der «Digitalen Wissensgemein- möglichen den direkten Transfer in den Praxis-
schaften» alltag und auch in andere digitalisierte Lebens-
bereiche. Sie dienen als Grundlage für ein le-
benslange Lernen.
Durch Kollaboration beim Lehren und Lernen Die Zusammenarbeit in Lehr- und Lernprozes-
entstehen neue Ideen und Lösungen sen in Praktika, Studien- und Abschlussarbei-
ten kann standort- und zeitunabhängig erfolgen
und ermöglicht neue digitale Formen zur Lö-
sungsfindung.
8/27RRB 2020/421 / Beilage
Diese Hauptziele lassen sich nur erreichen, wenn die folgenden unterstützenden Ziele realisiert
werden:
Unterstützende Ziele Ergebnisse
Services für die Lehrvorbereitung, für die Ent- Es besteht ein Katalog an Services, welche für
wicklung von Lern-, Förder- und Prüfungsum- die Lehrvorbereitung eingesetzt werden kön-
gebungen nen.
Services für die Durchführung von Lehrveran- Es besteht ein Katalog an Services für die
staltungen inkl. elektronischer Prüfungen, für Durchführung von Lehrveranstaltungen und
individualisiertes Lernen, für die Förderung von Assessments bzw. Prüfungen.
von Studierenden
Services für Projekte, Praktika, Forschung Es besteht ein Katalog an Services für Praktika
und Entwicklung und forschungsnahe Arbeiten von Studieren-
den.
Services für «interessierte Parteien» aus- Es besteht ein Katalog an Services, die von der
serhalb der Hochschule Allgemeinheit genutzt werden können.
Services für Literatur, Recherchen und Teil- Diese Services sollen die Informations- und
nahme an der «Wissensgemeinschaft» Medienkompetenz, Beurteilungsfähigkeit, kom-
plexe Recherchen und den zielgerichteten Ein-
satz für effizientes Lehren und Lernen fördern.
5.2.1.b Handlungsfeld 1.b – Standortübergreifende «Smart Factory» basierend auf
der «Hybriden Lernfabrik» und dem «DigitalLab»
Dieses Handlungsfeld «Hybride Lernfabrik und DigitalLab – Smart Factory für die produzierende
Industrie» ist das erste, unmittelbare Lieferobjekt des Teilprojekts 1, das mit hoher Priorität
implementiert werden soll. Es erarbeitet studiengang-, modul- und standortübergreifende Lehr-
und Lerninhalte auf der Basis von industriellen Produktionsprozessen für die digitalisierte
Wertschöpfungskette. Verschiedene Studiengänge können die erarbeiteten Inhalte spezifisch in
ihre Module integrieren.
Ziele Ergebnisse
Bisherige getrennte Infrastrukturen im Bereich Methoden und Infrastrukturen in Buchs und
der digitalen Produktion werden koordiniert Rapperswil werden abgeglichen und stehen,
und zusammengeführt nach Möglichkeit, an beiden Standorten, dem
Lehrkörper und den Studierenden, zur Verfü-
gung.
Es wird ein studiengangs-, modul- und stand- Die verschiedenen Studiengänge setzen die
ortübergreifender Einsatz der «Hybriden Lern- vorhandenen Infrastrukturen und Verfahren ge-
fabrik und des bestehenden «DigitalLab» ver- mäss ihren eigenen Anforderungen ein.
folgt
Die prozess- und businessorientierte «Smart Die «Smart Factory» erweitert die schon heute
Factory» wird als zentrales Paradigma für die gelehrte vertikale und horizontale Integration in
Ausbildung aufgebaut. den Industrieprozessen und kombiniert sie sys-
tematisch mit Data Science.
9/27RRB 2020/421 / Beilage
5.2.1.c Handlungsfeld 1.c – Aufbau weiterer ausgewählter «DigiLabs»
Das Modell der zeitnahen Integration von Innovationen in Lehre und angewandter Forschung
über sog. «DigiLabs» wird während des Projektes und auch nach Abschluss der ITBO fortgeführt
werden. Folgende Ziele werden im Handlungsfeld HF1c verfolgt:
Ziele Ergebnisse
Weitere «DigiLabs» in allen Fachbereichen Verfahren, welches auf effiziente Weise die
dienen dem Aufbau von Kompetenzen in der Identifizierung, Evaluation (festgelegte Krite-
Verknüpfung zwischen der Anwenderwelt und rien) und Implementierung der Labs ermög-
der Informationstechnik licht;
Ausgewählte «DigiLabs» werden realisiert.
5.2.2 Ziele Teilprojekt 2: «Markterweiterung Informatikangebot»
Mit diesem Teilprojekt wird ein Kernanliegen der ITBO, den Fachkräftemangel im Kanton St.Gal-
len und im Einzugsgebiet der OST zu beheben, aufgenommen. Folgende Ziele werden hier de-
finiert:
Ziele Ergebnisse
Curriculum BSc. Informatik für St Gallen Einführung auf Studienjahr 2021/2022.
Curriculum BSc. Wirtschaftsinformatik für Einführung auf Studienjahr 2021/2022.
Rapperswil
Abstimmung Kommunikation und Akquisition Konzept und Durchführung von standortspezi-
fischen Marketingaktivitäten.
Definition des Bedarfs an personellen, räumli- Dokument mit Kostenaufstellung und Pla-
chen und infrastrukturellen bzw. informatik- nung;
technischen Ressourcen Stellenplan mit Anforderungen für die Rekru-
tierung von Fachkräften;
Planung der Räume und Infrastrukturen.
Erhöhung des Anteils an Studentinnen im Ba- Der Anteil von Studentinnen im Bereich der
chelor-Studium am Ende des Projektes Informatik und Wirtschaftsinformatik an der
OST nimmt signifikant zu.
5.2.3 Ziele Teilprojekt 3: «Interdisciplinary Center for Artificial Intelligence»
(ICAI)
Die OST soll zu der Hochschule für interdisziplinäre, angewandte künstliche Intelligenz werden
(«Breiten-AI»). Dieses dritte Teilprojekt stellt sicher, dass die Dozierenden und Studierenden aller
Studiengänge an der OST die Möglichkeiten und Limitationen von AI in Bezug auf ihr Fachgebiet
verstehen. Dies führt dazu, dass AI in allen Bereichen der OST gelehrt und gelebt wird. Diese AI-
Breite stellt eine USP der OST dar, welche sich auch in der Studierendenanwerbung sehr gut
kommunizieren lässt.
Ziele Ergebnisse
Allen Studiengängen stehen für ihre individu- Aufbau eines Moduls «Teach the Teachers»:
ellen Bedürfnisse AI-Ausbildungsformate (Mo- Grundkurs in AI für alle Dozierenden. Ange-
dule) zur Verfügung passt an die Vorkenntnisse und Bedürfnisse
der Dozierenden.
10/27RRB 2020/421 / Beilage
Ziele Ergebnisse
Alle Studierende der OST kennen die Mög- Aufbau eines Moduls «Teach the Students»:
lichkeiten und Limitationen von AI in ihren Grundkurs für alle Studierenden. Individuali-
Fachgebieten siert nach Vorkenntnissen pro Studiengang.
Niederschwelliger Zugang zu AI-Beratung und Aufbau der Dienste «Walk-in-Services» und
Ressourcen «AI-Clinic»: Pro Standort sollen Ansprechper-
sonen unkomplizierte Hilfestellungen zu AI
leisten.
Interdisziplinäre, AI-basierte Projekte werden Definierte Kriterien für fördernswerte Projekte
gefördert und Beschreibung des Prozesses zur Erlan-
gung der Förderung liegen vor.
Profilierung der OST und des Kantons SG Kanton und Fachhochschule werden als Re-
ferenz für Ausbildung und Einsatz von AI in
der Praxis wahrgenommen.
6 Berührungspunkte zu anderen Projekten und Vorhaben
Der Schwerpunkt III der ITBO, das vorliegende Projekt «Kompetenzzentrum Angewandte Digitali-
sierung», ist durch einen hohen Praxis- und Wirtschaftsbezug gekennzeichnet. Die mit zeitge-
mässen Lehrmethoden und in innovativen Bereichen ausgebildeten Studierenden sind direkt als
qualifizierte Fachkräfte in der Wirtschaft der Einzugsregion OST einsetzbar.
In diesem Sinne trägt das Projekt der OST unmittelbar zur «Schwerpunktplanung der Regierung
(2017-2027)» bei und hilft deren strategische Ziele umzusetzen. Dies betrifft ganz besonders die
Teilziele 2.1 «Innovative Bildung und Forschung» und 4.1 «Gesellschaftsverträgliche Digitalisie-
rung», wozu die OST einen Kernbeitrag leistet. Abgeleitet von dem breiten Ausbildungsspektrum
an der OST, sind aber auch direkte und indirekte Beiträge an weitere Ziele möglich, von den
funktionalen Räumen und den Infrastrukturen, über soziale Aufgaben und Gesundheit bis hin zur
Ökologie und Ökonomie.
Sehr wichtig sind die konkreten Berührungspunkte mit den weiteren Projekten der ITBO. Ein ge-
genseitiger Erfahrungsaustausch und eine Koordination der verschiedenen Vorhaben ist ge-
wünscht. In einer späteren Phase des ITBO Programms sollten idealerweise Synergien zwischen
den Projekten aufgezeigt und genutzt werden.
Auch ein Informationsaustausch mit ähnlich gelagerten Initiativen an anderen Fachhochschulen
der Schweiz könnte sich, trotz Konkurrenzsituation, als punktuell sinnvoll erweisen. Zumindest
sollte diese Option offengehalten werden. Schweizweite Plattformen wie eduhub (von SWITCH)
bieten ebenfalls Austauschmöglichkeiten in bestimmten Bereichen (hier Digitale Lehre).
Auf eidgenössischer Ebene gibt es für das vorliegende Projekt durchaus weitere Programme, de-
ren Entwicklung zumindest beobachtet werden sollten, auch wenn sie nicht direkte Berührungs-
punkte aufweisen. Diese sind vornehmlich bei swissuniversities angesiedelt und besitzen
dadurch eine nationale bis internationale Perspektive. Namentlich sind dies:
‒ Das Programm P-8 «Stärkung von Digital Skills in der Lehre»: in der ersten Phase (2019 –
2020) wurden 100 Projekte mit einem Gesamtvolumen von 10 Mio. Franken unterstützt. Eine
zweite Phase (2021–2024) ist in Planung. Einige Projekte daraus könnten als wertvolle Erfah-
rung dienen.
‒ Das Programm P-5 «Wissenschaftliche Information»: einige der geförderten Projekte könnten
v.a. für das Teilprojekt «Innovative Lernumgebung» interessant sein, z.B. SwissMOOC. Ein
grosser Teil der Förderung von P-5 ging auch in den Aufbau und Betrieb von verschiedenen
11/27RRB 2020/421 / Beilage
Infrastrukturen für Datenmanagement sowie in die Befähigung der Hochschulangehörigen zur
Nutzung solcher Dienste.
Die demnächst folgende Phase (2021–2024) wird ein Programm «Open Science» sein, mit
vermehrtem Fokus auf «Open Access» und «Open Research Data» (später auch
«Open Education» und «Open Innovation»). Dieses Programm könnte ein Innovationsfaktor für
die Ausbildung und Forschung an Fachhochschulen werden und ist deshalb weiter zu be-
obachten, ggf. ist eine Teilnahme daran sinnvoll.
Das Nationale Forschungsprogramm NFP 77 «Digitale Transformation» des Schweizerischen
Nationalfonds (SNF) könnte ebenfalls ein weiterer Andockpunkt für das vorliegende Projekt bzw.
für einzelne der beschriebenen Teilprojekte sein.
7 Projektabwicklung
7.1 Projektorganisation und -controlling
7.1.1 Organigramm
Abbildung 3: Organigramm der Projektorganisation.
7.1.2 Organe
Gemäss Vorgaben von Auftraggeber und Programmleitung werden folgende Organe eingesetzt:
Funktion Benennung Bemerkungen
Projekt-Auftraggeberin Regierung
Vorsitzender Prof. Dr. Daniel Seelhofer Rektor OST
Projektausschuss
12/27RRB 2020/421 / Beilage
Projektausschuss R. Trösch Programmleiter ITBO, BLD SG
R. Bereuter Amtsleiter AHS
C. Höhener Verwaltungsdirektor OST
Prof. Dr. L. Bläser Leiter Departement Informatik OST
Prof. L. Ritter Leiter Departement Technik OST
Prof. Dr. S. Minder Hoch- Leiterin IQT OST
reutener
Prof. A. Simeon Stabschef OST (ohne Stimmrecht)
Qualitätssicherung und NN In Abklärung (evtl. PHSG)
Risikomanagement
Begleitausschuss Vertretung aus Lehre, For- Beizug nach fachlichem Bedarf,
schung, WB und Dienste kann auch dynamisch sein.
Projektleitung Prof. A. Simeon Stabschef OST. Leitet auch Projekt-
Support und -Kommunikation.
Teilprojektleitungen NN In Abklärung (OST)
7.1.3 Verantwortlichkeiten und Aufgaben Projekt-Auftraggeberin
‒ erteilt den Projektauftrag
‒ bewilligt die Finanzmittel
‒ genehmigt Teil-Projektaufträge
7.1.4 Verantwortlichkeiten und Aufgaben Projektausschuss
‒ unterstützt den Auftraggeber und das Programm, berät die Anträge an diese vor
‒ schafft gute Voraussetzungen für das Projekt und die Projektleitung
‒ verantwortet die Umsetzung des Projektauftrags
‒ überwacht die Projektaktivitäten und den Projektfortschritt
‒ überwacht und regelt die Mittelverwendung, berichtet dem Programmausschuss
‒ stellt das Projekt-Controlling sicher
‒ überprüft die Ergebnisse der Phasen
‒ befindet über anfällige Anpassungen der Ziele und über den Scope Change, und beantragt
diese dem Programmausschuss
‒ verantwortet die interne Kommunikation auf Projektebene
‒ stellt den Einbezug der Stakeholder sicher und genehmigt den Begleitausschuss
‒ überwacht das Risikomanagement des Projektes, berichtet dem Programmausschuss
‒ verantwortet Verschiebungen innerhalb des Projektauftrags
‒ verantwortet das interne Kontrollsystem
‒ genehmigt die Organisation der Teilprojekte und die Zusammensetzung der Teams
7.1.5 Verantwortlichkeiten und Aufgaben Projektleitung
‒ führt das Projekt operativ-koordinativ
‒ sorgt für die sachgerechte, zeitgerechte und kostengerechte Durchführung des Projekts
‒ führt das Projektteam
‒ führt und koordiniert die Teilprojektleitungen
‒ stellt das Controlling der drei Teilprojekte sicher
‒ plant, setzt in Gang und kontrolliert die Aktivitäten und Arbeitsschritte im Projekt
‒ berichtet dem Projektausschuss und beantragt allfällige Changes
‒ unterhält die Verbindung zur Stelle Qualitätssicherung und Risikomanagement
‒ stellt die Kommunikation innerhalb des Projekts sicher
13/27RRB 2020/421 / Beilage
‒ nimmt an den Sitzungen der Projektleiter-Konferenz teil
7.1.6 Verantwortlichkeiten und Aufgaben Teilprojektleitungen
‒ Führen jeweils eines der drei Teilprojekte im Sinne von 7.1.5
‒ Berichten dem Projektleiter
‒ Verfügen über keinen eigenen Ausschuss und Qualitätsmanagement für ihr Teilprojekt
7.1.7 Verantwortlichkeiten und Aufgaben der Stelle Qualitätssicherung und
Risikomanagement
‒ entlastet den Vorsitzenden des Projektausschusses und gewährleistet für diesen stets Ent-
scheidungs-Vorsprung
‒ berichtet dem Projektausschuss
‒ beurteilt mit den Mitgliedern des Projektausschusses periodisch offen und ehrlich die Lage
‒ bietet eine kritische und konstruktive Aussensicht
‒ schlägt notwendige Massnahmen vor und verfolgt deren Umsetzung
‒ Der Projektausschuss beantragt dem Programmausschuss ggf. den Verzicht auf diese Funk-
tion, falls die Komplexität des jeweiligen Projekts dies zulässt
7.2 Zeitplan
Der grobe Zeitplan ist für das vorliegende Projekt in der folgenden Tabelle skizziert. Dies gilt vor-
behältlich der in den detaillierten Teilprojektaufträgen spezifizierten Meilensteine und Planungs-
daten.
Zeitrahmen Aktivitäten Aktivitäten Aktivitäten
Teilprojekt 1 Teilprojekt 2 Teilprojekt 3
Lehr-/Lernumgebung Informatikangebot Artificial Intelligence
Q2 2020 Projektantrag an die Regierung und Genehmigung (14. April 2020).
Anschliessend Erarbeitung der Teilprojektaufträge 1-3,
Teilprojektanträge an den Programmausschuss und Genehmigung
(15. Juni 2020)
Q3/Q4 2020 Einrichtung eines oder Erarbeitung der Curri- Marketingkonzept und
mehrerer technischen cula und Regulative; –aktivitäten;
Teams und eines metho- Erarbeitung Marketing-
dischen Teams; konzept und Start Mar- Gründunganlass ICAI;
ketingaktivitäten;
Koordination und Integra- Planung Räume und
Aufbau «Teach the
tion der Infrastrukturen für Infrastrukturen;
Students»;
«Hybride Lernfabrik» und Koordination Studien-
«DigitalLab» in Buchs und administration;
Rapperswil. Aufbau «Teach the
Planung Ressourcen
Teachers».
und Einsatzplanung
Bereitstellung Lehrin-
halte.
Q1/Q2 2021 Entwickeln von Services Rekrutierung Dozie- Regelmässige Nutzung
zur Erreichung der Ziele rende und Einschrei- der beiden obigen Pro-
für Lehr-/Lernumgebung; bung Studierende; gramme.
14/27RRB 2020/421 / Beilage
Intensivierung der Mar-
Umsetzung Prozessin- ketingaktivitäten;
tegration und Business Einrichtung Arbeits-
Software («Smart Fac- und Studienplätze;
tory»); Aufbau Lernumge-
bung;
Marketingkonzept und – Planung Semsterbe-
aktivitäten. ginn.
Q3/Q4 2021 Weiterentwicklung und In- Start BSc. Informatik in Niederschwellige
tegration von Services; St.Gallen und BSc. «Walk-In Services»
Wirtschaftsinformatik in werden aufgebaut und
Rapperswil im Septem- genutzt.
Weiterentwicklung und In-
ber 2021.
tegration «Smart Fac-
tory».
Q1/Q2 2022 Einführung weiterer Weiterführung und Weiterführung und
bis Q4 2026 «DigiLabs». Ausbau der Informatik- Ausbau der AI-Ange-
angebote. bote und Projekte.
Alle drei Teilprojekte stehen unter hohem Zeitdruck, ab 2021 erste Resultate aufzuweisen. Insbe-
sondere der Start der zwei Studiengänge für das Studienjahr 2021/22 an den jeweils komplemen-
tären Standorten St.Gallen und Rapperswil, sowie die rasche Sichtbarkeit des Zentrums für «Arti-
ficial Intelligence» im 2020 stellen eine Herausforderung dar, zu der sich die OST mit diesem Pro-
jekt verpflichtet.
Folgende Meilensteine sind bis Ende 2020 geplant:
Termine Teilprojekte Meilensteine
15.06.2020 Alle drei Teilprojekte TP1/2/3-01: Teilprojektanträge an den Pro-
grammausschuss.
15.06.2020 Projektleitung P-01: Gesamtprojektplanung inkl. personeller
und finanzieller Planung.
30.09.2020 TP2 Markterweiterung TP2-02: Vorliegen Detailkonzept zu Curricula
Informatikangebot und Marketing. Planung der benötigten Ressour-
cen an Dozierenden und Sachmittel. Klärung der
Raumfrage. Beginn Marketingkampagne.
31.10.2020 TP1 Innovative Lehr- Die Meilensteine für das TP1 ergeben sich aus
und Lernumgebung denjenigen der einzelnen Handlungsfeldern.
TP1-HF1a Digitale Un- TP1-HF1a-01: Potenzielle Services für Lehrvor-
terstützung bereitung, für die Durchführung von Lehrveran-
staltung und für Praktika identifiziert.
TP1-HF1b «Smart Fac- TP1-HF1b-01: Planung zur Koordination und Zu-
tory» sammenlegung genehmigt und Start.
31.10.2020 TP3 «Artificial Intelli- TP3-02: ICAI ist in Betrieb, erste Marketingkam-
gence» pagne durchgeführt. Es liegen erste Versionen
der Module «Teach the Teachers» und «Teach
the Students» vor.
15/27RRB 2020/421 / Beilage
31.12.2020 TP2 Markterweiterung TP2-03: Einsatzplanung Dozierende ist bereit;
Studierendenadministration ist bereit für Ein-
schreibungen; Räume und Ressourcen sind defi-
niert und reserviert.
TP1-HF1c Weitere «Di- TP1-HF1c-01: Erste Runde Evaluationsverfahren
giLabs» durchgeführt; Planung zur Einrichtung ausge-
wählter «DigiLabs» ist aufgestellt.
Diese Meilensteine gelten vorbehältlich derjenigen, die in den Teilprojektaufträgen per
15.06.2020 definiert werden.
7.3 Projektumfang und -struktur
Das Projekt «Kompetenzzentrum Angewandte Digitalisierung» des Programms ITBO besteht, wie
ausgeführt, aus den folgenden drei Teilprojekten und Handlungsfeldern:
‒ Teilprojekt 1 (TP1): «Innovative Lehr- und Lernumgebung»
– TP1-HF1a: Handlungsfeld 1a «Digital unterstütztes Lehren und Lernen»
– TP1-HF1b: Handlungsfeld 1b «Standortübergreifende Smart Factory»
– TP1-HF1c: Handlungsfeld 1c «Aufbau weiterer ausgewählter DigiLabs»
‒ Teilprojekt 2 (TP2): «Markterweiterung Informatikangebote»
‒ Teilprojekt 3(TP3): «Interdisciplinary Center for Artificial Intelligence» (ICAI)
Die wichtigsten Massnahmen pro Teilprojekt, die in den jeweiligen Konzepten als Arbeitspakete
detailliert definiert und von der ITBO gefördert werden sollen, werden im Folgenden skizziert.
7.3.1 Teilprojekt 1: «Innovative Lehr- und Lernumgebung»
Der Bereich «Innovative Lehr- und Lernumgebung» stellt das erste Teilprojekt dar. Die Hauptele-
mente darin sind die Befähigung zur digitalen Kompetenz der wichtigsten Stakeholder, sowie die
praktische Verankerung in den beiden existierenden Labs mit klarem Bezug zur MEM-Branche.
Die Digitalisierungsstrategie der OST (s. Abbildung 1 im Abschnitt 2) betrifft alle vier Leis-
tungsbereiche der Hochschule: Lehre, Weiterbildung, Dienstleistungen und angewandte For-
schung und Entwicklung (aF&E). Im Rahmen der ITBO wird aber nur der Bereich der «Inno-
vativen Lehr- und Lernumgebung» betrachtet und finanziert (s. nachfolgende Abbildung 4). Dies
soll durch drei Handlungsfelder unterstützt werden, so dass sich die digitale Lehre und die
digitale Transformation gegenseitig unterstützen. Durch die neuartige «Smart Factory» und
weitere ausgewählte «DigiLabs» wird die praxisbezogene Schnittstelle zu aF&E gewährleistet.
16/27RRB 2020/421 / Beilage
Abbildung 4: Teilbereich der Strategie der OST, der durch die ITBO als «Innovative Lernumgebung» unterstützt wird.
7.3.1.a Handlungsfeld 1.a – Digital unterstütztes Lehren und Lernen
Hier werden die notwendigen Voraussetzungen geschaffen, damit die Möglichkeiten einer moder-
nen, IT-basierten Lehr- und Lernumgebung genutzt werden können. Dazu gehören neben den
verschiedenen Möglichkeiten von «Blended-Learning», «Distant-Learning», «Flipped Classroom»
usw. auch Angebote in Form von individualisiertem Lernen mit zugehörigen digitalen Kontroll-
und Fördersystemen. Es sollen in allen Studiengängen fachspezifische Curriculare Inhalte zur Di-
gitalisierung angeboten werden. Es sind auch die erforderlichen digitalen Medien einzubinden.
Elemente der im Teilprojektauftrag zu bestimmenden Arbeitspakete und Meilensteine sind:
‒ Digitale Räume, virtuell und real
‒ Produktionsumgebung für standortunabhängige, digitale Lehrinhalte
‒ Bereitstellung verschiedener Wissensplattformen auf der Basis von digitaler Kommunikation
und Kollaboration, persönliches e-Portfolio usw.
‒ Spezifikation und Aufbau einer Lernplattform für flexible und verteilte Lehrformate, inkl. Lern-
kontrolle und Durchführung von elektronischen Prüfungen
‒ Entwicklung von AI-gestütztem Learning, Analytics zur individuellen Förderung der Studieren-
den
‒ Elektronischer Marktplatz für die Vergabe von Studien- und Abschlussarbeiten
‒ Erarbeitung einer auf dem nationalen Aktionsplan Open Access basierten Plattform für wissen-
schaftliche Publikationen und Arbeiten von Studierenden
‒ Befähigung zum Einsatz von Open Data und Datenmanagement im Allgemeinen
7.3.1.b Handlunsgfeld 1.b – Standortübergreifende «Smart Factory» basierend auf
der «Hybriden Lernfabrik» und dem «DigitalLab»
In der Schweiz stellt die produzierende Industrie 17 Prozent der schweizweiten Wertschöpfung
dar (Bundesamt für Statistik) und nimmt einen zentralen Stellenwert ein. Die produzierende
Industrie ist in der Ostschweiz eine Schlüsselbranche. Zahlreiche Betriebe aus dem Maschinen-
und Metallbau, der Metallverarbeitung, der Elektrotechnik und Elektronik sowie der Präzisions-
instrumente (MEM-Branche) gehören zu den weltweit führenden Anbietern auf ihrem Gebiet.
Die Ostschweiz ist vor allem in den Zukunftsbereichen, wie der Sensorik, Photonik, Robotik,
Kunststoff und additive Fertigung ein wichtiger Standort. Die Digitalisierung ist ein zentraler
17/27RRB 2020/421 / Beilage
Wachstumstreiber dieser Branche. Dieses Handlungsfeld befähigt die Absolventinnen und
Absolventen das Paradigma der «Smart Factory» für die produzierende Industrie umzusetzen.
Die Verfahren zur Digitalisierung können dabei in zwei Dimensionen der thematischen Breite und
Tiefe eingesetzt werden, die sich auf zwei existierenden Labs in Buchs («Hybride Lernfabrik»)
und in Rapperswil («DigitalLab») beziehen. Die OST soll in diesem Bereich eine führende Rolle in
der Bildung von digitalen Lehr- und Lerninhalten von Industrie 4.0 einnehmen. Dies ist
schematisch in der foglenden Abbildung dargestellt:
Abbildung 5: Praxisorientierte Kompetenzaneignung durch die «Hybride Lernfabrik» (Buchs) und das «DigitalLab» (Rap-
perswil).
Elemente der im Teilprojektauftrag zu bestimmenden Arbeitspakete und Meilensteine sind:
‒ Koordination, Setup und Integration der Infrastrukturen am Standort Buchs
‒ Koordination, Setup und Integration der Infrastrukturen am Standort Rapperswil
‒ Koordination und Umsetzung der Themen Prozessintegration und Business Software
‒ Aufbau der Modellfabrik («Smart Factory») unter personeller, departementaler und standort-
übergreifender Vernetzung
‒ Aufbau der Lernumgebung für digital integriertes Unternehmen (vertikale Integration)
‒ Aufbau der Lernumgebung für digital integrierte Wertschöpfungskette (horizontale Integration)
‒ Aufbau der Lernumgebung für die prototypische Anwendung von Data Science
‒ Erstellung der benötigten Lehr- und Lernmaterialien
7.3.1.c Aufbau weiterer ausgewählter «DigiLabs»
Wichtig ist, beim innovativen Lernen die Dynamik beizubehalten und im extern und global vorge-
gebenem Takt mitziehen zu können. Zu diesem Zweck sind in Zukunft weitere «DigiLabs» vorge-
sehen, die sämtliche Departemente und Fachbereiche abdecken und während der Laufzeit des
Teilprojektes rasch und effizient implementiert werden können. Dieses Modell der zeitnahen In-
tegration von Innovationen in Lehre und angewandter Forschung wird auch nach Abschluss der
ITBO weiterverfolgt werden.
Elemente der im Teilprojektauftrag zu bestimmenden Arbeitspakete und Meilensteine sind:
‒ Bereitstellung eines Verfahrens zur Identifizierung von Bedürfnissen und Lücken, zur Unter-
stützung bei der Konzepterstellung und zur Evaluation
‒ Bereitstellung der Grundlagen für die Erfolgsmessung und periodische Re-Evaluation der «Di-
giLabs»
18/27RRB 2020/421 / Beilage
‒ Aufbau von weiteren «DigiLabs» für die Lehr- und Lernumgebung bei nachgewiesenem Be-
darf. Diese können aus allen Fachbereichen und Departementen stammen oder übergreifend
gestaltet werden.
Um dieses Potenzial zu eruieren, wurde 2019 an allen drei Teilschulen (neu: Standorte der OST)
ein Call für zusätzliche «DigiLabs» ausgeschrieben, der zu weiteren 14 Vorschlägen für innova-
tive Labs in allen Fachbereichen führte. Hauptbedingung ist, dass diese Labs ausdrücklich der
Lehre dienen müssen, die Lehre also Hauptnutzniesserin ist. Weitere Kriterien sind:
‒ das Lab ist möglichst attraktiv für die Ausbildung in den MINT-Fächern
‒ das Lab richtet sich möglichst an die Ausbildung für die produzierende Industrie, insbesondere
MEM-Bereich
‒ das Lab richtet sich möglichst an die Ausbildung für den Dienstleistungssektor
‒ das Lab fördert möglichst die Kompetenzen im Bereich Digitaler Wandel
‒ das Lab bietet Nutzen für möglichst viele Studiengänge
Die bisher angemeldeten Vorschläge für «DigiLabs» sind:
Nr. Standort Kürzel Beschreibung Fachbereich
OST
1 St.Gallen Architektur Digitale Werkstatt @ Ar- Architektur, Bau- und
Werkstatt chitektur Werkstatt Planungswesen
2 St.Gallen SimDec Simulationslabor im Be- Gesundheit
reich Dementia Care
3 St.Gallen SIMULAB Simulationslabor zur Ent- Technik
scheidungsunterstützung
in Produktions- und
Logistiksystemen
4 St.Gallen Simulations- Simulationslabor zur Aus- Gesundheit
spital bildung
5 St.Gallen SmartCity SmartCity @ OST Technik
6 St.Gallen HANSA Virtual Reality Lab Soziale Arbeit
«Handlungsanlässe Sozi-
aler Arbeit»
7 Rapperswil BIM Lab BIM Planungsmethode Architektur, Bau- und
implementieren Planungswesen
8 Rapperswil MedTech Lab Aufbau Medizinaltechnik- Technik
Lab
9 Rapperswil Smart City Lab Smarte Stadttechnolo- Architektur, Bau- und
gien Planungswesen
10 Rapperswil AI Lab Artificial Intelligence Lab Informatik
11 Buchs RheinLab Virtual Reality (VR)- und Technik
Augmented Reality (AR)-
Umgebung für Rein-
räume
12 Buchs Wissens- Systemtechnik-Akademie Technik
nuggets vermittelt Wissenspakete
19/27RRB 2020/421 / Beilage
Nr. Standort Kürzel Beschreibung Fachbereich
OST
13 Buchs MAS Energie Digitale Wissensplattform Technik
Digital im Bereich Energie
14 Buchs WIGEPS Wissensplattform zur ge- Technik
ometrischen Produktspe-
zifikation und Verifikation
Die genaue Anzahl, die inhaltlichen Schwerpunkte und Priorisierung weiterer «DigiLabs» soll im
Rahmen dieses Massnahmenpakets innerhalb des Teilprojektes 1 durch den Projektausschuss
bestimmt und weiterverfolgt werden.
7.3.2 Teilprojekt 2: «Markterweiterung Informatikangebote»
Dieses Teilprojekt entspricht den Vorgaben der Politik und der Wirtschaft (darunter die IHK
St.Gallen und Appenzell) und ergänzt die Initiativen der Teilprojekte der PHSG und der Uni SG,
aber auch von «IT rockt!».
Das Studium Wirtschaftsinformatik soll als Vollzeitstudium am Standort Rapperswil und der
Studiengang Informatik ebenso als Vollzeitstudium am Standort St.Gallen angeboten wer-
den. Dies stellt in beiden Fällen die häufiger gewählte Studienform dar. Zudem verzeichnet
diese Studienform i.d.R. weniger Studienabbrechende als ein berufsbegleitendes Studium.
Diese Studienform lässt auch mehr Spielraum in der Stundenplanung zu, was aufgrund des
Einsatzes von Lehrenden anderer Standorte (insbesondere aus St.Gallen für die Fächer der
Betriebswirtschaftslehre) ein wichtiger Aspekt ist.
Elemente der im Teilprojektauftrag zu bestimmenden Arbeitspakete und Meilensteine sind:
‒ Definition Curriculum BSc. Informatik für St.Gallen, inkl. Ressourcen- und Finanzplanung
‒ Definition Curriculum BSc. Wirtschaftsinformatik für Rapperswil, inkl. Ressourcen- und Finanz-
planung
‒ Bereitstellung der Studienadministration und der Regulative
‒ Marketingkonzept und Marketingaktivitäten
‒ Koordination mit den Standorten bezüglich Räumlichkeiten, Arbeitsplätzen, Infrastrukturen
‒ Planung der Dozierenden, weiterer personeller (administrativer und wissenschaftlicher) Mitar-
beitenden, Rekrutierung der Dozierenden
‒ Erstellung der benötigten Lehrmaterialien bzw. Aufbau der Lernumgebungen
‒ Erarbeitung eines Konzeptes und Umsetzung der Massnahmen in Zusammenarbeit mit der
Fachstelle für Gender/Diversity zur signifikanten Erhöhung des Anteils an Studentinnen in den
Informatik-Studiengängen.
7.3.3 Teilprojekt 3: «Interdisciplinary Center for Artificial Intelligence» (ICAI)
Künstliche Intelligenz oder «Artificial Intelligence» (AI) ist eine der Schlüsseltechnologien der Zu-
kunft. In der Schweiz wird das Thema von verschiedenen staatlichen und nichtstaatlichen Stellen
aktiv bearbeitet, jedoch besteht bisher nirgends ein Fokus auf die sogenannten «Breiten-AI», also
die Anwendung von etablierter künstlicher Intelligenz zur Lösung alltäglicher Probleme in Wirt-
schaft und Gesellschaft. Dies stellt eine bisher nicht besetzte Nische dar.
Um das Thema rasch zu besetzen, wird zu diesem Zweck Anfang 2020 ein spezielles Kompe-
tenzzentrum, das ICAI «Interdisciplinary Center for Applied Artificial Intelligence» geschaffen wer-
den. Dieses hat eine Doppelrolle: Einerseits ist es im vierfachen Leistungsauftrag tätig, anderer-
seits übernimmt es eine interne Führungsrolle beim Thema AI. Das ICAI stellt für die ganze OST
eine Initiative «AI everywhere for everyone» zur Verfügung – mit dem Credo: «An der OST
schliesst niemand ein Studium ab, ohne Kenntnisse in Artificial Intelligence zu haben».
20/27RRB 2020/421 / Beilage
Die OST positioniert sich dabei als Bindeglied zwischen der Spitzenforschung im Bereich der
künstlichen Intelligenz und der praktischen Anwendung in einer Organisation – möglichst durch
alle Mitglieder dieser Organisation.
Die Komplexität von AI und der Ansatz «Breiten-AI» sind kein Widerspruch. Mit einem internen,
dreiteiligen Programm soll dieser Breiten-Ansatz eingeführt werden und als Grundlage für
eine fachspezifische, weiter ausbaubare AI-Expertise dienen:
‒ Teil 1: «Teach the Teachers»
Allen Dozierenden der OST wird ein Grundkurs in AI angeboten, bei dem auf ihre spezielle Si-
tuation/Daten eingegangen wird. Dieses «Teach the Teachers» Konzept hat zum Ziel, dass die
wichtigsten Influencer der nächsten Generation von FH Absolventinnen und Absolventen in der
Ostschweiz die Möglichkeiten und Limitationen von AI verstehen und in ihrer Lehr- und For-
schungstätigkeit anwenden können.
‒ Teil 2: «Teach the Students»
Alle Studierende der OST müssen einen Grundkurs in AI belegen. Dieser ist optimiert auf die
Vorkenntnisse der Studierenden und benutzt Daten aus den jeweiligen Fachgebieten, um die
Möglichkeiten von AI aufzuzeigen. Es geht darum, die Grundideen zu kommunizieren und den
Studierenden funktionierende Beispiele aus ihren Bereichen zu geben, welchen den Nutzen
dieser neuen Technologie aufzeigen. Diese Beispiele sollen als Startrampe für eigene Projekte
dienen.
‒ Teil 3: «AI Walk-In Service»
An jedem Standort der OST wird ein «AI Walk-In Service» angeboten. Die Idee dabei ist, den
Studierenden und Dozierenden einfach und unkompliziert aktive Hilfe beim Einsatz von AI
zu leisten. Dies geht von Literaturhinweisen, über Softwarepakete bis zu kleinen Demopro-
grammen und Zugriff auf Hochleistungsrechnern. Die vertiefte Beratung bis hin zur Erar-
beitung von spezifischen Lösungen läuft kooperativ im Rahmen einer «AI-Clinic».
Aus Sicht Ostschweiz und der OST wird folgender Nutzen angestrebt:
‒ Beitrag zum Image der Ostschweiz als Hightech-Standort
‒ Erhöhung des themenspezifischen Know-hows im Zukunftsthema AI und somit erhöhte Wett-
bewerbsfähigkeit von Industrie und Gewerbe in der Ostschweiz
‒ Gesellschaftlicher Nutzen durch Abbau von Vorurteilen und durch erhöhtes Wissen
‒ Beitrag zur Sichtbarmachung des Erfolgs der ITBO
‒ Aufwertung des Images der OST als moderne Hochschule am Puls der Zeit
‒ Pull-Effekt für alle Studiengänge der OST durch Reputationsgewinn der OST
‒ Organisatorische und thematische Horizonterweiterung (AI als zusätzliches, flexibles Tool für
bestehende und neue Lösungen in Instituten und Studiengängen)
‒ Erhöhte internationale Kooperationsfähigkeit
Elemente der im Teilprojektauftrag zu bestimmenden Arbeitspakete und Meilensteine sind:
‒ Gründung ICAI, inkl. personeller Besetzung, Ressourcen, Partnerschaften
‒ Marketingkonzept und -aktivitäten, öffentlicher Gründungsanlass
‒ Erarbeitung der interdisziplinären Lehrmaterialien für Lehrkräfte und Studierende
‒ Betriebskonzept und Start für die «Walk-in-Services» und die «AI-Clinic»
7.4 Kosten und erforderliche Ressourcen
Gemäss dem Kantonsratsbeschluss stehen für die ITBO im Schwerpunkt III, also für das vorlie-
gende Projekt «Kompetenzzentrum Angewandte Digitalisierung», 11,3 Mio. Franken zur Verfü-
gung. Dieser Betrag umfasst eine Agilitätsreserve von 10 Prozent, welche nur durch den Pro-
grammausschuss der ITBO freigegeben werden kann. Für die Planung stehen somit 10,2 Mio.
Franken zur Verfügung.
21/27RRB 2020/421 / Beilage
Die finanziellen Mittel werden pro zeitlich definierter Teilprojektphase verteilt. Es ist abzusehen,
dass – Genehmigung des Antrags vorausgesetzt – die Teilprojekte gemäss vorherigem Zeitplan
im zweiten Quartal 2020 mit der Initialisierungs-(Definitions-)Phase starten werden können und –
wie im Zeitplan im Abschnitt 7.2 dargestellt – in unterschiedlichen Geschwindigkeiten bis zum
Ende der Laufzeit der ITBO, März 2027, geführt werden. Dabei können die benötigten finanziel-
len Mittel von Jahr zu Jahr variieren, wobei v.a. bei den Teilprojekten 1 und 2 die ressourcenin-
tensivsten Phasen schon ab 2020 beginnen.
Die genauen Planungsdaten, Meilensteine und Ressourcen pro Teilprojekt werden erst bei deren
Definition bis Ende zweites Quartal 2020 bestimmt. Interne Vorstudien haben zur folgenden
Übersicht zur Aufteilung der finanziellen Mittel aus der ITBO geführt (s. Anhang 1), vorbehältlich
Anpassungen und Koordination nach der Bereitstellung der Teilprojektanträge bis Juni 2020:
Teilprojekte Budget 2020 – 2026
(Franken)
Gesamtprojektleitung, 400'000
Qualitäts-/Risiko-Management
Teilprojekt 1 «Innovative Lehr- und Lernumgebung» 5'610'000
1.a Digital unterstütztes Lehren und Lernen
1.b «Hybride Lernfabrik» und «DigitalLab» («Smart Factory»)
1.c Aufbau weiterer «DigiLabs»
Teilprojekt 2 «Martkerweiterung Informatikangebot» an den Standor- 1'540'000
ten St.Gallen und Rapperswil
Teilprojekt 3 «Interdisciplinary Center for Artificial Intelligence» (ICAI) 2'620'000
10% Agilitätsreserve 1'130'000
Total 11'300'000
Dies stellt die Anschubfinanzierung für die drei Teilprojekte dar. Diese benötigen aber auch Infra-
strukturen und Räumlichkeiten. Diese Zusatzkosten, wie z.B. Investitionen in IT-Infrastrukturen
für die «Artificial Intelligence», werden nicht über die ITBO finanziert. Sie werden aus Eigenmit-
teln der OST bestritten und sind im Leistungsauftrag 2021-2022 (und nachfolgenden) als Kosten
für Infrastrukturen und Räumlichkeiten aufgeführt.
Der Zeitplan in Abschnitt 7.2 sieht eine Reihe von Meilensteinen für das Jahr 2020 vor. Für die
weiteren Jahre sind diese in den jeweiligen Teilprojekten noch zu definieren.
Teilprojekte 2020 Q2 2020 Q4 2021 2022 2023-26
Meilensteine TP1-01 Von TP1: tbd tbd tbd
TP2-01 HF1a-01, HF1b-01, HF1c-01
TP3-01
TP2-02
TP2-03
TP3-02
22/27RRB 2020/421 / Beilage
Daraus lässt sich ein Finanzbedarf einschätzen, der bestimmte Mittel schon im Jahr 2020 benö-
tigt. Alle drei Teilprojekte sollen ab 2021 erste Resultate liefern, insbesondere soll die «Markter-
weiterung Informatikangebot» schon im Herbst 2021 weitgehend umgesetzt sein. Für die vier
Jahre von 2023 bis 2026 wird in der folgenden Tabelle nur eine gleichmässige Verteilung der
Restmittel (knapp 40 Prozent) veranschlagt. Die Teilprojektanträge sollen auch hier einen genau-
eren Bedarf an Finanzmitteln einplanen.
Teilprojekte 2020 Q2 2020 Q4 2021 2022 2023-26
Gesamtprojektleitung, Projektsupport, 20 40 70 70 200
Qualitäts-/Risiko-Management
TP1: Teilprojekt «Innovative Lehr- und 40 610 1'280 980 2'700
Lernumgebung»
HF1.a Digitales Lehren & Lernen
HF1.b «Smart Factory»
HF1.c Weitere «DigiLabs»
TP2: Teilprojekt «Martkerweiterung 40 260 720 220 300
Informatikangebot» an den Standorten
St.Gallen und Rapperswil
TP3: Teilprojekt «Interdisciplinary 40 580 750 400 850
Center for Artificial Intelligence» (ICAI)
Total (Tsd Franken) 140 1'490 2'820 1'670 4'050
Anteil von Total 10,17 Mio. (Prozent) 16.0% 27.7% 16.4% 39.9%
Gemäss dieser Schätzung fallen 60 Prozent der finanziellen Mittel von Mitte 2020 bis Ende 2022
an. Dies entspricht auch der raschen Umsetzung der Teilprojekte in den ersten zweieinhalb Jah-
ren. Graphisch dargestellt sieht die Verteilung der jährlich zu beantragenden Finanzmittel folgen-
dermassen aus
Abbildung 5: zeitliche Verteilung der zu beantragenden Finanzmittel (in Tsd. Franken) pro Teilprojekt und Jahr.
23/27Sie können auch lesen