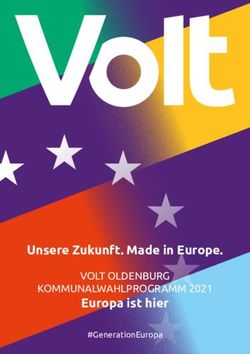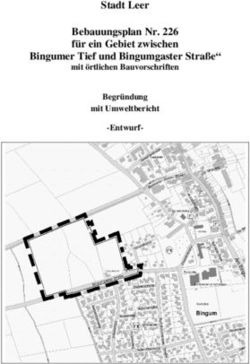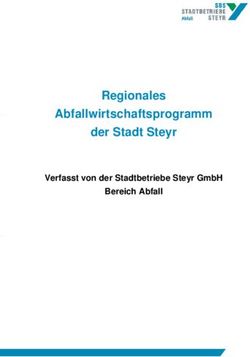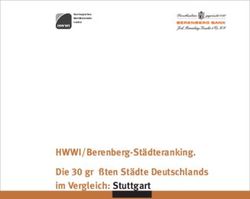Schöne Städte durch große Pläne? - Baukultur und integrierte Stadtentwicklungsplanung
←
→
Transkription von Seiteninhalten
Wenn Ihr Browser die Seite nicht korrekt rendert, bitte, lesen Sie den Inhalt der Seite unten
Raumforsch Raumordn (2010) 68:483–497
DOI 10.1007/s13147-010-0059-x
Wissenschaftlicher Beitrag
Schöne Städte durch große Pläne? – Baukultur und integrierte
Stadtentwicklungsplanung
Katharina Hackenberg · Rebekka Oostendorp ·
Claus-Christian Wiegandt
Eingegangen: 16. Februar 2010 / Angenommen: 19. Oktober 2010 / Online publiziert: 26. November 2010
© Springer-Verlag 2010
Zusammenfassung In den letzten Jahren wird das Thema the focus of discussion. At the same time there is a dis-
Baukultur auf allen Ebenen der Stadtentwicklungspolitik in course on the changed framework and characteristics of ur-
Deutschland zunehmend diskutiert. Dabei stehen insbeson- ban development planning. This article gives an introduc-
dere die Defizite in der baulichen Gestaltung der deutschen tion to current integrated urban development plans of the
Städte im Vordergrund. Gleichzeitig findet ein Diskurs 20 major cities in Germany and analyses them with regard
über veränderte Rahmenbedingungen und Eigenschaften to statements and objectives about urban design. Finally
der Stadtentwicklungsplanung statt. In diesem Beitrag wer- the two case studies of Cologne and Munich illustrate the
den die aktuellen Stadtentwicklungspläne der 20 größten different treatment of the topic building culture in urban
Städte in Deutschland vorgestellt und im Hinblick auf ihre development planning.
Aussagen zu stadtgestalterischen Zielen untersucht. An-
hand der beiden Fallbeispiele Köln und München wird der Keywords Building culture · Urban design · Urban
unterschiedliche Umgang mit dem Thema Baukultur in der policy research · Integrated urban development planning ·
Stadtentwicklungsplanung verdeutlicht. Overall-concept of urban development · Cologne · Munich
Schlüsselwörter Baukultur · Stadtgestaltung ·
Stadtpolitik · Integrierte Stadtentwicklungsplanung · 1 E
inführung: Wie passen Baukultur und
Leitbild · Köln · München Stadtentwicklungsplanung zusammen?
Seit etwa zehn Jahren stehen zwei Themen auf der stadt-
Beautiful Cities by Great Plans?—Building Culture entwicklungspolitischen Tagesordnung, die in wissen-
and Integrated Urban Development Planning schaftlichen Beiträgen bisher konzeptionell noch nicht
zusammengeführt wurden. Zum ersten erleben Stadtent-
Abstract In recent years building culture has become an wicklungspläne seit einigen Jahren in Deutschland eine
issue of increasing interest in urban development policy in Renaissance. Unter der deutschen EU-Ratspräsidentschaft
Germany. The deficiencies in urban design quality are in in der ersten Jahreshälfte 2007 ist es gelungen, dieses
Thema in der Leipzig Charta zur nachhaltigen europäischen
Stadt (BMVBS 2007a) nicht nur in Deutschland, sondern
K. Hackenberg · R. Oostendorp · Prof. Dr. C.-C. Wiegandt () auch in Europa als eine zentrale Angelegenheit der Stadt-
Stadt- und Regionalforschung, Geographisches
Institut der Universität Bonn, Meckenheimer Allee 166, entwicklungspolitik zu benennen (BMVBS 2009: 16). Zum
53115 Bonn, Deutschland zweiten handelt es sich um das Thema der Baukultur, das als
E-Mail: k.hackenberg@geographie.uni-bonn.de neues Politikfeld inzwischen auf allen staatlichen Ebenen
R. Oostendorp in Deutschland angekommen ist. Es geht dabei um „gutes
E-Mail: r.oostendorp@geographie.uni-bonn.de Planen und Bauen und das Reden darüber“ (BMVBS 2009:
Prof. Dr. C.-C. Wiegandt 71). Wir fassen darunter in unserem Beitrag vor allem die
E-Mail: wiegandt@geographie.uni-bonn.de Gestaltung der gebauten Umwelt in den Städten. Damit484 K. Hackenberg et al.
klammern wir Aspekte der Nutzung und Aneignung der Vergleich der beiden großen deutschen Städte Köln und
gebauten Umwelt, die in der Definition der Bundesregie- München (Abschn. 5). In zwei Fallstudien wollen wir hier
rung zur Baukultur einbezogen werden (BMVBW 2001: anhand eigener empirischer Erhebungen die unterschied-
11), bewusst aus. lichen Strategien im Zusammenhang mit übergeordneten
In unserem Beitrag wollen wir die beiden Themenbereiche Planungen bei der Stadtgestaltung aufzeigen. Ziel unseres
der Stadtentwicklungspläne und der Baukultur aufeinander Beitrages ist es also, für den Bereich der baulichen Gestal-
beziehen. Ausgangspunkt für unsere Überlegungen sind tung die Möglichkeiten der integrierten Stadtentwicklungs-
eigene Forschungen, die wir im Rahmen eines Projekts der politik für die Stadtgestaltung auszuloten und Perspektiven
Deutschen Forschungsgemeinschaft (DFG) in den letzten aufzuzeigen, wie die gestalterischen Qualitäten beim Planen
drei Jahren über die unterschiedliche Gestaltung deutscher und Bauen verbessert werden können.
Städte durchgeführt haben. Dabei ist eine zentrale Erkennt-
nis, dass unterschiedliche Bau- und Planungskulturen ein
wesentliches Erklärungsmoment für eine räumliche Diffe- 2 Stadtentwicklungsplanung im Wandel
renzierung der Stadtgestalt sind (vgl. Abschn. 5). In unserem
Beitrag wollen wir nun in diesem Zusammenhang nach dem Bevor wir nun auf die Situation der Stadtentwicklungs-
Stellenwert der integrierten Stadtentwicklungspläne fragen planung in der jüngeren Zeit eingehen, ist es hilfreich, die
und dabei die folgenden Forschungsfragen beantworten: unterschiedlichen Formen der Einflussnahme auf Stadt-
gestaltung in einer eher grundsätzlichen Art und Weise zu
• Welchen
Stellenwert nimmt das Thema Stadtgestaltung
charakterisieren. Dazu kann ein Modell dienen, das der
in integrierten Stadtentwicklungsplänen ein?
Politikwissenschaftler Hubert Heinelt (2006: 237 ff.) in die
• Welche räumlichen, inhaltlichen und institutionellen
Debatte über die räumliche Planung eingebracht hat. Heinelt
Aussagen für die Steuerung der Stadtgestaltung sind in
unterscheidet drei „Welten“ des staatlichen Handelns in der
den Plänen formuliert und wie unterscheiden sich die
Planung. In einer „höheren Welt“, dem „third order gover-
Aussagen zwischen den Städten?
ning“ (oder „meta governing“, wie er es nennt), geht es um
• Welche Konsequenzen für die Praxis der Stadtgestaltung
die Entwicklung von Leitbildern in der räumlichen Planung,
leiten die Akteure vor Ort (in Köln und München) aus
die nicht auf konkrete Einzelfälle ausgerichtet sind. Hier
diesen Plänen ab?
steht die grundsätzliche Bestimmung von Zielvorstellungen
• In welchem Verhältnis stehen die integrierten Stadtent-
im Sinne einer Reflexion über Handlungsmöglichkeiten im
wicklungspläne zur jeweiligen Planungskultur im The-
Vordergrund. Von dieser „Welt“ unterscheidet Heinelt die
menfeld der Stadtgestaltung?
Ebene des „first order governing“, bei der es um die kon-
Nach einer kurzen Einordnung der umfassenden Ansätze krete Planung der Durchführung eines einzelnen Vorhabens
der Stadtentwicklungsplanung in die verschiedenen Pha- geht – sei es um ein einzelnes Gebäude oder auch um eine
sen räumlicher Planung der letzten Jahrzehnte (Abschn. 2) konkrete Infrastrukturmaßnahme. Zwischen diesen beiden
werden wir zunächst in Anlehnung an die Ergebnisse einer „Welten“ identifiziert Heinelt das „second order governing“
jüngst erschienenen Studie des Deutschen Instituts für Urba- als eine räumliche Planungswelt, in der die konkreten Ein-
nistik die Verbreitung von integrierten Stadtentwicklungs- zelmaßnahmen in Durchführungsplanungen umgesetzt wer-
plänen in deutschen Städten betrachten (Abschn. 3) und die den. Die drei „Welten“ unterscheiden sich in der Art und
Pläne hinsichtlich ihres Beitrages für die Stadtgestaltung Weise, wie die beteiligten Akteure miteinander kommuni-
untersuchen (Abschn. 4). Im Anschluss geht es uns um den zieren und interagieren. Während bei der Herausarbeitung
handlungsleitender Orientierungen Dialog und Diskurs
bestimmende Kommunikationsformen sind, ist die Umset-
1
Wir stützen uns dabei auf unser abgeschlossenes Dfg-Projekt „Bau-
kultur – regionale Differenzierungen in der stadtgestalt“. ergebnisse zung von Planung eher durch hierarchische Interventionen
finden sich zu verschiedenen Aspekten unseres Projekts bei Brzenc- geprägt. Zwischen den einzelnen „Welten“ sollte es aber
zek/Wiegandt (2007), Brzenczek/Wiegandt (2009a), Brzenczek/Wie- Beziehungen geben, die durch die verschiedenen Pfeile in
gandt (2009b). Des weiteren beziehen wir uns auf einen gemeinsamen Abb. 1 angedeutet werden. Die Ausgestaltung dieser Bezie-
Vortrag beim geographentag in Wien, bei dem wir in der leitthemen-
sitzung „Krise der Planung?“ den Zusammenhang zwischen stadtent- hungen erscheint uns für eine erfolgreiche Planung ein zen-
wicklungsplanung und Baukultur hergestellt haben. Dazu haben wir, traler „Schlüssel“ zu sein.
ergänzend zur empirie des Dfg-Projekts, umfangreiche recherchen In Deutschland hat es im Laufe der letzten Jahrzehnte
in den 20 größten deutschen städten durchgeführt. schließlich konn- verschiedene historische Phasen im Verständnis von Stadt-
ten wir unser ursprüngliches Manuskript durch die konstruktiven Vor-
planung gegeben, in denen übergeordnete und zusammenfas-
schläge zweier gutachter verbessern, denen wir unbekannterweise an
dieser stelle herzlich danken. sende Konzepte einen jeweils unterschiedlichen Stellenwert
2
Vgl. auch die Umfrage zur Planungskultur unter http://www.pla- eingenommen haben. Dabei standen die beschriebenen
nung-neu-denken.de (letzter Zugriff am 01.07.2010). drei „Welten“ jeweils in einem unterschiedlichen Verhält-Schöne Städte durch große Pläne? – Baukultur und integrierte Stadtentwicklungsplanung 485 Planung als al. 2003: 13 ff.). Dabei spielen aktuell bei einer strategischen >>meta governing>second order governingvote>first order governing
486 K. Hackenberg et al.
Abb. 2 stadtentwicklungspläne in Deutschland – eine auswahl
und gemeinden zutrifft (BMVBs/BBsr 2009: 46). auch gung unterschiedlicher Handlungsfelder aus den Bereichen
unsere zeitgleich und unabhängig vom Difu-Projekt durch- Städtebau, Wirtschaft, Soziales, Kultur und Ökologie, die
geführten recherchen in den 20 einwohnerstärksten städten häufig durch eigenständige sektorale Konzepte ergänzt wer-
von Berlin bis Mannheim belegen dies (vgl. anhang 1 und den (BMVBS/BBSR 2009: 50 ff.). Bei unserer Analyse der
abb. 2). Stadtentwicklungspläne der 20 größten Städte lässt sich
aufgrund des geringen formalisierungsgrades von stadt- ebenfalls eine Tendenz zu einer großen Vielzahl und Viel-
entwicklungskonzepten und deren selbstverständnis als falt an Themenfeldern in den einzelnen Plänen feststellen,
lokal spezifische Prozesse (Berding 2006: 172 f.) bestehen die in unterschiedlicher Aussagetiefe zu einer umfassen-
zwischen den Plänen der 20 größten deutschen städte zum den Behandlung aller stadtrelevanten Aspekte führen (z. B.
Teil erhebliche Unterschiede sowohl in den Begrifflichkeiten München, Leipzig, Wuppertal). Es gibt jedoch auch einige
als auch bei den inhalten, den räumlichen geltungsbereichen Pläne, die wenige, stadtspezifische und aus ihrer Sicht
und dem ablauf der Planungsprozesse. frey/Keller/Klotz et zukunftsorientierte Themen in den Mittelpunkt der Betrach-
al. (2003: 14) sprechen in diesem Zusammenhang von der tung stellen (z. B. Frankfurt am Main, Düsseldorf).
„entstandardisierung“ der Planungspraxis und betonen die Je nach Art des Konzepts unterscheiden sich die Pläne
individualität der neuen stadtentwicklungspläne. Und doch auch in ihrem räumlichen Geltungsbereich. Während sich
haben alle Pläne den gleichen grundgedanken, im sinne des einige Städte in ihren Planungen auf Teilräume konzentrie-
third order governing leitbilder für die zukünftige stadtent- ren, stellen andere Leitlinien für die Gesamtstadt auf. Bei
wicklung zu entwerfen. den Teilräumen handelt es sich häufig um die Innenstadt,
Die bereits erwähnte studie des Difu hat die Vielfalt inte- teilweise erweitert durch einzelne Schwerpunkträume mit
grierter Konzepte in Deutschland aufbereitet und kommt zu besonderen Entwicklungspotenzialen. Bei gesamtstädti-
dem ergebnis, dass gesamtstädtische stadtentwicklungskon- schen Ansätzen ergeben sich in der Umsetzung durch die
zepte und leitlinien bzw. leitbilder zur stadtentwicklung Verteilung von Projekten ebenfalls teilweise räumliche
am häufigsten in deutschen Städten vorhanden sind. Außer- Schwerpunkte. Die für die Gesamtstadt formulierten Ziele
dem wurden in vielen städten die eher auf teilräume aus- stehen jedoch in diesen Fällen weiterhin im Vordergrund.
gerichteten integrierten entwicklungskonzepte der sozialen Dabei sind die meisten Städte bemüht, die Sichtweise ver-
stadt und des stadtumbaus sowie (integrierte) stadtteilent- schiedener lokaler Akteure und lokalspezifische Stärken und
wicklungspläne eingesetzt (BMVBs/BBsr 2009: 46 f.). Schwächen zu berücksichtigen (vgl. auch Frey/Keller/Klotz
Die betrachteten Pläne der 20 größten städte spiegeln eben-
falls die große Bandbreite integrierter Konzepte wider. Bei
Räumlicher Geltungsbereich der Stadtentwicklungspläne a) im
unserer analyse wurden jedoch nur leitlinien bzw. leitbil- Wesentlichen für die Innenstadt: Köln, Frankfurt am Main, Hannover,
der zur stadtentwicklung, stadtentwicklungskonzepte und Nürnberg, Mannheim; b) für die Innenstadt und weitere Schwerpunkt-
räume mit besonderen Entwicklungspotenzialen: Berlin, Dortmund,
stadtentwicklungspläne (steP) berücksichtigt.
Dresden, Bonn; c) für die Gesamtstadt: Hamburg, München, Stuttgart,
ein wichtiges Merkmal integrierter stadtentwicklungs- Essen, Düsseldorf, Bremen, Leipzig, Duisburg, Bochum, Wuppertal,
konzepte ist ihre thematische Breite und die Berücksichti- Bielefeld.Schöne Städte durch große Pläne? – Baukultur und integrierte Stadtentwicklungsplanung 487
et al. 2003: 14 f.). Daraus folgt, dass in den meisten Fällen 2002: 23). Damit sind Architekten und Ingenieure, Stadt-
die gemeinsame Entwicklung dieser Zielvorstellungen eine planer und Landschaftsarchitekten als Adressaten angespro-
zentrale Rolle spielt. So tragen ein gemeinsamer Erarbei- chen, die in ihren jeweiligen Professionen Verantwortung
tungsprozess und der damit verbundene Dialog mit externen für die Gestaltung der gebauten Umwelt übernehmen, damit
Experten und Bürgern in hohem Maße und mehr noch als sind aber auch die privaten und öffentlichen Bauherren und
das letztendlich vorliegende Konzept zur Steuerungswir- Investoren, die Stadtbauräte und Kommunalpolitiker ange-
kung und damit zum Erfolg von Stadtentwicklungsplänen sprochen, die in ihren unterschiedlichen Rollen und Funk-
bei (Frey/Keller/Klotz et al. 2003: 17; Berding 2006: 172; tionen Entscheidungen über die Gestaltung der gebauten
Beste 2009: 32). Trotzdem verzichten einige Städte bei der Umwelt treffen.
Erstellung ihrer integrierten Konzepte auf eine Beteiligung Über die Probleme der Gestaltung der gebauten Umwelt
der Bürger (vgl. auch BMVBS/BBSR 2009: 59 ff.). Bei hat in den vergangenen zehn Jahren in Deutschland ein
anderen Städten zeigt sich eine große Bandbreite bezüglich breiter Diskurs eingesetzt (vgl. Becker 2006; Durth/Sigel
der Intensität und des Zeitpunkts der öffentlichen Beteili- 2009: 23). Auf den Ebenen des Bundes, der Länder sowie
gung. Der Beteiligungsprozess beim Masterplan Köln doku- der Städte und Gemeinden findet dieser Diskurs unter dem
mentiert, dass eine intensive und transparente Beteiligung Stichwort der Baukultur statt (BBR 2002; BMVBS 2007b;
von Akteuren aus Verwaltung, Politik und Bürgerschaft ein BMVBS 2007c). Damit ist eine neue Form der Architek-
wesentlicher Faktor für eine hohe Qualität und Akzeptanz tur- und Städtebaupolitik angestoßen worden, die u. a. einer
des Ergebnisses ist (Beste 2009: 30 f.). Identitätsstiftung sowie der Imageverbesserung und Wirt-
Weiterhin ist die Beschlusslage zu solchen übergreifen- schaftsförderung dienen soll. Es wird gefordert, die Qualität
den und eher informellen Konzepten nicht einheitlich. So der gebauten Umwelt im Alltag des Planens und Bauens vor
gibt es teils am Anfang des Prozesses politische Beschlüsse Ort in den Städten und Gemeinden zu verbessern.
über die Aufstellung eines Konzepts. Teils werden aber auch Auf nationaler Ebene hat die Bundesregierung im Herbst
erst nach Abschluss der Planungen formale Vereinbarungen 2000 eine eigene Initiative zur Architektur und Baukultur
über die inhaltlichen Ziele oder deren Umsetzung getrof- ins Leben gerufen.10 Es handelt sich um einen Zusammen-
fen. Dabei ist zu vermuten, dass die Pläne durch politische schluss aller am Bau beteiligten Institutionen unter der
Beschlüsse im Sinne des second order governing in gewis- Federführung des Bundesministeriums für Verkehr, Bau
ser Weise legitimiert und damit in ihrer Umsetzung gestärkt und Stadtentwicklung. Ziel der Initiative ist es, das Thema
werden. des Bauens und Planens stärker zu popularisieren. Es geht
darum, das allgemeine Bewusstsein für Baukultur zu schär-
fen. Langfristig soll die Qualität der gebauten Umwelt ver-
4 D
as Thema der Baukultur in den neuen bessert werden. Gleichzeitig sollen die Möglichkeiten des
Stadtentwicklungsplänen Exports von Bau- und Planungsdienstleistungen gestärkt
werden.
4.1 Gestalterische Defizite in der gebauten Umwelt und Um diese Ziele zu erreichen, hat es in den letzten Jah-
Reaktionen der Architektur- und Städtebaupolitik ren zahlreiche Veranstaltungen und Kongresse gegeben, bei
denen über das Thema der Baukultur debattiert und gestritten
Bei der Gestaltung der gebauten Umwelt werden in wurde. Dabei kam es auch zu einer Präzisierung des schil-
Deutschland in den letzten Jahren häufig Defizite beklagt. lernden Begriffes der Baukultur. So werden unter Baukultur
Der Philosoph Wolfgang Welsch brachte es im Dezember neben der Ästhetik bzw. der Schönheit der gebauten Umwelt
2002 im Rahmen des „Ersten Nationalen Kongresses zur ebenso die Aspekte der Funktionalität bzw. des Gebrauchs-
Baukultur“ in folgender Weise auf den Punkt: „Wir befinden wertes, der Nachhaltigkeit im ökonomischen, ökologischen
uns, was unsere gebaute Umwelt angeht, in einer Phase der und sozialen Sinne sowie der Nachhaltigkeit im Verfahren,
Ernüchterung – ja vielleicht sogar tiefer Enttäuschung und also des Zustandekommens von Entscheidungen zur gebau-
Ratlosigkeit. Die hehren Modelle der älteren und neueren ten Umwelt, verstanden. Diese vier Dimensionen der Bau-
Moden haben sich, gelinde ausgedrückt, nicht als zielfüh- kultur werden auf die gesamte gebaute Umwelt bezogen,
rend erwiesen. Die Resultate sind nicht wie erhofft“ (Welsch also nicht nur auf herausgehobene Einzelbauwerke, sondern
auch auf Alltagsarchitektur, Ingenieurleistungen, Freiraum-
Keine öffentliche Beteiligung im Planungsprozess erfolgt z. B. in
planungen oder andere planerische Zugänge.
München, Frankfurt am Main, Düsseldorf, Dresden, Bochum und Im Laufe der letzten Jahre wurden verschiedene Berichte
Wuppertal.
zur Lage der Baukultur verfasst, die teilweise auch im
Zeitpunkt politischer Beschlüsse über Stadtentwicklungskonzepte
(Auswahl): zu Anfang des Prozesses: München, Stuttgart, Dortmund,
Duisburg, Bonn, Mannheim; nach Abschluss der Planungen: Ham- 10
http://www.architektur-baukultur.de (letzter Zugriff am
burg, Köln, Essen, Bremen, Leipzig. 01.07.2010).488 K. Hackenberg et al.
Abb. 3 Stellenwert der Baukul- Ausrichtung der Konzepte
tur in den Stadtentwicklungs-
plänen der 20 größten deutschen teilräumlich/sektoral gesamtstädtisch
Städte
1 2 3 4
B M K F DO M K L BO W
explizit
Leitbild-/ Zielebene
Thema Baukultur
H BN MA
N HH S E D HB
implizit
Unterziel oder
erläuternder Text DD DU BI
1 Innenstadtkonzept München 3 Perspektive München
2 Masterplan Innenstadt Köln 4 Leitbild 2020 Köln
Deutschen Bundestag diskutiert wurden. Nach einigen merksam macht und eine Diskussion mit der Bürgerschaft
Querelen im Gesetzgebungsverfahren hat inzwischen eine anstoßen will.
bundesweite Stiftung Baukultur im Jahr 2008 ihre Arbeit
aufgenommen (Durth/Sigel 2009: 732). Sie will nach ihrem 4.2 Stellenwert der Baukultur in den Plänen der 20
eigenen Anspruch als „unabhängige Instanz in der Bevölke- größten Städte Deutschlands
rung für ein Bewusstsein und den Dialog über die Qualität
unserer gebauten Umwelt“ werben. Daneben wird auf Bun- Um den Stellenwert von Baukultur in der neuen integrierten
desebene weiterhin die Initiative „Architektur und Baukul- Stadtentwicklungspolitik zu klären, haben wir für die 20
tur“ als Politikansatz geführt (BMVBS 2009: 71). größten deutschen Städte untersucht, wie das Thema Bau-
In einigen Bundesländern ist die Idee der bundesweiten kultur in den neu entstandenen Konzepten präsent ist. Da
Initiative inzwischen ebenfalls aufgegriffen bzw. zeitgleich mit Mitteln des formalen Planungsrechts kaum Einfluss
entwickelt worden (vgl. Anhang 2). So sind beispielsweise auf die Qualität der Stadtgestalt genommen werden kann
in Hessen und Nordrhein-Westfalen, in Rheinland-Pfalz und (Ganser 2006: 542), baukulturelle Belange also nicht in den
Bremen, in Sachsen und Sachsen-Anhalt sowie in Mecklen- „Welten“ des first order governing und des second order
burg-Vorpommern und Thüringen entsprechende Landesin- governing institutionell verankert sind, verwundert es nicht,
itiativen entstanden, die Überlegungen zur Baukultur in die dass das Thema in den eher informellen Verfahren der Stadt-
jeweilige Landespolitik einbringen. entwicklungsplanung auftaucht. Die Ebene des third order
Doch nicht nur auf der Ebene des Bundes und der Län- governing bietet damit auch neuen und eher „weichen“
der wurden inzwischen entsprechende Aktivitäten entfaltet. Themen die Möglichkeit, Einzug in die Planungswelten
Auch in den Städten und Gemeinden gibt es heute vielfäl- zu halten. Die Verbesserung der stadtgestalterischen Qua-
tige und vielversprechende Ansätze, um die Qualität der lität wird in allen untersuchten Städten als ein Ziel benannt
gebauten Umwelt zu erhöhen. Dabei geht es sowohl um die (vgl. Abb. 3). Stadtgestaltung wird auf diese Weise als eine
bessere Gestaltung des öffentlichen Raumes als auch um die „neuartige Problemstellung“ in den neuen Stadtentwick-
bessere Gestaltung von Hochbauten. Hier ist auf das große lungsplänen berücksichtigt (vgl. auch Frey/Keller/Klotz et
bürgerschaftliche Engagement in diesem Feld zu verwei- al. 2003: 15).
sen. Stellvertretend für andere große deutsche Städte seien Allerdings unterscheidet sich der Stellenwert dieses
ohne Anspruch auf Vollständigkeit für die Stadt Köln einige Themas im Verhältnis zu anderen Zielen der Stadtentwick-
dieser Initiativen genannt (vgl. Anhang 3). So gibt es einen lungspläne zwischen den einzelnen Städten deutlich. Ent-
eigenen Internet-Auftritt der Kölner Architekturszene, der sprechend der in den meisten Plänen identifizierten Struktur
in vorbildlicher Weise Aktuelles zur Baukultur in Köln auf- mit Hauptzielen und untergeordneten Zielen wird dabei
bereitet. Darüber hinaus gibt es regelmäßig stattfindende zwischen zwei Ebenen unterschieden. Während in einigen
Diskussionsveranstaltungen, die durch den Bund Deutscher Plänen stadtgestalterische Aspekte – neben anderen The-
Architekten (BDA), das Haus der Architektur oder das KAP- men – auf der Ebene von Zielen und Leitlinien einen hohen
Forum (Kommunikationsplattform für Architektur, Techno- Stellenwert erhalten, wird das Thema Baukultur in anderen
logie, Design) organisiert werden. Schließlich gibt es seit Fällen nur in allgemeinen Formulierungen innerhalb der
inzwischen elf Jahren eine jährlich stattfindende Architek- Unterkapitel behandelt. Diese Unterschiede gehen teilweise
turwoche, die auf die Anliegen des Planens und Bauens auf- auf die inhaltliche und räumliche Ausrichtung des Gesamt-
13Schöne Städte durch große Pläne? – Baukultur und integrierte Stadtentwicklungsplanung 489
konzeptes zurück. So nehmen teilräumliche bzw. sektorale Im Stadtentwicklungskonzept Stuttgart wird innerhalb des
Pläne das Thema Baukultur meist explizit als eigenständi- Leitzieles „Urbane Qualitäten stärken“ formuliert, dass „der
ges Leitbild oder Ziel auf. Gesamtstädtische Pläne mit ihrer charakteristische Grundriss der Stadt und ihre Silhouette“
Vielzahl an Handlungsfeldern erwähnen stadtgestalterische im Sinne einer „Weiterentwicklung der großen Architektur-,
Aspekte dagegen eher in Verknüpfung mit anderen Themen- Städtebau- und Ingenieurtradition“ als ein identitätsstif-
bereichen. Jedoch gibt es auch gesamtstädtische Pläne, die tendes Merkmal erhalten werden sollen (Landeshauptstadt
dem Thema Baukultur einen hohen Stellenwert geben (Mün- Stuttgart 2006: 13 f.). Weitere Beispiele für eine Einbet-
chen, Köln, Leipzig, Bochum, Wuppertal) (vgl. Abb. 3). tung stadtgestalterischer Aussagen in andere Themen sind
In insgesamt elf der 20 größten Städte wird Baukultur die Pläne der Städte Essen, Düsseldorf, Bremen, Dresden,
explizit in den Überschriften der einzelnen Planungsthe- Nürnberg, Duisburg und Bielefeld. Dabei werden in man-
men genannt. Auch hier gibt es jedoch Unterschiede in der chen Plänen bereits konkrete Vorstellungen zu stadtgestal-
inhaltlichen Ausgestaltung und Aussagetiefe. So beschäf- terischen Inhalten und deren Umsetzung benannt. So wird
tigen sich in Berlin gleich drei von neun Zielen des Plan- im Stadtentwicklungsprozess Essen ein Handlungsziel im
werks Innenstadt mit stadtgestalterischen Aspekten.11 Die Kapitel „Perspektive Wirtschaftsflächen“ folgendermaßen
Perspektive München betont in ihrer Leitlinie „Münchner formuliert: „Bei der Erstellung von Bebauungsplänen und
Stadtgestalt bewahren – Neue Architektur fördern“ vor der Umsetzung von Gewerbeansiedlungen ist die Einhal-
allem die Verknüpfung von alter und neuer Bausubstanz tung gestalterischer Grundlagen zu fordern“ (Stadt Essen
(Landeshauptstadt München 2005: 56 f.). In Dortmund und 2007: 42 f.). In diesem Zusammenhang sollen Gestaltungs-
Leipzig wird dagegen „nur“ die traditionelle Denkmalpflege richtlinien für Gewerbegebiete erarbeitet werden. Dieses
und nicht eine neue qualitätsvolle Architektur oder Gestal- Beispiel verdeutlicht darüber hinaus, inwieweit die eher
tung als eigenständiges Ziel aufgenommen. Das Verhältnis informellen Ziele und Überlegungen auf der Ebene des third
zur Gesamtzahl der behandelten Themen gibt ebenfalls order governing auch zu einer praktischen Umsetzung in
einen Hinweis auf die Bedeutung der Stadtgestalt in den der Durchführungsplanung des first order governing führen
Plänen. Während in Hannover beispielsweise zwei der vier können, und stellt damit mögliche Verknüpfungen zwischen
Ziele des Leitbildes dem Thema Baukultur zugeordnet wer- den einzelnen „Planungswelten“ dar (vgl. Abschn. 2).
den können („Funktion und Gestaltung öffentlicher Räume“ Trotz der dargestellten Unterschiede in der Gewichtung
und „Qualitätsstrategien für Städtebau und Architektur“), und inhaltlichen Ausgestaltung des Themas Stadtgestalt in
steht „Städtebau, Stadtplanung und Baukultur“ in Bochum den Stadtentwicklungsplänen wird deutlich, dass ein qua-
neben elf weiteren Themen. In Frankfurt am Main wird das litativ ansprechendes Stadtbild auf der Ebene der Leitbild-
Thema Baukultur mit dem Hochhausentwicklungsplan als entwicklung zumindest in den großen deutschen Städten
„stadtgestalterisches Leitbild für Hochhausbebauung“ sogar angekommen ist. Wichtig wäre nun eine Übertragung dieser
als einziges und ausdrückliches Ziel des Plans herausge- Ziele und Ideen auf die beiden anderen „Planungswelten“.
stellt. Dies ist jedoch das einzige Beispiel dafür, dass sich
ein gesamter Plan dem Thema Stadtgestalt widmet.
In neun Städten wird das Thema Baukultur nicht als 5 B
aukultur in den Stadtentwicklungskonzepten
explizites Leitbild oder Ziel formuliert. Das bedeutet jedoch von Köln und München
nicht, dass das Thema in den Plänen nicht vorkommt. In
diesen neun Plänen werden baukulturelle Aspekte als Unter- Wir konnten bisher zeigen, dass eine Renaissance der über-
punkte in verschiedenen Themenfeldern oder Zielformulie- greifenden Planung erkennbar ist. Es wurde dabei deutlich,
rungen behandelt. So wird z. B. im räumlichen Leitbild der dass das Thema „Baukultur“ in allen größeren Städten Ein-
Stadt Hamburg in der Zielbotschaft „Stadt erleben Hamburg“ gang in die Leitbildentwicklung gefunden hat. Allerdings
unter anderem eine Aufwertung öffentlicher Räume und eine unterscheiden sich die Stadtbilder bzw. die Qualität der
Inszenierung der Stadt angestrebt. In diesem Zusammen- gebauten Umwelt zwischen den deutschen Städten deutlich.
hang wird die Umgestaltung der Innenstadtplätze und ein Damit gibt es Unterschiede im lokalen Kontext, die die Aus-
Lichtkonzept für die Innenstadt thematisiert sowie „bei der gangs- und Zielpunkte für die Leitbildprozesse darstellen
künftigen Entwicklung […] zur Wahrung Hamburgischer und die die Entwicklung von Umsetzungsstrategien beein-
Identitäten eine Orientierung an den typischen Höhenver- flussen. Die Unterschiede der gebauten Umwelt zwischen
hältnissen“ gemäß der Entwicklungsstrategie „Stadtgestalt deutschen Städten lassen sich nicht monokausal erklären.
Hamburg“ gefordert (Stadt Hamburg 2007: 162, 166, 173). Vielmehr ist eine Vielzahl von Faktoren für diese Diffe-
renzierungen verantwortlich. Verschiedene Ansatzpunkte
zur Erklärung – wie das historische Erbe, die Entwicklung
11
Planungsziele des Planwerks Innenstadt: http://www.stadtentwick-
lung.berlin.de/planen/planwerke/de/planwerk_innenstadt/anlass_ziel/ von regionalen Baustilen oder eine unterschiedliche Wirt-
planungsziele.shtml schaftskraft – sind offensichtlich. Gleichzeitig gibt es aber490 K. Hackenberg et al.
auch Unterschiede im Umgang mit der gebauten Umwelt 5.1 Fallstudie Köln
zwischen einzelnen städten, die daher rühren, dass fragen
der stadtgestalt politische Prozesse in der stadtgesellschaft In Köln mangelt es seit der Nachkriegszeit an einer klaren
vor Ort durchlaufen. sie werden nicht nur direkt zwischen Linie in der Stadtgestalt, wozu die „zweite Zerstörung der
Bauherren und kommunaler Verwaltung bzw. Politik ausge- Stadt“ in Form des autogerechten Wiederaufbaus mit der
handelt, sondern auch in Zeitungen, foren und informations- Überformung alter Strukturen ihren Beitrag geleistet hat.
plattformen diskutiert. Die örtlichen auseinandersetzungen Der Stadt wird heute von den Unternehmern der Region
darüber und die institutionalisierung durch instrumente, Köln ein eher zerrissenes Stadtbild bescheinigt: „Betrachtet
gremien und Prozesse im rahmen der Baugenehmigungs- man die Kölner Innenstadt, so bietet sie ein recht zerklüf-
und Bauleitplanverfahren werden von stadt zu stadt unter- tetes Bild“ (Bauwens-Adenauer/Soénius 2009: 11). Diese
schiedlich geregelt. Die gebaute Umwelt ist demnach als bauliche Heterogenität wird von zahlreichen Experten, die
das resultat zahlreicher handlungen zu verstehen, die im wir interviewt haben, als Manko beschrieben. Exemplarisch
rahmen eines institutionellen Kontextes und eines gesell- für diesen Befund kann auch der eindrucksvolle Fotoband
schaftspolitischen Umfeldes vor Ort stattfinden. von Reinhard Matz (2005) dienen. Das enge Nebeneinan-
Wir haben dies im rahmen eines Dfg-Projektes unter- der unterschiedlicher Stilrichtungen kann nach Einschät-
sucht (vgl. Brzenczek/Wiegandt 2007, Brzenczek/Wiegandt zung des Baudezernenten Bernd Streitberger auch positiv
2009a, Brzenczek/Wiegandt 2009b) und dabei in annähe- gewendet werden, wenn betont wird, dass der Vitalität und
rung an die Beantwortung der frage nach unterschiedlichen hohen Individualität Kölns mittels eines heterogenen Stadt-
Planungskulturen und deren Einfluss auf das Erscheinungs- bildes besonderer Ausdruck verliehen wird. In dieser Lesart
bild der städte insgesamt vier fallstudienstädte für eine wird Köln als eine Stadt der Vielseitigkeit und Abwechslung
explorative analyse gewählt: neben den hier betrachteten interpretiert, die sich durch eine gewisse Kleinteiligkeit aus-
städten Köln und München haben wir auch die städte Bonn zeichnet und dabei ebenso Solitäre wie das Weltstadtkauf-
und Braunschweig untersucht. Die Kriterien für die auswahl haus von Renzo Piano über der Nord-Süd-Fahrt (Abb. 4)
der städte waren ihre größe, ihre lage in Westdeutschland oder jüngst die Kranhäuser von Hadi Teherani im Rheinau-
und ihre wirtschaftliche Prosperität. Obwohl bei einigen hafen (Abb. 5) ermöglicht.
Merkmalen ähnlich, decken unsere vier fallstudienstädte Dass ein solches heterogenes Stadtbild in einer Zeit der
doch eine große Bandbreite an ausgangsbedingungen ab, weichen Standortfaktoren aber auch negative Wirkungen
die sich im sinne der Pfadabhängigkeit jeweils in die orts- entfalten kann, ist den verantwortlichen Planern in der Stadt
spezifischen Routinen und Planungskulturen im Zusam- wohl bewusst. Im Dezember 2001 hat der Rat der Stadt Köln
menhang mit der stadtgestaltung vor Ort einprägen. hierzu beschlossen, im Sinne des third order governing ein umfas-
gehören beispielsweise ihre unterschiedlichen entstehungs- sendes Leitbild für Köln zu entwickeln (Stadt Köln 2009: 8),
geschichten und baukulturellen Vorprägungen, die leitvor- welches ein Handlungsfeld „Die attraktive Stadtgestaltung“
stellung im Wiederaufbau nach dem Zweiten Weltkrieg, die enthält (Stadt Köln 2009: 108). In der Einleitung zu dem
politischen Mehrheitsverhältnisse und auch der einsatz von Handlungsfeld heißt es: „Köln wird als weltoffen, gastlich
spezifischen Instrumenten der Gestaltung. In den einzel- und lebenslustig – als kosmopolitisch – wahrgenommen. Die
nen fallstudienstädten haben wir jeweils die gesamtstäd- Gestaltung der Stadt in ihrer baulichen Präsenz, ihren Grün-
tische strategie der stadtgestaltung (leitbilder, integrierte
stadtentwicklungspläne, Masterpläne o. Ä.) sowiezwei
verschiedene Projekte der stadtgestaltung in form von
„ansiedlungs- und gestaltungsgeschichten“ untersucht. auf
diese Weise konnte analysiert werden, ob und wie konkrete
einzelprojekte in übergeordnete Planungen und strukturen
eingebettet werden, also Beziehungen zwischen den drei
„Welten“ des staatlichen handelns in der Planung herge-
stellt werden (vgl. abschn. 3). an dieser stelle möchten wir
unsere Befunde aus der qualitativen Analyse (Dokumenten-
analyse, experteninterviews) für die rheinische Millionen-
stadt Köln und die bayerische landeshauptstadt München
in eine Beziehung zu den bisher vorgestellten leitbildpro-
zessen setzen.
Abb. 4 Köln WeltstadtkaufhausSchöne Städte durch große Pläne? – Baukultur und integrierte Stadtentwicklungsplanung 491
erstellt werden, welches im Sinne eines Regiebuchs expli-
zit als Orientierung für zukünftige Bauvorhaben und ihrer
Gestaltung dienen kann (vgl. Streitberger 2009: 168). Dabei
ist es nicht die Stadtverwaltung und damit die öffentliche
Hand selber, die diesen Masterplan entwickelt, sondern die
Initiative ging von der örtlichen Wirtschaft aus, die den Stel-
lenwert eines ansprechenden Stadtbildes im Wettbewerb der
Kommunen erkannt hat und um die Defizite der Stadt weiß.
Der Verein „Unternehmer für die Region Köln e. V.“ enga-
gierte mit dem Architekturbüro Albert Speer & Partner einen
„externen Sachverstand“ (Bauwens-Adenauer/Soénius
2009: 11), der zur Beruhigung des aufgeregten Bildes bei-
spielsweise Höhenfestsetzungen vorschlägt oder nach einer
Kölner Lösung für die Gestaltung des öffentlichen Raumes
Abb. 5 Köln Rheinauhafen
sucht. In Zukunft soll dieses Regelwerk bei Planungsent-
scheidungen auf der Ebene des first order governings (vgl.
flachen und Plätzen sowie dem gesamten Erscheinungsbild Abschn. 2), also der Ebene der Leitbildentwicklung, dazu
der Innenstadt und den Stadtteilen entspricht diesen posi- beitragen, dass das heterogene Stadtbild eine einheitlichere
tiven Attributen nicht in allen Fällen“ (Stadt Köln 2009: Kontur erfährt.
108). Daraus wird gefolgert, dass es einer integrierten und
gesamtplanerischen Strategie bedarf, die neben der Betrach- 5.2 Fallstudie München
tung von Einzelbauwerken wieder stärker das Gesamtbild
der Stadt in den Blick nimmt. Mit der Verabschiedung des Wie stellt sich die Situation nun in München dar? In der
Leitbildes durch den Rat im Jahre 2003 wurde gleichzeitig Innenstadt Münchens ist es in Fortsetzung des bewahrenden
die Verpflichtung an die Stadtverwaltung ausgesprochen, Weges aus der Zeit des Wiederaufbaus auch in den letzten
die im Leitbild vereinbarten Zielvorstellungen aktiv zu ver- Jahren gelungen, die meisten Bauvorhaben, wie beispiels-
folgen, die im Zuge des Erarbeitungsprozesses entstandene weise die „Fünf Höfe“, behutsam in die historische Bau-
Dialogkultur aufrechtzuerhalten (Stadt Köln 2009: 9) und substanz einzufügen (vgl. Abb. 6). Hier zeigt sich zumindest
zusätzlich auf der Ebene des second order governing Struk- die Innenstadt als ein weitgehend harmonisches und aufein-
turen aufzubauen, welche die Zielerreichung des Leitbildes ander abgestimmtes bauliches Ensemble. Die Mitarbeiter
durch ein fortlaufendes Controlling nachprüfbar machen. der Münchner Planungsverwaltung vergleichen dieses Vor-
Dies wurde auch deswegen als sinnvoll erachtet, da das gehen der städtischen Planung mit einem Schuhanzieher;
Thema der gebauten Umwelt in Köln bis 2003 in verschie- dies leistet seit vielen Jahren einen wichtigen Beitrag dazu,
denen organisatorischen Einheiten angesiedelt war, die in dass die Vorhaben in München – physisch wie mental – in
ihrem Zuschnitt mehrfach verändert wurden. So waren die eine fest gefügte Struktur eingepasst werden.
Aufgaben der Stadtentwicklung und Stadtplanung über eine
längere Zeit dem Wirtschaftsdezernat unterstellt. Daneben
gab es jeweils getrennt ein Hochbau- bzw. Tiefbaudezernat.
Die einzelnen Dezernate wurden von verschiedenen Dezer-
nenten geleitet. Erst mit der Besetzung der Leitungsstelle
durch Bernd Streitberger sind Ende 2003 alle Bau- und
Planungsaufgaben in einem Dezernat für Stadtentwicklung
und Planung zusammengefasst worden. Hier lassen sich
seitdem einige Veränderungen im Umgang mit der gebauten
Umwelt ausmachen. Dazu zählt auch, dass als eine Konse-
quenz des Leitbildprozesses eine Stadtraummanagerin ein-
gestellt wurde, die die Belange des öffentlichen Raumes auf
Seiten der Stadtverwaltung koordiniert. Außerdem wurde
die Beteiligung der Leitbildgruppe „Die attraktive Stadt-
gestaltung“ an der Entwicklung eines „Masterplanes Köln
Innenstadt“ institutionalisiert.
Zusätzlich zum Leitbild 2020 sollte mit dem „Masterplan
Köln“ ein planerisches Regelwerk für die Kölner Innenstadt Abb. 6 München „Fünf Höfe“492 K. Hackenberg et al.
Es gelingt der Stadt seit Langem, die Bauherren davon
zu überzeugen, dass sie ihre Vorhaben in der Innenstadt in
das bauliche Gefüge einpassen. Dazu das folgende Zitat von
Herrn Sandmeier, dem Koordinator für den öffentlichen
Raum in der Bauverwaltung: „Das ist wichtig für die Stadt
[…] in diesem Konzert mitzuspielen. Also nicht ein Solist
zu sein, die erste Geige nur zu spielen, sondern sich schon
in einem Gesamtorchester im Wohlklang zu befinden“. Ein
zentrales Beurteilungskriterium für ein solches Einfügen
ist die Maßstäblichkeit des neuen Vorhabens, wodurch den
stadträumlichen Bindungen und Beziehungen in München
ein hoher Stellenwert eingeräumt wird. Schließlich spielen
aber auch Materialien und Farben der einzelnen Bauvorha-
ben für die Fortentwicklung des Stadtbildes eine wichtige
Rolle. Dabei hat sich dieses so geschätzte Bild in den letz-
ten Jahren auch als ein Problem erwiesen, zeitgenössische Abb. 7 München Uptown
Architektur in die vorhandenen Strukturen einzuführen.
Insbesondere die über München hinaus bekannt gewordene behandelt. Außerdem werden hier die Baugenehmigungen in
Debatte über den Bau von Hochhäusern spiegeln dieses der sogenannten Lokalbaukommission erteilt. Damit erhält
Spannungsfeld zwischen Tradition und Moderne im Münch- dieses Referat eine Schlüsselstellung für Stadtgestaltungs-
ner Stadtbild wider (vgl. Abb. 7). prozesse. Das Münchner Baureferat ist hingegen vor allem
Dies zeigt das folgende Zitat von Herrn Reiß-Schmidt, für städtische Hoch- bzw. Tiefbauprojekte zuständig. In die-
dem Leiter der Hauptabteilung Stadtentwicklungsplanung: sem Referat geht es auch um die Gestaltung des öffentlichen
„… das ist die große Kunst […], mit diesen ganzen Bin- Raumes. Die Rollenteilung zwischen Planungs- und Baure-
dungen und mit dieser übergroßen Liebe zu dem, was (in ferat hat sich in den vergangenen 30 Jahren eingespielt.
München) ist und wie es ist, trotzdem Veränderungen auf Durch diese Vorgehensweise gelingt es, die Instrumente
einem relativ hohen Qualitätsniveau auch oft gegen eine der drei verschiedenen „Welten“ aufeinander abzustimmen,
zunächst mal abwartende oder sogar widerständige Hal- die dann von den kommunalen Akteuren aus Verwaltung
tung dann doch durch einen intensiven Diskussionsprozess und Politik auch gemeinsam getragen werden (vgl. Brzen-
mehrheitsfähig zu machen …“. Um dies zu leisten, gibt es czek/Wiegandt 2007: 10). Das Beispiel München zeigt,
ausgeklügelte Verfahren, um Einzelvorhaben in München dass die erwähnten unterschiedlichen „Welten“ der Planung
zu qualifizieren. Die Münchner Planungsverwaltung bindet auch kontinuierlich zueinander in Beziehung gesetzt wer-
die Planungssprecher der kommunalen Politik, die Archi- den müssen, um die öffentliche Politik der Stadtgestaltung
tektenschaft und die allgemeine Öffentlichkeit in diese Pro- erfolgreich und beständig zu gestalten.
zesse der Entscheidungsfindung seit Jahren intensiv ein.
Jenseits der Vorgaben im Baugesetzbuch fasst der Stadtrat 5.3 Unterschiede und Gemeinsamkeiten
vor bedeutenden Bauvorhaben zudem einen Eckdaten- und
Grundsatzbeschluss für das spezifische Vorhaben, in dem Im Vergleich der beiden Städte zeigt sich, dass es Aussa-
die Entwicklungsvorstellungen der Stadt formuliert sind. gen zur Baukultur in den jüngeren Stadtentwicklungsplänen
Zusätzlich werden die im Diskurs entwickelten und seit gibt, die jeweils ganz unterschiedliche Bezeichnungen tra-
Ende der 1990er Jahre vom Stadtrat beschlossenen Leitli- gen. In Köln ist es das „Leitbild 2020“ und zusätzlich ein
nien für die gesamtstädtische Entwicklung („Perspektive „Masterplan Köln Innenstadt“, in München ist es die „Per-
München“) dann im tagespolitischen Geschäft der städte- spektive München“. Im öffentlich initiierten und formali-
baulichen oder Architekturwettbewerbe oder auch in den sierten Leitbild werden sowohl in Köln als auch in München
Sitzungen der Kommission für Stadtgestaltung zitiert und Aussagen zur Gesamtstadt getroffen. Beim Masterplan zur
als Argumentationshilfen für die Qualifizierung der Einzel- Gestaltung der Innenstadt von Köln spielen private Akteure
fälle genutzt. Hinzu kommt die Kontinuität in der Organisa- eine besondere Rolle, ohne deren finanzielles Engagement
tion der Zuständigkeiten des Bau- und Planungsgeschehens eine derartige Planung für die Kölner Innenstadt gar nicht
in München. Organisatorisch ist seit 1979 das Planungsre- erfolgt wäre, und die dadurch eine prominente Behandlung
ferat (genaue Bezeichnung: Referat für Stadtplanung und erfährt. Ausgewählte Handlungsziele des Masterplanes
Bauordnung) vom Baureferat getrennt. Im Planungsrefe- werden aktuell auch zur Grundlage öffentlichen Handelns
rat werden seitdem alle Aspekte der Stadtentwicklung und gemacht, um kurzfristige und vorzeigbare Resultate zu
Stadtplanung, der Stadtsanierung und des Wohnungswesens erzielen (Meltzer 2009: 44). München hingegen hat über
13Schöne Städte durch große Pläne? – Baukultur und integrierte Stadtentwicklungsplanung 493
die Zeit hinweg im Rahmen der drei „Welten“ institutionell herausgenommen und in den Mittelpunkt der Betrachtung
verankerte Verfahren geschaffen, die projektunabhängig gestellt wird.
entwickelt wurden und die in der Qualifizierung von Einzel- Diese Pläne stehen am Ende eines vorausgegangenen
projekten immer wieder Anwendung finden. Abstimmungsprozesses der beteiligten Akteure aus dem
Im Zusammenspiel der drei „Welten“ zeigen sich auf diese politisch-administrativen System, der Wirtschaft und Bür-
Weise die unterschiedlichen Planungskulturen in den beiden gerschaft und werden als ein planungsstrategisches Instru-
Städten. Grundsätzlich gilt dabei, dass das Institutionenge- ment eingesetzt. Es geht darum, durch eine Generierung von
füge die Handlungen einerseits verbindlich vorstrukturiert, Zielvorstellungen und Leitbildern einen gesellschaftlichen
dass andererseits aber immer auch Handlungsspielräume Konsens für die zukünftige Stadtentwicklung zu erzeugen.
verbleiben, die durch die agierenden Akteure im Planungs- Damit sind sie Ausdruck der Zusammenarbeit, Abstim-
prozess unterschiedlich interpretiert werden können (vgl. mung und Übereinkunft der Akteure und werden selbst
Scharpf 2000). zum Bestandteil des institutionellen Kontextes. Sie dienen,
In diesem Kontext weisen Experten der Raum- und je nach Verbindlichkeit der Aussagen, als rahmensetzende
Planungswissenschaften12 generell darauf hin, dass es jen- Richtungsweiser und zur Abstimmung der unterschied-
seits rechtlicher Normen (Institutionen) auch kulturelle lichen Ebenen kommunaler Planung (vgl. Abschn. 2). Auf
Unterschiede in der Art und Weise gibt, wie Akteure mit diese Weise werden einerseits die inhaltlich-strategische
Planungsaufgaben umgehen. Mit dem Begriff der Planungs- Ausrichtung zukünftiger städtebaulicher Planungen und
kultur kann beschrieben werden, wie die Stadt(-öffentlich- andererseits die Wahl und Organisation der damit verbunde-
keit) und involvierte gesellschaftliche Teile mit aktuellen nen Planungsprozesse und der Einsatz weiterer Instrumente
Fragen der Stadtentwicklung umgehen, das heißt, wie über zur Gestaltung der Stadt vorstrukturiert.
den Einzelfall hinausgehend Regeln, Verfahren und Wert- Dem Anspruch einer langfristigen Stadtentwicklungs-
haltungen in der Herstellung bzw. im Umgang mit gebauter planung wird in München durch Evaluation der erreichten
Umwelt angewendet und etabliert werden. Planungskultur Handlungsziele zusätzlich Rechnung getragen. Auch in
als „heuristisches Konzept“ umfasst nach Weichhart (2007) Köln wird eine Evaluation angestrebt. Das Thema Stadtge-
organisations-, gruppen- oder länderspezifische Konfigura- stalt ist in allen hier angesprochenen städtischen Konzepten
tion der Werte, Normen, Orientierungen, Kommunikations- eine explizit genannte Aufgabe und somit als Politikthema
und Handlungsstile des raumplanerischen Handelns. Dabei in der strategischen Stadtplanung verankert. In Köln wird es
spielt auch die Geschichte von Institutionen eine wichtige langfristig darum gehen, ein sehr heterogenes Stadtbild zu
Rolle, weil in der Vergangenheit getroffene Entscheidungen beruhigen, während es in München genau andersherum die
sowie eingebürgerte Denkweisen als Entwicklungspfade bis Herausforderung sein wird, in ein eher traditionell homo-
in die Gegenwart hinein Bestand haben (vgl. Fürst 2007: genes Stadtbild auch herausragende bauliche Elemente der
2). Dies wirkt sich sowohl auf die handelnden Akteure und zeitgenössischen Architektur einzufügen.
die Akteurskonstellationen als auch auf den institutionellen
Rahmen und die Strukturen aus, in deren Kontext die Hand-
lungen stattfinden und sich im Sinne von formellen und 6 Fazit
informellen Regeln regelmäßig wiederholen. Kommunales
Verwaltungshandeln wird hierdurch ebenso beeinflusst wie Große Pläne – verstanden als integrierte Stadtentwick-
die Investitionen eines Wirtschaftsunternehmens oder die lungspläne – für schönere Städte – verstanden als eine von
Gründung bürgerschaftlicher Initiativen zur Baukultur. mehreren Dimensionen der Baukultur – sind in den großen
Planungskulturen lassen sich in diesem Verständnis deutschen Städten aktuell allerorts zu finden. Wir konn-
anhand der stadtspezifischen Entscheidungsprozesse und ten zeigen, dass diese Pläne in zunehmendem Maße durch
der im Politikfeld der Baukultur eingesetzten politischen Entstandardisierung und Individualität geprägt sind. Das
Maßnahmen, Instrumente und Strategien sowie den daran spezifische Entwicklungspotenzial vor Ort und die jewei-
beteiligten Akteuren analysieren (Brzenczek/Wiegandt lige Zusammenarbeit der lokalen Akteure sind daher von
2009b). Das Instrument der integrierten Stadtentwicklung entscheidender Bedeutung für die inhaltliche und formale
mit entsprechenden Stadtentwicklungsplänen und Leitbil- Ausgestaltung der Pläne sowie für ihre Umsetzung. Für das
dern ist ein Beispiel für eine solche politische Maßnahme, Politikfeld Baukultur haben wir dabei verdeutlicht, dass es
das hier aus einem weiten Spektrum von Maßnahmen und immer um eine Mehrebenenanalyse geht, bei der alle drei
Instrumenten zur Steuerung der Gestaltung von Städten „Welten“ der Planung mit ihrer jeweiligen Relevanz für die
(u. a. auch städtebauliche Wettbewerbe, Gestaltungsbei- Planungs- und Bauprozesse Berücksichtigung finden. Die
räte, Gestaltungssatzung; vgl. Brzenczek/Wiegandt 2009b) routinisierte Verzahnung der verschiedenen Planungsebenen
scheint uns ein Erfolgsfaktor für gute Planung zu sein. Die
12
http://www.planung-neu-denken.de (letzter Zugriff am 01.07.2010). bloße Zielaussage ist nicht ausreichend. Ausschlaggebend494 K. Hackenberg et al.
ist vielmehr die art und Weise, wie die leitvorstellungen tauschs, Auszeichnungen und Informationsveranstaltungen
zur Baukultur aus den integrierten stadtentwicklungsplä- für die eigene Stadt auch in die Tat umzusetzen. Nur so kann
nen in den planerischen Alltag Eingang finden. Dies ist es langfristig gelingen, die von der Bundesregierung ange-
nach unserer einschätzung der „schlüssel“ für das ergeb- stoßene und durch die Bundesstiftung Baukultur begleitete
nis einer qualitativ hochwertigen gebauten Umwelt. Diese Qualitätsdebatte über Baukultur in der Öffentlichkeit zu
Verfahren verstehen wir als einen wesentlichen aspekt von stärken, das Thema Baukultur in den Kommunen und Län-
Planungskultur, die – wie die beiden fallbeispiele gezeigt dern in den Planungsalltag zu integrieren und schließlich im
haben – unterschiedlich ausgeprägt sein kann. Um gene- internationalen Standortwettbewerb auch für die Qualitäten
rell Planungs- und handlungssicherheit für die beteiligten bundesdeutscher Baukultur zu werben.
akteure zu schaffen, bedarf es zeitlicher und instrumentel-
ler Kontinuitäten in den einzelnen städten. Vielerorts steht
das „junge“ thema Baukultur und stadtgestaltung zwar Anhang A
inzwischen auf der agenda der stadtentwicklungspoliti-
schen themen. Dabei bedarf es allerdings in einzelfällen Stadtentwicklungsdokumente der 20 einwohnerstärksten
noch weitergehender analysen, inwieweit im planerischen Städte in Deutschland
alltag auch routinen und Praktiken der sinnvollen abstim-
mung und Verzahnung der planerischen handlungsweisen Diese Übersicht basiert auf einer Internetrecherche und der
eingespielt sind. systematischen Analyse der offiziellen Dokumente zu den
städte und gemeinden sind heute dem ökonomischen einzelnen Stadtentwicklungsplänen. Die Darstellung der
strukturwandel, der demographischen entwicklung und der Ziele und die Einordnung des Themas Baukultur orientieren
zunehmenden internationalen standortkonkurrenz ausge- sich dabei an der Struktur dieser Pläne. Dabei wurden fol-
setzt. Dabei ist unbestritten, dass die Qualität der gebauten gende Pläne berücksichtigt:
Umwelt – auch im sinne der schönen stadt – für die lebens-
• Berlin:
Planwerke, http://www.stadtentwicklung.berlin.
qualität der Bürger und als weicher Standortfaktor für die
de/planen/planwerke/index.shtml; Senatsverwaltung für
ansiedlung von Unternehmen eine hohe relevanz hat. Der
Stadtentwicklung (2004): Stadtentwicklungskonzept
Bau des guggenheim-Museums in Bilbao durch frank
Berlin 2020. Statusbericht und perspektivische Hand-
O. gehry hat den Begriff des „Bilbao-effekts“ für dieses
lungsansätze. Berlin.
Phänomen geprägt. auch die implementierung der hohen
• Hamburg: Stadt Hamburg, Behörde für Stadtentwick-
städtebaulichen und architektonischen Qualitätsansprü-
lung und Umwelt (2007): Räumliches Leitbild. Entwurf.
che während der internationalen Bauausstellung emscher
Hamburg, http://www.hamburg.de/raeumliches-leitbild
Park (1989–1999) sind in diesem Zusammenhang zu nen-
• München: Landeshauptstadt München, Referat für Stadt-
nen. allerdings treten heute vielerorts bauliche Missstände
planung und Bauordnung (2005): Münchens Zukunft
infolge von sanierungs- und Modernisierungsbedürftigkeit
gestalten. Perspektive München – Strategien, Leitlinien,
deutlich zutage und werden – so die annahme – bei wei-
Projekte (Bericht zur Stadtentwicklung 2005). München,
ter zunehmenden sozialräumlichen Disparitäten zwischen
http://www.muenchen.de/Rathaus/plan/stadtentwick-
deutschen städten immer stärker sichtbar. in wirtschaftlich
lung/perspektive/39104/index.html; Landeshauptstadt
schwierigen Zeiten und angesichts größer werdender sozi-
München, Referat für Stadtplanung und Bauordnung
aler herausforderungen bedarf es deshalb insbesondere in
(2007): Perspektive München – Bilanz. Evaluierung der
finanzschwachen Kommunen bei stadtentwicklungspoli-
Perspektive München. Evaluierungsbericht 2007. Mün-
tischen entscheidungen eines klaren Votums für die lang-
chen; Landeshauptstadt München, Referat für Stadtpla-
fristige festlegung der gestalterischen Qualität mit dem
nung und Bauordnung (2007): Perspektive München
hierfür notwendigen einsatz von ressourcen.
– Konzepte. Innenstadtkonzept. Leitlinien für die Mün-
nicht nur in diesen städten, sondern deutschlandweit
chener Innenstadt und Maßnahmenkonzept zur Aufwer-
bedarf es deshalb einer etablierung und integration baukul-
tung. München.
tureller Ziele auf allen ebenen der Planung und entwick-
• Köln: Unternehmer für die Region Köln e. V. und Albert
lung. in diesem Kontext werden die aspekte der Qualität,
Speer und Partner (2008): Städtebaulicher Masterplan
nachhaltigkeit und leistungsfähigkeit beim Planen und
Innenstadt Köln. Köln, http://www.masterplan-koeln.
Bauen besonders hervorgehoben (vgl. Bundesstiftung Bau-
de/; Stadt Köln, Der Oberbürgermeister (2009): Leitbild
kultur 2010). ebenfalls bedarf es der Überzeugung und Bün-
2020. Kölns Weg in die Zukunft. Köln, http://www.stadt-
delung der treibenden Kräfte, um die in den großen Plänen
koeln.de/1/verwaltung/leitbild
formulierten Ziele und ideen durch vielfältige Maßnahmen
• Frankfurt am Main: Hochhausentwicklungsplan, http://
wie z. B. qualifizierende Verfahren, transparente Planungs-
www.stadtplanungsamt-frankfurt.de/hochhausentwick-
prozesse mit einem hohen Maß gesellschaftlichen aus-Sie können auch lesen