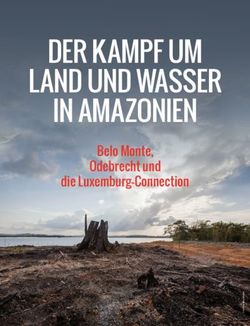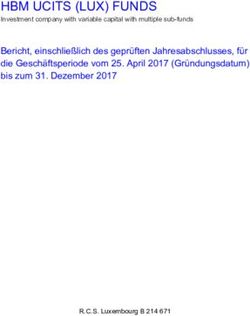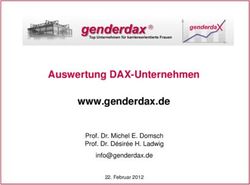Sitzung der Vollversammlung - Juni 2019 - IHK Schleswig-Holstein
←
→
Transkription von Seiteninhalten
Wenn Ihr Browser die Seite nicht korrekt rendert, bitte, lesen Sie den Inhalt der Seite unten
Sitzung
der Vollversammlung
Datum: 18. Juni 2019
Beginn: 16:00 Uhr
Ende: ca. 18:30 Uhr
Ort: Strandhotel, Räume Schleswig und Holstein, im Ferien- und Freizeitpark
Weissenhäuser Strand GmbH & Co. KG, Seestr. 1, 23758 Weissenhäuser Strand
Bild: André WalterTagesordnung
Vollversammlung am 18. Juni 2019 16:00 bis ca. 18:30 Uhr,
Strandhotel, Räume Schleswig und Holstein, im Ferien- und Freizeitpark
Weissenhäuser Strand GmbH & Co. KG, Seestr. 1, 23758 Weissenhäuser Strand
Von 15 bis 16 Uhr Führung durch Hotel und
Ferienanlage
David Depenau, Geschäftsführer, Ferien- und
Freizeitpark Weissenhäuser Strand, und
Mitglied der Vollversammlung
Vor Eintritt in die Tagesordnung stellt Herr Depenau
in einer Präsentation noch einmal die Ferienanlage
vor.
TOP 1 Formales – ab 16:15 Uhr
1.1 Tagesordnung Präses Friederike C. Kühn
Annahme
1.2 Protokoll der Sitzung vom 02.04.2019 Präses Friederike C. Kühn
Annahme
1.3 Wahl einer ehrenamtlichen Rechnungsprüferin Joseph Scharfenberger
(Anlage 1)
Beschlussfassung
TOP 2 HanseBelt e.V. – Projektzuwendung der IHK Dr. Astrid Bednarski,
zu Lübeck für 2019 (Anlage 2) Mitglied des Vorstandes
HanseBelt e. V.,
Beschlussfassung Mitglied der
Vollversammlung
TOP 3 Aktuelles (aus der IHK Schleswig-Holstein und der
IHK zu Lübeck) – ab 16:30 Uhr
3.1 Anforderungen an die KI-Strategie der Dr. Sabine Hackenjos
Landesregierung (Anlage 3)
Bericht und Kenntnisnahme
3.2 Neue Entwicklung in der IHK-Rechtsprechung Joseph Scharfenberger
(Urteil des Oberverwaltungsgerichts Münster)
Bericht und Kenntnisnahme
3.3 Novellierung des Berufsbildungsgesetzes Dr. Ulrich Hoffmeister
Bericht
Stand: 06.06.20183.4 IHK-Ausschüsse und –Wirtschaftsbeiräte -
Informationen aus dem Gremien
Ausschuss für Verkehr und Infrastruktur am Rüdiger Schacht
13.05.2019
- Hafenentwicklungsplan Lübeck – Einbindung
der Wirtschaft (Anlage 4)
Ausschuss für Energie und Umwelt am 23.05.2019 Kathrin Ostertag
- Klimaschutz und CO2-Bepreisung (Anlage 5)
TOP 4 Initiative „Mein Unternehmen Zukunft“ Präses Friederike C. Kühn
Film
TOP 5 Fehmarnbelt Days 2020 (Anlage 6) Katrin Olenik, FBBC/
Manfred Braatz
Bericht
TOP 6 Verschiedenes
- Rückblick „Kongress Frauen in Führung“ 2019 Präses Friederike C. Kühn
- Teilnahmehinweis auf DIHK-Netzwerktag Präses Friederike C. Kühn
„Frauen im Ehrenamt“ am 26./27.06.2019,
Bremen
- Berlin-Fahrt der VV am 15./16.10.2019 HGF Schöning
Ab 18:30 bis 18:45 Uhr gemeinsames Brainstorming
Fehmarnbelt Days 2020
18:45 Uhr Ausklang
Stand: 06.06.2018Recht und Steuern
Joseph Scharfenberger
Telefon: 0451 6006-235
Anlage 1
Vollversammlung
TOP 1.3: Wahl einer ehrenamtlichen Rechnungsprüferin
Datum/Termin:
29.05.2019 / 18.06.2019
1. Thema und Ziel:
Herr Hagen Goldbeck ist im Frühjahr in das Präsidium der IHK zu Lübeck gewählt worden.
Bisher bekleidet er das Amt eines ehrenamtlichen Rechnungsprüfers, aus dem er nun aus-
geschieden ist. Für ihn ist ein neuer ehrenamtlicher Rechnungsprüfer zu wählen.
2. Stand der Dinge:
Nach § 4 Abs. 2 k der Satzung der IHK zu Lübeck obliegt es der Vollversammlung, die eh-
renamtlichen Rechnungsprüfer zu wählen. Durch das Ausscheiden von Herrn Goldbeck ist
diese Position neu zu besetzen. Das Präsidium schlägt hierfür Frau Beatrix Wendland vor.
Frau Wendland hat sich hiermit einverstanden erklärt.
Herr Tesnau ist weiterhin als ehrenamtlicher Rechnungsprüfer für die Dauer der Wahlperiode
gewählt.
3. Nächste Schritte:
Die Vollversammlung wählt Frau Beatrix Wendland als ehrenamtliche Rechnungsprüferin.Geschäftsbereich Standortpolitik
Julia Beckmann
Telefon: 0451 6006-124
Anlage 2
Vollversammlung
TOP 2: HanseBelt e.V. – Projektzuwendung der IHK zu Lübeck für
2019
Datum:
13. Juni 2019
Termin:
18. Juni 2019
1. Warum dieses Thema?
Auch im letzten Jahr wurde intensiv an den Inhalten der HanseBelt Initiative gearbeitet, viele
Projekte und Veranstaltungen wurden erfolgreich umgesetzt.
Der HanseBelt Initiativkreis wird im Jahr 2019 noch einige geplante Projekte, Maßnahmen
und Veranstaltungen ausrichten. Um die Veranstaltungen und die Kommunikation professio-
nell umzusetzen, möchte der HanseBelt e.V. 34.000 € als Zuwendung aus dem für das Jahr
2019 vorgesehenen IHK-Budget beantragen.
2. Wie ist der Stand der Dinge?
Der HanseBelt Initiativkreis wird als starke Initiative in der Region wahrgenommen. Das Inte-
resse an Mitgliedschaften steigt. Der HanseBelt e.V. zählt aktuell 109 Mitglieder. Der Vor-
stand ist mit vielen interessierten Unternehmen im Gespräch.
Folgend sind die Veranstaltungen aufgeführt, die bereits im Jahr 2019 umgesetzt wurden:
• 5. Februar 2019, HanseBelt Wissen+ Reihe zum Thema New Work/Holakratie (Hypo-
port AG)
• 19. Februar 2019, HanseBelt Wissen+ Reihe zum Thema New Work/Holakratie (Hy-
poport AG)
• 7. März 2019, HanseBelt Wissen+ Reihe zum Thema New Work/Holakratie (Hypoport
AG)
• 14. März 2019, HanseBelt Begrüßungsempfang für neue Fach- und Führungskräfte
im HanseBelt (Stadtwerke Lübeck GmbH)
• 26. März 2019, HanseBelt Mitgliederversammlung (MFC I)
• 15. Mai 2019, HanseBelt UKW zum Thema „Azubi taucht ab“ (Stadtwerke Lübeck
GmbH)
• 19. Mai 2019, HanseBelt Golf Open (Golfclub Reinfeld)
• 6. Juni 2019, HanseBelt Arbeitskonferenz (erstmals gemeinsam mit dem Regional-
management) zum Thema „Butter bei die Fische – So arbeiten wir heute im Hanse-
Belt!“ (Media Docks Lübeck) – Mit Impulsen der MACH AG, Schwartauer Werke,
Stadtwerke Lübeck GmbH, CoWorkLand etc.Folgende Veranstaltungen sind für 2019 noch vorgesehen:
• 5.- 7. Juli 2019, Belt-Cup in Nyköbing, Dänemark
• Juli 2019, evtl. HanseBelt Summer Lunch (Medienzelt LN/NDR)
• 6. November 2019, HanseBelt Zukunftskongress 2019 (ECC – EVENT & CON-
GRESS CARRÉE Lübeck)
In Zusammenarbeit mit zwei Lübecker Agenturen wurde die Glücksforscher Kampagne er-
folgreich ausgerollt und in diesem Zuge auch das gesamte Design des Vereins angepasst.
Der Claim „region ahead“ wurde gestrichen, um zukünftig mehr mit Kampagnen Claims zu
arbeiten, die dann für einen bestimmten Zeitraum genutzt werden. Aktuell ist der HanseBelt
mit dem „Happy Region“ Claim unterwegs. Es wurden erfolgreiche Marketing Instrumente –
wie die Happy Region Tour eingeführt. Diese Tour ist in Zusammenarbeit mit der Piste
Lübeck entstanden und findet großen Anklang bei den Unternehmen. Bei der Tour werden
die Unternehmen und die Jobangebote auf eine unterhaltende Art präsentiert. Insbesondere
junge Fachkräfte fühlen sich hier angesprochen. Die Reichweite der Piste Lübeck kommt
dem HanseBelt e.V. hier zu Gute.
Zudem wurde die Marketing Kampagne „Bleib Glücklich“ zur Fachkräftegewinnung als Pilot-
projekt mit vier Hotels aus der Region gestartet. Die Flyer werden den Gästen bei ihrer Ab-
reise mitgegeben. Der QR Code weist auf das Traumjob Portal hin. Ziel ist es, die Touristen
als zukünftige Fach- und Führungskräfte für die Region zu gewinnen.
Es wurden HanseBelt Hoodies und T-Shirts entwickelt, welche HanseBelt Mitglieder mit dem
Zusatz „Botschafter“ erwerben können. Der Verein schafft damit eine Identifikation mit der
Region und dem Verein.
Neben weiteren Videoportraits mit HanseBelt Mitarbeitern, wurde auch ein HanseBelt Erklär-
film entwickelt, der nun bei der Gewinnung von neuen Mitgliedern zum Einsatz kommt und in
wenigen Minuten die wesentlichen Inhalte des Vereins erklärt. Zudem wurde eine Koopera-
tion mit der Piste Lübeck geschlossen. Die Piste Lübeck reist auf der „Happy Region Tour“
durch die HanseBelt Unternehmen und stellt diese in einem kurzen Clip vor. Hier werden
zum Beispiel auch die Ausbildungsberufe vorgestellt, da die Zielgruppe der Videos eher die
jüngere Generation ist.
Der HanseBelt hat im Jahr 2018 den HanseBelt Hub ausgerollt. Eine Art Social Intranet ex-
klusiv für die Mitarbeiter der HanseBelt Mitgliedsunternehmen. Hier werden die Mitarbeiter
eingeladen, sich auszutauschen, sich zu vernetzen und sich Hilfestellung bei unterschiedli-
chen Themen zu geben. Zudem ist der Hub eine digitale Plattform für die Arbeitsgruppen.
Diese können sich zusätzlich zu den persönlichen Treffen schnell miteinander austauschen
und Themen abstimmen.
Die Zusammenarbeit mit den dänischen Freunden hat sich durch den Belt-Cup im Jahr 2018
weiter intensiviert. Die Veranstaltung war ein großer Erfolg und wird im Juli 2019 in Däne-
mark fortgesetzt. Im Jahr 2020 kommt der Belt-Cup wieder nach Lübeck.
Gemeinsam mit Femernbelt Develoment ist die Kampagne „Auf zu neuen Horizonten“ ent-
standen, in der es darum geht, für den HanseBelt zu begeistern und auf die Chancen hinzu-
weisen, den die Region hat, wenn sie mit Skandinavien zu einer Zukunftsregion zusammen
wachsen. Ein kleines Projektteam arbeitet aktuell gemeinsam mit der Agentur Anders Björk
aus Lübeck einen Fahrplan aus, welche Maßnahmen neben einem bereits gedruckten Book-
let durchgeführt werden sollen.
2|3Im Juni 2018 hat der HanseBelt e.V. an dem Wettbewerb Land der Ideen (gefördert von der
Deutschen Bank) teilgenommen und bekam als Regionales Netzwerk den Titel „Ausgezeich-
neter Ort 2018“. Das Jahresmotto war „Welten verbinden – Zusammenhalt stärken“. Eine un-
abhängige Jury wählte den HanseBelt unter 1.500 eingereichten Bewerbungen aus. Im No-
vember 2018 ehrte der Chef der Staatskanzlei den Verein als einen von insgesamt vier
Preisträgern aus Schleswig-Holstein.
Beim HanseBelt Zukunftskogress 2018 feierte der HanseBelt sein zehnjähriges Bestehen.
Auch beim IHK Neujahrsempfang 2019 gab es Gratulationen seitens der IHK an Vorstands-
vorsitzenden Bernd Jorkisch.
Im März 2019 hat sich der HanseBelt e.V. einer Zertifizierung „Benchmarking of
Cluster Management Organisations“ unterzogen und hat das Bronze Label erhalten. Das
Bronze Label ist eine Bestandsaufnahme und steht für ein nachweislich gut organisiertes und
erfolgreich funktionierendes Wirtschaftsnetzwerk.
3. Wie sollte es sein?
Der HanseBelt Initiativkreis hat durch den Einsatz von zahlreichen ehrenamtlichen Stunden
und Manpower der aktiven Mitglieder messbare Erfolge erzielt. Es soll noch verstärkt daran
gearbeitet werden, das Thema HanseBelt bei den Mitarbeitern der Mitgliedsunternehmen
stärker zu verankern. Hierzu werden Veranstaltungsformate und Kommunikations Tools wie
der HanseBelt Hub genutzt.
Erstmals hat der HanseBelt e.V. die HanseBelt Golf Open ins Leben gerufen, um die Mitar-
beiter in einer netten Atmosphäre zusammen zu bringen.
Der HanseBelt Zukunftskongress am 6. November 2019 soll wieder zum Highlight der dies-
jährigen Arbeit der Initiative werden. Die Akzeptanz der HanseBelt Initiative steigt und die ge-
setzten Themen stoßen auf reges Interesse.
Mit der Zuwendung der IHK zu Lübeck in Höhe von 34.000 € ist die Finanzierung der Kom-
munikation und der Veranstaltungen gesichert.
4. Was muss getan werden?
Die Vollversammlung der IHK zu Lübeck stimmt dem geplanten Antrag auf Projektförderung
in Höhe von 34.000 € zu.
Der Vorstand des HanseBelt e.V. wird regelmäßig über den Fortgang der Projekte und Aktivi-
täten Bericht erstatten.
Anlage 2 A
Finanzübersicht des HanseBelt e.V. 2019
3|3Stand November 2018
ENTWURF
Anlage 2 A
HanseBelt e.V. Budgetplanung 2019 (Entwurf)
vorauss. Kontostand 31.12.2018 7.000,00 €
EINNAHMEN
Position Einnahmen
1. Mitgliedsbeiträge (Annahme 105 Mitglieder) 73.500,00 €
2. Einnahmen aus Veranstaltungen 9.500,00 €
2.1 Aussteller/Sponsoren Zukunftskongress 5.000,00 €
2.2 Teilnehmer Zukunftskongress 3.000,00 €
2.3 Teilnehmer Arbeitskonferenz 1.500,00 €
3. Projektzuwendungen der IHK zu Lübeck nach individueller Antragsstellung 34.000,00 €
3.1 Umsetzung Kommunkationskonzept 10.000,00 €
3.2 Zukunftskongress 20.000,00 €
3.3 Begrüßungsempfang 2.000,00 €
3.4 Summer Lunch 2.000,00 €
Summe 117.000,00 €
AUSGABEN
Position Ausgaben
1. Kommunikation/Marketing 29.900,00 €
1.1 regionale Kommunikationsmaßnahmen (Anzeigen, Material etc.) 8.000,00 €
1.2 Umsetzung Kommunikationskonzept (u.a. Hum Hub, Agenturen, Videos) 20.000,00 €
1.3 Homepage
Beratung / Programmierung 1.000,00 €
hansebelt.de (Hosting) 400,00 €
1.4 Messeauftritte, Präsenz auf Veranstaltungen Dritter 500,00 €
2. Regionale Veranstaltungen 55.500,00 €
2.1 HanseBelt Zukunftskongress 38.000,00 €
2.2 Summer-Lunch Travemünder Woche 3.000,00 €
2.3 HanseBelt Arbeitskonferenz 4.500,00 €
2.4 Belt Cup (Dänemark) 10.000,00 €
3. Traumkultur im HanseBelt 7.000,00 €
3.1 UKW (3x /Jahr) 500,00 €
4.1 Kooperationsveranstaltung TH/Uni Lübeck 1.000,00 €
4.2 Erfahrungsaustausch, 2-3 Veranstaltungen 500,00 €
4.3 Traumjob-Tour im HanseBelt (diverse Veranstaltungen Dritter) 2.000,00 €
4.4 Begrüßungsempfang 3.000,00 €
5. Verein 3.500,00 €
5.1 Mitgliederversammlungen (1-2 pro Jahr) 1.000,00 €
5.2 Finanzbuchhaltung/Steuerberatung (extern) 2.500,00 €
6. Kostenübernahme Geschäftsstelle (105 Mitglieder) 21.000,00 €
7. Mitgliedschaften/Partnerschaften 4.990,00 €
7.1 Beitrag FBBC 1.000,00 €
7.2 Beitrag DDHK 800,00 €
7.3 Beitrag IMH e.V. 250,00 €
7.4 Regionalmanagement 2.940,00 €
Summe 121.890,00 €
vorauss. Kontostand 31.12.2019 2.110,00 €Innovation und Umwelt
Dr. Sabine Hackenjos
Telefon: 0451 6006-291
Anlage 3
Vollversammlung
TOP 3.1: Anforderungen an die KI-Strategie der Landesregierung
Datum/Termin:
18. Juni 2019
1. Thema und Ziel:
Künstliche Intelligenz (KI) wie Machine Learning, Clusteranalyse oder Deep Learning mit
künstlichen neuronalen Netzen revolutionieren die Auswertung der stetig wachsenden Daten-
mengen. KI ist für die Unternehmen des Landes daher ein ernstzunehmendes strategisches
Zukunftsfeld, das heute schon in Entwicklung und Anpassung des Geschäftsmodells mit ein-
bezogen werden muss. Das Thema „Künstliche Intelligenz“ wird daher auch künftig für den
Standort Schleswig-Holstein ein immer stärker werdender Wachstumstreiber in Wirtschaft,
Forschung und Entwicklung und stößt umfassende Transformationsprozesse an. Folgerichtig
muss Schleswig-Holstein seine Position auf diesem Feld weiter ausbauen und festigen, wie
jüngst von der Landesregierung als Arbeitsschwerpunkt ausgerufen. Um die Entwicklung von
KI voranzutreiben, sollen die entscheidenden Akteure vernetzt werden. Bereits zu Beginn der
ersten Sondierungsgespräche in der Staatskanzlei saßen die drei IHKs mit am Tisch.
2. Stand der Dinge:
Derzeit erarbeitet die Staatskanzlei eine KI-Landesstrategie. Diese soll voraussichtlich noch
vor der Sommerpause am 18.06.2019 vom Kabinett verabschiedet werden. Im Vorfeld, am
20.03.2019, fand in Kiel die landesweite Konferenz „Künstliche Intelligenz – politische Ansätze
für eine moderne Gesellschaft“ auf Initiative der Staatskanzlei statt, die gemeinsam mit der
Christian-Albrechts-Universität zu Kiel, der IHK Schleswig-Holstein, dem Verein Digitale Wirt-
schaft SH sowie dem OpenCampus veranstaltet wurde. Zentral diskutiert wurde unter ande-
rem, auf welche Weise Erkenntnisse aus der Spitzenforschung in die Wirtschaft transferiert
werden können, wie der rechtliche Rahmen für die Anwendung von KI definiert werden könne
sowie welche gesellschaftlichen Aspekte, wie etwa der Wandel in der Arbeitswelt und Daten-
schutz und -sicherheit, zu betrachten seien. Die in diesem Rahmen erarbeiteten Ergebnisse
sollen dabei in die Landesstrategie Eingang finden und im Zuge einer Roadshow in der zweiten
Jahreshälfte verbreitet werden. Die drei IHKs zu Flensburg, zu Kiel und zu Lübeck erarbeiteten
unter Federführung des Kieler Hauses ihrerseits am 15.05.2019 erste, aus ihrer Sicht wichtige
Kernpunkte für ein noch zu erstellendes Positionspapier der Wirtschaft.
Die seitens der Staatskanzlei gesetzten Schwerpunkte der KI-Strategie sowie deren genaue
Inhalte sind noch nicht veröffentlicht. Unbekannt sind bis dato Format und Agenda der Road-
show. Die Wirtschaft benötigt andererseits einen klaren Handlungsrahmen und Unterstützung
seitens der Politik, um die unbestrittenen Chancen, die sich aus der neuen Technologie erge-
ben, für Schleswig-Holstein nutzbar zu machen. Aus diesem Grunde sollte die IHK SH sich
möglichst zeitnah in einem ersten Eckpunktepapier mit zentralen Forderungen im Rahmen
ihres Auftrages der Politikberatung zu Wort melden. Für die IHK zu Lübeck bedeutet dies: Die
Mitglieder der Vollversammlung der IHK zu Lübeck sind eingeladen in einem ersten Schritt diezentralen Positionen und Forderungen zu präzisieren und in Abstimmung mit den Schwester-
kammern zu finalisieren. Eine detaillierte Stellungnahme gegenüber der Landesregierung so-
wie weitere, noch abzustimmende Aktivitäten mit Blick auf die Roadshow schließen sich an.
3. Nächste Schritte:
Die Vollversammlung der IHK zu Lübeck stimmt dem geplanten Vorgehen zur Finalisierung
einer ersten Positionierung der IHK SH, ihrer Veröffentlichung im Rahmen einer landesweiten
Pressemeldung zu gegebener Zeit und der weiteren Begleitung der Arbeit der Landesregie-
rung zu.
2|2Standortpolik
Rüdiger Schacht
Telefon: 0451 6006-183
Anlage 4
Vollversammlung
TOP 3.4 Ausschuss für Verkehr und Infrastruktur am 13.05.2019
- Hafenentwicklungsplan Lübeck – Einbindung der Wirtschaft
Termin:
18.Juni 2019
1. Warum dieses Thema?
Der Ausschuss für Verkehr und Infrastruktur der IHK befasste sich in seiner Sitzung am 13.
Mai 2019 schwerpunktmäßig mit der Neuaufstellung des Hafenentwicklungsplans der
Hansestadt Lübeck.
Der alte Hafenentwicklungsplan datiert aus dem Jahr 1996. Die Hafenstandorte wurden
weitestgehend dem HEP von 1996 entsprechend entwickelt. Da die Veröffentlichung des
alten HEP schon 23 Jahre zurückliegt, bedarf es nunmehr einer Überprüfung der zukünftig
notwendigen Hafenkapazitäten. Hintergrund sind veränderte Umschlagsprognosen
(Seeverkehrsprognose) sowie veränderte wettbewerbliche Rahmenbedingungen für den
Ostseeverkehr.
2. Wie ist der Stand der Dinge?
Die Lübeck-Port-Authority (LPA) stellt zur Zeit auf Basis verschiedener Gutachten und
Plausibilitätsprüfungen einen neuen Plan auf. Vor der Vorlage in der Lübecker Bürgerschaft
sollen die Zwischenergebnisse im Rahmen eines moderierten Dialoges mit den Stakeholdern
abgestimmt werden. Die Debatte über den HEP 2030 wird über verschiedene Module auch
in den Stadtentwicklungsdialog über die Dachmarke Lübeck:überMorgen eingebunden:
Es gibt eine Online-Umfrage und Stadtteilgespräche. In einer Arbeitsgruppe
Hafenentwicklung sollen folgende Stakeholder miteinander beraten:
- Hafen- und Logistik (19): u.a. Umschlagsbetriebe, Reedereien, Speditionen, IHK
- Hansestadt Lübeck als Moderator
- Bürgervertreter (4)
- Anwohnerinitiativen (6)
- Travenutzer (4)
- Umwelt- und Naturschutzverbände (4)
3. Wie sollte es sein?
Ziel der Interessenvertretung der IHK muss die Erhöhung der Wettbewerbsfähigkeit des
Lübecker Hafens sein. Laut einer IHK-Studie aus dem Jahre 2013 steht diese in direktem
Zusammenhang mit der langfristigen Sicherung von 12.000 Arbeitsplätzen im IHK-Bezirk
sowie der Sicherung von Steuereinnahmen, dem Erhalt und dem Ausbau von
Handelsbeziehungen sowie den Transportverflechtungen des Lübecker Hafens mit
Zentraleuropa und dem skandinavischen, baltischen und russischen Raum. Es ist
vorgesehen, die vorliegende IHK-Studie zu aktualisieren.4. Was muss getan werden?
Die Industrie- und Handelskammer wird sich intensiv in den noch vor der Sommerpause
beginnenden Prozess einbringen. Es wird überlegt, aus diesem Grunde eine Ad hoc-
Arbeitsgruppe „Lübecker Hafen“ mit Vertretern der Hafenwirtschaft und der Organisationen
der Hafenwirtschaft einzurichten.
Die VV nimmt den Bericht zur Kenntnis.
2|2Innovation und Umwelt
Kathrin Ostertag
Telefon: 0451 6006-185
Anlage 5
Vollversammlung
TOP 3.4: Ausschuss für Energie und Umwelt am 23.05.2019 –
Klimaschutz und CO2-Bepreisung
Termin:
18.Juni 2019
1. Warum dieses Thema?
Die Norddeutschen Bundesländer haben Eckpunkte zu einer Wasserstoffstrategie vorgelegt.
Diese Technologie soll Abschaltungen von Windkraftanlagen im Norden verhindern und
gleichzeitig Mobilität klimafreundlicher gestalten.
Auf breiter Ebene wird eine CO2-Bepreisung gefordert. Der DIHK hat bereits einen
Vorschlag für eine Positionierung erarbeitet. Das kann sinnvoll sein, aber auch nur wenn
andere - bisher offenbar nicht wirksame - Instrumente neu überdacht werden. In diesem
Zusammenhang hat das Land Schleswig-Holstein eine Bundesratsinitiative zur Neuregelung
aller staatlich induzierten Preisbestandteile von Energie gestartet.
2. Wie ist der Stand der Dinge?
Der DIHK hat Leitlinien für eine tragfähige CO2-Bepreisung vorgelegt, die das DIHK
Präsidium am 6. Juni beschließen wird. Das Hauptamt ist über den Sommer bis Mitte
September in mehreren Runden eingeladen, diese Leitlinien mit konkreten Forderungen und
idealerweise mit einem alternativen Gesamtkonzept für wirksamen Klimaschutz zu
hinterlegen.
Der Ausschuss für Energie und Umwelt der IHK zu Lübeck hat in seiner Sitzung am 23.Mai
Klimaschutz von allen Seiten beleuchtet. Dr. Markus Groth vom Climate Service Center
Germany hat in die Thematik „Erreichung des 2 ° Zieles“ eingeführt und verdeutlicht, wie
dringend ein wirksames Handeln ist. Julian Schorpp vom DIHK in Brüssel spannte den
politischen Rahmen auf, der sich gerade für eine CO2-Bepreisung auf deutscher und
europäischer Ebene entwickelt. Anschließend zeigte uns Dr. Markus Groth wie weitverbreitet
CO2-Bepreisung international bereits ist. Das Ausschussmitglied Jan Eschke von Worleé
Chemie gab eine Übersicht über herausragende Aktivitäten der Wirtschaft für den
Klimaschutz. Bei den Beispielen von IKEA und Aldi wurde auch der anwesende Vertreter von
Friday for Futures aufmerksam mit dem dann später eine anregende Diskussion erfolgte.
Insgesamt ist man sich einige geworden, dass die aktuelle energiepolitische Rechtslage eher
Klimaschutz verhindert, denn befördert. Und es wurde die Gründung einer Ad hoc AG zur
CO2 Bepreisung und angrenzenden Themen beschlossen.
3. Wie sollte es sein?
Es soll mit betroffenen Unternehmen in einer Ad hoc AG die vom DIHK formulierten Leitlinien
mit konkreten Forderungen zu wirksamen Klimaschutzmaßnahmen hinterlegt werden mit
dem Fokus auf die Fragen: „Was wäre der Idealfall für die betroffene Wirtschaft?“ und „Was
dürfte auf keinen Fall passieren?“.
Aktuell sind noch zwei Termine kurz vor den Ferien in der Abstimmung. Es sind am 25. und
am 27.06.2019 jeweils von 9 bis 12 Uhr Räume in der MuK in Lübeck gebucht. Zudem erfolgt
eine enge Abstimmung mit den Schwesterkammern in Flensburg und Kiel.4. Was muss getan werden?
Bericht in der Vollversammlung. Das Thema soll breit diskutiert werden. Wir laden alle
Unternehmer dazu ein. Bei Interesse bitte Einladung bei INU Frau Sommerkamp
(Tel.: 0451 6006-143, Mail: sommerkamp@ihk-luebeck.de anfordern.
Anlage 5 A
DIHK Entwurf: Leitlinien für eine tragfähige CO2- Bepreisung
2|2Anlage 5 A
Anlage zu TOP 8
DIHK-Vorstandssitzung am 6. Juni 2019 in Berlin
– Entwurf –
Leitlinien für eine tragfähige CO2-Bepreisung
Die nationalen Ziele des Klimaschutzplans 2050 sehen eine Reduzierung der Treib-
hausgasemissionen Deutschlands um 40 Prozent 1 bis 2020, um 55 Prozent bis 2030
und um 80 bis 95 Prozent bis 2050 vor. Für das Jahr 2030 hat die Bundesregierung
im Klimaschutzplan zudem Ziele in den Wirtschaftsbereichen Energiewirtschaft, In-
dustrie, Gebäude, Verkehr und Landwirtschaft formuliert. 2
Im Gegensatz zum Klimaschutzplan entfalten die Verpflichtungen aus europäischen
Rechtsakten eine Bindungswirkung. Die Europäische Union hat im Rahmen des Ky-
oto-Protokolls und des Pariser Klimaschutzabkommens zugesagt, ihre Gesamtemis-
sionen bis 2020 um 20 Prozent und bis 2030 um mindestens 40 Prozent (jeweils ge-
genüber 1990) zu reduzieren. Für die Branchen, die dem europäischen Emissions-
handelssystem (ETS) unterliegen (Energiewirtschaft und weite Teile der Industrie),
wurde eine Treibhausgasminderung von 43 Prozent bis 2030 im Vergleich zu 2005
festgelegt.
Im Rahmen der Lastenteilung für die nicht unter den ETS fallenden Wirtschaftsberei-
che (Verkehr, Gebäude, Landwirtschaft) ist Deutschland zur Reduktion von Treib-
hausgasen um 14 Prozent bis 2020 und um 38 Prozent bis 2030 (jeweils gegenüber
2005) verpflichtet. 3 Deutschland wird sein Ziel 2020 in den Nicht-ETS-Sektoren vo-
raussichtlich verfehlen. Für die Erreichung des 2030 Ziels erscheint es aus heutiger
Sicht notwendig, bestehende Instrumente weiterzuentwickeln und zusätzliche Maß-
nahmen zu ergreifen. Damit werden absehbar auch an die deutsche Wirtschaft neue
Anforderungen seitens des Gesetzgebers gestellt, die Auswirkungen auf Wettbe-
werbsfähigkeit und den betrieblichen Alltag haben werden.
Aus dieser Ausgangslage speist sich eine Debatte um die Notwendigkeit zusätzlicher
klimapolitischer Instrumente, die auch Einfluss auf die wirtschaftlichen Standortbedin-
gungen Deutschlands haben werden. Gegenstand dieser Debatte sind neben ord-
nungsrechtlichen Vorgaben, Förderinstrumenten sowie Informations- und Beratungs-
angeboten vor allem verschieden ausgestaltete CO 2 -Bepreisungsmodelle.
1 Jeweils gegenüber dem Niveau von 1990.
2 Die Sektorziele können zum Teil weitreichende Folgen für die wirtschaftliche und soziale Entwick-
lung haben, weshalb die Ziele und darauf fußende Maßnahmenprogramme einer umfassenden
Folgenabschätzung (impact assessment) unterzogen werden sollen, die ggf. eine Anpassung der
Sektorziele ermöglicht.
3 Ausführlicher: „Aktuelle Klimaschutzziele auf internationaler, europäischer und nationaler Ebene“,
Wissenschaftlicher Dienst des Bundestags, 2018.Ein Auftrag zur Prüfung einer klimafreundlichen Weiterentwicklung des Steuer- und
Abgabensystems ist im Klimaschutzplan enthalten. Im Koalitionsvertrag ist ein CO 2 -
Bepreisungssystem als Ziel definiert, das mindestens die G20-Staaten umfassen
soll.
Zu den grundsätzlichen Optionen der direkten oder mittelbaren CO 2 -Bepreisung zäh-
len Instrumente der Mengen- und Preissteuerung. Die Möglichkeiten einer zusätzli-
chen CO 2 -Bepreisung durch ein Mengeninstrument reichen von einer Ausweitung
des Emissionshandels über die gesamten Nicht-ETS-Sektoren bis hin zur CO 2 -Men-
gensteuerung einzelner Segmente von Verbrauchssektoren. Auch für die Preissteue-
rung bestehen Optionen von einem einheitlichen CO 2 -Preis über alle Verbrauchssek-
toren bis hin zur Festlegung sektorieller CO 2 -Preise.
Angesichts der Vielfalt an Optionen formuliert der DIHK-Vorstand folgende Empfeh-
lungen als Grundvoraussetzungen für die Einführung zusätzlicher Instrumente zur
CO 2 -Bepreisung. Neue Instrumente zur direkten oder mittelbaren CO 2 -Bepreisung
sollten an diesen Kriterien gemessen werden und damit die betrieblichen Erfahrun-
gen und Herausforderungen der Unternehmen berücksichtigen. Die Reihenfolge
stellt dabei keine Priorisierung dar:
1. Europäisch und international denken: Die Einführung neuer Maßnahmen und
Instrumente sollte so weit wie möglich international, zumindest aber europäisch
abgestimmt erfolgen, um Wettbewerbsnachteile für Unternehmen am Standort
Deutschland zu vermeiden und Klimaschutz international durchzusetzen.
Begründung: Klimaschutz kann nur weltweit funktionieren. Gleichzeitig hat kein
anderer Wirtschaftsraum vergleichbar ambitionierte Ziele wie die EU. Deutsch-
land sollte Maßnahmen vermeiden, die einseitig zulasten der Wirtschaft gehen.
Bei einem rein nationalen Vorgehen sollten Zusatzbelastungen für die Betriebe
daher kompensiert werden. Eine Harmonisierung ist für die international ausge-
richtete Wirtschaft hierzulande wichtig. Nicht die absolute Höhe von Kosten ist
entscheidend im Wettbewerb, sondern vor allem die relative Kostenbelastung ge-
genüber anderen Unternehmen im gleichen Marktsegment.
2. Neue Instrumente an den Zielen ausrichten: Instrumente sollten zu den Zielen
passen. Bei einer sektorübergreifenden Zielverfolgung können übergreifende In-
strumente der CO 2 -Bepreisung eine flexible, effiziente und technologieneutrale
Zielerreichung über Sektorgrenzen hinweg unterstützen. Bleibt es andererseits
wie im Klimaschutzplan bei einzelnen Sektorzielen, sollten entsprechend sektor-
spezifische Instrumente gewählt werden.
2Begründung: Klimaschutz soll erfolgreich sein. Das heißt, Klimaziele sicher und
zu den für die Wirtschaft geringsten Kosten zu erreichen. Die Verständigung über
Ziele ist eine notwendige aber keine hinreichende Bedingung. Die Instrumenten-
wahl zur Erreichung dieser Ziele ist entscheidend. Aus Gründen der Effektivität
sollten starre Sektorziele daher mit sektorspezifischen Instrumenten adressiert
werden. Für ein die Nicht-ETS-Sektoren umfassendes Ziel kann ein übergreifen-
des CO 2 -Bepreisungsinstrument besser passen. Jahresscharfe Minderungsvor-
gaben sind mit einem Preisinstrument kaum zu erreichen, mit einem Mengen-
instrument dagegen treffsicher. Bei Punktzielen gibt es die Möglichkeit der Nach-
steuerung und damit mehr Flexibilität bei der Anpassung der Instrumente. In je-
dem Fall sollte berücksichtigt werden, dass zwischen den Wirtschaftsbereichen
unterschiedliche CO 2 -Vermeidungskosten bestehen.
3. Rechtsunsicherheit vermeiden: Es sollten keine Instrumente eingeführt werden,
die aus verfassungs- oder beihilferechtlichen Gründen Rechtsunsicherheiten für
Unternehmen mit sich bringen. Daher empfiehlt es sich, alle Maßnahmen intensiv
auf ihre Vereinbarkeit mit nationalem und europäischem Recht zu prüfen. Dies gilt
auch für ggf. einzuführende Entlastungsmöglichkeiten für Unternehmen. Diese
sollten, soweit dies erforderlich ist, bereits beihilferechtlich genehmigt sein, wenn
eine Entscheidung über CO 2 -Bepreisungssysteme gefällt wird.
Begründung: Die Wirtschaft steht bereits bei vielen politischen Beschlüssen zur
Energiewende vor der Herausforderung, einen hohen Grad an Rechtsunsicher-
heit verarbeiten zu müssen. Zudem müssen viele Entscheidungen des deutschen
Gesetzgebers beihilferechtlich überprüft und ggf. angepasst werden. Weitere
Rechtsunsicherheiten verhindern Investitionen der Unternehmen in die Energie-
wende und am Standort Deutschland.
4. Effektivität und Effizienz prüfen: Es ist wahrscheinlich, dass zumindest in ein-
zelnen Wirtschaftsbereichen weitere Instrumente zur Erreichung der nationalen
2030-Ziele benötigt werden. Es sollte daher zügig geprüft werden, ob eine CO 2 -
Bepreisung gegenüber der Anpassung bzw. Ausweitung bereits etablierter Politik-
instrumente effektiver und effizienter ist. Voraussetzung für zusätzliche Instru-
mente sollte sein, dass sie die Zielerreichung effektiv und kosteneffizient sicher-
stellen. Neue Instrumente sollten sich zudem in den bestehenden Kanon einbin-
den lassen bzw. diesen zu einem technologieoffenen Rahmen weiterentwickeln.
3Begründung: Es bestehen bereits zahlreiche – auch für viele Unternehmen rele-
vante – Klimaschutzinstrumente in Deutschland, auch der Mengen- und Preis-
steuerung. Wenn die Zahl der Instrumente ansteigt, ergeben sich neue Über-
schneidungen, Hemmnisse und Wechselwirkungen (siehe ETS und EEG), die zu
ineffizienten Ergebnissen führen und Klimaschutz für die Wirtschaft daher teurer
als notwendig machen können. Daher sollte zunächst die grundsätzliche Vorteil-
haftigkeit einer solchen Maßnahme bestätigt und auf Kohärenz mit weiteren
Rechtsnormen geprüft werden. Die Entwicklung neuer Technologien und deren
Markteinführung können sonst trotz Anreizen durch das neue Instrument ins
Leere laufen.
5. Ökonomische Folgen abschätzen: Vor der Einführung zusätzlicher Instrumente
sollten die ökonomischen Auswirkungen im Rahmen einer Folgenabschätzung
sowie die Wechselwirkungen mit bestehenden oder geplanten Instrumenten sorg-
fältig geprüft und geklärt werden. Dazu gehört, dass wirtschaftliche Auswirkungen
auf verschiedene Branchen und Unternehmensgrößen untersucht werden.
Begründung: Erst mit einer umfassenden Abschätzung der Auswirkungen von
bestimmten Maßnahmen wird die Politik in die Lage versetzt, informierte und ge-
samtwirtschaftlich effiziente Entscheidungen zu treffen. Vielfach wird z. B. davon
ausgegangen, dass die Industrie keine EEG-Umlage bezahlen würde, weil sie in
der Besonderen Ausgleichsregelung sei. In der Realität zahlt der allergrößte Teil
des produzierenden Gewerbes die volle EEG-Umlage. Die Belastungen für die
deutsche Wirtschaft, die sich aus Energiewende- und Klimaschutzmaßnahmen
ergeben (u. a. EEG, KWKG, „Ökosteuer“) belaufen sich jährlich auf eine mittlere
zweistellige Milliardensumme.
6. Wettbewerbsfähigkeit des Wirtschaftsstandorts Deutschland beachten: Zu-
sätzliche Instrumente sollten die Wirtschaft unter dem Strich nicht weiter belasten.
In besonderem Maße gilt dies für im internationalen Wettbewerb stehende Unter-
nehmen. Für diese sollten zusätzliche Belastungen ausgeschlossen werden. Für
alle anderen Betriebe sollten Zusatzbelastungen aus einer CO 2 -Bepreisung min-
destens begrenzt werden.
Begründung: Deutschland ist bei den Strompreisen in den meisten Verbraucher-
gruppen Spitzenreiter in Europa. 4 Insbesondere Unternehmen im internationalen
Wettbewerb aber auch die inländischen energieintensiven Unternehmen sind
4 EU-Kommission: Energy prices and costs in Europe.
4durch energiewendebedingte Abgaben und Umlagen vor allem auf den Strom-
preis benachteiligt. In der Industrie bereiten die hohen Energie- und Rohstoffkos-
ten die meisten Sorgen. 5 Bei den Strompreisen sind weitere Belastungen bereits
heute durch steigende Systemkosten wie Netzentgelte absehbar. Auch bei den
Kraftstoffen ist die Belastung durch erhobene Steuern im europäischen Vergleich
über dem Durchschnitt. Zusätzliche Belastungen verschlechtern die Bedingungen
am Standort Deutschland und führen zu Produktionseinschränkungen, gleichzei-
tig werden Emissionen ins Ausland verlagert (Carbon Leakage). Dies sollte in je-
dem Fall vermieden werden. Zudem sollten Systeme zur Rückverteilung an pri-
vate Haushalte und Unternehmen entwickelt werden, die zu einer spürbaren Ent-
lastung an anderer Stelle führen.
7. System der Abgaben und Umlagen weiterentwickeln und entbürokratisieren:
Die Einführung einer CO 2 -Bepreisung sollte sich in eine Weiterentwicklung und
Entbürokratisierung des bestehenden Abgaben- und Umlagesystems einfügen
bzw. bestehende Instrumente ersetzen.
Begründung: Eine Ergänzung von Energiesteuern um eine CO 2 -Komponente
entlastet weder Unternehmen noch Vollzugsbehörden von Bürokratie. Außerdem
birgt sie die Gefahr unsystematischer Zusatzbelastungen. Im Gegenteil sollte die
Einführung einer zusätzlichen CO 2 -Bepreisung ein Anlass sein, bestehende Sys-
teme zu hinterfragen, zu vereinfachen und zu ersetzen sowie die Wirtschaft vor
allem bei staatlich induzierten Energiepreisbestandteilen zu entlasten.
Zusätzliche Einnahmen aus einer CO 2 -Bepreisung sollten zudem nicht einer all-
gemeinen Staatsfinanzierung dienen. Neben einer Rückverteilung an private
Haushalte und Unternehmen (siehe Punkt 6) sollten Einnahmen aus einer CO 2 -
Bepreisung zur Förderung der Entwicklung und Anwendung emissionsarmer
Technologien eingesetzt werden.
8. Nicht-ETS-Sektoren in den Blick nehmen: Um die europäischen Verpflichtun-
gen einzuhalten, besteht in den ETS-Sektoren kein Bedarf an zusätzlichen Vorga-
ben für die Unternehmen. Daher sollte sich die Diskussion neuer Instrumente zur
CO 2 -Bepreisung auf die Bereiche konzentrieren, die nicht unter den Emissions-
handel fallen.
Begründung: Der Emissionshandel als Mengensteuerungsinstrument wird dafür
sorgen, dass die Sektoren Energiewirtschaft und weite Teile der Industrie zu den
5 DIHK-Konjunkturumfrage zum Jahresbeginn 2019.
5Minderungszusagen der EU für das Jahr 2030 ausreichend beitragen. Ob in
Deutschland die Emissionen in emissionshandelspflichtigen Sektoren stärker o-
der schwächer als im europäischen Durchschnitt ausfallen ist dafür unerheblich.
Anders verhält es sich für die Unternehmen in den Wirtschaftsbereichen, die nicht
unter den ETS fallen (Gebäude, Verkehr, Landwirtschaft). Hier steht Deutschland
in der Pflicht, die durch die Lastenteilungsentscheidung (Effort Sharing Regula-
tion) festgelegten Minderungsziele durch nationale Zusatzmaßnahmen zu errei-
chen.
9. Zeit zur Anpassung geben und stabile Rahmenbedingungen setzen: Um den
Unternehmen Entscheidungssicherheit zu geben, sollten neue Instrumente zur
CO 2 -Bepreisung nur mit angemessenem Vorlauf und einem für mehrere Jahre im
Voraus kalkulierbaren Entwicklungspfad eingeführt werden.
Begründung: Die Verlässlichkeit politischer Vorgaben ist für die Wirtschaft ein
hohes Gut, um in einem stabilen Rahmen investieren zu können. Sie benötigen
Zeit, sich auf neue Instrumente und Investitionssignale einstellen zu können. So
werden Unternehmensinvestitionen nicht kurzfristig entwertet. Große und wesent-
liche Schritte lassen sich in der Zukunft vor allem bei langlebigen Investitionsgü-
tern wie Maschinen, Anlagen oder Immobilien erreichen. Dort stehen aber oft
technologische, prozesstechnische oder verfahrenstechnische Grenzen mögli-
chen schnellen Einsparungen gegenüber.
10. Politische Durchsetzbarkeit beachten: Ohne eine Lenkungswirkung läuft eine
CO 2 -Bepreisung ins Leere. Damit einher geht automatisch eine Verschiebung
von Lasten zwischen verschiedenen Akteuren – privaten Haushalten und Unter-
nehmen gleichermaßen. Bei jeder Maßnahme sollten daher die politische Durch-
setzbarkeit und die langfristige Akzeptanz beachtet werden.
Begründung: Ist eine Maßnahme effektiv und rechtlich zulässig, stellt sich als
nächstes die Frage nach der Akzeptanz in Wirtschaft und Gesellschaft. So wür-
den erhebliche Belastungen einzelner Akteure die Umsetzung erschweren.
Ebenso sollte es keine Hängepartien wie bei der steuerlichen Förderung der
energetischen Gebäudesanierung geben, da diese Investitionen verhindern. Maß-
nahmen sollten transparent und nachvollziehbar ausgestaltet sein.
Berlin, 30. April 2019
6Standortpolitik
Manfred Braatz
Telefon: 0451 6006-182
Anlage 6
Vollversammlung
TOP 5: Fehmarnbelt Days 2020
Datum/Termin:
18. Juni 2019
1. Thema und Ziel:
Die Fehmarnbelt Days (FBDS) sind ein Konferenz-Format, das alle zwei Jahre in der Region
zwischen Hamburg und Südschweden organisiert wird. Unter der Leitung der Gründungsor-
ganisationen STRING, FBBC und Fehmarnbelt-Komitee finden die FBDS am 17. und 18. Mai
2020 im Ferienzentrum Weißenhäuser Strand statt. Die IHK zu Lübeck beteiligt sich als regi-
onaler Partner an der Organisation und ist federführend für das Thema ‚Wirtschaft und Regio-
nalentwicklung‘ verantwortlich.
Es ist das Ziel, mit den FBDS ein breites Publikum aus Politik, Verwaltung, Wirtschaft und
Öffentlichkeit anzusprechen, um die Entwicklungsperspektiven der Fehmarnbelt-Region zu
diskutieren. Für die IHK zu Lübeck ergibt sich 2020 die Chance, den Wirtschaftsstandort Han-
seBelt einem internationalen Publikum bekannt zu machen.
2. Stand der Dinge:
Aktuell laufen die Vorbereitungen für die inhaltliche Ausgestaltung der Konferenz. Zu den fünf-
ten Fehmarnbelt Days wollen wir zum ersten Mal aktiv die breite Öffentlichkeit zu einem grenz-
überschreitenden Dialog einladen. Nach den Vorbildern des dänischen Folkemøde auf Born-
holm und des schwedischen Allmedalen auf Gotland soll es in Form eines Bürgerfestivals zu
einem offenen Dialog zwischen Politik, Interessengruppen, Vereinen und der Bevölkerung
kommen. Ein in Deutschland neuer Ansatz, um Demokratie zu stärken, gute Nachbarschaft
auszubauen und den europäischen Gedanken für alle erlebbar zu machen. Denn nur, wenn
wir einander kennen und wissen, was uns eint, kann sich die grenz-überschreitende Fehmarn-
belt-Region zu einem europäischen Leuchtturm entwickeln.
Am zweiten Tag soll ein ‚klassisches‘ Konferenzprogramm organisiert werden, das eher das
Fachpublikum von Politik, Verwaltung, Unternehmen und sonstigen Akteuren im Fokus hat.
3. Nächste Schritte:
In den nächsten Monaten soll das Programm der beiden Veranstaltungstage finalisiert werden.
HINWEIS:
Im Nachgang der Vollversammlungssitzung laden wir alle Vollversammlungsmitglieder
und Gäste ein, sich an der inhaltlichen Gestaltung der Fehmarnbelt Days zu beteiligen.
Unter den beiden Leitfragen:
• Welche Themen im Kontext „Fehmarnbelt“ sind für Sie aus Unternehmersicht
besonders wichtig? Was würde Sie bewegen, an den Fehmarnbelt Days
teilzunehmen?
• Welche Personen/Akteure sollten auf den Fehmarnbelt Days zu Wort kommen
bzw. welche Meinung/Position würden Sie gerne auf den Fehmarnbelt Days
hören?
sammeln wir an einer Meta-Plan-Wand Ihre Meinungen und Wünsche.HGF-Stab
Dagmar Waselowski
Telefon: 0451 6006-102
Veranstaltungshinweise 2019
IHK-Veranstaltungen
U
Einen Überblick über die Veranstaltungen der IHKs Flensburg, Kiel und Lübeck finden Sie in unserer
Veranstaltungsdatenbank:
https://www.ihk-schleswig-holstein.de/System/veranstaltungssuche/vstSuche/1352840
1TU U1T
Bei Interesse bitten wir Sie, sich direkt zu den Veranstaltungen anzumelden.
Weitere Veranstaltungshinweise:
Dienstag, 18. Juni 2019
Vollversammlung
15 bis 16 Uhr Besichtigung der Anlage Weissenhäusser Strand/Strandhotel
16 bis ca. 20:30 Uhr (inkl. Ausklang)
Ferien- und Freizeitpark Weissenhäuser Strand GmbH & Co. KG, Strandhotel, Räume Schleswig
und Holstein
Seestr. 1, 23757 Weissenhäuser Strand
Ansprechpartnerin: Dagmar Waselowski, Tel.: 0451 6006-102
Dienstag, 25. Juni 2019
Wirtschaftsbeirat Segeberg
16 bis 18 Uhr
Möbel Kraft AG, Ziegelstr. 1, 23795 Bad Segeberg
Ansprechpartner: Justus Olesch, Tel.: 040 36138-6009
Donnerstag, 12. September 2019
Jobtour Bad Oldesloe
11 - 16 Uhr
Bad Oldesloer Ausbildungsbetriebe
Ansprechpartner: Frank Neef, Tel.: 0451 6006-216
Dienstag, 17. September 2019
Vollversammlung
16 bis ca. 20:30 Uhr (inkl. Ausklang)
Wirtschaftsakademie Schleswig-Holstein (WAK),
Guerickestr. 6-8, 23566 Lübeck
Ansprechpartnerin: Dagmar Waselowski, Tel.: 0451 6006-102
Donnerstag, 19. September 2019
Jobtour Norderstedt
11 - 16 Uhr
Norderstedter Ausbildungsbetriebe
Ansprechpartner: Frank Neef, Tel.: 0451 6006-216
Donnerstag, 19. September 2019
Parentum Lübeck
15 - 19 Uhr
media docks, Willy-Brandt-Allee 31, 23554 Lübeck
Ansprechpartner: Frank Neef, Tel.: 0451 6006-216Freitag, 20. September 2019 Ehrung der besten Auszubildenden im IHK-Bezirk Lübeck 16 - 20 Uhr Maritim Seehotel Timmendorfer Strand, Strandallee 73, 23669 Timmendorfer Strand Ansprechpartner: Sebastian Grothkopp, Tel.: 0451 6006-203 Mittwoch, 25. September 2019 4. Lübecker Ausbildungsrallye 9 - 15 Uhr Lübecker Ausbildungsbetriebe Ansprechpartner: Frank Neef, Tel.: 0451 6006-216 Dienstag, 5. November 2019 Gemeinsame Veranstaltung der IHKs Schwerin und Lübeck „Unternehmen im Wandel – 30 Jahre nach dem Fall der Mauer“ 16:30 bis 20:30 Uhr Betriebsrestaurant der Firma Euroimmun GmbH, Seekamp 31, 23560 Lübeck Ansprechpartnerin: Dagmar Waselowski, Tel.: 0451 6006-102 Donnerstag, 14. November 2019 Prüfertag mit Prüferehrung 14 - 18 Uhr media docks, Willy-Brandt-Allee 31, 23554 Lübeck Ansprechpartner: Sebastian Grothkopp, Tel. 0451 6006-203 oder Kristin Seifert-Prill, Tel.: 0451 6006- 209 Mittwoch, 20. November 2019 Landesbestenehrung Schleswig-Holstein 17 - 21 Uhr Musik- und Kongresshalle Lübeck, Willy-Brandt-Allee 10, 23554 Lübeck Ansprechpartner: Sebastian Grothkopp, Tel.: 0451 6006-203 Dienstag, 10. Dezember 2019 Vollversammlung 16 bis ca. 20:30 Uhr (inkl. Ausklang) IHK zu Lübeck, Räume Helsinki/Stockholm, Fackenburger Allee 2, 23554 Lübeck Ansprechpartnerin: Dagmar Waselowski, Tel.: 0451 6006-102
Sie können auch lesen