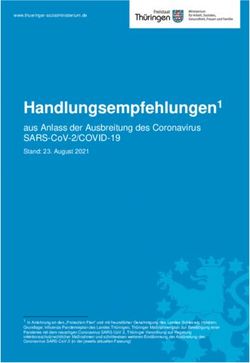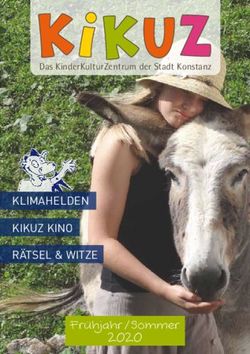Stellungnahme zu den Strukturanforderungen der Deutschen Rentenversicherung Bund - (April 2007)
←
→
Transkription von Seiteninhalten
Wenn Ihr Browser die Seite nicht korrekt rendert, bitte, lesen Sie den Inhalt der Seite unten
Stellungnahme zu den Strukturanforderungen der Deutschen Rentenversicherung Bund (April 2007)
Stellungnahme zu den Strukturanforderungen der DRV Bund Einführung Die stationäre Rehabilitation Sucht hat im Sinne des SGB IX den Auftrag, die selbstbestimm- te und gleichberechtigte Teilhabe von Menschen mit Behinderungen oder von Behinderun- gen Bedrohten am Leben in der Gesellschaft und ihren Gemeinden zu fördern, Einschrän- kungen der Erwerbsfähigkeit zu vermeiden, bzw. zu mindern, die Teilhabe am Arbeitsleben zu sichern und die persönliche Entwicklung zu stärken. Die Qualität der Rehabilitationsbe- handlung und deren Einbettung in das Behandlungs- und Versorgungssystem vor Ort sind dabei von entscheidender Bedeutung. Dieser Zielsetzung sollen die Strukturanforderungen der DRV Bund dienen, die in folgenden Dokumenten und Beiträgen vorgestellt wurden: Anforderungsprofil für eine stationäre Einrichtung zur medizinischen Rehabilitation von Alkoholabhängigen mit 100 Rehabilitationsplätzen, 26. Juli 2006 Dokumentationsbogen für Visitationen in Einrichtungen zur stationären medizinischen Rehabilitation bei Abhängigkeitserkrankungen, Version 1.0/Ab1 Oktober 2006 Vorträge zum Thema Bereitschaftsdienst/Notfallmanagement von Frau Helga Schallen- berg, Dezernat 8022 Abteilung Rehabilitation der DRV Bund (Management-Tagung des ‚buss’ im September 2005) und von Herrn Peter Baron Fachbereich 2 Abteilung Rehabili- tation der DRV Bund (Jahrestagung des ‚buss’ im März 2006) sowie Gespräch DRV Bund mit den Suchtverbänden vom 19. Juni 2006 Die hohe Leistungsfähigkeit der indikationsbezogenen, stationären medizinischen Rehabilita- tion Sucht ist weitgehend nachgewiesen. Daher dürfen pauschale Strukturanforderungen nicht dazu führen, dass die Qualität der individuellen Behandlung und des gesamten Be- handlungssystems reduziert wird. Die Festlegung von angemessenen Qualitätsstandards im Bereich Infrastruktur und Personal unter Berücksichtigung der besonderen Rahmenbedin- gungen im Indikationsbereich Abhängigkeitserkrankungen (geringes somatisches Risiko- potential der Patientinnen und Patienten, Größe und strukturelle Voraussetzungen der Ein- richtungen) sollte sich bundesweit an einheitlichen Maßstäben orientieren. Auch die Überprü- fung der Qualitätsstandards sollte in diesem Sinne erfolgen. Dabei ist ein vertrauensvoller und wertschätzender Umgang zwischen Leistungsträger und Leistungserbringer von zentra- ler Bedeutung. Die Formulierung von Checklisten (bspw. für Visitationen) ist prinzipiell zu begrüßen, führen sie doch zu größerer Transparenz und stärkerer Klarheit bzgl. der Anforderungen des Leis- tungsträgers. Kritisch ist jedoch die in den genannten Dokumenten durchschimmernde we- sentlich stärkere Betonung der Medizin und der ärztlichen Tätigkeit zu sehen. Unhinterfrag- bar ist die weiterhin gültige Prämisse, dass medizinische Rehabilitation nur unter ärztlicher Leitung und Verantwortung stattfinden kann. Dabei spielt bei den Sucht-Rehabilitanden im konkreten Versorgungsalltag die medizinische Perspektive gegenüber der sozialen und psy- chologischen Perspektive eine deutlich untergeordnete Rolle. Die geforderte ärztliche Prä- senz und Betreuungsintensität widerspricht teilweise den bisher gültigen und erfolgreichen Konzepten (und den zugehörigen genehmigten Stellenplänen) und kann möglicherweise nur zu Lasten anderer Berufsgruppen realisiert werden. Die interdisziplinäre Zusammenarbeit verschiedener Berufsgruppen trägt aber in diesem Rehabilitationsbereich besonders zur guten Ergebnisqualität bei, zumal es in der Regel kör- perlich stabilere und gesündere Menschen sind, die diese Entwöhnungsmaßnahmen in An- spruch nehmen. Gute Auslastungen und Haltequoten gerade kleinerer Rehabilitationseinrich- tungen sind als Hinweis auf hohe Qualität in diesen Einrichtungen zu werten. Eine allzu strenge Normierung kann konzeptionelle Weiterentwicklungen der indikationsbezogenen Rehabilitationsbehandlung beeinträchtigen und so einer von allen Seiten gewollten Stärkung der stationären, medizinischen Rehabilitation Sucht entgegenwirken. Stand: 18.04.2007 Seite 2 von 18
Stellungnahme zu den Strukturanforderungen der DRV Bund
Die Suchtverbände der freien Wohlfahrtspflege setzen sich mit dieser Stellungnahme ge-
meinsam dafür ein, dass eine nachhaltige Rechts- und Planungssicherheit für die Einrichtun-
gen ermöglicht wird und die Umsetzung der vorgestellten Strukturanforderungen durch kli-
nikspezifische Konzepte zum Bereitschaftsdienst und Notfallmanagement unter Berücksich-
tigung von Infrastruktur, Personalausstattung, regionaler Anbindung und finanziellen Rah-
menbedingungen erfolgen kann.
Ansprechpartner:
‚buss’ Wilhelmshöher Allee 273
Bundesverband für stationäre Suchtkrankenhilfe 34131 Kassel
Dr. Andreas Koch Telefon 0561/779351
Fax 0561/102883
andreas.koch@suchthilfe.de
CaSu Karlstraße 40
Caritas Suchthilfe 79104 Freiburg
Stefan Bürkle Telefon 0761/200-303
Fax 0761/200-350
stefan.buerkle@caritas.de
(fdr) Odeonstr.14
Fachverband Drogen und Rauschmittel 30159 Hannover
Jost Leune Telefon 0511/18333
Fax 0511/18326
leune@fdr-online.info
GVS Altensteinstr. 51
Gesamtverband für Suchtkrankenhilfe 14195 Berlin
im Diakonischen Werk Telefon 030/84312357
der Evangelischen Kirche in Deutschland Fax 030/84418336
Dr. Theo Wessel wessel@sucht.org
Stand: 18.04.2007 Seite 3 von 18Stellungnahme zu den Strukturanforderungen der DRV Bund Anforderungsprofil Allgemeine Anmerkungen Die Ausführungen im Anforderungsprofil richten sich an stationäre Einrichtungen zur medizi- nischen Rehabilitation von Alkoholabhängigen mit 100 und mehr Rehabilitationsplätzen. Damit zeigt es die Perspektiven der DRV-Bund für große Alkoholeinrichtung auf. Gleichzeitig wird im Papier jedoch festgestellt, dass bei den Einrichtungen für Alkohol- und Medikamen- tenabhängigkeit ein breites Spektrum von kleinen, mittelgroßen und großen Rehabilitations- einrichtungen existiert und dass die Einrichtungen mit mehr als 100 Rehabilitationsplätzen den qualitativen Anforderungen der Rentenversicherung am ehesten entsprechen. Im Text finden sich darüber hinaus Passagen, die Aussagen zur Rehabilitation von Drogenabhängi- gen treffen. Das ist insgesamt betrachtet missverständlich und erfordert eine Klarstellung durch die Ren- tenversicherung dahingehend, dass die vorliegenden Anforderungen an die großen Einrich- tungen im Bereich der Alkohol- und Medikamentenabhängigkeit gerichtet sind und nicht indi- rekt als Diskriminierung von Einrichtungen mit geringerer Platzzahl verstanden werden dür- fen. Es könnte hilfreich sein, ein Anforderungsprofil zu formulieren, das alle stationären Ein- richtungen der medizinischen Rehabilitation umfasst. Darin kann dann auch deutlich werden, dass unterschiedlich große Einrichtungen den unterschiedlichen Rehabilitationsbedarfen suchtkranker Menschen entgegen kommen. Die Vielzahl indikativer Gruppenangebote ist kein alleiniges Qualitätsmerkmal für eine erfolgreiche Rehabilitationsmaßnahme. Einrichtun- gen, mit weniger Plätzen können bessere Chancen der individuellen Förderung bieten, was für bestimmte Patientengruppen, beispielsweise für Menschen mit Migrationshintergrund, im Jugendalter und für junge Erwachsene – auch mit deren Kindern – von Vorteil sein kann. Insofern kann eine bestimmte Einrichtungsgröße, mit ihren jeweiligen spezifischen Angebo- ten, ein ausschlaggebendes Qualitätsmerkmal für die Erfüllung der individuellen Rehabilitati- onsbedarfe der Patienten/innen sein. Die medizinische Rehabilitation Suchtkranker orientiert sich nicht in erster Linie an somati- schen Erkrankungen, sondern folgt, wie im Anforderungsprofil beschrieben, dem biopsycho- sozialen Gesundheits- und Krankheitsfolgenmodell der WHO. Trotzdem ist eine Vielzahl der beschriebenen Forderungen zu einseitig an einem somatischen Behandlungsverständnis ausgerichtet. Dies wird beispielsweise in den Ausführungen zur apparativen Diagnostik so- wie in den personellen Anforderungen aber auch in der Beschreibung der allgemeinen An- forderungen (Arzneimittel- und Hygienekommission) deutlich. Hinweise auf einzelne Aspekte des Anforderungsprofils Im Folgenden wird auf wesentliche Aspekte des Anforderungsprofils eingegangen: a) Art und Umfang der Leistungen (Nr. 1) Das benannte Modell zur Kombinationsbehandlung „stationär/ambulant“ sieht grundsätzlich nur den stationären Beginn der Maßnahme vor. Dies ist für die Unterschiedlichkeit der Be- handlungsanforderungen zu einschränkend. b) Fort- und Weiterbildung (Nr. 2.2) Die Durchführung von Erste-Hilfe- und Notfall-Übungen sollte auf mindestens 1x jährlich be- grenzt sein. Wichtig ist, dass die Einrichtung sicherstellen kann, dass alle Mitarbeiter/innen jährlich beteiligt sein können. Stand: 18.04.2007 Seite 4 von 18
Stellungnahme zu den Strukturanforderungen der DRV Bund c) Arzneimittelkommission und Hygiene (Nr. 2.3 und 2.4) Für die Behandlungsbelange im Rahmen der medizinischen Rehabilitation von Suchtkranken erscheint die Einführung einer Arzneimittelkommission übertrieben. In den Kliniken, die ein Qualitätsmanagement betreiben, liegen Hygienepläne grundsätzlich vor. d) Apparative und räumliche Voraussetzungen (Nr. 5.3) Bei der apparativen Ausstattung zur Diagnostik sind unbedingt die besonderen Anforderun- gen, die das Krankheitsbild suchtkranker Menschen mit sich bringt, zu berücksichtigen. Not- fälle und Zusatzdiagnostiken, wie im Anforderungsprofil gefordert, entsprechen nicht den tatsächlichen Erfordernissen der Klientel der Suchtkranken. Wie in einer internen Befragung des Bundesverbandes für stationäre Suchtkrankenhilfe e.V. (‚buss’) deutlich wurde, werden in den stationären Einrichtungen zur medizinischen Rehabilitation für alkoholkranke Patien- ten mit geringem Risikopotential im Hinblick auf medizinische Notfälle behandelt. Besondere medizinische und psychiatrische Risikofaktoren werden im Rahmen der Aufnahmeuntersu- chung erhoben und entsprechende Maßnahmen eingeleitet. Notfälle (bis hin zu Todesfällen) treten - im Vergleich zu Normalbevölkerung - in sehr begrenztem Umfang auf und werden professionell behandelt (Erste Hilfe und Verständigung Notarzt). Die geforderten apparativen Voraussetzungen können, wenn tatsächlich erforderlich, auch an anderer Stelle sichergestellt werden. Belastungs-EKG, Abdomen-Sonographie, Lungen- funktionsstörungen etc. können von einem niedergelassenen Facharzt durchgeführt werden. Auch scheinen Überwachungszimmer für Notfälle mit Geräten zur Reanimation und Überwa- chung überdimensioniert. Sollte ein entsprechender Notfall eintreten, stellt sich die Frage der Verlegung in ein umliegendes Krankenhaus. e) Diagnostik (Nr. 6.2) Häufige Verlaufskontrollen unter anhaltender Abstinenz, wie die Kontrolle der Laborwerte und über sonografische Untersuchungen des Abdomens sowie laborchemische Abstinenz- kontrollen, wie im Anforderungsprofil gefordert, sind fachlich weder erforderlich noch sinnvoll. Kontrollen und Untersuchungen bei Rückfall und Rückfallgefährdung sind diagnostische In- strumente und sollten als solche ausschließlich punktuell, d.h. bei begründetem Verdacht und nicht präventiv oder begleitend eingesetzt werden. f) Personelle Anforderungen (Nr. 7) Grundsätzlich ist es richtig und verständlich, dass das Fachpersonal über entsprechende berufliche Qualifikationen verfügt. Suchtmedizinische Kenntnisse und Qualifikationen können jedoch nur tätigkeitsbegleitend in Einrichtungen der Suchthilfe erworben werden. Die Ein- trittsvoraussetzungen müssen die Möglichkeit berücksichtigen, die erforderlichen Fachkennt- nisse und Weiterbildungen in einem angemessenen Zeitraum in einer stationären Einrich- tung erlangen zu können. Inwieweit die Beteiligung der klinische Leitung der Einrichtung am Gesundheitstraining erfor- derlich ist, ist fraglich. Die apparativen Untersuchungen bei den Anforderungen für Stations- ärzte/innen werden sehr umfassend dargestellt. Deren Erfordernis im genannten Umfang wurde bereits unter Punkt 5.3 kritisch bewertet. Die Festlegung bei Diätassistentinnen, 80% ihrer Arbeitszeit im Patientenkontakt zu erbringen, ist schwer nachvollziehbar. Insgesamt stellt sich die Frage, ob eine Fachklinik unbedingt alle Berufgruppen vorhalten muss wie z.B. einen Sportlehrer. Aus ökonomischen Erwägungen kann ein entsprechendes Angebot auch über personelle und zusätzliche Leistungen von außen sichergestellt werden. Stand: 18.04.2007 Seite 5 von 18
Stellungnahme zu den Strukturanforderungen der DRV Bund Zur Besetzung von Arztstellen Ein großes Problem ist der Mangel an qualifizierten Ärzten auf dem Arbeitsmarkt. Zahlreiche Einrichtungen haben Schwierigkeiten, offene Stellen überhaupt oder adäquat zu besetzen; das Problem betrifft sowohl Assistenz- und Facharztstellen wie auch die Position der ärztli- chen Leitung. Die Anforderungen im Hinblick auf die Einhaltung des Stellenschlüssels und den Bereitschaftsdienst können somit teilweise nicht eingehalten werden, ohne dass die Ein- richtung dafür verantwortlich gemacht werden kann. Daher ist folgendes zu beachten: In der Anlage 2 Nr. 5 der Vereinbarung „Abhängigkeitserkrankungen“ vom 04.05.2001 wird für die ärztliche Leitung einer Einrichtung nicht zwingend der Facharzt für Psychiat- rie und Psychotherapie oder für Psychotherapeutische Medizin gefordert. Es ist auch ei- ne andere Facharztqualifikation (z.B. Psychiater, Internist, Allgemeinmediziner) mit der Zusatzbezeichnung „Psychotherapie“ oder „Psychoanalyse“ akzeptabel. Durch die Be- rücksichtigung dieser Alternativen kann das Spektrum qualifizierter und erfahrener Be- werber teilweise erheblich erweitert und die Suche nach einer „passenden“ ärztlichen Lei- tung erleichtert werden. Es ist in diesem Zusammenhang auch davon abzuraten, schlecht qualifiziertes ärztliches Personal nur für den Nacht- und Wochenenddienst einzustellen, weil in diesem Fall funk- tionierende Schnittstellen zu den übrigen therapeutischen Prozessen nur schwer zu rea- lisieren sind (Betreuungskontinuität und Übergabe). Falls also trotz ausreichender Arzt- stellen kein angemessener ärztlicher Präsenzdienst vorgehalten werden kann, sollten die betroffenen Einrichtungen entsprechende Alternativkonzepte (bspw. mit Kooperations- partnern oder anderen Berufsgruppen) ausarbeiten und mit dem federführenden Leis- tungsträger abstimmen. Stand: 18.04.2007 Seite 6 von 18
Stellungnahme zu den Strukturanforderungen der DRV Bund Dokumentationsbogen für Visitationen Qualitätsanforderungen schaffen Planungssicherheit, aber... Der Dokumentationsbogen für Visitationen ist in den stationären Einrichtungen der medizini- schen Rehabilitation Suchtkranker eher alarmiert, zumindest zwiespältig und selten befür- wortend aufgenommen worden. Offensichtlich führt die bisherige Praxis der Deutsche Ren- tenversicherung Bund dazu, neue Anforderungen zunächst einmal sorgenvoll zu betrachten. So sehr der Visitationsbogen zunächst auch die Verfahren weiter zu komplizieren scheint, so ist er andererseits auch ein Instrument, das Qualitätsanforderungen definiert und damit Pla- nungssicherheit schafft. Dass diese in einigen Bereichen weit über das in den Einrichtungen der medizinischen Rehabilitation Suchtkranker Mögliche hinausgeht, soll nachfolgend darge- stellt werden. Der Dokumentationsbogen für Visitationen gilt – oder auch nicht... Der Dokumentationsbogen wurde von der Deutsche Rentenversicherung Bund entwickelt und wird von den Regionalträgern direkt, adaptiert oder auch gar nicht angewandt. Im Sinne der Einheitlichkeit der Leistungserbringung ist von der Deutschen Rentenversicherung sicher zu stellen, dass seine Anwendung bundesweit abgestimmt wird. Dieses einheitliche Verfah- ren muss folgende Merkmale enthalten: 1. Unangemeldete Besuche in Therapieeinrichtungen sind Ausdruck des Misstrauens und angesichts einer transparenten Struktur-, Prozess- und Ergebnisqualität der Häuser nur bei massiven Qualitätsmängeln angebracht. 2. Die im Visitationsbogen niedergelegten komplexen Anforderungen können nur von gut ausgebildeten Visitatoren/-innen mit kommunikativer Kompetenz erfüllt werden. Das ist durch entsprechende Schulungen sicher zu stellen. 3. Im Sinne der Einheitlichkeit, auf Grund des Federführungsprinzips und der tatsächlichen Belegung sind gemeinsame Visitations-Teams DRV-Bund – Regionalträger notwendige Voraussetzung eines erfolgreichen Visitationsverfahrens. 4. Visitationen erfordern partnerschaftlichen Umgang, da die Anforderungen des Dokumen- tationsbogens nur im Dialog zu nutzbaren Ergebnissen führen, und müssen beratenden Charakter haben, um den Prozess der Qualitätsentwicklung zu unterstützen. Im Einzelnen ist festzustellen... Der Visitationsbogen transportiert das Bild des Einrichtungstyps einer Großklinik, der auf viele Einrichtungen im Verbundsystem der Suchthilfe nicht zutrifft. Hier finden sich eher klei- ne Therapieeinheiten, mit einem auf die/den Patienten/-in bezogenen Ansatz, der in der Re- gel ergänzt wird durch einen netzwerkbezogenen Ansatz in den jeweiligen regionalen Sucht- hilfeverbünden. Bis heute wurde jedoch von der Deutschen Rentenversicherung nicht deut- lich gemacht, worin die Vorteile großer Häuser liegen und inwiefern Normierungen der Struk- turqualität und des Behandlungsablaufs die Therapiechancen erhöhen können. Es entsteht der Eindruck, dass sich das Rehabilitationssystem zukünftig an den Erfordernis- sen verwaltungstechnischen Handelns ausrichtet und der Entwicklungs- und Rehabilitations- prozess der Patienten/-innen in Verbindung mit regional netzwerkbezogenem Qualitätsma- nagement demgegenüber eine untergeordnete Rolle spielt. Ein Großteil der Patienten/-innen in den Behandlungseinrichtungen für Drogenabhängige und viele im Bereich „legaler“ Süchte ist unter defizitären Sozialisationsbedingungen aufgewachsen und im Umgang mit soziokul- turellen Herausforderungen gescheitert. Für die Wiedereingliederung ist nicht nur medizini- sche sondern vor allem soziale und berufliche Rehabilitation zwingend erforderlich. Im Do- kumentationsbogen für Visitationen wird dies jedoch als kontraindiziert dargestellt, wenn Lernfelder wie Hausreinigung oder Küche von „Servicekräften“ übernommen werden sollen. Stand: 18.04.2007 Seite 7 von 18
Stellungnahme zu den Strukturanforderungen der DRV Bund Hier konterkarieren die Vorgaben des Dokumentationsbogens in erschreckender Weise die multidimensionalen Ansätze der erfolgreichen Rehabilitation Suchtkranker. Viele Patienten/-innen haben nicht gelernt, ihr Lebensumfeld bewusst wahrzunehmen, ge- schweige denn gesundheitsfördernd zu gestalten. Sie haben teilweise über viele Jahre auf der Straße gelebt oder in Haft zugebracht. Nach den dem Dokumentationsbogen zugrunde liegenden Vorstellungen lernen die Patienten/-innen, dass die Bedürfnisse ihres Alltags sich selbstständig durch Dritte erfüllen und sie selbst keinen Beitrag dazu leisten müssen. Auch die Standardisierung der Zimmerausstattungen engt Gestaltungsspielräume ein und erfüllt nicht den Zweck, perspektivisch ein selbstbestimmtes Leben führen zu können. Möglichkei- ten der Aktivierung und der Verbesserung von Teilhabemöglichkeiten werden hier ohne er- kennbare Notwendigkeit und um den Preis einer Verteuerung der Behandlung verstellt. Dies sind nur einige Beispiele, die die Absenkung eines bewährten Behandlungsstandards durch übermäßige Strukturanforderungen hin zu einem fremdbestimmten Verwahrstandard zu vollziehen scheinen. Dabei geht es nicht nur um die Frage, ob die neuen Visitationsstan- dards umgesetzt werden können – dies ist bei den meisten Anforderungen sicherlich der Fall – entscheidender ist die Frage der Sinnhaftigkeit und ob die Behandlungsangebote an die Patienten/-innen dadurch verbessert werden. Die formulierten Anforderungen kommen ei- nem Paradigmenwechsel gleich und sind daher zu kritisieren. Hier steht nicht eine Innovation im Interesse der Versicherten im Mittelpunkt, sondern der Versuch, eine Prüfschablone zu erstellen, die notwendigerweise Dynamisches festschreibt. Die Visitationsstandards dürfen sich nicht ausschließlich an klinischen Maßstäben mit bauli- chen, diagnostischen, apparativen und personellen Standards orientieren, da diese für die Rehabilitation mit dem Ziel der Wiederherstellung der Erwerbsfähigkeit nicht allein maßgeb- lich sind, sondern daran, wie Erfahrungen der Selbstwirksamkeit und Teilhabe in einem the- rapeutischen Setting und in das regionale Netzwerk gefördert werden können. So ist z.B. nicht erkennbar, worin der Vorteil von Krankenschwestern liegen soll, die in einem Klinikum sicherlich unverzichtbar sind, in einer Suchthilfeeinrichtung jedoch ihre spezifischen Kennt- nisse nicht einsetzen können, weil sie so gut wie gar nicht benötigt werden. Das Meistern von Lebenskrisen lässt sich nicht durch Blutdruckmessen beheben, sondern durch therapeu- tische Intervention und das Erkennen des Machbaren. Dagegen stellen z.B. Ex-User/-innen in der Drogentherapie eine therapeutische Alternative mit hohem Wirkfaktor dar und können zur Genesung in erheblichem Maße beitragen. Da diese Mitarbeiter/-innen zukünftig nicht mehr anerkannt werden, weil sie nicht die formalen Voraussetzungen erfüllen, wird ein weite- res positives Element der bisherigen Behandlung dem „Normierungswahn“ geopfert. Eine Vielzahl der Kriterien des Visitationsbogens der DRV ist offensichtlich nur von großen Kliniken zu erfüllen. Das genaue Studium der einzelnen Items der Bewertung macht deutlich, dass der Maßstab aus dieser Perspektive angelegt wird. Die Vorzüge des Settings kleinerer Einrichtungen mit bis zu 50 Plätzen bzw. therapeutischer Gemeinschaften für Drogenabhän- gige mit ihrem partizipativen Behandlungsansatz, ihren Möglichkeiten des individuellen Ein- gehens auf jeden einzelnen Patienten, mit ihren Mitwirkungs- und Gestaltungsräumen gehen dabei verloren, weil sie in den Ruf geraten sind, nicht mehr zeitgemäß zu sein. Nicht zuletzt haben die dem Dokumentationsbogen zugrunde gelegten Standards erhebliche finanzielle Auswirkungen auf die Einrichtungen, da nicht davon ausgegangen werden kann, dass im Kostensatz zusätzliche investive Mittel zukünftig berücksichtigt werden. Da die Leis- tungsentgelte schon seit vielen Jahren gedeckelt sind, können Investitionen nur über Kredite aufgebracht werden, die das Bestandsrisiko in erheblichem Maße erhöhen. Selbst kleine Belegungseinbrüche können so zu erheblichen und nicht tragbaren Belastungen führen. Stand: 18.04.2007 Seite 8 von 18
Stellungnahme zu den Strukturanforderungen der DRV Bund Anmerkungen zum Visitationsbogen der Deutschen Rentenversicherung im Detail 1.1.1 (3) Wann findet das Erstgespräch mit der/dem Bezugstherapeuten/-in statt? Es ist wichtig, dass die/der Patient/-in am Ankunftstag eine/-n Mitarbeiter/-in als Ansprech- partner/-in vorfindet. Es ist jedoch nicht immer sinnvoll, am Ankunftstag den Bezugsthera- peuten festzulegen. Es muss auch von beiden Seiten die Möglichkeit geben, die „Passung“ zu überprüfen. Außerdem sollten die Patienten/-innen ein Wahlrecht der/des Bezugsthera- peuten/-in haben. 1.1.1 (4) Biografische Anamnese Hier kann es sich nur um eine sehr formale biografische Anamnese handeln. Eine tieferge- hende biografische Anamnese kann den Patienten durchaus so labilisieren, dass ein Ab- bruch erfolgt. Dies ist vor allem dann der Fall, wenn schwere psychische Traumatisierungen lange Zeit verdrängt worden sind. Hier ist die Qualitätsforderung „spätestens am dritten Tag“ in vielen Fällen lediglich formal im Sinne einer Erhebung von Basisdaten zu erfüllen. 1.2.1 Aufnahmediagnostik Der Abschluss der Aufnahmediagnostik in allen relevanten Bereichen bis zum dritten Tag nach der Ankunft ist unrealistisch und nicht zwingend erforderlich. Ein angemessener Zeit- raum ist die erste Behandlungswoche. 1.2.2 Basisdiagnostik Der unbestimmte Begriff „adäquat“ ist in diesem Zusammenhang nicht hilfreich. Fast alle Apparate sind in kleinen Einrichtungen nicht notwendig. Apparative Diagnostik wird hier kon- sularisch mit externen Ärzten vollzogen. 1.2.5 Psychodiagnostik allgemein Dieses Item dokumentiert Unkenntnisse in den Verfahren. Eine differenzierte psychodynami- sche Diagnostik oder verhaltensanalytische Diagnostik ist ein Prozess, der im Verlaufe der Behandlung erfolgt und ständig vertieft wird. Innerhalb von drei Tagen kann keine psychodynamische Diagnostik erhoben werden. Sinn- voll kann dieses nur in den ersten Wochen geschehen. Die Forderung in Bezug auf die testgestützte Psychodiagnostik ist erfüllbar, setzt aber vor- aus, dass zusätzliche Arbeitszeit für eine/n Psychologe/-in bereit gestellt wird, die/der Tes- tungen z. T. durchführt und zumindest auswertet. Offen bleibt, ob die Ergebnisse therapiere- levant sind. Andernfalls würden Ressourcen für nicht therapierelevante Standarddiagnostik verschwendet. Anregung: Durch fallbezogene Besprechungen für auffällige Klienten Testungen vorsehen. 1.2.7 Spezielle Diagnostik Ebenso Ausdruck von Unkenntnis. Alle psychotropen Substanzen können gar nicht berück- sichtigt und getestet werden. 1.3 Sozialmedizinische Beurteilung Entspricht nicht der Realität. Die in der Mehrzahl tätigen nichtmedizinischen therapeutischen Mitarbeiter/-innen werden nur bei Problemfällen (1.3.2) berücksichtigt. Gerade im Bereich der sozialmedizinischen Beurteilung ist es wichtig, die interdisziplinäre Kompetenz einzubringen. 1.4 Nachsorge, Weiterbehandlung und Selbsthilfe Nachsorge, Weiterbehandlung und Selbsthilfe umfassen weit mehr Leistungen, als in diesen Items abgebildet. Die hohe Kompetenz vieler Einrichtungen in diesem Bereich ist mit den beschriebenen Items nicht abbildbar. Netzwerkbezogenes Qualitätsmanagement im Rahmen kommunaler Suchtkrankenhilfe wird nicht thematisiert. Selbst die Anforderungen der Deut- schen Rentenversicherung Bund an berufsbezogene Rehabilitation sind nicht berücksichtigt. Stand: 18.04.2007 Seite 9 von 18
Stellungnahme zu den Strukturanforderungen der DRV Bund 1.5.2 Organisation Unrealistischer Bewertungsmaßstab; die Angebote können in kleinen Einrichtung so gar nicht durchgeführt werden. 1.5.3 Qualitätssicherung Kann aufgrund zu geringer Fallzahlen in kleinen Einrichtungen kaum oder gar nicht umge- setzt werden. 1.6.1 Arzt-Patienten-Kontakt – Organisation Hier wird von einem abstrakten Klinikbetrieb ausgegangen. Die Vorteile intensiver persönli- cher Kontakte zum behandelnden Arzt in einer kleinen Einrichtung werden dagegen mit die- sem Beurteilungsraster nicht erfasst. Die Vorgabe von wöchentlichen Visitenzeiten tragen in keiner Weise zur Qualitätsverbesserung bei. 2.1.2 (1-3) Erreichbarkeit des Personals Mit diesen Items wird versucht, die Anonymität großer Einheiten zum Maßstab zu machen. Gerade kleine Einrichtungen können sehr individuell auf die Bedürfnisse der Patienten/-innen eingehen. 2.2.2 (1) Rehabilitationsteam / Bereichsteams Die therapeutischen Berufsgruppen sind nicht definiert. Auch dieses Item ist im Wesentlichen von großklinischen Systemen abgeleitet. Es ist in kleinen Teams nicht relevant bzw. kann kaum verwirklicht werden. 2.4.2 (2) Aufnahmeplanung / Aufnahme der Patienten Hier wird nicht nachvollziehbare Regelungs-“Wut“ deutlich. Ärztliche Beteiligung ist nicht das entscheidende Kriterium bei der Aufnahmeplanung. 2.5.1 (1) Therapieplanung / persönliches Therapieheft des Patienten Die Forderung nach einem Therapieheft ist Folge zu großer therapeutischer Einheiten, in denen Patienten/-innen im System verloren gehen können und deshalb Therapien dokumen- tieren müssen. In kleineren Einrichtungen ist/wird Dokumentation mit individuellen Angaben aus der EDV ersichtlich 2.5.2 Organisation und Planung der Therapie Das ist in kleinen Einrichtungen selbstverständlich. Sie sind wesentlich flexibler als große Einrichtungen. 2.7.1 Ernährung / Rahmenbedingungen Der Hinweis, Patienten nicht im Servicebereich des Speisesaals einzusetzen, ist eine über- zogene Forderung ohne Sachkenntnis. Hier wird nicht berücksichtigt, dass es nicht um Ser- vicekräfte geht, sondern um Menschen, die in ein Gesamtkonzept eingebunden sind. 2.8.2 (1-6) Medizinisches Notfallmanagement Dieses Item zeigt, dass der Dokumentationsbogen sich völlig von der Realität entfernt hat. Ein Notfallmanagement, das wie hier beschrieben verlangt wird, ist nicht einmal in Akutkran- kenhäusern zu realisieren (siehe separate Stellungnahme). Die Notfallausstattung ist in die- ser Form nicht notwendig und nicht finanzierbar. Im Notfall können Notärzte in kurzer Zeit in fast allen Einrichtungen vor Ort sein. Ein Notfalllabor ist überflüssig. Intubieren können in der Regel nur Ärzte, die so etwas regelmäßig üben, was bei Fachärzten für Psychotherapie oder Sozialmedizinern in der medizinischen Rehabilitation nicht der Fall ist. 3.4.3 (4) Beschwerdemanagement – Lesen des E-Berichtes durch Patienten Hier ist eine Klarstellung von Seiten der Rentenversicherung erforderlich, ob jetzt Patienten- berichte an diese herausgegeben werden dürfen oder sollen. Stand: 18.04.2007 Seite 10 von 18
Stellungnahme zu den Strukturanforderungen der DRV Bund 4.2.2 Barrierefreiheit Eine generelle Barrierefreiheit in allen einzelnen Einrichtungen ist schwer umzusetzen. In einem Einrichtungsverbund können einzelne Einrichtungen barrierefrei gestaltet werden. 4.6.1 (5) Patientenzimmer Höhenverstellbare Betten sind in medizinischen Reha-Einrichtungen für Abhängigkeitskranke nicht notwendig. 4.7 Diagnostische Grundausstattung Eine derartige diagnostische Grundausstattung ist nicht erforderlich. In Kooperation mit ex- ternen Ärzten können diese Anforderungen erfüllt werden. Mit den Ärzten in der Region be- stehen Vereinbarungen, dass alle ärztlichen Anforderungen gewährleistet sind. 4.8 Medizinisch-technische Ausstattung Das sind unspezifische medizinische Anforderungen, die in der medizinischen Rehabilitation im Wesentlichen nicht notwendig sind oder durch regionale Kooperationen hergestellt wer- den können. 4.11.4 Leitende/r Arzt /Ärztin mit Zusatzqualifikation Sozialmedizin oder Rehawesen Wie wird die jahrelange Erfahrung der Ärzte in den Einrichtungen berücksichtigt? Die ge- nannten Basiskriterien überfordern die Mehrzahl der kleineren Einrichtungen und können sich zum Ausschlusskriterium entwickeln. 4.11.8 Krankenschwester/-pfleger mit dreijähriger Ausbildung Nicht notwendig und wirtschaftlich nicht möglich. Bei konsequenter Umsetzung werden min- destens drei Krankenschwestern pro Einrichtung notwendig. Die bisherigen medizinischen Notfallsysteme haben funktioniert. 4.11.11 Diplom-Sportlehrer/in, Gymnastiklehrer/in In kleinen Einrichtungen nicht finanzierbar. 4.11.16 Med. Ernährungsberater/in; Diätassistent/in; Dipl.-Ökotrophologe/in In kleinen Einrichtungen nicht finanzierbar. Stand: 18.04.2007 Seite 11 von 18
Stellungnahme zu den Strukturanforderungen der DRV Bund Und was ist mit Adaptionseinrichtungen? … Ausgehend von dem Rahmenkonzept der Deutschen Rentenversicherung für die Adaptions- phase von 1994 ist die Frage zu stellen, welche Anforderungen aktuell an Adaptionseinrich- tungen gestellt werden (Personal, Ausstattung, Notfallmanagement), und ob diese ebenfalls im Rahmen von Visitationen überprüft werden sollen. Bekannt sind derzeit folgende Anforde- rungen: a) Strukturelle Anforderungen Die Einrichtung muss so gelegen sein, dass die Aufgabenerfüllung ohne besondere Er- schwernisse möglich ist. d.h. dass beispielsweise für die Besuche bei der Agentur für Arbeit und zur Absolvierung von Betriebspraktika nicht zu weite und zeitraubende Fahrten in Kauf genommen werden müssen. Sie sollte den individuellen Bedürfnissen der Versicherten ent- sprechen. Wenn die Einrichtung nicht über Kooperationen mit Betrieben für alle Versicherten Arbeitspraktika gewährleisten kann und dementsprechend einen Arbeits- und Beschäfti- gungstherapeuten/Ergotherapeuten beschäftigt, muss sie über einen Arbeitstherapiebereich verfügen. Weitere Strukturanforderungen sind: Neu zu errichtende Einrichtungen sollten über einen barrierefreien Bereich verfügen. Al- lerdings sollte Barrierefreiheit keine zwingende Voraussetzung für den Betrieb einer Adaptionseinrichtung sein, da der Anteil der entsprechenden Patienten extrem gering ist. Die Unterstützung sinnvoller Sport- und Freizeitmöglichkeiten ist sicherzustellen. Wichtig ist hier nicht allein das Angebot in der Einrichtung sondern vor allem auch das in der Gemeinde bzw. Region. Die Patientenzimmer sollten weitestgehend den Standards des sozialen Wohnungsbaus entsprechen. Dabei müssen individualisierte Wohnformen möglich sein, einrichtungsspe- zifische Besonderheiten als ein hoher Wert sollten Berücksichtigung finden und das Wunsch- und Wahlrecht des Patienten sollte in den Vordergrund gestellt werden. Dienstzimmer (z.B. für Ärzte und Therapeuten), Behandlungszimmer und angemessene Therapieräume sollten zur Verfügung stehen. Vorgehalten werden sollte auch ein Trocken- und Waschraum für die Versicherten sowie die Nutzung eines PC’ s mit Internetanschluss und individueller Mail-Adresse. Der weite- re Ausstattungsstandard sollte eher an den zu erwartenden Lebensbedingungen des Pa- tienten und nicht an den Vorgaben klinischer Behandlungsstandards der Rentenversiche- rer orientiert sein. Die zwingende Vereinheitlichung der unterschiedlichen regionalen Anforderungen an Einrich- tungen ist für den externen Adaptionsbereich kontraproduktiv und gefährdet den Fortbestand der Häuser, die auf Grund ihrer Lage und/oder ihrer Ausstattung oder anderer besonderer Merkmale einem generalisierten Gestaltungskonzept nicht entsprechen. Bei kleinen Einrich- tungen müssen die Vorgaben für Wirtschaftlichkeit und Effizienz im Hinblick auf die struktu- rellen Anforderungen berücksichtigen werden. Stand: 18.04.2007 Seite 12 von 18
Stellungnahme zu den Strukturanforderungen der DRV Bund b) Personelle Anforderungen Für die personelle Ausstattung einer Adaptionseinrichtung gelten folgende Eckwerte: Ein Arzt (FA für Psychiatrie/Neurologie) muss in der Einrichtung in die Entscheidungen eingebunden sein, ohne dass er der Leiter des Teams sein muss. Die Einrichtung muss über qualifizierte Sozialarbeiter/Sozialpädagogen, einer davon mit einer vom VDR vergleichbaren anerkannten indikationsspezifischen Weiterbildung, ver- fügen, die die Betreuung sicherstellen. Die Einrichtung muss für diejenigen Versicherten, die nicht an einem externen Arbeits- praktikum teilnehmen, über einen Arbeits- und Beschäftigungstherapeuten bzw. Ergothe- rapeuten verfügen. Der Bereich der Verwaltung muss personell abgedeckt sein. Der Personalschlüssel des Rahmenkonzeptes ist nur teilweise akzeptabel – Abweichungen aufgrund der besonderen Rahmenbedingungen in der Einrichtung müssen möglich sein. Ein interner ärztlicher/medizinischer Nachtdienst kann in der Regel nicht gewährleistet werden. Das individuell entwickelte Notfallmanagement, das an die spezifischen Rahmenbedingun- gen vor Ort angepasst ist, wird als ausreichend erachtet. Stand: 18.04.2007 Seite 13 von 18
Stellungnahme zu den Strukturanforderungen der DRV Bund Bereitschaftsdienst (ständige ärztliche Präsenz) Vorgaben der Deutschen Rentenversicherung Bund Zur Sicherstellung der medizinischen Versorgung der Patienten ist es grundsätzlich erforder- lich, einen 24-stündigen ärztlichen Präsenzdienst in Rehabilitationseinrichtungen vorzuhal- ten. Der Bereich der Abhängigkeitserkrankungen ist davon nicht ausgenommen. Allerdings ist es erforderlich, unter Berücksichtigung des neuen ArbZG (Arbeitszeitgesetz) als Ergebnis des entsprechenden EuGH-Urteils (Europäischer Gerichtshof) die gängigen Arbeitszeitmo- delle mit flexiblen Dienstzeiten und die Dienstpläne für das ärztliche Personal zu überprüfen. Die durchschnittliche wöchentliche Arbeitszeit wäre vor dem Hintergrund der gesetzlichen Regelungen somit auf maximal 48 Stunden zu begrenzen. Innerhalb dieses Rahmens ist eine durchgängige ärztliche Präsenz erst mit 6-7 Arztstellen realisierbar. Ein alternatives (zulässiges) Lösungsmodell wäre der Abschluss einer Dienstvereinbarung innerhalb der Ein- richtung oder des Trägers, der eine durchschnittliche wöchentliche Arbeitszeit von bis zu 58 Stunden auf freiwilliger Basis zulässt. Nach diesem Modell wären 5-6 Arztstellen für eine durchgängige Präsenz erforderlich. Die Deutsche Rentenversicherung Bund hat sich bereit gezeigt, im Rahmen der gesetzlichen Vorgaben individuelle Lösungen und Konzepte mit den Rehabilitationseinrichtungen zu bera- ten und umzusetzen. Das kann im Einzelfall auch bedeuten, dass bei Ausschöpfung aller verfügbaren Möglichkeiten (stellen- und kostenmäßig) eine personelle Aufstockung im Assis- tenzbereich vorgenommen werden muss, um den ständigen ärztlichen Präsenzdienst ge- währleisten zu können. Anmerkungen zur Umsetzung Grundsätzlich ist zu begrüßen, dass die Leistungsträger die Einrichtungen bei der Umset- zung der gesetzlichen Vorgaben unterstützen und den möglichen personellen Mehrbedarf bzw. die dadurch verursachten Mehrkosten über Anpassungen im Stellenplan sowie im Ver- gütungssatz abbilden wollen. Es ist darauf hinzuweisen, dass nur ‚große’ Einrichtungen von dieser Regelung betroffen sind, d.h. erst mit mindestens 5 Arztstellen (entspricht 150 Betten bei einem Arzt pro Station mit ca. 30 Betten) lässt sich überhaupt ein ArbZG-konformes Dienstplanmodell für die ärztliche Präsenz realisieren. Daher sind vor allem Einrichtungen, die über diese Bettenzahl verfügen oder bislang schon einen durchgängigen ärztlichen Prä- senzdienst vorgehalten hatten, dazu aufgefordert, ihren möglichen Mehrbedarf zu berechnen und mit dem federführenden Leistungsträger abzustimmen. Folgende Aspekte sind bei der Entwicklung entsprechender Dienstplan- und Arbeitszeitmo- delle zu berücksichtigen: Sicherstellung einer hinreichenden Kontinuität bei der Patientenbetreuung während der gesamten Behandlung Sicherstellung der Erreichbarkeit der Stationsärzte für die Patient/innen bei flexiblen Ar- beitszeiten Gewährleistung ausreichender Übergabezeiten zwischen den Diensten Flexibilisierung der Dienstpläne und Arbeitszeiten in Abstimmung mit den Bedürfnissen der betroffenen Mitarbeiter/innen (u.a. Berücksichtigung finanzieller Aspekte) Stand: 18.04.2007 Seite 14 von 18
Stellungnahme zu den Strukturanforderungen der DRV Bund Notfallmanagement Vorgaben der Deutschen Rentenversicherung Bund Einrichtungen, die bislang keinen 24-stündigen ärztlichen Präsenzdienst haben oder auf- grund ihrer Größe aufrechterhalten können, haben ein Notfallmanagement vorzuhalten. In diesen Einrichtungen werden Rehabilitanden behandelt, die aus Sicht des medizinischen Dienstes der DRV Bund über eine geringere gesundheitliche Gefährdung und somit über eine geringere somatische Notfallwahrscheinlichkeit verfügen. Von den verantwortlichen Ärz- ten dieser Einrichtungen sind im Konzept Indikationen und Kontraindikationen konkret zu beschreiben. Wenn im Rahmen der Aufnahme bzw. Aufnahmeplanung seitens der Einrich- tung ein nicht vertretbares Notfallrisiko erkannt wird, sind die Einweisungsunterlagen an die DRV Bund zurückzugeben oder bei nahtlosen Verlegungen aus dem Akutkrankenhaus ist die Aufnahme abzulehnen. Das Konzept für das Notfallmanagement muss folgende Aspekte umfassen: 1. Die 24-stündige Präsenz einer angemessenen Anzahl von Mitarbeiter/innen des medizi- nisch-therapeutischen bzw. des Pflegepersonals, wobei die Festlegung standortbezogen erfolgt, muss sichergestellt sein. Arbeitszeitmodelle und Dienstpläne müssen ebenfalls dem ArbZG entsprechen. 2. Übergabedienste zwischen den Schichten sind unabdingbar. Sie sind verbindlich zu re- geln und entsprechend zu dokumentieren. 3. Die diensthabenden Mitarbeiter/innen müssen die Grundregeln der Reanimation beherr- schen (nicht nur Erste-Hilfe-Ausbildung) und entsprechende Kurse nachweislich belegt haben sowie diese im angemessenen Zeitraum wiederholen. 4. Die ärztliche Notfallversorgung muss gewährleistet sein. Von der Rehabilitationseinrich- tung ist zu benennen, in welchem Zeitraum ein Arzt der Einrichtung oder des Rettungs- dienstes vor Ort eintreffen kann. Es müssen Notfallpläne schriftlich ausgearbeitet sein und dem federführenden Leistungsträger vorgelegt werden. 5. Notfallübungen sind zweimal jährlich von den an den Diensten beteiligten Mitarbei- ter/innen nachweislich durchzuführen. Alle übrigen Mitarbeiter/innen und die Pati- ent/innen sind in die Übungen einzubeziehen oder zumindest müssen mit diesen Notfall- schulungen durchgeführt werden. 6. Als sächliche Minimalausstattung wird vorausgesetzt: Ein Notfallkoffer („Ulmer Koffer“) mit Absaugmöglichkeit, Sauerstoffflasche und Defibrillator. Die Notfallausrüstung ist mo- natlich auf seine Einsatzfähigkeit hin dokumentiert zu überprüfen. Zusätzlich werden folgende strukturelle Anforderungen formuliert: 7. In allen Räumen, in denen sich Patient/innen alleine aufhalten können (Patientenzimmer, Nasszellen) sind Alarmierungsmöglichkeiten anzubringen, die auch im Falle eines Stur- zes noch greifbar oder erreichbar sein müssen (bspw. Notfallkordeln). Die Sauna muss über einen innen angebrachten Notfallknopf verfügen. Bei Betätigung muss der Alarm an einer zentralen und ständig besetzten Stelle ausgelöst werden (bspw. Rezeption, Schwesternzimmer, Dienstzimmer, mobiles Telefon). Die dort tätigen Mitarbeiter/innen müssen in die sich aus dem Alarm ergebenden Folgemaßnahmen eingewiesen sein (Notfallplan). 8. In allen Patientenzimmern sind Fluchtpläne anzubringen. In den Zimmern und den übri- gen Wohnbereichen ist darauf zu achten, dass die Fluchtwege frei bleiben und nicht durch Gegenstände/Mobiliar verstellt werden. Stand: 18.04.2007 Seite 15 von 18
Stellungnahme zu den Strukturanforderungen der DRV Bund 9. Die Türen der Patientenzimmer und Nasszellen sind mit einer zentralen Schließanlage (sog. Hotelschließzylinder) auszustatten. Diese gewährleisten, dass Mitarbeiter/innen im Notfall von außen in den von Raum gelangen können, auch wenn er von innen ver- schlossen wurde. Patient/innen können im Notfall den Raum verlassen, ohne die Tür auf- schließen zu müssen. 10. In allen relevanten Bereichen sind Erste-Hilfe-Kästen anzubringen. 11. Bei Neubauten sind Automatiktüren vorzusehen (Brandschutz). Anmerkungen zur Umsetzung Das Vorhalten eines geeigneten Notfallmanagement-Konzeptes ist für die Einrichtungen zur Rehabilitation Abhängigkeitskranker eine Selbstverständlichkeit und i.d.R. als Teil des QM- Handbuches ausführlich beschrieben. Damit ist auch bisher eine ausreichende Versorgung der Patient/innen bei medizinischen Notfällen gewährleistet gewesen. Die Umfrage unter den Einrichtungen des Bundesverbandes für stationäre Suchtkrankenhilfe (siehe Anlage 1) be- schreibt die aktuelle Situation und weist nach, dass die bestehenden Systeme in den Einrich- tungen funktionsfähig und angemessen sind. Allerdings gehen die formulierten Anforderungen der DRV Bund teilweise weit über das hin- aus, was in Einrichtungen erforderlich ist, die Rehabilitanden mit geringem somatischen Risi- kopotential behandeln. Im Einzelnen sind folgende Aspekte zu kritisieren: Eine entsprechende Risikoabschätzung findet bei der Patientenaufnahme grundsätzlich bereits statt, denn die ärztliche Leitung der Einrichtung muss überprüfen, ob die Behand- lung des Rehabilitanden unter medizinischen Aspekten verantwortbar ist. Eine entspre- chende ärztliche Prüfung und Entscheidung ist in den Prozessbeschreibungen am Tag der Aufnahme vorzusehen (bspw. erfolgt immer wieder aufgrund von Suchtmittelkontrol- len eine Verlegung in die Entgiftung). Allerdings muss das Erkennen von Risikopotentia- len nicht zwingend zu einer Abweisung führen, da die grundsätzliche Reha-Fähigkeit be- reits bei der Bewilligung des Reha-Antrages festgestellt wurde. Eine weitere Möglichkeit ist die Aufnahme sowie der Beginn der Behandlung im Zusammenhang mit der Einleitung von besonderen Präventions- und Überwachungsmaßnahmen. Zu Nr. 1-3: Eine Analyse der bestehenden Konzepte für den Nacht- und Wochenend- dienst kann in allen Einrichtungen sinnvoll sein (u.a. im Hinblick auf das ArbZG). Überga- ben zwischen den Diensten sind schon aus therapeutischer Sicht zur Sicherstellung der erfolgreichen Gesamtbehandlung unverzichtbar. Allerdings ist die Einschränkung des Personenkreises für die Dienste unter Bezug auf die Formalqualifikation (Ärzte, Thera- peuten, Pflegekräfte) wenig sinnvoll. Viel entscheidender ist die Ausbildung und das Inübunghalten des diensthabenden Personals in Basismaßnahmen der Reanimation und im Notrufsystem. Folglich ist das diensthabende Personal einrichtungsspezifisch festzu- legen und die Ausbildung nachzuweisen. Zu Nr. 4-5: Jede Einrichtung muss über einen Notfall- bzw. Alarmierungsplan verfügen. Dabei ist verbindlich festzulegen, welcher Alarmierungsweg nach Einleitung der Erst- maßnahmen von den diensthabenden Mitarbeiter/innen zu aktivieren ist. In Abhängigkeit von Lage und Infrastruktur der Einrichtung ist sowohl die Integration in die Notfallstruktur eines benachbarten Akutkrankenhauses wie die unmittelbare Alarmierung des Notarztes möglich. Die regelmäßige Übung dieser Notfallpläne ist selbstverständlich und schafft Handlungssicherheit im Ernstfall. Zu Nr. 6: Bei der Ausstattung des Notfallkoffers ist ein Standard vorzusehen, der den Möglichkeiten des sorgfältig ausgebildeten diensthabenden Personals entspricht (Beat- mung, Defibrillation). Die regelmäßige Überprüfung sollte sich an den Angaben der Her- steller orientieren. Stand: 18.04.2007 Seite 16 von 18
Stellungnahme zu den Strukturanforderungen der DRV Bund Zu Nr. 7-11: Die Notwendigkeit der hier geforderten sehr aufwändigen und kostenintensi- ven Maßnahmen ist deutlich in Frage zu stellen. Die Umfrage des ‚buss’ zeigt, dass die aufgetretenen Todesfälle durch Alarmierungsknöpfe nicht hätten verhindert werden kön- nen. Hingegen kommt die Alarmierung durch Mitpatienten im Zwei-Bettzimmer häufiger vor. Grundsätzlich sollten die baulichen Maßnahmen (Alarmierungssystem, Schließsys- tem, Automatiktüren, Erste-Hilfe-Kästen) in Abhängigkeit von den baulichen Vorausset- zungen und auch erst bei sowieso anstehenden Renovierungs- oder Baumaßnahmen umgesetzt werden. Bei Neubauten können entsprechende technische Anlagen vorgese- hen werden. Die Kennzeichnung und Offenhaltung von Fluchtwegen ist allerdings selbst- verständlich. Grundlage für das Notfallmanagement in Reha-Einrichtungen für Abhängigkeitserkrankun- gen sollte die anliegende Expertise sein (siehe Anlage 2). Sämtliche Kosten, die durch per- sonelle, organisatorische und bauliche Maßnahmen zur Umsetzung des Notfallmanage- ments anfallen, müssen außerdem durch die Leistungsträger erstattet werden (einmalige Aufschläge oder entsprechende Anhebung der Vergütungssätze) und können nicht zu Las- ten der Einrichtungen und ihrer Träger gehen. Stand: 18.04.2007 Seite 17 von 18
Stellungnahme zu den Strukturanforderungen der DRV Bund
Anlagen:
1. Umfrage des ‚buss’ zum Bereitschaftsdienst und Notfallmanagement
(Stand: Juni 2006)
2. Stellungnahme Notfallmanagement in Medizinischen Einrichtungen
(ohne Akutkrankenhäuser)
Stand: 18.04.2007 Seite 18 von 18Bundesverband für
Stationäre Suchtkrankenhilfe e.V.
Umfrage zum
Bereitschaftsdienst und
Notfallmanagement
Stand: Juni 2006
Gliederung
1. Teilnehmende Einrichtungen
Regionalgruppen
Bettenzahl
Suchtmittel
2. Ergebnisse Bereitschaftsdienst
Ärztlicher Bereitschaftsdienst (im Haus) – differenziert nach Einrichtungsgröße
Nichtärztlicher Dienst (im Haus) – differenziert nach Einrichtungsgröße
Ärztlicher Notdienst – differenziert nach Einrichtungsgröße
3. Ergebnisse Vorkommnisse (2003 – 2005)
Todesfälle
Tod innerhalb 24 Stunden nach Verlegung
Todesfälle - Fallbeschreibungen
Schaden durch verzögerte ärztliche Hilfeleistung
Schadensersatzansprüche
4. Zusammenfassung
2
1Teilnehmende Einrichtungen
Die Struktur der teilnehmenden Einrichtungen
im Hinblick auf regionale Verteilung, Größe
und Indikation entspricht im Wesentlichen der
Mitgliederstruktur des ‚buss‘.
Die Ergebnisse der Befragung können unter
diesen Voraussetzungen als repräsentativ
betrachtet werden.
3
Regionalgruppen
Häufigkeit Prozent
Bayern 12 14,6
Baden-Württemberg 12 14,6
Hessen / Rheinland-Pfalz 13 15,9
Norddeutschland 17 20,7
Nordrhein-Westfalen 20 24,4
Ostdeutschland 8 9,8
Gesamt 82 100,0
4
2Bettenzahl
Häufigkeit Prozent
ohne Angabe 2 2,4
bis 25 Betten 12 14,6
26 bis 50 Betten 37 45,2
51 bis 99 Betten 22 26,8
100 und mehr Betten 9 11,0
Gesamt 82 100,0
5
Suchtmittel
Häufigkeit Prozent
Alkohol / Medikamente 41 50,0
Alkohol / Medikamente / Drogen 27 32,9
Drogen 14 17,1
Gesamt 82 100,0
6
3Ärztlicher Bereitschaftsdienst
(im Haus)
Etwa jede 4. Einrichtung verfügt über einen
ständig im Haus anwesenden ärztlichen
Bereitschaftsdienst.
Bei etwa der Hälfte der größeren
Einrichtungen ist durchgängig ein Arzt
anwesend.
Die Möglichkeit, einen ärztlichen
Bereitschaftsdienst zu stellen, ist abhängig
von der Größe der Einrichtung und somit von
Umfang bzw. Struktur der personellen
Ausstattung.
7
Ärztlicher Bereitschaftsdienst
(im Haus)
Wochenende Häufigkeit Prozent
ohne Angabe 1 1,2
Ja 20 24,4
Nein 61 74,4
Gesamt 82 100,0
Nacht Häufigkeit Prozent
ohne Angabe 1 1,2
Ja 19 23,2
Nein 62 75,6
Gesamt 82 100,0
8
4Ärztlicher Bereitschaftsdienst
(im Haus)
Wochenende Häufigkeit Prozent
Ja 3 25,0
Nein 9 75,0
Gesamt 12 100,0
Nacht Häufigkeit Prozent
Ja 3 25,0
Nein 9 75,0
Gesamt 12 100,0
9 bis 25 Betten
Ärztlicher Bereitschaftsdienst
(im Haus)
Wochenende Häufigkeit Prozent
Ja 7 18,9
Nein 30 81,1
Gesamt 37 100,0
Nacht Häufigkeit Prozent
Ja 6 16,2
Nein 31 83,8
Gesamt 37 100,0
10 26 bis 50 Betten
5Ärztlicher Bereitschaftsdienst
(im Haus)
Wochenende Häufigkeit Prozent
Ja 7 31,8
Nein 15 68,2
Gesamt 22 100,0
Nacht Häufigkeit Prozent
Ja 7 31,8
Nein 15 68,2
Gesamt 22 100,0
11 51 bis 99 Betten
Ärztlicher Bereitschaftsdienst
(im Haus)
Wochenende Häufigkeit Prozent
Ja 4 44,4
Nein 5 55,6
Gesamt 9 100,0
Nacht Häufigkeit Prozent
Ja 4 44,4
Nein 5 55,6
Gesamt 9 100,0
12 100 und mehr Betten
6Nichtärztlicher Dienst (im Haus)
In Ergänzung zum oder als Ersatz für einen
ärztlichen Bereitschaftsdienst verfügen (fast)
alle Einrichtungen über einen ständig
anwesenden diensthabenden Mitarbeiter.
Diese Aufgabe wird überwiegend von
entsprechend ausgebildeten Pflegekräften,
Hilfskräften oder den therapeutischen
Mitarbeitern wahrgenommen.
Es existiert ein Vielzahl von
einrichtungsspezifischen Modellen zur
Sicherstellung dieses Präsenz-Dienstes.
13
Nichtärztlicher Dienst (im Haus)
Wochenende Nacht
Zahl % Zahl %
ohne Angabe 2 2,4 2 2,4
Therapeuten 13 15,8 3 3,6
Therapeuten und Hilfskräfte 7 8,6 2 2,4
Krankenpflege 17 20,7 40 48,8
Krankenpflege + Hilfskräfte 7 8,6 10 12,2
Therapeuten + Krankenpflege 26 31,7 6 7,4
Hilfskräfte 9 11,0 18 22,0
Wachdienst 1 1,2 1 1,2
Gesamt 82 100,0 82 100,0
14
7Nichtärztlicher Dienst (im Haus)
Wochenende Nacht
Zahl % Zahl %
Therapeuten 4 33,3 1 8,3
Therapeuten und Hilfskräfte 3 25,0
Krankenpflege 3 25,0 3 25,0
Krankenpflege + Hilfskräfte
Therapeuten + Krankenpflege
Hilfskräfte 2 16,7 8 66,7
Wachdienst
Gesamt 12 100,0 12 100,0
15 bis 25 Betten
Nichtärztlicher Dienst (im Haus)
Wochenende Nacht
Zahl % Zahl %
Therapeuten 7 18,9 1 2,7
Therapeuten und Hilfskräfte 3 8,1 2 5,4
Krankenpflege 5 13,5 14 37,9
Krankenpflege + Hilfskräfte 3 8,1 5 13,5
Therapeuten + Krankenpflege 13 35,2 5 13,5
Hilfskräfte 6 16,2 10 27,0
Wachdienst
Gesamt 37 100,0 37 100,0
16 26 bis 50 Betten
8Sie können auch lesen