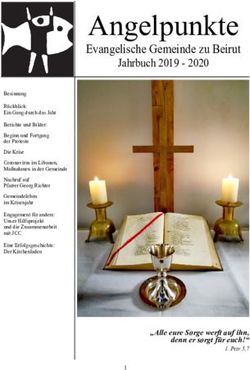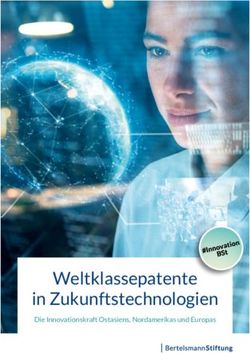Wohnen im Alter - Herausforderungen und Handlungsempfehlungen für Ge- meinden am Beispiel der Gemeinde Weiz - unipub
←
→
Transkription von Seiteninhalten
Wenn Ihr Browser die Seite nicht korrekt rendert, bitte, lesen Sie den Inhalt der Seite unten
Mag. Michaela Bauer
Wohnen im Alter – Herausforderungen
und Handlungsempfehlungen für Ge-
meinden am Beispiel der Gemeinde
Weiz
Masterarbeit
zur Erlangung des akademischen Grades
eines Master of Arts
im Rahmen des Universitätslehrganges
Interdisziplinäre Gerontologie
Assoz. Prof. Mag. Dr.phil. Ulla Kriebernegg
Karl-Franzens-Universität Graz
und UNI for LIFE
Weiz, Mai 2016Ehrenwörtliche Erklärung Ich erkläre ehrenwörtlich, dass ich die vorliegende Arbeit selbstständig und ohne fremde Hilfe verfasst, andere als die angegebenen Quellen nicht benutzt und die den Quellen wörtlich oder inhaltlich entnommenen Stellen als solche kenntlich gemacht habe. Die Arbeit wurde bisher in gleicher oder ähnlicher Form keiner anderen inlän- dischen oder ausländischen Prüfungsbehörde vorgelegt und auch noch nicht veröf- fentlicht. Die vorliegende Fassung entspricht der eingereichten elektronischen Versi- on. Mai 2016 Unterschrift
Danksagungen
An dieser Stelle möchte ich mich bei allen bedanken, die sich mit ihrem fachlichen
Wissen eingebracht haben und mir eine emotionale Stütze während des Verfassens
dieser Masterarbeit waren.
Ich danke:
Prof. Dr. Ulla Kriebernegg für ihre Unterstützung und die Betreuung bei meiner
Masterarbeit. Ihre Herzlichkeit und Klarheit hat mir geholfen, meinen Faden zu
finden und dank ihrer Betreuung, habe ich immer die passenden Worte gefun-
den.
Gruber Ingrid, meiner Freundin und Arbeitskollegin, für ihre Ausdauer und
Zeit. Mit ihren Fachkenntnissen hat sie mir geholfen, meine Gedanken zu ord-
nen und einen roten Faden zu finden. Ich bin ihr auch sehr dankbar für ihren
Einsatz bezüglich der Korrekturen.
Gerhard Ziegler für seinen Enthusiasmus. Mit seiner Idee, etwas für Weiz zu
tun, hat er mich zum Thema der vorliegenden Masterarbeit geführt.
Meiner Tochter Sarah für ihre Computerkompetenz. Mit ihrer Hilfe meisterte
ich die Herausforderungen von Tabellen und Verzeichnissen.
Meinem Mann Andi für sein Verständnis, seine Geduld und Liebe. Mit seiner
positiven Einstellung und den Glauben an mich, hat er mich nie verzweifeln
lassen.Kurzfassung Wohnen im Alter ist ein Thema, das uns alle betrifft. Im Besonderen sind hierbei die Gemeinden gefordert. Sie sind verantwortlich für Infrastruktur, Rahmenbedingungen und Daseinsvorsorge für ihre Bürgerinnen und Bürger. Unterschiedliche Faktoren führen nun zu einer Vielzahl von Herausforderungen für Gemeinden: Alter(n) und Altersbilder der Gesellschaft und des Einzelnen, die zu er- wartenden demografischen Veränderungen mit einer Zunahme der Hochaltrigkeit und der Veränderungen sozialer Strukturen wie Zunahme der Singlehaushalte und Abnahme familiärer Netzwerke, die unterschiedlichsten Wohnbedürfnisse und Wohn- formen der älteren Menschen sowie der mögliche Lösungsansatz einer Quartiers- entwicklung. Die vorliegende Arbeit beschäftigt sich mit diesen Anforderungen und stellt die Ist- Situation im Bereich der demografischen Entwicklung für die Gemeinde Weiz dar. Des Weiteren werden mögliche Wohnformen für ältere Menschen erarbeitet, mit dem Hinweis, welche Wohnformen in Weiz vorhanden sind. Auf das Konzept der Quar- tiersentwicklung wird näher eingegangen. Es stellt einen Lösungsansatz für Wohnen im Alter dar. Anhand des Bielefelder Modells soll gezeigt werden, wie ein Wohnkon- zept in der Praxis umgesetzt werden kann. Aus der Menge an Herausforderungen werden Handlungsempfehlungen erarbeitet, die in drei Bereiche (politisch, strategisch und inhaltlich) unterteilt werden. Jeder Be- reich umfasst eine Vielzahl an unterschiedlichsten Maßnahmen. Die Lösungsvor- schläge stellen allgemein für Gemeinden eine Arbeitsgrundlage dar, für die Gemein- de Weiz wurden spezifische Empfehlungen ausgesprochen, die in naher Zukunft in Angriff genommen werden sollten. Die Handlungsempfehlungen reichen von einer integrierten Stadtpolitik, Schaffung von förderlichen Rahmenbedingungen über Verbesserung der Information, Koopera- tion und Kommunikation bis hin zur Entwicklung eines altengerechten Wohnumfeldes und einer entsprechenden Infrastruktur. Schlüsselwörter: Herausforderungen, Demografie, Gemeinde, Wohnen im Alter, Quartiersentwicklung, Handlungsempfehlungen
Abstract Housing options for older people is a matter of concern to all of us but a key challen- ge for local governments. They are responsible for their citizens’ infrastructure facili- ties and frameworks as well as public services. Various factors trigger a series of challenges for small town communities: age and ageing, society-releated and individual images of old age, predictable demographic changes in connection with longevity, alteration of social structures such as single households and the decrease of family networks and varying needs and forms of housing for older people. A potential approach to respond to these challenge may the quarter development. This thesis deals with these requirements and outlines the current state of demogra- phic development in Weiz, a small town in the eastern part of the Austrian state of Styria. With reference to forms of habitation for older people which are already exis- ting in Weiz, it adresses further possible forms of elder-friendly dwellings. The focus has been laid upon the concept of quarter development as a workable approach to- wards housing options for older people. The „Bielefeld Modell“ serves as an example of best practice for old-age quarter developments. Based on this series of challenges, recommendations for action have been develo- ped which are subdivided into political, strategical, and content-related aspects. Each aspect comprises a number af various measures. Proposed solutions can serve as a general working basis for communities. For the city of Weiz, specific recommenda- tions have been made which are to be implemented in the near future. Recommendation for action comprise an integrated city community policy, promotion of favourable framework conditions, improvement of information, cooperation and communication and include the development of an elder-friendly residential environ- ment as well as appropriate infrastructure facilities. Key words: challenges, demography, small town communities, housing options for older people, small town quarter development, recommendations for action
Inhaltsverzeichnis
Inhaltsverzeichnis ................................................................................................ 1
1 Einleitung........................................................................................................ 5
2 Alter(n) und Altersbilder ................................................................................ 7
2.1 Die Heterogenität des Alter(n)s ............................................................... 7
2.2 Altersbilder............................................................................................. 11
2.3 (Aus-)Wirkungen von Altersbildern ........................................................ 13
2.4 Herausforderungen für die Gemeinde ................................................... 15
3 Demografischer Wandel .............................................................................. 17
3.1 Faktoren für die Bevölkerungsentwicklung in Österreich ....................... 18
3.2 Regionale Bevölkerungsentwicklung ..................................................... 19
3.2.1 Wohnbevölkerung in Weiz und Umlandgemeinden .................... 20
3.2.2 Altersstruktur der Bevölkerung .................................................... 21
3.2.3 Hauhaltsprognosen ..................................................................... 24
3.3 Herausforderungen für die Gemeinden ................................................. 24
4 Wohnen im Alter .......................................................................................... 27
4.1 Wohnbedürfnisse................................................................................... 28
4.2 Wohnsituation ........................................................................................ 29
4.3 Wohnformen im Alter ............................................................................. 31
4.3.1 Wohnen in der eigenen Wohnung – traditionelles Wohnen ........ 31
4.3.2 Betreubares Wohnen/Betreutes Wohnen.................................... 31
4.3.2.1 Betreutes Wohnen am Bauernhof................................. 33
4.3.3 Seniorenresidenzen .................................................................... 33
4.3.4 Seniorenwohnheime ................................................................... 34
4.3.5 Pflegeheime ................................................................................ 34
4.3.6 Gemeinschaftliches Wohnen ...................................................... 35
4.3.7 Wohn-/ Hausgemeinschaften ...................................................... 37
4.3.8 Hospize ....................................................................................... 38
4.4 Weitere Versorgungsstrukturen für ein Wohnen zu Hause .................... 384.4.1 Ambulante Pflege- und Betreuungsdienste ................................. 38
4.4.2 Teilstationäre Strukturen ............................................................. 41
4.4.3 Sonstige Strukturen..................................................................... 42
4.5 Herausforderungen für die Gemeinde ................................................... 44
5 Quartiersentwicklung .................................................................................. 48
5.1 Das Konzept der Quartiersentwicklung ................................................. 49
5.1.1 Grundprinzipien der Quartiersentwicklung .................................. 50
5.1.2 Ziele der Quartiersentwicklung .................................................... 50
5.1.3 Notwendige Akteure .................................................................... 53
5.1.4 Phasen der Quartiersentwicklung und Bausteine ....................... 54
5.2 Eine Erfolgsgeschichte – das „Bielefelder Modell“................................. 56
5.3 Herausforderungen für Gemeinden ....................................................... 58
6 Handlungsfelder und Handlungsempfehlungen ....................................... 59
6.1 Politische Handlungsfelder und Handlungsempfehlungen .................... 61
6.1.1 Integrierte Stadt-, Sozial-, Senioren- und Wohnpolitik ................ 61
6.1.2 Schaffung förderlicher Rahmenbedingungen .............................. 62
6.2 Strategische Handlungsfelder und Handlungsempfehlungen ................ 62
6.2.1 Verbesserung der Informationslage zum Wohnen im Alter ......... 63
6.2.2 Handlungsfeld Verbesserung der Kooperation, der
Zusammenarbeit, der Kommunikation und Stärkung der Eigeninitiative
sowie mögliche Maßnahmen ................................................................. 64
6.3 Inhaltliche Handlungsfelder und Handlungsempfehlungen .................... 66
6.3.1 Entwicklung eines altengerechten Wohnumfeldes und einer
altengerechten Infrastruktur ................................................................... 66
6.3.2 Gestaltung eines altengerechten Wohnangebotes ..................... 68
6.4 Handlungsempfehlungen für die Stadtgemeinde Weiz .......................... 70
7 Ausblick ........................................................................................................ 72
Literaturverzeichnis ........................................................................................... 74
Anhang ................................................................................................................ 82Abbildungsverzeichnis Abbildung 1: Bevölkerungsentwicklung in der Steiermark 2001 - 2050 ................ 20 Abbildung 2: Bevölkerungsentwicklung 2015-2030 .............................................. 21 Abbildung 3: Anteile der breiten Altersgruppen an der gesamten steirischen Bevölkerung in Prozent ........................................................................................ 22 Abbildung 4: Prognostizierte Belastungsquoten für die Steiermark 2009-2050 .... 23 Abbildung 5: Altersverteilung in den Gemeinden.................................................. 23 Abbildung 6: Alleinlebende nach Alter und Geschlecht 2012 ............................... 24 Abbildung 7: Ziele der Quartiersentwicklung ........................................................ 51 Abbildung 8: Hauptakteure der Quartiersentwicklung .......................................... 53 Abbildung 9: Übersicht über Handlungsfelder und Herausforderungen ............... 61
Abkürzungsverzeichnis AAL Ambient Assisted Living BGW Bielefelder Gemeinnützige Wohnungsgesellschaft mbH BMASK Bundesministerium für Arbeit, Soziales und Konsumentenschutz BMFSFJ Bundesministerium für Familien, Senioren, Frauen und Jugend DLG Dienstleistungsgesellschaft etc. et cetera IFAD Institut für angewandte Demografie KDA Kuratorium Deutsche Altenhilfe KFV Kuratorium für Verkehrssicherheit LASTAST Landesstatistik Steiermark ÖGCC Österreichische Gesellschaft für Care- und Casemanagement ÖNORM Österreichische Norm ÖPIA Österreichische Plattform für interdisziplinäre Altersfragen ÖPNV Öffentlicher Personen Nahverkehr SGS Servicestelle für Gesundheit und Soziales SONG Soziales Neu Gestalten StPHG Steiermärkische Pflegeheimgesetz WHO Weltgesundheitsorganisation
1 Einleitung
Wie möchten Sie gerne im Alter wohnen? Haben Sie sich diese Frage im Laufe
Ihres Lebens bereits einmal gestellt oder vielleicht haben Sie schon eine klare
Vorstellung davon? Ich nehme an, dass Sie auch zu der Mehrheit (nämlich 90-
95%) von Menschen gehören, die im Alter gerne zu Hause in ihren eigenen vier
Wänden wohnen bleiben möchten. Sollte es für Sie noch kein Thema gewesen
sein, für Gemeinden ist es auf jeden Fall ein brisantes.
Auf Grund der demografischen Veränderungen in den kommenden Jahren und
Jahrzehnten, in denen mit einer starken Zunahme der älteren und hochbetagten
Menschen zu rechnen ist, werden sich auch die zukünftigen Wohnformen ändern
müssen. Zusätzlich stellt der steigende Betreuungs- und Pflegebedarf sowie der
Rückgang der sozialen und familiären Netzwerke im Zusammenhang mit dem
Wohnen im Alter eine Herausforderung für Gemeinden dar.
Diese Arbeit zeigt die Herausforderungen für Gemeinden auf und erstellt Hand-
lungsempfehlungen, welche grundsätzlich von allen Gemeinden als Grundlage
herangezogen werden können.
In Kapitel eins werden Alter(n) und Altersbilder in ihrer Vielschichtigkeit darge-
stellt. Die Auswirkungen der Altersbilder auf das Individuum und die Gesellschaft
werden aufgezeigt, wobei es nicht um die Vollständigkeit der Definitionen geht,
sondern um die Darstellung der Komplexität. Die daraus resultierenden Heraus-
forderungen für eine Gemeinde werden am Ende des Kapitels aufgezählt.
Demografie und demografischer Wandel dienen als weiterer Erklärungsansatz für
die Notwendigkeit, sich mit dem Thema „Wohnen im Alter“ auseinanderzusetzen.
Die Menschen erreichen ein höheres Lebensalter und daher wird sich der Anteil
der älteren Bevölkerung in der Gesellschaft in Zukunft stark erhöhen.
Kapitel zwei beschäftigt sich mit diesem demografischen Wandel, zeigt die Ein-
flussfaktoren für die Bevölkerungsentwicklung auf, stellt die Altersstruktur in der
Bevölkerung dar und führt die Haushaltsprognosen an. Die für die Gemeinden er-
wachsenden Aufgabenfelder werden im Anschluss dargestellt.
5Kapitel drei zeigt die Wohnbedürfnisse der älteren Menschen, ihre derzeitige
Wohnsituation und mögliche Wohnformen im Alter auf. Jede Wohnform wird in
Relation zur Gemeinde Weiz und der dortigen Situation betrachtet, ob diejenige
Form vorhanden ist oder nicht. Somit erfolgt gleichzeitig eine Darstellung der Ist-
Situation für Wohnen im Alter in Weiz. Da für ein Wohnen zu Hause verschiedene
Versorgungsstrukturen zur Verfügung stehen, wie zum Beispiel Hauskrankenpfle-
ge oder 24-Stundenbetreuung, werden diese hier ebenso erwähnt. Die Herausfor-
derungen für Gemeinden werden in gewohnter Weise am Ende des Kapitels ange-
führt.
Das Konzept der Quartiersentwicklung kann einen wesentlichen Beitrag zum
Thema Wohnen im Alter leisten, weil dadurch die Strukturen der Gemeinde wei-
terentwickelt und bearbeitet werden und diese einen Einfluss auf die Lebensbe-
dingungen der Bürgerinnen und Bürger haben. Daher wird in Kapitel vier dieses
Konzept genauer betrachtet und das „Bielefelder Modell“ als eine Erfolgsgeschich-
te angeführt. Die daraus resultierenden Herausforderungen werden anschließend
aufgezählt.
In Kapitel fünf werden die Herausforderungen den Handlungsfeldern Politik, Stra-
tegie und Inhalt zugeordnet. Die entsprechenden Handlungsempfehlungen für
Gemeinden werden erarbeitet und dargestellt.
Die erarbeiteten und angeführten Maßnahmen haben auch für die Gemeinde Weiz
ihre Gültigkeit. In Kapitel sechs werden daher jene Maßnahmen aufgezählt, die
die Gemeinde Weiz möglichst rasch in Angriff nehmen und sukzessive umsetzen
sollte.
Abschließend erfolgt der Ausblick auf die weiteren notwendigen Schritte, die die
Gemeinde Weiz zukünftig tätigen soll, damit die Weizerinnen und Weizer auch im
Alter so lange wie möglich selbstständig zu Hause wohnen bleiben können und
bei Notwendigkeit eine andere passende Wohnform zur Verfügung steht. Durch
die angeführten Maßnahmen könnte die Gemeinde Weiz ein innovativer Vorreiter
in der Steiermark werden. Ziel dieser Arbeit ist es, eine Grundlage zu schaffen,
6aufgrund derer sich die Gemeinde Weiz diesen Herausforderungen stellt und de-
ren Bearbeitung in Angriff nimmt.
2 Alter(n) und Altersbilder
Wann beginnt das Alter? Wann endet es? Das Ende ist mit dem Tod klar definiert.
Die Frage nach dem Beginn ist wesentlich schwieriger und vor allem im Allgemei-
nen nicht eindeutig zu beantworten. Beginnt es mit dem Ende des Erwerbsalters?
Was trifft auf all jene Menschen zu, die aus gesundheitlichen Gründen bereits
schon in jungen Jahren und weit vor dem Regelpensionsalter keiner Erwerbstätig-
keit mehr nachgehen können? Werden Frauen nach dem Regelpensionsalter (60
Jahre) früher als „alt“ eingestuft im Gegensatz zu Männern (Pensionsalter 65 Jah-
re), obwohl die Lebenserwartung der Frauen höher liegt als die der Männer?
Das folgende Kapitel wird all diese Fragen nicht klären können, aber es soll dazu
dienen, die Begriffe „Alter“, „Altern“ und „Altersbilder“ in ihrer Vielfältigkeit darzu-
stellen. Am Ende des Kapitels werden die für eine Gemeinde erwachsenden Her-
ausforderungen erörtert.
2.1 Die Heterogenität des Alter(n)s
Das Wort „alt“ leitet sich sprachwissenschaftlich aus dem indogermanischen Wort-
stamm „al“ ab. Damit werden Prozesse wie „wachsen“ und „reifen“ bezeichnet.
Wie daraus zu erkennen ist, geht es bei dem Begriff „Altern“ um Wachstum und
Reifung, wobei Vergänglichkeit und die Nähe zum Tod miteingeschlossen werden.
Die Diskussion, die heute zum Thema „Alter und Altern“ geführt wird, nämlich die
einer positiven und/oder negativen Betrachtungsweise, ist keine Erscheinung der
Neuzeit. Platon beispielsweise hat eine positive Sichtweise vertreten („Die Ältes-
ten müssen befehlen, die Jungen müssen gehorchen“), demgegenüber ist Aristo-
teles gestanden, dem eine negative Sichtweise auf das Alter zugeschrieben wird
(„Altern und Fäulnis aber sind dasselbe“) (Kruse & Wahl, 2010, S. 10–11).
Eine einheitliche Definition von Alter zu finden ist sehr schwierig, denn bereits die
Terminisierung für den Beginn des Alters ist kaum möglich.
7Menschen altern sehr unterschiedlich und daher findet man in der Gruppe der äl-
teren Menschen eine breite Streuung verschiedener Lebensweisen und physi-
scher und psychischer Verfasstheit. Menschen können bereits sehr früh in eine
alters- und krankheitsbedingte Betreuungsabhängigkeit kommen, andere wiede-
rum sind auch noch in sehr hohem Alter „fit und rüstig“.
Klassisch wurde das Alter schon seit Hippokrates in auf- und absteigenden Zah-
lenreihen schematisiert (Gabriel, Jäger & Hoff, 2011, S. 14). Heute finden wir
chronologische Einteilungen vor allem in der Demografie zur Darstellung von Be-
völkerungsgruppen und deren Prognose sowie als formale Altersgrenzen. Wesent-
liche formale Altersgrenzen in Österreich sind das 6. Lebensjahr, das den Beginn
der Schulpflicht kennzeichnet, und das 18. Lebensjahr mit dem Erreichen der Voll-
jährigkeit. Für die Lebensphase „Alter“ ist bei Frauen das 60. Lebensjahr und bei
Männern das 65. Lebensjahr relevant. Es stellt das Regelpensionsalter dar, wobei
sich in den nächsten Jahren das der Frauen ebenfalls auf 65 Jahre erhöhen wird.
Diese rechtliche Fixierung rechtfertigt jedoch nicht, die betroffenen Menschen als
„alt“ abzustempeln (Böggemann, 1979, S. 164).
Die Weltgesundheitsorganisation (WHO) hat ebenfalls eine chronologische Eintei-
lung des Alters vorgenommen:
50-59 Jahre: alternder Mensch
60-64 Jahre: älterer Mensch
65-74 Jahre: wesentlicher Einschnitt in die Regressionsphase
75-89 Jahre: alter Mensch
90-99 Jahre: sehr alter Mensch
100-115: Langlebigkeit
Es zeigt sich, dass die Bestimmung des Alters durch die chronologische Einteilung
nicht ausreichend dargestellt wird, da das Alter von biologischen, psychologi-
schen, soziologischen Faktoren und kulturellen Zuschreibungen abhängig ist. Die
Anzeiger, wann jemand alt ist oder als alt eingestuft wird, sind sehr unterschiedlich
(Kolland, 2013, S. 65).
In der Biologie versucht man mit Hilfe bestimmter Marker, wie zum Beispiel Hörfä-
higkeit, Blutdruck und Vitalkapazität, das Alter eines Menschen zu bestimmen.
Das Alter wird demnach von Veränderungen der Organ- und Funktionssysteme
8begleitet (Böggemann, 1979, S. 165). Auf psychologischer Ebene gibt es keine
Marker, da die Einschätzung für das Alter von der Stellung im Lebenslauf abhängt.
Im Bereich der gesellschaftlichen Ebene gibt es einen klar bestimmten Faktor, der
das Ende der Erwerbsfähigkeit darstellt und somit den Beginn des Pensionsalters
kennzeichnet (Kolland, 2013, S. 65). Das „soziale oder soziologische Alter“ wird
somit von den Gesellschaftsstrukturen und der Kultur bestimmt. Es handelt sich
auch um die Rolle des Individuums in der Gesellschaft und statusbezogene Ver-
haltensweisen (Böggemann, 1979, S. 165).
Aber nicht nur innerhalb der Gruppe der alten Menschen gibt es starke Unter-
schiede. Betrachtet man ein und dieselbe Person, können verschiedenartige As-
pekte des Alters gleichzeitig auftreten. Bei den Organen und Nervenzellen lassen
sich schon sehr früh Rückgänge der Leistungsfähigkeit feststellen. Hingegen kann
gesagt werden, dass die Erfahrungen und das Wissen mit dem Alter zunehmen.
Somit bedeutet Alter einerseits Abbau und Abnahme, andererseits eine Zunahme
an Leistungsfähigkeit und Leistungskapazität (Kruse & Wahl, 2010, S. 3–4).
In allen Gesellschaften ist das Alter auch ein zentrales Merkmal für soziale Diffe-
renzierung im Sinne der Intersektionalität und betrifft den sozialer Status, das Ge-
schlecht und die ethnische Gruppenzugehörigkeit. Das heißt, abhängig vom Le-
bensalter wird Menschen der Zugang zu sozialen Rollen in einer Gesellschaft ge-
währt oder nicht (ebenda, S. 8).
Die steigende Lebenserwartung hat zu einer Ausweitung der nachberuflichen Le-
bensphase beigetragen. Sie kann bis zu 50 Jahre und länger dauern, abhängig
vom Beginn des Ruhestandes und dem erreichten Lebensalter. Deshalb erfolgt
eine weitere Aufgliederung der „Altersbevölkerung“. Begriffe wie „junge Alte“, „alte
Alte“ oder „drittes“ und „viertes“ Lebensalter werden dafür verwendet. Das dritte
Lebensalter (60–80 Jahre) schließt die jüngeren Pensionisten ein, die weitgehend
behinderungsfrei leben. Das vierte Lebensalter (ab 80 Jahren) bezieht sich auf die
hochaltrigen Menschen und bezeichnet eine Phase, in der die Wahrscheinlichkeit
einer Pflege- und Betreuungsbedürftigkeit stark ansteigt. Besonders auffallend ist
in dieser Altersgruppe das hohe Risiko an Demenz zu erkranken (Höpflinger & von
Wezemael, 2014, S. 23).
9Im Gegensatz zum Alter ist das Altern ein Prozess, der lebenslang stattfindet. Der
Verlauf der Biografie hat Einfluss auf die Ausgestaltung der späten Lebensphase
(Wahl & Heyl, 2004, S. 16).
Altern ist somit ein sehr komplexer und individueller Prozess, der von verschiede-
nen Faktoren wie Erbanlagen, allgemeinen Lebensbedingungen, persönlichen
Schicksalen und Umweltfaktoren abhängig ist. Auch die kulturelle Konstruktion
von Altersbildern spielt hier eine maßgebliche Rolle.
Ein aus dem Bereich der Biologie stammender Vorschlag einer Definition für das
Altern stammt von Max Bürger (1947): „Altern ist jede gesetzmäßige, irreversible
Veränderung der lebenden Substanz als Funktion der Zeit“ (zit. nach Kruse, 2008,
S. 21).
Aus dem Bereich der Psychologie dient die Definition von Hans Thomae (2002)
als Beispiel, in der die „graduelle Veränderung der thematischen Strukturierung
eines Menschen in das Zentrum gerückt wird“ (zit. nach Kruse, 2008, S. 21).
Wie nun ein Mensch die Anforderungen und Gestaltungsmöglichkeiten in seinem
Leben meistert, ist abhängig von seinem Zeithorizont und seinen im Lebenslauf
stattfindenden Veränderungen (Kruse, 2008, S. 21–22).
Die beim Alternsprozess auftretenden Veränderungen beschränken sich nicht nur
auf Verluste, sie schließen auch potenzielle Gewinne mit ein. Im Bereich der kör-
perlichen Veränderungen treten häufig Verluste auf, im seelisch-geistigen Bereich
kommt es hingegen zu einem Zuwachs an Wissen und Handlungskompetenz
(ebenda, S. 22).
Während Menschen im dritten Lebensalter sehr wohl als Konsumenten und Kon-
sumentinnen wahrgenommen werden, hat die Gesellschaft es aber noch nicht
verstanden, die vorhandenen Ressourcen und die bessere Lebensqualität der äl-
teren Menschen für sich zu nutzen. Backes (1997) beschreibt es als „Alterspara-
dox“, Kade (2009) als „Vergesellschaftungslücke“ (zit. n. Kolland, 2013, S. 64).
Schon an diesen Ausführungen zeigt sich, dass sich das Alter auf Grund der
Komplexität nur schwer einteilen und darstellen lässt. Die hohen individuellen Un-
terschiedlichkeiten und die Heterogenität der alten und älteren Menschen machen
das Alter zu einer Lebensphase, die als ebenso vielfältig erlebt werden kann wie
jede andere Lebensphase, beispielsweise die Jugend. Dies macht eine Beschäfti-
gung mit den Themen „Alter“ und „Altern“ lebendig und interessant.
102.2 Altersbilder
Jeder von uns hat eine bestimmte Vorstellung, ein bestimmtes Bild vom Alter, vom
Altwerden und Altsein. Häufig werden dem Alter Eigenschaften wie körperlicher
Abbau, Vergesslichkeit, Einsamkeit und Verlust zugeschrieben. Auch Attribute wie
Weisheit, Unabhängigkeit, Freizeit und Entspannung werden mit dem Alter in Ver-
bindung gebracht.
Als mögliche Definition des Begriffs „Altersbilder“ können „bildhafte Vorstellungen“
vom Alter als Lebensphase bzw. vom Prozess des Alterns herangezogen werden.
Diese vermitteln Informationen, Meinungen und Vorstellungen über alte Menschen
(Russow, 2012, S. 11). Mit Altersbildern lassen sich auch Lebensqualität und Le-
bensmöglichkeiten älterer Menschen beschreiben, begründen, deuten und recht-
fertigen. Sie stellen Deutungs-, Wert- und Ausdrucksmuster dar, die nicht stabil
sind. Altersbilder unterliegen einem Wandel, sind von Kultur zu Kultur unterschied-
lich und verändern sich mit der Komplexität der alltäglichen Lebensumstände und
-erfahrungen (BMFSFJ, 2010, S. 51).
Man hat demnach nicht nur mit einem Altersbild zu tun, sondern immer mit einer
Vielzahl dieser. Daher erscheint es sinnvoll, zwischen kollektiven und individuellen
Altersbildern zu unterscheiden (Wurm, Berner & Tesch-Römer, 2013, S. 1).
Mit dem kollektiven Deutungsmuster ist jenes Altersbild gemeint, das zu einer be-
stimmten Zeit gesellschaftlich verbreitet und überliefert ist. Individuelle Altersbilder
beziehen sich auf einzelne Vorstellungen, Einstellungen, Ideen, Überzeugungen
oder das Wissen über das Alter, über das Altwerden oder über ältere Menschen
(Backes & Clemens, 2013, S. 60).
Für die Entstehung von individuellen Altersbildern spielt die jeweilige Kultur eine
Rolle, aber auch die persönlichen Erfahrungen haben eine große Bedeutung. Die
individuellen Altersbilder können, wie auch die gesellschaftlichen, sowohl positiv
als auch negativ sein, wobei im kollektiven, gesellschaftlichen Altersbild Negativ-
zuschreibungen dominieren (Wurm et al., 2013, S. 1).
Im Hinblick auf die gesellschaftlichen Altersbilder spricht man auch von Altersste-
reotypen oder von Alternsstereotypen. Sie sind kollektiver Natur und umfassen
konsensuell geteilte Bilder, die sowohl positiv als auch negativ sein können. Be-
reits als Kind verinnerlicht man die gesellschaftlich vorherrschenden Al-
ter(n)sstereotype. Das hat zur Folge, dass die persönliche Sicht auf das Älterwer-
11den mit den gesellschaftlichen Altersstereotypen inhärent verbunden ist. Das
heißt, je älter eine Person ist, desto mehr beruht die persönliche Sicht auf das Äl-
terwerden auf den eigenen Erfahrungen. Das Altersbild der jüngeren Menschen
beruht hingegen vor allem auf gesellschaftliche Alter(n)sstereotypen (Wurm &
Huxhold, 2012, S. 31).
Die Entstehung von Altersbildern hängt auch von den Lebensbedingungen ab.
Nachteilige Lebensbedingungen fördern eher negative Einstellungen zum Alter(n),
privilegierte Bedingungen führen zu einem positiveren Altersbild (Amrhein & Ba-
ckes, 2007, S. 105).
Im sechsten Altenbericht des Bundesministeriums (2010) werden wiederum vier
Erscheinungsformen von Altersbildern unterschieden:
1. „Altersbilder als kollektive Deutungsmuster“ (dabei wird in öffentlichen Dis-
kursen das Alter und die soziale Stellung der älteren Menschen themati-
siert; z.B. der Diskurs über die Potenziale des Alters)
2. „Organisationale und institutionelle Altersbilder“ (dabei werden kulturell
entwickelte, gemeinsame Vorstellungen über angemessene Verhaltenswei-
sen, Aktivitäten und soziale Rollen in einem bestimmten Alter institutionali-
siert und erhalten somit eine konkrete, dauerhafte und handlungswirksame
Form; z.B. gesetzlich festgeschriebene Altersgrenzen)
3. „Altersbilder in der persönlichen Interaktion“
4. „Altersbilder als individuelle Vorstellungen und Überzeugungen“ (damit
sind, wie bereits erwähnt, die individuellen Vorstellungen, Überzeugungen,
Einstellungen und Wissensbestände über das Alter, über ältere Menschen
und über das Altwerden gemeint) (BMFSFJ, 2010, S. 27).
Nicht nur für ältere Menschen sind Altersbilder sehr bedeutsam. Sie haben Ein-
fluss auf die Meinungen und Überzeugungen aller Menschen, wobei dies auf vier-
fache Weise erfolgen kann:
auf den Verlauf und die Gestaltbarkeit von Alternsprozessen
auf die Selbsteinschätzung bezogen auf den eigenen Alternsprozess
auf charakteristische Merkmale älterer Menschen
auf vermeintlich alterstypische Ansprüche, Bedürfnisse und Bedarfe
(Kruse & Berner, 2012, S. 25).
122.3 (Aus-)Wirkungen von Altersbildern
Es erweist sich als notwendig, bei der Frage nach den (Aus-)Wirkungen von Al-
tersbildern zwei Ebenen zu unterscheiden, einerseits die individuelle Ebene und
andererseits die gesellschaftliche Ebene.
Auf der individuellen Ebene können Altersbilder sich direkt oder indirekt auf das
Verhalten sowie Erleben auswirken und auf der gesellschaftlichen Ebene beein-
flussen diese vor allem die gesellschaftliche Stellung älterer Menschen (Backes &
Clemens, 2013, S. 62).
Die Verteilung von positiven oder negativen individuellen Altersbildern in einer Ge-
sellschaft hängt vielfach von sozio-ökonomischen Faktoren wie Bildung, Alter,
Einkommen oder Gesundheitszustand ab. Zum Beispiel haben Personen im mitt-
leren Erwachsenenalter ein deutlich positiveres Altersbild als ältere Menschen.
Andererseits zeigen Personen mit einem niedrigeren Bildungsstatus wesentlich
negativere Altersbilder als Personen mit einem mittleren oder hohen Bildungssta-
tus (Wurm et al., 2013, S. 2).
Negative gesundheitsbezogene Altersbilder haben einen Einfluss auf die Ausge-
staltung von Institutionen im Gesundheitswesen. Eine geringe und ungleiche Ver-
teilung von Einrichtungen der geriatrischen Versorgung zeigt auf, dass einer opti-
malen gesundheitlichen Versorgung von älteren Menschen keine allzu große Be-
deutung beigemessen wird oder die Erfolgsaussichten als gering eingeschätzt
werden. Daher findet man in gesundheitspolitischen Diskussionen immer wieder
die Forderung, dass kostenintensive medizinische Leistungen nur mehr bis zu ei-
nem gewissen Lebensalter erbracht werden sollen (ebenda, S. 3).
Untersuchungen haben gezeigt, dass positive Altersbilder im Gegensatz zu nega-
tiven die Gedächtnisleistung verbessern, man gesünder und aktiver älter wird, es
zu einer rascheren Erholung nach schweren Erkrankungen kommt und man länger
lebt (BMFSFJ, 2010, S. 40).
Bei einem negativen Altersbild ist es des Weiteren problematisch, dass Krank-
heitssymptome und körperliche Einschränkungen auf das Alter zurückgeführt wer-
den. Dies hat zur Folge, dass ältere Menschen mit einem solchen Bild seltener
zum Arzt gehen und ein ungünstigeres Gesundheitsverhalten an den Tag legen.
13Bei einer positiven Sicht auf das Alter zeigt sich hingegen ein günstigeres Ge-
sundheitsverhalten, dass sich durch körperliche Bewegung, Sport und Spazier-
gänge manifestieren kann (ebenda, S. 40).
Die in einer Gesellschaft verbreiteten Altersbilder beeinflussen die Art wie Men-
schen mit auftretenden körperlichen, seelischen und sozialen Veränderungen um-
gehen und inwieweit sie versuchen, diese aktiv zu gestalten. Ebenso haben sie
Einfluss auf die Zielsetzungen von Menschen in unterschiedlichen Lebensaltern
und darauf, wie es um das Bemühen steht, diese auch tatsächlich zu verwirkli-
chen.
Altersbilder, sowohl individuelle als auch kollektive, zeigen Auswirkungen auf das
Selbstbild eines älteren Menschen. In diesem Zusammenhang beeinflusst daher
die Sichtweise auf das Alter(n) die Nutzung von Ressourcen, die individuelle Le-
bensplanung und das Bemühen um eine aktive Gestaltung des eigenen Alterns-
prozesses.
Im Bereich der Erlebens- und Verhaltensspielräume haben Altersbilder besonders
Einfluss auf die Möglichkeiten der sozialen Teilhabe und die Entwicklung von
Stärken (Kruse, 2012, S. 20–21).
Der sechste Altenbericht (2010) der Bundesrepublik Deutschland führt auch den
Einfluss des Verhaltens von Pflegepersonen an, welches zu einem Verlust von
Autonomie und zu einer Zunahme von Hilfsbedürftigkeit führen kann. Der Grund
dafür liegt in einem so genannten „Unselbstständigkeits-Unterstützungs-Muster“,
das heißt, dass Pflegepersonen häufig die Situation erleben, dass ältere Men-
schen Hilfe benötigen. Diese Erfahrung verallgemeinern sie und richten danach
ihre Handlungen aus – sie unterstützen unselbstständige Verhaltensweisen der
älteren Menschen und ignorieren selbstständige Verhaltensweisen (BMFSFJ,
2010, S. 40). Dies führt in weiterer Folge zu einer Zunahme der Hilfsbedürftigkeit
und zu einem Rückzug der älteren Menschen.
Ebenfalls hat man herausgefunden, dass Berufsgruppen, die täglich mit älteren
und alten Menschen zu tun haben, eigentlich jüngere Personen bevorzugen wür-
den, weil die Behandlung älterer Menschen wenig erfolgversprechend erscheint
und als emotional sehr belastend eingeschätzt wird (Amrhein & Backes, 2007, S.
107).
14Vorherrschend negative Altersbilder haben eine diskriminierende und stigmatisie-
rende Wirkung. Diese Diskriminierung von Menschen aufgrund des chronologi-
schen Alters bezeichnet der Gerontologe Robert Butler als „Ageism“ (ebenda, S.
105).
Altersbilder üben auch einen Einfluss auf die Verteilung knapper sozialpolitischer
Ressourcen aus und implizieren spezifische sozialpolitische Maßnahmen. Zum
Beispiel werden finanzielle Ressourcen weg von den klassischen Therapieformen
und hin zu biomedizinischer Grundlagenforschung verschoben, die den Alterungs-
prozess verhindern sollen. Ebenso setzt das Modell des Rückgangs der Morbidität
vermehrt auf präventive Maßnahmen zur Förderung eines gesunden, aktiven Al-
terns als darauf, die vorhandenen Ressourcen in die Behandlung chronischer Er-
krankungen zu investieren (ebenda, S. 106).
2.4 Herausforderungen für die Gemeinde
Eine der größten Herausforderungen, die der demografische Wandel mit sich
bringt, liegt sicherlich in der Heterogenität des Alters und in den daraus resultie-
renden unterschiedlichen Bedürfnissen.
Die oben genannten Ausführungen zeigen klar auf, dass man nicht von „einem“
Alter und auch nicht von einem Altersbild sprechen kann. Planungen, Konzepte
und Entscheidungen in Bezug auf ältere Menschen müssen daher immer multidi-
mensional, multikulturell und multiprofessionell gedacht werden.
Durch die Verlängerung der Lebensphase Alter wird die Definition „einer“ Ziel-
gruppe für Fragen bezüglich des Wohnens wesentlich erschwert. Es wird notwen-
dig sein, die einzelnen Bereiche in Bezug auf das Wohnen sehr differenziert zu
betrachten. In diesem Zusammenhang ist es auch wichtig, sich Gedanken darüber
zu machen, wie das Potenzial der älteren Menschen besser genutzt werden kann
und sie somit einen weiteren gesellschaftlichen Beitrag leisten könnten. Als Bei-
spiel sei an dieser Stelle das Thema „Freiwilligenarbeit“ erwähnt. Diese ehrenamt-
liche Tätigkeit stellt nicht nur einen Nutzen für die Gesellschaft dar, sondern wirkt
sich auch positiv auf das Lebensgefühl des Freiwilligen aus. Es kommt zu einer
Stärkung des Selbstwertgefühls, das Gefühl des Gebrauchtwerdens tut gut, er-
worbenes Wissen wird weitergegeben, soziale Kontakte werden geknüpft und das
Aktivsein trägt zum Wohlbefinden bei.
15In der Gesellschaft ist nach wie vor das negative Altersbild vorherrschend. Es wird
unabdingbar sein, dieses negative Altersbild in ein positives oder zumindest neut-
rales Altersbild zu wandeln. Die Gemeinde kann dies durch eine offene, transpa-
rente und Fähigkeiten und Ressourcen nutzende und fördernde Politik unterstüt-
zen.
Ebenso notwendig ist es, darauf zu achten, dass es zu einer Verringerung alters-
diskriminierender Handlungsweisen kommt. Arbeitsmarktpolitik, Gesundheitswe-
sen, Bildungswesen und Sozialwesen sind hier stark gefordert neue Ideen zu ent-
wickeln – und somit ist auch die Gemeinde gefordert.
Noch nicht erwähnt, aber sehr brisant, ist das erhöhte Risiko mit fortschreitendem
Alter an einer Demenz zu erkranken. Die Häufigkeit von Demenzerkrankungen
beträgt bei 65-jährigen 3%, steigt mit zunehmendem Alter exponentiell an und er-
reicht bei 90-jährigen über 35%. Die Zahl der Erkrankten in Österreich wird auf
etwa 110.000–120.000 geschätzt. Durch die Zunahme der älteren Menschen wird
auch eine Zunahme an Demenzerkrankungen erwartet. Für das Jahr 2030 schätzt
man die Zahl der Demenzerkrankungen in Österreich auf 168.000 (Gatterer, 2005,
S. 11).
In den nächsten Jahre stellen die Demenzerkrankungen eine der größten Heraus-
forderungen für die Gesundheits- und Sozialpolitik dar und daher bedarf diese
Thematik einer gesonderten Betrachtung. Da die Beschäftigung mit Demenzer-
krankungen im Alter sehr umfangreich ist, wird in dieser Arbeit nicht weiter darauf
eingegangen.
Folgende Punkte lassen sich als Herausforderung für die Gemeinde zusammen-
fassen:
Zunahme der Heterogenität im Alter
Verlängerung der Lebensphase Alter
Vorherrschendes negatives, gesellschaftliches Altersbild
Nutzung von Potenzialen und Ressourcen der älteren Menschen
Erhöhung des Risikos einer Demenzerkrankung im zunehmenden Alter
163 Demografischer Wandel
Im Zusammenhang mit dem demografischen Wandel, der im Folgenden mit Zah-
len belegt wird, wird auch von einem „Megatrend“ des 21. Jahrhunderts gespro-
chen, der nahezu alle Lebensbereiche der Gesellschaft erfasst und diese auch in
einem großen Ausmaß verändern wird. Es kann behauptet werden, dass jeder
Mensch davon betroffen sein wird (IFAD 2012, S. 4).
Davon betroffen ist besonders die Infrastruktur im ländlichen und im städtischen
Bereich, wobei auf Grund der Zuwanderung in den Städten die Problematik gerin-
ger ist als im ländlichen Bereich.
Durch die Anhebung des Pensionsalters ist der Arbeitsmarkt gefordert für ältere
Menschen geeignete Arbeitsplätze und Arbeitsbedingungen zu schaffen.
Die Versorgungssysteme müssen an den Bedarf der Bevölkerungsstruktur ange-
passt werden.
Verschiedenste Akteure aus dem Sozial- und Gesundheitsbereich, aus unter-
schiedlichen Politik- und Gesellschaftsfeldern beschäftigen sich mit der Frage, wie
nun diese gesellschaftlichen Veränderungen infolge der sich wandelnden Alters-
struktur gesteuert und gestaltet werden können (Au & Soworka, 2013, S. 3).
Was bedeutet der Begriff „demografischer Wandel“? Siedehoff (2008) hat auf sei-
ner Suche nach einer Definition folgendes festgestellt: „Sucht man nach einer
möglichst präzisen Definition für den fast allgegenwärtigen Begriff ’demographi-
scher Wandel’, stößt man auf ein kleines Problem: Es findet sich keine, zumindest
keine Nominaldefinition“ (zit. nach Rademacher, 2013, S. 27).
Eindeutig sind aber die Bereiche, die der demografische Wandel umfasst:
Quantitative Veränderung der Bevölkerungszahl, wobei es hier zu regiona-
len Unterschieden im Bezug auf Schrumpfung und Wachstum kommt
Veränderungen der Altersstruktur – Zunahme des kollektiven Alterns in der
Bevölkerung
Veränderung der Sozialstruktur
Veränderung der räumlichen Verteilung der Bevölkerung durch Migrations-
bewegungen
Veränderung in der anhaltenden ethnischen-kulturellen Differenz der Be-
völkerung (Schipfer, 2005, S. 13–14).
17Gesamtgesellschaftlich betrachtet ist eine der wichtigsten Veränderungen die Ver-
längerung und Ausdifferenzierung der Lebensphase Alter.
Mit dem demografischen Wandel geht eine nachhaltige Veränderung der Bevölke-
rungsstruktur einher. In fast allen Industriestaaten bedeutet dies, dass einem stei-
genden Anteil an älteren Menschen ein sinkender Anteil an jüngeren Menschen
gegenübersteht (ebenda, 2005, S. 3).
Der verbesserte Gesundheitszustand im Alter lässt eine aktive Teilhabe am sozia-
len Leben zu, das wiederum ist für die weitere Entwicklung unserer Gesellschaft
von großem Nutzen (Krämer, 2008, S. 337).
Auch darf man den sozialen Wandel nicht vergessen, der mit dem demografischen
Wandel einhergeht. Dabei wäre der Ausdruck „sozio-demografischer Wandel“
besser geeignet die komplexen Inhalte des demographischen Wandels abzubilden
(Schnur, 2010, S. 28). In den folgenden Ausführungen wird der demografische
Wandel anhand von Zahlen dargestellt.
3.1 Faktoren für die Bevölkerungsentwicklung in Österreich
Es sind mehrere Faktoren, die für das Altern einer Bevölkerung verantwortlich
sind. Vor allem vier Faktoren spielen für die Bevölkerungsentwicklung in Öster-
reich eine entscheidende Rolle:
1. Die wichtigste Ursache für die Alterung in der Bevölkerung liegt im Rück-
gang der Fertilität. Statistisch gesehen liegt seit mehr als 30 Jahren die
durchschnittliche Kinderzahl pro Frau unter dem „Reproduktionsniveau“,
welches bei zwei Kindern pro Frau liegt. In Österreich liegt der Wert bei 1,4
Kindern pro Frau, wobei eine Veränderung in den nächsten Jahren nicht zu
erwarten ist. Eher ist noch mit einem weiteren Anstieg des durchschnittli-
chen Fertilitätsalters und der Zunahme der kinderlos bleibenden Frauen zu
rechnen.
2. Zurzeit prägt die Baby-Boom-Generation der frühen 1960er-Jahre die An-
zahl der Personen im höheren Erwerbsalter. In Zukunft, ab 2020, wird diese
große Gruppe in Pension gehen und somit den Anteil der Menschen im
Pensionsalter stark erhöhen.
3. Eine weitere, sehr komplexe Rolle spielt die Migration. Es kann gesagt
werden, dass Österreich ein Einwanderungsland ist. Der Wanderungszu-
gewinn (ohne Asylwerberinnen und Asylwerber) liegt bei rund 25.000–
1830.000 Personen pro Jahr, wobei die Altersstruktur der Migrantinnen und
Migranten einen Einfluss auf den Alterungsprozess in Österreich haben
kann. Die Einwohnerzahl wird in den nächsten Jahren in Österreich auf
über neun Millionen Menschen ansteigen.
4. Der Rückgang der Sterblichkeit und die Lebenserwartungsgewinne im Er-
wachsenenalter führen bis zum Jahre 2050 zu einer Lebenserwartung bei
Männern von mehr als 84 Jahren und bei Frauen von 89 Jahren (Kytir,
2009, S. 44–45). Im Vergleich dazu beträgt die Lebenserwartung im Jahr
2014 bei Frauen 83,7 Jahre und bei Männern 78,9 Jahre (Statistik Austria,
2015a, S. 89).
Betrachtet man Europa, kann man eine Zweiteilung in Bezug auf Wachstum und
Schrumpfung feststellen. Weite Teile Europas, vor allem ländliche Regionen, wer-
den sich mit einer Schrumpfung der Bevölkerungszahlen auseinandersetzen müs-
sen. Einige wenige Gebiete können mit einem Wachstum der Bevölkerung rech-
nen. Dies sind vor allem die Regionen um die aufstrebenden Ballungszentren im
urbanen Bereich (IFAD, 2012, S. 6–7).
Im folgenden Kapitel soll ein Überblick über die demografische Situation von Ös-
terreich, der Steiermark und im speziellen der Gemeinde Weiz gegeben werden.
3.2 Regionale Bevölkerungsentwicklung
Die Prognosen für Österreich in Bezug auf die Bevölkerungsentwicklung sind
zweigeteilt. Insgesamt wird in Österreich die Bevölkerung in den nächsten 30 Jah-
ren wachsen, wobei es zu unterschiedlichen regionalen Entwicklungen kommen
wird.
In den Regionen Süd- und Ostösterreichs wird die Zahl der Menschen nur wenig
ansteigen oder rückläufig sein (beispielsweise in Kärnten), der hohe Anteil der äl-
teren Menschen wird noch weiter wachsen.
Eine Sonderstellung nimmt Wien ein. Hier kommt es zu einem Zuwachs der Be-
völkerung und der Anstieg der Zahl der älteren Bevölkerung ist geringer.
In den westösterreichischen Regionen wie Vorarlberg, Tirol und Salzburg wird es
zu einem Bevölkerungszuwachs kommen und der Altenanteil wird unter dem ös-
terreichischen Durchschnitt bleiben (Kytir, 2009, S. 56).
19In der Steiermark wird es ein kontinuierliches Wachstum der Bevölkerung geben,
das Ausmaß des jährlichen Anstiegs nimmt in den nächsten ca. 40 Jahren stark
ab (siehe Abbildung 1). Regionale Unterschiede sind aber merklich erkennbar. Die
Stadt Graz wächst auf Grund deutlicher Zuwanderungsgewinne aus dem In- und
Ausland sowie einer leicht positiven Geburtenbilanz besonders stark. Die Umland-
gemeinden von Graz weisen, hervorgerufen durch Wanderungsgewinne, ebenfalls
ein Bevölkerungswachstum auf. Vor allem in den Regionen der Hochsteiermark,
aber auch im west- und oststeirischen Hügelland dominiert der Bevölkerungsrück-
gang (Landesstatistik Steiermark, 2010, S. 14).
Abbildung 1: Bevölkerungsentwicklung in der Steiermark 2001–2050
Quelle: Landesstatistik Steiermark (LASTAST), 2010, S. 13
3.2.1 Wohnbevölkerung in Weiz und Umlandgemeinden
Mit Stichtag 01.01.2015 hatte Weiz 11.316 Einwohnerinnen und Einwohner, das
entspricht bei einer Größe von 17,5 km² einer Bevölkerungsdichte von 647 Ein-
wohnern je km² (Landesstatistik Steiermark, 2016).
Bereits mit April 2016 beträgt die Einwohnerzahl 11.497. Somit wuchs die Bevöl-
kerung in einem Zeitraum von 16 Monaten um 1,5 % (Stadtgemeinde Weiz, 2016).
Bis zum Jahr 2030 prognostiziert die Landesstatistik Steiermark (2016) einen An-
stieg der Bevölkerung in absoluten Zahlen auf 12.160, das entspricht einem Pro-
zentsatz von 7,6%.
20In den Umlandgemeinden von Weiz ist in Mortansch mit der prozentuell größten
Zunahme zu rechnen, die aus heutiger Sicht bei 3,08% liegen wird. In absoluten
Zahlen heißt das für Mortansch, dass im Jahre 2030 laut Berechnung 2.145 Men-
schen leben werden, um 123 mehr als im Jahr 2015.
In Thannhausen kommt es zu einer Stagnation der Bevölkerungsanzahl und aus
heutiger Sicht hat Naas mit einem leichten Rückgang der Bevölkerung zu rechnen.
Abbildung 2 zeigt die Bevölkerungsentwicklung von heute bis zum Jahr 2030.
Abbildung 2: Bevölkerungsentwicklung 2015-2030
Quelle: Landesstatistik Steiermark, 2016, eigene Darstellung
3.2.2 Altersstruktur der Bevölkerung
Bei den Prognosen für die Altersstruktur kommt es in der Steiermark, wie in allen
anderen Bundesländern auch, zu einem Anstieg des Anteils der über 65-jährigen.
Abbildung 3 zeigt die Entwicklung der Altersstruktur, dargestellt in breiten Alters-
gruppen, bis zum Jahre 2050. Die Darstellung lässt erkennen, dass der Anteil der
über 65-jährigen stark anwächst. Die Prognose von über 30% Anteil an älteren
Menschen in der Steiermark liegt über dem Österreichwert von 28%. Des Weite-
ren sieht man auch, dass der Anteil der Erwachsenen im erwerbsfähigen Alter
stark abnimmt. Bei der Altersgruppe der unter 20-jährigen ist ab dem Jahr 2025
nur mehr mit einer Abnahme von 1% zu rechnen. Im Jahre 2050 soll dieser Anteil
16,8% betragen (LASTAST, 2010, S. 18).
21Abbildung 3: Anteile der breiten Altersgruppen an der gesamten steirischen Bevöl-
kerung in Prozent
Quelle: LASTAST, 2010, S. 18
Diese Veränderungen haben zur Folge, dass es zu einer negativen Entwicklung
der Abhängigkeitsraten beziehungsweise der demografischen Belastungsquoten
kommt. Sie sind eine Möglichkeit, Veränderungen im Altersaufbau der Bevölke-
rung aufzuzeigen. Dabei wird die Zahl der Kinder und Jugendlichen sowie die Zahl
der älteren Menschen (65+) auf die Bevölkerung im Erwerbsalter bezogen.
Im Jahr 2009 fielen 30,3 ältere Menschen auf 100 Erwerbstätige. Diese Zahl stieg
bis zum Jahr 2015 auf 57,7 Personen an. Die Gesamtbelastungsquote steigt im
Zeitraum von 2001 bis 2050 um 25,9 auf 89,9 an (siehe Abbildung 4).
22Abbildung 4: Prognostizierte Belastungsquoten für die Steiermark 2009–2050
Quelle: LASTAT, 2010, S. 21
Im Sinne einer positiven Betrachtung des Alters und der Altersentwicklung erhält
man durch den Tausch von Zähler und Nenner der Belastungsquote die soge-
nannte „potentielle Unterstützungsrate“ (Zahl der Personen im Erwerbsalter auf
die Zahl der älteren Menschen).
Im Jahr 2001 konnte jede Person im Alter von 65 und mehr Jahren mit einer Un-
terstützung von 4,4 Personen im Erwerbsalter rechnen. Dieser Wert wird bis zum
Jahr 2050 auf 2,1 Personen sinken (Kytir, 2013, Folie 33).
Die derzeitige Altersstruktur in Weiz zeigt eine sehr ähnliche Verteilung wie in der
gesamten Steiermark. Der Anteil unter 20 Jahre beträgt 17,48%, der von 20 bis 65
Jahre 61,33% und der über 65 Jahre 21,19% (Landesstatistik Steiermark, 2016).
Abbildung 5 zeigt die Altersverteilung in den Gemeinden Weiz, Mortansch, Naas
und Thannhausen.
Abbildung 5: Altersverteilung in den Gemeinden
Quelle: Landesstatistik Steiermark, 2016, eigene Darstellung
233.2.3 Hauhaltsprognosen
Haushaltsprognosen erweisen sich als wichtig, weil sich damit die Zahl der allein-
lebenden älteren Menschen abschätzen lässt und auch die Zahl jener älteren
Frauen und Männer, die in Institutionen wie Alten- und Pflegeheimen wohnen
werden.
In Österreich beträgt die Zahl der alleinlebenden älteren Menschen (65+ Jahre)
433.000, das entspricht einem Anteil von 31,4%. Weitere 4,2% oder 58.000 ältere
Menschen leben in Institutionen (Kytir, 2009, S. 58–59).
Abbildung 6 zeigt deutlich den Geschlechterunterschied zwischen alleinlebenden
Frauen und Männern, der mit zunehmendem Alter immer deutlicher wird. Das Le-
ben ohne Partner/Angehörige bleibt auch in Zukunft ein „Frauenschicksal“.
Abbildung 6: Alleinlebende nach Alter und Geschlecht 2012
Quelle: Statistik Austria, 2013, S. 21
Die aktuellsten statistischen Zahlen, die für die vorliegende Arbeit von der Stadt-
gemeinde Weiz zur Verfügung gestellt wurden, zeigen folgende Wohnsitzvertei-
lung. 2.018 Personen leben alleine, das entspricht einem Anteil von 36,8%. 3.311
Personen leben in einem Zweipersonenhaushalt, 2.428 Personen in einem 3 Per-
sonenhaushalt (Stadtgemeinde Weiz, 2016). Die übrige Bevölkerung lebt in Mehr-
personenhaushalten.
3.3 Herausforderungen für die Gemeinden
Global gesehen hat der demografische Wandel auf alle Strukturen eines Staates
Einfluss. Aber vor allem die kleineren staatlichen Einheiten werden durch den de-
24mografischen Wandel vor große Herausforderungen gestellt, weil das Leben in all
seinen Ausprägungen und in all seiner Vielfalt hauptsächlich in den Gemeinden
stattfindet. Dadurch werden die Folgen des demografischen Wandels unmittelbar
erlebt (Naegele, 2010, S. 98).
Vor allem die zahlenmäßige Zunahme der Menschen im Bereich der Hochaltrigkeit
sowie die Abnahme der Kinder in Kindergärten und Schulen werden von Bedeu-
tung sein. Die Bereitstellung von Infrastruktur wie Betreuungsangebote und Schu-
len für diese beiden Altersgruppen ist ein primäres Aufgabenfeld von Gemeinden
(Schipfer, 2005, S. 5).
Gemeinden haben die Verantwortung, dass ausreichende Betreuungsangebote für
junge und alte Menschen zur Verfügung stehen. Die Kunst wird darin bestehen,
entsprechend der Zunahme der Hochaltrigkeit ausreichende Pflege- und Betreu-
ungseinrichtungen zur Verfügung zu stellen, aber auch den Ausbau der Pflege zu
Hause zu forcieren, um die finanziellen Belastungen so gering wie möglich zu hal-
ten. Im professionellen Bereich geht es um den Ausbau der mobilen Betreuungs-
und Pflegedienste. Unbedingt erforderlich sind auch Angebote, die die pflegenden
Angehörigen unterstützen und entlasten, da sie bis dato einen Großteil der Be-
treuung und Pflege abdecken.
Für die Finanzierung ihrer Aufgaben haben Gemeinden mehrere Einnahmequel-
len. Eine dieser Finanzquellen sind die Steuereinnahmen, die sich aus den eige-
nen Gemeindeabgaben als auch aus den Ertragsanteilen an den Bundesausga-
ben zusammensetzen. Da aber die demografische Entwicklung einen Rückgang
der erwerbstätigen Bevölkerung erwarten lässt, werden auch die Einnahmen der
Gemeinden rückläufig sein. Gleichzeitig kommt es aber zu einem Anstieg der So-
zialausgaben für die Gemeinden, weil es, wie bereits oben erwähnt, zu einer Zu-
nahme des Betreuungsangebotes für hochbetagte Menschen kommen wird (Bern-
steiner, 2015, S. 133).
Eine Herausforderung, die von vielen Experten immer wieder hervorgehoben wird,
ist die Aufrechterhaltung der sozialen Sicherungssysteme (Braß, 2013, S. 20).
In den nächsten Jahren wird für den Bereich Wohnen, neben der Zunahme der
Anzahl der hochbetagten Menschen, auch die Veränderung der Familienstruktur
eine relevante Rolle spielen. Auf Grund der hohen Scheidungsraten sowie der un-
terschiedlich langen Lebenserwartung von Männern und Frauen ist zu erwarten,
25Sie können auch lesen