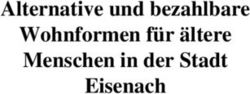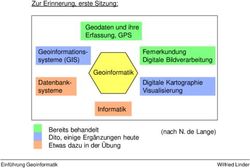Workshop 4: Finanzierungsmodelle Wie E-Mobilität auf die Straße bringen? - Innovationsschauplatz E-Mobilität München, 16.06.2016
←
→
Transkription von Seiteninhalten
Wenn Ihr Browser die Seite nicht korrekt rendert, bitte, lesen Sie den Inhalt der Seite unten
Workshop 4: Finanzierungsmodelle
Wie E-Mobilität auf die Straße bringen?
Innovationsschauplatz E-Mobilität
München, 16.06.2016Lebenszykluskosten und Wirtschaftlichkeit:
Worüber reden wir?
Beispiel für die langfristige Wirtschaftlichkeit von Innovationen und Nachhaltigkeit
über den Lebenszyklus anhand der Beschaffung eines Elektroautos:
Annahmen:
- Nutzungsdauer n = 12 Jahre
- Zinssatz i = 5% auf den Zeitpunkt der Anschaffung
- Zahlungen werden auf einen gemeinsamen Zeitpunkt bezogen, vollkommener Kapitalmarkt
(keine Berücksichtigung von Kapitalbindungskosten)
Fahrzeug: Smart Fortwo Coupé pure Benzin-Fahrzeug Diesel‐Fahrzeug Elektro‐Fahrzeug
Anschaffung: 10.274 12.095 19.000
laufende Kosten gesamt (10.000 km): 15.998 15.261 12.917
- Batterieleasing: 5.334
- KFZ-Steuern: 186 707 157
- Versicherung: 2.785 4.095 2.785
- Energie: * 9.975 7.406 3.420
- Wartung/Instandhaltung: * 3.052 3.052 1.221
Verkauf: 1.114 1.225 334
Summe (10.000 km): 25.158 26.131 31.583
Summe (20.000 km): 39.299 37.814 36.559
*) Verdopplung der Werte bzgl. der laufenden Kosten auf Basis 20.000 km/Jahr
München, 16.06.2016
2
Quelle: Kunath, J. et al (2012), Lebenszykluskosten für Elektrofahrzeuge, in: Industrie Management, 5, 2012, S. 9-14Lebenszykluskosten und Wirtschaftlichkeit:
Worüber reden wir?
Bei der Betrachtung des Begriffs der Lebenszykluskosten kann eine
Herstellerperspektive und eine Nutzerperspektive unterschieden werden.
Herstellerperspektive Nutzerperspektive
„[…]beschreibt der Lebenszyklus „Lebenszykluskosten sind dabei „[..] Lebenszykluskosten
den Zeitraum und die über die gesamte [erfassen] alle durch die
Zustandsänderungen, über den Lebensdauer geschätzten Kaufentscheidung
diese [Anm.: z.B. Produkte oder Gesamtkosten eines determinierten direkten und
Kundenbeziehungen ] geplant, bedeutenden Systems - indirekten Kosten, die über den
entwickelt und erstellt oder Konstruktion, Entwicklung, gesamten Lebenszyklus einer
beschafft, danach genutzt und Produktion, Betrieb, Wartung, Investition auftreten, inklusive
schließlich stillgelegt, veräußert Instandhaltung und Akquisition und Einkauf,
oder entsorgt werden.“ 1 Entsorgung beinhaltend.“ 3 Betrieb und Wartung sowie
Endverwertung.“2
Lebenszyklus Lebenszykluskosten
Verwandte Konzepte: Total Cost of Ownership, Product Lifecycle Management, Investitionsrechnung
München, 16.06.2016
3
Quelle: 1vgl. Seewöster (2006), S.38; 2vgl. Bode (2012), S.10; 3 vgl. Geißdörfer (2009), S.17.Lebenszykluskosten und Wirtschaftlichkeit:
Worüber reden wir?
Die Lebenszykluskosten werden als Kosten einer Einheit über den
gesamten Lebenszyklus verstanden („von der Wiege bis zur Bahre“).
Risikozuschläge,
Margen, Transaktions-
kosten?
Risikozuschläge,
Margen, etc.
München, 16.06.2016
4
Quelle: in enger Anlehnung an VDI Richtlinien 2884: Beschaffung, Betrieb und Instandhaltung von Produktionsmitteln, 2005, S.5Lebenszykluskosten in der VgV
Die Reform des Vergaberechts schafft die rechtlichen Grundlagen für die
Anwendung der Lebenszykluskostenrechnung.
§ 58 VgV - Zuschlag und Zuschlagskriterien
(1) Der Zuschlag wird nach Maßgabe des § 127 GWB auf das wirtschaftlichste Angebot erteilt.
(2) Zur Ermittlung des wirtschaftlichsten Angebots auf der Grundlage des besten Preis-Leistungs-Verhältnisses können
neben Preis oder Kosten auch qualitative, umweltbezogene oder soziale Zuschlagskriterien berücksichtigt werden,
insbesondere:
1. die Qualität, einschließlich technischer Wert, Ästhetik, Zweckmäßigkeit, Zugänglichkeit der Leistung, ihrer
Übereinstimmung mit Anforderungen des Designs für Alle, soziale, umweltbezogene und innovative Eigenschaften sowie
Vertriebs- und Handelsbedingungen,
2. die Organisation, Qualifikation und Erfahrung des mit der Ausführung des Auftrags be-trauten Personals, wenn die
Qualität des eingesetzten Personals erheblichen Einfluss auf das Niveau der Auftragsausführung haben kann, oder
3. die Verfügbarkeit von Kundendienst und technischer Hilfe sowie Lieferbedingungen wie Liefertermin, Lieferverfahren
sowie Liefer- oder Ausführungsfristen.
(3) Der öffentliche Auftraggeber gibt in der Auftragsbekanntmachung oder den Vergabeunterlagen an, wie er die einzelnen
Zuschlagskriterien gewichtet, um das wirtschaftlichste An-gebot zu ermitteln. Diese Gewichtung kann mittels einer Spanne
angegeben werden, deren Bandbreite angemessen sein muss. Ist die Gewichtung aus objektiven Gründen nicht möglich,
so gibt der öffentliche Auftraggeber die Zuschlagskriterien in absteigender Rangfolge an.
München, 16.06.2016
5Lebenszykluskosten in der VgV
Die Reform des Vergaberechts schafft die rechtlichen Grundlagen für die
Anwendung der Lebenszykluskostenrechnung.
§ 59 VgV - Berechnung von Lebenszykluskosten
(1) Der öffentliche Auftraggeber kann vorgeben, dass das Zuschlagskriterium "Kosten" auf der Grundlage der Lebenszykluskosten der
Leistung zu berechnen ist.
(2) Der öffentliche Auftraggeber gibt die Methode zur Berechnung der Lebenszykluskosten und die zur Berechnung vom Unternehmen zu
übermittelnden Daten/Informationen in der Auftragsbekanntmachung oder den Vergabeunterlagen an. Die Berechnungsmethode kann
umfassen
1. die Anschaffungskosten,
2. die Nutzungskosten, insbesondere den Verbrauch von Energie und anderen Ressourcen,
3. die Wartungskosten,
4. Kosten am Ende der Nutzungsdauer, insbesondere die Abholungs-, Entsorgungs- oder Recyclingkosten,
5. Kosten, die durch die externen Effekte der Umweltbelastung entstehen, die mit der Leistung während ihres Lebenszyklus in Verbindung
stehen, sofern ihr Geldwert bestimmt und geprüft werden kann; solche Kosten können Kosten der Emission von Treibhausgasen und
anderen Schadstoffen sowie sonstige Kosten für die Eindämmung des Klimawandels umfassen.
(3) Die Methode zur Berechnung der Kosten, die durch die externen Effekte der Umweltbelastung entstehen, muss folgende Bedingungen
erfüllen:
1. Sie beruht auf objektiv nachprüfbaren und nichtdiskriminierenden Kriterien. Ist die Methode nicht für die wiederholte oder dauerhafte
Anwendung entwickelt worden, darf sie bestimmte Unternehmen weder bevorzugen noch benachteiligen.
2. Sie ist für alle interessierten Parteien zugänglich.
3. Die zur Berechnung erforderlichen Daten lassen sich von Unternehmen, die ihrer Sorgfaltspflicht in normalem Maße nachkommen,
einschließlich Unternehmen aus Drittstaa-en, die dem GPA oder anderen, für die Union bindenden internationalen Übereinkommen
beigetreten sind, mit angemessenem Aufwand bereitstellen.
(4) Sofern eine Methode zur Berechnung der Lebenszykluskosten durch einen Rechtsakt der Europäischen Union verbindlich
vorgeschrieben worden ist, hat der öffentliche Auftraggeber diese Methode vorzugeben.
München, 16.06.2016
ACHTUNG: Für Straßenfahrzeuge ist die Berechnungsmethode der LZK gem. § 68 VgV vorgegeben! 6Definition „Wirtschaftlichkeit“
Vorschlag für ein einheitliches Wirtschaftlichkeitsverständnis.
Anforderungen an die soziale
Leistung
ökologische Nachhaltigkeits-
Ziele
ökonomische Innovations-
Leistung technische Ziele
Wirtschaftlichkeit =
Kosten Anschaffung
= Bestandteile des
Betrieb Lebenszyklus-
kostenansatzes
Entsorgung nach Art. 67 RL
Kostenfaktoren* 2014/24/EU
*beinhaltet Methoden der Kostenprognose wie LCC; betrifft nicht Einzahlungen / Auszahlungen (Kameralistik)
München, 16.06.2016
7Zielvision.
Entwicklung einer praktischen Arbeitshilfe:
universell einsetzbar ↔ Berücksichtigung von Warengruppen-Spezifika.
Test/ Pilotierung in einzelnen
Anforderungen:
HMdF: Integration von
Nachhaltigkeitskriterien in
Vergabestellen
Wirtschaftlichkeit.
KOINNO: Integration von Entwicklung einer „Impulse“ für systematisch-
Innovationskriterien in praktischen Arbeitshilfe einheitliches Vorgehen
Wirtschaftlichkeit.
DB/BW: Berücksichtigung langer
Nutzungsdauern bei Berechnungs- Berechnungs-
Beschaffungsentscheidungen. methode parameter
Zielvision: Arbeitshilfe
Beeinflussung eines
„Tool“ möglichen EU-
Lebenszyklusmodells
Bspw. Excel-basiert mit
„Anleitung /
Entscheidungsbaum /
Querverweisen auf Dokumentation“
existierende warengruppen-
spezifische Tools
München, 16.06.2016
8Lebenszykluskosten und Realität:
Erste empirische Ergebnisse
Knapp 80% der Befragten gehen davon aus, dass Lebenszykluskosten-
berechnungen in Zukunft an Bedeutung zunehmen.
Verteilung der Zustimmungswerte Anzahl der Antworten Mittelwert
a) LZK tragen zur Entscheidungsfindung bei 0% 14% 27% 38% 21% 63 3,65
b) LZK-Berechnung wird regelmäßig durchgeführt 16% 40% 19% 17% 8% 63 2,62
c) Sinn und Zweck der LZK sind klar benannt 23% 27% 18% 24% 8% 62 2,68
d) LZK werden in Zukunft eine bedeutende Rolle spielen 3% 16% 40% 39% 62 4,11
2%
Obwohl mehr als 80% der Befragten davon ausgehen, dass Lebenszykluskosten in Zukunft an Bedeutung
zunehmen werden, fehlt den Befragten oft ein klares Bild zu möglichen Einsatz- und Verwendungszwecken
der Lebenszykluskostenberechnung. Gleichzeitig werden die Lebenszykluskostenberechnungen nur
unregelmäßig durchgeführt. Dadurch ist ein Aufbau von Kompetenzen und Wissen nur zeitverzögert möglich.
1-stimme gar nicht zu 2-stimme eher nicht zu 3-indifferent 4-stimme eher zu 5-stimme voll und ganz zu München, 16.06.2016
9
Quelle: Umfrage der UniBwM gemeinsam mit dem Kompetenznetzwerk KoInno und dem Bundeswirtschaftsministerium. Stand: 18.08.2015Lebenszykluskosten und Realität:
Erste empirische Ergebnisse
Drei Kernziele werden verfolgt: 1) frühzeitige Einschätzung Finanzierung &
Machbarkeit, 2) Lieferantenauswahl und 3) Nutzungsende/ Verlängerung
1 Verteilung der Zustimmungswerte Anzahl der Antworten Mittelwert
a) Frühzeitige Bestimmung des Kostenrahmen / Machbarkeit 7% 15% 58% 15% 59 3,71
b) Frühzeitige Bestimmung des Finanzbedarfs 7% 20% 53% 15% 59 3,66
c) Frühzeitige Bestimmung der Produkt- und Tech.-auswahl 5% 30% 53% 12% 59 3,71
d) Frühzeitige Bestimmung von Kostentreibern und Wirkung 5% 25% 49% 19% 59 3,78
e) Bestimmung Vergleichsbasis zur Projektkostenkontrolle 16% 34% 38% 12% 58 3,47
f) Bestimmung von Leistungsanreizen für potentielle AN 23% 40% 32% 5% 57 3,19
2
g) Lieferantenauswahlentscheidung 4% 11% 20% 51% 14% 57 3,61
h) Steuerung des Produktänderungsmanagements 28% 40% 26% 6% 53 3,09
i) Überwachung von Garantien und Leistungsanreizen für AN 26% 46% 26% 57 2,96
j) Überwachung von Wartungs-, Reparatur- und Instandh. 16% 26% 44% 14% 57 3,56
k) Abschätzung von Produktverbesserung bzw. -änderungen 30% 37% 25% 4% 56 2,95
3
l) Evaluierung von Maßnahmen zur Verlängerung des Nutzung 11% 30% 46% 11% 56 3,54
m) Überprüfung der Kosten für Außerdienststellung 7% 26% 37% 19% 11% 57 3,00
n) Überprüfung zu erzielender Werte bei Verwertung 5% 23% 38% 32% 2% 56 3,02
3
o) Überprüfung des Ersatzzeitpunkts 16% 31% 37% 16% 57 3,53
p) Leistungsmessung des operativen Einkaufs 20% 29% 30% 20% 2% 57 2,55
München, 16.06.2016
1-stimme gar nicht zu 2-stimme eher nicht zu 3-indifferent 4-stimme eher zu 5-stimme voll und ganz zu
10
Quelle: Umfrage der UniBwM gemeinsam mit dem Kompetenznetzwerk KoInno und dem Bundeswirtschaftsministerium. Stand: 18.08.2015Lebenszykluskosten und Realität:
Erste empirische Ergebnisse
Drei Kernziele werden verfolgt: 1) frühzeitige Einschätzung Finanzierung &
Machbarkeit, 2) Lieferantenauswahl und 3) Nutzungsende/ Verlängerung
Verteilung der Zustimmungswerte Anzahl der Antworten Mittelwert
1 a) LZK-Berechnung vor der Vergabe 15% 18% 27% 28% 12% 60 3,03
b) LZK-Berechnung vor/während der Vergabe (durch AN) 31% 24% 21% 22% 2% 59 2,41
2
c) LZK-Berechnung nach Vergabe regelmäßig überprüft 30% 39% 20% 8% 3% 61 2,16
d) LZK werden nachträglich angewendet 33% 36% 24% 7% 61 2,05
1 3 e) LZK bedeutend für Mittelzuwendung 20% 30% 20% 23% 7% 60 2,67
Entlang des Beschaffungsprozesses werden die Lebenszykluskosten eher vor/während der Vergabe durch die
Auftraggeber ermittelt, die errechneten Kosten werden nur selten zur Kostenkontrolle nach erfolgter Vergabe
eingesetzt.
1-stimme gar nicht zu 2-stimme eher nicht zu 3-indifferent 4-stimme eher zu 5-stimme voll und ganz zu München, 16.06.2016
11
Quelle: Umfrage der UniBwM gemeinsam mit dem Kompetenznetzwerk KoInno und dem Bundeswirtschaftsministerium. Stand: 18.08.2015Lebenszykluskosten und Realität:
Erste empirische Ergebnisse
Für die Berechnung von Lebenszykluskosten wird im Kern MS Excel
eingesetzt.
Verteilung der Zustimmungswerte Anzahl der Antworten Mittelwert
a) Daten für LZK sind leicht zugänglich und verfügbar 27% 44% 22% 5% 59 2,10
2%
b) Finanzparameter und Normkostensätze liegen vor 34% 34% 16% 16% 58 2,12
c) LZK-Kostenstruktur zur Durchführung ist vorhanden 40% 24% 24% 9% 3% 58 2,12
d) Für LZK-Berechnung einfache Excel-Tools 16% 16% 8% 39% 21% 56 3,34
e) Für die LZK-Berechnung MS Access-Lösungen 77% 16% 5% 57 1,33
2%
f) Für die LZK-Berechnung Lizenzsoftwarelösungen 74% 12% 8% 3% 58 1,50
3%
Mehr als 60% der Befragten greifen für die Berechnung der Lebenszykluskosten auf MS Excel-Lösungen
zurück. Lizenzsoftwarelösungen werden nur selten genutzt.
1-stimme gar nicht zu 2-stimme eher nicht zu 3-indifferent 4-stimme eher zu 5-stimme voll und ganz zu München, 16.06.2016
12
Quelle: Umfrage der UniBwM gemeinsam mit dem Kompetenznetzwerk KoInno und dem Bundeswirtschaftsministerium. Stand: 18.08.2015Sie können auch lesen