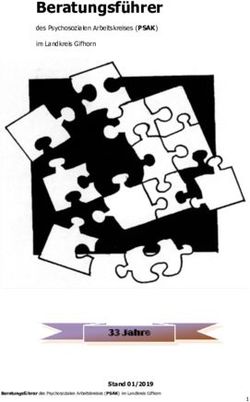"30 Jahre Wiedervereinigung. Und jetzt?" - Magdeburger Rede von Eva von Angern
←
→
Transkription von Seiteninhalten
Wenn Ihr Browser die Seite nicht korrekt rendert, bitte, lesen Sie den Inhalt der Seite unten
Magdeburger Rede von Eva von Angern
»30 Jahre Wiedervereinigung. Und jetzt?«
Ich freue mich sehr, dass Sie und ihr erschienen seid und grüße ebenso herzlich alle an ihren Com-
putern, Laptops oder Handys. Die sachsen-anhaltische Politik befindet sich kurz vor dem Ende der 7.
Wahlperiode des Landtages von Sachsen-Anhalt. Das ich heute hier stehe – als Fraktionsvorsitzende
und Spitzenkandidatin – ist keine Selbstverständlichkeit. Mir ist bewusst, dass ich das manch´ glück-
lichem Umstand und der Unterstützung von Menschen zu verdanken habe, die zum Teil heute hier sind.
Ich habe mich durchgekämpft. Es ist kein Selbstläufer. Es ist nicht so, dass einer Frau, Mutter von drei
Kindern, einer LINKEN, der rote Teppich ausgerollt wird. Ich habe viel meinem überparteilichem Frau-
ennetzwerk zu verdanken, dessen Vertrauen und Verlässlichkeit ich sehr zu schätzen weiß. Ich wurde
im Jahre 1976 in Magdeburg in einer fest im politischen System der DDR verankerte Familie geboren.
Fest verankert will heißen, dass meine Eltern den Sozialismus nicht grundsätzlich in Frage stellten. Sie
hatten kritische Fragen, aber ich kann mich gut daran erinnern, dass in meinem Beisein kein Westfern-
sehen geschaut wurde. Selbstverständlich tat ich es dann doch im Beisein meines älteren Bruders. Aber
eben heimlich. Klar ist aber: ich hatte eine glückliche Kindheit. Ohne Wenn und Aber. Als die Wende
kam, vollendete ich gerade mein dreizehntes Lebensjahr. Ich ging zur Schule, genoss meine Jugend und
rückblickend auch die Veränderungen, die ich als solche vielleicht auch aufgrund meines Alters bei
weitem nicht so negativ empfand. Ich kann mich gut daran erinnern, dass ich meinen Eltern heftige
Vorwürfe gemacht habe, weil sie das mit dem Sozialismus so richtig vergeigt haben und damit irgend-
wie auch meine persönlichen Planungen beeinflusst haben. Ich wollte Lehrerin werden und irgendwann
die Schweiz besuchen. Meine Mutter meinte, dass mir das im Gegensatz zu ihnen möglich sein wird. Als
Teenager hat man eben doch eher einen Tunnelblick. Dabei hatten meine Eltern 1989/ 1990 ganz andere
Probleme. Natürlich spürte ich in Familie und Freundeskreis die Ambivalenz der Monate zwischen Okto-
ber 1989 und Frühjahr 1990: Einerseits die Sorge, ja Angst meiner Eltern, wie grundstürzend die gesell-
schaftlichen Veränderungen sein würden, die sich abzeichneten und in rasantem Tempo vollzogen. Wie
in den meisten Familien der DDR arbeiteten auch meine Eltern in Vollzeit. Es ist mir erst Jahre später
bewusst geworden, was für sie dieser Umbruch tatsächlich bedeutet haben muss. Sie verloren den Boden
unter ihren Füßen und das in einem Alter, in dem man meint, angekommen zu sein. Wie viele meiner
Freundinnen erlebte auch ich die Ohnmacht, die Angst meiner Eltern in einer Zeit, in der man sie eigent-
lich als Fels in der Brandung sehen möchte. Sie mussten sich von ihrem selbstbestimmten Leben trennen
und wurden zu Bittstellern. Trotzdem taten sie alles dafür, dass ich eine glückliche Kindheit haben konn-
te. Es war eben nicht mehr der Urlaub im Thüringer Wald, sondern die Werbebusfahrt nach Österreich.
Für mich war es Abenteuer. Für sie ein harter Prozess – verbunden mit vielen Erniedrigungen. Damals
hatte ich kaum einen Blick dafür. Heute sehe ich es mit ganz anderen Augen.
Andererseits erinnere ich mich natürlich auch an die Fernsehbilder: die Euphorie, das Aufstehen der
Menschen, ihr Konstituieren zum souveränen Volk. Wolfgang Engler ist zuzustimmen, wenn er sagt, das
sprachliche Bild vom „Zusammenbruch der DDR“ sei eine Neidformel, von Leuten lanciert, die gern dabei
gewesen wären. Natürlich sprechen viele Politiker und auch andere Menschen – nicht nur in Sonntags-
reden – voller Stolz von der friedlichen Revolution der Ostdeutschen. Engler nennt sie unter Bezugnah-
me auf Hannah Arendt „Stunde öffentlichen Glücks“. Ich erinnere mich an Schilderungen eines früheren
Kollegen in der Landtagsfraktion, Frank Thiel, der auf der anderen Seite stand und eben glücklich da-
rüber war, dass alles überwiegend friedlich blieb. Er wollte nicht auf die eigenen Leute schießen müs-
sen. Selbstverständlich nicht. Er sprach von den neuen Ideen, den neuen Freiheiten, die viele erhofften
und ersehnten. Wir wissen jetzt, dass die Chancen nicht gleichmäßig verteilt waren und sind. Gewiss:Die Macht von SED und Staatsicherheit wurden weitgehend ohne Blutvergießen beendet, aber war die politische Wende deshalb auch friedlich? Erinnern Sie sich an den Satz von Bärbel Bohley: „Wir wollten Gerechtigkeit und bekamen den Rechtsstaat.“ Wir haben viel darüber zuhause diskutiert. Teilweise in heftiger Erregung. Erst Jahre später, anlässlich eines Festaktes zu „20 Jahren Justiz in Sachsen-Anhalt“ habe ich durch die von Prof. Jutta Limbach gehaltene Festrede den wirklichen Gehalt dieses Satzes ver- standen. Die erste Präsidentin des Bundesverfassungsgerichtes, die über Parteigrenzen hinweg strahlte und meine Berufswahl einmal mehr bestätigte. Ich wollte und ich will noch immer die Welt verändern. Hin zu einer gerechten Welt. Und ich bin stolz darauf, einen Teil meiner Referendar-Ausbildung bei ihrer Tochter absolviert zu haben. Ja, die Menschen wollten Gerechtigkeit, sie wollten in der großen Mehrzahl die Wiedervereinigung. Doch zur Wahrheit gehört eben auch, dass manche Träume nie realistisch waren und der Einigungsvertrag mit erheblichen Mängeln zu Lasten ostdeutscher Interessen belastet war, die noch bis heute spürbar sind. Eine Blaupause gab es für keine der beiden Seiten. Ich erinnere mich an ein Fernsehinterview mit einem jungen Wissenschaftler vor dem Hintergrund unzähliger glücklicher, vom zumeist ersten Besuch im Westen zurückkehrender Menschen, der den klaren Satz aussprach: „Das ist das Ende der DDR, weil die DDR seit heute am Weltmarkt agiert.“ Der Gehalt wurde in wenigen Monaten den Menschen mit voller Wucht deutlich. Binnen kurzer Zeit wurden mehr als eine Millionen Menschen in Ostdeutschland arbeitslos. Die Menschen in der DDR und die Ostdeutschen haben von da an radikalste Veränderungen durchstehen müssen. Es war ein wirtschaftlicher Zusammenbruch, ein demografisches Beben durch Abwanderung, 1,4 Millionen Menschen verlassen Ostdeutschland bis 1993. Es fand ein rigoroser Elitenaustausch statt und schließlich der umfassende politische wie kulturelle Systemwechsel, der keine ostdeutsche Biografie und nahezu keine ostdeutsche Familie unberührt ließ. Millionenfach umgepflügte Lebensläufe ließen kaum einen Stein auf dem anderen bleiben. Wenn in Ostdeutschland vom Strukturwandel die Rede ist, der ohne Frage dringend erforderlich ist, muss allen politischen Akteur*innen bewusst sein, dass es hierzu bereits Erfahrungen gibt: Millionenfachen Ab- sturz- und Verlusterfahrungen, die in der DDR keinerlei Erfahrungshorizont hatten und die Menschen brachial auch in ihrem Gleichheitsdrang traf, schufen ein Zusammengehörigkeitsgefühl, konstituierten den und die Ostdeutschen. Die Außenwahrnehmung der Ostdeutschen als „Jammerossis“ und die vielen anderen, nicht schmeichel- haften Zuschreibungen trugen dazu bei. Betrachtet man die Nach-Wende-Karrieren der wenigen Ostdeut- schen, die in Spitzenämter gelangt sind, fällt ins Auge, wie sehr sie dies unter Leugnung ihrer ostdeut- schen Prägungen erreicht haben. Angela Merkel, die ich ob ihrer Leistung als Mensch sehr respektiere, steht dafür exemplarisch. Sie begegnet uns gerade nicht, in keinem öffentlichen Moment als Ostdeutsche, während uns Politiker wie Markus Söder mit großer Selbstverständlichkeit als bayerischer Franke oder fränkischer Bayer gegenübertreten. Gerade nicht öffentlich ostdeutsch zu sein, ostdeutsche Lebenserfah- rungen eher zu beschweigen oder gar zu verleugnen, war und ist noch immer erfolgversprechender für die Karriere. Ich meine, dies ist nicht zuvörderst dem Mangel an Charakter, Mut oder Selbstbewusstsein der Ostdeutschen zuzuschreiben. Es ist eher Resultat der Assimilationserwartung an die Ostdeutschen und der Assimilationsleistung der Ostdeutschen. Es geht um das gesellschaftliche Klima gerade in den 1990er und in den Nullerjahren oder als Juristin gesprochen: Es geht um das Recht, öffentlich nicht nur Deutscher oder Europäer, sondern auch ostdeutsch sein zu dürfen. Es ist nicht mein, aber das Erleben vieler älterer Ostdeutscher, fremd im eigenen Land geworden zu sein. Jana Hensel hat das einmal als quasi-immigrantische Erfahrung der Ostdeutschen bezeichnet: fremd im eigenen Land geworden zu sein, ohne das eigene Land verlassen zu haben. Eine gewaltige Marginalisie- rungserfahrung, die nach und nach dadurch überlagert werden konnte, die verblassen konnte, indem sich viele Ostdeutsche durch harte Anpassungs- und Arbeitsleistung ihren Platz im Neuen sichern konn- ten. Doch diese Chance hatten nicht alle Menschen in Ostdeutschland.
Ich bin am 1. April 1996 Mitglied der PDS geworden (kein Aprilscherz, aber ich fand das damals total amüsant) und an meinem 25. Geburtstag nominierte mich meine Partei auf Platz 13 der Landesliste und ich bin tatsächlich Mitglied des Landtages von Sachsen-Anhalt geworden. Rückblickend: eine Wahn- sinnschance für mich. Ich hatte zu diesem Zeitpunkt einen zweijährigen Sohn, lediglich das erste Staats- examen in der Tasche, aber dank der Unterstützung von Kolleginnen den klaren Auftrag, das zweite Staatsexamen so schnell wie möglich neben dem Mandat zu realisieren. Gerade mal drei Tage nach dem ersten und bisher einzigen Volksentscheid in der Geschichte Sachsen-Anhalts, der im Übrigen maßgeb- lich durch Gewerkschaften und uns als Partei im Land getragen wurde, legte ich mein zweite Staatsex- amen erfolgreich ab. Nun war ich fast angekommen. Im Establishment. Schließlich durfte ich mich jetzt „Volljuristin“ nennen. In einer vor allem durch westdeutsche Sozialisation geprägte Justiz wie in Sachsen- Anhalt, in der man auf „Diplomjuristen“ der DDR nur zu gerne herabschaute, war ich akzeptiert. Natür- lich freute ich mich darüber, bis ich begriff, dass dieser Art des Umgangs ausgrenzt, ausgrenzen soll und nichts mit meinem Grundverständnis des menschlichen Miteinanders zu tun hat. Das ist es auch, was in den Debatten rund um unseren Slogan „Nehmt den Wessis das Kommando!“ mitschwingt. Wir leben derzeit in besonderen politischen, herausfordernden Zeiten und unter sehr besonderen Bedin- gungen – unter Coronabedingungen. Vieles geschieht digital. Ich habe unzählige Videokonferenzen, digi- tale Sprechstunden, Videoclips, Telefoninterviews hinter und teilweise noch vor mir. Wichtigstes Ziel: ich möchte als Abgeordnete im Landtag für die Menschen in unserem Land ansprechbar sein. Das ist wich- tig. Gerade jetzt. Gerade in einer Zeit der Isolation von Menschen, um ihr Leben und ihre Gesundheit zu schätzen. Es ist aber auch so wichtig, weil so vieles für viele Menschen so schwer zu verstehen ist, auch wir nicht alle Antworten auf die Fragen der Zeit haben und vor allem nicht alle Probleme der Menschen kennen. Probleme zu kennen, Ideen zu entwickeln – nicht über die Köpfe der Menschen hinweg, sondern mit ihnen. Kurzum: die Kümmerer-Partei. Das war und ist unsere Stärke. ¬¬Das war und ist unser Nut- zen für die Menschen in unserem Land. Darauf bin ich stolz! Das ist genau der Grund, warum ich politisch aktiv bin. Darin finde ich mich wieder und schlussendlich war das auch der Grund, warum ich „JA“ zur Spitzen- kandidatur gesagt habe. Ich wusste, dass ich dann genau dies ausstrahlen und sein möchte. Mein Her- zensthema, die Bekämpfung der Kinderarmut, kann ich in all meinen Reden, Interviews, Gesprächen thematisieren. Ich kann auf diese Weise Zustimmung über Parteigrenzen hinweg für so ein wichtiges Thema der Gegenwart und unserer Zukunft gewinnen. Ich bin so stolz darauf, dass es mir, uns gelungen ist, ein überparteiliches Netzwerk gegen Kinderarmut auch in Sachsen-Anhalt zu gründen und erfolg- reich zu arbeiten. Die Tatsache, dass es mir gelungen ist, die jetzige Kanzlerkandidatin der Grünen, Marcus Weinberg (CDU), Katja Suding (FDP), Dietmar Bartsch und wenn sie nicht drei Wochen zuvor zurück getreten wäre auch Andrea Nahles nach Magdeburg zu diesem Thema zu holen, ist ein enormer Erfolg für die Anerkennung dieses Problems in unserer Gesellschaft gewesen. Kurze Zeit späte wurde auf dieser Basis ein einstimmiger Beschluss im Landtag auf unsere Initiative hin gefasst und leider ist das Thema auch ganz eng mit Ostdeutschland, mit Sachsen-Anhalt verbunden. In Sachsen-Anhalt gibt es Stadtteile, in denen jedes zweite Kind in Armut lebt. Ich möchte kein Kind zurücklassen. Jedes Kind hat ein Recht auf eine sorgenfreie Kindheit und Zukunftschancen. Es ist kein Selbstläufer, dass ein Thema so präsent im politischen Raum ist und ich verspreche Ihnen, wenn ich mich erstmal an einem Thema festgebissen habe, dann bleibe ich dran. Das können alle im Raum bestätigen, die schon mal mit mir zu- sammengearbeitet haben. Ich bin seit einigen Monaten auf meiner „Landtour“ in Sachsen-Anhalt unterwegs. Von der Altmark bis nach Zeitz. Ich treffe Landräte, Ortsbürgermeister, Menschen, die sich für den Erhalt eines Schwimmba-
des engagieren, für Nachbarschaftstreffs, um Menschen verschiedener Herkunft zusammen zu bringen. Menschen, die vor dem Verfall stehende denkmalgeschützte Häuser retten, Kulturangebote für junge Menschen trotz Corona aufrechterhalten. Kitaerzieher*innen, die alles dafür tun, dass kein Kind zurück- bleibt. Altenpfleger*innen, die sich leidenschaftlich engagieren, um Senior*innen nicht allein zu lassen. Hochschulabsolvent*innen, die in Zusammenarbeit mit heimischen Unternehmen Ideen entwickeln, um den Klimawandel zu stoppen. Landwirte, Schäfer, Winzer, die trotz bürokratischer Hürden ihren Traum einer modernen Landwirtschaft leben. Es waren und sind noch viel mehr Menschen, die ich treffen durf- te und treffe, die mir ihre Zeit schenken, die mir zeigen, wie sie unser Land zu einem gerechten Land gestalten wollen. Sie, die Menschen, sind es: unser wahrer Sachsen-Anhaltischer Bodenschatz. Unser wahrer Schatz. Genau darum geht es mir als Fraktionsvorsitzende der LINKEN im Landtag von Sachsen- Anhalt und Spitzenkandidatin zur Landtagswahl heute: Ich möchte mit Ihnen und euch über aktuel- le und zukünftige Herausforderungen im Interesse der Menschen von Sachsen-Anhalt reden. Mir ist dabei wichtig, mit unseren politischen Schwerpunktsetzungen über die Grenzen unserer Partei hinaus interessant und auch anschlussfähig sind. Es befinden sich unter Ihnen bzw. Euch auch Men- schen, die mir immer wieder ganz persönlich Mut zusprechen und mich dadurch ermuntern, weiterzu- machen. Ich nenne stellvertretend Giselher Quast – von 1976 bis 2016 Domprediger in Magdeburg –, den ich die Ehre habe, meinen Freund nennen zu dürfen und er darf mich freundlich lächelnd Pastorentoch- ter nennen. Schön, dass ihr, du und deine Frau, da seid und ich freue mich schon jetzt auf unsere folgen- den Gespräche! Giselher Quast spielte in der Zeit der Friedlichen Revolution und auch in den Jahren da- vor eine wichtige Rolle. Er gab Halt, Raum für Kritik und hat bis heute ein offenes Ohr für beide Seiten. Ohne zu werten, ohne vorzuverurteilen zuzuhören und dennoch eine klare Haltung zu haben: Das sind seine Stärken und nicht nur deshalb schätze ich ihn sehr. Und wir haben schon einige Male über unsere Erfahrungen aus den Jahren 1989 und 1990 gesprochen. Nehmt den Wessis das Kommando! Ich halte kurz inne, lasse die Losung verhallen, beobachte Ihre und Eure Reaktionen und stelle fest: Auch heute setzt unser Slogan hier Emotionen frei und bewegt – sogar im Wortsinn! Damit sind wir auch schon mittendrin im Thema meiner Magdeburger Rede: „30 Jahre Wiedervereinigung – und was jetzt?“ Die Frage oder die Antwort, wo wir im Prozess der Deutschen Einheit tatsächlich stehen, präsentieren dieses Plakat, das eigentlich keines ist, und vor allem die darüber geführte öffentliche Debatte, die es ausgelöst hat. Ich will es offen sagen: Wir haben uns Aufmerksamkeit und Debatte erhofft, aber mich hat die Resonanz in ihrem Ausmaß sehr überrascht! Inzwischen bekomme ich Anfragen aus MV bis Sach- sen, aber auch von Menschen aus Sachsen-Anhalt, auch Medienvertreter*innen, die sich dieses Plakat geschenkt zum Aufhängen im Büro wünschen. Ich kann Ihnen hier sagen: es gibt tatsächlich nur ein einziges Plakat zum Hängen und das steht in meinem Büro. Ganz nebenbei haben wir mit dieser Debatte reichlich Schwung in den Wahlkampf gebracht. Wurde ich vor einiger Monaten noch schräg angeschaut, als ich auf den Termin der Landtagswahl hinwies, so spüre ich jetzt vielfach einen Wandel. Allein die vielen hängenden Plakate würden dies – wie wir wissen – nicht erreichen. Ich habe vor einigen Wochen – lange vor Veröffentlichung des besagten Plakates ein gemeinsames Papier u. a. mit Bodo Ramelow, dem Ministerpräsidenten von Thüringen, Dr. Dietmar Bartsch, dem Vorsitzenden unserer Bundestags- fraktion, Simone Oldenburg, der Fraktionsvorsitzenden der LINKEN in MV und Klaus Lederer, Senator für Kultur und Europa in Berlin in der Bundespressekonferenz vorgestellt. Unter dem Titel „Föderale Fairness für gleichwertige Lebensverhältnisse bis 2025“ begann ich mein Statement mit dem Satz: ich hätte nie gedacht, dass ich im Jahr 2021 als Spitzenkandidatin noch das Thema Osten in den Mittelpunkt meines politischen Handelns und einer politischen Kontroverse stellen muss. Es ist erforderlich. Drin-
gend. Diese Pressekonferenz hat in Sachsen-Anhalt wenig Resonanz erhalten. Das war bedauerlich, denn das Papier ist eine solide Auseinandersetzung mit der Ost-West-Beziehung, den Ost-West-Ungerechtigkei- ten. Es macht konkrete Voraschläge, wie das Ziel der gleichwertigen Lebensverhältnisse erreicht werden kann. Manchmal reicht eine solche Solidität, ein formal ruhiges Herangehen nicht aus, um Menschen zu bewegen, um Menschen zu erreichen. Manchmal bedarf es eben der Zuspitzung und der Provokation und wann, wenn nicht gerade in einem Wahlkampf ist das sogar das sinnvollste Stilmittel? Das Plakat hat das erreicht. Allerdings: bei aller Provokation und Zuspitzung kann kein Plakat dieser Welt ein Thema setzen, wenn es gänzlich einer Grundlage entbehrt. Deshalb lassen Sie uns bitte genau hinschauen, was die Grundlage ist! Das Grundgesetz höchstselbst spricht von „gleichwertigen Lebensverhältnissen“ und das meint nicht mehr und nicht weniger als das Ziel der „ausgeglichenen sozialen, infrastrukturellen, wirtschaftlichen, ökologischen und kulturellen Verhältnisse“. Ergo: Wer ein tatsächliches Interesse an der Vollendung der Deutschen Einheit hat, darf dieses Ziel – das Ziel der gleichwertigen Lebensverhältnisse - nicht aus dem Auge verlieren. Natürlich kenne ich wie alle hier im Raum die Erhebungen, die – wie z. B. der Sachsen-Anhalt-Monitor von 2020 – verdeutlichen, wie gespalten unser Land in tatsächlicher und emotionaler Hinsicht mehr als 30 Jahre nach der Wiedervereinigung noch ist. Uns haben auf den unterschiedlichen Kommunikations- wegen ungezählte Reaktionen erreicht. Die übergroße Mehrheit der Zusendungen ist zustimmend. Viele Meinungsäußerungen sind ablehnend, manche wütend ob unserer Undankbarkeit, andere unsäglich wegen der Bezugnahme auf verdienstvolles Wirken im Osten oder des Vorhalts eines Inländerrassismus, wieder andere mit dem Vorrechnen des gezahlten Solis. Manche sind auch hasserfüllt. Wieder andere sind getränkt von machtvollem Selbstbewusstsein wie die des Magdeburger Unternehmers Klemens Gut- mann, der uns mit dieser Veranstaltung kurzerhand in bester „Cancel-Culture-Manier“ aus seiner Firma immerhin am Standort des ehemaligen Schwermaschinenkombinats Ernst Thälmann hier in Magdeburg wies und damit – sicher unfreiwillig – überzeugend belegt, wie wichtig und ernst das Thema ist. Ich widerspreche ausdrücklich der These des Präsidenten der Arbeitgeber- und Wirtschaftsverbände, wenn er die Lohnunterschiede in Ost und West als gerechtfertigt ansieht, weil selbstverständlich „Leitungs- und Entwicklungsfunktionen“ besser bezahlt seien als die Tätigkeit „an der Kasse, an der Maschine, auf dem Fahrersitz, am Zeichentisch oder in der Sachbearbeitung“. Diesen Aussagen liegt ein Grundver- ständnis zu Grunde, das mich in seiner Deutlichkeit dann doch überrascht hat: Ostdeutschland, als Land der Kassiererinnen, Maschinistinnen, Kraftfahrerinnen, Zeichnerinnen, Sachbearbeiterinnen? Nein! Ostdeutschland und die hier lebenden Menschen sind ebenso vielfältig ausgebildet, teilweise hochqualifiziert wie alle Menschen in den übrigen Bundesländern. Daher muss die Frage gestellt und beantwortet werden: mit welcher Berechtigung werden diesen Menschen, den Menschen aus Ost- deutschland gute Löhne für gute Arbeit vorenthalten? Mit welcher Berechtigung werden Karrierewege vereitelt? Mit welcher Berechtigung werden Menschen mit ostdeutscher Sozialisation Anerkennung und Respekt verwehrt? Es gibt dafür weder formal noch moralisch eine Rechtfertigung. Es geht um Macht, um politische Entscheidungen und genauso muss es auch benannt werden, um eine Chance zu bekommen, diesen Zustand zu überwinden. Damit bin ich nicht radikal, sondern verfassungskonform. Ich bin aber sehr gern radikal-verfassungskonform. Mir fällt zu der Auseinandersetzung mit dem Präsidenten des Arbeitgeberverbandes ein, dass Demut Schwerkraft erzeugt und vor allem dafür sorgt, dass man auf dem Teppich bleibt. Denn Klemens Gut- mann kam als Mensch ohne jeden Berufs- oder Studienabschluss in den 1990er Jahren nach Magdeburg, baute Unternehmen auf und hatte und hat wirtschaftlichen Erfolg, weil er sich etwas zutraute, weil er sich reinkniete und Chancen nutzte – aber auch, weil seine heute 5.000 überwiegend ostdeutschen Mit-
arbeiterinnen und Mitarbeiter fleißig ihren Job erledigten und erledigen und: Weil er die Möglichkeiten der zahlreichen formellen und informellen Netzwerke nutzen konnte, die nach der Wende von West nach Ost transferiert worden sind. Die Tatsache, dass er heute wohl zu den wohlhabendsten Menschen in Sachsen-Anhalt zählt, sei ihm gegönnt. Seine Ignoranz vor den wirtschaftlichen und sozialen Problemen Ostdeutschlands, die er uns mitgeteilt hat, stößt mich ab. Wir haben ihm selbstverständlich unsere Argumente und Erwartungen an ihn als in Ostdeutschland tätigem Unternehmer sowie als Landesvertreter im Bundesverband der deutschen Industrie sowie in der Bundesvereinigung der Deutschen Arbeitgeberverbände schriftlich mitgeteilt. Ich halte nichts von dem unternehmerischen Leitsatz eines Erich Sixt, der Auftrag eines Unternehmers heiße, Geld zu verdienen und sonst nichts. Ich komme zurück zur Debatte um unseren Slogan „Nehmt den Wessis das Komman- do!“. Bemerkenswert finde ich das Ergebnis der „Frage der Woche“ des MDR, ob man die auf dem Plakat gewählte Formulierung in der heutigen Zeit angemessen empfinde. 59 Prozent meinten: Nein oder eher nein, immerhin 39 Prozent, was sehr deutlich über unserem aktuellen Wählerpotential liegt (ich sage: leider), sagten: Ja oder eher ja. Wie wäre das Ergebnis wohl ausgegangen, hätte der MDR nicht nach der Angemessenheit der Formulierung, also nach ihrer politischen Korrektheit, sondern nach der Zufrieden- heit mit der Repräsentanz von Ostdeutschen in den Führungsetagen von Politik, Wirtschaft und Gesell- schaft Ostdeutschlands gefragt? Es ist das eine, keine „Landeskinder“ in Führungspositionen zu erleben. Damit fehlt es übrigens auch an Vorbildern. Das andere ist aber auch das reale Erleben der Menschen, dass es ihnen an Chancengleichheit mangelt, weil sie in Ostdeutschland, in Sachsen-Anhalt geboren wurden. Und selbstverständlich müssen sich die Menschen in diesem Gefühl durch die unsäglichen Debatten um das Sigmund Jähn Planetarium in Halle oder die Aufnahme bzw. Nichtaufnahme von Täve Schur in die „Hall of Fame des Sports“ bestätigt fühlen. Warum gibt es in Magdeburg keinen Hans-Joachim Preil-Platz vor unserem Theater? Er hat das Theater viele Jahre geleitet. Dafür gibt es einen Konrad-Adenauer-Platz und einen Willi-Brandt-Platz. Ich bin mir nicht mal sicher, ob sie jemals in Magdeburg waren. Es sind rein politische Entscheidungen. Gut und böse. Schwarz und weiß. Doch die Menschen in Sachsen-Anhalt in Ostdeutschland verbinden ihr Leben ihr Wirken mit Menschen wie Täve Schur und Sigmund Jähn. Das Nichtanerkennen von ihnen wird von vielen Menschen in unserem Land zugleich mit einer Respekt- losigkeit gegenüber ihrer eigenen Lebensleistung wahrgenommen. Daher wundern mich die Leserbriefe in ihrer Vielzahl und Deutlichkeit überhaupt nicht. Das zu benennen, deutlich zu benennen, war Aufga- be unseres Plakates. Selbstverständlich spitzt unser Plakat sowohl in der Sprache wie in seiner Gestaltung zu. Es provoziert. Das sollte es. Es zwingt so nachgerade unweigerlich dazu, sich mit der transportierten Botschaft ausein- anderzusetzen. Das sollte es. Ich habe inzwischen sogar eine Einschätzung der „Arbeitsstelle für linguis- tische Gesellschaftsforschung“ an der Otto-von-Guericke-Universität zu diesem Plakat und insbesondere zu dem Bild von Kind und Hund lesen können. Beeindruckend! Im Ergebnis stellte Kristin Kuck von der Otto-von-Guericke-Universität fest – ich zitiere: „Das Bild kann auch schlicht als ein Kräftemessen zwi- schen zwei Parteien verstanden werden, die prinzipiell eine Einheit bilden und in Übereinstimmung in die gleiche Richtung laufen sollten. Das Plakat stellt dann einen Missstand dar: Es fehlt an der nötigen Konver- genz, um gemeinsam voranzukommen. Hier würde zumindest der Einheitsgedanke stärker im Vordergrund stehe. Jedoch würde immer noch die ungünstige Machtverteilung der Einheit Mensch – Hund wirksam.“ Herzlichen Dank für diese Auseinandersetzung und Interpretation! Klar ist schon jetzt: Es ist selten,
dass ein Wahlkampfplakat – zumal in einem Landtagswahlkampf – zumal in Ostdeutschland - so etwas schafft. Eine bundesweite Debatte! Sehr selten. Damit hat das Plakat etwas geschafft, was keine Debatte im Landtag, keine Antwort der Bundes- und der Landesregierung auf parlamentarische Anfragen von Abgeordneten meiner Partei und keine wissenschaftliche Studie geschafft haben. Das Plakat selbst ist übrigens anlässlich der Präsentation unserer Kampagne nicht mal wahrgenommen worden. Erst seine Platzierung in den Netzen bewirkte Reaktionen – zunächst einen veritablen Shitstorm und dann zunehmend auch Nachdenklicheres und auch viel Zustimmendes. Es wird noch immer viel über die Wortwahl, aber vor allem immer mehr über die der Wortwahl zugrundeliegende Situation diskutiert. Wir, DIE LINKE Sachsen-Anhalt, haben damit einen Raum der Debatte, auch der Kontroverse geöffnet, den die deutsche Politik sträflich vernachlässigt hat, obwohl es unzählige Daten und Fakten gibt, die uns zwingen müssten zu diskutieren und vor allem zu handeln! Ich weiß: Unser Plakat wird von vielen als politische Inkorrektheit empfunden getreu nach dem Motto des Linguisten Harald Weinrich, dass die politische Korrektheit die „Etikette der Gleichheit“ sei. Natürlich haben wir auch die vielstimmige Kritik auf den Vorwurf zur Kenntnis genommen – ein Vorwurf der weh tut: das Plakat spalte. Ich frage aber: Kann ein Satz auf einem Plakat etwas spalten, was in der Lebensrealität der meisten Menschen in bester Ordnung zusammengefügt ist? Ist es nicht vielmehr so, dass ein solcher Satz nur dann eine Kontroverse auslösen kann, wenn er den Finger in eine reale gesellschaftliche Wunde, in einen tief reichenden Riss legt? Gäbe es diese Wunde, diese tatsächliche und mentale Spaltung nicht, löste der Satz keine Kontroverse aus, würde er ins Leere laufen und – wenn überhaupt – mit Achselzucken quittiert werden. Muss, ja darf ein Wahlkampfplakat den Eindruck von Gleichheit in einer für die Menschen bedeutsamen Frage vorgaukeln, in der – so mei- ne These – substantielle Ungleichheit und Ungerechtigkeit herrschen? Was also sagt die Losung auf dem Plakat aus? Mit „Nehmt den Wessis das Kommando!“ ist zunächst mal die andere Seite des Konflikts angesprochen, denn die Aufforderung kann sich nur an die Ostdeutschen richten: Traut euch Führungspositionen zu, übernehmt gerade in eurer Heimat Verantwortung, packt an, wo sich Chancen bieten, und belasst es nicht dabei, nur larmoyant zu lamentieren, wenn es andere an eurer statt tun. Diese Aufforderung ist die zentrale Botschaft! Deshalb tut der Satz auch beiden Seiten weh. Auch mir. Mit „Nehmt den Wessis das Kommando!“ sind aber auch all jene aufgefordert, die aktuell die Verantwor- tung innehaben, die Bedingungen dafür mitzugestalten, dass zunehmend mehr Ossis in verantwortliche Positionen in Staat und Gesellschaft Ostdeutschlands kommen können. Mit „Nehmt den Wessis das Kommando!“ wird natürlich auch die These aufgestellt, dass überwiegend die Menschen aus den alten Ländern, die nach Sachsen-Anhalt gekommen sind, im Land das Kommando haben. Ich wiederhole mich: Das Plakat ist ein Volltreffer! Oberflächlich betrachtet, geht es um die Beantwortung der Frage: Wer führt den Osten Deutschlands, wer führt Deutschland? Ich möchte mich hier aus Zeitgründen auf zwei Erhebungen – eine wissen- schaftliche und eine staatliche – beschränken, um pars pro toto Belege für meine, unsere grundsätzliche These anzuführen, dass Ostdeutsche sowohl in den ostdeutschen Ländern der Bundesrepublik als auch insgesamt dramatisch unterrepräsentiert sind. Im Mai 2016 legte das Institut für Kommunikations- und Medienwissenschaft der Universität Leipzig in Zusammenarbeit mit dem MDR ihre Studie „Wer be- herrscht den Osten? Ostdeutsche Eliten ein Vierteljahrhundert nach der deutschen Wiedervereinigung“ vor. Als zentrales Ergebnis wird herausgearbeitet – ich zitiere:
„Heute, 25 Jahre und damit eine Generation nach der Wiedervereinigung, sind die Ostdeutschen in ge- sellschaftlichen Führungspositionen noch immer nicht adäquat repräsentiert. Zum Teil vollzieht sich statt einer Angleichung gar eine gegenteilige Entwicklung, geht ihre Zahl gar zurück. Zugespitzt lässt sich feststellen, dass, obwohl vielerorts eine Frauenquote, nirgends jedoch eine Quote für Ostdeutsche gefordert wird, die Ostdeutschen in Führungspositionen viel stärker eine Minderheit bilden als Frauen.“ „Ein Nachrücken Ostdeutscher in Führungspositionen in Ostdeutschland entsprechend der Bevölke- rungsverteilung ist kaum feststellbar. Nur 23 Prozent beträgt der Anteil Ostdeutscher innerhalb der Füh- rungskräfte in den neuen Bundesländern – bei 87 Prozent Bevölkerungsanteil. Lediglich in der Justiz, in Teilen der Wirtschaft, in der Bundeswehr und in einigen Medien ist ein, allerdings sehr langsames, Nachrücken festzustellen.“ Das Handelsblatt, nicht gerade links verortet, schätzte die Ergebnisse so ein: „Die Zahlen zeigen: Auch 30 Jahre nach dem Mauerfall geht durch Deutschland ein Riss.“ Schauen wir in die aktuelle Landesregie- rung von Sachsen-Anhalt: Lediglich zwei Minister haben eine ostdeutsche Sozialisation. Das ist übrigens spiegelverkehrt zum Kabinett Bodo Ramelows, immerhin einem LINKEN Ministerpräsidenten west- deutscher Herkunft. Bodo Ramelow bekennt ganz selbstbewusst, dass es für ihn auch gar nicht anders in Frage käme: selbstverständlich bedarf es in einer Landesregierung einer Widerspiegelung der Bevöl- kerung. Das ist übrigens auch der Grund, warum ich mich ebenso leidenschaftlich für eine paritätische Besetzung von Männern und Frauen im Parlament, der Landesregierung und dem Landesverfassungsge- richt einsetze. Und es macht Spaß Bodo Ramelow zuzuhören, wenn er leidenschaftlich über „Schwester Agnes“ und längeres gemeinsames Lernen in Thüringen redet. Beides „Produkte“ der DDR. Darf nur ein Ministerpräsident mit westdeutscher Sozialisation solche „Produkte der DDR“ ins vereinte Deutschland hineinführen? Nein, ich habe den Mut dazu, auch in Sachsen-Anhalt. Im Dezember 2020 legte die Kommission „30 Jahre Friedliche Revolution und Deutsche Einheit“ des Deutschen Bundestages ihren Abschlussbericht vor. Die Kommission habe, so der Abschlussbericht, der Frage der Vertretung Ostdeutscher in den Eliten des vereinigten Deutschlands eine besondere Bedeu- tung beigemessen, weil damit auch Fragen der demokratischen Repräsentation und der Legitimation berührt würden. Dauerhafte Repräsentationslücken könnten eine Entfremdung zwischen Bevölkerungs- gruppen und gesellschaftlichen Führungsgruppen bewirken sowie die Identifikation der Bürgerinnen und Bürger mit ihrem Gemeinwesen beeinträchtigen. Die Kommission stellte ebenfalls fest, es sei zu- tiefst unbefriedigend, dass Ostdeutsche in den Führungspositionen von Verwaltung, Justiz, Wirtschaft, Wissenschaft, Medien und Militär immer noch in sehr deutlicher Weise unterrepräsentiert sei. Ich zitiere: „Blickt man auf Deutschland insgesamt, zeigt sich, dass Ostdeutsche (je nach Studie) heute einen An- teil von 3 bis 8 Prozent der Führungspositionen einnehmen – und dies bei einem Bevölkerungsanteil von etwa 17 Prozent. Auch auf dieser Ebene ist der Anteil der Ostdeutschen in der Politik am höchsten. Besonders unterrepräsentiert sind Ostdeutsche in den Führungspositionen von Justiz, Wirtschaft und Bundeswehr (1 bis 2 Prozent). Das Nachrücken von Ostdeutschen in Spitzenpositionen vollzieht sich – auf ohnehin niedrigem Niveau – sehr langsam, teilweise geht ihr Anteil sogar zurück. „Auch wenn große Unterschiede zwischen den verschiedenen gesellschaftlichen und professionellen Sektoren bestehen, ist insgesamt festzustellen, dass sich die Ostdeutschen innerhalb der Bundesrepublik – bis auf die politischen Repräsentationseliten – in keinem einschlägigen Bereich entsprechend ihrer Be-
völkerungsstärke repräsentiert finden (dies trifft in der Regel nicht auf die kommunale Ebene zu). Dieser Befund spiegelt sich auch in der Wahrnehmung sowohl der west- als auch der ostdeutschen Bevölkerung wider.“ Diese Feststellungen der Kommission des Deutschen Bundestages von Ende 2020 ließen die FAZ, eben- falls eher nicht links verortet, resümieren: „Ostdeutsche sind dramatisch unterrepräsentiert.“ Der Vorsitzende dieser Kommission des Deutschen Bundestages, der ostdeutsche Sozialdemokrat und ehema- lige Ministerpräsident Brandenburgs, Matthias Platzeck, schätzte gegenüber der FAZ ein, dass diese gra- vierende Unterrepräsentanz ein „absolut ungesunder Zustand“ sei; die gegenwärtige Lage sei nicht gut für das Selbstwertgefühl der Ostdeutschen. Außerdem liege durch die mangelnden Aufstiegschancen der Ostdeutschen eine Ressource brach. Aktuelle Zahlen auf Fragen unserer Bundestagsfraktion belegen, dass im bspw. im Umweltbundesamt in Dessau ca. 77 Prozent der Sachbearbeiter*innen in Ostdeutsch- land geboren wurden. In der Ebene der Abteilungs- und Fachbereichsleitungen finden sich nur noch 20 bzw. 25 Prozent Ostdeutsche. Im Bereich der Pflegeberufe verdienen ostdeutsche Fachkräfte 90 Prozent des Bruttoentgeltes gegenüber ihren Kolleg*innen in Niedersachsen oder Bayern. In der Altenpflege sind es 22 Prozent Lohnunter- schied! Fast ein Drittel der Ostdeutschen arbeiten im sogenannten Niedriglohnsektor. In Westdeutsch- land sind es lediglich 16 Prozent und davon vor allem Frauen in Teilzeit. Arbeitnehmer*innen in Sach- sen-Anhalt arbeiten bundesweit am längsten: 2 Stunde länger pro Woche. Ihr Lohn: 6,16 Euro pro Stunde weniger. Langfristig bezahlen alle Menschen in Deutschland für diese Politik die Zeche: Erst mit staat- licher Zuzahlung von Aufstocker*innen und anderen Leistungen und am Ende der Grundsicherung im Alter ist das unternehmerische Modell Niedriglohn komplett beschrieben. Wie ist eigentlich zu all diesen Fakten die Einschätzung der Landesregierung Sachsen-Anhalts, die sich auf eine Koalition aus CDU, SPD und BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN stützt? Behebt sie den Bodenschatz ost- deutscher Kompetenzen? Weit gefehlt! Auf die Große Anfrage meiner Fraktion im Landtag zum Thema „Land Sachsen-Anhalt: Dreißig Jahre Land der Bundesrepublik Deutschland“ antwortet der Ministerprä- sident Dr. Haseloff (CDU), die Unterrepräsentanz Ostdeutscher in Führungspositionen stelle eine Zwangs- läufigkeit dar. Mir klingt das eher nach einem Physiker, der ein Naturgesetz beschreibt, als nach politi- schen Ambitionen, daran mit geeigneten Konzepten etwas zu ändern. Selbst in dem Bereich, in dem der MP und die Kenia-Koalitionäre das personalpolitische Heft des Handelns fest in der Hand halten, ohne Artikel 33 Absatz 2 des Grundgesetzes in den Blick nehmen zu müssen – der Besetzung der Minister- und Staatssekretärsposten in Sachsen-Anhat –, vermitteln sie den Eindruck, nahezu kein geeignetes ost- deutsches Führungspersonal zur Verfügung zu haben. Es reicht halt nicht oder zumindest nicht mehr, im Rahmen einer Sonntagsrede wie beim Antritt der Präsidentschaft im Bundesrat durch Ministerpräsident Haseloff zu versichern, er wolle bei der Vollendung der Deutschen Einheit ein Stück weiterkommen. Ich nenne das eine bestenfalls scheinbar ambitionierte Scheuklappen-Perspektive und setze dem entgegen: Nur ausdauerndes Arbeiten am Problem und das gute, vorbildliche Beispiel knüpfen gerade in der Personalpolitik den Geduldsfaden zwischen Ambition und Erfolg. In Sachsen-Anhalt sind aber dringender denn je Ambitionen und Lust am Gestalten gefragt. Denn macht nichts macht doch was! Wenn Angehörige einer bestimmten sozialen Gruppe trotz entsprechender Quali- fikation nicht aufsteigen, spricht man in der Soziologie von der „gläsernen Decke“. Ich werde immer und immer wieder die Ursachen für diese gläserne Decke herausarbeiten, öffentlich zur Debatte zu stellen und Seilschaften geknüpft aus gemeinsamer Herkunft, gemeinsamen Erfahrungen und der Verbindung in formellen oder informellen Netzwerken öffentlich machen. Wir brauchen eine gezielte Förderung ostdeutschen Führungskräftenachwuchses in allen Bereichen von Staat und Gesellschaft. Keine Sorge:
DIE LINKE strebt es nicht an, die nicht bestreitbare Hegemonie der Westdeutschen an den Schalthebeln der Macht durch eine Hegemonie der Ostdeutschen zu ersetzen. Es geht uns um gleiche Chancen für Ostdeutsche, Verantwortung im dann wirklich eigenen Land wahrzunehmen. Lassen Sie uns dies ge- meinsam aufarbeiten und vor allem auf Augenhöhe an der sachlichen und gefühlsmäßen Vollendung der Deutschen Einheit arbeiten. Gemeinsam für Chancengleichheit. War hier aus Anlass unseres Plakats „Nehmt den Wessis das Kommando!“ bislang von einem Riss durch Deutschland in Folge einer dramatischen Unterrepräsentanz Ostdeutscher in den Führungspositionen von Staat und Gesellschaft die Rede, muss tiefer geschaut werden, um die ganze Dimension der menta- len und tatsächlichen Spaltung Deutschlands freizulegen und als Tatsache anzunehmen, die unsere poli- tische Botschaft eben auch offen legt und was wahrscheinlich erst die zum Teil heftigen Reaktionen bei Ost- und Westdeutschen erklärt. Der bereits angeführte Bericht der Bundestagskommission fasst diese Dimension in dem vielleicht etwas zu harmlos daherkommenden, aber dennoch wahren Satz zusammen: „Es gibt Anlass zur Sorge, wenn bis zu zwei Drittel der Ostdeutschen in Umfragen erklären, dass sie sich in Deutschland noch immer als ‚Menschen zweiter Klasse‘ behandelt fühlen.“ Es entspricht nicht den Tatsachen, dass wir weniger produktiver sind, weniger qualifiziert, weniger engagiert, weniger mutig sind. Ich möchte, dass wir auch ostdeutsche Vorbilder präsentieren. Sie wer- den gebraucht, denn die Herausforderungen der nächsten Jahre für Sachsen-Anhalt sind gewaltig: Die Corona-Krise und ihre Kosten, die aus unserer Sicht vor allem die Gewinner der Krise und die Reichsten unseres Landes tragen sollten, die Bewältigung des Klimawandels, der Strukturwandel, die Meisterung der technologischen Revolution, ein Gesundheitswesen, dass am Menschen und nicht am Profit orientiert ist und einen sozialen Ausgleich innerhalb Deutschlands, in Europa und in Solidarität mit den Ärmsten der Welt. Umso wichtiger ist, die Deutsche Einheit zu vollenden. Ostdeutschland ist ein Zukunftsthema! Wir brauchen Versöhnung statt Spaltung. Wir brauchen Gerechtigkeit statt Zementierung der Ungerech- tigkeit. Wir brauchen Anerkennung und Respekt von Lebensleistungen statt Ausgrenzung. Wir brauchen Taten statt Ankündigungen. Wer redet, macht Politik. Wer handelt, verändert die Welt. Ich möchte das Land in Verantwor- tung verändern.
Sie können auch lesen