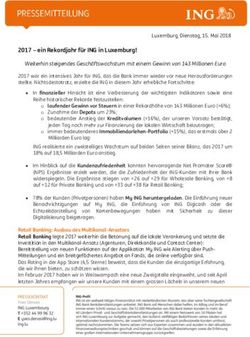Angewandter Arten- und Biotopschutz beim Landesverband Lippe - Vortrag anlässlich der 1. Lippischen Artenschutzkonferenz am 13.01.2018 ...
←
→
Transkription von Seiteninhalten
Wenn Ihr Browser die Seite nicht korrekt rendert, bitte, lesen Sie den Inhalt der Seite unten
Angewandter Arten- und Biotopschutz
beim Landesverband Lippe
Vortrag anlässlich der 1. Lippischen Artenschutzkonferenz am 13.01.2018Verbandsvorsteher Helmut Holländer (1987):
„Die wachsende Erkenntnis, daß für eine Sicherung der dauerhaften
Leistungsfähigkeit land- und forstwirtschaftlicher Urproduktion die
Verbesserung ihrer natürlichen Produktionsgrundlagen Boden, Wasser und
Luft zwingend geboten ist, hat zu einer Verstärkung der Umweltschutz-
bestrebungen des Landesverbandes Lippe geführt.
Neben dieser Zielsetzung wird die Erhaltung vielfältiger
Lebensgemeinschaften von Pflanzen und Tieren als
kulturelle Aufgabe verstanden.“
3Lange Tradition im Biotop- und Artenschutz
• Bereits 1970 beteiligte sich der LVL im Rahmen des
Europäischen Naturschutzjahres an einem Wettbewerb des
Landes NRW und erhielt eine Urkunde für besonders
vorbildliche Leistungen auf dem Gebiet des Schutzes der
Natur in der Freien Landschaft
4Lange Tradition im Biotop- und Artenschutz
z.B. Uferstreifenprogramm für alle Gewässerrandstreifen im Eigentum des LVL
ab 1985 (15 Jahre vor der Wasserrahmenrichtlinie!)
Beispiel Flussgebiet der Emmer:
• 1985 Umfassende Kartierung mit Defizitanalyse
• Bis Ende 1987 an Emmer und Niese 12,9 km Uferstreifen
• 15.300 Gehölze auf Domänenflächen gepflanzt
• Die Uferstreifen wurden aus Pachtflächen herausgenommen
6Lange Tradition im Biotop- und Artenschutz
z.B. Biotopvernetzung auf Ackerflächen seit 1985
Beispiel Domäne Fahrenbreite
• Erarbeitung eines Biotopverbundplans
• allein bis Ende 1987 wurden 2,3 km Hecken gepflanzt
• 8.500 Gehölze auf Domänenflächen gepflanzt
• Feucht- und Quellbereiche wurden Pachtfrei gestellt, dadurch
ca. 3 ha Sonderbiotope der natürlichen Sukzession überlassen
7Lange Tradition im Biotop- und Artenschutz
Naturschutzgebiete auf LVL-Flächen (Auswahl früher Gebiete)
• 1950 (1925) Donoperteich / Hiddeser Bent
• 1961 (1928) Norderteich
• 1970 (1926) Externsteine
• Graureiherkolonie in Erder
• 1991 Bielsteinhöhle mit Lukenloch
Nach Aufstellung der Landschaftspläne mittlerweile
mehr als 5.300 Hektar NSG auf Forstbetriebsflächen
Hinzu kommen weitere NSG in Bach- und Flussauen
auf landwirtschaftlichen Flächen
8Waldeigentum des Landesverbandes Lippe
Natura 2000 Gebiete in Lippe
Hellgrün = FFH-Gebiete
Schraffur = Vogelschutzgebiete
Waldfläche LVL = 15.800 Hektar
davon FFH-Gebiete = ca. 5.300 Hektar = 34 %
9Die Forstverwaltung
des LVL
Leitung Forstabteilung
1 Diplom-Forstwirt, 1 Diplom-Forstingenieurin (FH)
Forstreviere Stabsbereich Stabsbereich jagd-, fischerei-
Verwaltung und gewässerökologische
11 Diplom-Forstingenieure/Innen (FH) Fragen pp.
3 Forstwirtschaftsmeister und 21 Forstwirte 5 Mitarbeiter/Innen 2 Diplom-Forstingenieure
Zusammenarbeit
mit Landesbetrieb Wald und Holz NRW
Zertifizierte Externes
Forstunternehmer Forsteinrichtungs- Zusammenarbeit mit
werk Unterer Landschaftsbehörde des Kreises Lippe
Zusammenarbeit mit
Biologischer Station Lippe
Zusammenarbeit mit
Universität Göttingen und FH Hildesheim-Holzminden
11Nationale Strategie zur biologischen
Vielfalt
B 1.2.1 Wälder (2007) Waldbau beim Landesverband Lippe
Waldbauliche Ziele (2006):
„Unsere Vision für die Zukunft ist:
Leitbild: „Funktionsgerechter Waldbau auf ökologischer
Die Wälder in Deutschland weisen eine hohe
Grundlage“
natürliche Vielfalt und Dynamik hinsichtlich ihrer
Struktur und Artenzusammensetzung auf und
Erhaltung und/oder Schaffung von stabilen,
faszinieren durch ihre Schönheit.
ertragsstarken (Massen- und/oder Wertertrag)
Natürliche und naturnahe Waldgesellschaften und standortangepassten Waldbeständen
haben deutlich zugenommen. (= Waldökosystemen) auf einem
angemessenen Vorratsniveau,
Die nachhaltige Bewirtschaftung der Wälder erfolgt die flexibel und umfassend auf zukünftige
im Einklang mit ihren ökologischen und sozialen Veränderungen der Umwelt und/oder Gesellschaft
Funktionen. reagieren können.
Der aus Wäldern nachhaltig gewonnene Rohstoff
Holz erfreut sich großer Wertschätzung.“ (z.B. auf den Klimawandel, Schadstoffbelastungen,
extreme Witterungsereignisse, hohe Rohstoffnachfrage,
neue Nutzungsansprüche oder Einnahmeerwartungen )
1213
14
Vorratsentwicklung seit 1958
Efm.o.R. 3.725.944
4.000.000 3.145.778
2.743.963
3.500.000 2.584.230
2.269.389
3.000.000
2.500.000
2.000.000
1.500.000
1.000.000
500.000
0
1958 1976 1986 1995 2009
15Entw icklung des jährlichen Zuw achses seit 1958
Efm.o.R.
125.333
113.550
140.000
97.316
120.000 83.566
72.726
100.000
80.000
60.000
40.000
20.000
0
1958 1976 1986 1995 2009
1617
18
19
Die Waldbaustrategie des LVL
ist auch ökologisch erfolgreich!
• „Das Gebiet zeichnet sich durch eine mindestens landesweit
bemerkenswerte Vielfalt von Arten großer, strukturreicher
Wälder aus mit einer für den Standort typischen natürlichen
Artenzusammensetzung.“
• „Z. B. beherbergt es die gesamte, potenziell vorkommende
Palette der Waldeulen vom Sperlingskauz, Rauhfußkauz,
Waldkauz über Waldohreule hin bis zum Uhu.“
• „Darüber hinaus kommen mit Klein-, Mittel-, Bunt-, Grün-,
Grau- und Schwarzspecht alle in Nordrhein-Westfalen
auftretenden Spechtarten vor.“
alle drei Zitate: LANUV (2011): Gutachten zur Eignung des Teutoburger Waldes als Nationalpark
20Erhaltung und Förderung seltener Baumarten
(mit Blick auf gebietsheimische Genressourcen u.a. in
Kooperation mit der Forstgenbank)
• Elsbeere
• Speierling
• Flatterulme (z.B. Weseraue)
• Bergulme
• Vogelkirsche
• Moorbirke
• Wildapfel und Wildbirne
• Eibe
21Seltene Wirbeltierarten
in Wäldern des Landesverbandes:
• Luchs
• Wildkatze
• Uhu
• Schwarzstorch
• Rotmilan
• Fledermausarten
• Spechtarten
• …
22III
Nutzung und Biodiversität vereinbar?
23Waldfunktionen: Ansprüche an den Wald
(Auswahl)
Einkommen Arbeitsplatz
Nachwachsende
Landschaftsbild (Heimat)
Rohstoffe
gesundheits- Klimaschutz
fördernder WALD
Erholungsraum
Biotop- und Artenschutz
Emissions- und Klimaschutz
Wasser
24Dichtungen,
Hygieneartikel Membranen, Stoffe, Kleidung
Beläge
Filter
Papier Faserbaustoffe
Vulkanfiber Viskose
Pappe Biokunststoff
Zellulose Celluloid
Dämmstoff Medizin Verpackungen
Holzteer
Holzessig Cellophan
Holz-Metall- Isoliermaterial
Verbundwerkstoffe
Multitalent
Holz
Holzkohle Filteranlagen
Holz-Kunststoff- z.B. Kläranlagen
Verbundwerkstoffe
Brennholz
Häuser Bauholz
Möbel Spielzeug
25Bildquelle: Hochschule OWL / Asche, Dr. Norbert (2017)
261 Hektar Fichtenwald in Deutschland (Zahlen nach Schulze, E., 2016, Externe ökolog. Folgen v. Flächenstillleg. im Wald)
Holzmasse = ca. 300 bis 400 Festmeter, Zuwachs je Jahr = ca. 11 Festmeter
Bei Nutzung von ca. 8 Festmetern/Jahr und Ernteverlust von 20 %
liefert der Hektar Wald pro Jahr ca. 6,4 Festmeter Holz
1 Hektar Fichtenwald im borealen Nadelwald
Holzmasse = ca. 50 bis 150 Festmeter, Zuwachs je Jahr = ca. 1,5 Festmeter
Bei Nutzung von ca. 1,5 Festmetern/Jahr und Ernteverlust von 50 %
liefert der Hektar Wald pro Jahr ca. 0,75 Festmeter Holz
Ergebnis:
um 1 Hektar Nadelholz in Deutschland (= Sekundärwald) zu ersetzen,
würden gut 8 Hektar Fichte im borealen Nadelwald (= womöglich Urwald) benötigt
27Stichwort CO 2: Was sagt die Forschung?
28Neuere umfassende Untersuchungen (u.a. Uni Göttingen)
zur Artenvielfalt in Buchenwaldökosystemen
deuten auf folgendes hin:
• eine hohe Biodiversität auf Landschaftsebene stellt sich dann
ein, wenn die Vielfalt der angebotenen Lebensräume hoch ist
• Waldbausysteme, die räumliche und zeitliche Vielfalt
erzeugen, scheinen die Biodiversität zu fördern
• multifunktionale Forstwirtschaft schließt neben genutzten auch
ungenutzte Flächen ein. Beide leisten einen bedeutenden
Beitrag für den Erhalt einer hohen Artenvielfalt
29Forstliche Bewirtschaftung von Buchenwaldökosystemen
wirkt sich nicht per se negativ auf die Biodiversität aus
Ammer (2017) in AFZ-Der Wald 17/2017
Waldbewirtschaftung und Biodiversität:
Vielfalt ist gefragt!
Aus Ammann, C. (2017): Waldbewirtschaftung und Biodiversität: Vielfalt ist gefragt 30Textquelle: SVS BirdLife Schweiz 2011: Biodiversität: Vielfalt im Wald, 2011
Foto: Naturschutzgroßprojekt Senne, Internetseite
31IV
Kann Biotopschutz ein ökonomischer Wert sein?
32Die Einnahmen aus dem Forst sind für den Landesverband Lippe
von existenzieller Bedeutung
Der LVL kann weitere Bewirtschaftungsauflagen allenfalls bei
entsprechender Entschädigung verkraften
33Abschätzung der Betriebsleistung
nach Baumarten (DB I in €/ha)
unterstellt Ekl. I,5
800,00 761,12
700,00
600,00 552,08
Euro je Hektar
500,00
386,34
400,00 377,64
320,29 306,00 296,80
300,00
222,19
200,00
120,49
100,00
0,00
e
e
h
n
e
sie
te
l
er
e
ch
Al
Al
h
ch
pp
ch
ef
rc
la
Bu
Ei
Ki
Pa
Lä
Fi
g
ou
D
34Alt- und Totholz als Produkt des LVL-Forstbetriebes
Totholzinventur (ø über 15 cm in 1 m Höhe) des LVL 2009:
21.480 fm stehendes Totholz
45.494 fm liegendes Totholz
Wirtschaftlicher Wert ca. 2 Millionen Euro
35Aktueller Hiebssatz gesamt: 127.736 Efm/Jahr
36Alt- und Totholz als Produkt des LVL-Forstbetriebes
Förderung des dauerhaften Erhalts von Alt- und Totholzbäumen:
LVL: 2003/2004 insges. 2.591 Bäume in ausgewiesenen NSG
ca. 6.500 fm Masse
(Förderung 80 % des damaligen erntekostenfreien Holzpreises)
Allerdings keine Entschädigung
• für die dauerhaft entfallende Produktionsfläche und
• für die dauerhaft erhöhten Aufwendungen für Verkehrssicherung
und Arbeitsschutz
Weitere Nachteile:
• maximal 10 Bäume/ha förderfähig,
• maximal einmalig 2.300 Euro/ha Förderbetrag
• i.d.R. keine flächenhaften Elemente förderfähig (Altholzinseln)
37Alt- und Totholz als Produkt des LVL-Forstbetriebes
10 ha Wildnisfläche am Großen Ehberg, Nutzungsverzicht auf 99 Jahre,
100 % gefördert durch das Naturschutzgroßprojekt Senne
38Für den Artenschutz im lippischen Wald wichtig
wären:
• eine Ausweitung und bessere finanzielle Ausstattung von
Förderprogrammen für Totholz und Altholzinseln
• eine Förderung des Anbaus selten gewordener
Laubbaumarten, die sich schwer natürlich verjüngen
• ein spezielles, gefördertes Eichen-Anbauprogramm zum
großflächigen Erhalt von Stiel- und Traubeneichenwäldern
• Förderung der Nutzungseinschränkung von Sonderbiotopen
(z.B. Heideflächen)
3940
V
Förderung der Biodiversität durch Jagd und Fischerei
41Leistungen der Jäger
Großraubsäuger (Bär, Wolf, Luchs) sind in Lippe zur Zeit und
wahrscheinlich auch in naher Zukunft nicht in relevanten Dichten
vorhanden, um Schalenwildbestände einzuregulieren.
Naturnahe Waldökosysteme können nur natürlich entwickelt werden,
wenn Reh-, Rot- und Damwild in nicht zu hoher Dichte vorkommen.
Dies geschieht seit Jahrzehnten durch Ausübung der Jagd.
Den Wildbestand in seinem natürlichen Artenreichtum gesund zu erhalten
sowie seine natürlichen Lebensgrundlagen zu sichern und zu verbessern ist
gesetzlicher Auftrag.
Jagdausübung ist somit zur Zeit auch in Schutzgebieten unverzichtbar.
Hier ist den Jägern in Lippe ausdrücklich zu danken.
42Leistungen der Angler
1980er Jahre: Wiederansiedlung der Äsche in der Bega
Seit 1990er Jahren Besatz weitestgehend mit Fischbrut
• Fische als Futter/Wirt für viele andere Tiere im Nahrungskreis
(ohne Fisch kein Eisvogel)
Seit 1990er Jahren Wiederansiedlung von Edelkrebsen
1998 freiwilliger Hegeplan der Angler am Gewässersystem Bega
2000er Jahre: Eigenaufzucht von heimischen Besatzfischen (Genetik)
Eigene Versuche zur Wiederansiedlung des Lachses in Bega und Exter
2015 Erstellung des Hegeplans für die Emmer in Eigenleistung
Die Angler unterstützen die Bestrebungen zur Gewässerrenaturierung.
43Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit
44Sie können auch lesen