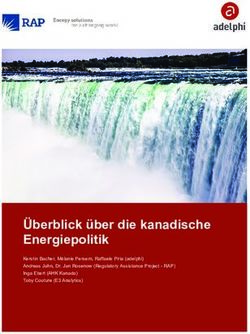Ausgabe 03 | 10. Februar 2014 - Oberösterreichs Industrie fordert Qualitätsschub in unseren Schulen - WKO
←
→
Transkription von Seiteninhalten
Wenn Ihr Browser die Seite nicht korrekt rendert, bitte, lesen Sie den Inhalt der Seite unten
Ausgabe 03 | 10. Februar 2014 Oberösterreichs Industrie fordert Qualitätsschub in unseren Schulen Kontinuierliche Verbesserungsprozesse – wie sie im Wirtschaftsleben Standard sind – und eine strukturierte Feedback-Kultur zwischen Lehrkräften unterschiedlicher Schulen fordert die sparte.industrie der WKO Oberösterreich für den heimischen Bildungsbereich. Die jeweils nachgelagerte Schule soll der Vorgelagerten ein qualitatives Feedback geben. So sollen etwa die Neuen Mittelschulen (NMS) ihre vorgelagerten Volksschulen auf Bildungslücken ihrer Schüler hinweisen und gemeinsam Verbesserungsvorschläge erarbeiten. „Damit könnte ein Qualitätsschub in unseren Schulen erzielt werden“, ist Günter Rübig, Obmann der sparte.industrie, überzeugt. Dass so ein Qualitätsschub vor allem für die Neue Mittelschule notwendig ist, zeigt die jüngste Überprüfung der Bildungsstandards, bei der die NMS hinter den Erwartungen blieb. Schlechter als vermutet schnitt die NMS in Englisch ab – auch in Oberösterreich: Mit 477 Punkten lag die NMS nicht nur klar hinter dem Gymnasium (618 Punkte), sondern auch hinter der Hauptschule (487). Faktum ist auch, dass in Englisch Mädchen deutlich besser abschneiden als Buben. Sieht man sich die Mathematikergebnisse im Detail an, zeigt sich, dass es noch mehr Mädchen sind, die die Standards nicht erreichen. "Wir müssen daher möglichst früh Mädchen für die Technik begeistern und Mathematik interessanter gestalten. Schließlich steigt die Nachfrage an Technikerinnern in der oberösterreichischen Industrie stetig. Und immer mehr Mädchen entscheiden sich auch dazu, einen technischen Beruf zu erlernen,“ erklärt Günter Rübig. Medieninhaber und Herausgeber: Impressum/Offenlegung: W http://wko.at/ooe/industrie/Offenlegung sparte.industrie der WKO Oberösterreich Hessenplatz 3 | 4020 Linz T 05-90909-4201 | F 05-90909-4209 E industrie@wkooe.at | W http://wko.at/ooe/industrie
Ausgabe 03 | 10.2.2014 BILDUNG DI Helmut Hattmannsdorfer | T 05-90909-4230 1. „Fit“ für die Lehre? Neuer Begabungstest weist Schülern den Weg zum Traumberuf Mit einem gemeinsam erarbeiteten Qualifikationskatalog wollen die sparte.industrie der Wirtschafts- kammer Oberösterreich und der Landesschulrat Absolventen der Pflichtschule bei der beruflichen Ori- entierung und auf dem Weg zum Traumberuf unterstützen. Die Schülerinnen und Schüler können ihre Begabungen ohne Prüfungsangst testen, die Aufgaben umfassen Deutsch, Mathematik, Englisch sowie persönliche und soziale Kompetenz. „Es geht darum, welches Grundwissen ein 14- oder 15-jähriger Pflichtschulabsolvent in diesen Bereichen haben muss, um eine Lehre ordentlich zu absolvieren“, er- klärt Rudolf Mark, Bildungssprecher der sparte.industrie. Der Hintergrund der Initiative: Viele Unternehmer stellen bei ihren Aufnahmeprüfungen für künftige Lehrlinge fest, dass die Qualifikation der Jugendlichen nicht immer so gut ist wie erwartet. Mit dem Katalog kann jeder sein Wissen überprüfen und damit lernen. Die Aufgabenbeispiele wurden gemein- sam von Ausbildungsleitern und Berufsschullehrern erarbeitet. „Dieses speziell für Industrielehrlinge entwickelte Übungsmaterial ist ein wichtiger didaktischer Grundlageneinstieg, um vorhandenes Potenzial zu erkennen. Schließlich stellt die richtige Berufswahl hohe Anforderungen an junge Menschen“, sagt Rudolf Mark. Die Aufgaben seien daher geeignet, um das Interesse an einem Lehrberuf in der Industrie zu wecken beziehungsweise sich gezielt darauf vor- zubereiten. Der Qualifikationskatalog der sparte.industrie der WKO Oberösterreich und des Landesschulrats steht unter www.traumberuf-industrie.at zum Download zur Verfügung. 2. Die Arbeiterkammerwahl als Dienstverhinderungsgrund? Grundsatz - Wahltermine - Wahlort – Betriebswahlsprengel Im Jahr 2014 finden die Arbeiterkammerwahlen statt. Den Arbeitnehmern ist die zur Ausübung des Wahlrechts erforderliche Freizeit einzuräumen. Für den Arbeitgeber stellt sich jedoch die Frage, ob die für die AK-Wahl einzuräumende Freizeit als entgeltlicher Dienstverhinderungsgrund zu sehen ist oder nicht? Grundsatz Der Arbeitnehmer, unabhängig davon, ob er ein Arbeiter oder Angestellter ist, hat sich zu bemühen, seine Erledigungen außerhalb der Arbeitszeit zu verrichten. Ein entgeltlicher Dienstverhinderungs- grund kann nur dann anerkannt werden, wenn die betreffende Erledigung nicht außerhalb der Arbeits- zeit möglich und zumutbar gewesen wäre. Medieninhaber und Herausgeber: Impressum/Offenlegung: W http://wko.at/ooe/industrie/Offenlegung sparte.industrie der WKO Oberösterreich Hessenplatz 3 | 4020 Linz T 05-90909-4201 | F 05-90909-4209 BI 1 von 5 E industrie@wkooe.at | W http://wko.at/ooe/industrie
Ausgabe 03 | 10.2.2014 BILDUNG DI Helmut Hattmannsdorfer | T 05-90909-4230 Damit wird die Teilnahme an der AK-Wahl – wie ihm folgenden noch detailliert aufgezeigt – in der Regel nicht als entgeltlicher Dienstverhinderungsgrund anzusehen sein. Wahltermine der Arbeiterkammerwahl 2014 Die Arbeiterkammerwahl findet statt in Vorarlberg vom 27.1.bis 6.2.2014, in Salzburg vom 27.1 bis 7.2.2014, in Tirol vom 27.1. bis 7.2.2014, in Kärnten vom 3.3. bis 12.3.2014, in Wien vom 11.3. bis 24.3.2014, in Oberösterreich vom 18.3. bis 31.3.2014, in der Steiermark vom 27.3. bis 9.4.2014, im Burgenland vom 31.3. bis 9.4.2014, in Niederösterreich vom 6.5. bis 19.5.2014. Die Wahllokale für die AK-Wahl sind von Montag bis Freitag zu den Bürozeiten geöffnet. In der Regel werden die Wahllokale auch am Sonntag offen halten. Wahlort Innerhalb des Wahlzeitraumes kann in öffentlichen Wahllokalen, im Wahllokal im Betrieb oder per Briefwahl gewählt werden. Der Wahlort der wahlberechtigten Arbeitnehmer richtet sich nach dem Standort des Betriebes. Alle Wahlberechtigten, die dem allgemeinen Wahlsprengel zugeordnet sind, erhalten vom Wahlbüro amtswegig eine Wahlkarte, mit der im öffentlichen Wahllokal oder per Briefwahl gewählt werden kann. Die AK-Wahlen können auch in Betriebswahlsprengel abgehalten werden. Betriebswahlsprengel bedeutet, dass sich das Wahllokal direkt im Betrieb des Arbeitnehmers befindet. In den einzelnen Betriebsstätten soll sich die Stimmabgabe nicht über mehr als 3 Tage erstrecken, sofern nicht zur ordnungsgemäßen Durchführung der Wahl im Hinblick auf die Struktur des Betriebes eine längere Dauer notwendig ist. Wahlberechtigte eines Betriebswahlsprengels, die sich an den Wahltagen voraussichtlich außerhalb ihres Wahlsprengels aufhalten, haben auf Antrag Anspruch auf Ausstellung einer Wahlkarte. Die Wahlkarte berechtigt zur Stimmabgabe auf postalischem Weg. Medieninhaber und Herausgeber: Impressum/Offenlegung: W http://wko.at/ooe/industrie/Offenlegung sparte.industrie der WKO Oberösterreich Hessenplatz 3 | 4020 Linz T 05-90909-4201 | F 05-90909-4209 BI 2 von 5 E industrie@wkooe.at | W http://wko.at/ooe/industrie
Ausgabe 03 | 10.2.2014 BILDUNG DI Helmut Hattmannsdorfer | T 05-90909-4230 Vorgangsweise in der Praxis Grundsätzlich sollte ein Arbeitgeber die Dienstnehmer auffordern in der Mittagspause wählen zu ge- hen. Weiters ist zu berücksichtigen, dass eine Wahlmöglichkeit an mehreren Tagen besteht. Endet die Arbeitszeit in manchen Betrieben am Freitagmittag, so hat der Arbeitnehmer jedenfalls an den Freitagnachmittagen die Möglichkeit, außerhalb seiner Arbeitszeit wählen zu gehen. Wohnt der Arbeitnehmer in der Nähe seines Betriebes, hat er auch am Sonntag die Möglichkeit, seine Stimme im öffentlichen Wahllokal abzugeben. Bestehen solche Möglichkeiten nicht, hat der Arbeitgeber zu prüfen, ob ein Dienstverhinderungsgrund unter Fortzahlung des Entgelts vorliegt. Bei Angestellten wäre das der Fall. Bei Arbeitern ist entschei- dend, ob es einen Arbeiterkollektivvertrag gibt und dieser einen entsprechenden Dienstverhinderungs- grund vorsieht. Ist ein Arbeitgeber verpflichtet im Betrieb ein Wahllokal aufzustellen? Ein Arbeitgeber kann nicht gezwungen werden, in seinem Betrieb ein Wahllokal zu errichten. In großen Betrieben ist es von der Organisation jedoch zu überlegen, einen solchen Betriebswahlsprengel einzu- führen. In diesen Fällen wäre die Zeit für die Stimmabgaben der wahlberechtigten Arbeitnehmer im Betrieb minimal. Tätigkeit von Funktionären sowie Mitgliedern von Wahlkommissionen Der Arbeitgeber ist verpflichtet, den als Kammerräten tätigen Arbeitnehmern die zur Erfüllung ihrer Obliegenheiten als Funktionäre der Arbeiterkammer erforderliche Freizeit zu gewähren. Ebenso ist den Arbeitnehmern vom Arbeitgeber die zur Tätigkeit als Mitglied in Wahlkommissionen erforderliche Freizeit einzuräumen. Ein Anspruch auf Fortzahlung des Entgelts durch den Arbeitgeber für diesen Per- sonenkreis ist im Gesetz nicht vorgesehen. 3. Berechnung von Überstundenentlohnungen Der VwGH hat in einer aktuellen Entscheidung zur Frage der Ermittlung der Überstundengrundvergü- tung und damit zur Höhe des Überstundenentgeltes für die KV’s der Eisen- und Metallerzeugenden und verarbeitenden Industrie (E/M KV’s) Stellung genommen (VwGH vom 11.12.2013, Zl. 2012/08/0217). Sachverhalt: Die E/M KV’s der Industrie sehen vor, dass bei Berechnung der Überstundengrundvergütung ein für die Arbeitnehmer günstigerer Teiler von 1/143 statt 1/167 (bei einer 38,5-Stunden Woche; das entspricht einer Verbesserung von 16,8 Prozent) angewendet wird und außerdem teilweise 100 prozentige statt Medieninhaber und Herausgeber: Impressum/Offenlegung: W http://wko.at/ooe/industrie/Offenlegung sparte.industrie der WKO Oberösterreich Hessenplatz 3 | 4020 Linz T 05-90909-4201 | F 05-90909-4209 BI 3 von 5 E industrie@wkooe.at | W http://wko.at/ooe/industrie
Ausgabe 03 | 10.2.2014 BILDUNG DI Helmut Hattmannsdorfer | T 05-90909-4230 50 prozentige Zuschläge (je nach zeitlicher Lagerung) gewährt werden. Bei der Berechnung der Über- stundengrundvergütung werden jedoch Zulagen und Zuschläge (mit Ausnahme des Vorarbeiterzuschla- ges) nicht miteinbezogen (siehe Abschnitt XIV Punkt 13). Ein Mitgliedsunternehmen des E/M-Bereiches hat sich KV-konform verhalten und demgemäß Zulagen bzw. Zuschläge nicht in die Überstundengrundvergütung einbezogen. Die Versicherungsanstalt für Eisenbahnen und Bergbau sah darin einen Verstoß gegen §10 Abs3 AZG (wonach der Berechnung des gesetzlichen 50 prozentigen Überstundenzuschlages der auf die einzelne Arbeitsstunde entfallende Normallohn zugrunde zulegen ist, worunter nach ständiger Rechtsprechung alle Entgeltteile zu verstehen sind, die der Arbeitnehmer für die betreffende Arbeit auch während der Normalarbeitszeit bekommen hat, da es sich bei Überstunden um eine „Fortsetzung der Normalar- beitszeit“ handelt) und forderte das Unternehmen zur Nachzahlung von Sozialversicherungsbeiträgen auf. Das Mitgliedsunternehmen hat gegen diese bescheidmäßig vorgenommene Aufforderung der Nach- zahlung von SV-Beiträgen – mit argumentativer Unterstützung durch die Landeskammer bzw. die BSI – sämtliche Rechtsmittel ausgeschöpft, wobei nunmehr der VwGH erfreulicherweise dem Mitgliedsunter- nehmen Recht gegeben hat. Zur Beurteilung stand somit die Gültigkeit der kollektivvertraglichen Regelung (Überstundengrundver- gütung in der Höhe von 1/143 ohne Zulagen, im Einzelfall auch 100 prozentige Überstundenzuschläge) gegenüber der gesetzlichen Regelung (Überstundengrundvergütung in der Höhe von bloß 1/167 zuzüg- lich Zulagen, aber nur 50 prozentiger Überstundenzuschlag). Entscheidungsbegründung des VwGH: Der VwGH ging von seiner bisherigen Rechtsprechung ab und schloss sich der jüngsten OGH-Judikatur an, wonach davon auszugehen ist, dass es bei kollektivvertraglicher Vereinbarung eines günstigeren Überstundenteilers grundsätzlich zulässig ist, Zulagen und Zuschläge aus der Berechnungsgrundlage für Überstundenzuschläge auszuschließen (siehe OGH vom 27.06.2007, 8 Ob A 82/06a; siehe auch Pfeil in ZellKomm. ², Rz 10 und 12 zu §10 AZG mwH). Voraussetzung dafür ist jedoch, dass diese Regelung im Ergebnis dazu führt, dass die Arbeitnehmer höhere Überstundenentlohnungen erhalten als bei Anwendung der gesetzlichen Re- gelung (sogenannter Günstigkeitsvergleich). Mit dieser Entscheidung ist die bislang bestehende Judikaturdivergenz zwischen VwGH und OGH besei- tigt. Ergebnis für den Industriebereich Im E/M-Bereich wird der Günstigkeitsvergleich zwischen kollektivvertraglicher und gesetzlicher Rege- lung nicht nur bei 100%-igen, sondern oftmals auch bei bloß 50 prozentigen Überstundenzuschlägen eine Besserstellung des Arbeitnehmers durch Anwendung der kollektivvertraglichen Berechnungsme- thode bewirken: Die Begünstigung der Berechnung des Überstundengrundlohnes durch Anwendung des Divisors 1/143 bewirkt einen Vorteil von 16,8 Prozent (Verhältnis von 167 zu 143) sodass die Nichtbe- rücksichtigung von Zulagen und Zuschlägen oftmals nicht ins Gewicht fällt. So machen beispielsweise Medieninhaber und Herausgeber: Impressum/Offenlegung: W http://wko.at/ooe/industrie/Offenlegung sparte.industrie der WKO Oberösterreich Hessenplatz 3 | 4020 Linz T 05-90909-4201 | F 05-90909-4209 BI 4 von 5 E industrie@wkooe.at | W http://wko.at/ooe/industrie
Ausgabe 03 | 10.2.2014 BILDUNG DI Helmut Hattmannsdorfer | T 05-90909-4230 die SEG-Zulagen im Bereich der E/M KV’s (bezogen auf die Grundstufe der Beschäftigungsgruppe A) nur knapp 5 Prozent der Entlohnung aus. Anzumerken ist weiters, dass es neben den kollektivvertraglich geregelten Zulagen und Zuschlägen auch noch betrieblich vereinbarte Zulagen und Zuschläge gibt, die ebenfalls heranzuziehen sind. Es ist daher im E/M-Bereich bei 50 prozentigen Überstundenzuschlägen im Einzelfall zu prüfen, ob kol- lektivvertraglich und betrieblich gewährte Zulagen und Zuschläge 16,8 Prozent erreichen bzw. über- steigen, da in diesen Fällen die gesetzliche Regelung besser wird. Für die anderen Kollektivvertragsbereiche der Industrie kann keine einheitliche Aussage getroffen wer- den, da vielfach kein begünstigter Überstundenteiler (Divisor) besteht bzw. Zulagen ohnehin in die Be- rechnungsgrundlage der Überstunden einbezogen werden. Hier ist eine genaue Prüfung je nach kollek- tivvertraglicher Regelung erforderlich, wobei bei 100 prozentigen Überstundenzuschlägen jedenfalls eine günstigere KV-Regelung vorliegt. Zusammenfassend ist daher festzuhalten, dass KV-Regelungen, die die Nichteinbeziehung von Zulagen und Zuschlägen in die Überstundengrundvergütung vorsehen, im Sinne des Günstigkeitsvergleiches weiterhin anwendbar bleiben, solange der Vorteil eines „besseren“ Überstundenteilers (bzw. des kol- lektivvertraglich vorgesehenen 100 prozentigen Überstundenzuschlages) eine Besserstellung der Ar- beitnehmer betreffend ihrer konkreten Überstundenentlohnung bewirkt. Zwecks Vermeidung gewohnheitsrechtlicher Ansprüche der Arbeitnehmer ist künftig Folgendes zu beachten: Unternehmen, die bisher in Befolgung der alten Rechtsmeinung des VwGH eine zu hohe Überstunden- grundvergütung ermittelt haben (z.B. im E/M-Bereich bei 50 prozentiger Überstundenentlohnung den Überstundengrundlohn mit 1/143 zuzüglich von Zulagen und Zuschlägen ermittelt haben) sollten diese Berechnung überdenken, da eine Fortführung dieses (aufgrund der nunmehr geklärten Rechtslage) freiwilligen Überhanges als Besserstellung verbunden mit dem Entstehen eines gewohnheitsrechtlichen Anspruches zu werten wäre. 4. Annonce DI (FH) 42 Jahre, Techniker-Betriebswirt, 22 Jahre Berufserfahrung (Projektmanagement, Innovations- management, Prozess- und Qualitätsmanagement, 10 Jahre Konstruktion 3D CAD), sehr affin mit be- triebswirtschaftlichem Zahlenwerk, sehr flexibel, hoch motiviert, belastbar, verantwortungsbereit mit teamförderndem Führungsstil, sucht neue Herausforderung im Zentralraum OÖ. Sehr gute Englisch- kenntnisse und Reisebereitschaft können vorausgesetzt werden. Nähere Informationen: Irina Haghofer, WKO Oberösterreich, Hessenplatz 3, 4020 Linz, T 05-90909-4231, E irina.haghofer@wkooe.at Medieninhaber und Herausgeber: Impressum/Offenlegung: W http://wko.at/ooe/industrie/Offenlegung sparte.industrie der WKO Oberösterreich Hessenplatz 3 | 4020 Linz T 05-90909-4201 | F 05-90909-4209 BI 5 von 5 E industrie@wkooe.at | W http://wko.at/ooe/industrie
Ausgabe 03 I 10.2.2014 ENERGIE Mag. DI Johann Baldinger | T 05-90909-4251 1. EU-Energie- und Klimapolitik schickt Industrie “in die Wüste” Mit Unverständnis reagiert Erich Frommwald, Energiesprecher der sparte.industrie der WKO Oberöster- reich, auf den Beschluss des Europäischen Parlaments, wonach die Vorschläge der EU-Kommission zum klima- und energiepolitischen Rahmen bis 2030 noch verschärft werden sollen. „Sollten auch die Staats- und Regierungschefs beim Europäischen Rat im März das überambitionierte Ziel zur Treibhaus- gas-Reduktion von minus 40 Prozent akzeptieren, riskiert man Betriebs-Absiedlungen und Arbeitslosig- keit in Europa“, warnt Frommwald. Frommwald befürchtet, dass durch einseitige Verschärfungen der Klimaziele in Europa die Wettbe- werbsfähigkeit bisher erfolgreicher Wirtschaftszweige massiv gefährdet wird. „Wir stehen vor dem Horrorszenario: Zuerst gehen notwendige Investitionen verloren, dann ganze Betriebsstand-orte und mit ihnen zehntausende Arbeitsplätze.“ Außerdem würden durch das nun anvisierte Reduktionsziel in der EU positive Effekte auf das Welt- klima ausbleiben. „Die bei uns durch Klimaschutzkosten zu teuer gewordenen, energietechnisch aus- gereizten Produktionsbetriebe müssten in andere Weltgegenden ausweichen und würden dort gleich große oder sogar größere Mengen an Treibhausgase emittieren.“ Deshalb brauche es ein internationa- les Klima-Abkommen, das auch die größten Emittenten USA und China ein-bezieht. „Wenn Unternehmen in Österreich bleiben und hier auch vermehrt investieren sollen, brauchen wir Rahmenbedingungen, die ihre Innovations- und Investitionskraft in Österreich stärken. Leider ist das Votum ein Schritt in die Gegenrichtung“, so Frommwald. 2. EU-Klima- und Energiepolitik 2030 Die Europäische Kommission hat den „Rahmen für die Klima- und Energiepolitik im Zeitraum 2020 – 2030“ präsentiert. Nachfolgend eine erste Zusammenfassung und Einschätzung der WKÖ: EINLEITUNG EU-Kommissionspräsident Barroso und die EU-Kommissare Oettinger und Hedegaard haben am 22. Jän- ner einen neuen Rahmen für die europäische Klima- und Energiepolitik bis 2030 vorgestellt. Hauptziel ist die Senkung der Treibhausgasemissionen um 40 Prozent unter den Stand von 1990. Weiters wird ein EU-weites Ziel für den Anteil erneuerbarer Energien von 27 Prozent vorgeschlagen. Die Vorschläge der Kommission dienen als Grundlage für die Diskussion der Staats- und Regierungs- chefs beim Europäischen Rat am 20. / 21. März in Brüssel. Davor gibt es Aussprachen der Umwelt- so- wie Wirtschaftsminister in ihren Ministerräten. Medieninhaber und Herausgeber: Impressum/Offenlegung: W http://wko.at/ooe/industrie/Offenlegung sparte.industrie der WKO Oberösterreich Hessenplatz 3 | 4020 Linz EN 1 von 7 T 05-90909-4201 | F 05-90909-4209 E industrie@wkooe.at | W http://wko.at/ooe/industrie
Ausgabe 03 I 10.2.2014 ENERGIE Mag. DI Johann Baldinger | T 05-90909-4251 ECKPUNKTE DES KLIMA-ENERGIE-PAKETS Das vorgeschlagene -40 Prozent CO2-Ziel bedeutet im Emissionshandel ein Ziel von -43 Prozent. Das wiederum verlangt ab 2020 einen ETS-„Cap“ von 2,2 statt derzeit 1,74. Die gesamte Reduktion soll EU-intern erreicht werden. Im non-ETS bedeutet das 40 Prozent-Ziel eine Reduktion von -30 Prozent EU-weit. Österreich müsste, sollte der Aufteilungsschlüssel ähnlich bleiben, im letzteren Bereich natürlich deutlich mehr machen. Allerdings rechnet das Impact Assessment mit einem österreichischen non-ETS-Ziel von -27 Prozent bis -32 Prozent. Das 27 Prozent-Erneuerbaren-Ziel ist zwar auf EU-Ebene „verbindlich“, soll aber nicht durch die ErneuerbarenRL auf MS heruntergebrochen werden. Stattdessen wurde eine neue Gouvernance- Struktur vorgeschlagen, die auf nationalen Plänen beruht. Wie die Zielerreichung garantiert werden soll, ist offen. Wie erwartet präsentierte die Kommission zu Energieeffizienz wenig Konkretes. Nach der Über- prüfung der EnergieeffizienzRL könnten im Herbst weitere Schritte folgen. Neuer legislativer Vorschlag zu Reform des ETS ab 2020 wie angekündigt –> Marktstabilitätsreserve, die das Angebot an Zertifikaten noch festgelegten Regeln automatisch anpasst. „Schlüsselindikatoren“ zu Wettbewerbsfähigkeit & Versorgungssicherheit. DIE VORSTELLUNGEN DER EU-KOMMISSION (auf Basis der EK-TEXTE): Ein verbindliches Ziel für die EU und die MS für die Reduktion der Treibhausgasemissionen: Das Ziel einer Emissionssenkung um 40 Prozent unter den Stand von 1990 ist das Kernstück der Energie- und Klimapolitik der EU bis 2030 und soll ausschließlich durch EU-interne Maßnahmen er- reicht werden. Die jährliche Senkung der Obergrenze („Cap“) für die Emissionen aus den unter das EU-ETS fallenden Wirtschaftszweigen würde von derzeit 1,74 Prozent auf 2,2 Prozent für die Zeit nach 2020 angehoben. Die Emissionen aus nicht unter das EU-Emissionshandelssystem fallenden Wirtschaftszweigen müss- ten um 30 Prozent unter den Stand von 2005 gesenkt werden, wobei diese Anstrengungen auf die Mitgliedstaaten verteilt würden. Die Kommission ersucht den Rat und das Europäische Parlament, sich bis Ende 2014 darauf zu einigen, dass sich die EU im Zuge der internationalen Verhandlungen über ein Ende 2015 in Paris zu schließendes neues Weltklimaabkommen Anfang 2015 zu einer Re- duktion um 40 Prozent verpflichten sollte. Ein verbindliches, EU-weites Ziel für erneuerbare Energien: Erneuerbare Energien werden beim Übergang zu einem wettbewerbsorientierten, sicheren und nachhaltigen Energiesystem eine wesentliche Rolle spielen. Ein verbindliches, EU-weites Ziel für einen Anteil der erneuerbaren Energien von mindestens 27 Prozent bis zum Jahr 2030 auf der Grundlage eines stärker marktorientierten Konzepts, das die erforderlichen Rahmenbedingungen für neu aufkommende Technologien bietet, hat wesentliche Vorteile für die Energiehandelsbilanz, die eigenständige Versorgung aus heimischen Energiequellen, die Beschäftigung und das Wachstum. Ein EU-weites Ziel für erneuerbare Energien ist erforderlich, um Impulse für weitere Investitionen in diesen Sektor zu geben. Medieninhaber und Herausgeber: Impressum/Offenlegung: W http://wko.at/ooe/industrie/Offenlegung sparte.industrie der WKO Oberösterreich Hessenplatz 3 | 4020 Linz EN 2 von 7 T 05-90909-4201 | F 05-90909-4209 E industrie@wkooe.at | W http://wko.at/ooe/industrie
Ausgabe 03 I 10.2.2014
ENERGIE Mag. DI Johann Baldinger | T 05-90909-4251
Eine Aufteilung in nationale Ziele durch EU-Rechtsvorschriften ist allerdings nicht vorgesehen, da-
mit die Mitgliedstaaten über die notwendige Flexibilität verfügen, um das Energiesystem so umzu-
bauen, dass es den nationalen Präferenzen und Gegebenheiten angepasst ist. Die Verwirklichung
des EU-Ziels für erneuerbare Energien würde durch die neu geregelte Governance sichergestellt,
die auf nationalen Energieplänen beruhen soll (siehe unten).
Energieeffizienz:
Eine verbesserte Energieeffizienz trägt zu allen Zielen der EU-Energiepolitik bei; ohne sie ist ein
Übergang zu einem wettbewerbsorientierten, sicheren und nachhaltigen Energiesystem nicht mög-
lich. Die Rolle der Energieeffizienz im Rahmen für die Politik bis 2030 wird bei der Überprüfung der
Richtlinie über Energieeffizienz, die im Laufe des Jahres abgeschlossen werden soll, näher betrach-
tet. Die Kommission wird sich nach Abschluss der Überprüfung damit befassen, ob die Richtlinie
möglicherweise geändert werden muss. Die nationalen Energiepläne der Mitgliedstaaten müssen
darüber hinaus auch die Energieeffizienz einbeziehen.
Reform des EU-ETS:
Die Kommission schlägt vor, zu Beginn des neuen EU-ETS-Handelszeitraums im Jahr 2021 eine
Marktstabilitätsreserve einzuführen. Die Reserve wäre auf den in den letzten Jahren entstandenen
Überschuss an Emissionszertifikaten gerichtet und würde gleichzeitig die Resilienz des Systems ge-
gen größere Schocks stärken, indem sie das Angebot an zu versteigernden Zertifikaten automatisch
anpasst. Die Einrichtung einer solchen Reserve zusätzlich zu der jüngst beschlossenen Verschiebung
der Versteigerung von 900 Millionen Zertifikaten auf 2019-2020 („Back-loading“) wird von einer
Vielfalt von Beteiligten befürwortet. Nach den heute vorgeschlagenen Rechtsvorschriften würde
die Reserve vollständig nach vorab festgelegten Regeln funktionieren, die der Kommission oder den
Mitgliedstaaten bei der Anwendung keinen Ermessensspielraum lassen.
Wettbewerbsorientierte, erschwingliche und sichere Energie:
Die Kommission schlägt einen neuen Satz von Schlüsselindikatoren zur Bewertung der im Lauf der
Zeit erzielten Fortschritte vor, um eine Faktenbasis für etwaige politische Initiativen zu schaffen.
Diese Indikatoren beziehen sich beispielsweise auf das Energiepreisgefälle zwischen der EU und
wichtigen Handelspartnern, die Diversifizierung der Versorgung und die eigenständige Versorgung
aus heimischen Energiequellen sowie auf die Verbindungskapazitäten von Mitgliedstaaten.
Anhand dieser Indikatoren wird die Politik bis 2030 für ein wettbewerbsorientiertes, sicheres Ener-
giesystem sorgen, das sich weiterhin auf Marktintegration, Diversifizierung der Energieversorgung,
stärkeren Wettbewerb, die Entwicklung der heimischen Energiequellen sowie auf die Förderung von
Forschung, Entwicklung und Innovation stützt.
Ein neu geregelte Governance:
Im Rahmen für die Politik bis 2030 wird eine neu geregelte Governance auf der Grundlage nationa-
ler Pläne für eine wettbewerbsorientierte, sichere und nachhaltige Energieversorgung vorge-
schlagen. Anhand der in Vorbereitung befindlichen Leitlinien der Kommission erarbeiten die Mit-
gliedstaaten diese Pläne nach einem gemeinsamen Konzept, das mehr Investitionssicherheit und
mehr Transparenz gewährleistet und die Kohärenz, EU-weite Koordinierung und Überwachung ver-
bessert. Ein iterativer Prozess zwischen der Kommission und den Mitgliedstaaten gewährleistet,
dass die Pläne hinreichend ehrgeizig sowie langfristig kohärent und regelkonform sind.
Medieninhaber und Herausgeber: Impressum/Offenlegung: W http://wko.at/ooe/industrie/Offenlegung
sparte.industrie der WKO Oberösterreich
Hessenplatz 3 | 4020 Linz EN 3 von 7
T 05-90909-4201 | F 05-90909-4209
E industrie@wkooe.at | W http://wko.at/ooe/industrieAusgabe 03 I 10.2.2014 ENERGIE Mag. DI Johann Baldinger | T 05-90909-4251 Die Mitteilung über den Rahmen für die Politik bis 2030 wird von einem Bericht über Energiepreise und -kosten begleitet, in dem die wichtigsten Preis- und Kostentreiber bewertet und die Preise in der EU mit denen ihrer wichtigsten Handelspartner verglichen werden. Seit 2008 sind die Energiepreise in beinahe jedem Mitgliedstaat gestiegen vor allem aufgrund von Steuern und Abgaben, aber auch wegen höherer Netzkosten. Der Vergleich mit den internationalen Partnern verdeutlicht ein wachsendes Preisgefälle, namentlich im Hinblick auf die Erdgaspreise in den USA, das die Wettbewerbsfähigkeit Europas und vor allem der energieintensiven Branchen untergraben könnte. Die steigenden Energiepreise können aber zum Teil durch eine kosteneffiziente Energie- und Klimapo- litik, wettbewerbsorientierte Energiemärkte und Maßnahmen zur Steigerung der Energieeffizienz (zB Nutzung energieeffizienterer Erzeugnisse) ausgeglichen werden. Die Industrie in der EU muss möglich- erweise unter Beachtung physikalischer Grenzen weitere Anstrengungen auf dem Gebiet der Energie- effizienz unternehmen, da die Konkurrenz dies ebenfalls tut und die EU-Unternehmen beschließen, Investitionen im Ausland zu tätigen, um näher bei expandierenden Märkten zu sein. Diese Feststellun- gen sind in den Rahmen für die Politik bis 2030 eingeflossen. Die Wirtschaftskammer Österreich spricht sich vehement gegen ein EU-Treibhausgasreduktionsziel von -40 Prozent aus. Bestätigen die Staats- und Regierungschefs im März das überambitionierte Reduktionsziel, verabschiedet sich Europa auf lange Zeit vom eigentlich angestrebten Wachstumspfad. Zuerst gehen dringend notwendige Investitionen verloren, dann Betriebsstandorte und mit ihnen Zehntausende Arbeitsplätze. Energietechnisch weitgehend ausgereizte Betriebe haben keine technologischen Möglichkeiten, ihre Emissionen nennenswert zu verringern. Sie wären somit gezwungen, immer größere Mengen Zertif- ikate zuzukaufen, zu Preisen die ein Vielfaches des heutigen betragen. Anstatt die Wettbewerbsfähigkeit der Industrie durch immer neue Verschärfungen der Klimaziele zu belasten, muss ihr Innovations- und Investitionspotenzial gestärkt werden. Auch der Klimaschutz hat nichts von klimapolitischen Alleingängen, denn die bei uns durch Klimaschutzkosten zu teuer gewordenen, energietechnisch ausgereizten Produktionsbetriebe müssen in andere Weltgegenden ausweichen und werden dort gleich oder sogar größere Mengen an Treibhausgase emittieren. Die WKÖ begrüßt, dass vor 2020 keine weiteren Eingriffe in den Emissionshandel geplant sind und dass sie Carbon Leakage Regelungen bis dahin unverändert bleiben. Allerdings sehen wir die vorgeschlagene „Reform“ des ETS durch die Marktstabilitätsreserve sehr kritisch, da sie ein „permanentes Backloading“ ermöglicht. DIE FORDERUNGEN DER UP ZUR KLIMA- UND ENERGIEPOLITIK (auf Basis der WKÖ–Antwort zur Grünbuch-Konsultation 2013): Die Re-Industrialisierung Europas als Ziel festschreiben Das generelle Wachstums- und Beschäftigungsziel der Europäischen Union muss von künftigen klima- und energiepolitischen Überlegungen unterstützt werden. Europa soll die Blaupause für ein globalisierungsfähiges, hochkompetitives, prosperierendes, CO2-armes Wirtschaftsmodell liefern. Medieninhaber und Herausgeber: Impressum/Offenlegung: W http://wko.at/ooe/industrie/Offenlegung sparte.industrie der WKO Oberösterreich Hessenplatz 3 | 4020 Linz EN 4 von 7 T 05-90909-4201 | F 05-90909-4209 E industrie@wkooe.at | W http://wko.at/ooe/industrie
Ausgabe 03 I 10.2.2014
ENERGIE Mag. DI Johann Baldinger | T 05-90909-4251
Die europäischen Industrieunternehmen tragen dazu bei, dass innovative, CO2-arme Technologien
mit Wertschöpfungseffekten in der EU entstehen. Die Re-Industrialisierung Europas muss daher ne-
ben klima- und energiepolitischen Zielen ein gleichberechtigtes Ziel werden und der Anteil der pro-
duzierenden Unternehmen in Europa wieder steigen! Die De-Industrialisierung schwächt Europa
und ist zu stoppen.
„Standortgarantie“ als Schutz vor carbon leakage
Solange eine internationale CO2-Kostenschieflage besteht, braucht es – als Standortgarantie - eine
garantierte Zuteilung von 100 Prozent Gratiszertifikaten an effizient produzierende energieinten-
sive Betriebe (Schutz vor „carbon leakage“). Eine Standortgarantie für effiziente, energieintensive
Unternehmen soll dazu beitragen, dass diese Unternehmen wieder in Europa investieren. Konkret
bedeutet das:
Carbon leakage Schutz wird nicht alle fünf Jahre überprüft, sondern besteht bis zum Gleichzie-
hen anderer Wirtschaftsräume bei den CO2-Kosten der Industrie.
Carbon leakage Betriebe, die CO2-effizient produzieren („Benchmark“), erhalten für 100 Pro-
zent ihres Bedarfs Gratiszertifikate, ohne nachträgliche Abschläge.
Weltweiten Klimaschutz ausbauen - keine Verschärfungen des EU Alleingangs
Die WKÖ unterstützt das Ziel der EU, ein umfassendes globales Klimaschutzabkommen zu erreichen,
das auch die größten Emittenten USA und China einbindet. Gleichzeitig lässt das einseitige Redukti-
onsziel der „Low-Carbon Roadmap“ von -40 Prozent bis 2030 außer Acht, dass einige Mitgliedstaa-
ten Atomenergie ablehnen und CCS per Gesetz verboten haben. Wir sprechen uns daher vehement
gegen weitere klimapolitischer Alleingänge der EU aus, die die europäische Wirtschaft einseitig
mit Kosten belasten und eine Abwanderung CO2-intensiver Produktion aus Europa forcieren.
EU-ETS muss marktwirtschaftliches Instrument bleiben – Reinvestition statt planwirtschaftlicher
Intervention
Der EU-Emissionshandel hat „auf kosten- und wirtschaftlich effiziente Weise auf eine Verringerung
von Treibhausgasemissionen hinzuwirken.“ Eine Fokussierung auf den CO2-Preis (anstelle von CO2-
Reduktion) - die sich in den Ideen zu Eingriffen in den Emissionshandel niederschlägt - überlagert
das ursprüngliche Ziel der Effizienz und erzeugt hohe Unsicherheit. Derzeit werden Auktionseinnah-
men nicht verbindlich reinvestiert sondern fließen in das allgemeine Budget der Mitgliedstaaten.
Auktionserlöse müssen für die Entwicklung kohlenstoffarmer Produktionstechnologien zweck-
gebunden werden.
Wettbewerbsfähige Energiepreise und Versorgungssicherheit garantieren
Eine kostenoptimierte, nachhaltige und gesicherte Energieversorgung muss gewährleistet werden.
Das Ziel müssen wettbewerbsorientierte Energiemärkte sowie international wettbewerbsfähige und
für den Verbraucher erschwingliche Energiepreise sein. Die um ein Vielfaches höheren Gaspreise im
Vergleich zur USA sind ein gravierender Nachteil für den Produktionsstandort Europa und führen zur
Abwanderung europäischer Industriebetriebe. Das Energiepreisgefälle zur USA ist einzuebnen.
Medieninhaber und Herausgeber: Impressum/Offenlegung: W http://wko.at/ooe/industrie/Offenlegung
sparte.industrie der WKO Oberösterreich
Hessenplatz 3 | 4020 Linz EN 5 von 7
T 05-90909-4201 | F 05-90909-4209
E industrie@wkooe.at | W http://wko.at/ooe/industrieAusgabe 03 I 10.2.2014 ENERGIE Mag. DI Johann Baldinger | T 05-90909-4251 Erneuerbare Energien kosteneffizient ausbauen Die WKÖ spricht sich für den weiteren Ausbau von erneuerbaren Energiequellen aus. Allerdings muss auf eine sinnvolle und kosteneffiziente Einbettung in das Gesamtsystem geachtet werden. Die Förderregime sind zu harmonisieren, die Leitungsinfrastruktur muss ausgebaut werden. Der Ener- giebinnenmarkt ist zu vollenden. Erst mit diesen Voraussetzungen lassen sich weitere Ziele beim Ausbau der Erneuerbaren kosteneffizient erreichen. Der Wettlauf der Fördersysteme für Erneuer- bare ist zu beenden. Gesondertes Energiesparziel für 2030 entbehrlich Der Verbesserung der Energieeffizienz kommt eine zentrale Bedeutung zu. An ein europaweit ver- bindliches Energiespar-Ziel bis 2030 sollte jedoch nicht gedacht werden, da es den Spielraum für ökonomische Maßnahmengestaltung einschränkt. Ein starrer Wert als verbindliche Obergrenze des Energieverbrauchs ist wachstumsfeindlich. Weitere Informationen dazu finden Sie unter folgenden Links: http://tiny.cc/u1wuax http://tiny.cc/5zwuax http://tiny.cc/90wuax Ansprechpartner: Mag. André Buchegger Energie- und Umweltpolitik Bundessparte Industrie E andre.buchegger@wko.at 3. E-Control: Ökostromförderung setzt Regeln des Marktes außer Kraft „Das Ökostromfördersystem muss effizienter und marktorientierter werden“, weist E-Control-Vorstand Martin Graf einmal mehr auf nötige Anpassungen hin. Mit dem Fördersystem wurde der Ausbau des Ökostroms erfolgreich vorangetrieben - jetzt ist aber an der Zeit, das System nachhaltig weiterzuent- wickeln. Die derzeitigen Fördermittel könnten zukünftig noch effizienter eingesetzt werden, um die Erneuerbaren-Ziele zu erreichen. Durch die gesetzlich garantierten Einspeisetarife wurde ein marktfernes System geschaffen, das auch der Forderung der EU-Kommission nach einem marktorientierten Fördersystem widerspricht. Diese Probleme wurden in den vergangenen Jahren immer deutlicher sichtbar", erläutert Graf. Durch Ein- speisetarife erhält der Anlagenbetreiber unabhängig vom Marktpreis und den damit verbundenen Marktsignalen während eines garantierten Zeitraums für jede eingespeiste Kilowattstunde einen ge- wissen Betrag. Das Ziel der Anlagenbetreiber muss also sein, möglichst viel Strom in das öffentliche Netz einzuspeisen - unabhängig von der Nachfrage. Die Regeln des Marktes werden damit außer Kraft gesetzt. Medieninhaber und Herausgeber: Impressum/Offenlegung: W http://wko.at/ooe/industrie/Offenlegung sparte.industrie der WKO Oberösterreich Hessenplatz 3 | 4020 Linz EN 6 von 7 T 05-90909-4201 | F 05-90909-4209 E industrie@wkooe.at | W http://wko.at/ooe/industrie
Ausgabe 03 I 10.2.2014 ENERGIE Mag. DI Johann Baldinger | T 05-90909-4251 Dauerhaft erneuerbare Energien durch Einspeisetarife zu fördern, führt zu volkswirtschaftlichen Nach- teilen, da auf die Spezifika der Technologieentwicklung, die Anteile der Erneuerbaren bei der Gesam- tenergieaufbringung sowie die Marktreife nicht hinreichend eingegangen wird. In Europa wird umfas- send über die Weiterentwicklung der Förderungen für erneuerbare Energien diskutiert; Österreich könnte hier nachhaltige und marktnahe Lösungen entwickeln. Investitionsförderungen, aber auch Aus- schreibemodelle oder steuerliche Anreize könnten den weiteren Ausbau der erneuerbaren Energien marktnah einen neuen Impuls geben. Es geht um die Weiterentwicklung des Ökostroms in Österreich, hier ist das beste und kosteneffizienteste Modell zu entwickeln und umzusetzen. 4. Erneuerbare Energien: Jobkahlschlag geht weiter Solar- und Windkraft betroffen - Experten zeichnen düsteren Ausblick Das Jobwunder durch die erneuerbaren Energien bleibt weiter aus, wobei der Stellenabbau sogar noch weiter gehen soll. Einer Analyse des Statistischen Bundesamtes und des Bundesamtes der Solarwirt- schaft (BSW) http://solarwirtschaft.de nach waren vorläufigen Zahlen zufolge im November 2013 über 4.800 Menschen in der Herstellung von Solarzellen und Solarmodulen beschäftigt. Das sind etwa 2.700 oder ein Drittel weniger als im Jahr davor. 2012 hatten noch rund 10.000 Menschen in der Branche ge- arbeitet. Der BSW bestätigte die Abwärts-Entwicklung der Branche, verwies jedoch auf andere Zahlen. Danach sollen 2011 einer Studie des Wirtschaftsprüfers Prognos http://prognos.comnd 22.000 Vollzeitstellen in der Produktion von Solarstromanlagengegeben haben. Diese Zahl habe sich BSW-Angaben nach in den vergangenen zwei Jahren jedoch halbiert. Allein im 2012 Jahr sollen zwischen 25 und 30 Prozent der Stellen weggefallen seien. Aber auch im Wind-Bereich lässt sich dieser Trend beobachten. Laut IG- Metall-Angaben ging die Zahl der Vollzeitstellen in der Offshore-Windindustrie im vergangenen Ge- schäftsjahr um mehr als 2.000 zurück. Weitere Entlassungen seien für das laufende Jahr angekündigt. Betriebsräte in Unternehmen, die Windkraftanlagen für den Einsatz im Meer bauen, hätten von einer Auslastung der Firmen nur noch bis Mitte des Jahres berichtet. Besser sähe die Situation hingegen im Onshore-Bereich aus. 5. Veranstaltung: EU- Klima- und Energieziele 2030: Chancen und Risken für österreichische Industrie Die Wirtschaftskammer Wien lädt Sie herzlich zur Fachveranstaltung „EU- Klima- und Energieziele 2030: Chancen und Risken für die österreichische Industrie“ ein. Termin: 6. März 2014, 13:00 – 16:45 Uhr Ort: Wirtschaftskammer Wien, Großer Saal, Stubenring 8-10, 1010 Wien Weitere Infos dazu finden Sie unter http://tiny.cc/980uax Medieninhaber und Herausgeber: Impressum/Offenlegung: W http://wko.at/ooe/industrie/Offenlegung sparte.industrie der WKO Oberösterreich Hessenplatz 3 | 4020 Linz EN 7 von 7 T 05-90909-4201 | F 05-90909-4209 E industrie@wkooe.at | W http://wko.at/ooe/industrie
Ausgabe 03 | 10.2.2014 STEUERN UND FINANZEN Dr. Ernst Grafenhofer | T 05-90909-4241 1. Steuerpaket 2014 schadet der heimischen Industrie Auch wenn in der Regierungsvorlage zum Abgabenänderungsgesetz 2014 aus Sicht der sparte.industrie einige Verbesserungen zum Begutachtungsentwurf erreicht wurden, bleiben wesentliche Änderungen im Bereich der Gruppenbesteuerung jedoch aufrecht. Dies ist insbesondere für Expansionspläne in auf- strebenden Märkten wie China, Russland und Indien schädlich. Die Einschränkung der Besteuerung von freiwilligen Abfertigungen mit 6 Prozent im System „Abfertigung Alt“ soll erst ab einer monatlichen freiwilligen Abfertigung in Höhe von EUR 13.590,-- gelten. Kündigungsentschädigungen und Vergleichszahlungen hingegen sollen jetzt bis zu einem Fünftel der neunfachen Höchstbeitragsgrundlage (derzeit EUR 8.154,--) doch steuerfrei bleiben. Darüber hinaus enthält die Regierungsvorlage ein neues Betriebsausgaben-Abzugsverbot für jene sonstigen Bezüge, die beim Empfänger nicht mit 6 Prozent der Steuer unterliegen. Positiv an der Regierungsvorlage ist, dass Zins-und Lizenzzahlungen „nur“ dann nicht mehr abzugsfähig sind, wenn sie beim Empfänger einer effektiven Besteuerung von weniger als 10 Prozent unterliegen. Auch finale Verluste, die aus Betrieben oder Betriebsstätten im Ausland stammen, die bis zum 28. Februar 2014 veräußert oder aufgegeben wurden, unterliegen keiner Nachversteuerung. „ Wir müssen aber immer noch feststellen, dass die Bundesregierung keineswegs standortorientiert handelt und dem Steuerpaket nicht die Giftzähne zieht“, sagt Anette Klinger, Steuersprecherin der sparte.industrie. Nähere Ausführungen siehe Artikel: Fortsetzung Steuerpaket 2014 schadet der heimischen Industrie. Medieninhaber und Herausgeber: Impressum/Offenlegung: W http://wko.at/ooe/industrie/Offenlegung sparte.industrie der WKO Oberösterreich Hessenplatz 3 | 4020 Linz SF 1 von 7 T 05-90909-4201 | F 05-90909-4209 E industrie@wkooe.at | W http://wko.at/ooe/industrie
Ausgabe 03 | 10.2.2014
STEUERN UND FINANZEN Dr. Ernst Grafenhofer | T 05-90909-4241
2. Fortsetzung Steuerpaket 2014 schadet der heimischen Industrie
Hier finden Sie Informationen zur Regierungsvorlage zum Abgabenänderungsgesetz 2014. Aus Sicht
der Industrie sind folgende wesentlichste Änderungen im Vergleich zum Begutachtungsentwurf
erreicht worden:
Entschärfungen bei den Zins- und Lizenzzahlungen:
Zins- und Lizenzzahlungen sollen „nur“ dann nicht mehr abzugsfähig sein, wenn sie beim Empfänger
einer effektiven Besteuerung von weniger als 10 Prozent unterliegen, oder der nominelle Steuersatz
im Empfängerland unter 10 Prozent liegt (bisher war eine Halbierung zwischen 10 Prozent und 15
Prozent vorgesehen)
Geringe Verbesserungen bei Auslandsverlusten im EStG (z.B. von Betriebsstätten):
Finale Verluste, die aus Betrieben oder Betriebsstätten stammen, die bis zum 28.2.2014 veräußert
oder aufgegeben wurden unterliegen keiner Nachversteuerung
Änderungen bei der Besteuerung mit 6 Prozent beim Dienstnehmer:
entgegen den ursprünglichen Absichten (ab EUR 4.530,--) soll die Einschränkung der Besteuerung
von freiwilligen Abfertigungen mit 6 Prozent im System „Abfertigung-ALT“, nun erst ab einer mo-
natlichen freiwilligen Abfertigung iHv EUR 13.590,-- gelten. Im Gegenzug wurde der
Anwendungsbereich erweitert, da die Grenze nun auch für die sogenannte „Zwölftelregelung“
vorgesehen ist. Kündigungsentschädigungen und Vergleichszahlungen sollen jetzt bis zu einem
Fünftel der Neunfachen Höchstbeitragsgrundlage (derzeit EUR 8.154,--) doch steuerfrei bleiben
Einschränkung der Abzugsfähigkeit freiwilliger Abfertigungen beim Dienstgeber:
um dennoch dasselbe Aufkommen wie im ersten Entwurf zu erreichen (EUR 30 Millionen), soll nun
der Betriebsausgabenabzug beim Dienstgeber eingeschränkt werden
jener Betrag, der beim Dienstnehmer nicht mit 6 Prozent besteuert wird, soll mit einem Betriebs-
ausgabenabzugsverbot belegt werden (!)
Bei freiwilligen Abfertigungszahlungen an langjährige Mitarbeiter, die vor dem 1.1.2003 eingetreten
sind und sich im System „Abfertigung-ALT“ befinden, wird der Betriebsausgabenabzug daher bereits
deutlich unter EUR 100.000,-- versagt (abhängig vom Einzelfall).
Auszahlungen aufgrund von Sozialplänen sind nur dann ausgenommen, wenn der Sozialplan bereits
vor dem 1.3.2014 abgeschlossen wird.
für alle Sozialpläne die danach abgeschlossen werden gibt es – entgegen dem Regierungsprogramm -
keine Ausnahme
Medieninhaber und Herausgeber: Impressum/Offenlegung: W http://wko.at/ooe/industrie/Offenlegung
sparte.industrie der WKO Oberösterreich
Hessenplatz 3 | 4020 Linz SF 2 von 7
T 05-90909-4201 | F 05-90909-4209
E industrie@wkooe.at | W http://wko.at/ooe/industrieAusgabe 03 | 10.2.2014
STEUERN UND FINANZEN Dr. Ernst Grafenhofer | T 05-90909-4241
Normverbrauchsabgabe:
Entgegen allen gemachten Zusagen an die Wirtschaft zu Abstimmung um mit der Programmierung
der Systeme beginnen zu können, soll nun doch noch eine Differenzierung zwischen Benzin und
Dieselfahrzeugen eingeführt werden (Dieselfahrzeuge sollen schlechter gestellt werden); für Motor-
räder wird der Höchstsatz auf 20 Prozent angehoben (anstelle von 30 Prozent).
Keine Änderungen gab es u.a. in den folgenden Bereichen: pauschale Nachversteuerung bei der
Einschränkung des Kreises der ausländischen Gruppenmitglieder, pauschale Nachversteuerung bei den
ausländischen Betriebsstättenverlusten (außer den finalen Verlusten der Vergangenheit), Umstellung
der Rückstellungberechnung (steuerliche Abzinsung mit 3,5 Prozent)
3. Umsatzsteuerbetrugsbekämpfungsverordnung – Metalle in Rohformen und
Halbfertigerzeugnissen
Die Umsatzsteuerbetrugsbekämpfungsverordnung, deren übereiltes Inkrafttreten die Wirtschaftskam-
mer Österreich vehement beansprucht hat, sieht den Übergang der Steuerschuld
(Reverse Charge = RC) vom liefernden Unternehmer auf den Warenempfänger u.a. für bestimmte
Metalle in Rohformen oder als Halberzeugnisse vor.
Grundsätzlich beabsichtigt diese Verordnung (VO) vom Übergang der Steuerschuld rohe Metalle und
Lieferungen von Halberzeugnissen zu erfassen, die auf der betreffenden Produktionsstufe normaler-
weise nicht für die Endnutzung bestimmt sind. In der am 26. November 2013 veröffentlichen Verord-
nung werden diese wie folgt definiert:
Lieferungen von Metallen (aus Kapitel 71 und aus Abschnitt XV der Kombinierten Nomenklatur, ausge-
nommen Positionen 7113 bis 7118, Kapitel 73, Positionen 7411 bis 7419, 7507, 7508, 7608, Unterposi-
tion 7609 00 00 bis Position 7616, Unterpositionen 7806 00, 7907 00 00, 8007 00 80, 8101 99 90, 8102
99 00, 8103 90 90, 8104 90 00, 8105 90 00, 8106 00 90, 8107 90 00, 8108 90 60, 8108 90 90, 8109 90
00, 8110 90 00, 8111 00 90, 8112 19 00, 8112 29 00, 8112 59 00, 8112 99, Unterposition 8113 00 90,
Kapitel 82 und 83), außer diese fallen unter die Schrott-Umsatzsteuerverordnung, BGBl. II Nr.
129/2007, oder die Differenzbesteuerung nach § 24 UStG 1994 wird angewendet.
Medieninhaber und Herausgeber: Impressum/Offenlegung: W http://wko.at/ooe/industrie/Offenlegung
sparte.industrie der WKO Oberösterreich
Hessenplatz 3 | 4020 Linz SF 3 von 7
T 05-90909-4201 | F 05-90909-4209
E industrie@wkooe.at | W http://wko.at/ooe/industrieAusgabe 03 | 10.2.2014 STEUERN UND FINANZEN Dr. Ernst Grafenhofer | T 05-90909-4241 Nachstehend finden Sie die wichtigsten Fragen beantwortet, die uns in der letzten Zeit gestellt wurden und hoffen so, zumindest in vielen Fällen Klarheit schaffen zu können. Weiteres dürfen wir festhalten, dass zur Lösung von Abgrenzungsproblemen folgende Stellen kontaktiert werden können: Bei Unklarheiten, ob eine Ware (Einzelfälle) einer Unterposition der Kombinierten Nomenklatur zuzu- ordnen ist, steht die Zentrale Auskunftsstelle/Zoll des Bundesministeriums für Finanzen für eine un- verbindliche telefonische Tarifauskunft zur Verfügung: T 01-514 33-564053 F 01-514 33-5964053 Erreichbarkeit: Montag bis Freitag, 6.00 bis 22.00 Uhr Außerdem wird die WKÖ das BMF dringend darum ersuchen, das während einer Übergangsfrist alle Wirtschaftsraumzollämter für entsprechende Auskünfte zur Verfügung stehen. Nachfolgend übermitteln wir die bei uns eingegangenen FAQs: Frage 1: Welche Waren sind von der Verordnung grundsätzlich erfasst? Die nachstehende Aufstellung soll Ihnen einen Überblick geben. Wir weisen jedoch darauf hin, dass Sie wegen der Lesbarkeit und Verständlichkeit keinesfalls vollständig sein kann. Waren, die weitergehenden Bearbeitungsschritten unterzogen wurden und die schon Beschaffenheitsmerkmale der fertigen Ware aufweisen, sind nicht von der VO erfasst. Gold, Silber, Silberplattierungen auf unedlen Metallen, Goldplattierungen auf unedlen Metallen, Platin, Palladium, Rhodium, Iridium, Osmium und Ruthenium, Platinplattierungen auf edlen oder unedlen Metallen (Kapitel 71) Pulver, Rohformen, Stäbe, Drähte, Profile, Bleche und Bänder, Abfälle und Schrott Eisen und Stahl (Kapitel 72) Masseln, Blöcke, Rohformen, Pellets, Halbzeug, Coils, flachgewalzte Erzeugnisse nicht in Coils, flachgewalzte Erzeugnisse plattiert oder überzogen, Walzdraht, Stabstahl, Profile (z. B. U, H, I, L, T …), Draht (auch mit unedlen Metallen überzogen) Kupfer, Kupfer-Zink-Legierungen (Messing) und Kupfer-Zinn-Legierungen (Bronze), Kupfervorlegierungen (Kapitel 74) Kupferkathoden (auch Abschnitte), Barren, Knüppel, Rohformen, Pulver, Stangen, Stäbe, Profile, Draht, Bleche, Bänder, Folien und dünne Bänder Nickel und Nickellegierungen (Kapitel 75) Rohformen, Pulver, Stangen, Stäbe, Profile, Draht, Bleche, Bänder, Folien Aluminium (Kapitel 76) Rohformen, Pulver, Stangen, Stäbe, Profile, Hohlprofile, Draht, Bleche, Bänder, Folien und dünne Bänder Medieninhaber und Herausgeber: Impressum/Offenlegung: W http://wko.at/ooe/industrie/Offenlegung sparte.industrie der WKO Oberösterreich Hessenplatz 3 | 4020 Linz SF 4 von 7 T 05-90909-4201 | F 05-90909-4209 E industrie@wkooe.at | W http://wko.at/ooe/industrie
Ausgabe 03 | 10.2.2014 STEUERN UND FINANZEN Dr. Ernst Grafenhofer | T 05-90909-4241 Blei (Kapitel 78) Rohformen, Pulver, Platten, Bleche, Bänder, Folien Zink und Zinklegierungen (Kapitel 79) Rohformen, Staub und Pulver, Stangen, Stäbe, Profile, Draht, Bleche, Bänder, Folien Zinn und Zinnlegierungen (Kapitel 80) Rohformen, Stangen, Stäbe, Profile, Draht, Bleche, Bänder Titan, Wolfram, Molybdän, Tantal (Kapitel 81) Rohformen, Pulver, Stangen, Stäbe, Draht, Profile, Bleche, Bänder, Folien Magnesium (Kapitel 81) Rohformen, Drehspäne, Körner Cobaltmetalle (Kapitel 81) Zwischenerzeugnisse der Cobaltmetallurgie, Rohformen, Pulver Andere unedle Metalle z.B. Bismut, Cadmium, Zirconium, Antimon, Chrom, Beryllium, Germanium, Vanadium, Gallium, Hafnium u.v.m. (Kapitel 81) Rohformen, Pulver Alle Angaben erfolgen trotz sorgfältigster Bearbeitung ohne Gewähr. Eine Haftung der Wirtschaftskammer Österreich ist ausgeschlossen. Frage 2: Wann ist ein Zuschnitt nicht von der Verordnung erfasst? Ein einfacher rechteckiger Zuschnitt eines Blechs, ein gerader Abschnitt eines Profils oder einer Stange ändert nichts an der Zuordnung. Lediglich wenn ein spezieller Zuschnitt nach Konstruktionszeichnungen erfolgt und dieser bereits die wesentlichen Merkmale des Fertigproduktes aufweist, ist er der Position der Fertigware zuzuordnen. Lohnverarbeitungen, wie Zuschnitte und Oberflächenbehandlungen von bereitgestelltem Material sind sonstige Leistungen und keine Warenlieferungen – sie sind somit nicht erfasst. Werden Material und Zuschnitt extra verrechnet, wird trotzdem eine Ware geliefert - zu deren Einstufung siehe oben. Frage 3: Wenn ein Profil oder eine Stange oberflächenbehandelt wird, hat das Auswirkungen? Eine Oberflächenbehandlung eines Metallteiles ändert nicht die Zuordnung. Baustahlgitter (HS Position 7314) und Distanzstreifen (HS Position N 7326) werden mit MwSt verrechnet, obwohl diese Produkte aus Walzdraht hergestellt werden, bei dem die Verrechnung ohne USt erfolgt. Medieninhaber und Herausgeber: Impressum/Offenlegung: W http://wko.at/ooe/industrie/Offenlegung sparte.industrie der WKO Oberösterreich Hessenplatz 3 | 4020 Linz SF 5 von 7 T 05-90909-4201 | F 05-90909-4209 E industrie@wkooe.at | W http://wko.at/ooe/industrie
Ausgabe 03 | 10.2.2014
STEUERN UND FINANZEN Dr. Ernst Grafenhofer | T 05-90909-4241
Bei Baustahlgitter handelt es sich um ein Produkt einer höheren Bearbeitungsstufe als Draht. Darüber
hinaus weist Draht ein höheres Betrugsrisiko aus, da einfacher zu transportieren.
4. Optimierung der steuerlichen Forschungsprämie
Forschungsprämie und –förderung: Unterschiede und Gemeinsamkeiten
Holen Sie sich praktische Tipps für die Beantragung des FFG Gutachtens und die Optimierung
der Forschungsprämie. Stellen Sie sicher, dass Sie das gesamte Potential der Forschungsprämie
voll ausschöpfen. Auch als KMU steht Ihnen die Forschungsprämie etwa für
innovative Produktverbesserungen zu!
Was ist neu am Antragsverfahren zur Forschungsprämie?
Praktische Erfahrungen mit FFG-Gutachten – Dos and Don’ts
Der Ablauf: So kommen Sie zu Ihrem Gutachten
Schöpfen Sie das gesamte Potenzial für die Forschungsprämie aus?
Wo wird häufig Bemessungsgrundlage „liegen gelassen“?
Tipps für die Dokumentation und Nachweisführung
Interessant für KMU: Auch experimentelle Entwicklung wird gefördert!
Auftragsforschung und Abgrenzung zu Hilfsleistungen
Welche Tätigkeiten fallen unter F & E? (Frascati Manual)
Unterschiede zwischen einer Forschungsprämie und Forschungsförderung
Fördermöglichkeiten für anspruchsvolle Entwicklungsvorhaben (Voraussetzungen, förderfähige
Kosten, Förderarten)
Wie können Betriebe in OÖ durch das TIM-Dienstleistungsangebot die eigene Innovationskraft
stärken?
Vortragende:
MMag. Katharina Gruber, Österr. Forschungsförderungsgesellschaft
Mag. Natascha Stornig, LeitnerLeitner GmbH
Alois Keplinger, TIM - WKO Oberösterreich
Termin/Ort: Do, 20.3.2014: 16.00 – 18.30 Uhr
WKO Linz, Hessenplatz 3, 4020 Linz
Kostenbeitrag: WKOÖ-Mitglieder: EUR 49,--
Nicht-Mitglieder: EUR 59,--
Anmeldungen unter: WIFI-UNTERNEHMER-AKADEMIE| Wiener Str. 150|4021 Linz|
T 05-7000-7053|F 05-7000-3559|E unternehmerakademie@wifi-ooe.at|W wifi.at/ooe/uak
Medieninhaber und Herausgeber: Impressum/Offenlegung: W http://wko.at/ooe/industrie/Offenlegung
sparte.industrie der WKO Oberösterreich
Hessenplatz 3 | 4020 Linz SF 6 von 7
T 05-90909-4201 | F 05-90909-4209
E industrie@wkooe.at | W http://wko.at/ooe/industrieSie können auch lesen