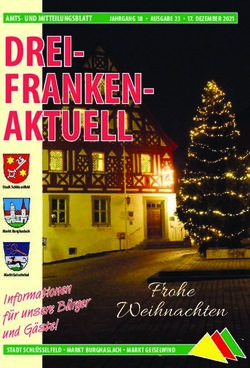Begleitpublikation - Fritz Bauer Institut
←
→
Transkription von Seiteninhalten
Wenn Ihr Browser die Seite nicht korrekt rendert, bitte, lesen Sie den Inhalt der Seite unten
Die I.G. Farben und das Konzentrationslager Buna-Monowitz | Inhaltsverzeichnis
Inhaltsverzeichnis
Geleitwort 5
DIE ERRICHTUNG DES KONZENTRATIONSLAGERS 7
BUNA-MONOWITZ
1. Was war die I.G. Farben? 8
2. Die Gründung der I.G. Auschwitz im April 1942 10
3. Das Konzentrationslager Auschwitz 14
4. Zwangsarbeiter bei der I.G. Auschwitz 16
5. Die SS 20
6. Die Mitarbeiter der I.G. Farben 24
DIE HÄFTLINGE IM KONZENTRATIONSLAGER 28
BUNA-MONOWITZ
7. Deportation 30
8. Ankunft 34
9. Zwangsarbeit 37
10. Fachleute 40
11. Hierarchien unter den Häftlingen 42
12. Willkür und Misshandlungen 45
13. Verpflegung 47
14. Hygiene 48
15. Krankheit 50
16. Selektion – Die »Auswahl zum Tode« 53Die I.G. Farben und das Konzentrationslager Buna-Monowitz | Inhaltsverzeichnis 3
17. Widerstand 56
18. Bombenangriffe 59
19. Todesmärsche 61
20. Befreiung 64
21. Die Zahlen der Toten 66
DIE I.G. FARBEN NACH 1945 UND DIE JURISTISCHE 67
AUFARBEITUNG IHRER VERBRECHEN
22. Die I.G. Farben nach 1945 68
23. Der Nürnberger Prozess gegen die I.G. Farben 70
(1947/48)
24. Die Urteile im Nürnberger Prozess 72
25. Der Wollheim-Prozess 76
(1951 – 1957)
26. Aussagen aus dem Wollheim-Prozess 78
(1951 – 1957)
27. Frankfurter Auschwitz-Prozesse 80
(1963 – 1967)
28. Die politische Vereinnahmung des 81
Fischer-Prozesses durch das SED-Regime
29. Das Ende der I.G. Farben i.L. 82
(1990 – 2003)
Impressum 855
Geleitwort
Die I.G. Farben und das Konzentrationslager Buna-Monowitz
Wirtschaft und Politik im Nationalsozialismus
ZUR AUSSTELLUNG
Der Chemiekonzern I.G. Farben ließ ab 1941 in unmittelbarer Nähe zum Konzen-
trationslager Auschwitz eine chemische Fabrik bauen, die größte im von Deutsch-
land während des Zweiten Weltkriegs eroberten Osteuropa. Sie war zugleich als
zentraler Baustein des gewaltsamen Programms der »Germanisierung« der Region
um Auschwitz gedacht. Neben deutschen Fachkräften setzte das Unternehmen auf
der riesigen Baustelle Tausende von Häftlingen aus dem KZ Auschwitz, außerdem
Kriegsgefangene und Zwangsarbeiter aus ganz Europa ein. Für die zunehmende
Zahl von KZ-Häftlingen errichteten der Konzern und die SS, die eine intensive Zu-
sammenarbeit miteinander verband, 1942 das firmeneigene KZ Buna-Monowitz.
Tausende Häftlinge kamen durch die unmenschlichen Arbeitsbedingungen zu
Tode oder wurden in den Gaskammern in Auschwitz-Birkenau ermordet, wenn sie
nicht mehr arbeitsfähig waren.
Die Ausstellung des Fritz Bauer Instituts zeichnet Entstehung, Betrieb und
Auflösung des KZ Buna-Monowitz nach. Historische Fotografien dokumentieren
die Perspektive von SS und I.G. Farben auf Baustelle und Lageralltag. Sie werden
kontrastiert mit autobiographischen Texten von Überlebenden, darunter Primo
Levi, Jean Améry und Elie Wiesel, sowie den Aussagen von ehemaligen Häftlingen
in den Nachkriegsprozessen. Informationen zu den Gerichtsverfahren nach Kriegs-
ende und den Bemühungen der Überlebenden um Entschädigung beschließen die
Ausstellung.
In der vorliegenden Begleitpublikation sind die Inhalte der Ausstellung
dokumentiert und in Grundzügen erläutert. Sie dient der Vor- und Nachbereitung
und ist als Einführung in das Thema hilfreich. Ziel ist es, die überlieferte Erinne-
rung von ehemaligen Häftlingen des KZ Buna-Monowitz in den Mittelpunkt der
Aufmerksamkeit zu stellen. Ihre zum Teil literarisch anspruchsvollen, zum Teil als
Zeugenaussagen in Prozessen formulierten Texte sind die zentralen Exponate. Die
übrigen Elemente bieten Informationen, um ihre Erzählungen und Aussagen in
den Kontext zu setzen.
Die Ausstellung ist dem Andenken der ermordeten und der überlebenden
Häftlinge des Lagers Buna-Monowitz gewidmet. Auf dem Gelände des I.G. Farben-
Hauses, heute Teil der Goethe-Universität Frankfurt am Main, erinnert das Woll-
heim Memorial an sie. Dessen Website [www.wollheim-memorial.de] bietet genaue
Informationen und darüber hinaus auch Interviews mit Überlebenden.
Prof. Dr. Sybille Steinbacher | Direktorin Fritz Bauer InstitutDie I.G. Farben und das Konzentrationslager Buna-Monowitz 7 die Errichtung des Konzentrationslagers Buna-Monowitz Aufnahme der amerikanischen Luftaufklärung vom Lager Monowitz (Auschwitz III) (Die Aufnahme wurde – wie die ebenfalls gedrehte, 1978 eingefügte Beschriftung – zur Vereinheitlichung der Karten nach Norden ausgerichtet.) | Auschwitz, 31. Mai 1944 | Washington, DC, National Archives and Records Administration
8 Die I.G. Farben und das Konzentrationslager Buna-Monowitz | 1. I.G. Farben
Firmenlogo der I.G. Farben um 1925 | Leverkusen, Bayer AG,
Corporate History & Archives
Die 1925 gegründete »I.G. Farbenindustrie« war keine Interessen-
gemeinschaft im herkömmlichen Sinne, sondern eine Aktien-
gesellschaft, also ein einheitliches Unternehmen, in dem die
bis dahin selbständigen Firmen der I.G. aufgingen. Der Begriff
»Interessengemeinschaft« hatte ab 1925 lediglich die Bedeutung
eines Eigennamens, der nicht mehr voll ausgeschrieben, sondern
nur noch in der Abkürzung »I.G.« verwendet wurde.Die I.G. Farben und das Konzentrationslager Buna-Monowitz | 1. I.G. Farben 9
WAS WAR DIE I.G. FARBEN?
Mitte des 19. Jahrhunderts entstanden die ersten chemischen Fabriken in
Deutschland. Sie stellten vor allem künstliche Farbstoffe her. Im Ersten Weltkrieg
machten diese Betriebe große Gewinne mit Sprengstoffen. Sechs von ihnen grün-
deten im Jahr 1925 die I.G. Farbenindustrie AG, einen der größten internationalen
Industriekonzerne.
Mit der Machtübernahme der Nationalsozialisten 1933 stellte sich die
I.G. Farben rasch auf die neue politische Situation ein: Der Konzern unterstützte
den Wahlkampf der NSDAP 1933 finanziell. In der gesamten Zeit der NS-Herrschaft
zahlte das Unternehmen Millionenbeträge an die verschiedenen NS-Massenorga-
nisationen. Neben der finanziellen Lobbyarbeit sorgten die Konzernleitung und
die Belegschaft für eine rasche Selbstnazifizierung: Bis Ende 1936 traten acht
Spitzenmanager in die NSDAP ein. Auch Mitarbeiter in mittleren Leitungsfunk-
tionen versprachen sich durch die Parteimitgliedschaft erhöhte Karrierechancen.
Zugleich wurden alle Mitarbeiter und Vorstandsmitglieder, die gemäß der NS-Ras-
senpolitik als Juden galten, zum Rücktritt gezwungen, ins Ausland versetzt oder
entlassen.
Die I.G. Farben stimmte ihre Interessen, Forschung und Investitionen in den
Bereichen Sprengstoffe und Chemiewaffen, Kunstfasern, Leichtmetalle, Treibstoffe
und Mineralöle, Kunststoffe und Synthesekautschuk eng mit der wirtschaftlichen
Vorbereitung für den Zweiten Weltkrieg ab. Der Konzern beteiligte sich damit
wesentlich an der Aufrüstungspolitik des »Dritten Reichs«.
DIE ZUSAMMENARBEIT DER I.G. FARBEN
MIT DEM NS-REGIME
Der Zentralausschuss der I.G. Farben schuf 1935 in Berlin die »Vermittlungs-
stelle W« (W = Wehrmacht), um die Zusammenarbeit mit dem Militär zu verbes-
sern. Leiter wurde Vorstandsmitglied Carl Krauch, der zu einer Schlüsselfigur bei
der Verflechtung von Konzern und Regierung wurde.
1936 übernahm Krauch mit seinem von der I.G. mitgebrachten Team die Ab-
teilung »Forschung und Entwicklung« im »Amt für deutsche Roh- und Werkstoffe«.
Ziel dieser Abteilung war es, kriegswichtige Rohstoffe durch chemisch erzeugte
Stoffe zu ersetzen, um das Deutsche Reich von Importen unabhängig zu machen.
Die Vorgaben der NS-Regierung zu Qualität und Quantität von Stoffen wurden mit
den Investitionsplanungen und der Forschung der I.G. Farben abgestimmt.
1940 wurde Krauch als »Generalbevollmächtigter für Sonderfragen der che-
mischen Erzeugung« direkt Hermann Göring unterstellt. Für seine Aufgaben als
Regierungsvertreter und für die Kriegsplanung beurlaubte ihn die I.G. Farben. Er
behielt jedoch alle Ämter im Konzern bei und wurde weiterhin von ihm bezahlt.
Die Gründungsfirmen der I.G. Farben
BASF (Ludwigshafen), Bayer (Leverkusen), Farbwerke Hoechst (Frankfurt am Main),
Agfa (Berlin), Weiler-ter Meer (Uerdingen), Griesheim-Elektron (Frankfurt am Main)10 Die I.G. Farben und das Konzentrationslager Buna-Monowitz | 2. Gründung I.G. Auschwitz
DIE GRÜNDUNG DER
I.G. A U S C H W I T Z I M A P R I L 1 9 4 2
Nach dem deutschen Überfall auf Polen am 1. September 1939 suchte die
I.G. Farben nach einem Standort für ein großes Chemiewerk in Osteuropa. Die Ent-
scheidung fiel 1940/41 auf die 60 Kilometer westlich von Krakau gelegene Stadt
Oświęcim (Auschwitz). Dabei spielten militärische, politische und wirtschaftliche
Gründe eine Rolle: Der Ort lag verkehrsgünstig, in der Umgebung fanden sich
reiche Rohstoffvorkommen (Kohle, Kalk und Wasser), und für den Bau des Werks
konnten Zwangsarbeiter aus dem nahegelegenen Konzentrationslager Auschwitz
eingesetzt werden.
Das neue Chemiewerk war als komplexe chemische Fabrik konzipiert. Zu-
nächst sollte das Werk die militärische Nachfrage nach künstlichen Kraftstoffen
und synthetischem Kautschuk (Buna) befriedigen. Für spätere Friedenszeiten war
geplant, dass die Produktionsanlagen den Markt im eroberten Osten mit Kunst-
stoffen versorgen sollten.
WAS IST BUNA?
Zu Beginn des 20. Jahrhunderts stieg die weltweite Nachfrage nach Naturkaut-
schuk (Gummi) für die Reifenproduktion der stark wachsenden Automobilindus-
trie. Der damit einhergehende Preisboom veranlasste die Chemieindustrie, nach
Verfahren für eine künstliche Herstellung von Kautschuk zu suchen. Seit 1929
hielt die I.G. Farben ein Patent auf die Herstellung von künstlichem Gummi, das sie
als Buna bezeichnete. Aufgrund der hohen Herstellungskosten und der fallenden
Preise für Naturkautschuk während der Weltwirtschaftskrise wurde die Produktion
jedoch eingestellt.
Ab 1933 nahmen die I.G. Farben und das NS-Regime Verhandlungen über
die Großproduktion von Buna auf, um sich von Naturkautschuk unabhängig zu
machen. Geplant wurden vier Produktionsanlagen: in Schkopau (Buna I, Produktion
ab März 1937), Hüls (Buna II, Produktion ab 1940), Ludwigshafen (Buna III, Pro-
duktion ab Ende 1942) und Auschwitz (Buna IV).
Besuch Heinrich Himmlers auf
der Baustelle | Baustelle I.G.-
Baugelände, Auschwitz 1942 |
Oświęcim, Państwowe Muzeum
Auschwitz-Birkenau
Reichsführer SS und Chef der
Deutschen Polizei Heinrich
Himmler besuchte am 17. und
18. Juli 1942 Auschwitz und ließ
sich von I.G.-Oberingenieur Dr.
Max Faust die Baumaßnahmen
zeigen.Die I.G. Farben und das Konzentrationslager Buna-Monowitz | 2. Gründung I.G. Auschwitz 11 Werke und Betriebe der I.G. Farben 1943 | Nürnberg, 1947 | Washington, DC, National Archives and Records Administration Im Zweiten Weltkrieg profitierte die I.G. Farben von der Übernahme von Betrieben in den besetzten Gebieten. An mindestens 23 Standorten setzte der Konzern Zwangsarbeiter und KZ-Häftlinge ein.
12 Die I.G. Farben und das Konzentrationslager Buna-Monowitz | 2. Gründung I.G. Auschwitz
13 Die Baustelle der I.G. Auschwitz | Auschwitz, um 1943/44 | Frank- furt am Main, Fritz Bauer Institut An dem Kraftwerk wurden Eisenbeton- und Dachdeckerarbeiten ausgeführt. Bis zur Befreiung durch die Rote Armee im Januar 1945 waren einige Anlagen im Fabrikkomplex fertiggestellt, die Großproduktion von Methanol lief seit Oktober 1943. Zu der für Februar 1945 vorgesehenen Aufnahme der Buna-Produktion kam es nicht mehr.
14 Die I.G. Farben und das Konzentrationslager Buna-Monowitz | 3. Konzentrationslager Auschwitz
D A S KO N Z E N T R AT I O N S L A G E R
AUSCHWITZ
Im April 1940 befahl Heinrich Himmler, der Reichsführer SS und Chef der
Deutschen Polizei, den Bau des Konzentrationslagers Auschwitz. Zum Komman-
danten wurde SS-Hauptsturmführer Rudolf Höß ernannt. Durch die sukzessive Ein-
richtung von Gaskammern in Birkenau seit 1942 wurde das Lager in den Jahren
1943 und 1944 zum größten Vernichtungszentrum der Nationalsozialisten.
In Auschwitz wurde die systematische Massenvernichtung von Menschen, vor
allem Juden aus ganz Europa, aber auch Sinti und Roma, mit dem Giftgas Zyklon B
durchgeführt. Auschwitz war zudem eines der größten Zwangsarbeitslager der
deutschen Industrie. In über 40 Außenlagern mussten Häftlinge in landwirtschaft-
lichen Betrieben, Rüstungsfabriken, Kohlegruben und anderen Produktionsstätten
Zwangsarbeit leisten, bis ihre Kräfte erschöpft waren.
Von den Juden, die zwischen 1942 und 1944 aus ganz Europa nach Auschwitz
deportiert wurden, wählte die SS Zehntausende zur Zwangsarbeit aus. Ihre Ange-
hörigen wurden zumeist direkt nach der Ankunft in Auschwitz-Birkenau ermordet.
SS-Interessengebiet Auschwitz-Birkenau 1944 | Nachbearbeitete Fotografie |
Auschwitz, 26. Juni 1944 | Washington, DC, National Archives and Records Admin-
istration
Historische Aufnahme der amerikanischen Luftaufklärung von Auschwitz I, Birkenau
und MonowitzSCHEMATISCHE ÜBERSICHT ÜBER DAS SS-INTERESSENGEBIET 0 km 2 km
Auschwitz-Birkenau um 1944
Auschwitz II (Birkenau): Stadtzentrum von Auschwitz
Das Vernichtungs- und Konzentrationslager (Oświęcim)
lag in einem Sperrbezirk von rund 40 Quadrat-
kilometern und wurde zwischen 1941 und 1944
kontinuierlich ausgebaut. Ab 1942 bestanden
in Birkenau Anlagen für den systematischen
Massenmord.
l
h se
ic
We
Werk der I.G. Farben
Werk für synthetischen Treibstoff
und Gummi
Auschwitz I (Stammlager):
Das auf einem ehemaligen Kasernengelände
errichtete Lager existierte seit Mai 1940. Die
Häftlinge mussten in den nahegelegenen
Betrieben der SS Zwangsarbeit leisten. 1941 Auschwitz III (Buna-Monowitz
führte die Lagerleitung hier erstmals Versuche
zur Massenvernichtung von Menschen mit
und Nebenlager):
dem Giftgas Zyklon B durch. 1942 erbaute die I.G. Auschwitz das firmeneigene Lager
Buna-Monowitz. Es war das erste Konzentrationslager,
das sich auf dem Gelände eines privatrechtlichen Groß-
konzerns befand.
1516 Die I.G. Farben und das Konzentrationslager Buna-Monowitz | 4. Zwangsarbeit I.G. Auschwitz
ZWANGSARBEITER BEI DER
I.G. AUSCHWITZ
Auf der Baustelle der I.G. Farben wurden in großem Umfang Zwangsarbeiter
aus dem Konzentrationslager Auschwitz eingesetzt. Für die I.G. Farben war die
Ausbeutung der Häftlinge ein profitables Geschäft. Die Mietpauschale für die Häft-
lingsarbeit lag etwa ein Drittel unter dem üblichen Lohnniveau für freie Arbeits-
kräfte in dieser Region.
Zu Beginn der Bauarbeiten an der Fabrik im April 1941 mussten die Häftlinge
jeden Tag vom Stammlager Auschwitz zur sechs bis sieben Kilometer entfernten
Baustelle marschieren. Später wurden sie mit der Bahn gebracht. In den Augen
der I.G.-Werksleitung stellten sowohl der kräftezehrende Marsch, der die unter-
ernährten Häftlinge zusätzlich schwächte, als auch der zeitaufwendige Transport
mit Güterwaggons einen nutzlosen Verschleiß an Arbeitskraft und -zeit dar. Daher
drängte sie auf die Errichtung eines Außenlagers auf dem Werksgelände. Es ent-
stand im Herbst 1942 an der Stelle des polnischen Dorfes Monowice, dessen Ein-
wohner vertrieben worden waren.
Häftlinge des Buna-Außenkommandos marschieren durch die Stadt Auschwitz. |
Auschwitz, zwischen April 1941 und Juli 1942 | Oświęcim, Państwowe Muzeum
Auschwitz-BirkenauDie I.G. Farben und das Konzentrationslager Buna-Monowitz | 4. Zwangsarbeit I.G. Auschwitz 17
1942 1943 1944
Januar 2.900 7.000
Februar 1.500 7.000
März 3.000 7.800
April 3.200 7.200
Mai 4.000 9.200
Juni 4.000 10.100
Juli 5.000 10.100
August 6.000 11.500
September 6.400 10.100
Oktober 6.600 9.800
November 2.300 6.400 10.600
Dezember 3.700 7.000 10.500
Zwangsarbeiter im Konzentrationslager Buna-Monowitz | Antoni Makowski,
»Organisation, Entwicklung und Tätigkeit des Häftlings-Krankenbaus in Monowitz
(KL Auschwitz III)«, in: Hefte von Auschwitz, Jg. 15 (1975)
Die Tage der Häftlinge im KZ Buna-Monowitz bestanden aus vielen Stunden meist
schwerer Arbeit im Freien ohne die nötige Schutzkleidung. Die Arbeitszeit betrug
im Sommer zehn bis elf Stunden, im Winter mindestens neun Stunden. Nach der
Rückkehr ins Lager mussten die Häftlinge manchmal noch ein bis zwei Stunden
Ausbauarbeiten im Lager leisten.
Die meisten Häftlinge des Lagers Buna-Monowitz, etwa 25.000 bis 30.000
Personen, gingen aufgrund der ungenügenden Ernährung, der unzureichenden
Kleidung und der harten Arbeitsbedingungen zugrunde. Viele wurden auf der
Baustelle ermordet oder bei Selektionen (Aussonderungen nach Kriterien der
»Arbeitsfähigkeit«) in die Gaskammern nach Birkenau geschickt.
Häftlinge beim Ausmarsch aus dem Lager Buna-Monowitz zur Arbeit auf dem
Werksgelände | Auschwitz, zwischen 1942 und 1944 | Oświęcim, Państwowe
Muzeum Auschwitz-Birkenau
Nach dem Morgenappell wurden die Arbeitskommandos zusammengestellt.
Sobald die SS eine Postenkette zur Baustelle und um sie herum gebildet hatte,
rückten die Kommandos aus. Im Hintergrund des Bildes sind die Baracken der SS
zu erkennen.18 Die I.G. Farben und das Konzentrationslager Buna-Monowitz | 4. Zwangsarbeit I.G. Auschwitz
Die I.G. Farben und das Konzentrationslager Buna-Monowitz | 4. Zwangsarbeit I.G. Auschwitz 19
20 Die I.G. Farben und das Konzentrationslager Buna-Monowitz | 5. SS
DIE SS
Die SS verwaltete und bewachte das Lager Buna-Monowitz. Sie vermietete
die KZ-Häftlinge an die I.G. Farben zur Zwangsarbeit auf dem Werksgelände. Be-
reits im März 1941 einigten sich die Vertreter der I.G. Farben und der SS in Berlin
auf die Bedingungen der Zwangsarbeit: Sie vereinbarten, dass die I.G. Farben pro
Hilfsarbeiter und Tag drei Reichsmark, pro Facharbeiter und Tag vier Reichsmark
an die SS zahlte. Die Häftlinge erhielten keinerlei Lohn.
Täglich sorgten die SS-Wachmannschaften für die Bereitstellung der Arbeits-
kommandos. Die Aufmerksamkeit der SS-Männer galt vor allem der Absicherung
des Lagers nach außen und der Aufrechterhaltung der inneren »Ordnung«.
SS-Angehörige, die im Januar 1945 zur Absicherung von 2.006 Männer
Buna-Monowitz und seiner Außenlager eingesetzt waren: 15 Frauen
Ehemalige SS-Angehörige, die nach 1945 juristisch zur Re- 4 Männer
chenschaft gezogen wurden:
S. 21: Auszüge aus: Kommandanturbefehl von Heinrich Schwarz
vom 28. Januar 1944 | Oświęcim, Państwowe Muzeum Auschwitz-
Birkenau
Der Lagerkommandant hatte die oberste befehlende Dienststel-
lung in einem Konzentrationslagers inne. Er war Befehlshaber der
Wachmannschaften und des weiteren von der SS eingesetzten
Personals.Die I.G. Farben und das Konzentrationslager Buna-Monowitz | 5. SS 21
[…]22 Die I.G. Farben und das Konzentrationslager Buna-Monowitz | 5. SS
LAGERKOMMANDANT
Heinrich Schwarz (1906 – 1947)
Eintritt in SS und NSDAP: Dezember 1931
Zivilberuf: Reproduktionsfotograf
1906 in München geboren. → Ausbildung zum Reproduktionsfotografen und zeit-
weise Arbeit in diesem Beruf. → 1926 bis 1931 erwerbslos. → Ab 1939 Beginn
einer Laufbahn bei der Lager-SS, zunächst in den Konzentrationslagern Dachau
und Mauthausen. → Im Juni 1941 Versetzung in das SS-Hauptamt »Haushalt und
Bauten«. → September 1941 Wechsel in die Inspektion der Konzentrationslager
in die Abteilung »Häftlingseinsatz«. Stationierung in der Außenstelle in Auschwitz
und zeitweise in Birkenau. → Im August 1943 setzte ihn der Lagerkommandant
von Auschwitz, Rudolf Höß, als seinen Vertreter ein. → Ab November 1943 bis zur
Räumung im Januar 1945 Lagerkommandant in Buna-Monowitz und den angeglie-
derten Außenlagern. → Ab dem 1. Februar 1945 Lagerkommandant des Konzen-
trationslagers Natzweiler-Struthof im Elsass. → 1947 von einem französischen
Militärgerichtshof zum Tode verurteilt und hingerichtet.
Foto: Frankfurt am Main, Fritz Bauer Institut
KOMMANDOFÜHRER, RAPPORTFÜHRER
Bernhard Rakers (1905 – 1980)
Eintritt in SA und NSDAP: März 1933
Eintritt in SS: Herbst 1934
Zivilberuf: BäcKer
1905 in Sögel im Emsland geboren. → 1930 Meisterprüfung als Bäcker. → 1934
Bewerbung als Wachmann in den frühen Konzentrationslagern im Emsland. Ab-
bruch der Ausbildung zum KZ-Wächter nach einem Unfall. → Umschulung als
Koch. Arbeit in der Lagerküche des KZ Esterwegen. → 1936 bis 1942 Küchenchef
im KZ Sachsenhausen. Wegen Unterschlagung von Lebensmitteln Versetzung nach
Auschwitz. → Ab Anfang 1943 Kommandoführer in Buna-Monowitz. Morgens und
abends eskortierte er mit dem ihm unterstellten SS-Wachkommando die Häftlinge
zum Werksgelände und zurück ins Lager. Nach Beschwerden wegen seiner Grau-
samkeit und Brutalität gegenüber Häftlingen wurde er zum Rapportführer in Buna-
Monowitz befördert. In dieser Funktion war er unter anderem für die Appelle und die
Feststellung der Lagerstärke zuständig. → Dezember 1944 bis Januar 1945 Lager-
führer im Nebenlager Gleiwitz II (Deutsche Gas-Ruß-Werke GmbH; Sitz Dortmund).
→ Im Februar 1945 Lagerführer im Nebenlager Weimar-Gustloff-Werke des KZ Bu-
chenwald. → 1945 in amerikanischer Kriegsgefangenschaft. → 1948 im Entnazi-
fizierungsverfahren aufgrund seiner Zugehörigkeit zur SS zu einer Gefängnisstrafe
von zweieinhalb Jahren verurteilt (die Strafe wurde vom Gericht auf seine Kriegs-
gefangenschaft angerechnet und galt als verbüßt). → Rückkehr in seinen Beruf
als Bäcker. → 1950 Verhaftung und Beginn von insgesamt drei Prozessen vor dem
Landgericht Osnabrück (1952–1959) gegen ihn. → 1953 im ersten Rakers-Prozess
wegen Mordes an Häftlingen zu lebenslanger Haft verurteilt. → Mitte 1971 begnadigt
und Weiterarbeit in seinem Zivilberuf.
Foto: Frankfurt am Main, Fritz Bauer InstitutDie I.G. Farben und das Konzentrationslager Buna-Monowitz | 5. SS 23
SANITÄTSDIENSTGRAD
Gerhard Neubert (1909 – 1993)
Eintritt in SS: Mai 1940
Zivilberuf: Klavierbauer
1909 in Johanngeorgenstadt im Erzgebirge geboren. → 1927 Abschluss der Lehre
als Klavierbauer. → 1931 Tätigkeit in einer Möbelfabrik. → 1940 Einberufung zur
Waffen-SS und Grundausbildung in Prag. → Mitte 1942 nach Auschwitz kommandiert.
Wachdienst und Bedienung der Desinfektionsanlage für Kleidung, Absolvierung
eines Desinfektions- und Krankenpflegerlehrgangs. → Seit Anfang 1943 Sanitäts-
dienstgrad im Häftlingskrankenbau des KZ Buna-Monowitz und dort an Selektionen
beteiligt. → Nach der Auflösung des Lagers im Januar 1945 Dienst in den Konzen-
trationslagern Buchenwald, Mittelbau-Dora (Boelcke-Kaserne) und Neuengamme.
→ 1945 Verhaftung durch die britische Armee, nach zehn Wochen Freilassung. →
Arbeit als Bauerngehilfe, Tischler und Polier. → 1958 bis 1963 Angestellter bei
der Standortverwaltung einer Bundeswehreinheit, danach abermals Tätigkeit in
der Möbelfabrik, in der er schon vor dem Krieg gearbeitet hatte. → Im ersten
Frankfurter Auschwitz-Prozess angeklagt, jedoch nicht in Untersuchungshaft ge-
nommen. Wegen Krankheit des Angeklagten trennte das Gericht das Verfahren
ab. → Im zweiten Frankfurter Auschwitz-Prozess (1965 – 1966) wurde er erneut
vor Gericht gestellt und zu dreieinhalb Jahren Haft verurteilt. → 1971 Entlassung.
Foto: Frankfurt am Main, Fritz Bauer Institut
LAGERARZT
Horst Fischer (1912 – 1966)
Eintritt in SS: November 1933
Eintritt in NSDAP: Mai 1937
Zivilberuf: Arzt
Fischer, geboren 1912 in Dresden, wuchs als Vollwaise bei Verwandten in Dresden
und Berlin auf. → 1932 bis 1937 Medizinstudium an der Universität Berlin. →
Ab 1939 Arbeit als Truppenarzt der Waffen-SS. → 1942 nach Auschwitz versetzt.
Aufstieg zum Stellvertreter des Standortarztes. → November 1943 bis September
1944 Lagerarzt im Häftlingskrankenbau in Buna-Monowitz (Fischer war einer der
ranghöchsten SS-Mediziner in Auschwitz). → Nach 1945 Landarzt in der DDR. →
Mitte der 1960er Jahre Aufdeckung seiner Identität als Nebenprodukt einer Über-
prüfung durch das Ministerium für Staatssicherheit (MfS) wegen intensiver West-
kontakte und »politischer Unzuverlässigkeit« gegenüber dem DDR-Regime. → Im
März 1966 wurde Fischer vom Obersten Gericht der DDR des Mordes an mehreren
Tausend Menschen für schuldig befunden und hingerichtet.
Foto: Frankfurt am Main, picture-alliance/dpa24 Die I.G. Farben und das Konzentrationslager Buna-Monowitz | 6. Mitarbeiter I.G. Farben
D I E M I TA R B E I T E R D E R I.G. FA R B E N
Die I.G. Farben sandte Ingenieure, Angestellte und Meister zur I.G. Auschwitz.
Die Mitarbeiter erhielten für die Versetzung Gehaltszulagen, etwa in Form von
»Trennungsentschädigungen«, Steuererleichterungen und besonderen Sozial-
leistungen, darunter eine mustergültige medizinische Versorgung. Zudem wurde
ihnen ein umfassendes Freizeitprogramm geboten, um einen Ausgleich zur Arbeit
und zum »Verzicht auf die aus der Heimat gewohnte Zivilisation, Lebenskultur«
(Walther Dürrfeld, Heinrich Schuster) zu schaffen.
Die Belegschaft der I.G. Auschwitz wurde entsprechend der NS-Rassenhier-
archie kategorisiert und in insgesamt zwölf Barackenlagern getrennt nach Herkunft
und Status untergebracht. In der Stadt Auschwitz wurden im April 1941 die Wohn-
häuser von Juden beschlagnahmt und für leitende Angestellte der I.G. Auschwitz
bereitgestellt. Für die übrigen Beschäftigten ließ die Werksleitung moderne Wohn-
siedlungen und Baracken errichten.
Fotos von Feierabend- und Sportver-
anstaltungen | Auschwitz, 1943/44 |
Frankfurt am Main, Fritz Bauer Institut
Die Werksleitung der I.G. Auschwitz
organisierte für ihre Angestellten ein
umfangreiches Freizeitangebot in Form
von Konzerten, Kino- und Theatervor-
stellungen und Sportveranstaltungen.Die I.G. Farben und das Konzentrationslager Buna-Monowitz | 6. Mitarbeiter I.G. Farben 25
Neuerbaute Siedlung in der Stadt Oświęcim (Auschwitz) | Auschwitz, 1943/44 |
Frankfurt am Main, Fritz Bauer Institut
Den Ingenieuren und Angestellten gewährte die Werksleitung besondere Sozial-
leistungen wie Grünanlagen oder die Verschönerung ihrer Wohnungen.
Das Foto wurde im I.G.-Farben-Prozess von dem Angeklagten Walther Dürrfeld als
Beispiel für den rasanten Aufschwung der Stadt und des gesamten Landstrichs
dank der I.G.-Werkssiedlung vorgelegt.
BELEGSCHAFT IN AUSCHWITZ AM 15. NOVEMBER 1942
Deutsche Belegschaft: 4.944
Gesamtbelegschaft * des Werks: 20.555
*) ohne Häftlinge des KZ Buna-Monowitz
Neben Zivilarbeitern handelt es sich um Zwangsarbeiter (vor allem
aus Osteuropa), Kriegsgefangene und Häftlinge aus einem Erzie-
hungslager, die in verschiedenen Barackenlagern in Auschwitz un-
tergebracht waren.
Entsandte Mitarbeiter der I.G. Farben nach Auschwitz und Angehörige
von Fremdfirmen:
GEWERBLICHE BELEGSCHAFT ANGESTELLTE
Belegschaft Fach- Hilfs- Lehrlinge, technische kauf-
arbeiter arbeiter Umschüler männische
Deutsche 331 483 1.776 111 535
I.G.-Angehörige
Angehörige 1.122 386 22 91 87
fremder Firmen
Deutsche 1.453 869 1.798 202 622
Belegschaft insg.
Bernd Wagner | IG Auschwitz. Zwangsarbeit und Vernichtung von Häftlingen des
Lagers Monowitz 1941 – 1945, München 2000, S. 33126 Die I.G. Farben und das Konzentrationslager Buna-Monowitz | 6. Mitarbeiter I.G. Farben
DAS LAGERSYSTEM DER I.G. AUSCHWITZ
Auf der Großbaustelle der I.G. Farben herrschte von Beginn an starker Arbeitskräf-
temangel. Dem versuchte die I.G. Farben durch die Anwerbung von zivilen Fremd-
arbeitern entgegenzuwirken. Zudem nutzte sie ab 1940 ihre »Vermittlungsstelle W«
in Berlin, um Kriegsgefangene und Zwangsarbeiter zu beschaffen. Untergebracht
waren diese Menschen in riesigen Lagerkomplexen, welche die Werksgebäude der
I.G. Farben umgaben (im Plan gelb markiert).
Für die zahlreichen ausländischen Arbeitskräfte variierten der Arbeitsschutz
und die sozialrechtlichen, politischen, medizinischen und hygienischen Bedin-
gungen je nach ihrer durch die NS-Ideologie definierten Stellung als »Rasse«. Die
Löhne der Ostarbeiter, Polen, Balten, Juden, Sinti und Roma waren deutlich ge-
ringer als die Löhne anderer Ausländer oder der Deutschen, ihre Unterbringung
und medizinische Versorgung war schlechter, und die Lebensmittelrationen fielen
geringer aus.
Die unmenschlichste Form der Zwangsarbeit erlebten die Häftlinge in den
Konzentrationslagern, zumeist handelte es sich um jüdische Häftlinge, die jed-
weden Rechts beraubt wurden.Die I.G. Farben und das Konzentrationslager Buna-Monowitz | 6. Mitarbeiter I.G. Farben 27 Fabrik- und Lagerkomplex des Werkes Auschwitz der I.G. Farben | Plan im Maß- stab 1:10.000 | Ende 1944 | Frankfurt am Main, Fritz Bauer Institut Der zeitgenössische Lageplan der I.G.-Planer wurde im Nürnberger Prozess ver- wendet, um den Anwesenden die Anordnung der Gebäude zu veranschaulichen.
28 Die I.G. Farben und das Konzentrationslager Buna-Monowitz
Die Häftlinge
im Konzentrationslager
Buna-MonowitzDie I.G. Farben und das Konzentrationslager Buna-Monowitz 29
»Ganz anders ist Buna. Buna ist hoffnungslos, durch und
durch trübe und grau. Diese ausgedehnte Wirrnis von
Eisen, Zement, Schlamm und Qualm ist die Verneinung
der Schönheit schlechthin. Ihre Straßen und Bauten werden
mit Zahlen und Buchstaben benannt wie wir, wenn sie
nicht unmenschliche und unheilvolle Namen tragen. In
diesem Bereich wächst kein Grashalm, und die Erde ist
getränkt mit den giftigen Säften von Kohle und Petro-
leum. Nichts lebt hier, nur Maschinen und Sklaven: und
jene mehr als diese.«
Primo Levi | Ist das ein Mensch?, München 1991, S. 85
Zur Person: Primo Levi (1919 – 1987) wurde am 31. Juli 1919 in Turin geboren und
studierte dort Chemie. Ende 1943 wurde er als Mitglied der Resistenza verhaftet
und im Januar 1944 zunächst in das Lager Fossoli bei Modena und von dort aus im
Februar nach Buna-Monowitz deportiert. Levi überlebte die schweren Arbeitskom-
mandos in den ersten Monaten und wurde im November 1944 als Chemiker in ein
Facharbeiterkommando aufgenommen. Bis Januar 1945 arbeitete er im wetterge-
schützten Labor. Kurz vor der Räumung des Lagers erkrankte er an Scharlach und
wurde im Häftlingskrankenbau zurückgelassen, in dem es zu diesem Zeitpunkt
keine medizinische Betreuung mehr gab.
Durch Glück und Zufall erlebte er die Befreiung durch die Rote Armee am
27. Januar 1945 und kehrte nach Italien zurück, wo er bis 1977 in der chemischen
Industrie arbeitete. Seine autobiographischen Berichte, seine Erzählungen und
Romane wurden mit Literaturpreisen ausgezeichnet und in viele Sprachen über-
setzt. 1987 nahm sich Levi mutmaßlich das Leben.
Primo Levi | circa 1960 | Zum Text: Primo Levis Bericht erschien bereits 1947 (Neuausgabe 1958) auf
Mailand, Fondazione Italienisch unter dem Titel Se questo è un uomo und ist der wohl bekannteste und
Centro di Documenta- für die Rezeption einflussreichste Bericht eines Monowitz-Überlebenden. Levi
zione Ebraica Contem- schildert seine Erlebnisse während seiner einjährigen Haft in Buna-Monowitz.
poranea (Fondo fotografico Seine Beschreibungen sind überaus präzise, klar und nüchtern. Dabei nutzt er
Levi Anna Maria, inv. 363-016) seine persönlichen Erfahrungen als Ausgangspunkt für Reflexionen über die Ent-
menschlichung der Opfer.30 Die I.G. Farben und das Konzentrationslager Buna-Monowitz | 7. Deportation
D E P O R TAT I O N
Im Herbst 1941 begann die bürokratisch organisierte Deportation von Juden
aus dem Deutschen Reich, dem Protektorat Böhmen und Mähren und dem ›ange-
schlossenen‹ Österreich. Mit Zügen wurden die Menschen zunächst in die Ghettos
im besetzten Mittel- und Osteuropa verschleppt. Seit März 1942 fuhren Züge aus
den besetzten und verbündeten europäischen Ländern auch nach Auschwitz.
Vorbereitet wurden die als »Sonderzüge« bezeichneten Transporte der
Deutschen Reichsbahn durch das Referat IV B 4 (»Judenreferat«) des Reichssicher-
heitshauptamts (RSHA) in Berlin unter der Leitung von Adolf Eichmann.
Etwa 650 solcher Transporte mit insgesamt über einer Million Juden, Sinti
und Roma endeten in Auschwitz-Birkenau.
Im Deutschen Reich holten Beamte die Betroffenen zu Hause ab und sperrten sie in
öffentliche Sammellager, die in Messehallen oder in jüdischen Einrichtungen wie
Synagogen errichtet worden waren. War ein Transport zusammengestellt, brachte
die Gestapo die Betroffenen zu Fuß oder in Lkws zu den öffentlichen Bahnhöfen,
zumeist Güterbahnhöfen, von wo aus die Züge starteten.
»Mein Bruder Hermann und ich […] richteten uns, als
erste in den Waggon kletternd, in einer Ecke ein.
Unterhalb einer Klappe, die eine Art Fensteröffnung
war, damit die Tiere, die sonst hier transportiert wurden,
an heißen Tagen nicht erstickten. Unser Waggon füllte
sich so sehr, dass an ein Sich-Hinlegen nicht mehr zu
denken war. Als der Zug rollte und nirgendwo hielt,
Imo Moszkowicz |
wurden die ersten menschlichen Bedürfnisse riechbar. 2003 in seinem Haus
Wer den Mut hatte, sich in die Hosen zu scheißen, der in Ottobrunn | Wien,
Daniela Ebenbauer
war gar nicht so schlecht dran. […] Die Degradierung
nahm allerprimitivste Formen an, die ihren Tiefpunkt auf
der Rampe von Auschwitz erreichte. Beinahe vier Tage
waren wir unterwegs, die meisten vollgeschissen, elendig
stinkend.«
Imo Moszkowicz | Der grauende Morgen. Erinnerungen, Paderborn 2008, S. 79
Zur Person: Imo Moszkowicz (1925 – 2011) war der Sohn eines jüdisch-russischen
Schuhmachers und wuchs in Ahlen im Münsterland auf. 1938 emigrierte der
Vater nach Argentinien, die Familie sollte am 10. November folgen. In der Pogrom-
nacht am 9. November wurden jedoch die Wohnung und alle Ausreisedokumente
zerstört. 1939 erfolgte die Umsiedlung der Familie nach Essen. Die Mutter und vier
Geschwister wurden im April 1942 nach Izbica, ein »Durchgangsghetto« für dieDie I.G. Farben und das Konzentrationslager Buna-Monowitz | 7. Deportation 31
Vernichtungslager Sobibor und Belzec, deportiert. Der Bruder David wurde nach
Auschwitz verschleppt und im Februar 1943 auf der Rampe erschossen.
Am 1. März 1943 wurden Imo und sein Bruder Hermann von Dortmund nach
Auschwitz deportiert. Auf der Rampe verlor Imo seinen Bruder aus den Augen. Er
selbst wurde zur Zwangsarbeit für die I.G. Farben gezwungen. Moszkowicz über-
lebte die Todesmärsche und wurde im Mai 1945 in der Nähe von Liberec (Reichen-
berg) durch die Russen befreit.
Nach der Befreiung begann er eine Theater- und Regiekarriere. Er war als
Schauspieler und Regisseur an zahlreichen großen Bühnen im deutschsprachigen
Raum sowie in Santiago de Chile und Tel Aviv tätig und führte in über 200 Fernseh-
filmen und -serien Regie. Am 11. Januar 2011 starb er in München.
Zum Text: Moszkowicz veröffentlichte seine Autobiographie im Jahr 1996, also mit
über 50 Jahren Abstand. Er macht sein Unvermögen, die Verfolgung, Zwangsarbeit
und die Erlebnisse in Buna-Monowitz vergessen zu können, zum Thema seines Buches:
Die verdrängten und unerwünschten Erinnerungen brachen immer wieder in seinen
Alltag und seine Arbeit als Schauspieler und Regisseur ein.
Moszkowicz berichtet nicht historisch-chronologisch, sondern nimmt Schil-
derungen aus seinem Leben nach der Befreiung als Ausgangspunkt für Erinne-
rungen und Reflexionen über Auschwitz. Dabei springt er immer wieder zwischen
den Erinnerungsebenen, die er sprachlich unterschiedlich gestaltet. Erst die stete
Rückkehr zu positiven Erinnerungen ermöglicht die Auseinandersetzung mit dem
Unerträglichen.
DEPORTATIONEN VON JUDEN NACH AUSCHWITZ-BIRKENAU
Frankreich 69.000
Niederlande 60.000
Belgien 25.000
Deutschland/Österreich 23.000
Italien 7.500
Norwegen 690
Slowakei 27.000
Protektorat Böhmen und Mähren/Ghetto Theresienstadt 46.000
Jugoslawien 10.000
Griechenland 55.000
Polen 300.000
Ungarn 438.000
Aus Konzentrationslagern 34.000
1.100.000
Insgesamt etwa
(1.095.190)
WEITERE DEPORTATIONEN
Polen 147.000
Sinti und Roma 23.000
Sowjetische Kriegsgefangene 15.000
Andere 25.000
1.300.000
Insgesamt etwa
(1.305.190)
Franciszek Piper | Die Zahl der Opfer von Auschwitz | Staatliches Museum Ausch-
witz-Birkenau, 199332
Die I.G. Farben und das Konzentrationslager Buna-Monowitz | 7. Deportation 33 Auszug Transportliste | Transport vom 29. November 1942 aus Berlin nach Auschwitz | Bad Arolsen, Arolsen Archives Die Gestapo ging bei der Zusammenstellung der Transporte systematisch und akribisch vor. In Zusammenarbeit mit verschiedenen lokalen und kommunalen Dienststellen wurden die in den jeweiligen Orten lebenden Juden erfasst. Die Erhebung diente als Grundlage für die Transporte.
34 Die I.G. Farben und das Konzentrationslager Buna-Monowitz | 8. Ankunft
ANKUNFT
Die Deportationszüge kamen von Frühjahr 1942 bis Mai 1944 an der »Alten
Rampe« in der Nähe des Güterbahnhofs von Auschwitz an. Im Mai 1944 wurde die
»Neue Rampe« innerhalb des Vernichtungslagers Birkenau in Betrieb genommen.
Nach der Ankunft trieben SS-Männer die Deportierten oft mit Schreien und
Schlägen aus den Waggons. Direkt neben dem Zug fand die erste Selektion durch
SS-Offiziere, ab März 1943 ausschließlich durch SS-Ärzte statt. Noch auf der Rampe
wurden zwei Kolonnen gebildet: Alte, Schwache, Kinder und jüngere Jugend-
liche, Schwangere und Frauen mit Kindern wurden direkt in die Gaskammern ge-
bracht.
Die Überlebenden der Selektionen gelangten zu Fuß oder auf Lkws in das
Stammlager Auschwitz, in das Vernichtungslager Birkenau oder in das firmen-
eigene Arbeitslager Buna-Monowitz der I.G. Farben. Dort mussten sie sämtliche
Wertsachen und ihre Kleidung abgeben, kamen zur »Entlausung« und wurden in
kalte Duschen geführt. Ihnen wurden die Haare geschoren, und eine Häftlings-
nummer wurde ihnen auf den linken Unterarm tätowiert. Nach einem sogenannten
Quarantäneaufenthalt erfolgte die Zuteilung zu einem Arbeitskommando, in dem
sie Zwangsarbeit leisten mussten. Waren sie physisch nicht mehr arbeitsfähig,
schickte sie die SS ins Gas.
15 — 35 % der Deportierten wurden als »arbeitsfähig« beurteilt.
65 — 85% wurden sofort in den Gaskammern ermordet.
»Endlich hält der Zug an, und im Morgengrauen sind
wir auf dem Bahnsteig von Auschwitz. Die Türen der
Waggons werden aufgerissen und unter Gebrüll und
Geschrei müssen wir sie verlassen. […] Herzergreifende
Szenen spielen sich ab, als Frauen und Kinder von den
Männern getrennt werden. Auf der Bahnhofsrampe
kommen wir an einigen SS-Offizieren vorbei, die uns,
einen nach dem anderen, sehr oberflächlich im Vorbei-
gehen mustern. Man wird entweder nach rechts oder
nach links gewiesen. Ich komme nach rechts und bemerke,
dass die auf meiner Seite eingereihten Männer eher
jung und in guter physischer Verfassung sind. Die
Selektion scheint beendet zu sein. Man sagt uns, dass
wir ins Lager marschieren werden. Die andere Gruppe
hingegen wird auf Lastwagen verladen.«
Willy Berler | Durch die Hölle. Monowitz, Auschwitz, Groß-Rosen, Buchenwald,
Augsburg 2003, S. 51Die I.G. Farben und das Konzentrationslager Buna-Monowitz | 8. Ankunft 35
Zur Person: Willy Berler (1918– 2008) wurde am 11. April 1918 in Czernowitz in der
Bukowina als Sohn eines Kaufmanns geboren. Er war Mitglied in zionistischen Ju-
gendorganisationen und besuchte 1936 eine Landwirtschaftsschule in Palästina. Auf
Wunsch der Eltern kam er nach einem Jahr zurück, um in Liège Chemie zu studieren.
Nach dem Überfall der Wehrmacht auf Belgien 1940 flüchtete Berler nach
Frankreich, kehrte jedoch nach einigen Monaten aus Geldnot wieder. Er wurde
denunziert und am 19. April 1943 nach Buna-Monowitz deportiert. In den ersten
Tagen arbeitete er im »Kommando Holzhof«. Nach einer Woche, in der er schwere
Baumstämme mit bloßen Händen transportieren musste, war er so entkräftet,
dass er in den Krankenbau kam. Aus Mitleid sorgte der Blockälteste dafür, dass
er in das Stammlager Auschwitz I verlegt wurde. Ab Ende Januar 1944 arbeitete
er in einem Pflanzenzuchtlabor im SS-Hygiene-Institut Rajsko. Er überlebte den
Todesmarsch und befand sich im KZ Buchenwald, als er von der U.S. Army am
Willy Berler | 1940 |
11. April 1945 befreit wurde. Berler kehrte nach Belgien zurück, wo er in der Indus-
Paris – Gerpinnes,
trie arbeitete und 1947 seine Frau Ruth heiratete.
L’ Harmattan – Quorum /
Ruth Fivaz-Silbermann Zum Text: Berler schrieb den Bericht erst mit einem Abstand von über 55 Jahren.
Aus der zeitlichen Distanz heraus schildert er detailliert den Alltag der Häftlinge,
das Verhalten der SS und der Funktionshäftlinge sowie einige Abläufe im Lager.
Dabei ist er sehr auf eine genaue historische Einordnung des Geschehenen bedacht.
Berler wählt eine einfache, sachlich-nüchterne Sprache. Auffallend ist demge-
genüber die Wahl der Erzählzeit: Der Ich-Erzähler berichtet im Präsens. Dadurch
schafft er Unmittelbarkeit.
»Wir kamen vor ein großes Tor, das von SS-Männern
bewacht wurde. Ein kurzes Gebell. Das Tor öffnete sich.
Wir sahen die Stacheldrahtgitter, die Wachtürme,
Männer in Blau und Weiß mal hier, mal dort, einen
großen leeren Platz, eine Reihe niedriger Häuser aus
Holz. […] Wir mußten […] einen Flur entlanglaufen.
Männer, Häftlinge sagten uns auf deutsch – ein paar
auf französisch: ›Gib alles her, was du hast, du darfst
nichts bei dir behalten, du kannst es nachher wieder
abholen.‹ […] Der Befehl sauste auf uns nieder: ›Alles
ausziehen.‹ Dreihundertvierzig Männer splitternackt, das
hatte ich noch nie gesehen, das war irgendwie lächerlich.
Die einen hielten ihre Hände wie ein Feigenblatt, ande-
re krümmten sich. Niemand lachte. Die nächste Etappe
war die Dusche, lauwarm, mit etwas, das an Seife
erinnerte. Hätten wir gewußt, was für eine Bedeutung
das Duschen hatte, splitternackt, für die, die am Bahnhof
in der rechten Reihe standen, hätten wir uns in diesem
Augenblick ganz sicher unwohl gefühlt.«
Paul Steinberg | Chronik aus einer dunklen Welt, München 1998, S. 4636 Die I.G. Farben und das Konzentrationslager Buna-Monowitz | 8. Ankunft
Zur Person: Paul Steinberg (1926 – 1999) wurde am 18. Oktober 1926 in Berlin in
eine russisch-jüdische Familie geboren. Die Mutter starb bei der Geburt. 1933 zog
die Familie nach Frankreich, später nach Italien, Spanien und wieder zurück nach
Frankreich. Im September 1943 verhafteten französische Polizisten den Sechzehn-
jährigen und brachten ihn ins französische Durchgangslager Drancy. Von dort
wurde er wenige Wochen später nach Auschwitz deportiert und in Buna-Monowitz
zum Schleppen von Ziegelsteinen gezwungen. Steinberg erwarb das Wohlwollen
des Lagerältesten und wurde nach einigen Tagen einem leichteren Kommando zum
Reinigen von Magazinen zugeteilt.
Bei seiner Ankunft im KZ Buna-Monowitz hatte er sich als Chemiker aus-
gegeben, deshalb wurde er ab Januar 1944 im »Chemie-Kommando«, dem auch
Primo Levi angehörte, eingesetzt. Am 18. Januar 1945 wurde er mit Tausenden
anderen Häftlingen auf den Todesmarsch nach Gleiwitz getrieben und von dort in Paul Steinberg | 1998
offenen Waggons ins KZ Buchenwald gebracht. Dort gelang es ihm, sich als politi- beim Überlebenden-
schen Häftling auszugeben und so der Ermordung der im Lager verbliebenen etwa treffen in Frankfurt
1.200 jüdischen Häftlinge zu entgehen. Nach der Befreiung Buchenwalds kehrte am Main | Frankfurt
Steinberg nach Paris zurück, wo er in einem kaufmännischen Beruf arbeitete. Er am Main, Fritz Bauer
heiratete und hatte zwei Töchter. 1999 starb er in Paris. Institut
Zum Text: Paul Steinberg entschloss sich, nach 50 Jahren seine Erinnerungen an
das KZ Buna-Monowitz aufzuschreiben. Der Bericht folgt grob einer chronologi-
schen Ordnung der Ereignisse, allerdings wechselt der Erzähler immer wieder die
Erzählebene. Er schildert zum einen die im Lager verübten Grausamkeiten, zum
anderen reflektiert er, welche Auswirkungen das Erlebte auf ihn in der Nachkriegs-
zeit hatte.
Von seinem aktuellen Standpunkt aus versucht Steinberg, sich seinem frü-
heren Ich als Achtzehnjähriger anzunähern, es zu verstehen und seine Handlungen
nachzuvollziehen. Ihn beschäftigt vor allem die Frage, wie die täglichen Gräuel
und die Gewalt die Menschen veränderten, insbesondere, wie er sich selbst ver-
änderte, sich anpasste, um überleben zu können, und sich gleichzeitig deshalb
schuldig fühlte.
HÄFTLINGSNUMMERN
Die SS erfasste nur diejenigen Deportierten mit Nummern, die bei der Ankunft
nicht direkt in den Gaskammern ermordet wurden. Jeder Häftling erhielt eine
fortlaufende Nummer, mit der er anstelle seines Namens im Lager angesprochen
wurde. Anfangs waren Häftlinge in Auschwitz durch Nummern auf der Kleidung
gekennzeichnet worden.
Weil toten Häftlingen (vor allem im Winter) häufig die Kleidung gestohlen
wurde und eine Identifizierung dann kaum noch möglich war, ging die SS ab Mitte
1942 dazu über, jüdischen Häftlingen die Nummer auf den linken Unterarm zu
tätowieren. Ab 1943 wurde mit allen Häftlingen, die keine »Reichsdeutschen«
waren, so verfahren. Diese Praxis war nur in Auschwitz üblich, in anderen Konzen-
trationslagern hatten Häftlinge ihre Nummer nur auf der Kleidung zu tragen.Die I.G. Farben und das Konzentrationslager Buna-Monowitz | 9. Zwangsarbeit 37
ZWANGSARBEIT
Die SS und Wirtschaftsunternehmen beuteten die Häftlinge sowohl inner-
halb als auch außerhalb des Lagers als Arbeitskräfte aus. Innerhalb des Geländes
wurden sie von der SS bei der Lagerverwaltung, der Arbeitsorganisation und im
Krankenbau eingesetzt. Außerhalb arbeiteten sie für die I.G. Farben oder wurden
an Dutzende von Industrieunternehmen weitervermietet.
Die Häftlinge fürchteten vor allem die Transport- und Erdkommandos sowie
die Kabelkommandos. Dabei handelte es sich um Arbeitskommandos mit einigen
Hundert Häftlingen, die ständig mit brutalsten Prügelexzessen zu höherem Arbeits-
tempo angetrieben wurden. Viele brachen bei der schweren Arbeit zusammen und
starben.
Auf der Baustelle waren die Häftlinge der Witterung schutzlos ausgeliefert.
Die Häftlingskleidung schützte nur unzureichend gegen Hitze oder Kälte. Im Winter
kehrte kaum ein Kommando ohne Erfrierungen von der Arbeit zurück, manchmal
gab es 30 Tote am Tag. Zu zahlreichen Toten kam es auch bei Arbeitsunfällen auf
der Werksbaustelle der I.G. Auschwitz. Die häufigsten Todesursachen waren jedoch
körperliche Auszehrung und unbehandelte Krankheiten.
Durchschnittliche Überlebensdauer der Häftlinge
in Buna-Monowitz: 3 — 4 Monate
»Das erste Kommando, zu dem wir ausrückten, war das
Zementkommando. Die Waggons, die genauso aussahen
wie jene, die uns nach Auschwitz transportierten, hatten
Zementsäcke geladen. Im Waggon standen jeweils zwei
Häftlinge, die einen Zementsack hoben, ihn einem vor
dem Waggon stehenden Häftling auf die Schultern
legten, dieser dann mit seiner Last im Laufschritt zu
einem Zementlagerplatz lief, wo ihm der Zementsack
von zwei anderen Häftlingen zum Stapeln abgenommen
wurde. Dann ging es im Laufschritt zu dem Waggon
zurück. Im Laufschritt mußte alles gehen. ›Im Laufschritt,
dalli-dalli!‹
Meine Erinnerung will nicht zurückrufen, wie viele an
dieser Schwerstarbeit bereits in den ersten Tagen zu
Grunde gingen. Mir kommt es wie ein Prüffeld vor:
Wer das hier übersteht, hat gewisse Chancen, weiterzu-
kommen, weiterzuleben.«
Imo Moszkowicz | Der grauende Morgen. Erinnerungen, Paderborn 2008, S. 9038 Die I.G. Farben und das Konzentrationslager Buna-Monowitz | 9. Zwangsarbeit
Zur Person: Imo Moszkowicz ▸ vgl. S. 30
Zum Text: Bei der Ankunft auf der Rampe in Auschwitz hatte sich Moszkowicz wohl-
weislich als Zimmermann ausgegeben. Nachdem er die Zeit im »Todeskommando
Zement« überstanden hatte, fand er Arbeit als Zimmermann. Er wurde für die
Herstellung von Holzsäulen für eine Hallenkonstruktion eingesetzt.
Da diese Arbeit rasch vonstattenging, wurde er zusätzlich zum Schleppen
von Eisendraht eingeteilt. Den Draht mussten die Häftlinge auf ihren Schultern
vom Lagerplatz aus zur Baustelle tragen. Ihre Schultern versuchten sie mit dem
Papier zerrissener Zementsäcke zu schützen, was jedoch nur leidlich gelang und
zudem verboten war.
»Otto und ich mußten uns dem Kabelkommando anschließen.
Die Arbeit im Kabelkommando war eine der schwersten,
die man sich vorstellen kann. Wir waren jeder Witte-
rung ausgesetzt. Ob im Sommer bei sengender Hitze
oder im Winter bei klirrendem Frost und tiefem Schnee,
täglich mußte über eine bestimmte Länge ein Graben für
die Kabel gegraben werden. Je vier bis fünf Häftlinge
mußten die Loren mit Erde vollschaufeln und sie bergauf
schieben. Dazu gab es fast ununterbrochen Schläge von
den SS-Männern und den Kapos, die die Arbeit für
die IG-Farben mit Stockhieben beschleunigen wollten.
So blieb es nicht aus, daß fast täglich Häftlingen von
den Loren Finger oder Zehen, oft sogar Hände und
Füße, abgefahren wurden. Die Verstümmelten wurden
zwar in den Krankenbau eingeliefert, aber man sah sie
nie wieder lebend herauskommen.«
Tibor Wohl | Arbeit macht tot. Eine Jugend in Auschwitz, Frankfurt am Main 1990,
S. 48
Zur Person: Tibor Wohl (1923 – 2014) wurde am 28. Juni 1923 in Rarbok in der
Tschechoslowakei (heute Rohožník) geboren und wuchs mit seinem jüngeren Bru-
der Paul in einer bürgerlichen Familie auf. 1936 zog die Familie nach Prag. Ein
Versuch, nach Ecuador zu fliehen, scheiterte 1939, da die Familie einem Betrü-
ger aufgesessen war. Im Dezember 1941 wurde die Familie zur Zwangsarbeit nach
Theresienstadt und im Oktober 1942 weiter nach Auschwitz deportiert. Bei der
Ankunft verlor Wohl seine Familie aus den Augen und sah sie nie wieder.
In Buna-Monowitz wurde er für schwere Transportarbeiten und im Kabel-
kommando eingesetzt. Während eines Aufenthalts im Krankenbau führten SS-
Ärzte, darunter Horst Fischer, Experimente mit Elektroschocks an ihm durch. Nach
einem kurzen Aufenthalt im Schonungsblock im Frühjahr 1944 lernte Wohl den
Tschechen Arnost Tauber kennen und schloss sich dem Widerstand an. Über diese
Kontakte wurde er der Desinfektionsstation zugeteilt, wo er bis zur Auflösung des
Lagers arbeitete.Die I.G. Farben und das Konzentrationslager Buna-Monowitz | 9. Zwangsarbeit 39
Wohl wurde am 18. Januar 1945 auf den Todesmarsch nach Gleiwitz getrie-
ben. Es gelang ihm jedoch, während eines Partisanenangriffs mit zwei Kameraden
zu entkommen und sich bis zur Befreiung durch die Rote Armee am 27. Januar zu
verstecken.
Wohl kehrte nach Prag zurück, heiratete und hatte zwei Kinder. 1969 floh
er mit seiner Familie nach Österreich und arbeitete fortan als Montageabteilungs-
leiter. Zuletzt lebte er in Frankfurt am Main.
Wohl sagte im zweiten Frankfurter Auschwitz-Prozess gegen Gerhard Neubert
und in der DDR 1966 gegen Horst Fischer aus.
Zum Text: Wohl verfasste bereits 1948 in tschechischer Sprache ein Manuskript
über seine Erlebnisse. Erst 30 Jahre später, nach seiner Verrentung, schrieb er
dann eine Version in deutscher Sprache. Sie sollte dazu beitragen, die Wahrheit
über Auschwitz aufzudecken. Wohls Wunsch, dadurch »nach den vielen Jahren
eine Last« abschütteln zu können, blieb unerfüllt. So konstatiert er in seinem
Tibor Wohl | 1998 beim Vorwort: »ich will vergessen, aber ich kann es nicht«.
Überlebendentreffen Wohl berichtet detailliert vom Lageralltag in Buna-Monowitz. Dabei verzich-
in Frankfurt am Main | tet er auf Ausblicke auf die Nachkriegszeit oder die Zeit vor seiner Lagerhaft. Der
Frankfurt am Main, Text ist chronologisch in einzelne Kapitel gegliedert und beschreibt verschiedene
Fritz Bauer Institut Aspekte des Lagerlebens: die Ankunft, den tödlichen Arbeitsalltag, die permanen-
ten Schikanen und Prügelexzesse, Aufenthalte im Krankenbau und Selektionen.
Er beginnt seine Erinnerungen mit der Deportation nach Auschwitz und endet mit
der Befreiung durch die Rote Armee. Viele Erlebnisse, die ihn selbst betrafen und
zu denen er als Zeuge vor Gericht aussagte, wie die pseudomedizinischen Folter-
experimente von Fischer, spart er jedoch aus.
Häftlinge entladen Zementsäcke von Bahnwaggons, die für die Baustelle der
I.G.-Farben-Fabrik bestimmt sind. | Auschwitz, zwischen 1942 und 1945 | Fotograf
unbekannt | Washington, DC, United States Holocaust Memorial Museum40 Die I.G. Farben und das Konzentrationslager Buna-Monowitz | 10. Fachleute
FACHLEUTE
Mit dem Fortschreiten der Bauarbeiten wandelten sich die Arbeitsschwer-
punkte. Immer mehr Häftlinge wurden als qualifizierte Facharbeiter eingesetzt. Sie
übernahmen Arbeiten als Schlosser, Maurer, Zimmerleute, Maler oder Schweißer.
Ab 1944 wuchs der Anteil der Produktionskommandos, in denen Häftlinge in Chemie-
laboratorien hochqualifizierte Arbeiten ausführten. In den Schreibkommandos er-
ledigten einige wenige Häftlinge sogar Schriftverkehr und bearbeiteten Statistiken.
Häftlinge wurden jedoch bevorzugt zu riskanten und lebensgefährlichen Arbeiten
herangezogen, wie im Bombenräumkommando, das 1944 nach den Luftangriffen
Blindgänger auf dem Werksgelände barg.
»Ein Schlosser etwa war ein privilegierter Mann, da man
ihn in der zu errichtenden IG-Farben-Fabrik brauchen
konnte und er die Chance hatte, in einer gedeckten,
der Witterung nicht ausgesetzten Werkstatt zu arbeiten.
Das gleiche gilt für den Elektriker, den Installateur,
den Tischler oder den Zimmermann. Wer Schneider
oder Schuster war, hatte vielleicht das Glück, in eine
Stube zu kommen, wo man für die SS arbeitete. Für
den Maurer, den Koch, den Radiotechniker, den Auto-
mechaniker gab es die Minimalchance eines erträglichen
Arbeitsplatzes und damit des Überstehens. Anders war
die Lage dessen, der einen Intelligenzberuf hatte. Ihn
erwartete das Schicksal des Kaufmanns, der gleichfalls
zum Lumpenproletariat im Lager gehörte, das heißt:
er wurde einem Arbeitskommando zugeteilt, wo man
Erde aufgrub, Kabel legte, Zementsäcke oder Eisen-
traversen transportierte.«
Jean Améry | Jenseits von Schuld und Sühne. Bewältigungsversuche eines Über-
wältigten, München 1988, S. 16 f.
Zur Person: Jean Améry (1912 – 1978) wurde am 31. Oktober 1912 als Hans Mayer
in Wien in eine jüdische Familie geboren. Der Name Améry ist ein Anagramm von
Mayer und Jean die französische Form von Hans. Nach dem frühen Tod des Vaters
wuchs Améry bei der Mutter auf. Bereits als Zwölfjähriger verließ er die Schule.
Nach einer Buchhändlerlehre arbeitete er einige Jahre als Gehilfe in der Buchhand-
lung der Volkshochschule Leopoldstadt. Er bildete sich an der Universität Wien
durch den Besuch literarischer und philosophischer Vorlesungen weiter. Ende 1938
floh er nach Belgien. Nach einer ersten Verhaftung 1940 gelang Améry die Flucht.Sie können auch lesen