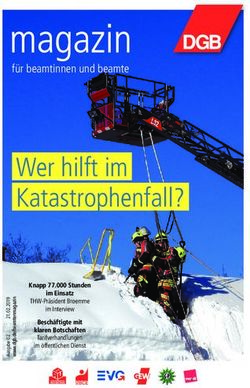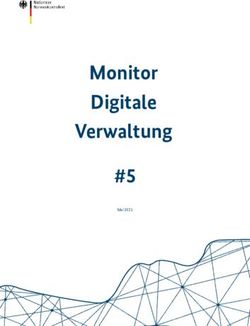Belege, Fakten, Argumente - Projektskizze Habilitation - moebellabor
←
→
Transkription von Seiteninhalten
Wenn Ihr Browser die Seite nicht korrekt rendert, bitte, lesen Sie den Inhalt der Seite unten
Projektskizze
Habilitation
Olaf Rahmstorf
Arbeitstitel
Belege, Fakten, Argumente
Eine Untersuchung zur Transformation der Wissensorganisation im
digitalen Zeitalter am Beispiel der Wikipedia
23.01.20
erster Entwurf
Eingereicht bei Professor Bernt Schnettler
Universität Bayreuth
2. Betreuer Professor Franz Schultheis
Zeppelin Universität Friedrichshafen2
1 | Einführung .................................................................................................................... 3
2 | Kontext......................................................................................................................... 5
2.1 | Digitalisierung ..................................................................................................................................5
2.2 | Vorgeschichte der Wikipedia: Digitalisierung und Open Source.....................................................7
2.3 | Das Exemplarische der Wikipedia....................................................................................................8
3 | Fragestellung ................................................................................................................ 9
3.1 | Begriffliche Abgrenzung und Arbeitshypothesen ..........................................................................10
4 | Forschungskonzept ..................................................................................................... 11
4.1 | Öffentlichkeit
Theoretischer und historischer Zusammenhang ................................................................................13
4.1.1 | Theoriegeschichtlicher Kontext ..............................................................................................13
4.1.2 | Eingrenzung des Begriffs der Öffentlichkeit im Hinblick auf die Forschungsfrage ...............14
4.1.3 Eingrenzung der Fragestellung.................................................................................................16
4.1.4 | Das Modell der exemplarischen Öffentlichkeit .......................................................................16
4.2. | Habitus
Forschungslogisches Instrument ........................................................................................................17
4.3. | Wahrheitstheorien
Theoretische Konzepte der Wikipedia und ihre Begründbarkeit .......................................................19
4.4 | Praxis
Online-Feldforschung ........................................................................................................................20
4.4.1 | Sequenzanalyse .......................................................................................................................20
4.4.2 | Theoretische Einbettung der Sequenzanalyse .........................................................................21
4.4.3 | Datengrundlage ......................................................................................................................22
4.4.4 | Fallauswahl .............................................................................................................................22
5 | Stand der Forschung zur Wikipedia ............................................................................. 23
6 | Zeitplan ...................................................................................................................... 25
2019 – Vorarbeiten zur empirischen Untersuchung ..........................................................................25
2020 – Feldforschung (muss finanziert sein) .....................................................................................25
2021 – theoretische Konzepte, Einordnung der Forschungsergebnisse ............................................25
2022 – Abschlussanalyse und Zusammenfassung der Ergebnisse .....................................................25
2023 – Publikation ........................................................................ Fehler! Textmarke nicht definiert.
7 | Literatur3 1 | Einführung Der 13. März 2012 ist ein historisches Datum. An diesem Tag stellte die gedruckte Encylopædia Britannica ihr Erscheinen ein: 244 Jahre nach ihrer Erstausgabe, elf Jahre nach der Gründung der Wikipedia. Heute ist kein allgemeinbildendes Nachschlagewerk mehr in gedruckter Version erhältlich. Ein gutes viertel Jahrtausend zuvor hatten Diderot und seine Mitstreiter mit der legendären »encylopédie« das vom Klerus verordnete Weltbild vom Kopf auf die Füße gestellt. Dem früheren CEO der Encyclopædia Britannica Inc. zufolge war »Das Internet […] der letzte Nagel zum Sarg«. Wer ein aktuelles Lexikon konsultieren möchte, ist unvermeidlich auf Online-Enzyklopädien verwiesen. Allerdings wird er vermutlich nicht »im Internet« nachschlagen, wie das Zitat suggeriert. Viel zu unsicher, unverbindlich und offensichtlich interessengeleitet sind die dort auffindbaren Informationen. Er wird auch nicht die Online- Ausgabe der Encyclopædia Britannica heranziehen, wie man schlussfolgern könnte. In der Mehrzahl der Fälle, wird er die Wikipedia zu Rate ziehen – was auch Google ihm standardmäßig vorschlägt. Die unauffällige Omnipräsenz der Wikipedia ist ein Faktum – ganz unabhängig von ihrem mehr oder weniger guten Ruf. Auch wer die Wikipedia widerwillig oder skeptisch konsultiert, wird am Ende – sofern er nicht über eigene Expertise verfügt – die dort gefundenen Informationen repetieren. Seriöser als die auf einer kommerziellen oder von Interessen- gruppen lancierten Website gefundenen – so die Annahme – werden sie allemal sein. Die Wikipedia liegt weltweit an fünfter Stelle der am häufigsten aufgerufenen Websites, hinter Google, Youtube, Facebook und Baidu. Sie erscheint in knapp 300 Sprachen, enthält fast 48 Millionen Artikel die von rund 60 Millionen »Autoren« und »Autorinnen« verfasst, verändert, ergänzt, redigiert und korrigiert werden. Die Zeit des gedruckten Nachschlagewerks ist ein für alle Mal vorbei. Anfangs glaubten die Herausgeber der Encyclopædia Britannica noch, dass es sich nur um eine Umstellung des Formats, der Präsentationsform handeln würde. Die Enzyklopädie sollte dem entsprechend in einer Online-Version weiter erscheinen. Das tut sie bis heute. Sie steht
4 damit allerdings nicht auf Platz fünf sondern auf Platz 2.624 aller Websites, mit einer Zugriffsrate, die von der Wikipedia um das 177-fache übertroffen wird.1 Denn nicht nur die Zugriffsweise auf »Nachschlagewerke« hatte sich geändert, auch die Art der Produktion einer Enzyklopädie wurde vollständig transformiert. Rückblickend sprach man davon, die Herausgeber traditioneller Lexika hätten die Entwicklung ›verschlafen‹, hätten einäugig auf das Publikationsformat geschielt und nicht erkannt, dass das Internet auch nach neuen Formen der Produktion und Organisation verlangt. Aber: Hätten Sie das vorhersehen können? Nicht einmal Larry Sanger und Jimbo Wales – die ›Erfinder‹ der Wikipedia – sahen diese Entwicklung voraus. Sie wagten zunächst nur einen kleinen Schritt. Die »Nupedia« genannte Online-Enzyklopädie sollte von Experten (und Expertinnen2) verfasst werden, welche sich schriftlich zu bewerben hatten und deren Artikel ein Peer-Review-Verfahren durchlaufen mussten. Diesem Projekt war keinerlei Erfolg beschieden. Nach 18 Monaten waren gerade mal 20 Artikel erschienen.3 Erst als Jimbo Wales ein »fun project«4 startete und damit den radikalen – und von seinem Mitstreiter abgelehnten – Schritt vollzog, das Verfassen von Artikeln für alle freizugeben, entwickelte sich die jetzt Wikipedia genannte Website explosionsartig. Innerhalb von einem Jahr stieg die Artikelzahl auf 40.000, um bereits drei Jahre später die Millionengrenze zu überschreiten. Das neue »Leitmodell« einer Enzyklopädie war geschaffen. Es umfasst, neben der neuartigen Präsentation und dem veränderten Zugriff, vor allem ein völlig neuartiges Modell der Arbeitsorganisation und darüber hinaus eine Neufassung des Begriffs von Objektivität. 1 https://www.similarweb.com/website/britannica.com?competitors=wikipedia.org, abgerufen am 29.10.2018. 2 Um beide Geschlechter zu berücksichtigen wird in der Schreibweise alterniert, es werden beide Geschlechter erwähnt oder eines wird in Klammern gesetzt. Letzteres deutet an, dass zwar eine einigermaßen gleichgewichtige Teilhabe erwünscht wäre, aber nicht der Realität entspricht, wie z.B. in der Wikipedia. 3 https://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Nupedia&oldid=181146303, permanent link vom 23.9.2018, abgerufen am 28.10.2018. 4 »Finally, weʼd like to announce a fun project loosely associated with Nupedia, Wikipedia. Have a look and write a paragraph or two!«, lautet die initiale Ankündigung von Jimbo Wales. Vgl. https://web.archive.org/web/20010118225800/http://www.nupedia.com/, »way back machine«, aufgerufen am 28.10.2018.
5 2 | Kontext 2.1 | Digitalisierung Heute reiht sich das Projekt Wikipedia in einen Zusammenhang gesellschaftlicher Umbrüche ein, die seit einigen Jahren unter dem Schlagwort Digitalisierung diskutiert und zunehmend auch von der Wissenschaft beforscht werden (so legte z.B. der Schweizer Nationalfonds vor Kurzem ein 30 Millionen Franken schweres nationales Forschungsprogramm zum Thema »digitale Transformation« auf). Der äußerst unscharfe Begriff der Digitalisierung umfasst dabei Phänomene wie Industrieroboter, selbstfahrende Autos, alternative Formen der Zimmervermittlung (Airbnb) oder auch neuartige Geschäftsmodelle, die auf Datenhandel basieren. Dem entsprechend werden epochale Zeitenumbrüche diagnostiziert. So erkennt Dirk Baecker (2018) einen menschheitsgeschichtlichen Viersprung von oralen Kulturen, über schriftliche Kulturen und Buchdruck-Kulturen bis hin zur Internet-Kultur. Ähnlich weit ausholend verortet Daniela Pscheida (2007) in Anlehnung an Marshall McLuhan die Wikipedia am Übergang von der »Gutenberggalaxis« zur »Turing-Galaxis« (Coy 1996). Schnell wird aber deutlich: Die Vielzahl an Beobachtungen und die Unterschiedlichkeit der zur Zeitdiagnose herangezogenen Phänomene fordert eine Differenzierung in der Sache. Im folgenden Schema wird versucht die geplante Forschungsarbeit in diesen Diskurs einzu- ordnen und das Forschungsfeld damit einzugrenzen.
6
Bereiche der Digitalisierung Digitalisierung
(grobe Entwurfsskizze |ohne jeden Anspruch auf Vollständigkeit)
Arbeitswelt Konsum Mobilität Kommunikation Wissensorganisation
automati- Digitalisie- Digitalisierung- Fahrzeuge email
sierung in rung d. Musik mobilitäts- internet
Industrie Verwaltung Film dienstleistung ›facebook‹ gesellschaftlich kulturelles Wissen instrumentelles Wissen
& Reiseplanung (›uber‹).... ›whats app‹
Industrie 4.0 (›airbnb‹) ....
relevantes Wissen Kunst & Ästhetik Technik & Verwaltung
Medizin smart home
Bildung Internet der Dinge
.... games
...
Meinungsbildung
politische Willensbildung
Wissensvermittlung
Wissensproduktion
Wissensorganisation
Organisationsebenen & formen
Digitale Vernetzung der
Wissenschaft Enzyklopädien journalistische Erzeugnisse soziale Netzwerke Bildungsinstitutionen
open science
Digitale Recherche
›google scholar‹ verschiedene Varianten und Kombinationen in der Praxis vorhanden
...
open source global kleine und mittlere private öffentliche
peer production agierende Unternehmen Träger Hand
Gemeingüter Konzerne (kmU) Verbände
(Privat)eigentum an Software | Daten
Fachwikis u.ä. 1 Symbiosen Kooperationen Mischformen
Wikipedia
›Produktion‹ ›Konsum‹ | Rezeption
An dieser Stelle setzt die Studie an UGC 1: Symbiose Wikipedia – Google
Engt man das breite Spektrum der Digitalisierungsfolgen auf den engeren Sektor der
Meinungs- und Willensbildung ein, so ist man schnell mit einem spezifischen Typus zeit-
diagnostischer Theorien konfrontiert: Der klassische Journalist hat ausgedient, dessen Gate-
keaper-Funktion ist hinfällig geworden, Qualitätssicherung durch Ausbildung, Berufsethos
und Standesorganisationen wie Presserat und Pressekodex ist im Niedergang begriffen, die
sozial bindende und intellektuell einende Kraft öffentlich rechtlicher Fernsehsender scheint
ebenso dahin, wie jene der großen Volksparteien. Vielmehr organisieren sich die Menschen in
sozialen Netzwerken ihre eigenen Zugehörigkeiten, basteln sich (bestenfalls) ihre eigenen
Welten oder werden großflächig von finanzstarken Akteuren manipuliert. Filterblasen und
Fake News sind hier die aktuellen Schlagworte und es ist klar: Die Wikipedia ist nicht
gemeint. Wikipedia stellt aus dieser Sicht vielmehr die andere, die »seriöse Seite« des
Internets dar. Dabei ist interessant zu beobachten, wie einstmals kritisierte Medien angesichts
von wiedererstarkendem Rechtsradikalismus und Nationalismus, rückblickend als Garanten
des Qualitätsjournalismus geadelt werden. Das früher als schnelllebig und oberflächlich
kritisierte Format der Tageszeitung steht heute für seriöse Recherche. Der Begriff Gatekeaper
– von seinem Erfinder als kritischer Seitenhieb gegen die Definitionsmacht der Journalisten
gemeint (Lippmann 1964) – symbolisiert unterdessen die Qualitätssicherungsinstrumente der
Standesorganisation. Die breitenwirksamen Bindekräfte des öffentlich-rechtlichen7 Fernsehens, das man heute mit Händen und Füßen gegen den kommerziellen Einheitsbrei der Privatsender verteidigen möchte, galten Habermas (1990; orig. 1962) in seiner Studie zum Strukturwandel der Öffentlichkeit noch als Verfallsform bürgerlicher Diskurskultur. Wenn sich solchermaßen mit den Phänomenen auch die Beurteilungsmaßstäbe, mit denen diese evaluiert werden, verschieben, so ist es notwendig die eigenen Untersuchungsmaßstäbe auszuweisen und theoretisch zu verankern. Im Forschungskonzept wird dargestellt, auf welchem Weg dies erfolgen soll. 5 Zunächst aber ist die Wikipedia in den Kontext der Digitalisierungsdebatte einzuordnen. 2.2 | Vorgeschichte der Wikipedia: Digitalisierung und Open Source Mittelbare Auswirkungen der Digitalisierung ergeben sich seit den 1970er Jahren aus der Umstrukturierung der Arbeitswelt durch die Entwicklung digitaler Steuerungstechnik und Automatisierung 6 und dann aus der Umstellung sämtlicher Verwaltungsvorgänge. Als nächster Schub kann die Digitalisierung der öffentlichen Kommunikation bezeichnet werden, welche unter anderem den ganzen Sektor der Printmedien betrifft und umwälzt. Während ursprünglich versucht wurde, tradierte Geschäftsmodelle auf das neue Medium zu übertragen 7 , Dienstleistungen also als Bezahlservice anzubieten oder über unmittelbare Werbeeinblendungen zu finanzieren, setzte sich bald die mittelbare Werbefinanzierung über den Datenhandel als Geschäftsmodell durch. Schon früh stellten sich andere Akteure gegen diese, wie sie es nannten, Kommerzialisierung des Netzes und formierten sich zu einer sozialen Bewegung. Aus ihr entwickelte sich nicht nur eine spezifische, auf Ehrenamt basierende, Unternehmensform, es entstand auch eine neue Form vernetzten Zusammen- arbeitens. Der Open-Source-Bewegung ging es darum, die Privatisierung eines aus ihrer Sicht öffentlichen Gutes, des Quellcodes, zu verhindern: »All software should be free in the sense of free to change, modify, rewrite, adapt.« (Williams 2002, 11) Erste Projekte »offen« vernetzter Zusammenarbeit entstanden in der Softwareproduktion (z.B. Linux- Betriebssystem). In der rückblickenden Interpretation war ein neues Modell der kooperativen Produktion geboren, das Raymond (2000) als das Prinzip des »Basars« beschrieb und jenem der »Kathedrale« entgegensetzte: dem geplanten, durchdachten und dann arbeitsteilig durchgeführten Bau einer Kathedrale stand nun die anarchisch, wildwuchernde ›Architektur‹ 5 Vgl. insbesondere Kapitel 4.3. 6 Wenn heute vor Arbeitsplatzverlust durch Digitalisierung gewarnt wird, so ist daran zu erinnern, das beispielsweise das Fiatwerk in Termoli bereits 1984 in der Lage war, mit 30 Arbeitsplätzen inklusive Putzpersonal täglich 2500 Motoren zu produzieren: Das heißt, ein Angestellter konnte in 10 Minuten einen Automotor herstellen (Bornschier 1988, 106). 7 So glaubte die Encyclopædia Britannica anfangs den Preis für Ihre erste Ausgabe auf CD ROM mit 1000,- US-Dollar festsetzen zu können, was rückblickend kaum nachvollziehbar ist.
8
eines Basars gegenüber, welcher zur allgemeinen Überraschung erfolgreiche Produkte
hervorbrachte. Diese Vorgeschichte in der Open-Source-Bewegung ist für das Verständnis
der Wikipedia zentral:
- Aus ihr entwickelt sich der technische Baustein, welcher die Wikipedia überhaupt
ermöglicht: das »Wiki«.8
- Sie lieferte die zündende Idee für die Wikipedia: das nicht hierarchische, ungeplante
Zusammenarbeiten vieler Akteure an einem Projekt.
- Sie bietet mit dem Konzept der Offenheit (»Openness«) 9 zugleich das ideologische
Fundament, welches für viele »Wikipedianer«, wie sie sich selbst nennen, die
Motivationsgrundlage ihres Engagements darstellt.10
2.3 | Das Exemplarische der Wikipedia
Die Wikipedia wird von mir als Gegenstand ausgewählt, weil sie ihren Erfolg einer spezifi-
schen Form der öffentlichen Online-Kooperation verdankt, welche prägend ist für zahlreiche
nicht kommerzielle Angebote des Internets: Crowdworking, wie es im Szene-Jargon heißt,
oder eben UGC (»user generated content«). Sie hat sich nicht nur im Sektor der Online-
Enzyklopädien eine stabile Monopolstellung erworben11, sondern steht in ihrem Beharren auf
Werbefreiheit 12 , Ehrenamtlichkeit und Spendenfinanzierung, wie auch ihrem Credo, das
Wissensmonopol der Eliten einzuebnen, für eine spezifische, keineswegs widerspruchsfreie,
Forderung nach einer Transformation der Öffentlichkeit. Da ich die strukturellen Effekte der
Digitalisierung untersuchen will und nicht das Potenzial ihrer Ausbeutung, nehme ich die
Wikipedia in den Fokus und nicht Phänomene wie Datenhandel oder Microtargetting. Dabei
ist selbstverständlich zu berücksichtigen, dass die Frontstellung zu kommerziellen Anbietern
eine Selbstzuschreibung der Akteure ist, die kritisch beleuchtet werden muss. Auch ein auf
Ehrenamt beruhendes Unternehmen ist bei über 90 Millionen Jahresumsatz ein
privatwirtschaftlicher Akteur und Spendenfinanzierung kann zunächst als alternatives
Geschäftsmodell betrachtet werden, ähnlich wie Werbefinanzierung oder Datenhandel statt
8
Zur Technik der Wikis und ihren Implikationen vgl. Ebersbach, Anja et al. 2008.
9
Vgl. Tkacz 2014, der die Widersprüche der Openness-Bewegung in ihrer Bedeutung für die Wikipedia aus der
Begriffsgeschichte des Konzeptes der Offenheit bei Popper und Hayek rekonstruiert.
10
Dies zeigt nicht nur die Studie von Stegbauer (2009), sondern spiegelte sich auch in Interviews, welche ich im Vorfeld mit
»Wikipedianern« geführt habe.
11
Versuche, ein Konkurrenzunternehmen aufzubauen, selbst von finanzstarken Playern wie Google, mussten aufgegeben
werden: Google Knol wurde 2011 nach nur drei Jahren, wieder eingestellt (https://de.wikipedia.org/wiki/Knol).
12
Dies ist auch als Tribut an die Ehrenamtlichkeit zu sehen. Als Larry Sanger 2002 die Möglichkeit von
Werbeeinblendungen auf der Wikipedia nur erwähnte, sprangen die aktivsten Mitglieder der spanischen Wikipedia ab und
gründeten die enciclopedia libre. Ein Schock, von dem sich die spanischsprachige Wikipedia erst nach Jahren erholen konnte,
als ihre Klickraten jene der enciclopedia libre wieder erreichten.9
Bezahlservice. In der Untersuchung wäre zu analysieren, worin die tatsächlichen, harten
Unterschiede zu einem kommerziell ausgerichteten Unternehmen denn bestehen.
Noch ein anderer Aspekt macht die Wikipedia als Studienobjekt interessant: Sie ist ein Portal,
dass sich im Gegensatz zu den Online-Auftritten der klassischen print- oder audiovisuellen
Massenmedien in einer Phase der Institutionalisierung und der Herausbildung von Qualitäts-
sicherungsinstrumenten wie Regeln, Routinen und Habitus befindet. Solche Entwicklungs-
phasen zu beobachten, ist wissenschaftlich von besonderem Reiz, da in der inneren Dynamik
des Institutionalisierungsprozesses und den daraus resultierenden Konflikten Strukturmerk-
male einer Institution sichtbar werden. Sie liegen noch nicht vollständig unter institutionellen
Vorkehrungen und Routinen verborgen.
3 | Fragestellung
Mit dem vorgestellten Projekt möchte ich am Beispiel der Wikipedia untersuchen, welche
neuen Diskurspraktiken sich durch netzwerkgestützte Modelle kollektiver
Wissensorganisation herausbilden, welche Orientierungspunkte und Wahrheitskriterien sich
dabei durchsetzen und was dies im Hinblick auf einen öffentlichen Diskurs bedeutet.
Die Fragestellung wird unter drei Gesichtspunkten angegangen:
1. Sie erscheint zunächst als wissenssoziologische Fragestellung, die in einer Mikro-
analyse die Praktiken innerhalb der Wikipedia, sowie ihre institutionelle Rahmung
untersucht.
2. Zugleich stellt sich aber die wissenschaftstheoretische Frage, welche normativen Leit-
linien dieser Wissensorganisation zugrunde liegen und inwiefern sie zeitgenössischen
wissenschaftstheoretischen Erkenntnissen gerecht werden. Hier wird es darum gehen
die Prinzipien und Praktiken des Diskurses aus der Perspektive der Argumentations-
theorie zu untersuchen und einer kritischen Bewertung zu unterziehen.
3. Es wird darum gehen, die Bedeutung dieser Diskurspraktiken für den aktuellen
»Strukturwandel der Öffentlichkeit« (Habermas 1990) zu klären. Der Begriff der
Öffentlichkeit steht dabei im Zentrum der gesellschaftstheoretischen Erörterung des
Gegenstandes.10 3.1 | Begriffliche Abgrenzung und Arbeitshypothesen Im Untertitel der Arbeit wird der Begriff Wissensorganisation verwendet, obwohl die Be- griffe Wissensproduktion oder Wissensvermittlung geläufiger und in der sozial-wissenschaft- lichen Literatur etabliert sind. Ich möchte mit diesem Begriff zum einen dem Umstand Rech- nung tragen, dass die Netzkultur für die Aufhebung der klaren Trennung von Produzenten und Konsumenten steht und beide dort in der Figur des »Prosumers« vereint werden (ob zu Recht oder zu Unrecht bleibt für die Forschung offen, das Forschungsdesign sollte solche Offenheit aber ermöglichen und die Frage nicht begrifflich vorentscheiden). Aus dieser Sicht wäre es irreführend, Abläufe im Rahmen von »user generated content« analog zu einer Produktionslogik zu konzeptualisieren, wie dies häufig geschieht. Ich vermeide daher nach Möglichkeit den Begriff Wissensproduktion ebenso wie jenen der Wissensvermittlung und spreche von Wissensorganisation. Der Organisationsbegriff umfasst die formalen, organisatorischen und technischen Eigenheiten einer Institution ebenso wie die (organisierte) Tätigkeit, der in ihr handelnden Akteure (vgl. Kap. 4.2 »habitus«). Eigentliche Wissensproduktion findet hingegen weder in Zeitungen oder Rundfunkanstalten noch in der Wikipedia statt. In der Wikipedia wird eine solche sogar durch die Statuten ausgeschlossen (»keine Theoriebildung«13). Wissensvermittlung hingegen erscheint mir als Begriff einerseits zu pädagogisch, andererseits zu schwach: Wissen wird in einer Enzyklopädie nicht nur vermittelt, es wird ausgewählt, gewichtet, umformuliert, eingeordnet und angeordnet. Diesen Vorgängen gilt das Interesse der anvisierten Studie. Der Fokus der empirischen Untersuchung liegt dementsprechend auf den Aushandlungsprozessen innerhalb der Wikipedia (vgl. Kap. 4.4). Im Untertitel verwende ich zudem den Begriff Wissen und nicht Information. Die ein- schlägige Literatur unterscheidet in der Regel zwischen Wissen, Information und Daten. Wissen ist dabei nicht nur der Begriff, der traditionell mit Enzyklopädien in Verbindung gebracht wird. Er beinhaltet gegenüber Information auch einen qualitativen Mehrwert. Auch wenn der Begriff Wissen nicht ganz so weitreichende normative Implikationen aufweist wie der Begriff Bildung, so beinhaltet er doch einen Bezug auf die Sinnhaftigkeit des Gewussten, während Informationen – hier den reinen Daten deutlich näher – noch frei sind von jeglichen über ihren propositionalen Gehalt hinaus gehenden Sinnbezügen. Gerade wenn man die 13 Es gehört zu den Grundprinzipien der Wikipedia, dass nur vorhandenes Wissen wiedergegeben, aber kein neues Wissen erzeugt werden soll: »Einer der Grundsätze bei der Erstellung dieser Enzyklopädie ist: Die Wikipedia bildet bekanntes Wissen ab. Sie dient der Theoriedarstellung, nicht der Theoriefindung.« (https://de.wikipedia.org/wiki/Wikipedia:Keine_Theoriefindung)
11 Transformation der Wissensorganisation untersucht, ist es nicht ratsam, mögliche Verschiebungen auf dieser Achse durch begriffliche Vorentscheidungen aus dem Ge- genstandsbereich der Untersuchung auszuschließen. Diese begriffliche Klärung leitet auch zu einer der Arbeitshypothesen der anvisierten Untersu- chung über, wie sie sich im Titel andeutet. Ähnlich wie man es bei den durch die Fake-News- Debatte hervorgebrachten Faktencheckern beobachten kann, findet sich in der Wikipedia eine Beschränkung der Geltungsprüfung auf Fakten und Daten. Deren Relevanz, deren Bedeutung für den Gegenstand und deren Stellenwert im Rahmen eines Argumentations- zusammenhanges scheint sich einer Überprüfbarkeit zu entziehen. Geprüft wird die Wahrheit von Informationen, nicht die Angemessenheit des eingebrachten Wissens oder die Breite eines Deutungshorizontes. Die Qualität von Argumenten, deren Beurteilung zwar intuitiv leicht, deren erkenntnistheoretische Fundierung aber hinlänglich schwer fällt, ist – zumindest auf der Ebene der formalen Statuten – kein Kriterium, dem sich die Wikipedianer bei ihrer Arbeit stellen müssten. Für die Praxis ist diese Feststellung allerdings zu relativieren: Ähnlich wie man bei »Faktencheckern«14 beobachten kann, dass deren Autoren und Autorinnen das eng gesteckte Feld der reinen Faktenprüfung schnell verlassen, wenn schlechte Argumente mit richtigen Fakten belegt werden, erlebt man in der Wikipedia, dass automatisch argumentiert wird, auch wenn ein schlichter Beleg jegliche Debatte über die Relevanz eines dargebotenen Faktums abwürgen könnte. In beiden Fällen scheint zu gelten: die Praxis ist besser, als die Theorie vermuten lässt. Die Theorie aber birgt ihre eigenen Schwierigkeiten, will sie nicht Wahrheit an Mehrheiten assimilieren 15 , will sie aber auch nicht den scientistischen Welterklärungen des 19. Jahrhunderts folgen und hinter die Erkenntnisse der Sprechakttheorie zurückfallen. Ohne eine Auseinandersetzung mit der Argumentationstheorie scheint eine Analyse faktischer Diskurse jener Kriterien zu entbehren, deren Abwesenheit im Untersuchungsgegenstand zu problematisieren ist. 4 | Forschungskonzept Die Fragestellung erfordert ein Forschungskonzept, welches die verschiedenen Ebenen der Untersuchung unterscheidet, klar strukturiert und es ermöglicht, sie aufeinander zu beziehen. 14 Damit sind die so benannten journalistischen Formate gemeint, die seit der Fake news Debatte aus dem Boden spriessen. 15 Jimbo Wales schreibt an prominenter Stelle zu den Konsequenzen des »neutral point of view«: »If a viewpoint is held by an extremely small minority, it does not belong on Wikipedia, regardless of whether it is true or you can prove it […].«
12
Die folgende Skizze soll einen ersten Überblick über die Dimensionen der Untersuchung
geben:
Makro Ebene
Öffentlichkeit
in Bezug auf Wissen:
Auswahl
Anordnung
Geltungsüberprüfung
Diskurs
lange Vorgeschichte: Sprechakttheorie
Encyclopédistes & Aufklärung
materiale Dimension
Geltungsansprüche
formale Dimension
Argumentationstheorie
kurze Vorgeschichte:
Vorgeschichte
Open source & Konsenstheorien der
›freies Wissen‹ Wahrheit
»neutral point of view«
Gesprächskultur Pariser Salons formale Organisationsstruktur
(Salons des 18. vs. 17. Jh.) der Wikipedia
informelle Regeln der
Wikipedia
Habitus
Untersuchung der
Wikipedia-Praktiken
Sequenzanalyse
Praktiken
Mikro Ebene
Es stellt sich auf verschiedenen Ebenen das Problem der Verallgemeinerbarkeit der gewonnen
Erkenntnisse und damit die Frage nach dem Zusammenhang zwischen Mikro- und Makro-
Ebene. In den folgenden Absätzen werden die drei Dimensionen, wissenssoziologische Em-
pirie, Wissenschaftstheorie und Gesellschaftstheorie in umgekehrter Reihenfolge näher er-
läutert und auf die Fragestellung der Arbeit hin konkretisiert.13
4.1 | Öffentlichkeit
Theoretischer und historischer Zusammenhang
4.1.1 | Theoriegeschichtlicher Kontext
»Am Strukturwandel der bürgerlichen Öffentlichkeit lässt sich
studieren, wie es vom Grad und der Art ihrer Funktionsfähigkeit
abhängt, ob der Vollzug von Herrschaft und Gewalt als eine
gleichsam negative Konstante der Geschichte beharrt – oder
aber, selber eine historische Kategorie, der substantiellen
Veränderung zugänglich ist.«
Habermas 1962
Heute scheinen wir erneut an einer Schwelle zu stehen, an der die historische Kategorie
»Öffentlichkeit« sich im Umbruch befindet. Die Beantwortung der Frage, ob die negative
Konstante, von der Habermas in seiner richtungsweisenden Studie 1962 spricht, sich durch-
setzt, wird auch davon abhängen, welche der gegenwärtigen Trends im Prozess der Digitali-
sierung sich durchsetzen. Zu beobachten sind derzeit zwei gegenläufige Bewegungen, die
man grob vereinfachend wie folgt beschreiben kann: Auf der einen Seite die Verwertungs-
logiken marktbeherrschender Anbieter im Bereich Social Media, auf der anderen Seite die
Kräfte, welche die neuen Kommunikationsmedien freigesetzt haben und die zu ganz neuen
Formen der Kooperation, des Austausches, des Diskurses und der Informationsverbreitung
geführt haben. Um diese Entwicklung auf den Begriff der Öffentlichkeit zurückzubeziehen,
ist kurz Habermasʼ These zu deren Strukturwandel zu rekapitulieren. Ausgehend von einer
idealisierten Rekonstruktion16 der bürgerlichen Öffentlichkeit des 18. Jahrhunderts entlang
publizistischer Tätigkeiten, Caféhaus- und Salonkultur und den legendären Arbeitszusammen-
hängen der »encyclopédistes« schlägt er einen weiten Bogen in die Mitte des zwanzigsten
Jahrhunderts, um dort den Verfall der bürgerlichen Öffentlichkeit unter dem Diktat der
Massenmedien zu konstatieren. Die einstmals in der Öffentlichkeit diskutierenden Bürger
würden in die Rolle passiver Konsumenten gedrängt: Die neuen Medien »ziehen das
Publikum als Hörende und Sehende in ihren Bann, nehmen ihm aber zugleich die Distanz der
›Mündigkeit‹, die Chance nämlich, sprechen und widersprechen zu können.« (Ebd., 261) Aus
dieser stark verkürzten Darstellung zu Habermasʼ Theorie lässt sich leicht die These ableiten,
dass die Digitalisierung diese Deformation des öffentlichen Diskurses, die unter der Herr-
16
Dies konzediert auch Habermas selbst im Vorwort zur Neuauflage 1990 (ebd., 15).14 schaft der Massenmedien entstand, überwindet und die Bürger und Bürgerinnen aus der Rolle passiver Konsumenten befreit (vgl. z.B. Hansen et. al 200917, kritisch dagegen z.B. Ochs 2018, der fordert, dass "Mauern, Wände, Vorhänge, Separees, Kaffehäuser, […]" in die Datenlandschaft eingebaut werden. (ebd. 184f.)) Es ist deutlich, dass eine solche, positive These sich nur auf jene Trends innerhalb der Digitalisierung beziehen lässt, in welcher zumindest der Anspruch auf einen allgemeinen und öffentlichen Diskurs verteidigt wird. Hier scheint es Kommunikationsformen zu geben, die sich zum alten Ideal der bürgerlichen Öffentlichkeit in Beziehung setzen lassen und gleichzeitig aufgrund der neuartigen Kommunikationsmöglichkeiten eine bislang unbekannte Form des öffentlichen Diskurses hervorbringen. Den Charakteristika dieser neuen Formen gilt das Interesse der anvisierten Studie. Im folgenden Absatz wird dargestellt, wie das Konzept der Öffentlichkeit auf die geplante Untersuchung hin spezifiziert werden soll. 4.1.2 | Eingrenzung des Begriffs der Öffentlichkeit im Hinblick auf die Forschungsfrage Zur Öffentlichkeit zählen der öffentliche Diskurs, der öffentliche Raum und das öffentliche Le- ben. Auch wenn die Begriffe nicht trennscharf und auch nicht auf der gleichen logischen Ebene angesiedelt sind, so sollte doch zwischen ihnen unterschieden werden. Während öffent- liches Leben und öffentlicher Raum die physische Anwesenheit der Subjekte unterstellen, ist der öffentliche Diskurs in modernen Gesellschaften weitestgehend medial vermittelt. Unter- dessen spricht man jedoch auch von virtuellen Räumen, sodass auch von einem Diskursraum gesprochen werden kann, der keine physische Anwesenheit verlangt. Im Folgenden wird der Begriff des öffentlichen Raumes im Sinne spezifischer Zugangsmöglichkeiten und An- ordnungen für die Akteure auch auf virtuelle Räume ausgedehnt (zur Sonderstellung von physischen Räumen und ihrer Bedeutung für die Sozialwissenschaft vgl. Löw 2001). Das Attribut öffentlich zielt zum einen auf die Allgemeinheit der Zugangsmöglichkeiten, zum anderen aber auch auf Transparenz und öffentliche Kontrolle bei der Regulierung des öffent- lichen Raumes. Neben einem geschützten, nicht öffentlichen Privatraum ist daher auch der massierte Auftritt von privatwirtschaftlichen Akteuren im öffentlichen Raum als Gegen- konzept zu Öffentlichkeit zu betrachten. Zwar sind von jeher private Akteure wichtige Mit- spieler im öffentlichen Raum, ob es sich nun um Verleger, Publizisten oder private Fernseh- 17 Einige Autoren verfolgen diese These. Hansen et al. führen dies z.B. an der Wikipedia aus und kommen zu einem positiven Fazit: »While several challenges persist, the example of Wikipedia illustrates the positive potential of information systems in supporting the emergence of more emancipatory forms of communication.« (Hansen et al. 2009, 38)
15 sender handelt. Allerdings verändert sich deren Funktion qualitativ, wenn sie nicht mehr als Teilnehmer am Markt agieren, sondern strukturell bedingte Monopolstellungen einnehmen, wie sie für das Internet typisch sind. Bei einem bedeutenden Teil der Angebote im Netz geht es nämlich nicht um die Teilnahme an Märkten sondern um die Organisation von Märkten oder Marktplätzen. Während zwei Geschäfte mit vergleichbarem Angebot in produktiver Konkurrenz nebeneinander existieren können, funktionieren Marktplätze nach dem Gesetz: »the winner takes it all«. Das zentrale Qualitätsmerkmal eines Marktplatzes ist eben die An- zahl der Teilnehmer, aus der sich die Vielfältigkeit des Angebots ergibt, während bei benach- barten Geschäften die Vielfältigkeit durch die Anzahl der Konkurrenten entsteht. Aufgrund der Aufhebung räumlicher Distanzen im Internet entstehen für virtuelle Markplätze daher quasi natürliche Monopole.18 Für privatwirtschaftliche Akteure wie Google, Facebook, Ebay etc. gilt, dass Zugangsmöglichkeiten nicht allgemein sind, sondern in privatrechtlichen Verträgen festgelegt werden, dass Transparenz den Grundvorstellungen betrieblicher Konkurrenz widerspricht und eine öffentliche Kontrolle der Regulierungskriterien nur sehr eingeschränkt möglich ist19. In diesem Sinn ist das Internet teilweise als öffentlicher, teilweise jedoch als privatwirtschaft- lich organisierter Raum zu betrachten. Während ein Großteil der Studien zur Transformation der Öffentlichkeit im Internetzeitalter sich kritisch mit der Dominanz privatwirtschaftlicher Akteure und den Schwierigkeiten, deren Gebaren rechtlich einzuhegen auseinandersetzt, möchte die hier vorgestellte Arbeit sich bewusst mit einem auch dem Anspruch nach als öffentlicher Raum organisierten Netzwerk befassen. Damit wird verhindert, dass die Überla- gerung von Effekten, die auf die Spezifika der Netzlogik und Netzkultur zurückzuführen sind, mit Effekten, welche der Dominanz privatwirtschaftlicher Monopolisten geschuldet sind, die trennscharfe Analyse beider Phänomene verunmöglicht. Um es in traditioneller Terminologie auszudrücken: Auswirkungen, welche auf die Produktionsverhältnisse zurückzuführen sind, würden dem Stand der Produktivkräfte zugeordnet und umgekehrt (solche Verwechslung war von jeher ein Auslöser für Maschinenstürmerei und könnte auch heute Anlass für Digitalisie- rungsängste sein). 18 Häufig wird die Herausbildung solcher Monopole als typischer Netzeffekt bezeichnet, wobei übersehen wird, dass es nicht das Internet ist, sondern die Art des Geschäftsmodells, welches zum Monopol führt. Tausende von Möbelproduzenten bieten ihre Waren im Internet an, ohne dass es dabei zu irgendeiner Art von Monopolbildung kommt, die es nicht vorher schon gegeben hätte. »Konkurenz belebt das Geschäft« gilt eben für einzelne Anbieter, nicht aber für Marktplätze, zu denen neben Ebay, Amazon, Google, Airbnb (Ferienwohnungsmarkt) und Uber (Fahrdienstleistungen) auch Facebook (Kontakt-Markt), Youtube (Videomarkt) und Twitter (Nachrichtenmarkt) zu rechnen sind. 19 Die Schwierigkeiten angesichts des internationalen Auftretens der Unternehmen und der daraus resultierenden problematischen territorialen Lokalisierbarkeit strafbarer Handlungen zeigten sich eindrücklich für Justizminister Heiko Maas bei der Einführung des Netzwerkdurchsetzungsgesetzes (NetzDG).
16 4.1.3 Eingrenzung der Fragestellung Damit wird deutlich, dass die Studie nicht die Transformation der Öffentlichkeit im digitalen Zeitalter insgesamt untersucht. Sie untersucht jene Transformationen, die sich in einem bewusst als öffentlicher Raum organisierten Bereich ergeben. Offen bleibt dabei, ob das untersuchte Modell die Oberhand behält oder ob private Anbieter, die auf den Wissensmarkt vordringen (so z.B. Red-Bull-Gründer Dietrich Mateschitz mit seinem Portal Addendum, vgl. NZZ vom 16.12.2017), solche Akteure verdrängen werden oder ob sich am Ende Mischformen, Joint-Ventures oder Symbiosen 20 zwischen ehrenamtlich organisierten und profitorientierten Unternehmungen, wie sie derzeit im Kommen sind, durchsetzen. Eine Verallgemeinerung im erkenntnistheoretischen Sinn findet in der vorgestellten Studie nur von der Wikipedia auf einen bestimmten Typus des öffentlichen, im Internet organi- sierten, Diskurses statt und nicht auf andere Bereiche digitalisierter Öffentlichkeit. Dabei ist es Anspruch der Untersuchung herauszuarbeiten, welche Effekte der Logik des Netzes, insbe- sondere also der unmittelbaren Beteiligung einer unüberschaubar großen Anzahl von Akteuren, geschuldet und welche auf das spezifische, von den Gründern der Wikipedia gewählte, Konzept zurückzuführen sind. Damit einher geht selbstverständlich die Frage, welche alternativen Modelle es für die Wikipedia oder ähnliche Vorhaben denn realistischerweise geben würde. 4.1.4 | Das Modell der exemplarischen Öffentlichkeit Während man Habermas zu Recht – wie er selbst konzediert – vorgeworfen hat, dass er das elitäre und in den Zugangsmöglichkeiten begrenzte Modell der bürgerlichen Öffentlichkeit idealisiert und verallgemeinert hat, ist es dezidierte Absicht der hier vorgestellten Arbeit, die Wikipedia als Ort einer exemplarischen Öffentlichkeit zu konzipieren. Im Gegensatz zur Teilöffentlichkeit, welche das Bürgertum im 18. Jahrhundert repräsentierte, mit klaren Ausschlusskriterien über Bildung, Geschlecht und Einkommen, verfügt die exemplarische Öffentlichkeit, wie sie hier vorgestellt wird, über subtilere Ausschlusskriterien, die es genauer zu analysieren gilt. Als exemplarisch lässt sie sich bezeichnen, weil sie einen Zugang aller ermöglicht, auch wenn nur eine Teilmenge diese Möglichkeit nutzt. Die zu verhandelnden Themen werden von einer begrenzten Zahl an Personen diskutiert, die aber jederzeit austauschbar sind, bei der es keiner verbrieften Qualifikation bedarf und bei der es außer dem 20 Gern angeführt wird in diesem Zusammenhang die Symbiose zwischen Wikipedia und Google, wobei Google mit Hilfe der Wikipedia den ökonomischen Gewinn erzielt, den diese nicht machen darf, während es gleichzeitig der Wikipedia die Popularität besorgt, die sie für ihre Spendenfinanzierung benötigt.
17
Zugang zum Internet und der Fähigkeit, eine Tastatur zu bedienen, in der Theorie keine tech-
nischen Hürden gibt. Inwiefern sich der Begriff der exemplarischen Öffentlichkeit schärfen
lässt und inwiefern er sich gegen andere Konzepte der Repräsentation wie Delegation, Avant-
Garde oder Elite abgrenzen lässt, wäre zu untersuchen.
Ein Verallgemeinerungsschritt auf oberster Ebene findet also statt, indem die Wikipedia als
Beispiel für eine exemplarische Öffentlichkeit gefasst wird (Siehe auch Kapitel 2.3, das
Exemplarische der Wikipedia).
4.2. | Habitus
Forschungslogisches Instrument
Will man in einer Falluntersuchung herausfinden, welche beobachteten Handlungen durch
individuelle Eigenschaften hervorgerufen sind und welche sich auf strukturelle Merkmale
einer Institution zurückführen lassen, so benötigt man ein theoretisches Modell, wie
Strukturmerkmale durch Akteure in Handlungen übersetzt werden. Das einfachste Modell ist
hier jenes der Arbeitsroutinen. Es eignet sich in herausragender Weise zur Erklärung der Ver-
haltensweisen von Angestellten in bekannten, sich regelmäßig wiederholenden
Alltagssituationen. Solche Routinen spielen gerade in der Wikipedia aufgrund der großen
Zahl repetitiver Vorgänge eine nicht unbedeutende Rolle. Allerdings gilt mein Interesse weni-
ger der alltäglichen, routinierten Artikelbearbeitung sondern den Aushandlungsprozessen im
Fall divergierender Meinungen. Gerade in Konfliktfällen werden eingeübte Alltagsroutinen
häufig verlassen. Etwas mehr Komplexizität lässt sich da mit dem Rollenmodell abbilden. In
Konfliktfällen wird beispielsweise gerne auf Hierarchien zurückgegriffen, welche die Akteure
in Rollen verinnerlicht haben.21 Rollen werden angeeignet, können aber auch gewechselt wer-
den, Akteure können verschiedene Rollen spielen, ohne dass ihre Identität dadurch in Frage
gestellt wird. Rollen liegen in diesem Sinn an der Oberfläche einer Persönlichkeitsstruktur.
Das Rollenmodell eignet sich besonders zur Erklärung von Verhaltensmustern in stark
arbeitsteiligen und hierarchisch strukturierten Institutionen. Dies trifft auf die Wikipedia aber
gerade nicht zu.
Stärker in die Tiefe gehen Rollenmodelle, welche biographisch angeeignete, stark
verinnerlichte Rollen zu ihrem Gegenstand machen, etwa Geschlechterrollen (man kann aller-
dings fragen, ob der Begriff der Rolle hier angemessen ist, da man die eigene Geschlechter-
rolle nicht im gleichen Sinn verlassen kann, wie man beispielsweise zwischen einer Vaterrolle
21
Auf diese Dimension hebt König in seiner kritischen Untersuchung zur Wikipedia ab (König 2014).18
und einer Angestelltenrolle wechselt). Hier greifen tiefenpsychologische Erklärungsmuster,
die auf ganze Gruppen, Gesellschaftsklassen oder eben Geschlechtszugehörigkeiten
angewandt werden. Ein Teil der Faschismusanalysen setzte bei tiefsitzenden aber kollektiv
geteilten Charakterstrukturen an, wie sie beispielsweise im »autoritären Charakter« zum Aus-
druck kamen. Für die vorliegende Arbeit sind solche tiefenpsychologischen Erklärungsmuster
wenig geeignet. Institutionen wie die Wikipedia nutzen höchstens solche Charakterstrukturen,
bringen sie jedoch nicht hervor. Benötigt wird also ein Konzept das zwischen dem Rollen-
modell und dem tiefenpsychologischen Charaktermodell auf einer mittleren Ebene ange-
siedelt ist. Hier bietet sich das ausgearbeitete Habituskonzept von Pierre Bourdieu (1993) an.
Bourdieu bezeichnet die Habitusformen als »strukturierte Strukturen, die wie geschaffen sind,
als strukturierende Strukturen zu fungieren, d.h. als Erzeugungs- und Ordnungsgrundlagen für
Praktiken und Vorstellungen, die […] objektiv ›geregelt‹ sind, ohne irgendwie das Ergebnis
der Einhaltung von Regeln zu sein, und genau deswegen kollektiv aufeinander abgestimmt
sind, ohne aus dem ordnenden Handeln eines Dirigenten hervorgegangen zu sein.« (Bourdieu
1993, 98f.) Diese Definition scheint prädestiniert, vernetzte Institutionen wie die Wikipedia
zu erklären. Es geht dabei um die Strukturen, die durch die expliziten Regularien der
Wikipedia und ihre innere Organisationsform hervorgebracht werden, ohne dass sie sich in
einer Ableitungslogik zwingend aus diesen ergeben. Es ist diese Ebene, welche die Praxis der
Wikipedia strukturiert und bestimmt, bei der es darum geht die Übersetzung der Reglemente
in eine Alltagspraxis durch die Akteure zu fassen. Diese kann nur durch eine empirische
Untersuchung, durch Beobachtung, erforscht werden. Sie kann nicht durch logische
Ableitungen aus den Statuten, Vorgaben und Organisationsprinzipien der Wikipedia
gewonnen werden. Insofern sich in der Beobachtung Strukturmuster erkennen lassen, die sich
wiederholen, die sich selbst bei unterschiedlichen Akteuren, mit unterschiedlichem
Charakter, in verschiedenen Situationen wiederholen, können wir die gewonnenen
Erkenntnisse verallgemeinern und der Institution als ihre Strukturmerkmale zuordnen.
Vor dem Hintergrund dieser theoretischen Vorüberlegungen gliedert sich die Untersuchung
der Wikipedia in zwei Ebenen:
1. die Ebene der formellen Regeln und technischen Vorkehrungen, welche die Arbeit in
der Wikipedia strukturieren. Diese können den Statuten und Reglementen der Wiki-
pedia entnommen und anschließend analysiert werden.19
2. die Ebene der Ausdeutung und Anwendung dieser Regeln durch die beteiligten
Akteure in der Alltagspraxis. Dies ist Gegenstand der empirischen Forschung, deren
Logik im übernächsten Absatz erläutert wird.
4.3. | Wahrheitstheorien
Theoretische Konzepte der Wikipedia und ihre Begründbarkeit
In einem ersten Schritt der Feldforschung sollen die offiziellen Regeln dargestellt und einer
genauen Analyse unterzogen werden. Hier wird insbesondere die innere Konsistenz und
Widerspruchsfreiheit des Regelwerkes von Interesse sein, denn an den Widersprüchen entste-
hen die Nahtstellen, an denen unterschiedliche Handlungsoptionen ansetzen. Bei einer
Organisation wie der Wikipedia, mit einer sehr großen und wechselnden Teilnehmerzahl und
beschränkten Möglichkeiten zum persönlichen und informellen Austausch, muss davon
ausgegangen werden, dass die offiziellen Regeln einen hohen Stellenwert in Bezug auf die
Steuerung der Alltagspraxis haben, auch dann, wenn sie von den Akteuren unterschiedlich
ausgedeutet und mit Leben gefüllt werden.
Der Verhaltenskodex der Wikipedia basiert zunächst auf den vier unverrückbaren Säulen, den
sogenannten »four pillars«, welche als einzige nicht von der Community modifiziert werden
dürfen.22 Diese Regeln sollen einer genaueren Analyse unterzogen werden. Insbesondere im
neutralen Standpunkt, dem sogenannten NPOV (»neutral point of view«) liegt das erkenntnis-
theoretische Fundament der Wikipedia. Hier entsteht der Bezug zur erkenntnistheoretischen
Dimension der Forschung. Insbesondere die Frage, ob das Ideal des Diskurses in der
Wikipedia sich an einem normativen Begriff der Qualität von Argumenten festmacht, oder am
faktischen und damit vorherrschenden Diskurs ausgerichtet ist, verweist unmittelbar auf die
Problemstellungen einer Konsensustheorie der Wahrheit (Habermas, 1984, 127ff.).
Unterhalb der »four pillars«, gibt es eine Reihe von Regeln, Wegleitungen und Tutorials,
welche von der Community ausgehandelt wurden und die Arbeit in der Wikipedia normativ
strukturieren. Hinzu kommen die technischen Vorkehrungen, über die der Zugang zu und die
Möglichkeiten der Beteiligung an der Wikipedia gesteuert werden.
Das Ensemble dieser Regeln definiert den Rahmen, welchen die Akteure in ihrer
Alltagspraxis ausdeuten und auch aushandeln. Von besonderem Interesse ist dabei, dass
sämtliche Regeln unterhalb der four pillars selbst Ergebnis eines kollektiven
22
In Kurzversion lauten diese: 1. Wikipedia ist eine Enzyklopädie, 2. Neutralität, 3. Freie Inhalte, 4. Keine persönlichen
Angriffe (https://de.wikipedia.org/wiki/Wikipedia:Grundprinzipien).20 Aushandlungsprozesses sind, welcher unter den gleichen Voraussetzungen und mit den identischen technischen Tools durchgeführt wurde, wie die Bearbeitung der Artikel selbst. Dadurch lässt sich bereits das offizielle Regelwerk auf zwei Ebenen analysieren: Neben den Regeln selbst können die Verhaltens- und Argumentationsmuster untersucht werden, welche deren Hervorbringung zugrunde lagen. 4.4 | Praxis Online-Feldforschung 4.4.1 | Sequenzanalyse Im Laufe des Institutionalisierungsprozesses werden die formellen Regeln in informelle über- setzt. Unter den Anforderungen der Alltagspraxis werden Routinen gebildet und die Beteilig- ten verinnerlichen die alltäglichen Reaktionsmuster in ihrem Habitus. Diese Ebene der laten- ten Sinnstrukturen soll in der Sequenzanalyse untersucht werden. Ziel der empirischen Untersuchung ist die Analyse der inneren Logik der Aushandlungsprak- tiken in der Wikipedia. Um dies zu erreichen, möchte ich ein Beobachtungsverfahren anwen- den, mit dem die Struktur des Diskurses jenseits der jeweiligen konkreten Inhalte in den Blick gerät. Es bietet sich die Methode der Sequenzanalyse an (Oevermann et al. 1979, Schütze et al. 1973, Soeffner 1989, Reichertz 2013).23 In der Sequenzanalyse wird der zu untersuchende Text in Sequenzen zerlegt, die in ihrer zeitlichen Abfolge analysiert werden. Der Fokus der Analyse liegt dabei auf der Entwicklung der Interaktion. Jede Sequenz wird in der Interpretationsgruppe zunächst daraufhin untersucht, welche theoretischen Anschlussmöglich- keiten sich aus ihr ergeben, um dann im zweiten Schritt herauszufinden, welche dieser Möglichkeiten faktisch realisiert wurden. In der fortschreitenden Interpretation des Textes verengen sich die anfangs weit gefächerten Deutungsmöglichkeiten zunehmend aufgrund der jeweils realisierten Anschlüsse und geben so die latente Sinnstruktur des Textes und damit die informellen Codes und Regeln, preis. 23 Die Sequenzanalyse wird im Wesentlichen in drei erkenntnistheoretisch leicht differierenden Varianten angewendet: der objektiven oder strukturalen Hermeneutik wie sie ursprünglich von Oevermann entwickelt wurde, der eher an der Grounded Theory (Glaserfeld/Strauss) orientierten »Bielefelder« Variante (Schütze) und der stärker phänomenologisch ausgerichteten »Konstanzer« Version (Soeffner). Ich orientiere mich stärker an der Oevermann’schen Variante und kombiniere das Verfahren aufgrund des Charakters unseres Gegenstandes mit Elementen der Konversationsanalyse, wie dies auch in der Konstanzer Schule praktiziert wurde (vgl. zur Konversationsanalyse Scheggloff/Sachs 1973, Eberle 1997).
21 4.4.2 | Theoretische Einbettung der Sequenzanalyse Die Sequenzanalyse kommt häufig in Kombination mit der Grounded Theorie oder phänomenologisch ausgerichteten sozialwissenschaftlichen Modellen zur Anwendung. Das induktive empirische Verfahren der Sequenzanalyse wird in diesem Fall durch eine ebenfalls induktive Form der Theoriebildung ergänzt. Dadurch entsteht mitunter der Eindruck, die Sequenzanalyse sei insgesamt ein Verfahren für induktives Vorgehen in der Sozialwissenschaft, auch wenn in der Praxis häufig eine Iteration zwischen Induktion und Deduktion vorherrscht. In der hier vorgestellten Studie soll das methodische Verfahren der Sequenzanalyse – wie oben ausgeführt – dezidiert in ein theoretisches Modell eingebunden werden. Das Konzept der Öffentlichkeit bildet die große theoretische Klammer, das Konzept des Habitus das forschungslogische Instrument zur Vermittlung von Theorie und Praxis. Es dient dazu, die Sequenzanalyse als Methode auf den Gegenstand zu kalibrieren, wie Reichertz (2016, 264) dies nennt. Da mit der Sequenzanalyse sehr unterschiedliche Ebenen der Interaktion untersucht werden können, ermöglicht erst die Klärung des Forschungsfokus »Habitus« eine zielgerichtete und damit auch arbeitseffiziente Anwendung der Sequenzanalyse. Es ist eine der Stärken der ausgearbeiteten Theorien zur Sequenzanalyse, dass die logischen Ebenen einer Interaktion sich trennscharf unterscheiden lassen. Eine andere Funktion in der hier vorgestellten Arbeit hat die Theorie der Öffentlichkeit. Sie bildet als theoretischer Kontext den Rahmen, innerhalb dessen die Ergebnisse der Sequenz- analyse interpretiert werden (ebd. 263 f.). Die irrige Annahme, die Sequenzanalyse fordere eine induktive Theoriebildung, entsteht gelegentlich auch durch den Grundsatz, Kontext- wissen müsse während der Analyse ausgeblendet werden. Der Begriff Kontextwissen muss hier jedoch ausdifferenziert werden. Die Sequenzanalyse unterscheidet zwischen drei Typen des Kontextes: Theoretischer Kontext, Konkreter oder äußerer Kontext und innerer Kontext (Reichertz 2016). Beim Deuten der Textsequenzen geht es ausschließlich darum, das Kontextwissen über die jeweilige Kommunikationsituation24 auszublenden. Dabei handelt es ich um einen Kunstgriff zur Verhinderung vorschneller Schlüsse vom bereits bekannten äußeren Kontext auf den inneren Kontext, wie er in der Gesprächssituation realisiert wird (Reichertz 2016, 265 f.). 24 Als »Situation« wird in der Hermeneutik der »Anwesenheitsraum« bezeichnet, innerhalb dessen sich soziale Akteure konkret begegnen (vgl. Goffman 1971, 29). In mediatisierten Gesellschaften entfernt sich dieser Begriff von der Vorstellung unmittelbarer physischer Anwesenheit (vgl. Knorr-Cetina 2012). Im Fall der hier geplanten Analyse entzerrt sich die Interaktionssituation darüber hinaus zeitlich, sodass der Begriff Situation nicht mehr dem Alltagsverständnis entspricht, sachlich aber noch angemessen ist. Die Konsequenzen dieser Entzerrung für die Forschung sollen im Rahmen der Studie diskutiert werden.
Sie können auch lesen