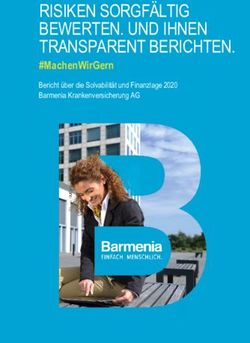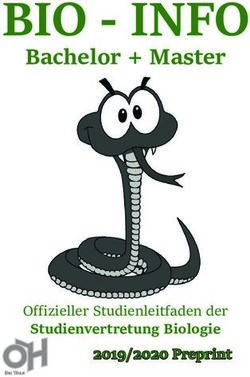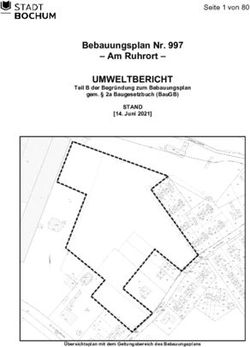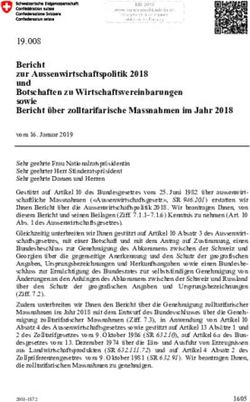Biologische Vielfalt. Gemeinsam für mehr Artenvielfalt.
←
→
Transkription von Seiteninhalten
Wenn Ihr Browser die Seite nicht korrekt rendert, bitte, lesen Sie den Inhalt der Seite unten
Hessisches Ministerium für Umwelt, Klimaschutz,
Landwirtschaft und Verbraucherschutz
Biologische Vielfalt.
Gemeinsam für mehr Artenvielfalt.
Hessischer Biodiversitäts-
bericht 2020
Bericht der Landesregierung über ergriffene
und geplante Maßnahmen zur Erhaltung der
Biologischen Vielfalt in Hessen
Berichtszeitraum 01.01. bis 31.12.2020
Hessisches Ministerium für Umwelt, Klimaschutz,
Landwirtschaft und Verbraucherschutz
E-Mail: biologischevielfalt@umwelt.hessen.de
www.biologischevielfalt.hessen.de2 Hessischer Biodiversitätsbericht 2020 73
Kennzahlen der Hessischen Biodiversitätsstrategie —
Überblick
Kenn- Beschreibung aktuelle Zuordnung
zahl Tendenz
Lesenswertes kurz gefasst. 1 Erhaltungszustände der Natura 2000-Schutzgüter in Hessen Ziel I, II
Hintergrundinfos auf Abruf. 2 Bestandsentwicklung lebensraumtypischer Vogelarten in
Hessen
Ziel I, II, III, IV,
V, VI
Der Hessische Biodiversitätsbericht 3 Naturschutzfinanzierung in Hessen Ziel I, II, III, VII,
IX, X
informiert über persönliches
und amtliches Engagement auf allen Ebenen. 4 Gesamtzahl der erstellten Artenhilfskonzepte in Hessen Ziel I, II, VIII
5 Prozentualer Anteil der hessischen Vogelschutzgebiete, für Ziel I, II, VII, VIII
die Maßnahmenpläne vorliegen
6 Umgesetzte Maßnahmen pro Jahr in hessischen Natura Ziel I, II
2000- und Naturschutzgebieten
7 Landwirtschaftsfläche mit hohem Naturwert in Hessen Ziel IV, VIII
(keine Angaben für 2019)
8 Anteil der ökologisch bewirtschafteten Fläche in Hessen Ziel IV
9 Förderung artenreicher Agrarökosysteme in Hessen Ziel III, IV
10 Förderung artenreicher Grünland-Ökosysteme in Hessen Ziel III, IV
11 Dauerhaft ungenutzter Staatswald in Hessen Ziel III, V
12 FSC-zertifizierte Waldflächen in Hessen Ziel V
13 Ökologischer Zustand der hessischen Gewässer Ziel VI
14 Höhe der in Hessen bewilligten Fördermittel für Ziel VI
Maßnahmen zur Gewässerentwicklung und zum naturnahen
Gewässerausbau
15 Anzahl der umgesetzten Maßnahmen pro Jahr zur Ziel I, VII
Bekämpfung von invasiven Neobiota in hessischen Natura
2000- und Naturschutzgebieten
16 Anzahl der ehrenamtlichen sachkundigen Helfer für Ziel II, VIII, IX
„geschützte Konfliktarten“ in Hessen
17 Gesamtmitgliederzahl der anerkannten Ziel IX, X
Naturschutzvereinigungen in Hessen
18 Besucherzahl ausgewählter hessischer Naturschutzzentren Ziel X
19 Teilnehmertage in den hessischen Jugendwaldheimen Ziel X
(zeitweise pandemiebedingt geschlossen)
biologischevielfalt.hessen.deHessischer Biodiversitätsbericht 2018 3
Inhalt
Vorwort 4, 9
Wirksamkeit und Sensibilisierung 5—8
Kennzahlen der Hessischen Biodiversitätsstrategie
Die Hessische Biodiversitätsstrategie – Wo stehen wir? 10
Erläuterungen zur ersten Phase bis 2020
Ziel I: Natura 2000
Ausgewählte Maßnahmen zur Erfassung und Verbesserung 16
Ziel II: Arten und Lebensräume der Hessen-Liste
Ausgewählte Maßnahmen zur Förderung und Entwicklung 22
Ziel III: Ökosystemleistungen
Ausgewählte Maßnahmen zur Sicherung gesunder Lebensverhältnisse 28
Ziel IV: Offenland und Landwirtschaft
Ausgewählte Maßnahmen zur Verbesserung der Vielfalt 32
Ziel V: Wald und Forstwirtschaft
Ausgewählte Maßnahmen zur Kartierung und Revitalisierung 36
Ziel VI: Gewässer
Ausgewählte Maßnahmen zur Verbesserung des ökologischen Zustands 40
Ziel VII: Invasive Arten
Ausgewählte Maßnahmen zur Vermeidung möglicher Ausbreitungen 44
Ziel VIII: Monitoring
Ausgewählte Maßnahmen zur Weiterentwicklung des Naturschutz-Monitorings 46
Ziel IX: Ehrenamt und Wissenschaft
Ausgewählte Maßnahmen zu deren verstärkter Einbindung 50
Ziel X: Bürgerwertschätzung und -beteiligung
Ausgewählte Maßnahmen zur Öffentlichkeitsbeteiligung 54
Ziel XI: Maßnahmen anderer Ressorts zur Erhaltung der Biologischen Vielfalt
Ausgewählte Maßnahmen der Hessischen Landesregierung 58
Abkürzungen und Begriffserklärungen 69
Impressum und Bildnachweise 71
Kennzahlen der Hessischen Biodiversitätsstrategie — Überblick 734 Hessischer Biodiversitätsbericht 2020
Vorwort
Sehr geehrte Damen und Herren,
liebe Leserinnen und Leser,
wir tragen Verantwortung dafür die Biologische Viel- Das Bewusstsein für die vorhandenen Naturschätze
falt zu erhalten, das ist wichtig für uns und die kom- ist immens gewachsen. Akzeptanz, Unterstützung
menden Generationen. Denn Biodiversität sichert und Wertschätzung aller Beteiligten sprechen heute
für uns Menschen lebensnotwendige Ökosystem- für den Erfolg der Hessischen Biodiversitätsstrategie.
dienstleistungen: Frische Luft, sauberes Wasser und Die politische Verstetigung ist in den Regierungs-
fruchtbare Böden. Gleichzeitig ist eine artenreiche programmen dokumentiert und kommt auch im
Natur Voraussetzung für die Anpassungsfähigkeit regelmäßigen Austausch mit dem Landesnatur-
möglichst vieler Ökosysteme an den Klimawandel. schutzbeirat zum Ausdruck. 2016 haben wir eine
Die Biologische Vielfalt prägt auch Hessens Natur- Nachschärfung der Strategie umgesetzt. Eine um-
räume, Landschaften, Gärten und Grünanlagen in fassende Neuausrichtung steht nun an.
unseren Städten und bietet uns damit wichtige Er-
holungsräume. Gemeinsam für mehr Biodiversität
Über den Rückgang der Biodiversität und das Insek- Die Ziele der Hessischen Biodiversitätsstrategie kön-
tensterben wird heute viel diskutiert. Ich erinnere nen wir nur unter Mitwirkung vieler Partnerinnen und
mich, das war bei der Auftaktveranstaltung zur Bio- Partner erreichen. Die Renaturierung von Flüssen
diversitätsstrategie im Jahr 2014 noch anders. Mit und Bächen, der Umstieg auf erneuerbare Energie,
einer intensiven Öffentlichkeitsarbeit, vielen Kreis- das nachhaltige und möglichst naturnahe Bewirt-
konferenzen, und einem webbasierten Informations- schaften von Agrar- und Waldflächen, die zusätzliche
angebot haben wir in den vergangenen Jahren im Ausweisung von Schutz- und Wildnisgebieten – das
Rahmen der Biodiversitätsstrategie dazu beigetra- alles ist nur zu schaffen, wenn Kommunen, Verbände,
gen für dieses Thema zu sensibilisieren. Landwirtinnen und Landwirte, Waldbesitzende und
Bürgerinnen und Bürger gemeinsam an einem
Strang ziehen.
Fortsetzung Seite 95
Wirksamkeit und Sensibilisierung –
Kennzahlen der
Hessischen Biodiversitätsstrategie
1 Günstige Erhaltungszustände der Natura 2000-Schutzgüter in Hessen Ziel
I, II
a) Erhaltungszustand der relevanten b) Erhaltungszustand der relevanten c) Erhaltungszustand der relevanten
Arten der Vogelschutz-Richtlinie Arten der FFH-Richtlinie Lebensraumtypen der FFH-Richtlinie
?
Angabe in Prozent
26,19 2025 ?
2025
29,03 45,68 15,22 15,56
30,49 29,89
25,64 ?
2008 2014 2020* 2007 2013 2019 2007 2013 2019
Art. 12 – Bericht (HE); nur 6-jährlich (2014, 2020, …) Art. 17 – Bericht (HE); nur 6-jährlich (2013, 2019, …) Art. 17 – Bericht (HE); nur 6-jährlich (2013, 2019, …)
* Datenauswertung verschoben
Ziel
2 Bestandsentwicklung lebensraumtypischer Vogelarten in Hessen I, II, III, IV, V, VI
gemäß Nachhaltigkeitsindex Gesamtlandschaft Zielwert HBS 2020
100 %
„Artenvielfalt und 1994
82,3 %
Landschaftsqualität“ 2018
79,3 %
Angabe in Prozent
2018 51 106 89 67
2017 55 122 90 64
90 83 73
2010 59
74 76 79 65
2004
1994 101 102 59
56
Teil- Agrarland Wälder Siedlungen Binnengewässer
indikatoren:
gemäß Nachhaltigkeitsindex „Artenvielfalt und Landschaftsqualität“ Bestandsentwicklung repräsentativer Arten [%]6
3 Naturschutzfinan- Ziel 4 Gesamtzahl der erstellten Ziel
zierung in Hessen I, II, III, VII, IX, X Artenhilfskonzepte in Hessen I, II, VIII
21,7 Gesamtzahl (aufsummiert)
2020*
24,4
in Millionen Euro
2019
2018
9,1
11,1 20,2 2016
2015
10,3 9,9 2017
8,8
2014
2012 2013
2013 2015 2017 2018 2019 2020
Naturschutzmittel in den Landeshaushaltsplänen des Um- alle im Auftrag der Naturschutzfachbehörden (HLNUG,
weltministeriums; naturschutzrelevante Haushaltsmittel des VSW) erstellt; * 3 Artenhilfskonzepte aktualisiert
Förderkapitels 09 22
5 Prozentualer Anteil der
Ziel
6 Umgesetzte Maßnahmen
hessischen Vogelschutz- pro Jahr in hessischen
I, II, Ziel
gebiete, für die Maß- Natura 2000- und
VII, VIII I, II
nahmenpläne vorliegen Naturschutzgebieten
7.492
2020
48% 2019
2019
43% 2020
7.053
2018
7.483
2016 2017
41% 5.779 2015 5.234
2018 2013 3.084 2014 4.772
2012 2.948
Im letzten Berichtszeitraum Ende 2016 lagen für alle FFH- Maßnahmen aus den jeweiligen Maßnahmen- bzw. Pflege-
Gebiete Maßnahmenpläne vor, deshalb beziehen sich die plänen gem. Naturschutzinformationssystem NATUREG
Angaben jetzt auf die Vogelschutzgebiete.
7 Landwirtschaftsflächen mit Ziel 8 Anteil der ökologisch bewirt- Ziel
hohem Naturwert in Hessen IV, VIII schafteten Fläche in Hessen IV
18,9 15,8
2020
2019 16,0
18,5 17,5
2018
2017 13,7
14,9
15,6
16,9 2016
12,7
2015 11,5
2014 11,3
2011 2015 11,0
2013
2009 2013 2017 2012 10,7
High Nature Value Farmland: Anteil der „Landwirtschafts- Anteil der ökologisch bewirtschafteten Flächen an der lan-
flächen mit hohem Naturwert“ an der gesamten Landwirt- desweiten landwirtschaftlichen Nutzfläche [%]
schaftsfläche [%]
9 Förderung artenreicher Agrarökosysteme 10 Förderung artenreicher Grün
in Hessen Ziel III, IV land-Ökosysteme in Hessen Ziel III, IV
Hektar 14.772 14.019 14.626 14.795 15.600 16.700 Tausend Hektar pro Jahr
pro Jahr
13.230 12.272 12.326 12.095 12.300 12.800
1.542 1.747 2.300 2.700 3.300 3.900
60,0
2.346
59,0 2019
57,0 2018
55,0 2020
2017
52,0 2016
42,0 2015
2012 40,0
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2013 37,5
2014
HIAP HALM HIAP/HALM Greening gesamt
Förderung 2012 bis 2014 gem. HIAP (Blüh- und Schonstreifen), ab 2015 gem. HALM (ein- und Agrarumweltmaßnahme „Grünlandextensivierung“, Förderung 2012
mehrjährige Blühstreifen/-flächen, Ackerrandstreifen, Ackerwildkrautflächen) sowie GREENING bis 2014 gem. HIAP B5, ab 2015 gem. HALM D1
(Ökologische Vorrangflächen Brache und Feldrandstreifen)7
11 Dauerhaft ungenutzter Ziel 12 FSC-zertifizierte Waldfläche in Hessen (Flächenanteile für Ziel
Staatswald in Hessen III, V Staatswald, Privatwald und Kommunalwald) V
in Prozent, Anteil von hessi- 37,0 40,0 40,0
10 % scher Gesamtwaldfläche 0,1
4,5
0,1
4,4
0,1
3,5
2020
2019
14,46
0,1
17,0
0,1 41,6 44,5 43,6
7,5 %
3,82 4,5 %
2018 21,6 % %
2014
2017 18,4 %
%
2016
2013 2015
2012 2016 2017 2018 2019 2020
3% % Staatswald Privatwald Kommunalwald Gesamtfläche
Flächenanteil ungenutzter Staatswaldflächen [%] zertifizierte Flächenanteile für Staatswald, Privatwald und Kommunalwald [% der jeweiligen hessischen Gesamt-
waldfläche]
13 Ökologischer Zustand der Ziel 14 Höhe der in Hessen bewilligten Fördermittel Ziel
hessischen Gewässer VI für Maßnahmen zur Gewässerentwicklung VI
und zum naturnahen Gewässerausbau
Anteile mit „gutem“ oder „sehr gutem“ Zustand
in Millionen Euro jährlich
Fließgewässer Seen
Gesamt Teilkomponente
bewertung Fischnährtiere
2020
13.246.290
2020
2018
11,1 %
33,3 % 27,3*% 2019 11.416.950 2012
2011 10.295.940 11.020.180
9.680.670
2015 2013
4,7% 8.068.990 2015
18,2 % % 7.618.770
2010 2017
6.965.170
2016 6.463.520
5,7%
2009
2014 6.417.650
21,9 % % 5.050.380
Die Gesamtbewertung setzt sich aus 3 Teilkomponenten zusammen und richtet Mittel aus dem „Landesprogramm für Gewässerentwicklung und Hochwasser-
sich nach der schlechtesten Teilkomponente; Erhebung nur 6-jährlich (2009, 2015, schutz“
2021 …). ** Die Bewertungsmethodik wurde gegenüber 2015 geändert.
15 Anzahl der umgesetzten Maßnahmen pro 16 Anzahl der ehrenamtlichen sach-
Jahr zur Bekämpfung von invasiven Neobiota Ziel kundigen Helfer für „geschützte Ziel
in hessischen Natura 2000- und Naturschutz- I, VII Konfliktarten“ in Hessen (zum Beispiel II, VIII, IX
gebieten Biber, Luchs, Wolf)
2019
jährlich 167 2020
2018
148
165 115
2017
145
2016 2018
2016 60
2015
80
93
111 100
2014 2019
77
2020
2015
2017
gem. Naturschutzinformationssystem NATUREG vom Land geschulte Personen, die vor Ort ehrenamtlich Unterstützung leisten8
17 Gesamtmitgliederzahl der anerkannten Naturschutzvereinigungen Ziel
in Hessen IX, X
205.243
199.902
196.132
194.930
176.821 181.227 187.886
168.303 171.853
2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
gem. Angaben der Landesgeschäftsstellen (acht Institutionen)
18 Besucherzahlen ausgewählter hessischer Naturschutzzentren Ziel
X
Nationalparkzentrum Kellerwald Edersee
Umweltbildungszentrum Schatzinsel Kühkopf (Eröffnung 2014)
41.000 45.855
40.000 36.000 38.000 27.869 38.780
27.392 31.134 32.504
33.000 25.115
29.953 28.954
24.022
11.044
2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
Personen, die Eintritt gezahlt oder dort an Veranstaltungen teilgenommen haben
19 Teilnehmertage in den hessischen Jugendwaldheimen Ziel
XI
21.380 22.836 20.704 21.685 20.371
18.418 17.218 17.275
4.347
2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
Personen, die an Veranstaltungen teilgenommen habenHessischer Biodiversitätsbericht 2020 9
Das weltweite Artensterben und der Klimawandel sind
globale Krisen, die wir nur gemeinsam bewältigen
können. Wir müssen den Rückgang der Biologischen
Vielfalt stoppen. Dabei geht es nicht nur um das
Überleben von Tier- und Pflanzenarten und den Schutz
von Lebensräumen, sondern letztlich auch um die
Lebensgrundlagen von uns allen.
Umweltministerin Priska Hinz
Neben der Naturschutzverwaltung sind seit fünf Weiterentwicklung des Biotopverbunds in Hessen
Jahren auch die anderen Ressorts in die Hessische steht auf der Agenda, um vielen wandernden Tieren
Biodiversitätsstrategie integriert. So werden zum freie Wege zu ermöglichen. Im Bereich der Agrar-
Beispiel Dach- und Fassadenbegrünung beim Hoch- förderung können wir Landwirtinnen und Landwirte
schulbau berücksichtigt, Forschungsvorhaben be- noch gezielter bei ihren Umweltmaßnahmen unter-
schäftigen sich mit Insekten, bei der Denkmalpflege stützen.
werden Sanierungen durchgeführt bei denen auch
Refugien von Vögeln und Pflanzen erhalten bleiben, Für die Mitarbeit aller Beteiligten danke ich auf die-
beim Straßenbau werden blütenreiche Verkehrs- sem Weg ganz herzlich.
inseln geschaffen und bei der Siedlungsentwicklung
Grünflächen mitgedacht und entwickelt.
Der Biodiversitätsbericht 2020 dokumentiert gegen Ihre
über dem Landtag die in Hessen ergriffenen Maß-
nahmen und zeigt Bürgerinnen und Bürgern Mög-
lichkeiten der Mitwirkung auf: Zum Beispiel mit
einer nektarreichen Begrünung im eigenen Garten
und auf dem Balkon. Zugleich weist der Bericht die
Perspektiven für eine Fortschreibung der Hessischen
Biodiversitätsstrategie bis 2030 aus, um gemeinsam
unser lebenswertes, vielfältiges Hessen zu erhalten.
So wollen wir die Feldflurprojekte weiter ausbauen Priska Hinz
und damit besonders gefährdete Tier- und Pflanzen- Hessische Ministerin für Umwelt, Klimaschutz,
arten auf Äckern noch besser schützen. Auch die Landwirtschaft und Verbraucherschutz10 Hessischer Biodiversitätsbericht 2020
Die Hessische Biodiversitätsstrategie:
Wo stehen wir?
Die Hessische Biodiversitätsstrategie (HSB) startete im
Juni 2013, drei Jahre später wurde sie umfangreich
überarbeitet und erweitert. Sie richtete sich, wie viele
andere Biodiversitätsstrategien auch, an das Jahr
2020 und orientierte sich dabei an europäischen und
internationalen Strategien.
Ziele wurden gesteckt, Maßnahmen engagiert umge-
setzt. Nun erscheint der Biodiversitätsbericht für das
Jahr 2020 und es ist Zeit, eine Bilanz zu ziehen.
Was hat Hessen erreicht in den letzten Jahren? Wel-
che Strukturen wurden aufgebaut und wie haben sich
die Erhaltungszustände von Arten und Lebensräumen
entwickelt? Wurden die Ziele erreicht?
Die Berichte zu den einzelnen Maßnahmen der elf
Ziele folgen nach diesem Kapitel. Im Vergleich zu den
Berichten der Vorjahre sind sie ausführlicher. Denn
die Berichte sollen, wo es möglich war, eine Bilanz
ziehen und die Entwicklung im hessischen Natur-
schutz über die letzten Jahre aufzeigen. Wie wurden
die Maßnahmen umgesetzt, was wurde erreicht und
welche Überlegungen stehen hinter Maßnahmen und
Projekten? Die HBS hat über einhundert Einzelmaß-
nahmen. Über alle ausführlich zu berichten, ist auch in
einem längeren Bericht nicht möglich. Daher wurden
pro Ziel Maßnahmen ausgesucht, die auf die Entwick-
lung des Ziels hinweisen bzw. die exemplarisch für
das Ziel stehen.
Was nach der Lektüre der Berichte, nach der Bilanz
von sieben Jahren HBS deutlich ist:
Das Thema Biodiversität hat stark an Bedeutung
gewonnen. Biodiversität wird vermehrt als „Gemein-
schaftswerk“ von allen – Naturschutz, Landwirtschaft,
Forst, Gewässer- und Bodenschutz – gesehen. Es ist ländlichen Raum geschaffen worden und werden
in der Landesentwicklung und nicht zuletzt im Klima- weiterhin geschaffen.
schutz- und der Klimaanpassung angekommen.
Gleichwohl bleiben die Erhaltungstrends von
Das Gebietsmanagement und die Artenschutz- Arten und Lebensräumen in der Summe besorgnis-
programme wurden deutlich verstärkt, mit den erregend.
Landschaftspflegeverbänden sind neue Akteure imHessischer Biodiversitätsbericht 2020 11
Nicht nachzulassen und perspektivisch die Arten
wieder in einen besseren Erhaltungszustand zu be-
kommen, ist ein Ansporn für die Weiterentwicklung
der HBS.
In den letzten Jahren wurden viele Strukturen ge-
schaffen, zum Beispiel eine gute Entwicklung der
Naturschutzhaushalte, die die Basis legten für Maß-
nahmen und Strukturen oder die Etablierung von
Landschaftspflegeverbänden, der Ausbau des
Öko-Landbaus uvm. In den nächsten Jahren heißt es,
hierauf aufzubauen.
Der Bedeutungsgewinn wird nicht zuletzt durch eine
erhebliche Steigerung der Naturschutzmittel deutlich:
Im Naturschutzhaushalt 2013 standen rund 8,8 Millio-
nen Euro zur Verfügung, 2020 waren es 24,3 Millionen
Euro. Auch die Anzahl der Erhaltungsmaßnahmen in
den Schutzgebieten hat sich in dem Zeitraum deutlich
gesteigert. 2013 waren es rund 3.100, sieben Jahre
später hat sich die Anzahl mit 7.492 mehr als
verdoppelt.
Deutlich gesteigert haben sich auch die Mittel zur
Umsetzung des Hessischen Programms für Agrar-
umwelt- und Landschaftspflegemaßnahmen (HALM).
2020 erhielten rund 9.000 landwirtschaftliche Be-
triebe erstmals eine Summe von über 42 Millionen
Euro und setzen auf über 250.000 Hektar – rund 1/3
der hessischen Agrarfläche – besonders umweltscho-
nende Maßnahmen um.
Auch der Ökologische Landbau hat sich seit Bestehen
der HBS gut entwickelt: Ende 2020 bewirtschafteten
2.329 Betriebe eine Fläche von121.740 Hektar. Im
Vergleich zum Jahr 2013 ist dies eine Steigerung um
Auch die Rheinauen sind Rückzugsort und potentieller rund 37.430 Hektar, um gut 44 Prozent.
Lebensraum für viele Tier- und Pflanzenarten
Mit dem Ausbau der Ökomodellregionen in Hessen
zum Ökomodelland-Hessen ist die Struktur gelegt,
um eine weitere Steigerung des Öko-Landbaus auch
in den kommenden Jahren zu erreichen.12 Hessischer Biodiversitätsbericht 2020
Neben der Ausweitung von HALM und der Steige- zehn Prozent der ackerbaulich genutzten landwirt-
rung des Anteils der Öko-Landwirtschaft ist an dieser schaftlichen Fläche Hessens.
Stelle die Etablierung der so genannten „Feldflur-
Projekte“ zu nennen, bilden sie doch einen weiteren Erste Erfolge der Projekte zeigen sich zum Beispiel
wichtigen Baustein zur Erhaltung der Biologischen in Bad Zwesten. Durch die gezielte Beratung von
Vielfalt in landwirtschaftlichen Räumen. In dem Pro- Landwirtinnen und Landwirten hat sich die Fläche der
gramm arbeiten modellhaft Akteurinnen und Akteure umgesetzten Maßnahmen seit Beginn des Projek-
aus dem Naturschutz, der Landwirtschaft, Jagd und tes zwischenzeitlich verdoppelt. Auch die Bestände
Forst kooperativ zusammen, um gemeinsam den entwickeln sich gut. Bei der ersten Erhebung im Jahr
Bestand gefährdeter Arten im Offenland wiederaufzu- 2018 wurden acht Rebhuhn Brutpaare gezählt, Ende
bauen. 2019 waren es 25 Paare.
Im Jahr 2019 starteten die ersten Projekte in den Parallel zu den Projekten vor Ort startet in diesem Jahr
Schwerpunkträumen im Landkreis Gießen und im begleitend verstärkte Öffentlichkeitsarbeit, um alle
Hochtaunuskreis. Im Opel Zoo Kronberg wurde eine Hessinnen und Hessen für die Bedeutung einstmals
Aufzuchtstation für Feldhamster eröffnet, im Feld- weit verbreiteter Arten wie Rebhuhn und Feldhamster
flurprojekt Bad Zwesten wurde die Betreuung der zu sensibilisieren. Denn hier greift, wie so oft im Natur-
Projektteilnehmer intensiviert. schutz der Leitsatz: Nur was man kennt, kann man
schützen.
Ziel der Projekte ist es, Rebhuhn, Feldhamster, Acker-
wildkräuter und andere Leitarten wieder fest in den Dass all diese Anstrengungen nötig sind, zeigt ein
großflächigen Projektgebieten zu beheimaten. Blick auf die Erhaltungszustände insbesondere von
Arten des Offenlandes, zum Beispiel Wiesen- und
In den Feldflurprojekten sollen durch die Anlage von Ackervögel. Die Arten dieser Gruppe zählen zu den
Blühflächen, Aussparungen auf den Äckern für Ler- derzeit in Hessen am stärksten betroffenen Vogel-
chen oder Feldhamster und weiteren Agrarumwelt- arten. Der Teilindikator „Agrar-/Offenland“, so zeigen
maßnahmen die betreffenden Arten vor Ort gezielt es auch die Kennzahlen der HBS, weist in den letzten
gestützt werden, um letztlich eine Wiederausbreitung zwanzig Jahren eine deutlich negative Entwicklung
anzubahnen. Aktuell beträgt die gesamte Kulisse der auf. Zahlreiche Arten der Agrarlandschaft, wie zum
Feldflurprojekte rund 50.000 Hektar, das sind knapp Beispiel Braunkehlchen, Wiesenpieper, Bekassine,
Die Flächenbewirtschaftung im Offenland sollte ausreichend viele und möglichst unterschiedliche Saum- und
Vernetzungsstrukturen bereitstellenHessischer Biodiversitätsbericht 2020 13
Moorauge im Schwarzen Moor, Rhön
Kiebitz, Großer Brachvogel, Rebhuhn und Grauam- Lebensräume „ausweichen“ zu können. Für Arten, die
mer sind in Hessen nach wie vor vom Aussterben wandern können, sind diese Biotopverbundstrukturen
bedroht. Den umgesetzten Artenhilfsmaßnahmen ein wichtiges Element, um auch mit veränderten
ist es zu verdanken, dass die genannten Arten bis- Lebensräumen klar zu kommen.
her als Brutvögel in Hessen noch nicht ausgestorben
sind. Hier gilt es in Zukunft den Fokus verstärkt auf Ein weiterer wichtiger Bestandteil der HBS ist die so
die besonders bedrohten Arten (nicht nur der Vö- genannte „Hessen-Liste“, die den Fokus definierte:
gel) auszurichten und gezielte Artenhilfsprogramme Welche Artenverluste wären für Hessen besonders
zu etablieren. Die Feldflurprojekte zeigen den Weg schmerzlich? Welche Lebensräume sind unbedingt
hierzu bereits auf. besser zu schützen? Hier wurden Schwerpunkte
gelegt und Verbände, Vereine sowie Regierungs-
Klimawandel und Biodiversitätsverlust stärker zusam präsidien haben mit der Hessen-Liste wirkungsvolle
mendenken ist schon jetzt, aber vor allem in der Maßnahmen umgesetzt. Das Instrument hat sich be-
Zukunft besonders wichtig, denn gut funktionierende währt, gleichwohl gilt es die Liste weiterzuentwickeln,
Ökosysteme sind widerstandsfähiger gegen Störun- gerade im Hinblick auf den Insektenschutz.
gen, so auch zunehmende klimawandelbedingte Wet-
terextreme wie Trockenheiten oder veränderte Nieder- Die Bevölkerung zu sensibilisieren, zu motivieren und
schlagsverhältnisse, aber auch Überschwemmungen. an Maßnahmen teilhaben zu lassen, war ein weiterer
wichtiger Baustein der Biodiversitätsstrategie in den
Daher zielt die Maßnahme „Erhaltung und Weiter- vergangenen Jahren. So konnte die zwischen 2005
entwicklung von Biotopverbundsystemen und Ver- und 2014 als Schwerpunkt etablierte Konzeption
meidung weiterer Landschaftszerschneidung“ des Weltdekade Bildung für nachhaltige Entwicklung der
Integrierten Klimaschutzplans Hessen 2025 auf die Vereinten Nationen zur dauerhaften Verankerung von
(Wieder-)Herstellung von Biotopverbundstrukturen Bildung für nachhaltige Entwicklung im deutschen
für Arten ab, welche vom Klimawandel potentiell Bildungssystem genutzt werden, die sogar von der
besonders betroffen sind. Denn Arten benötigen Deutschen UNESCO-Kommission als offizielle Maß-
mit zunehmendem Klimawandel verstärkt Korridore nahme der Weltdekade ausgezeichnet wurde. Seit
zum Wandern, um angesichts der Veränderung ihrer 2012 ist Biodiversität ein bleibender Schwerpunkt im
Jahresprogramm der Naturschutz-Akademie Hessen.14 Hessischer Biodiversitätsbericht 2020
Wie geht es weiter?
Ziel des diesjährigen Berichtes ist es auch zu schauen:
Wo stehen wir, was haben wir erreicht? Jetzt heißt es,
das Erreichte weiterzuführen und gleichzeitig zu über-
legen, wie sich die Biodiversitätsstrategie weiterent-
wickeln kann und muss. Wichtige Themen der letzten
Jahre, wie das Insektensterben, müssen und werden
einen stärkeren Raum in der nächsten Strategie ein-
nehmen.
Mit dem Abschluss der Arbeit an diesem Bericht
starten wir die Weiterentwicklung der Hessischen Bio-
diversitätsstrategie, wie es auch der Koalitionsvertrag
vorsieht.
Auf internationaler Ebene sind die Prozesse pande-
miebedingt ins Stoppen geraten. Derzeit ist die Welt-
biodiversitätskonferenz für November 2021 geplant.
Die Europäische Union (EU) hat vorgelegt und im
letzten Jahr mit der EU-Biodiversitätsstrategie 2030
einen Rahmen gesetzt: Bis 2030 sollen auf 30 Prozent
der Landgebiete und 30 Prozent der Meeresgebiete
Europas Schutzzonen geschaffen werden. Die Wie-
derherstellung geschädigter Landökosysteme in ganz
Europa sollen unter anderem durch die Stärkung der
Ökolandwirtschaft und biodiversitätsreicher Land-
schaftselemente, das Aufhalten und Umkehren des
Verlusts an Bestäubern, die Rückführung von Fließ-
gewässern in einen freien Flusslauf auf mindestens
25.000 Kilometer und durch die Reduzierung des
Einsatzes und der Schadenswirkung von Pestiziden
um 50 Prozent bis 2030 erreicht werden.
In diesem und in den nächsten Jahren werden die
strategischen Vorhaben in konkrete Handlungen um-
gesetzt.
Blick vom Urwaldsteig auf den EderseeHessischer Biodiversitätsbericht 2020 15 Die EU-Biodiversitätsstrategie braucht aber auch eine Umsetzung konkret vor Ort, auf regionaler Ebene. Wie auch bei der Aufstellung der Biodiversitätsstra- tegie 2013 und der Weiterentwicklung wenige Jahre später, wird sich auch die Weiterentwicklung ab 2020 an übergeordneten Strategien orientieren, aber auch den Spezifika in unserem Land Rechnung tragen. Die Weiterentwicklung der Biodiversitätsstrategie ist dabei ein Puzzleteil von mehreren. Der oben bereits angesprochene Bedeutungsgewinn zeigt sich in den Jahren 2020 und 2021 besonders: Die Arbeiten an einem Hessischen Naturschutzgesetz sind weit fort- geschritten. Es wird neue Akzente setzen und den Naturschutz weiter stärken. Institutionell bilden die hessenweiten Gründungen von Landschaftspflege- verbänden ein kooperatives Netz in der Fläche. Das „Zentrum für Artenvielfalt“, welches aus der Natur- schutzakademie Hessen, der Vogelschutzwarte (VSW) sowie der Abteilung Naturschutz des Hessischen Landesamtes für Naturschutz, Umwelt und Geologie besteht, wird derzeit mit Hochdruck aufgebaut und soll zu Beginn des kommenden Jahres seine Arbeit aufnehmen. Für die in Hessen besonders charakteristischen Streu- obstwiesen ist eine Strategie in Erarbeitung, um sie weiterhin zu erhalten und ihrer Bedeutung gerecht zu werden. Nicht zuletzt ist ein Hilfsprogramm für windenergiesensible Arten im Entstehen. All das zusammen schafft den Rahmen für die nächs- ten Jahre. ■ Autorin: Rebecca Stecker, Referatsleiterin Biodiversitätsstrategie und Artenschultz, Hessi- sches Umweltministerium
16 Hessischer Biodiversitätsbericht 2020
Ziel I: Natura 2000
Kennzahlen 1, 2, 3, 4, 5, 6, 15
Stopp der Verschlechterung der relevanten Natura 2000-Lebensräume und
-Arten und Verbesserung des Erhaltungszustandes
„Stopp der Verschlechterung der relevanten NA-
TURA 2000-Lebensräume und -Arten und Verbesse-
rung des Erhaltungszustandes“ – so lautet das erste
Ziel der Hessischen Biodiversitätsstrategie.
Landesweite Maßnahmen bilden das Grundgerüst,
um diese Ziele zu erreichen. Die Maßnahmen rei-
chen von der Vervollständigung der mittelfristigen
Maßnahmenpläne für alle Gebiete nach Fauna-Flora-
Habitat Richtlinie (FFH-RL) und alle Vogelschutzge-
biete (VSG), über die flächendeckende Einrichtung
von Landschaftspflegeverbänden und den Aus-
bau eines landesweiten Netzes zur Betreuung der
Schutzgebiete und Arten bis hin zur Erstellung von
Artenhilfskonzepten für Arten, deren Erhaltungszu-
stand ungünstig ist oder sich verschlechtert. Ziegenbeweidung Amöneburg
Die folgenden Textbeiträge zeigen, wie die Maß- Ziegenbeweidung im FFH- und
nahmen umgesetzt wurden und sie zeigen vor allem
auch: Naturschutz braucht Ressourcen, ein gutes Naturschutzgebiet Amöneburg
Gesamtsystem von engagierten Akteurinnen und
Akteuren und vor allem Zeit und Strukturen. Ziegen- Zum Erhalt der Magerrasen am Hang des FFH- und
projekte zur Offenhaltung von Lebensräumen, damit Naturschutzgebiets Amöneburg – das zweitälteste
diese nicht verbuschen, oder die Wiederherstellung Naturschutzgebiet in Hessen – wurde ein Ziegen-
von Magerrasen sind zwei von zahlreichen Beispie- beweidungsprojekt ins Leben gerufen. Die am
len, die verdeutlichen, wie die Biodiversitätsstrategie Basaltkegel vorkommenden Trespen-Schwingel-
in der Praxis umgesetzt wird. Schon im Hessischen Kalk-Trockenrasen (submediterraner Halbtrocken-
Biodiversitätsbericht 2019 konnten naturschutzfach- rasen) waren zu Zeiten der Grunddatenerhebung
liche Beweidungsprojekte wie „Schaf schafft Land- im Erhaltungszustand gut bis durchschnittlich (B-C).
schaft“ näher erläutert werden. Ein Teil der Trockenrasen am Unterhang war bereits
stark verbuscht und nur noch fragmentarisch vor-
Gerade in den letzten Jahren ist mit dem Aufbau handen. Doch auch umfangreiche motormanuelle
eines Netzes an Artberatern, den fachlichen Grund- Entbuschung konnten das Gehölzwachstum nicht
lagen in Form von Artenhilfskonzepten, EU- dauerhaft eindämmen. Daher wurde mit einer ge-
finanzierten Großprojekten und der Gründung von mischten Herde aus Ziegen, Schafen und zeitweise
Landschaftspflegeverbänden viel erreicht worden. Eseln gearbeitet, um die Magerrasen dauerhaft in
gutem Zustand zu erhalten und die Ausbreitung der
Gehölze zu verhindern.
Die Magerrasen und Felsfluren der Amöneburg sind
eng miteinander verzahnt. Um das Weidemanage-
ment besser steuern zu können, wurde ein festerHessischer Biodiversitätsbericht 2020 17
elektrischer Zaun installiert, der nochmals unterteilt und Begutachtung wird das Weidemanagement
ist. Dieser ermöglicht es Besuchern, das Gebiet zu jährlich gesteuert. Im Jahr 2018 war es bedingt
passieren, aber auch die Tiere zu lenken und ge- durch Erosion, dem extrem trockenen Sommer
zielt zu verteilen. Auf Informationstafeln erfahren die (Witterungsstress) und dem Einfluss der Weidetiere
Besucherinnen und Besucher Wissenswertes über zu negativen Veränderungen des LRT gekommen. Die
das Ziegenprojekt. Das Ziegenbeweidungsprojekt beeinträchtigten Bereiche wurden von der Winterbe-
begann im Frühjahr 2008. Seitdem erfolgten Vegeta- weidung komplett ausgespart und die Beweidungs-
tionsuntersuchungen zur Wirkungs- und Erfolgskon- intensität deutlich verringert. In den letzten beiden
trolle in den Jahren 2009, 2010, 2014, 2016, 2018 Jahren konnte sich die Vegetation nur in Teilen durch
und 2019. Mithilfe dieser Berichte und der engen die Weideruhe mit Erfolg regenerieren.
Abstimmung zwischen RP Gießen und den Ver-
antwortlichen für Maßnahmenplanung, Tierhaltung ■ Autorin: Bianka Lauer, RP Gießen
Neu entstandene Silbergrasfluren sind Bestandteil des
LRT 2330. Im Vordergrund: Sandstrohblume (Helichry- Erhalt und Entwicklung von
sum arenarium) und Bergsandglöcken (Jasione mon-
tana) als charakteristische Arten Sandmagerrasen (LRT 2330)
Das Vorkommen des FFH-Lebensraumtyps 2330
Sandmagerrasen (Dünen mit offenen Grasflächen
mit Corynephorus und Agrostis) zeichnet mehrere
Natura 2000-Gebiete in Südhessen aus. Wichtig für
die Erhaltung sind eine angepasste Bewirtschaftung
der sehr mageren Standorte und die Bewahrung des
Offenlandcharakters. Eine besondere zusätzliche
Maßnahme, das sog. Abplaggen, hat das zuständige
Amt für den ländlichen Raum des Hochtaunuskreises
in verschiedenen FFH-Gebieten im Kreis Offenbach
umgesetzt. Dabei wird in Teilbereichen die oberste
Bodenschicht samt Vegetation flach abgetragen. Auf
diese Weise entstehen mosaikartig neue Pionierflä-
chen mit Rohsanden, die eine Neuentwicklung von
Sandmagerrasen fördern. Das Beispiel des FFH-Ge-
biets „Sandrasen bei Urberach“ zeigt, dass auf diese
Weise gute Erfolge erzielt werden können. Auf früher
abgeplaggten Flächen haben sich typische Vegeta-
tionsstrukturen gebildet. Ende 2020 wurden weitere
Freilegen von Rohsandboden für die Neubesiedelung Flächen im Gebiet bearbeitet.
von Sandmagerrasenbeständen im FFH-Gebiet „Sand-
rasen bei Urberach“ ■ Autorin: Jutta Schmitz, RP Darmstadt18 Hessischer Biodiversitätsbericht 2020
Mausohren (Myotis) im Winterschlaf
Öffnung und Sicherung von Auch außerhalb des Richelsdorfer Gebirges erfol-
Fledermaus-Winterquartieren im gen solche Maßnahmen auf Initiative der Oberen
Naturschutzbehörde. So konnten im Landkreis Fulda
Richelsdorfer Gebirge ebenfalls zwei Bergwerksstollen gesichert werden
und bei Heringen, in Zusammenarbeit mit K+S,
Im Rahmen der Hessischen Biodiversitätsstrategie zwei große Luftschutzstollenanlagen mit speziellen
hat das Regierungspräsidium Kassel 2020, in enger Fledermaus-Lochsteinen zu Winterquartieren um-
Zusammenarbeit mit dem Forstamt Rotenburg an gebaut werden. Für 2021 sind weitere Maßnahmen
der Fulda und dem Landesverband für Höhlen- und in diesem Projekt geplant.
Karstforschung Hessen e.V., ein langfristiges Projekt
zum Schutz der einheimischen Fledermäuse gestar- ■ Autor: Stefan Zaenker, RP Kassel
tet. Von diesem Projekt profitieren insbesondere die
Bechsteinfledermaus, das Große Mausohr, die Fran-
senfledermaus, das Graue Langohr und das Braune
Langohr, die alle in der Hessen-Liste aufgeführt
sind, aber auch andere Fledermausarten sowie eine
Vielzahl weiterer Arten (zum Beispiel überwinternde
Amphibien, wie der in der Hessen-Liste geführte
Feuersalamander).
Im Rahmen des Projektes werden gezielt alte Berg-
werksstollen im Richelsdorfer Gebirge geöffnet
und die Eingänge mit fledermaus- und amphibien-
gerechten Gittern gesichert. Hierdurch wird eine
Biotopvernetzung geschaffen, die den Fledermäu-
sen eine vielfältige Auswahl an Überwinterungs- und
Tagesquartieren bietet. So konnten im letzten Jahr
der Kurprinz-Friedrich-Wilhelm-Stollen bei Bebra-
Braunhausen sowie der Ölbergstollen und der
Torwaldwieser Stollen bei Nentershausen dauerhaft Zur Sicherung des Ölbergstollens war der Einsatz eines
gesichert werden. Baggers notwendigHessischer Biodiversitätsbericht 2020 19
Landschaftspflegeverbände – umweltprogramm HALM, der Biodiversitätsstrategie,
Einsatz für mehr Naturschutz in dem Klimaschutzplan, aus Bund-Länder-Mitteln und
der Umweltlotterie GENAU bereitgestellt.
Hessen
Mit dem LPV im Kreis Groß-Gerau, der im November
Landschaftspflegeverbände leisten einen wichtigen 2020 gegründet wurde, gibt es in Hessen nun in
Beitrag für den Erhalt und Schutz der Natur und Kul- zehn von 21 Landkreisen LPV als aktive Motoren für
turlandschaft in Hessen. Um die wichtige Arbeit der den Naturschutz. Alle zehn LPV haben Anträge vor-
Verbände langfristig finanzieren zu können, hat das gelegt und werden in 2021 die Landesförderung in
Hessische Umweltministerium eine neue Förderricht- Anspruch nehmen.
linie erarbeitet, die seit September 2020 in Kraft ist.
Die Förderrichtlinie ermöglicht es den kreisweit täti- Je nach Region und Landkreis setzen die LPV unter-
gen, gemeinnützigen Landschaftspflegeverbänden schiedliche Schwerpunkte und gehen verschiedene
(LPV), die Umsetzung von Naturschutzmaßnahmen Wege – je nach regionalen Besonderheiten vor Ort.
zu verstärken und langfristig zu planen. Grundlage Alle Maßnahmen eint dabei das Ziel, die Arten und
für die Förderung ist ein jährliches Arbeits- und Maß- Lebensräume im Schutzgebietsnetz Natura 2000
nahmenprogramm, das die LPV mit den Fachbehör- zu fördern und zu erhalten sowie insbesondere im
den der Landkreise abstimmen. Gefördert werden Offenland dem Rückgang der Biologischen Vielfalt
Personalmittel für die Vorbereitung, Begleitung und entgegen zu wirken.
Evaluation von Maßnahmen insbesondere zur Um-
setzung des Schutzgebietsnetzes Natura 2000 und ■ Autorin: Jutta Katz, Hessisches
der Hessischen Biodiversitätsstrategie. Dafür stellt Umweltministerium
das Land pro Landkreis Mittel in Höhe von bis zu
200.000 Euro jährlich zur Verfügung. Finanzmittel für Weiterlesen: Neues Förderprogramm
die Umsetzung der Maßnahmen werden zusätzlich https://t1p.de/h1zb
aus dem Naturschutz-
haushalt des Weiterlesen: Koordinierungsstelle Hessen
Landes, dem https://t1p.de/i1vs
Hessischen
Agrar-
Gehölzarme Aue mit arten- und blütenreichem Grün-
land im FFH-Gebiet „Helfholzwiesen und Brühl bei
Erda“: Lebensraum für das Braunkehlchen (Saxicola
rubetra), ein vom Aussterben bedrohter Wiesenbrüter -
hier gibt es Brutbereiche, Beratung der Landwirtschaft
und schonende Reduzierung der Gehölze20 Hessischer Biodiversitätsbericht 2020
Auch 2020 waren wieder Artberater der VSW u. a. im Rahmen verschiedener Feldflurprojekte aktiv, um die Bestände
des in Hessen stark gefährdetet Rebhuhns (Perdix perdix) wieder auf ein sicheres Niveau zu bringen
Beratung der Vogelschutzwarte Wachtelkönig, Wendehals, Wiedehopf und Wiesen-
pieper.
für jede und jeden kostenlos
Für die aufgeführten Arten waren landesweit, u. a. im
In Hessen befinden sich knapp 50 Prozent der Brutvö- Rahmen von Feldflur- und Wiesenbrüterprojekten
gel in einem ungünstig-schlechten Erhaltungszustand. sowie zur Umsetzung von Maßnahmen in Streuobst-
In der Regel sind die betroffen Arten in ihren Bestän- beständen, zehn Artberaterinnen und Artberater
den gefährdet, stark gefährdet oder sogar vom Aus- sehr erfolgreich im Einsatz.
sterben bedroht. Für einige dieser Arten hat die VSW
Artenhilfskonzepte und Maßnahmenblätter entwi- ■ Autor: Lars Wichmann, VSW
ckelt. In diesen werden Schutz- und Entwicklungsmaß-
nahmen präsentiert, mit denen die betroffenen Arten
wieder in einen günstigen Erhaltungszustand ge-
bracht werden können. Um eine effektive Umsetzung Weiterlesen: https://t1p.de/8mtw
der Maßnahmen zu gewährleisten, ist ein fundiertes
Fachwissen zur Biologie der Zielart essentiell. Hier
kommen die Artberaterinnen und Artberater der VSW
ins Spiel. Um sicherzustellen, dass geplante Maß-
nahmen optimal in die Fläche gebracht werden und
langfristig eine möglichst große Wirksamkeit entfal-
ten, können hessische Behörden, Vereine und Privat-
personen bei der VSW kostenlos Beratung anfordern.
Die Artberaterinnen und Artberater der VSW nehmen
mit ihnen Kontakt auf und besuchen sie gerne auch
vor Ort. So erhalten sie eine kompetente Beratung
und erfahren, ob sich Flächen für die Umsetzung von
Maßnahmen für eine bestimmte Zielart eignen und
welche Maßnahmen wo, in welchem Umfang und zu
welchem Zeitpunkt realisiert werden können.
2020 umfasste das Beratungsangebot der VSW
folgende 16 Vogelarten: Bekassine, Braunkehl-
chen, Flussregenpfeifer, Gartenrotschwanz, Grau- Wachtelkönig (Crex crex) mit nicht flüggen Jungen –
ammer, Großer Brachvogel, Haubenlerche, Kiebitz, die Artberatung der VSW leistet einen wesentlichen
Raubwürger, Rebhuhn, Steinkauz, Uferschwalbe, Beitrag, um das Aussterben in Hessen zu verhindernHessischer Biodiversitätsbericht 2020 21
■ Praxisnahe Beratung in
Kooperation mit dem Ehrenamt
Hessen baut das Netz zur Betreuung der
Schutzgebiete und Arten in enger Zusammen-
arbeit mit den Verbänden aus
Das HLNUG hat in 2020 dreißig Expertinnen
und Experten als Artberaterinnen und Artbera- Gelbbauchunke (Bombina variegata)
ter beauftragt, die den Behörden des Landes,
der Kommunen, Gemeinden und Städte kosten- Mopsfledermaus), Schmetterlinge (Blauschil-
los zur Verfügung stehen. Sie sollen bei Natur- lernder Feuerfalter, Schwarzer Apollo, Skabio-
schutzfragen helfend zur Seite stehen und beim sen-Scheckenfalter), Mollusken (Bachmuschel)
Maßnahmenmanagement zum Schutz der Arten und Krebse (Steinkrebs). Außerdem sind weitere
unterstützen. Es werden zahlreiche Artgruppen Expertinnen und Experten zur Bekämpfung von
bedient, wie die Amphiben (Geburtshelferkröte, invasiven gebietsfremden Arten im Auftrag des
Gelbbauchunke, Knoblauchkröte, Kreuzkröte, HLNUG aktiv. Ab 2021 werden zusätzlich Be-
Moorfrosch, Wechselkröte), Reptilien (Äskulap- raterinnen und Berater den Insektenschutz auf
natter, Kreuzotter), Fische (Schlammpeitzger), Flächen und die invasive asiatische Hornisse
Libellen (Helm-Azurjungfer, Große Moosjung- betreuen.
fer), Käfer (Eremit), Pflanzen (Frauenschuh,
Sand-Silberscharte, Verantwortungsarten),
■ Autor: Dr. Andreas Opitz, HLNUG
Moose (Grünes Besenmoos, Kugelhornmoos),
Bärlappe, Säugetiere (Feldhamster, Luchs, Weiterlesen: https://t1p.de/v9yf
Artenhilfskonzepte Artenhilfskonzepte für Wendehals, Bachmuschel,
Kreuzkröte und Co. können auf der Homepage des
Seit 2007 werden im Auftrag der Abteilung N des HLNUG und der VSW abgerufen werden.
HLNUG und seit 2008 im Auftrag der VSW landes-
weite Artenhilfskonzepte (AHK) für besonders ■ Autor: Lars Wichmann, VSW
bedrohte Pflanzen- und Tierarten der Anhänge II
und IV der FFH-Richtlinie erstellt. Priorität haben die Weiterlesen: HLNUG-Downloads https://t1p.de/uffz
Arten, deren Erhaltungszustand in Hessen gemäß und VSW-Downloads https://t1p.de/8mtw
FFH-Richtlinie mit „rot“ (ungünstig – schlecht) be-
wertet wurde. Die mittlerweile 55 Artenhilfskonzepte
liefern wertvolle Hintergrundinformationen über
Verbreitung, Bestandssituation und Gefährdung der
jeweiligen Art und definieren geeignete, flächen-
bezogene Erhaltungsmaßnahmen an den der-
zeitigen Habitaten. Zusätzlich werden kurze, leicht
lesbare Maßnahmenblätter erstellt, in denen das
Wichtigste zusammengefasst ist. Für Vögel gibt es
zudem die sog. Gebietsstammblätter, die sich mit
Empfehlungen für konkrete Maßnahmen speziell an
Dritte richten. Durch diese Zusatzangebote sind die
Artenhilfskonzepte auch für viele Naturschützerin-
nen und –schützer in der Praxis gut umsetzbar. Die Wendehals (Jynx torquilla)22 Hessischer Biodiversitätsbericht 2020
Ziel II: Hessen-Liste
Kennzahlen 1, 2, 3, 4, 5, 6, 16
Sicherung und Entwicklung von Arten und Lebensräumen, für die Hessen
eine besondere Verantwortung hat
Die „Hessen-Liste“ ist den Akteurinnen und Akteuren Zu weiteren Maßnahmen des Ziels II gehört auch die
des Naturschutzes in Behörden und vor allem aber Förderung der Akzeptanz konfliktträchtiger Arten
auch im ehrenamtlichen Naturschutz inzwischen ein durch bürgernahe Öffentlichkeitsarbeit und gutes
fester Begriff: In ihr sind 259 Arten und 38 Lebens- fachliches Management. Denn insbesondere in
räume auch nach räumlichen Schwerpunkte aufge- Ballungsräumen oder in der Interaktion zwischen Na-
listet, für die Hessen eine besondere Verantwortung turschutz und Landwirtschaft können Konflikte auf-
trägt. Mit den Mitteln zur Umsetzung der Biodiversi- treten. Am Beispiel des Bibers zeigt sich dies gut: Er
tätsstrategie führen Verbände, Vereine und Behörden ist ein Landschaftsarchitekt, sorgt mit seinen Umge-
naturschutzfachliche Maßnahmen zur Verbesserung staltungen für neue Lebensräume seltener Tierarten.
Erhaltungszustände dieser Arten und Lebensräume Gleichzeitig verursacht er aber auch Schäden. Daher
vor Ort durch. bedarf es hier neben Öffentlichkeits- und Aufklä-
rungsarbeit auch eines umsichtigen Managements
Ein Schwerpunkt der Förderung liegt hierbei auf den der beteiligten Akteurinnen und Akteure. Auch dies
für Hessen besonders charakteristischen Streuobst- gehört zu den wichtigen Aufgaben zur Umsetzung
wiesen, daher erarbeitet das Umweltministerium in der Biodiversitätsstrategie.
diesem Jahr auch eine Streuobststrategie.
Bestandssicherung und
Wiederansiedlung des Efeu-
Moorglöckchens
Das Efeu-Moorglöckchen (Wahlenbergia hedera-
cea) besiedelt in Hessen nur noch kleine vereinzelte
Flächen. Auch im restlichen Deutschland kommt die
stark gefährdete Rote Liste-Art nur sehr spärlich vor.
2018 konnte im Rahmen eines vom RP Darmstadt
geförderten Biodiversitätsprojekts der letzte Bestand
im Odenwald durch Flächenankauf und gezielte
Pflegemaßnahmen gesichert werden. Noch im Bo-
den vorhandene Samen keimten und blühten wieder
auf. Da sich die Pflanzen seither gut entwickeln,
wurden aus den neu entstandenen Samen erfolg- Reaktiviertes Vorkommen am natürlichen Standort
reich Jungpflanzen zur Wiederansiedlung aufgezo-
gen. Die Auspflanzung der ersten Exemplare fand im
Oktober 2020 im Naturschutzgebiet Eutergrund bei der Kreisverwaltung des Odenwaldkreises, in enger
Bullau statt, gefolgt von weiteren im ehemaligen Ver- Zusammenarbeit mit dem Botaniker Dr. Markus
breitungsgebiet. Getragen wird das Projekt gemein- Sonnberger.
sam vom Naturschutzzentrum Odenwald (NZO) und
der Abteilung Landschaftspflege und Naturschutz ■ Autorin: Jutta Schmitz, RP DarmstadtHessischer Biodiversitätsbericht 2020 23
„Rhön-Quellschnecke im Biodiversitätsstrategie durch das RP Gießen wurde
die Maßnahmendurchführung vor Ort gemeinschaft-
Vogelsberg“ lich von Naturschutzbehörde und dem Forstsamt
Schotten gesteuert und durch die grundbesitzenden
Die Rhön-Quellschnecke – eine Art der „Hessen- Kommunen unterstützt.
Liste“ – für die Hessen eine besondere Verantwor- Die Maßnahmen wurden durch die Aufstellung einer
tung hat – kommt in Mittelhessen ausschließlich Hinweistafel mit Durchführung eines Pressetermins
im Vogelsberg und vorrangig in Höhenlagen über öffentlichkeitswirksam präsentiert.
500 Meter vor. Sie lebt direkt im Quellaustritt und
wenige Meter abwärts von Quellen mit gleichmäßig ■ Autor: Gerrit Oberheidt, RP Gießen
kaltem Wasser; dies oft im Wald.
Weiterlesen: https://t1p.de/r31n
Auf Grundlage zahlreicher Erkenntnisse und des
landesweit gültigen Artgutachtens hat die untere
Naturschutzbehörde des Vogelsbergkreises mit
Unterstützung des Landesverband Höhlen- und
Karstforschung im Jahre 2016 die Initiative zur Rena-
turierung zuvor kartierter Quellen ergriffen. Ziel war
jeweils die Entfernung der Quellenverbauungen und
Verrohrungen zur Wiederherstellung eines geeigne-
ten Lebensraums der Rhön-Quellschnecke.
Nach erfolgreicher Antragstellung und Finan- In Höhenlagen meist über 500 Metern kommt die Rhön-
zierungszusage aus Mitteln der Hessischen Quellschnecke (Bythinella compressa) noch vor
■ Förderung der Biodiversität im hat sie ein Maßnahmenprogramm zur langfristi-
gen Erhaltung und Förderung der Biodiversität
Streuobstgebiet Witzenhausen- im Streuobstgebiet rund um Wendershausen
Wendershausen erarbeitet. Neben der Erhaltung der wertvollen
Baumbestände gilt es ein umfassendes
Rund um den Ort Wendershausen befinden sich Nutzungskonzept in Kooperation mit
besonders wertvolle Streuobstwiesen mit zahlrei- den ortsansässigen Bewirtschaf-
chen hoch- und halbstämmigen Kirschbäumen. terinnen und Bewirtschaftern zu
Vor allem die Bestände mit einem hohen Anteil entwickeln.
an alten Bäumen, viel Totholz und Baumhöhlen
in Waldrandnähe sind regelrechte „Hotspots der Im Frühjahr 2020 wurde mit
Biologischen Artenvielfalt“. Revitalisierungs- und Stabi-
lisierungsschnitten an er-
Sie bieten Rückzugsräume für zahlreiche be- haltenswerten, bestehenden
drohte Arten - darunter auch viele, die besonders Bäumen begonnen. Zudem
sensibel auf Veränderungen ihres Lebensraumes wurden 140 hochstämmige
in Folge des Klimawandels reagieren. Zu diesen Obstbäume, insbesondere
gehören zum Beispiel Mittelspecht, Wendehals, Kirschen, gepflanzt. Die Förderung
Steinkauz, Haselmaus, Eremit oder die Mopsfle- dieser Maßnahmen erfolgt aus Bio-
dermaus. diversitätsmitteln des Landes Hessen. Die
Maßnahmen schließen die Erhaltung des unter
Innerhalb des Geo-Naturparks Frau-Holle-Land den Bäumen befindlichen Grünlands mit ein.
nimmt die Abteilung Naturschutz und Land-
schaftspflege seit Juli 2020 die Aufgaben eines ■ Autorin: Susanne Pfingst, Geo-Naturpark
Landschaftspflegeverbandes im Werra-Meißner- Frau-Holle-Land
Kreis wahr. Im Rahmen eines Projekts während
der Pilotphase zum Landschaftspflegeverband Weiterlesen: https://t1p.de/hhz024 Hessischer Biodiversitätsbericht 2020
Nur extensiv genutzte Streuobstwiesen können
sich zu sehr artenreichen Lebensräume entwickeln
Streuobst
Streuobst ist ein hessisches Kulturgut mit herausra- im Rahmen der Umset-
gender Bedeutung für die Biologische Vielfalt. Viele zung der Hessischen Biodi-
Streuobstbestände befinden sich jedoch in keinem versitätsstrategie bereits jetzt schon verschiedenste
guten Pflegezustand oder wurden im Laufe der Aktivitäten und stellt finanzielle Mittel bereit, um die
Jahre in eine intensive Nutzung überführt. Mit der in hessischen Streuobstbestände zu schützen und zu
Arbeit befindlichen Streuobstwiesenstrategie wird erhalten. Streuobstwiesen stehen auf der Hessen-
das Ziel verfolgt, die für die Artenvielfalt wertvollen Liste der Arten und Lebensräume, für deren Erhalt
Streuobstwiesen zu schützen und zu erhalten. Aber Hessen eine besondere Verantwortung trägt. Neuan-
auch abseits dieser Strategie unternimmt das Land lagen von Streuobstwiesen, Nachpflanzungen sowie
die Instandsetzungspflege überalterter Bestände
wurden beispielsweise in den letzten Jahren über
Landesmittel gefördert. Von den Maßnahmen sowie
der Überführung in eine extensive Landnutzung
(Beweidung oder Mahd) profitieren Streuobst-Cha-
rakterarten wie beispielsweise Gartenrotschwanz,
Steinkauz oder Wendehals. Die VSW stellt neben
Artenhilfskonzepten und Maßnahmenblättern auch
einen Berater für diese Streuobst-Charakterarten zur
Verfügung. Die Beratung hinsichtlich der langfristi-
gen Habitatgestaltung für diese Vogelarten kann von
Vereinen, Behörden und Privatpersonen auf Anfrage
bei der VSW in Anspruch genommen werden (info@
vswffm.de).
Wanderbeweidung sorgt für eine typische Artenaus-
wahl und deren genetischen Austausch mit anderen ■ Autorin: Amelie Hübner, Hessisches
Vorkommen UmweltministeriumHessischer Biodiversitätsbericht 2020 25
Artenhilfsmaßnahmen
für windenergiesensible
Arten gestärkt
Das Land Hessen intensiviert Artenhilfs-
maßnahmen für windenergiesensible
Arten, insbesondere für Fledermausarten
in FFH-Gebieten und für Vogelarten in
Vogelschutzgebieten: Hessen betont bei
der Umsetzung der Bewirtschaftungspläne
für Natura-2000-Gebiete Maßnahmen zur
Erhaltung und Verbesserung des Erhal-
tungszustands dieser Arten. Darüber hinaus
werden auch außerhalb solcher Gebiete
Artenhilfsmaßnahmen besonders für diese
Arten durchgeführt. Hierzu hat das Land
Hessen ein landesweites Hilfsprogramm
für windenergiesensible Arten gestartet. Im
Rahmen des Programms sollen Maßnahmen
für die windenergiesensiblen Vogelarten
Schwarzstorch, Rotmilan, Wespenbussard
und Waldschnepfe sowie die windenergie-
sensiblen Fledermausarten Großer und
Kleiner Abendsegler, Mopsfledermaus,
Bechsteinfledermaus und Rauhautfledermaus umge- Artenhilfsmaßnahmen für Rotmilan, Schwarzstorch
setzt werden. Als erste Maßnahmen wurden Schutz- und Wespenbussard ausgegeben. Hinzu kommen
zonen im Umkreis von bis zu 200 Meter um Schwarz- Grünlandmaßnahmen im HALM, Maßnahmen nach
storchhorste im hessischen Staatswald eingerichtet. IKSP oder Maßnahmen zur Umsetzung der Was-
Im Körperschafts- und Privatwald werden solche serrahmenrichtlinie (WRRL), die ebenfalls positive
Maßnahmen durch Vertragsnaturschutz angestrebt. Wirkungen entfalten. Schließlich sollen die Aus-
In allen Waldbesitzarten sollen zudem Horstschutz- gleichsmaßnahmen der Projektträger künftig stärker
maßnahmen gegen den Waschbären erfolgen. Für in Populationsschwerpunkte gelenkt werden.
die genannten Maßnahmen wurden für das Jahr
2021 zusätzlich 80.000 Euro eingeplant. 2017 bis ■ Autor: Klaus-Ulrich Battefeld, Hessisches
2019 hat das Land bereits mehr als 300.000 Euro für Umweltministerium
Sechs Schwarzstörche (Ciconia nigra) am EderseeSie können auch lesen