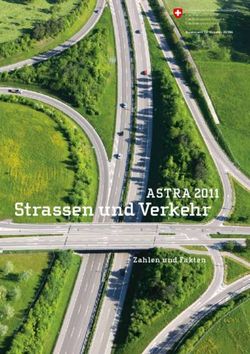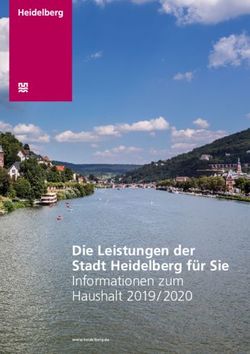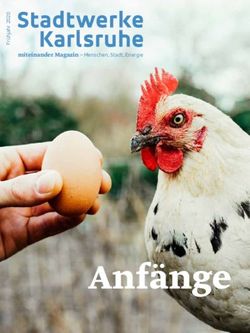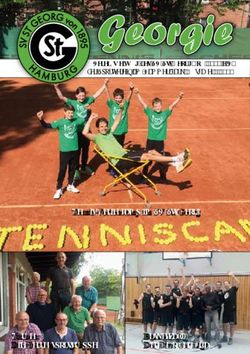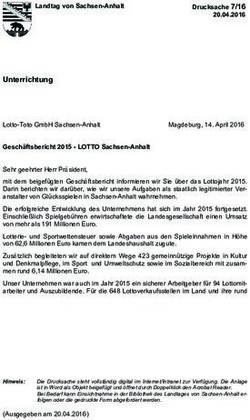Brienzersee: Ein Ökosystem unter der Lupe - Resultate des Forschungsprojekts zum Rückgang des Planktons und der Felchenerträge - WSL
←
→
Transkription von Seiteninhalten
Wenn Ihr Browser die Seite nicht korrekt rendert, bitte, lesen Sie den Inhalt der Seite unten
Brienzersee: Ein Ökosystem unter der Lupe Resultate des Forschungsprojekts zum Rückgang des Planktons und der Felchenerträge Bau-, Verkehrs- und Energiedirektion des Kantons Bern Volkswirtschaftsdirektion
Editorial
Erfolgreicher Indizienprozess
am Brienzersee
1999 fingen die Berufsfischer im Brien- sen deshalb übliche Ungenauigkeiten von
zersee plötzlich und unerwartet kaum gegen 20 Prozent auf – das ist unvermeid-
noch Felchen. Der jährliche Ertrag brach lich und liegt in der Natur der Sache.
auf weniger als 2 Tonnen ein, nachdem in
den späten 1970er-Jahren noch 40 Ton- Bei allen Grenzen, welche die Natur der
nen gefangen wurden. Gleichzeitig stell- Wissenschaft setzt – die entscheidenden
ten die Fachleute des Gewässerschutz- Ergebnisse der Studie sind hieb- und
amtes fest, dass auch die Wasserflöhe stichfest. So wissen wir, dass sich der
(Daphnien) verschwunden waren, von Brienzersee heute natürlicherweise in
welchen sich die Felchen hauptsäch- einem äusserst nährstoffarmen Zustand
lich ernähren. Zwar gab es verschiedene befindet, dessen geringe Algen- und da-
Vermutungen über mögliche Hintergrün- mit Zooplankton-Produktion auch künf-
de, jedoch kaum überzeugende Beweise. tig keine grösseren Fischfangerträge er-
Da keine „Zeugen“ zu vernehmen waren laubt. Diese waren in den 1970er-Jahren
und der Brienzersee sowieso die „Aussa- nur deshalb so hoch, weil das Abwasser
Prof. Alfred Wüest, Leiter der ge verweigert“, entschied sich der Kanton damals weitgehend ungeklärt in den See
begleitenden Expertengruppe Bern für einen wissenschaftlichen „Indi- gelangte. Nachgewiesen ist jetzt auch,
zienprozess“ – ein nachträgliches Erfor- dass der See vor dem Bau der Stauseen
schen des „Tathergangs“ in diesem ein- im Sommer deutlich trüber und im Winter
zigartigen Ökosystem. etwas klarer war. Ohne die Wasserkraft-
nutzung wären bei gleicher Nährstoffver-
Im Auftrag des Kantons haben Fachleu- sorgung weder ein vermehrtes Algen-
te verschiedener Institute im See und in wachstum noch ein höherer Fischertrag
seinem Einzugsgebiet während über zwei zu erwarten.
Jahren tausende von Daten erhoben, aus-
gewertet und zu einem in sich konsisten- Die Forschungsarbeit am Brienzersee
ten Bild zusammengefügt. Diese aufwän- stiess auf grosses Interesse, und die Iden-
digen Untersuchungen haben Resultate tifikation der Gesprächspartner mit dem
geliefert, mit denen sich die Vorgänge See und dessen Einzugsgebiet wirkte sehr
von 1999 im Brienzersee überzeugend motivierend. Auch das spürbare politische
rekonstruieren lassen. Wie immer in der Spannungsfeld belebte viele der wissen-
Naturwissenschaft, weisen Erhebungen schaftlichen Diskussionen mit „konkreter
in der Umwelt natürliche Schwankungen Realität“. Allen, die sich für das äusserst
auf: So haben wir zum Beispiel 2003 völ- interessante Forschungsprojekt engagiert
lig ungeplant den Jahrtausendsommer haben, möchte ich an dieser Stelle herz-
und 2005 ein gewaltiges Hochwasser er- lich danken.
fasst. Viele Zahlen dieser Broschüre wei-
Antworten auf häufige Fragen
Die im Lauf der Jahre unterschiedliche Antworten auf häufige Fragen zusätzlich
Trübung des Brienzersees wirft immer in einem separaten Dokument zusammen-
wieder Fragen nach den möglichen Grün- gefasst. Die entsprechenden Erklärungen
den auf. Auch der Zusammenhang zwi- sind auf der Homepage des Amtes zu
schen der Brienzersee-Studie, den Aus- finden:
bauplänen der Kraftwerke Oberhasli AG www.gsa.bve.be.ch
und der laufenden Restwassersanierung > Gewässerqualität > Seen
ist häufig unklar. Weil die vorliegende Bro- > Berichte > Brienzersee: Antworten
schüre nur auf die Resultate der aktuellen auf häufige Fragen
Untersuchungen eingeht, hat das GSA die
Inhalt
Der Brienzersee im Überblick Wenig Futter für die Daphnien Geringer Einfluss der Stauseen
Wie die meisten Seen am Alpenrand ist Die mangelnde Futterbasis, tiefe Wasser- Die Stauseen der Kraftwerke Oberhasli im
der Brienzersee ein nährstoffarmes Ge- temperaturen und der ausserordentliche Grimselgebiet verändern die Wasserfüh-
wässer, das stark von den unproduktiven Abfluss während des Hochwassers im rung der Aare und halten Geschiebe so-
Gebirgszonen in seinem Einzugsgebiet Frühling waren 1999 die Hauptgründe für wie Schwebstoffe zurück. Dadurch wird
geprägt wird. den Zusammenbruch der Daphnienpopu- der Partikeleintrag in den Brienzersee ver-
Seiten 4 / 5 lation im Brienzersee. Ein ähnlicher Ein- ringert und zeitlich verlagert, was sich auf
bruch ist im Frühjahr auch künftig wieder das Licht im See auswirkt. Doch der Ein-
möglich. fluss auf die jährliche Algenproduktion ist
Die Fangerträge bleiben bescheiden Seiten 10 / 13 gering.
Seiten 18 / 21
Stark verringertes Nährstoffangebot
Das geringe Nährstoffangebot und die Die Folgerungen der Behörden
Lichtabschwächung durch die einge-
tragenen Trübstoffe lassen im Brienzer-
see auch künftig nur ein geringes Algen-
wachstum erwarten. Die Populationen der
Daphnien und Felchen im See werden da-
her nicht mehr die Bestandesgrössen der
späten 1970er-Jahre erreichen.
Die Fischer am Brienzersee müssen sich
langfristig auf geringe Fänge einstellen.
Äusserst tiefe Nährstoffgehalte limitieren
das Futterangebot für Fische und lassen
in Zukunft jährliche Fangerträge von nur 2 Weil heute wieder weniger Nährstoffe in
bis 3 Kilo pro Hektare Seefläche erwarten. den Brienzersee gelangen, haben die
Felchenerträge stark abgenommen. Der
Seiten 6 / 9 Kanton Bern lehnt Abstriche beim tech-
nischen Gewässerschutz zur Erhöhung
der Fischerträge jedoch klar ab. Aus ge-
wässerökologischer Sicht drängen sich
auch keine Massnahmen zur Reduktion
Seiten 14 / 17 der winterlichen Seetrübung auf.
Seite 22
Die wissenschaftlichen Grundlagen
Seite 23
Impressum und Links
Titelbild: Entnahme einer Wasserprobe Die vorliegende Publikation erscheint Seite 24
im Brienzersee mit der Schöpfflasche. auch als Sonderausgabe 2/2006 des
Die Wasserflöhe oder Daphnien (links) GSA-Informationsbulletins.
sind die Nahrungsgrundlage der Felchen.
Einzugsgebiet
Karges Leben in einem
typischen Alpenrandsee
Seeausfluss der Aare bei Interlaken. Rechts mündet die Lütschine in den Brienzersee.
Wie die meisten Seen am Alpenrand ist der Brienzersee ein nährstoffarmes
Gewässer, das stark von den unproduktiven Gebirgszonen in seinem Einzugs-
gebiet geprägt wird. Fels und Gletscher machen mehr als die Hälfte der
Gesamtfläche aus. Bedingt durch die hohe Erosion transportieren die Haupt-
zuflüsse Aare und Lütschine grosse Mengen an mineralischen Partikeln in
den See. Diese Trübstoffe sind der Grund für das von Frühling bis Herbst
milchige, türkisfarbene Erscheinungsbild des Brienzersees.
Der Brienzersee liegt 564 Meter über vor allem aus Alpweiden bestehen. Wie bei Bieler- und Thunersee wird auch
Meer in einer rund 2,5 Kilometer breiten Die extensive Nutzung hat zur Folge, dass der Wasserstand des Brienzersees von
Talmulde, die der eiszeitliche Aareglet- dem See nur wenig Nährstoffe zufliessen, der zentralen Leitstelle des kantonalen
scher geschaffen hat. Als einer der gröss- so dass die Algenproduktion äusserst ge- Wasserwirtschaftsamtes in Bern reguliert.
ten schweizerischen Alpenrandseen ist er ring ausfällt. Weil das pflanzliche Plank- Es bedient die ferngesteuerte Schleuse
in der Fliessrichtung der Aare beidseitig ton die Basis der Nahrungspyramide bil- zwischen Interlaken und Unterseen und
von bis zu 2300 Meter hohen Bergketten det, bleiben auch die Entwicklung des berücksichtigt dabei in einem grossräu-
umgeben, die auch im Uferbereich steil Zooplanktons und damit die Fischbestän- mig abgestimmten Verbund unterschied-
abfallen, so dass es kaum Flachwasser- de begrenzt. Der Brienzersee ist also von liche Nutz- und Schutzinteressen – wie
zonen gibt. Natur aus ein äusserst nährstoffarmes, etwa jene der Wasserkraftnutzung, Schiff-
unproduktives und daher wenig ertrag- fahrt und Fischerei sowie des Hoch-
Stark vergletschertes Einzugsgebiet reiches Gewässer. wasserschutzes.
Sein mehrheitlich alpines Einzugsge- Der tiefste aller Berner Seen Grosse Mengen an Schwebstoffen
biet erstreckt sich über 1134 Quadratkilo-
meter und ist damit fast 38 Mal so gross Mit über 2000 Litern pro Quadratmeter Bedingt durch das zu rund einem Fünf-
wie der See. Wichtigste Zuflüsse sind liegt der mittlere Jahresniederschlag im tel vergletscherte Einzugsgebiet und die
die Hasliaare und die bei Bönigen in den Einzugsgebiet rund 40 Prozent über dem auch in den Gletschervorfeldern hohe
Brienzersee mündende Lütschine. Ent- gesamtschweizerischen Durchschnitt, was Erosion schwemmen Aare und Lütschine
sprechend dem gebirgigen Charakter ist für die Hochalpen typisch ist. Davon ver- grosse Mengen an mineralischen Schweb-
die Gegend nur dünn besiedelt, und der dunsten etwa 340 Liter und 1720 Liter stoffen in den Brienzersee. Die entspre-
Anteil der Siedlungsfläche beschränkt fliessen in den Brienzersee ab. Dieser hat chenden Frachten belaufen sich heute
sich auf 2 Prozent. Unproduktive Zonen, ein Fassungsvermögen von 5,15 km3 und im Mittel jährlich auf gut 300‘000 Tonnen.
die hier grösstenteils aus Fels und Glet- speichert damit gut viermal soviel Wasser Während der Abfluss der Lütschine – bis
scher bestehen, machen 56 Prozent des wie der flächenmässig um fast ein Drit- auf wenige Massnahmen zum Schutz vor
Einzugsgebiets aus. Die restlichen 42 Pro- tel grössere Bielersee. Wegen seiner Tie- Hochwasser – einen natürlichen Verlauf
zent entfallen je zur Hälfte auf Wald und fe und Lage wird der Brienzersee nicht je- hat, wird die Aare seit den 1930er-Jahren
landwirtschaftliche Nutzflächen, welche den Winter vollständig durchmischt. stark durch die Anlagen der Kraftwerke
Oberhasli KWO im Grimselgebiet beein- Der Brienzersee auf einen Blick
flusst. Ihre Staumauern halten einen Teil
des sommerlichen Schmelz- und Nieder- Fläche des Sees 29,8 km2
schlagswassers in den vier grössten Stau- Mittlere Tiefe des Sees 172 Meter
seen Oberaar-, Grimsel-, Räterichsboden- Maximale Tiefe des Sees 259 Meter
und Gelmersee zurück, um es im Winter Fassungsvermögen des Sees 5,15 Milliarden m3
zu turbinieren. Dadurch gelangt im Som- Mittlere Aufenthaltszeit des Wassers im See 980 Tage
mer weniger Wasser in den Brienzersee Fläche des Einzugsgebiets 1134 km2
als unter natürlichen Umständen, während Fläche des Teileinzugsgebiets Hasliaare 603 km2
der Zufluss in der kalten Jahreszeit heute Fläche des Teileinzugsgebiets Lütschine 391 km2
durch den Kraftwerkbetrieb deutlich grös- Mittlere Höhe des Einzugsgebiets über Meer 1950 Meter
ser ist. Zudem werden Hochwasserspit- Höchster Punkt des Einzugsgebiets (Finsteraarhorn) 4272 Meter
zen gebrochen und jährlich 232‘000 Ton-
nen Partikel auf dem Grund der Stauseen
abgelagert, die sonst ebenfalls in den
Brienzersee geschwemmt würden. reszeit seine Farbe verändert. Im Winter, menten des Sees sind in den letzten 75
wenn die Transparenz des Wassers am Jahren keine offensichtlichen Verände-
Gletschermilch prägt grössten ist, dominiert ein Blau mit einem rungen nachzuweisen, die sich auf äus-
die Farbe des Sees leicht grünlichen Einschlag. Mit zuneh- sere Einflüsse im Einzugsgebiet zurück-
mender Trübung im Frühling gewinnen die führen liessen. Die Deltabereiche von
Auf Grund der Unterschiede in den Ein- Grüntöne an Intensität, und im Hochsom- Aare und Lütschine sind charakterisiert
zugsgebieten sind auch die Einschich- mer hat der Brienzersee eine grau-grü- durch hohe Ablagerungen und Sandge-
tungstiefen der zwei wichtigsten Zuflüs- ne Farbe mit einem leuchtenden, milchig- halte sowie ein unruhiges Relief mit deut-
se in den Brienzersee etwas verschieden. weisslichen Einschlag. Mit dem Ende der licher Rinnenbildung. Katastrophale Mur-
Da die Aare deutlich weniger Schwebstof- Gletscherschmelze im Herbst nimmt der gänge – wie jener des Lammbachs von
fe führt und ihr Wasser einen tieferen Salz- Partikeleintrag ab, während die im Som- 1896 oder der Ausbruch des Glyssibachs
gehalt aufweist, schichtet sie sich häufiger mer angeschwemmten Schwebstoffe im bei Brienz im August 2005 – und mäch-
– und im Vergleich zur Lütschine tenden- See langsam auf den Grund absinken. So tige Rutschungen im See wie diejenige
ziell auch höher – in das oberflächennahe gewinnt der Brienzersee seine Transpa- von 1996 im Aaredelta führen in den Mün-
Seewasser ein. Damit trägt sie stärker zur renz und damit die vorwiegend blaue Far- dungsbereichen und im zentralen Tie-
sichtbaren Trübung des Brienzersees bei be allmählich wieder zurück. fenwasser immer wieder zur Ablagerung
als die Lütschine. grosser Sandmengen und zur Bildung
Die Gletschermilch der beiden Zuflüs- Mächtige Sedimente in den Deltas mächtiger Sedimentschichten.
se prägt das trübe, türkisfarbene Erschei-
nungsbild des Sees, der je nach Jah- In den ungestört abgelagerten Sedi-
Die wichtigsten Kategorien der Bodennutzung im Einzugsgebiet
Brienz Gadmen
Meiringen
Innertkirchen
Interlaken
Wald
Guttannen
Landwirtschaftliche Nutzflächen
- Wiesen, Weiden, Äcker, Obstbau
Grindelwald
- Alpweiden
Grimsel
Lauterbrunen
Siedlungsflächen
Unproduktive Flächen
- Gewässer
- unproduktive Vegetation
- Fels, Geröll, Gletscher
Wald: 21%
Landwirtschaft: 21%
Siedlungsgebiet: 2%
Unproduktive Flächen: 56%
Im alpin geprägten Einzugsgebiet des Brienzersees machen Gletscher, Fels, Geröll und Gewässer 56 Prozent aus. Auf Grund der
extensiven Landnutzung fliessen dem See nur wenig Nährstoffe zu. (Daten: Arealstatistik 1992/97, BFS GEOSTAT)
Fische
Der Felchenertrag bleibt
auch in Zukunft bescheiden
Der Spezialfang mit engmaschigen Netzen täuscht: Im Brienzersee nehmen die Felchenfangerträge seit Jahren ab.
Die Fischer am Brienzersee müssen sich langfristig auf geringe Fänge
einstellen. Äusserst tiefe Nährstoffgehalte limitieren das Futterangebot für
Fische und lassen in Zukunft jährliche Fangerträge von nur 2 bis 3 Kilo
pro Hektare Seefläche erwarten. Die Felchen als wichtigste Brotfische sind
deutlich kleiner als früher und haben stark an Gewicht eingebüsst. Mit
weiteren Einbrüchen ihrer wichtigsten Futterbasis – wie im Jahr 1999 – ist
auch künftig zu rechnen.
Zwischen 1975 und 1981 gingen den Be- von 3 auf weniger als 1 Mikrogramm pro zersee ist diesbezüglich also keine Aus-
rufsfischern des Brienzersees pro Hektare Liter abgenommen und sich seither auf nahme. Vielmehr musste man sich bis
Seefläche im Durchschnitt 14 Kilo Felchen diesem tiefen Niveau eingependelt. in die 1950er-Jahre mit noch geringeren
ins Netz. Dagegen mussten sie sich von Im Bielersee hingegen ist dieser entschei- Fängen bescheiden. Vor 1950 lag der Er-
2001 bis 2005 mit einem mittleren Jah- dende Nährstoff in rund 10 Mal höherer trag pro Hektare immer unter 2 Kilo. Dann
resertrag von 1,9 Kilo ihres Brotfischs be- Konzentration vorhanden, so dass viel nahm die Nährstoffzufuhr vor allem durch
gnügen. Dieser macht heute mit knapp mehr Algen gedeihen, die am Anfang der Phosphat-Einträge aus ungeklärtem Ab-
5700 Kilo pro Jahr etwa 80 Prozent des Nahrungskette stehen. Etwa im gleichen wasser und teilweise auch durch Ab-
Gesamtfangs aus. Im Vergleich dazu ha- Verhältnis gehen den Fischern hier des- schwemmungen von landwirtschaftlich ge-
ben es die Arbeitskollegen am Bielersee halb auch mehr Felchen ins Netz. nutzten Flächen in die Fliessgewässer und
deutlich besser. In der gleichen Zeitperio- Stabilisiert sich die Phosphatkonzentra- in den See stark zu. Gleichzeitig ermögli-
de holten sie pro Hektare durchschnittlich tion des Brienzersees auf den niedrigen chte der technische Fortschritt den Be-
22 Kilo oder gut 11 Mal soviel Felchen aus Werten der letzten Jahre, ist künftig noch rufsfischern eine höhere Effizienz, wobei
dem Gewässer. mit einer jährlichen Nettoproduktion der insbesondere der Einsatz von Motorschif-
Felchen von höchstens 8 Kilo pro Hektare fen anstelle von Ruderbooten und die neu-
Die Fangerträge sinken zu rechnen. Geht man davon aus, dass en Kunststoffnetze zu steigenden Fang-
mit dem Phosphatgehalt des Sees die Fischerei etwa 30 Prozent davon ab- erträgen führten. Obwohl es zwischen-
schöpfen kann, so ergeben sich realisti- durch immer grosse natürliche Schwan-
Die Diskrepanz der Fangerträge wider- sche mittlere Jahreserträge von maximal 2 kungen gab, kletterten die Fangzahlen in
spiegelt die völlig unterschiedliche Nähr- bis 3 Kilo je Hektare oder zwischen 6 und den besten Jahren von 1975 bis 1981 in
stoffsituation der beiden Seen. Der Brien- 9 Tonnen für den ganzen See. mehreren Stufen auf Rekordwerte.
zersee ist mit seinem alpin geprägten
Einzugsgebiet ein äusserst nährstoffar- Ähnliche Fangzahlen wie 1950 Einbrüche in Etappen
mes Gewässer mit nur geringer Phosphat-
zufuhr und entsprechend schwacher Al- Diese Erträge sind vergleichbar mit den Seither geht es jedoch stetig bergab. Der
genproduktion. So hat sein in den letzten Fängen in anderen nährstoffarmen Seen. Bau von Kläranlagen mit Phosphatfällung,
drei Jahrzehnten laufend sinkender Phos- Auf Grund der Phosphatgehalte können das 1986 in Kraft getretene Phosphatver-
phatgehalt allein zwischen 1994 und 2002 die Fischer nicht mehr erwarten. Der Brien- bot für Waschmittel, strengere Vorschriften
für den Gülleaustrag und die bessere An-
passung der Düngung an den Nährstoff-
bedarf der Pflanzen liessen die Phosphat-
konzentration im See – und damit auch
die Produktivität der Felchenbestände –
laufend sinken. Seit den Maximalfängen,
die noch bis 1981 mehrmals über 15 Kilo
lagen, verringerte sich der Ertrag in den
1980er-Jahren auf etwa 10 Kilo pro Hek-
tare, brach nach 1990 auf durchschnitt-
lich gut 5 Kilo ein und erreichte schliess-
lich 1999 und 2000 einen Tiefpunkt unter
1 Kilo, wie man ihn seit den Kriegsjahren
nie mehr erlebt hatte. Im Vergleich zum
Vorjahr fingen die Berufsfischer noch ge-
rade 10 Prozent der Felchen, was zu
einem temporären Zusammenbruch der
Netzfischerei am Brienzersee führte.
Hungernde Felchen Die Felchen im Brienzersee sind heute nur noch halb so schwer wie ihre Artgenossen
der 1980er-Jahre.
Die im Hochwasserjahr 1999 gefangenen
Fische waren mager und offensichtlich kauft, muss also mittlerweile doppelt so kantonale Fischereiinspektorat seit 1984
schlecht ernährt. Im Rahmen seiner Rou- viele Felchen und drei- bis viermal so viele monatlich 25 Fische aus dem Tagesfang
tineuntersuchungen stellte das kantonale Brienzlig fangen wie vor 20 Jahren, um eines Berufsfischers untersucht und dabei
Gewässer- und Bodenschutzlabor GBL im auf denselben Ertrag zu kommen. – neben anderen Merkmalen – auch Län-
Brienzersee gleichzeitig ein fast völliges Wie Wachstumsanalysen zeigen, besteht ge, Gewicht und Alter bestimmt. Aus den
Verschwinden der Daphnien fest. Diese ein statistisch gesicherter Zusammen- Jahren 2001 und 2002 liegen zusätzlich
Kleinkrebse sind ein Teil des Zooplank- hang zwischen dem Bestand der Daph- Analysen des Mageninhalts von rund hun-
tons und bilden die wichtigste Futterquel- nien und dem Wachstum der Felchen in dert Brienzerseefelchen vor. Die Fachleu-
le der Felchen. der dafür wichtigen Jahreszeit von Mai bis te stellten dabei fest, dass zwischen dem
Seit 2001 wachsen die Fische zwar wie- September. Mit Ausnahme der Jungfische Gewichtsanteil des Zooplanktons im Ma-
der etwas besser, aber deutlich lang- im ersten Lebensjahr, die sich primär von gen der Fische und dessen Gesamtbe-
samer als früher. Erreichte ein vierjähriger, Hüpferlingen – einem anderen Kleinkrebs stand im See ein direkter Zusammenhang
geschlechtsreifer Brienzlig vor 20 Jah- – ernähren, gilt dies für den Zuwachs der besteht, der bei Daphnien am stärksten
ren noch eine Körperlänge von 25 bis 30 Felchen im zweiten, dritten und vierten ist. Seit 1997 nimmt die Zahl der Daph-
Zentimeter, so sind es heute kaum mehr Lebensjahr. Dabei zeigt sich über länge- nien im Brienzersee ab, was zur Folge hat,
20 Zentimeter. Vergleicht man das Ge- re Zeit auch eine nachweisbare Verknüp- dass die Fische immer seltener auf das
wicht von zwei so unterschiedlich lan- fung zwischen dem Gehalt an Nährstoffen Zooplankton treffen und somit auch we-
gen Brienzlig, erscheint die Abnahme um im See sowie der Längen- und Gewichts- niger fressen können. Dies ist der Haupt-
70 Prozent in dieser Zeit noch drama- entwicklung der Fische. grund für das langsamere Wachstum der
tischer. Auch die schneller wachsenden Felchen.
Felchen bringen inzwischen nur noch die Abhängigkeit von den Daphnien
Hälfte des Gewichts ihrer Artgenossen Stark verminderte Nahrungsaufnahme
der 1980er-Jahre auf die Waage. Ein Be- Solche Vergleiche waren im Rahmen des
rufsfischer, der seinen Fang pro Kilo ver- Forschungsprojekts nur möglich, weil das Im Rahmen der Brienzersee-Studie durch-
geführte Modellrechnungen gehen dem
Felchenfangerträge der Berufsfischer am Brienzersee permanenten Hunger auf den Grund. Fel-
chen filtrieren nicht einfach das Wasser,
25
sondern schnappen ihre Beute gezielt.
70
Sind genügend Futtertiere vorhanden,
Jahresertrag in Kilo pro ha
Jahresertrag in Tonnen
60 20 was bei einem hohen Bestand von rund
1500 erwachsenen Daphnien je Kubikme-
50
15 ter Wasser – wie etwa im November 1995
40 – der Fall ist, können die Felchen pro Mi-
nute knapp 60 Daphnien fressen. Der
30 10
im November 1999 stark reduzierte Be-
20 stand von bloss noch 5 ausgewachsenen
5 Daphnien je m3 verringerte ihre mögliche
10
Fressleistung auf nur 2,4 Tiere pro Minu-
0 0 te. Noch härter traf es den kleineren und
1935 1945 1955 1965 1975 1985 1995 2005 langsameren Brienzlig, der im gleichen
Zeitraum statt 50 lediglich 0,8 Daphnien
fressen konnte. Der Brienzlig scheint dem-
nach viel stärker von der Reduktion der
Unter natürlichen Bedingungen war der Brienzersee nie ein ertragreiches Fischgewäs- Nahrungsgrundlage betroffen zu sein als
ser, wie die Fangzahlen zwischen 1930 und 1950 zeigen. Trotz natürlicher Schwan- der Felchen. Wegen dem geringen Be-
kungen der Bestände sind die Auswirkungen des verminderten Nährstoffeintrags durch stand an Daphnien haben die Fische heu-
den Bau von Kläranlagen nach 1975 deutlich zu erkennen. te vor allem im Frühling und Frühsommer
Seit 1984 untersucht das Fischereiinspektorat (rechts) monatlich 25 Fische aus dem Tagesfang eines Berufsfischers und bestimmt
dabei auch Länge, Gewicht und Alter der Felchen.
Mühe, ihren Tagesbedarf an Nahrungsor- zumal der Einbruch der Daphnien vorab serschichten, in denen die Felchen ihr
ganismen zu decken. die Entwicklung im Frühsommer betraf. Futter hauptsächlich suchen und finden.
Die geringe Produktivität des Brienzer- Insbesondere beim Brienzlig dürfte sich Solange die Schwebstoffe nicht während
sees bewirkt ein instabiles Nahrungsnetz. das beschränkte Nahrungsangebot auch mehrerer Wochen in den oberen Wasser-
Aus diesem Grund ist ein Einbruch der auf die Entwicklung der Geschlechtsor- schichten verbleiben, ist eine direkte Be-
wichtigsten Futterbasis der Felchen – ge- gane auswirken. einflussung des Felchenwachstums un-
mäss den wissenschaftlichen Erkenntnis- wahrscheinlich. Weil die Fachleute keine
sen – jeweils im Frühling auch künftig wie- Unwahrscheinlicher langfristige Veränderung der Trübung fest-
der möglich. Einfluss der Trübung stellen konnten, lässt sich das reduzierte
Wachstum der Felchen auch nicht damit
Auswirkungen auf die Fortpflanzung Eine erhöhte Trübung im See reduziert die erklären.
Sichtweite der Felchen und könnte da-
Die Anzahl der produzierten Eier hängt mit im Extremfall auch deren Fressleis- Dezimieren die Felchen
bei den Fischen vom Körpergewicht ab. tung beeinträchtigen. Dies ist allerdings ihre Futterorganismen?
Deshalb wirkt sich das reduzierte Wachs- nur der Fall, wenn die vom Zooplankton
tum zusätzlich auch auf die Fortpflanzung bevorzugten und für die Felchen als Nah- Im Rahmen der Brienzersee-Studie ist
aus. 1999 erreichte die Gesamtzahl der rungsgründe wichtigen Wasserschichten auch abgeklärt worden, inwiefern die Fel-
abgelegten Eier durch den Zusammen- durch Schwebstoffe stark getrübt werden. chen selbst ihre Nahrungsgrundlage de-
bruch des Nährtierbestandes vor allem Wie Messresultate und Simulationen des zimiert haben und so am Verschwinden
beim Brienzlig einen Tiefpunkt. Entschei- Schwebstoffgehalts im Brienzersee mit der Daphnien im Jahr 1999 beteiligt sein
dend war dabei der Futtermangel kurz vor und ohne Stauseen im Einzugsgebiet zei- könnten. Nimmt man an, dass die Felchen
der Laichsaison im August. Da die grös- gen, tritt die stärkste Trübung in der Regel ausschliesslich Daphnien fressen, so be-
seren Felchen im Dezember laichen, be- im Sommer unterhalb von 10 Metern auf. seitigen sie bei normaler Entwicklung ih-
kamen sie dies etwas weniger zu spüren, Damit liegt sie meistens unter den Was- rer Futterorganismen im Sommer täglich
Fischfangerträge in den drei Berner Seen Phosphatgehalt und Felchenproduktion im Gleichschritt
70 3.0 300
Felchenproduktion in Kilo pro Tag
Jahresertrag in Kilo pro ha
60 2.5 250
50
2.0 200
Phosphat µg/l
40
1.5 150
30
1.0 100
20
10 0.5 50
0 0 0
1935 1945 1955 1965 1975 1985 1995 2005 1994 1996 1998 2000 2002 2004
Brienzersee Thunersee Bielersee Phosphatkonzentration Felchenproduktion
Nicht nur im Brienzersee gingen die Fangerträge der Berufs- Der Phosphatgehalt im Brienzersee erreicht heute noch knapp
fischer nach den Höchstständen in den 1970er-Jahren zurück. ein Drittel der Konzentrationen der frühen 1990er-Jahre. Auf
Trotz ebenfalls geringer Nährstoffzufuhr ist der Thunersee leicht Grund des zunehmend knappen Nahrungsangebots hat auch die
produktiver als der Brienzersee, weil sein Wasser klarer ist. Nettoproduktion der Felchen markant abgenommen.
0,5 bis 1,5 Prozent des Zooplanktons. Brienzlig und Felchen
Wie Auswertungen der Magenanalysen
und der Zooplanktonbestände für die Jah-
re 2001 und 2002 zeigen, besteht die Fel-
chennahrung jedoch nicht ausschliesslich
aus Daphnien. Speziell im Frühling sind
auch Mückenlarven und im Sommer grös-
sere Raubkrebschen wichtige Nahrungs-
bestandteile. Wird den Modellrechnungen
diese differenzierte Nahrungszusammen-
setzung zu Grunde gelegt, übersteigt der
Daphnienfrass der Felchen pro Tag nur
selten 1 Prozent des Bestandes.
Grundsätzlich könnten die Felchen zwar
einen erheblichen Teil der Daphnienpo- cm
pulation konsumieren und deren Aufbau – 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25
zusammen mit weiteren ungünstigen Fak-
toren – dadurch weitgehend unterbinden.
Die seit 1997 tendenziell rückläufigen Der Brienzlig (unten) ist deutlich kleiner als der Brienzersee-Felchen (oben), von
Felchenbestände haben den Frassdruck dem er sich optisch kaum unterscheidet. Beide Fische leben meistens in
jedoch vermindert. Zudem verursachten denselben Schwärmen.
auch Frassraten von täglich mehreren
Prozent vor 1999 und nach 2000 nie ei- Im Brienzersee leben zwei Felchenformen, chen, der sich erst im Dezember in den
nen derartigen Einbruch der Kleinkrebse der kleinwüchsige Brienzlig und der grös- Uferpartien fortpflanzt, durch Erbrütung
wie 1999. Deshalb schliessen die Fachleu- sere Felchen. Die meiste Zeit des Jahres und Aufzucht gestützt. Zwischen 1989
te einen übermässigen Frass der Fische halten sie sich in den gleichen Schwär- und 2000 hat man im Brienzersee jährlich
als alleinige Ursache für den gehemmten men auf, wo sie von Auge nicht eindeutig 30‘000 bis 250‘000 Brütlinge ausgesetzt.
Aufbau der Daphnienpopulation zwischen auseinander zu halten sind. Spezialisten Wegen dem abnehmenden Bestand hat
Frühling 1999 und Sommer 2000 aus. erkennen sie an der ungleichen Anzahl der Kanton die Einsätze seit 2001 intensi-
von Kiemenreusendornen sowie am unter- viert. So werden nun zusätzlich Felchen-
Nachhaltige schiedlichen Wachstum. brütlinge aus dem Brienzersee in Netz-
Bewirtschaftung der Felchen Der sommerlaichende Brienzlig bevorzugt käfigen im planktonreicheren Thunersee
Laichplätze in 30 bis über 100 Metern Tie- aufgezogen. Einer Steigerung der Auf-
Seit 1999 haben die Berufsfischer am fe, wobei der Bestand ausschliesslich aus zucht für den Brienzersee sind auf Grund
Brienzersee viel weniger Brienzlig ge- der Naturverlaichung stammt. Demgegen- der schmalen Futterbasis jedoch enge
fangen als vor dem Einbruch des Daph- über wird der schneller wachsende Fel- Grenzen gesetzt.
nienbestandes. Wie Probefänge mit en-
geren Maschenweiten zeigen, hat man sen. Damit verfolgt das Fischereiinspek- fach durch Besätze mit Brutfischen aus
ihren Bestand wahrscheinlich stark unter- torat das Ziel, einen höchst möglichen anderen Seen ersetzen kann. Weil man
schätzt, weil die gegenüber früher deut- Ertrag abzuschöpfen, ohne dadurch die für den Brienzligfang inzwischen engma-
lich kleineren und schlankeren Fische mit Nachhaltigkeit der Fänge zu gefährden. schige Netze einsetzt, ist die Überwa-
den bis Ende 2005 erlaubten Netzma- Diese Form der Bewirtschaftung ist auch chung jetzt besonders wichtig. Denn es
schen kaum mehr gefangen werden konn- aus Artenschutzgründen wichtig, weil die gilt zu vermeiden, dass zu viele unreife
ten. Deshalb hat der Kanton ab 1. Januar Felchenformen jedes einzelnen Schweizer Jungfelchen gefangen werden, was den
2006 neue Vorschriften für das Fangmin- Sees genetisch einzigartig sind, so dass Bestand weiter schwächen könnte.
destmass und die Maschenweite erlas- man sie bei einer Überfischung nicht ein-
Wachstumsentwicklung der Felchen Wie viele Daphnien fressen die Felchen?
400 500
400
350
300
300
Totallänge in mm
200
250 100
0
200
0
150
0.5
100 1.0
50 1.5
0 2.0
1981 1985 1990 1995 2000 2004 Jahr Jan 2001 Juli 2001 Jan 2002 Juli 2002
1. Jahr 2. Jahr 3. Jahr 4. Jahr Daphnienbestand in t Daphnienfrass durch Felchen in %
Wie die Auswertung der Jahre 2001 und 2002 zeigt, übersteigt
Das geringere Futterangebot wirkt sich vor allem ab dem zwei- der tägliche Daphnienfrass der Felchen nur selten 1 Prozent
ten Lebensjahr auf das Wachstum der Felchen im Brienzersee der Population. Damit wird der Bestand der Kleinkrebse in sei-
aus. 1984 erreichten sie im dritten Lebensjahr noch eine Länge ner wichtigen Wachstumsphase im Frühling normalerweise nicht
von 300 mm, heute sind es nur noch 250 mm. stark gehemmt.
Entwicklung der Daphnien Ein neuerlicher Zusammenbruch ist möglich Mit diesem Zwillingsnetz lässt sich das Zooplankton bis in grosse Tiefen beproben. Die mangelnde Futterbasis, tiefe Wassertemperaturen und der ausserordent- liche Abfluss während des Hochwassers im Frühling waren 1999 die Haupt- gründe für den Zusammenbruch der Daphnienpopulation im Brienzersee. Dagegen lassen sich Schwebstoffe und Parasiten als ebenfalls vermutete Ursachen ausschliessen. Bedingt durch das zunehmend knappe Nahrungs- angebot ist ein erneuter drastischer Einbruch des Daphnienbestandes im Frühjahr auch künftig wieder möglich – mit entsprechenden Auswirkungen auf die Felchen. Nach den heftigen Schneefällen vom Feb- wurden. Wochenlang waren die Verlus- den verstärkten Abfluss verursachten Ver- ruar 1999 lag der Schnee im alpinen Ein- te durch diesen Abfluss grösser als das luste im Mai und Juni somit nicht durch zugsgebiet des Brienzersees im Frühling Wachstum des Bestandes. Dadurch ge- Wachstum kompensieren. noch meterhoch. Als die Schneeschmel- lang es der Population im Jahr 1999 nicht, ze im folgenden Mai und Juni mit mehrtä- sich im Frühsommer wie üblich im See zu Immer kleinere Population gigen Starkniederschlägen zusammenfiel, entwickeln. Von Februar bis August war führten Aare und Lütschine riesige Men- der Bestand so klein, dass man die Daph- Seit Beginn der Routineuntersuchungen gen an Wasser und liessen den Seespie- nien bei Routineuntersuchungen nicht im Brienzersee durch das Gewässer- und gel rasch ansteigen. mehr nachweisen konnte. Bodenschutzlabor GBL des Kantons Bern Fachleute der Eawag – dem Wasserfor- ist die Daphnienpopulation im Lauf der schungs-Institut des ETH-Bereichs – ha- Schlechte Startbedingungen letzten zehn Jahre ständig kleiner gewor- ben die entsprechenden Auswirkungen den. Die Tiere reagieren damit auf den auf die Daphnien untersucht. Nach ih- Weil die Eientwicklung der Daphnien von Rückgang des Nährstoffeintrags, der das ren Erkenntnissen dämpfte der während der Temperatur abhängt und kaltes Was- Algenwachstum begrenzt. Das geringe eineinhalb Monaten unüblich hohe See- ser das Schlüpfen der Jungtiere verzö- Nahrungsangebot limitiert die Entwick- durchfluss die Entwicklung der Population gert, herrschten im Frühjahr 1999 ohne- lung der Daphnien während des ganzen im Brienzersee ausserordentlich stark. Die hin schlechte Startbedingungen. In der Jahres und erlaubt ihnen zwischen De- Kleinkrebse können in der Wassersäule kritischen Entwicklungsphase der Popu- zember und April kein Populationswachs- zwar auf- und absteigen, doch auf Grund lation war der Brienzersee in den obers- tum. Nach dem üblichen Einbruch im Win- ihrer eingeschränkten Schwimmfähigkeit ten 10 Metern bis zu 3 Grad kälter als im ter brauchen sie deshalb immer länger, sind sie weitgehend den Strömungen aus- Normalfall. Der grosse und kalte Zufluss um sich in der wärmeren Jahreszeit wie- geliefert. Die Forschenden gehen davon spülte das erst spärlich erwärmte Ober- der im See zu vermehren. aus, dass viele der vorhandenen Daph- flächenwasser damals überdurchschnitt- nien in der fraglichen Zeit vom Hochwas- lich rasch aus. Auf Grund der reduzierten ser zum Seeausfluss der Aare und fluss- Temperatur wuchs die Daphnienpopulati- abwärts Richtung Interlaken gespült on nur sehr langsam und konnte die durch 10
Daphnien klonen ihren Nachwuchs
Daphnien sind kleine Krebstiere, die in – sei es durch den eigenen Frassdruck hen, kann sich eine lokale Daphnienpopu-
Schweizer Seen bis zu 2 Millimeter gross auf die Algen oder als Folge der kürzeren lation auch nach einem völligen Einbruch
werden. Sie verfügen über einen Filterap- Herbsttage und tieferen Temperaturen –, wieder neu in einem See aufbauen. Dies
parat, mit dem sie das Wasser filtrieren stellen die Weibchen oft auf die sexuel- kann durch Dauereier aus dem betrof-
und sich auf diese Weise mehrheitlich von le Reproduktion um. Sie produzieren nun fenen Gewässer oder aus anderen Seen
Algen, aber auch von Bakterien und wei- Männchen und Dauereier. Letztere werden geschehen, woher sie zum Beispiel zu-
terem organischem Material ernähren. Da- von den Männchen befruchtet und dann fällig durch Wasservögel oder Menschen
bei gelangen auch mineralische Schweb- ins Wasser abgegeben, wo sie zum See- transportiert werden. Im Normalfall bilden
stoffe in die Verdauung. grund sinken. Im Frühling können daraus die Dauereier eine Art Überbrückungshil-
Zusammen mit anderen Zooplanktonarten wieder junge Daphnien schlüpfen. Blei- fe für das Überstehen der nahrungsarmen
spielen die Daphnien eine zentrale Rolle ben die Dauereier im Oberflächenfilm des Zeit im Winter, während der die asexuel-
in der Nahrungskette eines Sees. Für viele Wassers gefangen, so werden sie biswei- len Weibchen keine Eier bilden können.
Fische wie zum Beispiel die Felchen, wel- len von Winden und Strömungen ans Ufer
che hauptsächlich von tierischem Plank- gespült. Weil die Eier sehr robust sind und
ton leben, bilden sie mit Abstand die wich- Eis, Austrocknung und selbst den Ma-
tigste Futterquelle. Im Spätfrühling, wenn gen von Fischen unbeschadet überste-
das Angebot an Algen in den Seen durch
die zunehmende Lichteinstrahlung immer Ein Daphnienweib-
grösser wird, wächst die Population der chen mit asexuel-
Kleinkrebse normalerweise rasch an. len Eiern, die ohne
Befruchtung ent-
Geklonte und befruchtete Jungtiere stehen (links) und
eines mit sexuell
In den nahrungsreichen Sommermonaten erzeugten Dauerei-
leben in einem See nur Daphnienweib- ern (rechts).
chen, die ohne Befruchtung – und damit
ohne Männchen – Nachkommen bilden
können. Diese Jungtiere sind genetisch
identisch mit ihrer Mutter, stellen also Klo-
ne von ihr dar. Sobald sich das Angebot
an pflanzlichem Plankton verschlechtert
Hungerphase im Winter tert, so wird die erste Überlebensstrategie be, Wind und Strömung – an ungünstigen
immer riskanter. Die spezielle Topogra- Stellen absinken, wo sie für immer liegen
Die Daphnien des Brienzersees verfü- phie des Brienzersees schmälert aber bleiben.
gen über zwei Strategien, um die winter- auch den Schlüpferfolg der Dauereier.
liche Hungerphase zu überstehen. Ei- Denn geeignete seichte Stellen mit einer Die Daphnien fehlten schon früher
nerseits überwintern die Weibchen als Wassertiefe von höchstens 20 Metern, wo
asexuelle Population, andererseits produ- die Jungtiere überhaupt aus den Dauer- Von Februar bis August 1999 konnte
zieren sie im Herbst Dauereier, aus de- eiern schlüpfen können, machen im steil das GBL im Brienzersee keine Daphnien
nen im Frühling – stimuliert von Licht und abfallenden Becken nur gerade 8 Prozent nachweisen. Das weitgehende Fehlen der
Wärme – wieder Jungtiere schlüpfen (sie- der gesamten Seefläche aus. Deshalb ist Kleinkrebse war jedoch keine einmalige
he Kasten). Falls sich die Nahrungsgrund- die Wahrscheinlichkeit relativ gross, dass Ausnahmeerscheinung. Wie Analysen der
lage im Winter künftig weiter verschlech- die Dauereier – je nach Ort der Eiabga- Eawag von Sedimentkernen zeigen, las-
sen sich Dauereier auf dem Grund des
Anzahl Daphnien pro m2 in 1000 von 1985 bis 2005 Sees bis zurück ins Jahr 1955 nachwei-
sen. Zwischen 1918 bis 1955 fehlten sie
250 in den Ablagerungen der Sedimente aber
0–100 m
ganz. Die Erkenntnis deckt sich mit der
200 historischen Literatur, die wiederholt vom
Fehlen der Daphnien im Brienzersee be-
Daphniendichte lnd./m2
richtet, so etwa für die Jahre 1876, 1895,
150
1898, 1921, 1922, 1945 und 1946. Hinge-
keine Daten gen wurden sie 1897 nachgewiesen. Vor
100 1955 scheinen sich die Tiere also nie dau-
erhaft im See etabliert zu haben, sondern
sind nur in einzelnen Jahren aufgetaucht.
50
Einbrüche auch künftig möglich
0
1985 1990 1995 2000 2005 Laut den Fachleuten der Eawag ist die
Population im See heute so labil, dass
Stressfaktoren in der wichtigen saisona-
Die Daphniendichte im Brienzersee folgt einem saisonalen Muster mit beträchtlichen len Entwicklungsphase – wie etwa ein
natürlichen Schwankungen. Angegeben ist die Zahl der Individuen von 0 bis 100 Meter Frühlingshochwasser oder eine kurzfristi-
Tiefe. Im Hochwasserjahr 1999 konnten die Fachleute des Kantons im See nur verein- ge Reduktion der Algenproduktion – wie-
zelte Daphnien nachweisen. derum zu einem Einbruch der Daphnien
11Im Rahmen der Forschungsarbeiten sind die im Brienzersee gefangenen Daphnien in den Labors der Eawag umfassend untersucht
worden. Dabei zeigte sich unter anderem, dass der Gehalt an Trübstoffen im See zu tief ist, um die Daphnien zu schädigen.
führen könnten. Obwohl deren Bestand Wie frühere Felduntersuchungen aus an- nie derart hohe Werte gemessen worden.
seit Mitte der 1990er-Jahre laufend abge- deren Seen zeigen, können diese unter Dies gilt auch für das Hochwasser 1999.
nommen hat, halten die Wissenschaftler besonderen Umständen die Nahrungs- Von April bis August waren die Schweb-
ein völliges Verschwinden der Tiere aus aufnahme, Fitness und Fruchtbarkeit des stoffgehalte im See damals mit bis zu
dem Brienzersee in naher Zukunft aber für Zooplanktons vermindern. Dabei beein- 6 Milligramm pro Liter zwar überdurch-
sehr unwahrscheinlich. Denn selbst wenn trächtigen besonders hohe Konzentra- schnittlich lange hoch, erreichten jedoch
die asexuellen Weibchen den Winter nicht tionen an Schwebstoffen das Popula- nicht die für Daphnien kritischen Werte.
überstehen, könnte die Population immer tionswachstum und unter ungünstigen Deshalb schliessen die Fachleute einen
wieder aus Dauereiern entstehen, die ent- Umständen auch das Überleben der Zusammenhang zwischen dem Schweb-
weder aus dem Brienzersee selbst oder Tiere. stoffgehalt und dem allgemeinen Daph-
aus anderen Gewässern stammen. Dies Wie eigens mit Daphnien und Schweb- nienrückgang im Brienzersee aus.
mag erklären, weshalb sich die dezimier- stoffen aus dem Brienzersee durchgeführ- Umgekehrt ist ein Einfluss der Daphnien
te Daphnienpopulation, von der das GBL te Experimente zeigen, sind die Gehalte auf die sommerliche Sichttiefe im See je-
im Herbst 1999 nur wenige Tiere fand, im an Trübstoffen im See jedoch zu tief, um doch denkbar. Bestandesgrössen, wie
Folgejahr wieder erholte. die Daphnien zu schädigen. Problema- sie noch im Sommer 1995 auftraten, wa-
tisch wären erst Konzentrationen ab zir- ren theoretisch in der Lage die obersten
Keine kritische Konzentration ka 25 Milligramm pro Liter, wenn gleich- 50 Meter des Brienzersees in einem Mo-
an Schwebstoffen zeitig kaum Nahrung vorhanden ist. Mit nat durchzufiltern und dabei auch die
Ausnahme einer Phase unmittelbar nach Schwebstoffe teilweise aus dem Was-
Da Daphnien ihre Umgebung filtrieren dem August-Hochwasser von 2005, als ser zu entfernen. Zur Blütezeit der Popu-
und dabei wahllos Partikel zwischen 0,5 man in einzelnen Tiefenschichten 24 Mil- lationen in den 1970er und 1980er-Jah-
und 40 Mikrometer aufnehmen, konsumie- ligramm je Liter registrierte, sind in den ren könnte dieser biologische Filtereffekt
ren sie auch mineralische Schwebstoffe. Oberflächenschichten der Seemitte bisher den See im Juli und August aufgeklart ha-
Anzahl der Dauereier pro m2 im Sediment Wasserabfluss und Entwicklung der Daphnien
20 000 300 300
1
2 18 000
Anzahl der Dauereier pro m2
Abfluss in Ringgenberg m3/s
Daphniendichte (Ind./m2)
3 250 250
16 000
4
5 14 000
200 200
6 12 000
7
10 000 150 150
8
9 8000
10 100 100
6000
11
12 4000
50 50
13 2000
14
0 0 0
cm 1920 1940 1960 1980 2000 Jan März Mai Juli Sept Nov
Abfluss Daphniendichte
1999 Durchschnittsjahr 1999 Durchschnittsjahr
Vor 1955 scheinen sich die Daphnien nie dauerhaft im Brienzer- In der ersten Jahreshälfte 1999 haben der aussergewöhnliche
see etabliert zu haben. Dies zeigen Sedimentkerne, in denen Abfluss im Brienzersee und das kalte Wasser die Daphnienpopu-
nach Dauereiern gesucht wurde. Ein Jahr entspricht jeweils lation in ihrer normalen saisonalen Entwicklung stark gehemmt.
einer hellen und einer dunklen Lage im Sediment. Deshalb fiel das übliche exponentielle Frühlingswachstum aus.
12Mit einem Durchflussversuch wurde der Für die Daphnien war das Hochwasser vom August 2005 keine Katastrophe. Weil sich
Einfluss der Trübstoffe auf die Daphnien im Spätsommer bereits eine grosse Population aufgebaut hatte, reagierten sie weniger
analysiert. anfällig als im Frühjahr 1999.
ben. Für eine gesicherte Aussage fehlen Andere Hochwassersituation
allerdings die Datengrundlagen. Sollten im August 2005
die subjektiven Beobachtungen zutreffen,
wonach der See vor 10 bis 20 Jahren im Im Gegensatz zu 1999 ist der Daphni- zentrationen eher positiv auf die Tiere aus.
Sommer kurzzeitig transparenter war als enbestand während des Hochwassers Selbst bei Gehalten im schädlichen Be-
heute, würde der Daphnienrückgang eine im August 2005 nicht eingebrochen. Die reich könnten die Kleinkrebse immer noch
plausible Erklärung dafür liefern. Ausgangsbedingungen waren nämlich in die Tiefe oder nach oben ausweichen,
völlig anders. Denn im Spätsommer hatte da die Trübung im Brienzersee durch das
Weder ein Versagen der Dauereier sich im Vergleich zum Frühling im Brien- Einschichten der Zuflüsse nicht über alle
noch Parasiten als Ursache zersee bereits eine üblich grosse Daph- Wasserschichten gleich verteilt ist.
nienpopulation aufgebaut, und das Zoo-
Auch die Vermutung, wonach die Dau- plankton reagierte wegen dem besseren
ereier möglicherweise durch abgelager- Futterangebot und den deutlich wärmeren
te Partikel zugedeckt oder erstickt wor- Wassertemperaturen weniger anfällig auf
den seien, haben die Forscher verworfen. äussere Einflüsse. Zudem hielt der hohe
Das Hochwasser 1999 führte im See näm- Wasserabfluss 2005 nur zwei Wochen an
lich nicht zu einer stärkeren Ablagerung und nicht anderthalb Monate wie 1999.
von Schwebstoffen. Im untersuchten Ufer- Ausserdem schwemmt ein Hochwasser
bereich bei Iseltwald lag die durchschnitt- im Sommer mehr organische Bestandteile
liche Sedimentationsrate in 19 Metern Tie- an als im Frühjahr. Diese können teilwei-
fe 1999 mit 1,9 Millimetern sogar deutlich se von den Daphnien als Nahrung genutzt
unter dem langjährigen Mittelwert von 3,5 werden. In solchen Fällen wirken sich
Millimeter pro Jahr. Somit reichten die an Schwebstoffe unter den kritischen Kon-
den seichten Stellen des Brienzersees ge-
messenen Stoffablagerungen nicht aus, Biomasse der Algen in Gramm pro m2
um die Jungtiere vom Schlüpfen abzu-
30 000
halten. Zudem konnten die Fachleute der
Eawag im Labor auch Dauereier aus
25 000
früheren Jahren zum Schlüpfen bringen.
Ein Problem mit dieser Form der Fort-
20 000
pflanzung kommt als Erklärung für den
Einbruch der Daphnien von 1999 folglich 15 000
nicht in Frage. Im Sommer, wenn die Zu-
flüsse am meisten Schwebstoffe in den 10 000
See eintragen, sind die Jungtiere ohnehin
bereits aus den Dauereiern geschlüpft. 50 000
Die Wissenschaftler schliessen im Übrigen
auch einen entsprechenden Einfluss von 0
Parasiten praktisch aus. Erstens liessen 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005
sich in Proben fast keine Erreger nachwei- Mikroplankton (gross) Nanoplankton (mittel) Picoplankton (klein)
sen. Zweitens ist eine hohe Ansteckungs-
rate angesichts der tiefen Daphniendichte
im Brienzersee eher unwahrscheinlich. Daphnien ernähren sich vor allem vom Nanoplankton. Dessen Konzentration war
1999 bis in eine Seetiefe von 20 Meter nicht aussergewöhnlich tief. Damit lässt sich
der damalige Einbruch der Kleinkrebse nicht mit einem verminderten Nahrungsange-
bot erklären
13Nährstoffbilanz und Algenproduktion
Der Mangel an Nährstoffen
prägt das Leben im See
Mit dieser Flasche lassen sich gleichmässige Mischproben aus den obersten 20 Metern des Sees entnehmen.
Im Brienzersee beschränkt sich das jährliche Wachstum von pflanzlicher
Biomasse heute auf rund 5000 Tonnen oder 67 Gramm Kohlenstoff pro Qua-
dratmeter. Auf die Fläche bezogen ist dies weniger als die Hälfte der Produk-
tion im Vierwaldstättersee. Das geringe Nährstoffangebot – insbesondere
der Mangel an algenverfügbarem Phosphat – und die Lichtabschwächung
durch die eingetragenen Trübstoffe lassen auch in Zukunft nicht mehr
erwarten. Deshalb werden die Populationen der Daphnien und Felchen im
See nicht mehr die Bestandesgrössen der späten 1970er-Jahre erreichen.
Für das Algenwachstum ist das Element schine. 96 Prozent des Phosphors sind der Nachweisgrenze. Als Vergleich dazu
Phosphor auch im Brienzersee der limitie- an schwerlösliche Mineralien und an an- misst man im Bielersee rund 10 Mal hö-
rende und somit entscheidende Nährstoff. dere – zum Teil auch organische – Parti- here Werte. Die seit Mitte der 1970er-Jah-
Selbst wenn alle anderen Wachstums- kel gebunden, die zum Grossteil auf den re laufend sinkenden Phosphatkonzentra-
faktoren im Überfluss vorhanden wären, Seegrund absinken, ohne für das pflanz- tionen im Brienzersee widerspiegeln damit
liesse der begrenzte Phosphatgehalt im liche Plankton je verfügbar zu sein. Denn vor allem den Rückgang dieses Nährstoffs
See keine wesentlich höhere Plankton- aus den Sedimenten erfolgt keine Rücklö- aus der Siedlungsentwässerung. Belief
produktion zu. Da die Algen am Anfang sung von Phosphat, das die Algen wieder sich die entsprechende Zulauffracht um
der Nahrungskette stehen, bestimmt ihr umsetzen könnten. Auf Grund des hohen 1970 noch auf jährlich 25 Tonnen, so sind
Wachstum das gesamte übrige Leben mineralischen Anteils macht der Eintrag es heute lediglich rund 2 Tonnen. Der Ein-
im Gewässer. Je geringer die Konzentra- von gelöstem, biologisch verfügbarem trag von biologisch verwertbarem Phos-
tion an biologisch verfügbarem Phosphat Phosphor aus den Zuflüssen nur die Rest- phat aus den übrigen Quellen macht seit
im See, umso weniger Biomasse wächst. menge von etwa 4 Prozent der gesam- Jahrzehnten konstant rund 5 bis 7 Ton-
Dieses beschränkte Angebot wirkt sich ten Phosphorfracht aus. Die Fachleute der nen aus. Darunter fallen zum Beispiel Ab-
direkt auf die Daphnien und auf weitere Eawag beziffern sie heute auf knapp 8 schwemmungen aus Wiesen, Feldern und
Zooplanktonarten aus. Finden sie nichts Tonnen pro Jahr, wobei der Eintrag von Wäldern sowie Einträge aus der Luft. Bei
zu fressen, sind ihre Bestände klein, so Kläranlagen, durch Abschwemmungen heftigen Regenfällen gelangen zudem 0,4
dass auch den Felchen die Nahrungs- und aus der Luft mitberücksichtigt ist. Tonnen gelöstes Phosphat über Entlastun-
grundlage fehlt. gen von ungereinigtem Abwasser aus der
Entscheidender Beitrag der Kanalisation in die Gewässer.
Wenig bioverfügbares Phosphat Siedlungsentwässerung Den Ausschlag für das seit den 1940er-
Jahren allmählich steigende und nach
Durch Erosion im Einzugsgebiet werden Die vom Kanton im Brienzersee gemes- dem Höhepunkt von 1975 sinkende Nähr-
jährlich gut 200 Tonnen Phosphor in den senen Phosphatgehalte entsprechen dem stoffangebot im See gibt also in erster Linie
Brienzersee geschwemmt. Diese Menge geringen Eintrag aus den Zuflüssen. Mit die Entwicklung der Abwasserentsorgung.
entspricht knapp 0,7 Promille der gesam- Werten unter 1 Mikrogramm pro Liter lie-
ten Schwebstofffracht von Aare und Lüt- gen sie seit einigen Jahren im Bereich
14Gletscher und Fels – wie hier in der Grimselregion – prägen das Einzugsgebiet des Brienzersees. Deshalb ist der Eintrag an Nährstof-
fen, die das pflanzliche Plankton verwerten kann, äussert gering. Das knappe Nahrungsangebot schränkt auch die Produktivität des
Zooplanktons und der Fische ein.
Rasanter Anstieg Die starke Zunahme der Nährstoffgehalte des Gewässerschutzes nach Inbetrieb-
der Phosphatgehalte führte in der Folge vor allem in den Mittel- nahme der ARA Brienz im Jahr 1975 erst-
landseen zu einer Überdüngung. Hier wu- mals dämpfend auf die Phosphatzufuhr
Noch in der ersten Hälfte des 20. Jahr- cherten die Algen, und auf dem Seegrund aus. Bis 1988 folgten weitere bedeutende
hunderts wurden die menschlichen Fäka- zehrte die Zersetzung der absterbenden ARA in Meiringen, Grindelwald und Lau-
lien im Einzugsgebiet des Brienzersees Biomasse im Herbst den Sauerstoff im terbrunnen. Diese vier Anlagen behandeln
vielerorts in Gruben gesammelt und land- Tiefenwasser auf, was den Lebensraum zusammen gut 90 Prozent der Abwasser-
wirtschaftlich verwertet. Die zunehmende von Fischen und anderen Wasserorganis- menge aus dem Einzugsgebiet. Die wei-
Versorgung der Liegenschaften und Woh- men bedrohte. teren sieben Kläranlagen in der Regi-
nungen mit Trinkwasser erforderte dann on sind für den Nährstoffhaushalt im See
den Bau von Kanalisationen, die man da- Der Bund gibt Gegensteuer weniger wichtig. In Kombination mit dem
mals noch ohne jegliche Reinigung des Phosphatverbot für Waschmittel wurde
Abwassers in ein Gewässer einleitete. Unter anderem auf Druck der Fischer und der Phosphateintrag aus Abwasser in den
Damit überschritt der Eintrag von Phos- ihrer Organisationen reagierte der Bund, See durch den Bau der grösseren ARA in-
phaten aus Urin und Fäkalien in den frü- indem er zuerst die Reinigung des Ab- nert 13 Jahren stufenweise von rund 25
hen 1950er-Jahren erstmals den Zulauf wassers in Kläranlagen gesetzlich regelte, Tonnen auf noch rund 3 Tonnen reduziert
aus den übrigen Quellen. Ungefähr zur 1986 ein Verbot für Waschmittelphosphate und seit 1989 nochmals auf die gegen-
gleichen Zeit kamen neue Waschmittel in Kraft setzte und bei Abwasserreini- wärtige Menge von 2 Tonnen gesenkt.
auf, die bis zu 40 Prozent aus Phosphaten gungsanlagen (ARA) im Einzugsgebiet
bestanden. Pro Einwohner gelangte da- der Seen schliesslich eine zusätzliche Effiziente Phosphatfällung
mit jährlich fast ein Kilo gelöster Phosphor Reinigungsstufe zur Entfernung des Phos- in den ARA
in den See, wovon rund 60 Prozent aus phors verlangte. Im Brienzersee wirkten
Wasch- und Reinigungsmitteln stammten. sich die Massnahmen zur Verbesserung Seit einigen Jahren bemisst sich die Höhe
Eintrag von biologisch verfügbarem Phosphat in den Brienzersee
40
ARA Brienz
ARA Meiringen
Tonnen Phosphor pro Jahr
ARA Grindelwald
30
Phosphat-Verbot
ARA Lauterbrunnen
20
Optimierung
Phosphatfällung ARA
10
0
1935 1945 1955 1965 1975 1985 1995 2005
Natürlich und diffus anthropogen ARA-Abläufe, Kanalisation
Der Phosphateintrag in den See aus natürlichen und diffusen Quellen ist seit Jahrzehnten ziemlich konstant. Die Entwicklung der
Nährstoffzufuhr widerspiegelt deshalb in erster Linie die Fortschritte bei der Abwasserentsorgung im Einzugsgebiet. Seit dem Bau
der ersten Kläranlage im Jahr 1975 gelangt immer weniger Phosphat in den Brienzersee. Nicht zufällig gleicht die Kurve der
Entwicklung der Felchenerträge auf Seite 7.
15Mündung des Giessbachs in den Brien- Ein Grossteil des Phosphats aus dem Abwasser, das bis 1975 ungeklärt in den See ge-
zersee: Das saubere Bachwasser enthält langte, wird heute in den Kläranlagen – wie hier in der ARA Brienz – ausgefällt. Der
kaum Nährstoffe. Nährstoffrückgang schmälert die Produktivität des Sees.
der vom Kanton Bern erhobenen Abwas- fügbarem Phosphat in den Brienzersee schliesslich auf grosse Frachten an mine-
serabgabe nach der Reinigungsleistung spielen die Stauseen der KWO jedoch ralischen Schwebstoffen zurückzuführen,
der jeweiligen ARA. Als Massstab dient eine untergeordnete Rolle. Sie halten die mit den Zuflüssen aus dem verglet-
dabei die Konzentration an Nährstoffen pro Jahr etwa 2 Tonnen entsprechendes scherten Einzugsgebiet in den See gelan-
im Auslauf der Kläranlage, wobei für je- Phosphat zurück, das die Algen theore- gen. Durch die angeschwemmten Trüb-
des nicht zurückgehaltene Kilo Phosphor tisch verwerten könnten, wenn es ohne stoffe verfügen die Algen in den für sie
30 Franken zu bezahlen sind. Diese Len- Rückhalt über die Aare abfliessen würde. produktiven Sommermonaten nur in der
kungsabgabe hat die Betreiber der Klär- Wenn die KWO in den Wintermonaten das obersten Wasserschicht über genügend
anlagen – wie erwünscht – zur Optimie- im Sommer gespeicherte Wasser turbinie- Licht. Weil das pflanzliche Plankton von
rung der Phosphatfällung bewogen. Auf ren, gelangen Trübstoffe und damit auch der Sonneneinstrahlung abhängt, kann es
ein Jahr umgerechnet leben in der Region Phosphat in den Brienzersee. Die Algen nur bis in eine Tiefe von 10 Metern wach-
etwa 36‘000 Einwohner und Feriengäste, können diesen Nährstoff dann aber nur sen, was die Produktion der Biomasse
die rund 9 Tonnen an gelöstem Phosphat teilweise verwerten, der Rest ist für die im Vergleich zu anderen nährstoffarmen
die Toilette runterspülen. Davon halten die Primärproduktion verloren. Unter natür- Seen noch weiter begrenzt.
ARA im Einzugsgebiet des Brienzersees lichen Bedingungen würde dem pflanz-
heute etwa 90 Prozent zurück. lichen Plankton im Sommer somit etwas
Der Nährstoffrückgang im Brienzersee ist mehr Phosphat zur Verfügung stehen.
also nicht ein ungewollter Vorgang, son- Es handelt sich bei den winterlichen Ver-
dern entspricht in seiner Entwicklung den lusten jedoch um maximal 5 Prozent der
Anforderungen des eidgenössischen Ge- gesamten Nährstoffmenge. Für die Jah-
wässerschutzgesetzes. Als von Natur aus resproduktion im See ist diese saisonale
sehr nährstoffarmes Gewässer war der Umlagerung des Phosphateintrags folg-
See vor 1950 nie ein produktiver Lebens- lich nicht bedeutend.
raum für Fische. Die heutige Nährstoffver-
sorgung entspricht deshalb annähernd Spärliches Algenwachstum Stickstoffgehalt im Sediment
dem ursprünglichen Naturzustand. In der
produktivsten Phase der 1970er- und frü- Mit einer jährlichen Algenproduktion von
hen 1980er-Jahre gab es dagegen deut- 67 Gramm Kohlenstoff pro Quadratmeter 2000
lich höhere Felchenerträge, weil mehr un- gedeiht im Brienzersee deutlich weniger
geklärtes Abwasser in den Brienzersee pflanzliches Plankton als in anderen nähr- 1990
gelangte. stoffarmen Seen der Schweiz, wie etwa 1980
im Thuner-, Walen- oder Vierwaldstätter-
Jahr
Phosphorrückhalt in den Stauseen see. Bezogen auf die Fläche produziert 1970
letzterer 160 Gramm Kohlenstoff je m2, 1960
Das im Sommer anfallende Gletscherwas- also mehr als das Doppelte. Für ein Ge-
ser hat einen hohen Schwebstoffgehalt, wässer mit einem mittleren Phosphatge- 1950
der einige 100 Milligramm je Liter aus- halt unter einem Mikrogramm pro Liter 1940
machen kann. Deshalb ist im Einzugs- liegt der Brienzersee mit seiner geringen
gebiet der Stauanlagen ein grosser An- Biomasse allerdings im üblichen Rahmen. 1930
teil des Phosphors an Partikel gebunden. So findet man etwa in den weitgehend un- 700 900 1300 1500 1100 1700
Weil diese grösstenteils absinken und für berührten Seen der kanadischen Rocky µg Gesamtstickstoff pro Gramm
immer im Sediment der Stauseen verblei- Mountains ähnliche Verhältnisse.
ben, verschwinden auch die angelagerten Ein weiterer Grund für das beschränkte Auch der zeitliche Verlauf des Stickstoff-
Nährstoffe. Gemessen am jahrzehntelang Algenwachstum ist – neben den sehr tie- gehalts im Sediment bestätigt den prä-
prägenden Einfluss der Siedlungsentwäs- fen Nährstoffkonzentrationen – auch die genden Einfluss der Kläranlagen auf den
serung auf den Zulauf von biologisch ver- Lichtabschwächung. Diese ist fast aus- Nährstoffeintrag in den Brienzersee.
16Sie können auch lesen