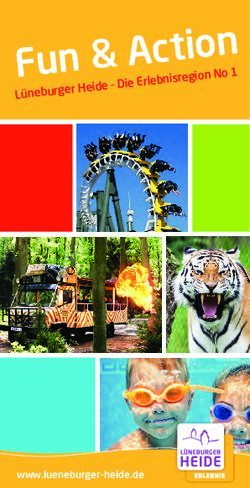Das Konzept der Bedürfnispyramide nach Abraham Maslow1 - Pfade des Glücks eV
←
→
Transkription von Seiteninhalten
Wenn Ihr Browser die Seite nicht korrekt rendert, bitte, lesen Sie den Inhalt der Seite unten
Das Konzept der Bedürfnispyramide nach Abraham Maslow1
Abraham Maslow (1908 - 1970) wies das Menschenbild der Ethologie (Vergleichende
Verhaltenswissenschaft) und der Psychoanalyse zurück, denn das Verhalten von Tieren und das
Verhalten von neurotischen Menschen sollte seiner Meinung nach nicht als zentraler
Ausgangspunkt zur Erklärung menschlichen Verhaltens verwendet werden. Er war Vertreter und
Mitbegründer der "Humanistischen Psychologie". Die humanistische Psychologie grenzt sich
sowohl vom Behaviorismus als auch von der Psychoanalyse ab und bezeichnet sich so als "dritte
Kraft" der Psychologie. Dazu gehören: Abraham Maslow, Charlotte Bühler, Carl Rogers, Fritz
Perls, Sidney M. Jourard, Rollo May, Fred Massarik u.a. Man wollte eine Psychologie entwickeln,
die das aktive Streben des Menschen nach einem erfüllten Leben, nach Anerkennung und
Selbstverwirklichung in den Mittelpunkt stellte. 1961 wurde unter dem Vorsitz von Abraham
Maslow die "American Association of Humanistic Psychology" gegründet, die folgende Thesen
vertritt: Im Zentrum der Aufmerksamkeit steht die erlebende Person (nach theoretischen
Erklärungen und sichtbarem Verhalten). Der Akzent liegt auf spezifisch menschlichen
Eigenschaften wie der Fähigkeit zu wählen, der Kreativi tät, Wertschätzung und
Selbstverwirklichung. Die Auswahl der Fragestellung und Forschungsmethoden erfolgt nach
Sinnhaftigkeit (weniger nach Objektivität). Ein zentrales Anliegen ist die Aufrechterhaltung von
Wert und Würde des Menschen, und das Interesse gilt der Entwicklung der jedem Menschen
innewohnenden Kräfte und Fähigkeiten. Die Wurzeln der Humanistischen Psychologie lassen sich
unschwer auf die europäischen Traditionen der Phänomenologischen Psychologie, der
Psychologischen Anthropologie und auf die Leipziger Ganzheitspsychologie zurückführen.
Größere Ähnlichkeiten finden sich in der Reformpädagogik (Georg Kerschensteiner, Peter
Petersen, Maria Montessori) und zur geisteswissenschaftlichen Psychologie, da bei diesen
Richtungen die starke Betonung der Eigengesetzlichkeit menschlichen Denkens und Handelns und
die Annahme dynamischer Kräfte im Menschen im Mittelpunkt stehen. Auch in ihrem Methoden
greifen die humanistischen Psychologen auf altere Ansätze zurück, wie z.B. die
phänomenologischen Methoden wie sie von Edmund Husserl, Theodor Lipps und Ludwig Klages
benutzt wurden. Der Psychologie soll allem Seelischen ohne voreilige Deutung, Wertung oder
Kritik mit derselben Aufmerksamkeit begegnen. Auf Grundlage der Humanistischen Psychologie
sind mehrere Therapie- und Beratungsformen entwickelt worden. Maslow ging davon aus, daß der
Mensch von Natur aus gut ist und sich selbst entfaltet. "Destruktivität, Sadismus, Grausamkeit sind
nicht inhärent (also sie sind keine ureigenen menschlichen Bedürfnisse wie etwa bei Freud),
sondern wesentliche Reaktionen auf Frustrationen unserer inhärenten Bedürfnisse" (Maslow, 1973,
S. 21). Der Mensch wird in seinem Verhalten von hierarchisch strukturierten Bedürfnissen geleitet.
Diese lassen sich als Pyramide darstellen, an deren Basis sich die grundlegenden körperlichen
Bedürfnisse befinden, während an der Spitze das Bedürfnis nach Selbstverwirklichung steht, das
1
http://arbeitsblaetter.stangl-taller.at/MOTIVATION/Beduerfnis-Pyramide-Maslow.shtmlaber erst dann verwirklicht werden kann, wenn alle grundlegenderen Bedürfnisse befriedigt worden sind. Die Selbstverwirklichung, wie sie Maslow versteht, könnte mit einem mystischen Gipfelerlebnis verglichen werden: der Mensch übersteigt seine eigenen Grenzen, wird eins mit der Menschheit und dem Kosmos. In Maslows Sicht hat er damit den Kern der Existenz überhaupt erreicht. Diese Selbstverwirklichung basiert auf einem persönlichen Wachstum durch die Erfüllung eines Lebensauftrags, der in der Entfaltung der eigenen Kreativität liegen kann wie im selbstlosen Einsatz für eine gerechte Sache. "Bedürfnispyramide von Maslow" Physiologische Bedürfnisse: Die wichtigsten sind Hunger, Durst und Sexualität. Wenn diese konstant befriedigt werden verlieren sie an Bedeutung. Sicherheitsbedürfnisse: Bedürfnis nach Sicherheit, Stabilität, Ordnung, Schutz, Freiheit von Angst und Chaos, Struktur, Ordnung, Gesetz. Wenn die physiologischen Bedürfnisse befriedigt sind, die Sicherheitsbedürfnisse aber nicht, bestimmen diese weitgehend unser Verhalten. Menschen wünschen sich eine vorhersagbare Welt, Inkonsistenz und Ungerechtigkeit verunsichern sie. Zugehörigkeits- und Liebesbedürfnisse: Ergebnisse soziologischer Studien bestätigen die negativen Auswirkungen von Entwurzelung aus Bezugsgruppen (Wegzug der Familie in einen anderen Ort; Auflösung der Familie z.B. durch Scheidung; Emigration, Aussiedler) Wertschätzungs- und Geltungsbedürfnis: Das Bedürfnis umfaßt zum einen den Wunsch nach Stärke, Leistung und Kompetenz, zum anderen das Bedürfnis nach Prestige, Status, Ruhm und Macht. Darauf gründet sich das Selbstwertgefühl eines Menschen. Bedürfnis nach Selbstverwirklichung (Wachstumsbedürfnis, Selbstaktualisierung): Damit spricht Maslow das Streben nach der Entwicklung der eigenen Persönlichkeit an. Die Effekte dieses Strebens sind von Person zu Person sehr unterschiedlich. Es zeigt sich darin eine "Vorwärtstendenz" im menschlichen Wesen. Der Mensch drängt danach, die Einheit seiner Persönlichkeit zu erleben, er ist auf der Suche nach Wahrheit. Er drängt nach "vollem Sein": Heiterkeit, Freundlichkeit, Mut, Ehrlichkeit, Liebe, Güte ... Die ersten vier Bedürfnisse nennt Maslow auch "Defizitbedürfnisse", da ungünstige Folgen zu erwarten bei Nichtbefriedigung sind (z.B. Krankheit) und ein Gefühl der Entbehrung hervorrufen. Bedürfnisse stehen untereinander in folgender Beziehung: Wenn ein Bedürfnis erfüllt ist, tritt das nächsthöhere an seine Stelle. Je höher das Bedürfnis, desto später in der Entwicklung einer Person entsteht es, sodaß man bei Erwachsen in der Regel komplexere Bedürfnisstrukturen feststellen kann. Je höher das Bedürfnis, desto weniger wichtig ist es für das reine Überleben, denn es kann leichter aufgeschoben werden, sie werden als weniger drängend erlebt und können auch ganz verschwinden. Ein Individuum, dessen Verhalten durch höhere Bedürfnisse bestimmt ist (das setzt voraus, daß alle grundlegenderen Bedürfnisse befriedigt sind), ist seltener krank, schläft besser und lebt länger. Befriedigung höherer Bedürfnisse führt weg von psychopathologischen Erscheinungen (psychischen Krankheiten) und ist damit ein wichtiger Schutzfaktor für Gesundheit. Höhere Bedürfnisse werden sozial höher
bewertet. Das Befolgen und die Befriedigung höherer Bedürfnisse haben positive soziale
Konsequenzen (Loyalität, Freundlichkeit...).
Die Pyramide der Bedürfnisse – Entsprechend der 7 Chakren2
2
https://www.google.de/search?
q=Chakra+Pyramide&client=opera&hs=G9m&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwiRlJ-
1wObXAhUBJFAKHUe8CcAQ_AUICigB&biw=1366&bih=658#imgrc=-HAtu9DkJQEhLM:Stufenmodell der psychosozialen Entwicklung3
Die acht Stadien
Jede der acht Stufen stellt eine Krise dar, mit der das Individuum sich aktiv auseinandersetzt. Die
Stufenfolge ist für Erikson unumkehrbar. Die erfolgreiche Bewältigung einer Entwicklungsstufe
liegt in der Klärung des Konflikts auf dem positiv ausgeprägten Pol. Sie ist für die Bewältigung der
nächsten Phase zwar nicht unbedingt erforderlich, aber hilfreich. Die vorangegangenen Phasen
bilden somit das Fundament für die kommenden Phasen, und angesammelte Erfahrungen werden
verwendet, um die Krisen der höheren Lebensalter zu verarbeiten. Dabei wird ein Konflikt nie
vollständig gelöst, sondern bleibt ein Leben lang aktuell, war aber auch schon vor dem jeweiligen
Stadium als Problematik vorhanden. Für die Entwicklung ist es notwendig, dass er auf einer
bestimmten Stufe ausreichend bearbeitet wird, damit man die nächste Stufe erfolgreich bewältigen
kann.
Stadium 1: Ur-Vertrauen vs. Ur-Misstrauen (1. Lebensjahr)
„Ich bin, was man mir gibt.“
Das Gefühl des Ur-Vertrauens bezeichnet Erikson (1973) als ein „Gefühl des Sich-Verlassen-
Dürfens“ (ebenda: 62). Hierzu ist das Kind auf die Verlässlichkeit der Bezugspersonen
angewiesen. Die Bindung zu der Mutter und die damit verbundene Nahrungsaufnahme spielt eine
bedeutende Rolle, da die erste Bezugsperson die Welt repräsentiert. Werden dem Kind
Forderungen nach körperlicher Nähe, Sicherheit, Geborgenheit, Nahrung etc. verweigert,
entwickelt es Bedrohungsgefühle und Ängste, da eine weitgehende Erfüllung dieser Bedürfnisse
lebenswichtig ist. Außerdem verinnerlicht es das Gefühl, seine Umwelt nicht beeinflussen zu
können und ihr hilflos ausgeliefert zu sein. Hier entsteht die Gefahr der Etablierung eines Ur-
Misstrauens. Es können infantile Ängste des „Leergelassenseins“ und „Verlassenwerdens“
entstehen (ebd.). Fixierung durch zu starke orale Frustration zeigt sich in oralen Charakterzügen
wie Reizhunger, Gier, Leere-Gefühle, Depression, Ur-Misstrauen, starken
Abhängigkeitswünschen.
Stadium 2: Autonomie vs. Scham und Zweifel (2. bis 3. Lebensjahr)
„Ich bin, was ich will.“
Erikson bezeichnet dieses Stadium als „entscheidend für das Verhältnis zwischen Liebe und Hass,
Bereitwilligkeit und Trotz, freier Selbstäußerung und Gedrücktheit“. Beschrieben werden die
zunehmende Autonomieentwicklung des Kindes und ihre Bedeutung für die Manifestierung eines
positiven Selbstkonzeptes bzw. einer Identität. Die Bedingung für Autonomie wurzelt in einem
festen Vertrauen in die Bezugspersonen und sich selbst, setzt also die Bewältigung der Phase
„Vertrauen versus Misstrauen“ (vgl. Stadium 1) voraus. Das Kind muss das Gefühl haben,
3
http://arbeitsblaetter.stangl-taller.at/PSYCHOLOGIEENTWICKLUNG/EntwicklungErikson.shtmlexplorieren oder seinen Willen durchsetzen zu dürfen, ohne dass dadurch der erworbene „Schatz“ des Vertrauenkönnens und Geborgen-Seins in Gefahr gerät. Hier spielt Erikson zufolge die Emotion Scham eine wichtige Rolle. Die weitgehende oder permanente Einschränkung der explorativen Verhaltensweisen des Kindes führt dazu, dass es seine Bedürfnisse und Wünsche als schmutzig und nicht akzeptabel wahrnimmt. Was sich somit beim Kind etabliert, ist schließlich Scham und der Zweifel an der Richtigkeit der eigenen Wünsche und Bedürfnisse. Fixierungen ergeben sich durch strenge Erziehung und zeigen sich in zwanghaften Charakterzügen: kleinlich oder geizig in Bezug auf Liebe, Zeit und Geld; Betonung von Recht und Ordnung, Pünktlichkeit und Fleiß; perfektionistische Ansprüche; frühreifes strenges Gewissen, sehr selbstkritisch; Unsicherheit und Zweifel an sich selbst; Putzzwang oder Waschzwang. Stadium 3: Initiative vs. Schuldgefühl (4. bis 6. Lebensjahr) „Ich bin, was ich mir vorstellen kann zu werden.“ Findet das Kind mit vier oder fünf Jahren zu einer bleibenden Lösung seiner Autonomieprobleme, steht es Erikson zufolge bereits vor der nächsten Krise. Er legt hier seinen Fokus stark auf die Bewältigung oder Nichtbewältigung des „Ödipuskomplexes“. Die symbiotische Beziehung zwischen Mutter und Kind öffnet sich, und das Kind erkennt die Bedeutung anderer Personen im Leben der Mutter. Weiter geht es in erster Linie um eine gesunde Meisterung der kindlichen Moralentwicklung. Die Grundlage für die Entwicklung des Gewissens ist gelegt, das Kind fühlt sich unabhängig vom Entdecktwerden seiner „Missetaten“ beschämt und unwohl. „Aber vom Standpunkt der seelischen Gesundheit müssen wir darauf hinweisen, dass diese große Errungenschaft nicht von übereifrigen Erwachsenen überlastet werden darf; dies könnte sich sowohl für den Geist als auch für die Moral selbst übel auswirken. Denn das Gewissen des Kindes kann primitiv, grausam und starr werden, wie sich gerade am Beispiel von Kindern beobachten lässt, die sich mit einer Abschnürung ihrer Triebe durch Verbote abfinden mussten. Gegebenenfalls verinnerlicht das Kind die Überzeugung, dass es selbst und seine Bedürfnisse dem Wesen nach schlecht seien.“ Im Gegenzug dazu beschreibt Erikson das Kind, welches diese Krise bewältigen kann, als begleitet vom Gefühl „ungebrochener Initiative als Grundlage eines hochgespannten und doch realistischen Strebens nach Leistung und Unabhängigkeit“(ebenda: 87f). Fixierungen können durch Angst und Schuldgefühle entstehen, die dann zu einer Selbsteinschränkung führen, gemäß den eigenen Fähigkeiten, Gefühlen, Wünschen zu leben. Es kann auch zu einer Überkompensation kommen, ständig initiativ sein zu müssen, als bestünde ihr Wert nur in der eigenen Leistung. Schuldkomplexe, Übergewissenhaftigkeit sowie hysterische Symptome können hier ebenso entstehen.
Stadium 4: Werksinn vs. Minderwertigkeitsgefühl (6. Lebensjahr bis Pubertät) „Ich bin, was ich lerne.“ Kinder in diesem Alter wollen zuschauen, mitmachen, beobachten und teilnehmen; wollen, dass man ihnen zeigt, wie sie sich mit etwas beschäftigen und mit anderen zusammenarbeiten können. Das Bedürfnis des Kindes, etwas Nützliches und Gutes zu machen, bezeichnet Erikson als Werksinn bzw. Kompetenz. Kinder wollen nicht mehr „so tun, als ob“ – jetzt spielt das Gefühl, an der Welt der Erwachsenen teilnehmen zu können, eine große Rolle. Sie wollen etwas herstellen (z. B. mit Knetmasse) und dafür Anerkennung erhalten, ebenso für ihre geleisteten kognitiven Fähigkeiten. Demgegenüber steht in dieser Phase die Entwicklung eines Gefühls der Unzulänglichkeit und Minderwertigkeit. Dieses Gefühl kann sich immer dann etablieren, wenn der Werksinn des Kindes überstrapaziert wird. Überschätzung – ob vom Kind oder von seiner Umwelt ausgehend – führt zum Scheitern, Unterschätzung zum Minderwertigkeitsgefühl. Auf beiden Seiten (Werksinn und Minderwertigkeit) können Fixierungen entstehen: Überkompensation durch Arbeit und Leistung, Anerkennung vor allem über Leistung zu holen, Arbeits- und Pflichtversessenheit, Angst vor dem Arbeiten und Leisten, Angst vor Versagen. Stadium 5: Ich-Identität vs. Ich-Identitätsdiffusion (Jugendalter) „Ich bin, was ich bin.“ Identität bedeutet, dass man weiß, wer man ist und wie man in diese Gesellschaft passt. Aufgabe des Jugendlichen ist es, all sein Wissen über sich und die Welt zusammenzufügen und ein Selbstbild zu formen, das für ihn und die Gemeinschaft gut ist. Seine soziale Rolle gilt es zu finden. Ist eine Rolle zu strikt, die Identität damit zu stark, kann das zu Intoleranzgegenüber Menschen mit anderen Gruppenneigungen führen, die dann im Grunde „eliminiert“ werden müssen, weil der Druck der eigenen Peer-Group zu groß wird und „den anderen [Fremden]“ nicht akzeptieren kann. Mit einer noch nicht gefestigten eigenen Identität kann der Jugendliche sich im seltensten Fall von der Meinung seiner Peer-Group absetzen und seine eigene Meinung bilden. Schafft der Jugendliche es nicht, seine Rolle in der Gesellschaft und seine Identität zu finden, führt das nach Erikson zu Zurückweisung. Menschen mit dieser Neigung ziehen sich von der Gesellschaft zurück und schließen sich unter Umständen Gruppen an, die ihnen eine gemeinsame Identität anbieten. Wird dieser Konflikt erfolgreich ausbalanciert, so mündet das in die Fähigkeit der Treue. Obwohl die Gesellschaft nicht perfekt ist, kann man in ihr leben und seinen Beitrag leisten, sie zu verbessern. (Das Gleiche gilt für zwischenmenschliche Beziehungen.) Fixierungen zeigen sich in unbefriedigender Identität durch Unruhe, ewige Pubertät und vorschnelle Begeisterung.
Stadium 6: Intimität und Solidarität vs. Isolation (frühes Erwachsenenalter) „Wir sind, was wir lieben.“ Aufgabe dieser Entwicklungsstufe ist es, ein gewisses Maß an Intimität zu erreichen, anstatt isoliert zu bleiben. Die Identitäten sind gefestigt, und es stehen einander zwei unabhängige Egos gegenüber. Es gibt viele Dinge im modernen Leben, die dem Aufbau von Intimität entgegenstehen (z. B. Betonung der Karriere, großstädtisches Leben, die zunehmende Mobilität). Wird zu wenig Wert auf den Aufbau intimer Beziehungen (was auch Freunde etc. mit einbezieht) gelegt, kann das nach Erikson zur Exklusivität führen, was heißt, sich von Freundschaften, Liebe und Gemeinschaften zu isolieren. Wird diese Stufe erfolgreich gemeistert, ist der junge Erwachsene fähig zur Liebe. Damit meint Erikson die Fähigkeit, Unterschiede und Widersprüche in den Hintergrund treten zu lassen. Fixierungen können sich zeigen in: Selbst-Bezogenheit und sozialer Isolation; Selbstaufopferung und Verschmelzung mit anderen. Stadium 7: Generativität vs. Stagnation und Selbstabsorption (Erwachsenenalter) „Ich bin, was ich bereit bin zu geben.“ Generativität bedeutet die Liebe in die Zukunft zu tragen, sich um zukünftige Generationen zu kümmern, eigene Kinder großzuziehen. Erikson zählt dazu nicht nur eigene Kinder zu zeugen und für sie zu sorgen, er zählt dazu auch das Unterrichten, die Künste und Wissenschaften und soziales Engagement. Also alles, was für zukünftige Generationen „brauchbar“ sein könnte. Stagnation ist das Gegenteil von Generativität: sich um sich selbst kümmern und um niemanden sonst. Zu viel Generativität heißt, dass man sich selbst vernachlässigt zum Wohle anderer. Stagnation führt dazu, dass andere uns ablehnen und wir andere. Niemand ist so wichtig wie wir selbst. Wird die Phase erfolgreich abgeschlossen, hat man die Fähigkeit zur Fürsorge erlangt, ohne sich selbst dabei aus den Augen zu verlieren. Fixierungen können sich zeigen: in einer übermäßigen Bemutterung, in Leere und Langweile oder in zwischenmenschlicher Verarmung. Stadium 8: Ich-Integrität vs. Verzweiflung (reifes Erwachsenenalter) „Ich bin, was ich mir angeeignet habe.“ Der letzte Lebensabschnitt stellt den Menschen vor die Aufgabe, auf sein Leben zurückzublicken. Anzunehmen, was er getan hat und geworden ist, und den Tod als sein Ende nicht zu fürchten. Das Gefühl noch einmal leben zu müssen, vielleicht um es dann besser zu machen, Angst vor dem Tod, führt zur Verzweiflung. Setzt sich der Mensch in dieser Phase nicht mit Alter und Tod auseinander (und spürt nicht die Verzweiflung dabei), kann das zur Anmaßung und Verachtung dem Leben gegenüber führen (dem eigenen und dem aller). Wird diese Phase jedoch erfolgreich gemeistert, erlangt der Mensch das, was Erikson Weisheit nennt – dem Tod ohne Furcht entgegensehen, sein Leben annehmen und trotzdem die Fehler und das Glück darin sehen können. Fixierung zeigt sich in Abscheu vor sich und anderen Menschen, unbewusste Todesfurcht.
Das Entwicklungsstufenmodell nach Piaget 4
Jean Piaget (1896 - 1980) entwickelte die Theorie des "genetischen Lernens" (auch
"struktur-genetische" Theorie), die sich mit der Erklärung der kognitiven Entwicklung von
Kindern beschäftigt. Im Mittelpunkt steht dabei die Interaktion eines Kindes mit seiner
Umwelt. Piaget wird als "Übervater der Entwicklungspsychologie" bezeichnet
(vgl. Spektrum der Wissenschaft , 2002).
Seine Erkenntnisse beruhen auf den Beobachtungen seiner eignen Kinder, die altersabhängig
bestimmte (Denk-) Fehler begingen. Mit dieser Vorgehensweise unterschied sich Piaget
deutlich von experimentell arbeitenden Psychologen, die komplizierte Versuchsanordnungen
in eigens eingerichteten Versuchslaboren für die Forschung nutzen (und nutzen).
Piaget untersuchte den Aufbau der kindlichen Logik anhand seiner empirischen
Beobachtungen natürlicher Verhaltensabläufe und entwickelte daraus eine
erkenntnistheoretische Begründung: Er stellte den Zusammenhang zwischen dem kindlichen
Denken und der Entwicklungsphase her. Kurzum: er widmete sich der Beobachtung der
kindlichen Entwicklung des Denkens.
Auf seinen Beobachtungen baute Piaget sein Modell der vier Entwicklungsstufen auf, nach
denen jeder Mensch im Rahmen seiner Entwicklung diese Phasen oder Stadien der
kognitiven Entwicklung durchläuft. Nach Piaget sind die Phasen universell, d.h. sie kommen
in allen Kulturen vor.
Jede dieser Stufen/Phasen ist durch spezifische Merkmale charakterisiert. Besonders
relevant ist, dass sich das kindliche Denken in jeder (Entwicklungs-) Stufe vom Denken
eines Erwachsenen unterscheidet. Ist etwas für einen Erwachsenen einleuchtend und logisch,
so muss dies noch längst nicht für ein Kind ebenfalls einleuchtend und logisch erscheinen.
Wichtig ist, dass die Stufen grundsätzlich aufeinander aufbauen, das jeder Stufe zugeordnete
Lebensalter ist jedoch nur als Anhaltspunkt zu betrachten: Die Übergänge zwischen der
einzelnen Stufen sind fließend und das jeweilige Lebensalter kann individuell abweichen
(vgl. Piaget & Inhelder , 1972, S. 153)
4
http://www.lern-psychologie.de/kognitiv/piaget.htmDie Entwicklungsstufen nach
Piaget:
(je nach Autor gibt es leichte Unterschiedene in den Namen der Phasen/Stufen )
Bevor diese vier Stufen ausführlich erläutert werden, sehen wir uns einige
Grundannahmen des Modell von Jean Piaget an; diese Grundannahmen dienen als
Grundlage für die vier Stufen der kindlichen Entwicklung des Denkens.
Bei der Entwicklung haben nach Piaget (vgl. Mietzel, 2001, 75) vier Faktoren einen Einfluss
auf die kognitive Entwicklung:
- Reifung,
- Aktive Erfahrung,
- Soziale Interaktion,
- Streben nach Gleichgewicht.
Nach Jean Piaget strebt ein Individuum nach einem Gleichgewicht (Äquilibrium)
zwischen Assimilation und Akkommodation.
Durch das Assimilieren und Akkommodieren nutzt ein Individuum seine
Schemata oder erweitert diese.
Falls dieser Satz nicht ganz verständlich wurde - hier kommt die Erklärung:
Adaption (Anpassung nach die Umwelt)
Schema
Ein Schema bildet den Grundbaustein des menschlichen Wissens. Unter Schema versteht
man ein organisiertes Wissens- oder Verhaltensmuster.
Begriffe werden so verzweigt und miteinander vernetzt, dass sie in einen (individuell)
logischen Zusammenhang gebracht werden. Ein Schema dient als 'Geistesvorlage'
(Schablone), beispielsweise für eine Handlung, mit der man - ohne zu nachzudenken - auf
dieselbe Art handeln kann.
Schemata sind individuelle (d.h. in jedem Menschen verschiedene) Kategorien oderNetzwerke, in denen nach bestimmten Regeln Objekte oder Ereignisse eingeordnet werden können. Piaget differenziert Schemata nach (a) Verhaltensschemata (auch Handlungsschemata) wie z.B. ein Schema für das Laufen, ein Schema für das Hinlegen, ein Schema für das Bücken usw. und (b) kognitiven Schemata wie z.B. Schemata für Gegenstände, welches anhand deren Eigenschaften aufgebaut ist. Verhaltensschemata und kognitive Schemata Beispiel für ein Schema: sind wiederum miteinander vernetzt, so dass sich Mischungen ergeben, wie die nebenstehende Abbildung eines Schema verdeutlicht. Schemata entwickeln sich durch die Differenzierung des Wissens (Akkommodation, siehe unten). So weiß ein Kind z.B. dass man in Keks wegen der Krümel vorsichtiger beißen muss, als in Brot. Unter Schema kann man sich in diesem Zusammenhang ein verzweigtes System von Karteikarten vorstellen: Sie haben eine Karteikarte für 'Brot' angelegt, welche eine Beschreibung enthält, wie man mit 'Brot' umzugehen hat. Sie bedienen sich also diesem Karteikartensystem, um sich nicht an jede Situation neu gewöhnen zu müssen. Stellen Sie sich bitte einmal vor, wie umständlich es wäre, wenn keiner mit Nahrung umzugehen wüsste: Sie bekommen eine Scheibe Brot und wissen nicht, was Sie damit machen können oder sollen. Also probieren Sie es aus ... können Ihre gewonnene Erkenntnis jedoch nicht abspeichern.
Zitate zu Schemata nach Piaget:
"Er [der Begriff Schema] bezieht sich nicht nur auf organisierte Verhaltensmuster,
sondern auch auf internalisierte Denkmuster." Mönks & Knoers (1996, 151)
"Die Begriffe Schema und Struktur werden zunächst als Abstraktion und als
kategorisierende Zusammenfassung von Handlungsweisen gebraucht." Oerter &
Montada (1998, 548)
„Piaget war davon überzeugt, dass Kinder ihre Schemata durch ihre Interaktion mit der
Umwelt 'konstruieren'." Mietzel (1998 a, 73)
"Ab etwa dem 2. Lebensjahr verfügt das Kind neben sensomotorischen auch über
kognitiv/operationale Schemata. Diese Schemata kann man als die Grundstrukturen des
Denkprozesses bezeichnen." Mönks & Knoers (1996, 151)
"Ein Schema ermöglicht es dem Kind, neue Reaktionen mittels Akkommodation zu
erlernen." Mönks & Knoers (1996, 151)
Bei einem Säugling sind noch wenige solcher Schemata oder "Karteikarten" vorhanden, die
sich jedoch mit zunehmenden Alter und mit zunehmender Auseinandersetzung mit der
Umwelt deutlich vermehren. Die entsprechende "Karteikarte" wird geöffnet, wenn ein Reiz
eine Reaktion erfordert - und das Kind 'weiß', wie es zu reagieren hat.
Die Anpassung (Adaption) der vorhandenen Schemata - also der individuellen
Wissensnetzwerke - an eine aktuelle Situation erfolgt
über Assimilation undAkkommodation .
"Piaget betrachtete die kognitive Entwicklung als Ereignis des ständigen Wechselspiels von
Assimilation und Akkommodation. Die Assimilation bewahrt und erweitert das Bestehende
und verbindet so die Gegenwart mit der Vergangenheit, und die Akkommodation entsteht
aus Problemen, die die Umwelt stellt, also aus Informationen, die nicht zu dem passen, was
man weiß und denkt." Krech & Crutchfield (1992, Band 4, S. 41)
"[...] denn assimilieren heißt, das Objekt je nach der eigenen Handlung und dem eigenen
Gesichtspunkt, also in Funktion eines "Schemas" zu modifizieren." Piaget (1975, S. 348)
Akkommodation (Anpassung, Anhäufung, Anreicherung, Umweltanpassung)
Akkommodation bedeutet die Erweiterung bzw. Anpassung eines Schemas (also der
kognitiven Strukturen) an eine wahrgenommene Situation, die mit den vorhandenen
Schemata nicht bewältigt werden kann.
Akkommodation kommt nur zustande, wenn die Assimilation nicht ausreicht um eine
Situation zu bewältigen, d.h. eine Situation oder eine Reizgegebenheit sich nicht in einvorhandenes Schema integrieren lässt. Die vorhandenen Schemata sind unzureichend und müssen erweitert werden. Man passt sich dem Vorgefundenen an, wobei das Schema erweitert und somit ausdifferenziert wird. Akkommodation bedeutet die vorhandenen kognitiven Strukturen so anzupassen, dass sie der Realität (wieder) entsprechen und zukünftig für eine verbesserte (da ausdifferenziertere) Problemlösung dienlich sind. Beispiel Akkommodation: Der Versuch eines Kindes an einem Bauklotz zu saugen, wird durch die Assimilation gestützt, wenn der Bauklotz einem essbaren Gegenstand ähnlich erscheint. Da der Bauklotz jedoch keine Nahrung beinhaltet, genügt die Assimilation nicht zur Bewältigung dieser Situation. Das Kind muss akkommodieren: Das Schema wird erweitert (vielleicht indem die Karteikarte 'Nahrung' erweitert wird um: Nicht blau, nicht aus Holz, ...). Kann eine Situation nicht durch das Ausnutzen der Inhalte bestehender Schemata erfolgreich bewältigt werden [Assimilation], so muss das entsprechende Schema um die neuen Erkenntnisse erweitert werden [Akkommodation]. Zitate zu Akkommodation nach Piaget: Erfolgt eine Anpassung an eine Situation oder einen Gegenstand, nennt Piaget diesen Vorgang Akkommodation des Schemas an den Gegenstand. Vgl. Oerter & Montada (1998, 548) "Die Anpassung an die Wirklichkeit nennt Piaget Akkommodation." Oerter & Montada (1998, 523) "Bei der Akkommodation werden die Schemata selbst verändert, um der Information angemessen zu sein oder um nicht zu anderen Schemata oder der Gesamtstruktur in Widerstand zu stehen." Zimbardo (1992, 66) "Aus pädagogisch-psychologischer Sicht ist von Bedeutung, dass ein Lernender Neues zunächst vor dem Hintergrund des bereits Bekannten interpretiert. ... Es gäbe keinen Anlass, dieses Wissen in Frage zu stellen und zu erweitern, wenn (ihm [Linus, Beispiel. S. 72 ]) keine Gelegenheit gegeben würde, Erfahrungen im Umgang mit Keksen zu sammeln."Mietzel (1998 a, 73)
Bildquelle: Mietzel (1998 a, 72)
In diesem Beispiel versucht Linus zunächst zu assimilieren: Er versucht mit dem Keks so
umzugehen, wie er es mit Brot gewöhnt ist: Eine Scheibe Brot kann man biegen. Nach
einigen fehlgeschlagenen Versuchen akkommodiert er: Ein Keks kann nicht mit Brot
gleichgestellt werden. Es handelt sich zwar bei beiden um etwas Essbares und um eine
Backware, dennoch gibt es Unterschiede. Ein Keks ist etwas anderes, als eine Scheibe Brot -
das vorhandene Schema muss erweitert werden (Akkommodation), da es nicht ausreicht.
"Man findet in der Tat auf allen Stadien der Intelligenzentwicklung die Akkommodation und
die Assimilation, aber sie sind immer besser differenziert und ergänzen sich in ihrem
wachsenden Gleichgewicht immer besser." Piaget (1975, S. 207)
Assimilation : Wahrgenommenes passt in die bereits vorhandenen, kognitiven
Strukturen (Schemata).
Akkommodation : Die kognitiven Strukturen (Schemata) müssen an die neue Situation
angepasst werden, da die vorhandenen Strukturen für die Lösung nicht ausreichen.
Adaption / Äquilibrium (Gleichgewichtsstreben)
Assimilation und Akkommodation sind Formen der Anpassung (Adaption) des Individuums
an seine Umwelt. Lebende Organismen streben nach einem Gleichgewicht (Äquilibrium)
zwischen Assimilation und Akkommodation.Zitate zu Äquilibrium nach Piaget:
"Equilibrium beschreibt auf dem einfachsten Niveau ein Gleichgewicht zwischen
Assimilation und Akkomodation." Lefrancois (1994, 129)
"Die Tendenz zur Adaption kann umschrieben werden als die angeborene Tendenz eines
jeden Organismus, sich an seine Umgebung anzupassen. Diese Adaptionstendenz besteht
aus zwei Komponenten bzw. zwei komplementären Prozessen: Assimilation und
Akkommodation." Mönks & Knoers (1996, 149)
"Äquilibration heißt Findung von Gleichgewicht. Der Impuls zur Differenzierung
bestehender Strukturen, zu ihrer inneren Koordination oder Integration, also zum Aufbau
immer komplexerer Strukturen erfolgt aus der Erfahrung eines "Ungleichgewichtes", das
sind fehlschlagende Assimilationsversuche, Widersprüche zwischen verschienen
Assimilationsversuchen, kognitive Konflikte." Oerter & Montada (1998, 553 f)
Abb. 92
Bildquelle: Mönks & Knoers (1996, 152)Stufen der kognitiven Entwicklung Fassen wir zusammen: Nach Piaget gibt es vier Phasen bzw. Stufen der kindlichen Entwicklung des Denkens (auch: "der kognitiven Entwicklung"). In jeder dieser Stufen wird auf die vorherige Stufe aufgebaut. Piaget war der Überzeugung, dass alle Kinder diese Stufen in derselben Reihenfolge durchlaufen, obwohl das Entwicklungstempo unterschiedlich sein kann. "Es sei hier ein für allemal festgehalten, daß Altersangaben in diesem Buch immer nur ein durchschnittliches und erst noch ungefähres Alter meinen" (1977, Anm. 1, S. 119)." Lück & Miller (1999, 134) Besonders relevant ist die Kenntnis der Stufen z.B. für Erzieher, Lehrer oder Eltern. Die Stufen verdeutlichen beispielsweise die Wichtigkeit während der ersten Schuljahre mit Beispielen und Symbolen zu arbeiten; diese Informationen könnten somit in die Unterrichtsplanung übernommen werden. Es sollte versucht werden, einem Kind Probleme in einem angemessenen Schwierigkeitsniveau entsprechend der jeweiligen Entwicklungsstufe zu präsentieren. Aus den Ansätzen von Jean Piaget ist ein sehr aktives Erziehungskonzept abzuleiten, welches von der Welt des Kindes (und nicht der Welt der Erwachsenen) ausgeht. Übersicht über die vier Stufen der Entwicklung:
Sensomotorische Phase 0 bis 2 Jahre - Säuglingsalter
In den ersten beiden Lebensjahren sammelt ein Kind Erfahrungen
mit seinen Sinnesorganen (senso = sinnlich, die Sinne betreffend) und
mit seinem Bewegungen (Motorik = Bewegungsvorgänge).
Mit jedem Lebensmonat werden die Bewegungen des Kindes besser, da das Kind
verschiedene Möglichkeiten variiert und zunehmend koordiniert.
Während des sensomotorischen Stadiums der kognitiven Entwicklung tritt die
Intelligenz nur in Form von motorischer Aktivität als Reaktion auf sensorische
Reizung auf (vgl. Mönks & Knoers , 1996, 154)
Piaget unterteilte die sensomotorische Stufe in sechs Unterstufen:
0. bis 1. Lebensmonat: Angeborene Reflexmechanismen
Von der Geburt an ist ein Baby mit bestimmten Reflexen (Saug-, Schluck- und
Greifreflex) ausgestattet. Der Organismus zeigt spontane Tätigkeiten.
"Die reproduktive oder funktionelle Assimilation, die diese Übung gewährleistet,
setzt sich andererseits fort in einer verallgemeinernden Assimilation (leeres Saugen
zwischen den Mahlzeiten und Saugen an neuen Gegenständen) und in einer
wiedererkennenden Assimilation (Unterscheidung der Brustwarze von anderen
Gegenständen)." Piaget & Inhelder (1972, 18)
"Üben führt zur Konsolidierung der gegebenen Schemata und zu deren Anpassung an
die jeweiligen Gegebenheiten, also bereits zu ihrer Differenzierung: Das Saugen an
der Mutterbrust ist etwas anderes als das Saugen an der Flasche und am Daumen;
[...]" Oerter & Montada (1998, 520)
1. bis 4. Lebensmonat: Primäre Kreisreaktionen
Auf den eigenen Körper beschränkte Aktivitäten. Handlungen mit angenehmen
Konsequenzen werden wiederholt.
Zufällig berührt die Hand die Lippen. Da diese Aktivität als angenehm empfunden
wird, versucht das Kind die Hand zum Mund zu führen (Daumenlutschen).
"Das Kind baut sich sein Wissen von dieser Welt auf, indem es durch aktives Tun
zunächst Erfahrungen an seinem eigenen Körper, später an Gegebenheiten seiner
Umgebung sammelt. ...
Die einzige Möglichkeit des Denkens besteht darin, etwas mit den vorgefundenen
Dingen zu tun, d.h., sie zu betrachten, zu berühren, in den Mund zu stecken und nach
ihnen zu greifen. Während es in seiner Objektwelt hantiert, empfängt es über seineSinnesorgane Rückmeldungen; es wiederholt diejenigen Aktivitäten, die interessante
Effekte auslösen. Piaget spricht von "Kreisreaktionen"." Mietzel (1998 a, 79)
"Ein Schema ist die Struktur oder Organisation der Aktionen, so wie sie sich bei der
Wiederholung dieser Aktion unter ähnlichen oder analogen Umständen übertragen
oder verallgemeinern." Piaget & Inhelder (1972, S. 19)
"Handlungsschemata, wie Saugen, Greifen, einen Gegenstand anblicken, werden auf
immer mehr Gegenstände und weitere Umweltbereiche angewandt. Dies nennt Piaget
in Anlehnung an biologische Prozesse die generalisierte Assimilation,
"Einverleibung" von Objekten, Personen, Umweltgegebenheiten in die eigenen
"Handlungsorgane oder -schemata"." Oerter & Montada (1998, 520)
"Wir versuchen während des ganzen Lebens, neuartige Probleme an uns bekannte
Schemata und Konzepte zu assimilieren, d.h. mit jenen Konzepten zu lösen, die uns
geläufig sind." Oerter & Montada (1998, 523 f)
4. bis 8. Lebensmonat: Sekundäre Kreisreaktionen
Das Kind entdeckt, dass es durch eigene Aktivitäten bestimmte Effekte in der Umwelt
hervorrufen kann. Handlungen können als Mittel zum Zweck eingesetzt werden. Es
existiert demnach die Möglichkeit einer Differenzierung zwischen dem gewünschten
Ziel / der erwünschten Reaktion und dem angewendeten Mittel zur Erreichung des
Ziels.
In einigen Sequenzen experimentiert das Kind mit dieser Möglichkeit der
Einflussnahme auf die Umwelt:
Zufälliges Schlagen an eine Glocke. Das Geräusch gefällt dem Kind anscheinend, da
es wiederholt gegen die Glocke schlägt, um diese zum Klingeln zu bringen.
Objekte bleiben etwa ab dem achten Lebensmonat auch dann noch erhalten, wenn sie
nicht mehr gesehen werden: Das bisherige "Aus den Augen - aus dem Sinn" wird
durch eine kognitive Existenz (also ein inneres Abbild des nicht mehr sichtbaren
Gegenstandes) abgelöst.
8. bis 12. Lebensmonat: Intentionales Verhalten
(Intention = absichtlich, vorsätzlich, hier: zielgerichtet)
Übertragung bereits bekannter Effekte auf eine Aktivität in neuen Situationen. Durch
das Ausprobieren werden die Handlungsschemata durch Anpassung weiter verfeinert.
Weiterhin werden die vorhandenen Schemata besser koordiniert (der
Bewegungsablauf wird flüssiger).12. bis 18. Lebensmonat: Tertiäre Kreisreaktionen
Das Kind versucht herauszufinden wann und warum bestimmte Ereignisse auftreten.
Es offenbart Interesse an jeder neuen Reizsituation. Auch hier ist es für das Kind
wieder von Bedeutung, wie es selbst auf die Umwelt einwirken kann. Durch
das Experimentieren in der Umwelt werden neue Handlungsschemata angelegt.
Das Kind untersucht verschiedene 'Spritztechniken' beim Baden. Es kann mit der
eigenen Hand oder mit der Spielente auf das Wasser schlagen und das Wasser spritzt
unterschiedlich weit...
"Es [das Kind] probiert systematisch verschiedene Möglichkeiten aus, einen Ball zu
werfen: mit einer Hand, mit beiden Händen, aus geringer Höhe, aus großer Höhe
usw." Oerter & Montada (1998, 521)
18. bis 24. Lebensmonat: Übergang zur voroperationalen Phase
Ergebnisse einer Aktivität können zum Teil vorhergesehen werden. Experimentieren,
wie eine Handlung 'am besten' vollzogen werden kann, wird unnötig, da Handlungen
innerlich vollzogen und vorausgeplant werden können.
Mit knapp zwei Jahren existiert ein 'inneres Abbild' eines Gegenstandes: Das Kind
"kann mit diesem Objekt "im Geiste" umgehen, ohne daß dieses physisch präsent sein
muß." Verinnerlichung von Handlungen charakterisiert den Übergang zum
Denken." Oerter & Montada (1998, 521)
Präoperationale Phase 2 bis 7 Jahre - Kindergarten- und Vorschulalter
Das Denken ist noch voll mit logischen Irrtümern, da das kindliche Denken mehr von
der Wahrnehmung als von der Logik beherrscht wird. So glauben Kinder zu Beginn
der präoperationalen Phase beispielsweise, dass aus einem Junge ein Mädchen
werden kann, wenn er Spielsachen von Mädchen (z.B. Puppen) spielt.
Anthropomorphismus (oder die Tendenz zur Vermenschlichung)
Kinder im Kindergartenalter neigen zur Vermenschlichung von Gegenständen. Tut
sich ein Kind beispielsweise an einem Tisch weh, so ist es der böse Tisch, der
absichtlich im Weg stand bzw. dem Kind absichtlich weh tun wollte.
Magisches Denken
Im Vorschulalter ist das kindliche Denken oft magisch: Gegebenheiten werden dem
Wirken höherer Mächte zugeschrieben. Entgegen naturwissenschaftlichen Erklärungen
erachten die "magisch denkenden" Kinder Phänomene als durch höhere Kräftegesteuert. Dem Kind ist es zunehmend möglich, sich komplette Handlungen auf gedanklicher Ebene vorzustellen, wenn diese Handlungen bereits im "echten Leben" ausgeführt wurden. Kinder machen nach, was sie beobachtet haben: Sie spielen die Rolle ihrer Eltern, fahren Auto oder spielen Situationen und Charaktere nach, die sie im Fernsehen beobachtet haben. In der voroperationalen Phase wird oftmals ein Missverständnis "gelernt", dem die Mengenlehre entgegentritt: Man zeigt einem Kind Äpfel und zeigt nacheinander darauf: "eins", "zwei", "drei". In der fehlerhaften Anpassung übernimmt das Kind den Namen "drei" für den dritten Apfel. Auf die Bitte "Gib mir die drei!", gibt das Kind den dritten Apfel - statt alle drei! In diesem Fall besitzt das Kind keinen Mengenbegriff und überträgt "drei" als den Namen des dritten Apfels. Die "Umschüttaufgabe" (Teil 1) Der bekannteste Versuch von Piaget zu den "logischen Irrtümern" ist sicherlich die Umschüttaufgabe: Kindern wurde ein breites Gefäß mit Flüssigkeit gezeigt und die Flüssigkeit vor den Augen der Kinder in ein dünneres Gefäß umgeschüttet. Zu Beginn der präoperationalen Phase sind Kinder der Meinung, die Flüssigkeitsmenge habe sich verändert. Erst mit mit einem Alter von ca. 7 Jahren (Übergang zur Phase der konkreten Operationen) "wissen" Kinder, dass die Flüssigkeitsmenge sich beim Umschütten nicht verändert. Egozentrismus Ab ca. 4 Jahren (intuitive [anschauliche] Phase) vermindern sich zwar einige "logische Irrtümer", dennoch ist das Denken sehr egoistisch und stark dominiert von der Wahrnehmung. Das Kind denkt egozentrisch: Es hat seine Ansicht und hält seine Ansicht für die einzig mögliche und somit auch für die einzig richtige Ansicht. "Ein egozentrisches Kind ist unfähig, sich die Sichtweise anderer zu eigen zu machen." Lefrancois (1994, 131) "Egozentrismus meint hier nicht Ichbezogenheit, sondern die Schwierigkeit, sich eine Szene aus der Sicht eines anderen vorzustellen." Piaget: "... Das egozentrische Kind - und alle Kinder sind egozentrisch - betrachtet seinen eigenen Blickpunkt als den einzigen möglichen. Es ist unfähig, sich in die Stellung eines anderen zu versetzten,
denn es ist ihm nicht gegenwärtig, dass die andere Person eine Sichtweise hat."
Demnach scheint ein Kind davon auszugehen, dass sämtliche Sozialpartner ebenso
denken und fühlen, wie es selbst.
Mietzel (1998 a, 84 f)
Beispiel:
"- Peter, hast du einen Bruder?
- Ja.
- Wie heißt denn Dein Bruder?
- Hans.
- Hat Hans auch einen Bruder?
- Nein." Mönks & Knoers (1996, 157)
Zentrierung
Piaget spricht von 'Zentrierung', wenn ein Kind bei seinem Urteil nur auf
jeweils ein Merkmal achten kann.
Die Aufmerksamkeit ist auf ein Merkmal oder eine
Sichtweise beschränkt:
In einem Versuch erhielten Kinder Stäbe, die sie
der Größe nach sortieren sollten.
Teilweise wurde das Ziel auch erreicht, wie
nebenstehende Abbildung verdeutlicht:
Ein zwei bis drei Jahre altes Kind hat in der Regel
eine fehlerhafte Sortierung der Stäbe
vorgenommen - der Vergleich zweier Stäbe und
deren Sortierung sind möglich: der oberste Stab ist
größer als der zweitoberste Stab; der zweitunterste
Stab ist größer als der unterste Stab.
Den Kindern fehlte jedoch der Gesamtüberblick,
sie achteten beim Lösen der Aufgabe nur auf ein
Merkmal (Stab 1 ist größer als Stab 2) - aber nicht
auf die Sortierung aller vier Stäbe (1 > 2 > 3 > 4)
"Das Kind versteht etwas von Klassen, da es Objekte identifizieren kann; sein
Verständnis ist jedoch unvollständig, da es noch nicht zwischen scheinbar identischen
Mitgliedern derselben Klasse unterscheiden kann ..." Lefrancois (1994, 132)Phase der konkreten Operationen 7 bis 12 Jahre - Grundschulalter
Ab dem siebten und dem achten Lebensjahr wirkt sich die Wahrnehmung nicht mehr in so
hohem Maße auf die Urteilsbildung aus.
Konkrete Denkoperationen werden möglich: Das Kind kann mehrere Dimensionen einer
Situation beachten: Auch Klassen, Serien und Zahlen stellen kein Problem mehr dar.
Die "Umschüttaufgabe" (Teil 2)
"Während sich das voroperational denkende Kind zumeist noch von seinem
Wahrnehmungseindruck täuschen lässt, kennt es als konkret operationaler Denker die
richtige Antwort. Wenn einer Menge nicht hinzugefügt oder weggenommen wird, so
erklärt es seine Antwort, bleibt sie unverändert (Aspekt der Identität). Auch wenn die
Flüssigkeitssäule in dem einen Glas höher, im zweiten Glas niedriger aussieht,
berücksichtigt das sieben- oder achtjährige Kind sowohl Höhe als auch Breite (Aspekt
der Kompensation)." Mietzel (1998 a, 86)
Schüttet man den Inhalt eines breiten Gefäßes in ein dünneres Gefäß, so scheint sich der
Inhalt vermehr zu haben. Die Phase der konkreten Operationen ist unter anderem
dadurch gekennzeichnet, dass das Kind ein logisches Verständnis für die Invarianz
besitzt: Wenn sich an der Menge nichts ändert (es wird nicht hinzugeschüttet und es geht
nichts verloren), so bleibt die Menge gleich. Das Kind urteilt demnach durch Logik und
nicht durch die Wahrnehmung.
"Das Verständnis der Invarianz zeigt an, daß die Kinder auf dieser Stufe weitere geistige
Operationen ausführen können. Sie können Informationen geistig transformieren und die
Reihenfolge der kognitiven Verarbeitungsschritte sogar umkehren. Sie verlassen sich nun
eher auf Begriffe als auf das, was ihre Wahrnehmung sie sehen oder fühlen läßt."
Die Stufen des Moralbewusstseins5
Kriterien für die Entwicklung
Um von einer Stufe des Moralbewusstseins zu einer anderen zu gelangen, muss ein Mensch auf
drei Bereichen Fortschritte machen:
1. Seine soziale Perspektive muss sich erweitern, weg von einer
rein egozentrischen Perspektive hin zur Realisierung der Ansprüche anderer Menschen in
der Gemeinschaft.
5
https://de.wikipedia.org/wiki/Kohlbergs_Theorie_der_Moralentwicklung2. Seine moralische Selbstbestimmung muss sich verbessern, er muss moralische Normen
hinterfragen und begründen lernen.
3. Die Begründung der Regeln seines Handelns muss sich verbessern. Eine reine
egozentrische Lust/Unlust-Begründung wird schrittweise abstrakter hin zu einer
postkonventionellen Normbegründung.
Drei Ebenen mit je zwei Unterstufen
Kohlberg unterscheidet drei Hauptniveaus des moralischen Urteilens, die jeweils aus zwei
Unterstufen bestehen:
Präkonventionelle Ebene
Diese Ebene entspricht dem Niveau der meisten Kinder bis zum neunten Lebensjahr, einiger
Jugendlicher und vieler jugendlicher und erwachsener Straftäter. Auf dieser Ebene erlebt das Kind
zum ersten Mal, dass es auch andere Sichtweisen neben der eigenen geben kann, die
Autoritätspersonen sind jedoch weiterhin die Vorbilder.
1. Stufe – Die Orientierung an Strafe und Gehorsam:
In der ersten Stufe orientieren sich diese nicht an moralischen Ansprüchen, sondern im
Wesentlichen an wahrgenommenen Machtpotenzialen. Die von Autoritäten gesetzten Regeln
werden befolgt, um Strafe zu vermeiden.
2. Stufe – Die instrumentell-relativistische Orientierung:
In der zweiten Stufe erkennen Kinder die Gegenseitigkeit menschlichen Verhaltens. Rechthandeln
besteht darin, die eigenen Bedürfnisse und gelegentlich die von anderen als Mittel (instrumentell)
zu befriedigen. Menschliche Beziehungen werden vergleichbar mit der Austauschbeziehung des
Marktes verstanden. Sie orientieren ihr Verhalten an dieser Gegenseitigkeit, reagieren also
kooperativ auf kooperatives Verhalten, und üben Rache für ihnen zugefügtes Leid (tit for tat/do ut
des – „ich gebe, damit du gibst“; "Wie du mir so ich dir").
Konventionelle Ebene
Dieser Ebene sind der Großteil der Jugendlichen und Erwachsenen zuzuordnen.
3. Stufe – Die interpersonale Konkordanz- oder „good boy/nice girl“-Orientierung:
Moralische Erwartungen Anderer werden erkannt. Den Erwartungen der Bezugspersonen und
Autoritäten möchte der Proband entsprechen (good boy/nice girl), nicht nur aus Angst vor Strafe.
Wird er den Erwartungen nicht gerecht, empfindet er auch Schuldgefühle. Korrespondierend dazu
richtet er ebenfalls moralische Erwartungen an das Verhalten anderer. Es wird darüber hinaus
häufig aufgrund der zugehörigen Intention argumentiert („Er hat es doch gut gemeint“).4. Stufe – Die Orientierung an Gesetz und Ordnung: Über die dritte Stufe hinaus erkennt der Proband die Bedeutung moralischer Normen für das Funktionieren der Gesellschaft. Auch die nicht von Bezugspersonen an das Kind gerichteten Erwartungen werden erkannt (allgemeine moralische Regeln der Gesellschaft) und befolgt, da sie für das Aufrechterhalten der sozialen Ordnung erforderlich sind (law and order). Zwischen- bzw. Übergangsstufe 4 1/2. Stufe: Bei der Auswertung einer Längsschnittstudie wurde festgestellt, dass High-School-Absolventen wieder moralische Urteile entsprechend der Stufe 2 fällten. Daraufhin wurde die Zwischenstufe nachträglich in die Theorie integriert. In der Übergangszeit zum Erwachsenwerden befinden sich Jugendliche typischerweise in einer Übergangsphase. Um sich vom konventionellen Niveau des Moralbewusstseins zu lösen, ist es wichtig, moralische Normen zu hinterfragen und nicht blind Autoritäten zu folgen. In der Übergangsphase gelingt es dem Menschen noch nicht, die Begründung von Normen auf ein neues, intersubjektives Fundament zu stellen, er ist moralisch orientierungslos. Menschen dieser Stufe verhalten sich nach ihren persönlichen Ansichten und Emotionen. Ihre Moral ist eher willkürlich, Begriffe wie „moralisch richtig“ oder „Pflicht“ halten sie für relativ. Im günstigen Fall gelingt ihnen die Entwicklung zur 5. Stufe des Moralbewusstseins, es kann aber auch sein, dass sie in der Übergangsstufe verbleiben oder zur 4. Stufe zurückfallen. Die Zwischenstufe wird als postkonventionell angesehen, obwohl moralische Urteile auf dieser Stufe noch nicht prinzipiengesteuert sind. Postkonventionelle Ebene Nur eine Minderheit von Erwachsenen erreicht diese Ebene, meistens erst nach dem 20. Lebensjahr. 5. Stufe – Die legalistische Orientierung am Sozialvertrag: Moralische Normen werden jetzt hinterfragt und nur noch als verbindlich angesehen, wenn sie gut begründet sind. In der fünften Stufe orientiert sich der Mensch an der Idee eines Gesellschaftsvertrags. Aus Gedanken der Gerechtigkeit oder der Nützlichkeit für alle werden bestimmte Normen akzeptiert. Nur etwa ein Viertel aller Menschen erreicht diese Stufe. 6. Stufe – Die Orientierung am universalen ethischen Prinzip: Die sechste Stufe wird schließlich nur noch von weniger als 5 % der Menschen erreicht. Hierbei wird die noch diffuse Begründung von Normen der fünften Stufe verlassen. Die Moralbegründung orientiert sich jetzt am Prinzip der zwischenmenschlichen Achtung, dem Vernunftstandpunkt der Moral. Das richtige Handeln wird mit selbstgewählten ethischen
Prinzipien, die sich auf Universalität und Widerspruchslosigkeit berufen, in Einklang gebracht, wobei es sich also nicht mehr um konkrete moralische Regeln, sondern um abstrakte Prinzipien handelt (kategorischer Imperativ). Konflikte sollen argumentativ unter (zumindest gedanklicher) Einbeziehung aller Beteiligten gelöst werden. Diese Stufe ähnelt der Normbegründungsform der Diskursethik. 7. Stufe: Das eigentliche Stufenmodell Kohlbergs geht bis zur 6. Stufe. Kohlberg hat später Vermutungen geäußert, es könne eine 7. Stufe geben, in der moralische Urteile transzendental begründet werden. Systematisch ausgebaut wurde dieser Aspekt von Kohlberg nicht. Nur sehr wenige Menschen schaffen es bis dahin. Das Individuum der Stufe 7 ist erfüllt von universeller Liebe, Mitleid oder Heiligkeit. Kohlberg zitiert nur einige wenige Beispiele: Jesus, Buddha, Gandhi.
Vierphasenmodell der Bindungsentwicklung nach Bowlby 1969:6
1. Vorphase: bis ca. 6 Wochen
2. Personenunterscheidende Phase: 6. Woche bis ca. 6./7. Monat
3. Eigentliche Bindung: 7./8. bis 24. Monat
4. Zielkorrigierte Partnerschaft: ab 2 / 3 Jahren
Das individuelle Bindungsverhalten/der Bindungstyp eines Neugeborenen entsteht durch die Anpassung an
das Verhalten der zur Verfügung stehenden Bindungspersonen. Hierbei bilden die ersten sechs
Lebensmonate die Phase stärkster Prägung. Es kann jedoch von gewisser Plastizität ausgegangen werden:
Bindungsverhalten ändert sich gegebenenfalls bei entsprechenden Erfahrungen im Verlauf
der Kindheit und Jugend. Hierbei haben sich bestimmte, die Bindung betreffende Schutz- und
Risikofaktoren (wie z. B. eine im späteren Leben auftauchende, sichere Bindung oder
aber Psychotraumata) als wichtige Einflüsse erwiesen. Im Erwachsenenalter gilt es als relativ konstant und
bestimmt spätere enge Beziehungen. Die frühe Mutter-Kind-Interaktion zeigt somit die Tendenz
zur Generalisierung. Darüber hinaus belegen Forschungen, dass das Bindungsmuster
einen transgenerativen Aspekt aufweist: Unsicher gebundene Kinder haben, wenn sie Eltern werden,
überdurchschnittlich häufig wieder unsicher gebundene Kinder. Mittels spezifischer Testverfahren kann mit
hoher Wahrscheinlichkeit von Aussagen werdender Mütter über ihr Ungeborenes die spätere Entwicklung
eines bestimmten Bindungstypus des Kindes vorhergesagt werden.
Bindungstypen des Kindes
In einer Fremden Situation aber auch in anderen Untersuchungskonstellationen konnten bestimmte
Bindungstypen klassifiziert werden. Das Bindungsverhalten ist sehr vielfältig und oft individuell
unterschiedlich in der Ausprägung. Heute werden meist vier Bindungsqualitäten bei Kindern genannt:
Bindungstypen Abkürzung Beschreibung Verhalten in der Testsituation
Wenn die Bezugsperson den Raum verlässt,
weinen, schreien die Kinder und wollen
ihrer Bezugsperson folgen. Sie lassen sich
nicht von der Testerin trösten. Bei der
Rückkehr der Bezugsperson suchen sie
Körperkontakt und wollen z.B. auf den Arm
genommen werden. So beruhigen sie sich
Solche Kinder haben eine schnell wieder. Sie nutzen ihre
Sichere emotional offene Strategie und Bezugsperson als sichere Ausgangsbasis,
B-Typ von welcher aus sie den Raum explorieren
Bindung verleihen ihren Gefühlen
Ausdruck. und auch mit der Testerin in Kontakt treten.
Das Hormon Cortisol wird bei Stress
ausgeschüttet. Diese Situation bedeutet
Stress und somit eine Cortisolausschüttung.
Bei Wiederkehr der Bezugsperson nimmt
das Cortisol prompt wieder ab, da die
Stressregulierung über die Nähe zur
Bezugsperson erfolgt.
Unsicher A-Typ Die Kinder zeigen eine Sie wirken bei der Trennung von der
vermeidende Pseudounabhängigkeit von der Bezugsperson unbeeindruckt; sie zeigen
Bindung Bezugsperson. Sie zeigen ihre Emotionen nicht offen, sondern
auffälliges Kontakt- versuchen jeden Ausdruck zu vermeiden.
Vermeidungsverhalten und Bei der Wiederkehr der Bezugsperson
beschäftigen sich primär mit ignorieren die Kinder diese. Häufig wird
6
https://de.wikipedia.org/wiki/BindungstheorieSie können auch lesen