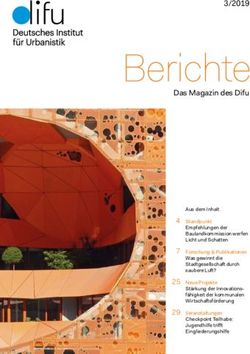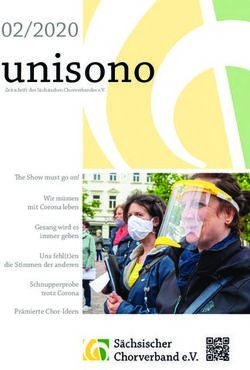Das Magazin des Difu 1/2021 - Deutsches Institut für Urbanistik
←
→
Transkription von Seiteninhalten
Wenn Ihr Browser die Seite nicht korrekt rendert, bitte, lesen Sie den Inhalt der Seite unten
1/2021
Das Magazin des Difu
Aus dem Inhalt
4 Standpunkt
Innenstädte: Mit Steuern
steuern oder mit Steuern
gestalten?
6 Forschung & Publikationen
Kommunale Bodenpolitik
neu aufstellen
24 Neue Projekte
Auszubildende schieben
Klimaschutz in Kommunen
an
31 Veranstaltungen
Kultur in Zeiten der
PandemieEditorial Neue Projekte
24 Klimaaktive Kommunen
Standpunkt
24 Azubis für mehr Klimaschutz
4 Innenstädte: Mit Steuern steuern oder
25 Radverkehr fördern
mit Steuern gestalten?
25 Start-up in Kiel!
Forschung & Publikationen
Veranstaltungen
6 Kommunale Bodenpolitik
26 Veranstaltungsübersicht
nachjustieren und neu aufsetzen
27 Und sie regt sich doch! -
7 Pandemie-Folgen: Kultur, Sport
Kultur in Zeiten der Pandemie
und soziale Angebote werden leiden
28 Was geht? Rausgehen ist das neue
8 Neue Instrumente für die nachhaltige
Ausgehen
Stadtentwicklung
29 Innovative Lösungen für Kommunen
10 Umfrage zu Klimaschutz, erneuerbaren
und Regionen vorgestellt
Energien und Klimaanpassung
30 Kommunale Klimakonferenz 2020 mit
11 Photovoltaik und solare Wärmenetze
vorbildlichen Klimaschutzaktivitäten
für den Klimaschutz in Kommunen
12 Mit flexiblen On-Demand-Angeboten
Nachrichten & Service
ÖPNV-Bedarfsverkehr modernisieren
16 Was ist eigentlich ein
14 Mit intelligenten Stellplatzkonzepten
Bürgerentscheid?
nachhaltige Mobilität voranbringen
17 Veröffentlichungsüberblick
15 „Moderne Stadtgeschichte“ feiert
19 Difu-Service für Zuwender
Jubiläum: 50 Jahre Stadtgeschichte
20 Difu-Informationsangebote/
21 Fachkräftebedarf – Flaschenhals in
Impressum
den Kommunalverwaltungen?
31 Wettbewerb „Klimaaktive Kommune
22 Planung blau-grün-grauer
2021“ gestartet!
Wasserinfrastrukturen in der Stadt
32 Difu-Intern: Abschied und Neubeginn
33 Difu aktiv
34 Neues im Difu-Inter-/Extranet
35 Difu-PresseresonanzEditorial
Liebe Leserin, lieber Leser,
nach wie vor prägt die Pandemie unser Leben. Die Geräusche, Gerüche und Ge-
Foto: Annette Koroll
schwindigkeiten in den Städten verändern sich, Funktionen und Qualitäten der
Städte sind im Pausen-Modus, Kultur, Handel und Gastronomie kämpfen um ihre
Existenz, die Menschen verändern sich.
Die Folgen werden über die Pandemie hinausreichen. So boomt beispielsweise
der Online-Handel, die Transformation der Innenstädte – oder generell der Zentren
– wird an Dynamik gewinnen, die Idee städtischer Treffpunkte, Kommunikations-
räume und „Erlebnisknoten“ gerät in Gefahr.
Prof. Dr. Carsten Kühl thematisiert in seinem Standpunkt in diesem Berichte-Heft
die Frage, ob die derzeit diskutierte Paketsteuer die Lösung sein kann und welche
alternativen und konsequenteren Maßnahmen jetzt notwendig und Erfolg verspre-
chend sind.
Daneben geben wir in diesem Berichte-Heft wie immer einen Einblick in hochaktu-
elle Themen-Klassiker, mit denen sich das Difu beschäftigt und die sich fast immer
um das Bestreben der Kommunen nach einer nachhaltigen und generationen-
gerechten Stadtentwicklung drehen. Dazu gehören die Auseinandersetzung mit
einer am Gemeinwohl orientierten kommunalen Bodenpolitik ebenso wie Hand-
lungsmodelle für die Infrastrukturplanung, im Klimaschutz- und in der Klimaan-
passung oder im Rahmen der Verkehrswende.
Ich wünsche Ihnen eine anregende Lektüre!
Luise Adrian
Kaufmännische Geschäftsführerin
3Standpunkt
Berichte 1/2021
Innenstädte: Mit Steuern steuern oder
mit Steuern gestalten?
Nach der Pandemie wird eine Revitalisierung der Innenstädte nötig sein. Manche
Einzelhändler und Gastronomen werden die Pandemie nicht überstehen. Rettet uns eine
Paketsteuer? Oder sind die Prioritäten der Kommunalhaushalte anzupassen?
Im politischen Berlin wird die Einführung einer Pa- die ihren Verkauf auf Onlinehandel, z.B. in Kombi-
ketsteuer für den Onlinehandel gefordert. Sie soll nation mit stationären Verkaufs- und Showrooms,
zwei Effekte erzielen: erstens die Wettbewerbs- umstellen, um den veränderten Konsumentenprä-
vorteile des Onlinehandels gegenüber dem stati- ferenzen Rechnung zu tragen und um ihre Wett-
onären Einzelhandel durch eine Verteuerung des bewerbsposition zu stärken?
Versandhandels reduzieren und zweitens Steuer-
aufkommen generieren, das für die Revitalisierung Andere argumentieren, der Onlinehandel be-
der Innenstädte nach Corona benötigt wird. schädige das öffentliche Gut „Funktionalität der
Innenstadt“, ohne dass die Nutznießer sich an
Solche „Lenkungssteuern“ sind Verbrauchsteu- dem Schaden beteiligen. Die Begründung ist
ern. Sie belasten Bezieher niedriger Einkommen theoretisch überzeugend, aber daraus abgeleitete
relativ stärker als höherer Einkommen und ihr Maßnahmen sind schwer umsetzbar. Wer legt den
Steueraufkommen lässt sich nur schwer den Maßstab für Beeinträchtigung der Funktionalität
Kommunen zurechnen, in denen Verbraucher mit fest? Und wie viele verschiedene Abgaben müs-
der Paketsteuer belastet werden. Eine Paketsteuer sen erhoben werden, um alle potenziellen Beein-
würde deshalb wie andere indirekte Steuern trächtigungen der Funktionalität der Innenstadt zu
vom Bund erhoben und vereinnahmt. Sie könnte bepreisen? Letztlich muss jede Abgabenerhebung
zweckgebunden eingesetzt werden – auch wenn dem verfassungsrechtlichen Gleichbehandlungs-
das im deutschen Steuersystem bisher (aus guten gebot standhalten.
Gründen: Nonaffektationsprinzip) nicht üblich ist.
Die Steuereinnahmen könnten dann nach einem Im Kern geht es um die Bedrohung des Einzelhan-
Schlüssel auf die Kommunen verteilt werden. dels und der Innenstädte durch den Onlinehandel.
Es geht also um fairen oder unfairen unternehme-
Systematisch betrachtet stellt sich dabei die rischen Wettbewerb und darum, wie die Städte
Frage, ob es ähnlich wie bei Ökosteuern soge- den Folgen eines potenziellen Strukturwandels für
nannte externe Effekte gibt, die mit Onlinehandel ihre Innenstädte begegnen sollten.
verbunden sind und durch die Paketsteuer kom-
pensiert (internalisiert) würden. Bei der Ökosteuer Unfairer Wettbewerb liegt aber nicht per se dann
sollen z.B. Belastungen der Umwelt, die nicht in vor, wenn sich Konsumentenpräferenzen verän-
der unternehmerischen Kosten- und Preiskalkula- dern und Marktanteile verschieben. Im Gegenteil:
tion berücksichtigt werden, „eingepreist“ werden. Das ist wettbewerbspolitisch grundsätzlich er-
wünscht. Es deutet aber vieles darauf hin, dass es
Der Versandhandel unterscheidet sich vom sta- keinen fairen Wettbewerb zwischen dem statio-
tionären Handel im Wesentlichen durch die An- nären Einzelhandel und den großen international
lieferung der Waren, die wiederum überwiegend agierenden Onlineanbietern gibt. Reine Online-
mit CO2-Emissionen verbunden ist. Es ist wenig händler sind per Definition schon nicht stationär
überzeugend, aus diesem Grund eine spezielle und haben deshalb die besten Voraussetzungen,
Paketsteuer einzufordern. Es gibt bereits eine um internationale Steuergestaltungs- und letzt-
CO2-Abgabe, mit der die Umweltbelastung des lich Steuervermeidungspotenziale zu nutzen. Die
motorisierten Individualverkehrs besteuert wird daraus resultierenden Wettbewerbsvorteile sind
und die zumindest kalkulatorisch auch in die eklatant. Während Amazon es in den Jahren 2017
Fotos: Difu
Preise der Onlineprodukte einfließt. Kunden des und 2018 geschafft hat, sein unternehmerisches
stationären Einzelhandels, die mit dem eigenen Ergebnis so zu gestalten, dass in den USA keine
Pkw in die Innenstadt kommen, erzeugen letztlich Steuerzahlungen angefallen sind, muss ein sta-
aus dem gleichen Grund wie der Onlinehandel tionärer Einzelhändler in der Rechtsform einer
umweltschädliche Emissionen. Außerdem: Müsste Personengesellschaft seine Gewinne über 58.000
die Paketsteuer dann auch bei denen erhoben Euro in Deutschland mit 42 Prozent versteu-
Prof. Dr. Carsten Kühl werden, die ihre Waren mit E-Fahrzeugen oder ern. Es ist Aufgabe der staatlichen Regierungen
+49 30 39001-214 Lastenrädern anliefern lassen? Müssten auch die möglichst auf OECD-Ebene diesem Missstand
kuehl@difu.de stationären Einzelhändler die Steuer entrichten, – wenigstens durch eine unternehmerische
4Standpunkt
Berichte 1/2021
Mindestbesteuerung und eine einheitliche Steuer- und Gastronomen werden die Pandemie wirt-
bemessungsgrundlage – zu begegnen. schaftlich nicht überstehen. Andere werden
wegen des veränderten Konsumverhaltens einen
Viele Beschäftigungsverhältnisse bei großen Teil ihrer Läden schließen und parallel ins On-
Online-Anbietern – auch in Deutschland – sind linegeschäft einsteigen. Der Bedarf an Büroflä-
prekär. Schlechte Bezahlung, schlechte Arbeitsbe- chen – auch in innerstädtischen Lagen – wird
zum Weiterlesen dingungen, unterdrückte betriebliche Mitbestim- zurückgehen, weil die Pandemie aufgezeigt hat,
mung. Das gilt übrigens auch für die Lieferfirmen, wo private und öffentliche Dienstleister Effizienz-
Bundesinstitut für Bau-, die für die Onlinehändler arbeiten. Es ist Aufgabe potenziale durch die Ausweitung von Homeoffice
Stadt- und Raumforschung der nationalen Arbeitsmarktpolitik, diesen Miss- nutzen können. Es ist eine originäre Aufgabe der
(BBSR) im Bundesamt ständen entgegenzuwirken. Städte den drohenden Leerstand so zu gestalten,
für Bauwesen und Raum- dass lebendige und funktionierende Innenstädte
ordnung (BBR) (Hrsg.)
Andererseits leidet der Einzelhandel gerade in in- mit neuen Konzepten, die der jeweiligen örtlichen
(2017): Online-Handel –
nerstädtischen Lagen unter zum Teil überteuerten Situation angepasst sind, erhalten bleiben. Zum
Mögliche räumliche Aus-
Mietbedingungen. Renditegesteuerte Immobili- Beispiel Flächen für soziale Einrichtungen, Räume
wirkungen auf Innenstädte,
Stadtteil- und Ortszentren. enfonds und vermachtete Märkte sind Ursache für kulturelle Angebote, mehr (bezahlbaren)
Bonn; dafür, dass die Mieten einen immer höheren Anteil Wohnraum in innerstädtischen Quartieren. Was
www.difu.de/11255 der Betriebskosten im Einzelhandel ausmachen. dabei jeweils angemessen ist und was durchge-
Auch hier besteht Handlungsbedarf auf Seiten der setzt werden kann, unterliegt dem Diskurs der
Bunzel, Arno und Kühl, nationalen Regulatorik. Stadtgesellschaft und dem Stellenwert, den die
Carsten (2020): Stadtent- politisch Verantwortlichen vor Ort dieser Aufgabe
wicklung in Coronazeiten – Der Politik wird es vermutlich nicht möglich sein, beimessen.
eine Standortbestimmung, kurzfristig die ungerechtfertigten Wettbewerbs-
Berlin;
vorteile der Onlinehändler zu beseitigen. Sie sollte Diese wichtige Gestaltungsaufgabe erfordert
www.difu.de/15641
sie aber jetzt und konsequent angehen. Für ein öffentliche Mittel. Eine nachhaltige Stadtentwick-
zügiges Handeln bestehen zwei Optionen: Die lung kostet Geld. Die Einnahmen aus einer syste-
Arndt, Wulf-Holger und
Klein, Tobias (Hrsg.) (2018): Überbrückungshilfen müssen während der Pan- matisch inkonsistenten und in ihrem Aufkommen
Lieferkonzepte in Quartieren demie solange fortgeführt werden, wie erwartet unsicheren Paketsteuer erscheinen verlockend,
– die letzte Meile nachhaltig werden kann, dass Geschäfte nicht auch ohne die sind aber das falsche Instrument. Bund und Län-
gestalten, Berlin; Pandemie in die Insolvenz geraten würden. Und es der werden dazu neigen, den Kommunen zu er-
www.difu.de/11852 müssen von Seiten des Bundes gezielte Förder- klären, dass sie mit der Erhebung der Paketsteuer
programme aufgelegt werden, die eine Neuaus- ihre „Schuldigkeit getan haben“. Transformati-
Kühl, Carsten und Pätzold, richtung der Geschäftsmodelle des stationären onsprozesse in der Stadtentwicklung sind jedoch
Ricarda (2020): Gewer- Einzelhandels unterstützen, z.B. die Transforma- kommunale Kernaufgabe. Städten und Gemein-
beimmobilien unter Druck,
tion zu stationären Angeboten in Kombination mit den sind daher die hierfür notwendigen Steu-
in: Wirtschaftsdienst, 100.
onlinegestützten Lieferangeboten. Solche Maß- ermittel in angemessener Höhe bereitzustellen,
Jahrgang, Heft 9/2020;
nahmen wären wirksamer und zielgerichteter als wenn deren eigene Finanzkraft nicht ausreicht:
www.bit.ly/3aaz0t1
die künstliche Verteuerung von Onlineangeboten Über den kommunalen Finanzausgleich und durch
Kühl, Carsten (2020): Stadt durch eine Paketsteuer. entsprechende Programmlinien im Städtebauför-
und Handel, auf einzelhan- derungsgesetz, das schon immer den Anspruch
del.de: Das Stadtbild wird sich nach Corona verändern, hatte, neue Herausforderungen in der Stadtent-
www.bit.ly/3acMKDy und zwar nicht zum Guten. Manche Einzelhändler wicklung planerisch und fiskalisch zu begleiten.
5Forschung & Publikationen
Berichte 1/2021
Kommunale Bodenpolitik
nachjustieren und neu aufsetzen
Kommunen können durch strategische Bodenpolitik die verloren gegangene Handlungs-
fähigkeit sowie Gestaltungsoptionen für die Stadtentwicklung zurückgewinnen. Dies zeigt
eine vom Difu in Kooperation mit 14 deutschen Städten durchgeführte Studie.
Die „Bodenfrage“ ist mitnichten neu, sie spitzt Mit dem nun veröffentlichten Bericht werden kon-
sich allerdings immer weiter zu. Dies bekommen krete Empfehlungen vorgelegt, wie Städte zu einer
vor allem die stark wachsenden Stadtregionen konsistenten und effektiveren Bodenpolitik kom-
zu spüren, weil Flächen für Wohnungsbau, für men können und welche konkreten Gestaltungs-
die Schaffung von Arbeitsplätzen, für soziale, optionen hierfür von Bedeutung sind. Dabei geht
kulturelle, sportliche, gesundheitliche Zwecke, es vor allem um eine bessere Verzahnung von Lie-
für Freizeit und Erholung im öffentlichen Raum genschaftspolitik, Stadtentwicklung und Stadtpla-
und auch für Klimaschutz und -anpassung knapp nung. Denn eine aktive Bodenpolitik setzt das Zu-
werden. Der Boden wird mehr und mehr zur sammendenken von räumlicher Entwicklung und
entscheidenden Frage für die Entwicklungsfä- Liegenschaften voraus. Eine wirksame kommunale
higkeit der Kommunen. Steigende Bodenpreise Bodenpolitik erfordert deshalb eine ressortüber-
bewirken zusätzlich, dass auch die Finanzierung greifend getragene kommunale Gesamtstrategie,
der genannten Aufgaben und ganz allgemein der welche an die Stelle von Einzelentscheidungen
Daseinsvorsorge zunehmend unter Druck gerät. tritt und stadtentwicklungs- und liegenschafts-
Was zunächst die Kommunen und den Staat trifft, politische Strategien und Instrumente konse-
muss am Ende von Verbraucher*innen, Nutzer*in- quent bündelt. Dabei geht es zunächst darum,
nen und Steuerzahler*innen bezahlt werden. den strategischen, operativen und finanziellen
Nutzen zu erkennen, der mit einer aktiven Liegen-
schaftspolitik verbunden sein kann. Gemeinwohl
und Nachhaltigkeit sind hierfür die Leitlinien.
Neben der Sichtung des Liegenschaftsportfolios
und der Überprüfung aktueller Zweckbindungen
müssen der Erhalt und die Erweiterung des nicht
zweckgebundenen Liegenschaftsvermögens (Flä-
chenreserve) im erforderlichen Umfang sowie die
langfristige Sicherung der am gemeinwohlorien-
Foto: Ricarda Pätzold, Difu
tierten Nutzung bei der Vergabe (Konzeptvergabe,
Erbbaurecht etc.) in den Blick genommen werden.
Städte müssen auch in 50 Jahren noch in der
Lage sein, auf eigenen Flächen Entwicklungen zu
initiieren, die von anderen Marktakteuren nicht zu
erwarten sind.
Die Bodenfrage wird damit zur Schlüsselfrage Der Bericht enthält zahlreiche Hinweise, wie eine
für eine nachhaltige, am Wohl der Allgemeinheit in diesem Sinne effektive Liegenschaftspolitik
ausgerichtete Entwicklung unserer Städte und ausgestaltet werden kann. Auch die Schnittstelle
Gemeinden. Dieser Befund gab Anlass für ein zu den großen Aufgaben der Stadtentwicklung
Kooperationsprojekt des Deutschen Instituts für in der Innenentwicklung und bei der Entwicklung
Urbanistik mit 14 Städten, deren Ausgangslage neuer Baugebiete wird aufgegriffen und es werden
www.difu.de/16293 und stadtspezifischen Ziele zum Teil erheblich Hinweise zur strategischen Nutzung des städte-
variieren. Beteiligt waren Berlin, Braunschweig, baulichen Instrumentariums gegeben. Diese rei-
Dresden, Frankfurt, Hamm, Heidelberg, Karls- chen von Baulandmodellen, über städtebauliche
ruhe, Leipzig, Mannheim, München, Nürnberg, Entwicklungsmaßnahmen bis hin zu Vorkaufs-
Prof. Dr. Arno Bunzel
Potsdam, Oldenburg und Stuttgart. Begleitet und rechten und Milieuschutzsatzungen. Schließlich
+49 30 39001-238
unterstützt wurde das Vorhaben von den Fach- werden mit dem Bericht auch Empfehlungen an
bunzel@difu.de
kommissionen „Stadtentwicklung“ und „Liegen- Bund und Länder formuliert. Denn die öffentliche
Dipl.-Ing. schaften“ des Deutschen Städtetags. Gemeinsa- Hand darf den „Schatz“ ihres Liegenschaftsver-
Ricarda Pätzold mes Ziel aller war es, Möglichkeiten und Chancen mögens nicht achtlos aus der Hand geben und sie
+49 30 39001-190 der Neujustierung der kommunalen Bodenpolitik darf nicht selbst zum Preistreiber auf den Immobi-
paetzold@difu.de auszuloten. lienmärkten werden.
6Forschung & Publikationen
Berichte 1/2021
Pandemie-Folgen: Kultur, Sport
und soziale Angebote werden leiden
Für die kommunalen Haushalte wird die Corona-Lage zu einer zunehmenden
Belastungsprobe. Investitionen zeigen sich noch robust – Digitalisierungsinvestitionen
werden sogar ansteigen.
Eine Vorabauswertung des vom Difu für die die Einnahmen – als auch die Ausgabensituation
KfW-Bankengruppe erstellten „Kommunalpanel verschlechtert. Insgesamt rechnen 85 Prozent der
2021“ zeigt, dass die öffentliche Investitionstätig- Kämmereien – im Vergleich zur Lage vor der Pan-
keit in Kommunen noch der Krise trotzt. Allerdings demie – mit sinkenden Einnahmen für 2021 und
trübt sich das Bild gerade bei finanzschwachen die Folgejahre. Trotz der zu erwartenden Minder-
Kommunen deutlich ein. Mittelfristig besteht die einnahmen werden für eine Mehrheit der Kommu-
Gefahr, dass es vor allem bei Ausgaben für frei- nen vor allem Investitionen in die Digitalisierung
willige Aufgaben zu Einsparungen kommt. Frei- wichtiger. 64 Prozent rechnen mit „eher“ bzw.
willige Aufgaben in den Bereichen Kultur, Sport sogar „stark steigenden“ Investitionsausgaben für
und Soziales sind für die Daseinsvorsorge und die die Digitalisierung. Hart wird es voraussichtlich
Lebensqualität in Deutschland von großer Bedeu- den Kultur- und Sportbereich treffen: Angesichts
tung – gerade auch in einer Post-Corona-Zeit. Die der zu erwartenden Mindereinnahmen infolge der
Befragungsergebnisse zeigen, dass sich die Lage Pandemie gehen 42 Prozent (Kultur) bzw. 32 Pro-
im Laufe des Jahres keinesfalls entspannt hat. Im zent (Sport) der Kommunen davon aus, dass sie
Gegenteil: Rund 73 Prozent der Kommunen geben künftig in diesen Bereichen weniger Geld ausge-
an, dass sich die Finanz- und Haushaltslage – ben werden. Auch für sonstige soziale Angebote,
bezogen auf die Einnahmen – schlechter oder wie z.B. für Jugendliche oder Senior*innen, die
sogar deutlich schlechter darstellt, als noch zu nicht bereits über die Leistungen der Sozialhilfe
Beginn der Krise zu befürchten war. Auch bezogen rechtlich fixiert sind, gehen 27 Prozent der Kom-
auf die Ausgaben hat ein erheblicher Anteil der munen von einer Ausgabenreduzierung aus. Über
Kommunen eine pessimistischere Einschätzung die vier abgefragten Aufgabenbereiche – Kultur,
als im Frühjahr. Zwar gehen rund 54 Prozent der Sport, Soziales, Wirtschaftsförderung – hinweg
Kommunen davon aus, dass die Ausgabensitua- erwartet ein deutlich größerer Anteil finanzschwa-
tion im Vergleich zur Einschätzung im Mai 2020 cher Kommunen einen Rückgang als dies unter
unverändert ist. Zugleich bewerten jedoch auch finanzstärkeren Kommunen der Fall ist. Es besteht
43 Prozent die aktuelle Ausgabensituation als die Gefahr, dass sich die seit Jahren bestehen-
schlechter oder deutlich schlechter. Dabei hat den Ungleichheiten zwischen den Kommunen in
sich bei über einem Drittel der Kommunen sowohl Deutschland erneut verschärfen werden.
www.difu.de/16336
Christian Raffer
+49 30 39001-198
raffer@difu.de
Dr. Henrik Scheller
+49 30 39001-295
scheller@difu.de
7Forschung & Publikationen
Berichte 1/2021
Neue Instrumente für eine nachhaltige
Stadtentwicklung
Wo stehen die Kommunen auf dem Weg zu den Nachhaltigkeitszielen der UN,
insbesondere bei Klimaschutz und Klimaanpassung? Das Difu hat mit der Bertelsmann
Stiftung und weiteren Partnern die SDG-Indikatoren für Kommunen weiterentwickelt.
Vor zwei Jahren wurden die SDG-Indikatoren für im Auftrag und gemeinsam mit der Bertelsmann
Kommunen – das Kennzahlensystem, mit dem ab- Stiftung und den kommunalen Spitzenverbänden
gebildet werden kann, welche Beiträge eine Kom- (Deutscher Städtetag, Deutscher Städte-und
mune zur Erreichung der Sustainable Develop- Gemeindebund, Deutscher Landkreistag), dem
ment Goals leistet – veröffentlicht. Inzwischen sind Bundesinstitut für Bau-, Stadt- und Raumfor-
die Indikatoren weiterentwickelt worden. Daher schung (BBSR), der Servicestelle Kommunen in
wurden eine neue Publikation sowie begleitende der Einen Welt (SKEW) und der deutschen Sektion
Angebote für Städte und Gemeinden erarbeitet. des Rates der Gemeinden und Regionen Europas
bereits 2018 einen ersten Aufschlag für ein um-
Insgesamt 120 Indikatoren können nun für das fassendes Monitoring zum Status quo der SDGs
Monitoring der kommunalen Nachhaltigkeitsleis- auf kommunaler Ebene erarbeitet. Der erste Indi-
tung wie mit einem Baukastensystem angezeigt katorenkatalog „SDG-Indikatoren für Kommunen“
und angewendet werden. Jede Kommune kann beinhaltete 47 Kernindikatoren zur quantitativen
daher einzelne Indikatoren verwenden, verändern, Abbildung jener Ziele und Unterziele der Agenda
ergänzen oder auch nicht berücksichtigen – je 2030, die in einem aufwändigen und partizipa-
nachdem, wie es zum jeweiligen Ort passt. Das tiv angelegten Prozess als relevant für deutsche
Oliver Peters, M.Sc. begleitende SDG-Portal, das 2019 mit dem UN- Kommunen bewertet wurden. Die seitdem vorge-
+49 30 39001-204 SDG-Action-Award ausgezeichnet wurde, ermög- nommene Evaluierung, Erprobung und Weiterent-
opeters@difu.de licht neben der Darstellung von Indikatorendaten wicklung der Indikatorik resultierte in 120 neuen
tausender Kommunen, sich mit weiteren Kommu- oder aktualisierten Indikatoren. So werden nun
Dr. Jasmin Jossin nen eines gleichen Typs, d.h. mit ähnlichen Struk- über 60 Prozent der für Kommunen relevanten
+49 30 39001-200 turmerkmalen, zu vergleichen und von etwa 200 Unterziele messbar. Nicht zuletzt eigens entwi-
jossin@difu.de dargestellten Praxisbeispielen zu lernen. ckelte Index-Indikatoren führten insbesondere bei
SDG 3 „Gesundheit“, SDG 11 „Städte“, SDG 12
Dipl.-Umweltwiss.
Die Bedeutung der Kommunen für die Erreichung „Produktion“, SDG 13 „Klimaschutz“ sowie SDG
Anne Roth
der globalen Nachhaltigkeitsziele wurde und wird, 15 „Leben an Land“ zu einer Verbesserung des
+49 221 340308-22
roth@difu.de
auch vor dem Hintergrund der Pandemie, seitens Monitorings.
der Politik, der Zivilgesellschaft und der Wissen-
Dipl.-Geogr. Jan Walter schaft immer wieder hervorgehoben. Im Rahmen Mit dem zum Deutschen Nachhaltigkeitstag veröf-
+49 221 340308-26 der Arbeitsgruppe „SDG-Indikatoren für Kom- fentlichten Indikatorenkatalog und dem Relaunch
walter@difu.de munen“ hat das Deutsche Institut für Urbanistik des SDG-Portals, das die dazugehörigen Daten
8Forschung & Publikationen
Berichte 1/2021
für alle Landkreise sowie für Städte und Gemein- bezüglich der Energiesuffizienz setzen, die im Ein-
den ab 5.000 Einwohner*innen zur Verfügung klang mit den im Pariser Klimaschutzabkommen
stellt, werden nun umfassende Möglichkeiten getroffenen Zielen stehen. Dies gilt in ähnlicher
für Kommunen bereitgestellt, um die Umset- Form auch für den Bereich Klimaanpassung, in
zung einer nachhaltigen Stadtentwicklung zu dem es bislang noch weniger gelungen ist, kon-
unterstützen. Dabei wird das SDG-Portal ständig krete Ziele zu formulieren. Nach wie vor werden
aktualisiert und erweitert: So werden in Kürze (auch) auf kommunaler Ebene die beiden Aufga-
beispielsweise auch Handlungsempfehlungen für ben Klimaschutz und Klimaanpassung oft parallel
Kommunen mit einem gemeinsamen „SDG-orien- bearbeitet, ohne dass in hinreichender Weise Syn-
tierten Kommunaltyp“ zur Verfügung gestellt. ergien genutzt werden.
Der Klimaschutz und die Anpassung an den Kli- Seitens der Bürger*innen zeigt sich ein zuneh-
mawandel zählen zu den größten Herausforderun- mendes Bewusstsein, dass angesichts des fort-
gen in Kommunen, sodass sie einen besonderen schreitenden Klimawandels Handlungsbedarf
Stellenwert in der Debatte um eine nachhaltige besteht. Ein Großteil der Bürger*innen spürt die
Entwicklung einnehmen – fälschlicherweise wer- Klimaveränderungen in der eigenen Stadt oder
den Klimaschutz und nachhaltige Entwicklung Gemeinde und geht davon aus, dass sich der Kli-
oftmals gleichgesetzt. Trotz dieser Bedeutung mawandel auf das eigene Leben insgesamt „eher
fehlt es in diesem Bereich an einer breiten Wis- negativ“ bzw. „negativ“ auswirken wird, wie die
sensbasis, die verschiedene Ebenen und Pers- zugrundeliegende repräsentative Bevölkerungsbe-
pektiven betrachtet sowie an Indikatoren, die mit fragung zeigt. Rund ein Viertel der deutschen Be-
kleinräumigen und hochwertigen Daten hinterlegt völkerung sieht die Risiken, die der Klimawandel
werden können. Vor diesem Hintergrund widmete mit sich bringen wird, jedoch (noch) nicht.
sich der projektbegleitende Monitorbericht 2020
dem Schwerpunkt Klima und Energie. Drei zent-
rale Fragestellungen werden im Bericht adressiert:
Wo stehen die Kommunen im Bereich Klima-
schutz und -anpassung, welchen Einfluss haben
Kommunen auf die nationale Treibhausgas-Bilanz
und Zielerreichung im Klimaschutz und wie wird
das Engagement der Kommunen im Klimabereich
von den Bürger*innen wahrgenommen? Zur Be-
antwortung dieser komplexen Forschungsfragen
wurde ein umfassender Methodenmix bestehend
aus Kommunal- und Bevölkerungsbefragung,
Interviews von Gute-Praxis-Kommunen und der
Auswertung bestehender Daten angewendet.
Im Ergebnis zeigt sich, dass die Umsetzung von
Klimaschutz und Klimaanpassung im Sinne der
Agenda 2030 viele Kommunen noch immer vor
nicht unerhebliche Herausforderungen stellt, in
denen Zielkonflikte vermieden und Synergien aus-
genutzt werden müssen. Dabei können Treibhaus-
gas-Bilanzen den kommunalen Klimaschutz un-
terstützen und die Aktivitäten steuern, aber nicht
alle kommunalen Klimamaßnahmen abbilden.
Der zunehmende Anteil an Kommunen, die kon-
tinuierlich Treibhausgas-Bilanzen erstellen, zeigt
zum Weiterlesen mehrheitlich auf, dass ihre Emissionen über alle
Sektoren hinweg über die Jahre gesunken sind. Insgesamt bestätigt sich der Eindruck, dass sich
immer mehr Kommunen auf den Weg machen
www.difu.de/16324
www.difu.de/16115
Mit Blick auf die Energiewende fällt allerdings auf, und sich systematisch mit den lokalen Herausfor-
www.sdg-portal.de dass die SDGs insgesamt vergleichsweise un- derungen des Klimawandels befassen. Dieser sich
präzise und ergänzungsbedürftig formuliert sind, hoffentlich noch beschleunigende Trend leistet
Monitor Nachhaltige um streitsicher über eine Zielerreichung urteilen einen entscheidenden Beitrag zur nachhaltigen
Kommune Bericht 2020 zu können. Deshalb empfiehlt es sich, dass Kom- Entwicklung.
– Schwerpunkt Klima und munen sich klare Ziele bezüglich des Ausbaus
Energie (wird in Kürze im erneuerbarer Energieträger, der Verbesserung der
Repository hinterlegt) Energieeffizienz sowie Handlungsmöglichkeiten
9Forschung & Publikationen
Berichte 1/2021
Umfrage zu Klimaschutz, erneuerbaren
Energien und Klimaanpassung
Nach Maßnahmen, Erfolgen, Hemmnissen und Entwicklungen rund um das Thema
Klimaschutz und Klimaanpassung befragte das Difu die Kommunen 2020. Im Fokus
standen auch Extremwetterereignisse. Die Ergebnisse sind als Difu-Paper veröffentlicht.
Die Aufmerksamkeit für Themen rund um Klima- zurückzuführen vor allem auf Energiesparmaß-
schutz und Klimawandel hat seit 2019 zu Recht nahmen und eine Steigerung der Energieeffizienz.
einen deutlichen Aufschwung erfahren. Um die Im Gegensatz dazu wurde im Verkehrsbereich
Entwicklungen und den Bedarf der Kommunen eine Erhöhung des CO2-Ausstoßes bei 48 Prozent
in diesem Themenfeld einschätzen zu können, der antwortenden Kommunen verzeichnet.
befragt das Difu sie seit 2008 alle vier Jahre. Ziel
ist es, Informationen über neue Maßnahmen und Im Schwerpunkt „Klimawandel in Kommunen“
Projekte zum kommunalen Klimaschutz, zur Nut- zeigt sich eine signifikante Zunahme von Ex-
zung erneuerbarer Energien und zu kommunalen tremwetterereignissen: Im Vergleich zu 2008 wird
Anpassungsstrategien an den voranschreitenden deutlich, dass über alle Extremwetterereignisse
Klimawandel zu gewinnen. An der Umfrage 2020 hinweg auch die mehrmalige Betroffenheit stark
haben sich 200 Kommunen beteiligt. angestiegen ist. Neben den Starkniederschlägen
ist für die Kommunen vor allem bei Hitze- und
Ausgewählte Umfrageergebnisse wurden als Di- Dürreperioden eine erhöhte Virulenz zu ver-
fu-Paper veröffentlicht – hier ein erster Einblick: zeichnen. Bedeutsam sind diese Entwicklungen
Bei der Erstellung von Klimaschutzkonzepten nicht nur für die Umsetzung von kommunalen
konnten 87 Prozent der antwortenden Kommunen Maßnahmen und Planungsprozessen sondern
bereits Aufschluss über ihre spezifischen Poten- auch mit Blick auf Gesundheitsprävention und
ziale in ihren unterschiedlichen Handlungsfel- Objektschutz.
dern erlangen und zugleich Prioritäten festlegen
sowie Synergien zwischen verschiedenen Einzel- Klimafolgenanpassungen sind ebenso wie Kli-
maßnahmen erschließen. Zudem ermöglichen maschutzmaßnahmen bereits heute zwingend zu
kommunale CO2-Bilanzen eine Bewertung und berücksichtigen, um Spätschäden, Gefahren und
Kontrolle von bereits durchgeführten Maßnahmen Folgekosten zu vermeiden. Die defizitäre Haus-
im Klimaschutz und können als Indikator für die haltslage einiger Kommunen, der Sanierungsstau
Entwicklung sowie als Entscheidungsgrundlage bei vielen Liegenschaften, Personalmangel oder
für weitere Maßnahmen herangezogen werden. fehlendes Fachpersonal erschweren jedoch teil-
62 Prozent der teilnehmenden Kommunen mel- weise Investitionen und damit die Umsetzung
den eine Reduzierung des CO2-Ausstoßes in ihren von Maßnahmen für mehr Klimaschutz- und
kommunalen Einrichtungen. Im Durchschnitt Klimaanpassung.
sanken dort die CO2-Emissionen um 27 Prozent,
Extremwetterereignisse
in Kommunen
Mehrfachnennungen
möglich; 2020, n=169;
2016, n=254; 2012, n=180;
2008, n=98
www.difu.de/16344
Dipl.-Ing.
Cornelia Rösler
+49 221 340308-18
roesler@difu.de
Julius Hagelstange
+49 221 340308-24
hagelstange@difu.de
10Forschung & Publikationen
Berichte 1/2021
Photovoltaik und solare Wärmenetze
für den Klimaschutz in Kommunen
Zwei neue Publikationen rücken die Nutzung erneuerbarer Energien in Kommunen in den
Fokus. Die in der Online-Serie #Klimahacks erschienenen Ausgaben widmen sich den
Themen Photovoltaik auf kommunalen Dächern sowie solaren Wärmenetzen.
Für die Erreichung der nationalen Klimaschutz- Endenergieverbrauch bei, weshalb im Zuge der
ziele sind erneuerbare Energien sehr wichtig. Energiewende vor allem in diesem Bereich sowohl
Damit die Energiewende gelingen kann, kommt auf eine Reduktion als auch auf den Einsatz erneu-
es vor allem auf zwei wesentliche Dinge an: die erbarer Energien gesetzt werden muss. Ziel dieser
Reduktion des Energiebedarfs und der Einsatz #Klimahacks-Ausgabe ist es daher, zunächst über
erneuerbarer Energien. Gerade Kommunen über- die verschiedenen erneuerbaren Wärmequellen
nehmen bei der Energiewende eine tragende zu informieren, aus denen sich ein zentrales Wär-
Rolle. Vor diesem Hintergrund befassen sich die menetz zusammensetzen kann. Im Fokus stehen
zwei neuen Ausgaben der #Klimahacks-Reihe mit solare Wärmenetze, die in den letzten Jahren
dem Thema Klimaschutz und erneuerbare Ener- immer mehr an Bedeutung gewonnen haben, vor
gien. Beide Publikationen zeigen auf, wie man sich allem im Bereich der städtischen Wärmeversor-
die Strahlkraft der Sonne zu Nutze machen kann. gung. Denn gerade in dicht besiedelten urbanen
Räumen bieten Wärmenetze eine Möglichkeit,
Solare Stromgewinnung: Die Ausgabe No. 6 der um Stadtquartiere oder Mehrfamilienhäuser mit
#Klimahacks-Reihe befasst sich mit dem Potenzial erneuerbaren Energien zu versorgen. Das verdeut-
kommunaler Dachflächen zur Installation von Pho- lichen auch die zahlreichen Praxisbeispiele, die in
tovoltaik-Anlagen. Denn auf dem Weg zu 100 Pro- dieser Ausgabe vorgestellt werden und als Moti-
zent erneuerbarer Energien im Strombereich bil- vation für interessierte Kommunen dienen sollen.
det der Photovoltaik-Ausbau einen wesentlichen
Eckpfeiler. Gerade Kommunen können hier mit Als digitales „Flipbook“ erreichen die #Klimahacks
gutem Beispiel vorangehen und geeignete Dach- durch ihr multimediales Online-Format eine be-
flächen ihrer kommunalen Liegenschaften für die sonders hohe Leserfreundlichkeit. Interaktive Gra-
www.difu.de/16300 Photovoltaik nutzen. Herzstück dieser Ausgabe ist fikelemente liefern detaillierte Informationen und
www.difu.de/15704 eine detaillierte Kurzanleitung, die Auskunft über verdeutlichen Arbeitsabläufe. Praxisnahe Video-
die wichtigsten Schritte auf dem Weg zur kommu- clips sind direkt in das Flipbook eingebettet.
nalen PV-Dachanlage gibt, angefangen von der Jede Ausgabe enthält zudem eine Linkliste zu
Auswahl geeigneter Dachflächen über Fragen des kommunalen Praxisbeispielen sowie zu anderen
Paul Ratz, M.Sc.
Denkmalschutzes bis hin zum Betrieb der Anlage. aktuellen Veröffentlichungen zum jeweiligen The-
+49 221 340308-11
menschwerpunkt. Die #Klimahacks erscheinen
ratz@difu.de
Solare Wärmeerzeugung: In der #Klimahacks- im Rahmen des Difu-Projekts „Neue Impulse im
Dipl.-Geogr. Jan Walter Ausgabe No. 7 wird das Thema kommunale kommunalen Klimaschutz (NIKK)“, das über die
+49 221 340308-26 Wärmenetze genauer unter die Lupe genommen. Nationale Klimaschutzinitiative des Bundesum-
walter@difu.de Wärme trägt zu etwa 50 Prozent zum deutschen weltministeriums gefördert wird.
11Forschung & Publikationen
Berichte 1/2021
Mit flexiblen On-Demand-Angeboten
ÖPNV-Bedarfsverkehr modernisieren
Was bei der Modernisierung flexibler und nachfrageorientierter Angebote im öffentlichen
Personennahverkehr zu beachten ist, zeigen aktuelle Erfahrungen aus dem vom Difu für
die Region Hannover umgesetzten Forschungsprojekt „On demand besser ans Ziel!“.
Bild: Region Hannover
Der bereits seit Jahrzehnten etablierte Bedarfs- Barrierefreiheit, eine regelmäßige Bestellung, bei-
verkehr des öffentlichen Personennahverkehrs spielsweise durch Berufspendelnde, sowie die zu-
(ÖPNV) ergänzt oder ersetzt den Linienverkehr verlässige Verknüpfung mit im Takt verkehrenden
in nachfrageschwachen Zeiten und Gebieten. Angeboten wie S-Bahn oder Regionalbus. Auch
Bedarfsverkehr ermöglicht es, insbesondere in Fragen der Anpassung des On-Demand-Verkehrs
ländlich geprägten Räumen, die Daseinsvorsorge an die Anforderungen des ÖPNV sind bisher noch
zu gewährleisten. Allerdings wird ÖPNV-Bedarfs- weitgehend unerforscht.
verkehr selten zu attraktiven Angeboten weiterent-
wickelt und offensiv beworben. Diesen Fragen ging das Deutsche Institut für Ur-
banistik (Difu) im Auftrag der Region Hannover im
Neue flexible Angebote liegen aktuell im Trend. Forschungsprojekt „On demand besser ans Ziel!“
Vielerorts entwickeln sich neue Mobilitätsange- im Rahmen des BMBF-Förderprogramms „Mobi-
bote, die auf Abruf angeboten und als Sammelver- litätsWerkStadt2025“ nach. Die Region Hannover
kehr organisiert werden. Diese On-Demand-Mo- plant einen Modernisierungsprozess des nach-
bilitätsdienste haben auch das Interesse der frageorientierten ergänzenden ÖPNV-Angebots
ÖPNV-Branche geweckt. Den ÖPNV-Aufgaben- auf der „Verteilungsebene“. Hier geht es um
trägern stellen sich in diesem Zusammenhang u.a. ÖPNV-Angebote bei Verbindungen mit niedriger
folgende Fragen: Nachfrage, auf denen sich ein attraktiver Linien-
verkehr nicht realisieren lässt. Unter dem Pro-
• Bietet sich durch On-Demand-Verkehr die duktnamen „sprinti“ soll ein wettbewerbsfähiger
Möglichkeit, dem ÖPNV-Bedarfsverkehr einen Last- und First-Mile-Baustein des ÖPNV, der an
Modernisierungsschub zu geben? das frische Image der neuen On-Demand-Ange-
• Könnten attraktive First- und Last-Mile-Ange- bote anknüpft, zunächst in drei Pilotkommunen
bote als Zubringer zu Haltestellen an Haupt- umgesetzt werden: Wedemark, in Sehnde und in
linien des Busverkehrs oder Bahnstationen Springe. Das Difu unterstützte den Prozessver-
geschaffen werden? lauf mit der wissenschaftlichen Begleitung des
• Und kann so das Netz enger geknüpft werden? Vorhabens.
www.difu.de/16282
Die Herausforderung für ÖPNV-Aufgabenträger Eine neue Difu-Veröffentlichung fasst die bisher
und Anbieter von On-Demand-Verkehr besteht gewonnenen Erkenntnisse aus der ersten Projekt-
darin, einen Evolutionsprozess für die Angebote phase zusammen. Die Veröffentlichung hat den
Victoria Langer, M.Sc.
zu initiieren, sodass der bisher unter limitierten Charakter eines Werkstattberichts, der einen aktu-
+49 30 39001-257
langer@difu.de
Anforderungen erprobte Verkehr dem komplexen ellen Diskussionsstand widerspiegelt und der über
Anforderungsprofil eines ÖPNV-Angebots gerecht das konkrete Vorhaben in der Region Hannover
Dr. phil. Jürgen Gies wird – beispielsweise im Hinblick auf die ange- hinaus Hinweise zu Aspekten gibt, die für die Um-
+49 30 39001-240 sprochene Zielgruppe oder die Tarifintegration. setzung von On-Demand-Verkehr mit Integration
gies@difu.de Zu nennen sind unter anderem die Umsetzung der in den ÖPNV relevant sind.
12Forschung & Publikationen
Berichte 1/2021
Mit intelligenten Stellplatzkonzepten
nachhaltige Mobilität voranbringen
Wie kann Stellplatzbau in neuen Stadtquartieren umgesetzt werden, sodass Baukosten
gesenkt und gleichzeitig nachhaltige Mobilität gefördert werden? Eine neue Difu-
Sonderveröffentlichung (englisch und demnächst auch auf deutsch) zeigt Wege auf.
Die Regelungen zum Stellplatzbau in verschie- Parken benötigt Platz. Dies reduziert nicht nur die
denen europäischen Ländern standen im Fokus bebaubare Fläche, sondern auch Raum für Auf-
des Difu-Forschungsprojekts Park4SUMP, das im enthalt und Spiel. Ist das eigene Auto das nächst-
Rahmen des europäischen Horizont 2020-Pro- gelegene Verkehrsmittel zur Wohnung, ist es oft
gramms umgesetzt wird. Betrachtet werden dabei die erste Wahl. Dadurch erhöht sich der Parkdruck
auch am Zielort: am Arbeitsplatz, in Einkaufszen-
tren und bei Freizeiteinrichtungen.
Es gibt somit eine Reihe guter Gründe über eine
Veränderung der Stellplatzschlüssel nachzuden-
ken. In einer englischen Sonderveröffentlichung
– auch eine deutschsprachige Version ist in Vor-
bereitung – werden Vorgehensweisen verschiede-
ner europäischer Länder vorgestellt, sowie gute
Praxisbeispiele, die zeigen, dass Regelungen zum
Foto: Martina Hertel, Difu
Stellplatzbau ein wichtiges Steuerungsinstrument
innerhalb der Stadt- und Verkehrsplanung sind.
Raum für Aufenthalt statt für In den meisten europäischen Ländern ist die Park-
parkende Fahrzeuge raum- und Stellplatzpolitik im Handlungsbereich
lokaler Politik. Nationale oder regionale Regierun-
vor allem neue Wohngebiete, aber auch Gebiete gen geben hierzu meist Richtlinien vor. Wenn die
mit gemischter Nutzung von Wohnen und Ge- kommunale Ebene Regelungen zur Stellplatzbau-
werbe sind von Interesse, da diese zunehmend pflicht erlassen kann, so können drei Vorgehens-
im Mittelpunkt von Stadterweiterungsprojekten weisen unterschieden werden:
stehen.
• Aufhebung der Stellplatzbaupflicht, um die
Bisher legt der Stellplatzschlüssel fest, wie viele Baukosten zu senken: Beispiele in Deutschland
Stellplätze für Pkw und Fahrräder zu errichten sind Berlin und Hamburg,
sind. Die Anzahl richtet sich dabei nach Wohnein- • Reduktion der Stellplatzbaupflicht, wenn Alter-
heiten oder der Wohnfläche bzw. nach der Fläche nativen existieren, z.B. wenn das Bauvorhaben
für Büros, Einzelhandel und Arbeitsplätze sowie in einem Gebiet mit guter Anbindung an den
den vorgesehenen Nutzungen. In den meisten öffentlichen Nahverkehr liegt und/oder fun-
Ländern existieren „Mindeststandards“ für den dierte Mobilitätskonzepte vorliegen: Beispiele
Stellplatzbau. Das heißt, dass Bauträger über sind Freiburg/Br., Darmstadt und Graz,
ihren Pflichtteil hinaus mehr bauen können, wenn • Festlegung einer Maximalzahl von Stellplätzen,
sie es für notwendig halten. Feste Höchstwerte als d.h. Stellplatzobergrenzen für neue Gebäude:
„Maximalstandards“ begrenzen dagegen die zu Beispiele sind Zürich und das Zentrum von
bauende Anzahl der Stellplätze, um kein Überan- London.
www.difu.de/16332 gebot an Stellplätzen zu schaffen. Hierdurch sol-
len nicht nur Kosten gesenkt, sondern es soll auch Die Erfahrungen mit allen drei Optionen – in ver-
dem Anstieg des Pkw-Besitzes und somit langfris- schiedenen Formen – zeigen, dass Vorgaben für
tig dem Pkw-Verkehr entgegengewirkt werden. die Errichtung von Stellplätzen ein äußerst wich-
Dr. phil. Jürgen Gies
tiges Steuerungsinstrument innerhalb der Stadt-
+49 30 39001-240
Etwa 80 Prozent aller Wege beginnen und enden und Verkehrsplanung sind. Die Integration einer
gies@difu.de
an der Wohnung, sodass die Verfügbarkeit von veränderten Parkraum- und Stellplatzpolitik in
Dipl.-Geogr. Parkmöglichkeiten an der Wohnung besonders den Verkehrsentwicklungsplan (VEP) oder nach-
Martina Hertel wichtig für die Wahl des Verkehrsmittels ist. Zu- haltigen Mobilitätsplan (SUMP) ist für Kommunen
+49 30 39001-105 dem ist der Stellplatzbau ein Kostenfaktor im empfehlenswert und grundsätzlich anzustreben.
hertel@difu.de Wohnungsbau – Stichwort teure Tiefgarage – und
14Forschung & Publikationen
Berichte 1/2021
„Moderne Stadtgeschichte“ feiert
Jubiläum: 50 Jahre Stadtgeschichte
Die neue Ausgabe der Zeitschrift „Moderne Stadtgeschichte“ wirft einen Blick auf die
eigene Historie. Das Autorenteam nimmt den runden Geburtstag zum Anlass für eine
Rückschau und Bestandsaufnahme zur historischen Stadtgeschichtsforschung.
Die neue Ausgabe der „Modernen Stadtgeschich- Paradigmenwechsel von der Sozial- zur Kultur-
te“ (MSG, 2/2020) ist eine ganz besondere geschichte in den 1980er-Jahren und deren Aus-
Veröffentlichung: Sie ist die Jubiläumspublika- wirkungen auf die historische Stadtforschung
tion „50 Jahre Moderne Stadtgeschichte“. Das zusammen.
Gründungsjahr der Zeitschrift 1970 – damals
„Informationen zur modernen Stadtgeschichte Der umfangreiche zweite Abschnitt bietet ver-
– IMS“ – ist Anlass für eine Rückschau und Be- schiedene Texte zur zunehmenden Öffnung der
standsaufnahme zur historischen Stadtforschung. deutschen Forschung für internationale und ins-
Die Herausgeber Dieter Schott und Sebastian besondere europäische Perspektiven. So beleuch-
Haumann (Darmstadt) erinnern in ihrer Einleitung tet Richard Rodger (Edinburgh) die Verbindungen
an Gründerpersönlichkeiten des Aufbruchs in der des maßstabsetzenden Centers for Urban History
Forschung um 1970, wie z.B. Hans Herzfeld, Wolf- an der Universität Leicester zu europäischen For-
gang Hofmann und Christian Engeli, und erläutern scher*innen. Marjanna Niemi (Tampere) skizziert
die Zusammenstellung des Heftes aus Berichten die Entwicklung der wichtigen „European Associa-
von Zeitzeugen und themenzentrierten Beiträgen. tion for Urban History“ (EAUH) mit ihren interna-
tionalen Konferenzen. Beiträge von Christoph
Bernhardt (Berlin) und Geneviève Massard-
Guilbaud (Lyon) sowie Tim Soens (Antwerpen)
berichten, gleichfalls in europäischer Perspektive,
von der dynamischen Entwicklung der Forschun-
gen zur städtischen Umweltgeschichte.
In einem dritten Abschnitt thematisieren ver-
schiedene Autor*innen wichtige jüngere Entwick-
lungen, so Heinz Reif (Berlin) die Gründung der
„Gesellschaft für Stadtgeschichte und Urbani-
sierungsforschung“ (GSU) im Jahr 2000, Gisela
Mettele (Jena) die Bedeutung der Kategorie „Gen-
der“ für die historische Forschung, und Clemens
Wischermann (Konstanz) die wirtschaftlichen
Dimensionen der Stadtgeschichte. Eine Reflek-
tion von Martin Knoll (Salzburg) zum Verhältnis
von Stadt und Land in der Forschung sowie eine
tabellarische Übersicht der Themenschwerpunkte
der IMS/MSG seit ihrer Gründung runden das Ju-
biläumsheft ab.
Im Hinblick auf die besondere Gestaltung dieser
Ausgabe beschränken sich die weiteren Beiträge
auf einen Tagungsbericht von Andrea Bärnreuther
(Berlin) über ein Symposium des Bauhaus-Ar-
chivs/Museum für Gestaltung unter dem Titel
Mehrere von Clemens Zimmermann (Saarbrü- „Was heißt hier Haltung?“ zu Deutungsmustern
www.difu.de/16222 cken) zusammengestellte Beiträge zentraler in der heutigen Debatte um die berühmte Kunst-
Akteure der 1970er-Jahre reflektieren die Hin- und Architekturschule, sowie auf die Zusammen-
tergründe und Bedingungen der Entstehung der stellung von Veranstaltungsterminen. Die Kürze
Prof. Dr. Zeitschrift. Dieter Schott unterzieht ihre The- der letztgenannten Rubrik reflektiert schlaglicht-
Christoph Bernhardt menschwerpunkte in den 1970er-Jahren einer artig die außergewöhnlichen Bedingungen, mit
christoph.bernhardt@ reflektierenden Auswertung. Martin Baumeister denen in der Zeit der Covid-19-Pandemie auch
hu-berlin.de (Rom) fasst eine Round-Table-Diskussion zum die historische Stadtforschung zu kämpfen hat.
15Was ist eigentlich...? Bürgerentscheid Begriffe aus der kommunalen Szene, einfach erklärt Der Bürgerentscheid ist ein Instrument der direkten Demokratie, das auf kommunaler Ebene die Möglichkeit zur politischen Mitbe- stimmung bietet. Bürgerentscheide können von den Bürger*innen per Bürgerbegehren – also durch Sammlung einer bestimmten Mindestanzahl von Unterschriften Wahlbe- rechtigter – herbeigeführt werden. Geht die Initiative von den gewählten kommunalen Ver- treter*innen per Mehrheitsbeschluss aus, wird von einem Ratsbegehren gesprochen. In einem Bürgerentscheid entscheiden die Bürger*innen einer Kommune direkt über eine kommunalpolitische Sachfrage. Mit ihrem Kreuz bei JA oder NEIN auf die zur Abstim- mung gestellte Frage kann eine bereits be- schlossene Maßnahme verhindert, verändert oder eine neue Maßnahme durchgesetzt wer- den. Der Bürgerentscheid hat also die gleiche Wirkung wie der Beschluss des Gemeinde- bzw. Stadtrates. In einem Bürgerbegehren dürfen nur diejenigen abstimmen, die zu den Kommunalwahlen wahlberechtigt sind. Ein Bürgerentscheid ist dann erfolgreich, wenn er zwei Hürden überspringt: Die Mehrheit der Abstimmenden muss ihm zu- stimmen und diese Mehrheit muss zudem einen bestimmten Anteil an allen Stimm- berechtigten ausmachen (Erfolgs- oder Zustimmungsquorum). ———————————————————————— „Durch Bürgerentscheide haben Bürger*in- nen die Chance, direkt und verbindlich über geplante Projekte zu entscheiden.“ ———————————————————————— 2019 wurden knapp 360 kommunale Bürger- entscheide eingeleitet, mehr als 40 Prozent davon in Bayern, während in Bremen und Ber- lin 2019 kein Verfahren registriert wurde. Das liegt daran, dass die Kommunalverfassungen der Länder unterschiedliche Regelungen auf- weisen. So unterscheiden sich beispielsweise das notwendige Zustimmungsquorum sowie die jeweiligen Negativkataloge, in denen die Themen aufgeführt sind, die von einem Begehren ausgeschlossen sind, z. B. die Abstimmung über Haushaltsfragen oder die Verwaltungsorganisation. Weitere Begriffe online: www.difu.de/6189 16
Veröffentlichungen
Berichte 1/2021
Edition Difu – Das Bebauungsplanverfahren nach Straßen und Plätze neu entdecken –
Stadt Forschung Praxis dem BauGB 2007 Verkehrswende gemeinsam gestalten
Muster, Tipps und Hinweise Fachtagungsdokumentation
So geht‘s Von Marie-Luis Wallraven-Lindl u.a., M. Hertel, T. Bracher, T. Stein (Hrsg.)
Fußverkehr in Städten neu denken und 2011, 2., aktualisierte Auflage, 224 S., 35 € Bd. 8/2018, 90 S., 15 €
umsetzen ISBN 978-3-88118-498-4, 29,99 € ISBN 978-3-88118-625-4, 12,99 €
Uta Bauer (Hrsg.)
2019, Bd. 18, 240 S., vierfarbig, zahlreiche Abb. Städtebauliche Gebote nach dem Junge Flüchtlinge – Perspektivplanung
und Fotos, 39 € Baugesetzbuch und Hilfen zur Verselbstständigung
ISBN 978-3-88118-643-8, 33,99 € A. Bunzel (Hrsg.), von M.-L. Wallraven-Lindl, Veranstaltungsdokumentation
A. Strunz, 2010, 188 S., 30 € Dialogforum (Hrsg.), Bd. 7/2018, 188 S., 20 €
Vielfalt gestalten ISBN 978-3-88118-486-1 ISBN 978-3-88118-626-1, 16,99 €
Integration und Stadtentwicklung in
Klein- und Mittelstädten Difu-Impulse Neue Konzepte für Wirtschaftsflächen
Bettina Reimann, Gudrun Kirchhoff, Ricarda Herausforderungen und Trends am Beispiel des
Pätzold, Wolf-Christian Strauss (Hrsg.) Vielfalt und Sicherheit im Quartier Stadtentwicklungsplanes Wirtschaft in Berlin
2018, Bd. 17, 364 Seiten, kostenlos Konflikte, Vertrauen und sozialer Zusammenhalt Von S. Wagner-Endres u.a.
ISBN 978-3-88118-618-6 in europäischen Städten Bd. 4/2018, 84 S., 15 €
www.difu.de/12236 Gabriel Bartl, Niklas Creemers, Holger Floeting ISBN 978-3-88118-614-8, 12,99 €
(Hrsg.)
Wasserinfrastruktur: Den Wandel Bd. 3/2020, 182 S., 20€ Lieferkonzepte in Quartieren – die letzte
gestalten ISBN 978-3-88118-667-4, 16,99 € Meile nachhaltig gestalten
Technische Varianten, räumliche Potenziale, Lösungen mit Lastenrädern, Cargo Cruisern
institutionelle Spielräume Verkehrswende nicht ohne attraktiven und Mikro-Hubs, W. Arndt und T. Klein (Hrsg.)
Martina Winker und Jan-Hendrik Trapp (Hrsg.), ÖPNV Bd. 3/2018, 96 S., 12,99 €
2017, Bd. 16, 272 S., vierfarbig, 39 € Wie lassen sich große ÖPNV-Projekte
ISBN 978-3-88118-584-4 erfolgreich umsetzen? Difu-Papers
Jürgen Gies (Hrsg.)
Kommunaler Umgang Bd. 2/2020, 104 S., 18 € Klimaschutz, erneuerbare Energien
mit Gentrifizierung ISBN 978-3-88118-648-3, 15,99 € und Klimaanpassung in Kommunen
Praxiserfahrungen aus acht Kommunen Maßnahmen, Erfolge, Hemmnisse und Entwick-
Von Thomas Franke u.a., 2017, Bd. 15, 316 S., Checkpoint Teilhabe lungen – Ergebnisse der Umfrage 2020
vierfarbig, zahlreiche Abb., 39 € Kinder- und Jugendhilfe + BTHG – Von J. Hagelstange, C. Rösler und K. Runge
ISBN 978-3-88118-579-0 Neue ganzheitliche Lösungen entwickeln! 2021, 24 S., nur online
Veranstaltungsdokumentation www.difu.de/15789
Sicherheit in der Stadt Dialogforum „Bund trifft kommunale Praxis“
Rahmenbedingungen – Praxisbeispiele – Bd. 1/2020, 160 S., 20 Euro Altersarmut in Städten
Internationale Erfahrungen ISBN 978-3-88118-653-7, 16,99 € Kommunale Steuerungs- und Handlungsmög-
Holger Floeting (Hrsg.), 2015, Bd. 14, 392 S., lichkeiten. Von Beate Hollbach-Grömig u.a.
zahlreiche Abbildungen, 39 € Was gewinnt die Stadtgesellschaft durch 2020, 56 S., 5 €, 3,99 €
ISBN 978-3-88118-534-9, 33,99 € saubere Luft? www.difu.de/15789
Die lebenswerte Stadt: Handlungsfelder und
Orientierungen für kommunale Planung Chancen Kommunale Wirtschaftsförderung 2019
und Steuerung – Ein Handlungsleitfaden Von Tilman Bracher u.a., Bd. 2/2019, 68 S., 15 € Strukturen, Aufgaben, Perspektiven: Ergebnisse
Von Jens Libbe unter Mitarbeit von ISBN 978-3-88118-642-1, 12,99 € der Difu-Umfrage
Klaus J. Beckmann, 2014, Bd. 13, 212 S., 29 € Von Sandra Wagner-Endres
ISBN 978-3-88118-529-5 Öffentlichkeitsbeteiligung beim 2020, 42 S., 5 €, 3,99 €
Netzausbau www.difu.de/15617
Städtebauliche Verträge – Evaluation „Planungsdialog Borgholzhausen“
Ein Handbuch Von Stephanie Bock, Jan Abt, Bettina Reimann Smart Cities in Deutschland –
Vierte, aktualisierte und erweiterte Auflage. Bd. 1/2019, 98 S., 15 € eine Bestandsaufnahme
Mit Berücksichtigung der BauGB-Novelle 2013 ISBN 978-3-88118-640-7, 12,99 € Von Jens Libbe und Roman Soike
Von A. Bunzel, D. Coulmas und G. Schmidt- 2017, 28 S., 5 €, 3,99 €
Eichstaedt, 2013, Bd. 12, 466 S., 39 € www.difu.de/11741
ISBN 978-3-88118-508-0, 33,99 € ————————————————————————————————————————————
Übersicht aller Publikationen + Bestellmöglichkeit
Difu-Arbeitshilfen
www.difu.de/publikationen
eBooks: http://difu.ciando-shop.com/info/einside/ – Info für Zuwender: www.difu.de/12544
Die Satzungen nach dem Baugesetzbuch
3. Auflage
Vertrieb: Difu gGmbH, Zimmerstraße 13-15, 10969 Berlin,
A. Bunzel (Hrsg.), von A. Strunz,
Tel. +49 30 39001-253, Fax: +49 30 39001-275, Mail: vertrieb@difu.de
M.-L. Wallraven-Lindl, 2013, 172 S.,
zahlreiche Satzungsmuster, 29 €
Alle Difu-Veröffentlichungen und -eBooks sind für Difu-Zuwender kostenlos, die mit Stern
ISBN 978-3-88118-526-4
gekennzeichneten Publikationen gibt es exklusiv für Zuwender auch digital.
17Sie können auch lesen