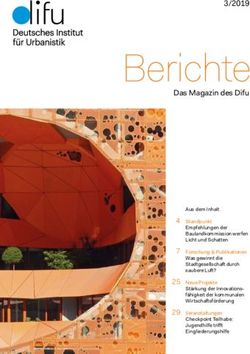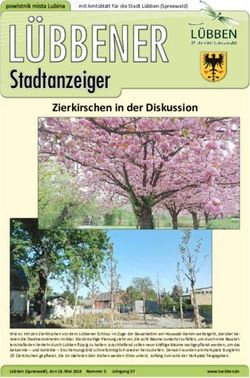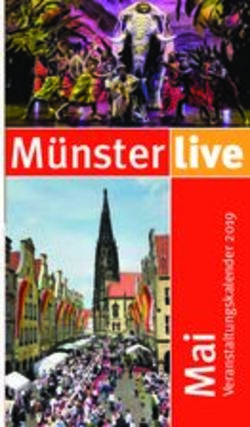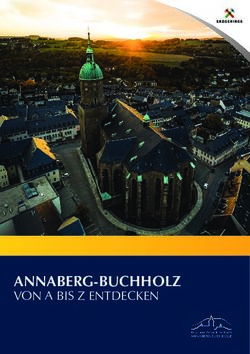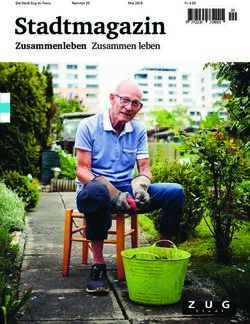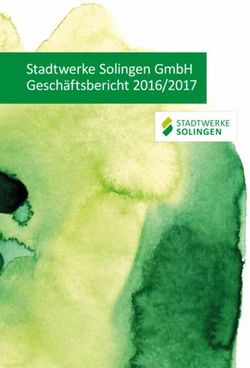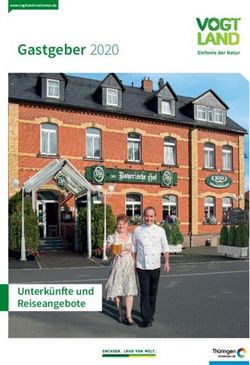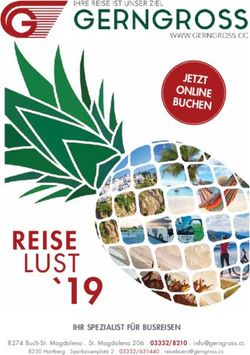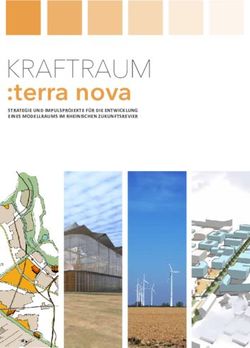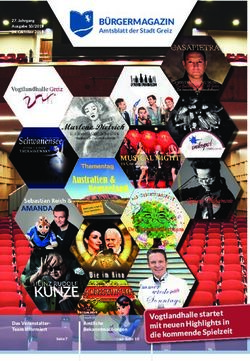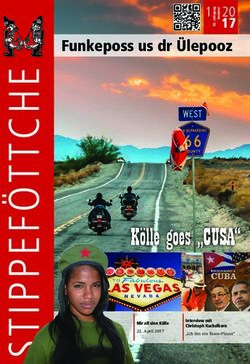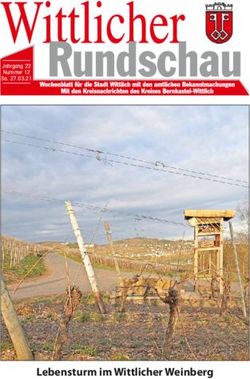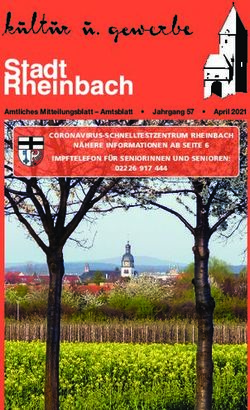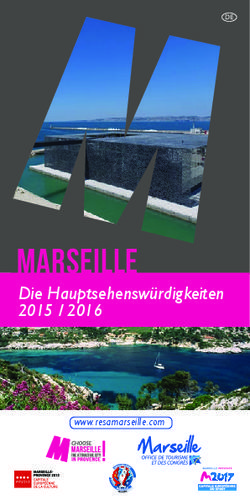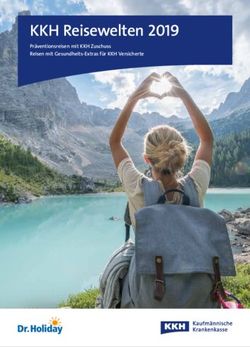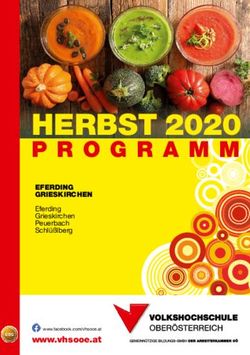Das Magazin des Difu 2/2021 - Deutsches Institut für Urbanistik
←
→
Transkription von Seiteninhalten
Wenn Ihr Browser die Seite nicht korrekt rendert, bitte, lesen Sie den Inhalt der Seite unten
2/2021 Das Magazin des Difu Aus dem Inhalt 4 Sonderthema OB-Barometer 2021: Klimaschutz wird für die Städte immer wichtiger 7 Forschung & Publikationen Kann Wohnen im Umland Vorteile für Stadt und Land bringen? 24 Neue Projekte Stadtentwicklung und Mobilität verbinden 31 Veranstaltungen Wie die kommunale Wärmewende gelingen kann
Editorial 23 Starke Städte – Donut-Ökonomie
24 Nachhaltiges Verkehrssystem
Sonderthema
24 Stadtentwicklung und Mobilität
4 OB-Barometer 2021: Klimaschutz wird
für die Städte immer wichtiger
Veranstaltungen
25 Veranstaltungsübersicht
Forschung & Publikationen
26 Planerische Experimente geben
6 Ausweitung kommunaler
Impulse für die Zukunftsstadt
Wohnungsbestände
27 Eine Stadt für alle: inklusiv, vernetzt,
7 Wie kann Wohnen im Umland Vorteile
barrierefrei
für Stadt und Land bringen?
29 Beteiligung als ein Erfolgsfaktor für
8 KfW-Kommunalpanel 2021: Keine
urbane Sicherheit
Entwarnung für die Kommunalfinanzen
30 Werkzeuge zur Gestaltung der
9 Erster nationaler Fortschrittsbericht
Verkehrswende
zur New Urban Agenda erschienen
31 Wie die kommunale Wärmewende
10 Forschungsimpulse für eine
gelingen kann
nachhaltige Stadt
32 Holzbau: Wertvoller Bestandteil des
11 Zukunftsszenarien für Infrastrukturen
kommunalen Klimaschutzes
der öffentlichen Daseinsvorsorge
12 Welche Auswirkungen hat die Krise auf
Nachrichten & Service
bürgerschaftliches Engagement?
16 Was ist eigentlich...?
14 Moderne Stadtgeschichte:
Mikromobilität
Städtisches Wissen
17 Veröffentlichungsüberblick
15 Jugendklimarat & Co: Vorbildliche
19 Difu-Service für Zuwender
Klimaaktivitäten für alle sichtbar
20 Difu-Informationsangebote/
21 Wer soll an die Bordsteinkante –
Impressum
Curbside Management
33 Difu aktiv
34 Neues im Difu-Inter-/Extranet
Neue Projekte
35 Difu-Presseresonanz
22 Strategien für inklusives Wohnen
22 Integration im Blick
23 Kommunale WärmeplanungEditorial
Liebe Leserin, lieber Leser,
in dieser Ausgabe begegnen Ihnen zwei „Klassiker“ des Deutschen Instituts für
Urbanistik – das OB-Barometer und das KfW-Panel. Beide Arbeiten werden jähr-
lich neu durchgeführt und liefern daher interessante empirische Vergleichsdaten.
Foto: Difu
Im Februar 2020 – also unmittelbar vor Corona in Deutschland und sicherlich
auch unter dem Eindruck der Fridays for Future Bewegung – stieg der Klimaschutz
zum TOP Thema für die Oberbürgermeisterinnen und Oberbürgermeister auf. Die
für uns spannende Frage, ob Corona das Thema Klimaschutz in den Hintergrund
drängen oder für eine zusätzliche Sensibilisierung sorgen würde, scheint in den
deutschen Städten entschieden. Die Stadtspitzen wollen ihre Stadt klimagerecht
und mit einer angepassten Mobilität in die Zukunft entwickeln.
Das Difu untersucht jährlich im Auftrag der Kreditanstalt für Wiederaufbau das
Investitionsverhalten der Kommunen. Die gute Nachricht ist, dass der kommu-
nale Investitionsrückstand trotz Corona praktisch unverändert geblieben ist. Die
schlechte Nachricht ist, dass die Kommunen mit 149 Mrd. Euro „Investitionsschul-
den“ in den anstehenden Transformationsprozess gehen.
Ende Mai ist Tilman Bracher, der Leiter des Forschungsbereichs Mobilität, nach
exakt 20 Jahren am Difu in den Ruhestand gegangen. Tilman Bracher hat sich
eine außergewöhnlich hohe Reputation in der Fachwelt, bei Verbänden und Politik
sowie bei den Medien erworben. Wir am Difu haben davon ungemein profitiert. Wir
verabschieden einen sehr geschätzten Kollegen und wünschen ihm nur das Beste,
für das, was jetzt kommt. Neue Forschungsbereichsleiterin „Mobilität“ wird Anne
Klein-Hitpaß. Wir stellen sie Ihnen in unserem nächsten Berichte-Heft vor.
Bis dahin wünsche ich Ihnen eine angenehme Lektüre von Heft 2/2021!
Ihr
Carsten Kühl
Wissenschaftlicher Direktor, Geschäftsführer
3Sonderthema
Berichte 2/2021
OB-Barometer 2021: Klimaschutz
wird für die Städte immer wichtiger
Für die Oberbürgermeister*innen der deutschen Städte bleiben trotz der Coronapandemie
Klimaschutz und Mobilität aktuell und in Zukunft die wichtigsten Themen der
kommunalpolitischen Agenda. Die Stadtentwicklung gewinnt an Bedeutung.
Das diesjährige OB-Barometer des Deutschen OBs so häufig genannt, dass sie nun das zweit-
Instituts für Urbanistik (Difu) steht im Zeichen der wichtigste aktuelle Handlungsfeld in den Kom-
Coronapandemie. So überrascht es nicht, dass bei munen sind (45 Prozent). Abstrahiert man von
der Frage nach den aktuell wichtigsten Aufgaben der Sondersituation Corona (69 Prozent), so ist es
in der Stadt die Bewältigung der Coronakrise und sogar das aktuell wichtigste kommunale Hand-
ihrer Folgen mit deutlichem Abstand am häufigs- lungsfeld. Bis einschließlich 2019 hat der kommu-
ten genannt wurde (69 Prozent). Im Gegensatz zu nale Klimaschutz nur eine untergeordnete Rolle
den übrigen Handlungsfeldern gibt es hier keine gespielt. Im Jahr 2020 hat das Politikfeld einen
Vergleichswerte zum Vorjahr, da der letzte Befra starken Bedeutungszuwachs erfahren. Die Vermu-
gungszeitraum im Januar und Februar 2020 lag, tung lag nahe, dass Klimaschutz, auch durch die
also vor der Pandemie. Ziel der auch 2021 im Demonstrationen der Fridays-for-Future-Bewe-
Januar und Februar durchgeführten Befragung gung, stärker ins Bewusstsein der politisch Ent-
ist die Ermittlung eines Gesamtbildes der aus scheidungstragenden gerückt ist. Unklar war, wie
Sicht der Stadtspitzen wichtigsten Aufgaben und nachhaltig dieser Effekt sein würde und ob „Um-
Herausforderungen für deutsche Kommunen. Be- weltthemen“ – wie schon manchmal in der Ver-
fragt werden jeweils Stadtspitzen der deutschen gangenheit – infolge anderer großer Krisen wieder
Städte mit mindestens 50.000 Einwohner*innen. auf der Prioritätenskala nach hinten rücken. Dies
Die Ergebnisse basieren auf einer repräsentativen scheint diesmal nicht so zu sein. Klimaschutz wird
telefonischen Befragung der (Ober-)Bürgermeis- sogar noch wichtiger eingeschätzt als 2020. Auch
ter*innen, die im Januar/Februar 2021 vom Mei- bei den Zukunftsthemen haben „Klima, Energie,
nungsforschungsinstitut infratest dimap durchge- Nachhaltigkeit“ (53 Prozent) ihre Spitzenposition
führt wurde. vor Mobilität (50 Prozent) und Digitalisierung (37
Prozent) behauptet. Urbane Mobilitätskonzepte
In diesem Jahr ist es besonders spannend einen sind heute überwiegend Verkehrskonzepte, die
Blick auf die übrigen Handlungsfelder und ihre den motorisierten Individualverkehr eindämmen
Entwicklung in den letzten Jahren zu werfen: Die sollen. Sie sollen CO2- und Feinstaubbelastun-
Themen unter der Überschrift „Klima, Energie, gen reduzieren und sind somit konstituierender
Nachhaltigkeit“ haben in 2021 noch einmal an Be- Bestandteil einer kommunalen Umwelt- und Kli-
deutung gewonnen. Sie werden von den befragten maschutzpolitik. Dass Klimaschutz und Mobilität
Fotos: Difu
Prof. Dr. Carsten Kühl
+49 30 39001-214
kuehl@difu.de
Dr.
Beate Hollbach-Grömig
+49 30 39001-293
hollbach-groemig@difu.de
4Sonderthema
Berichte 2/2021
sowohl bei den aktuellen wie auch den künftig einen ohnehin stattfindenden Veränderungspro-
wichtigen Themen Spitzenpositionen einnehmen, zess forciert. Die Innenstädte stehen damit vor
unterstreicht den großen Stellenwert, den die einem gewaltigen Umbruch. Das empfinden die
Stadtspitzen heute ökologischen Fragen ein- Oberbürgermeister*innen insofern als eine große
räumen. Digitalisierung hat dagegen durch die Herausforderung.
Anforderungen und Veränderungen in der Coron-
apandemie nicht noch einmal einen Bedeutungs- Im Januar und Februar 2021 schien bei den Ober-
gewinn auf der kommunalen Ebene erfahren. bürgermeister*innen zumindest eine Hoffnung zu
bestehen, dass das Thema Corona in der Kom-
Smart City, Wohnungsbau und Finanzen sind munalpolitik bald wieder der Vergangenheit an-
„alte Bekannte“ bei den wichtigsten aktuellen gehören wird. Während mehr als zwei Drittel aller
Handlungsfeldern, dies gilt auch für kommunal- Stadtspitzen Coronamaßnahmen und Corona-
politische Themen mit zunehmender Bedeutung. folgen als aktuell wichtiges Handlungsfeld be-
Sie bleiben in der Rangfolge in etwa unverändert. nannten, rangiert das Thema Corona unter den
Dass die Finanzlage der Kommunen keine stär- zukünftig wichtigen Handlungsfeldern nur auf
kere Ausprägung aufweist, mag überraschen, da dem vorletzten Platz. Nur wenig verändert haben
die Kommunen coronabedingt extreme Ausfälle sich die Wünsche der Stadtspitzen im Hinblick
bei den Steuereinnahmen zu verzeichnen hatten. auf die Handlungsfelder, in denen sie bessere
Die fiskalischen Kompensationsmaßnahmen des Rahmenbedingungen durch Länder, Bund oder
Bundes und der Länder haben vermutlich dazu EU wünschen: An Bedeutung gewonnen hat der
beigetragen, dass die Kommunen aktuell und zu- Wunsch nach Unterstützung im Handlungsfeld
künftig ihre Finanzlage in etwa so einschätzen wie Digitalisierung (71 Prozent). Dies ist vermutlich in
in den beiden Jahren zuvor. erheblichen Teilen zurückzuführen auf die in der
Coronapandemie deutlich gewordenen Engpässe
Bemerkenswert ist hingegen der starke Bedeu- – beispielsweise in der Datenübermittlung von
tungszuwachs des Themas Innenstadtentwicklung Gesundheitsämtern, der Möglichkeit von Verwal-
bei den aktuellen ebenso wie bei den zukünftigen tungsbeschäftigten, im Homeoffice zu arbeiten,
Herausforderungen. Eine Erklärung liefern die oder in der digitalen Infrastrukturausstattung von
Antworten auf die Frage nach den Herausforde- Schulen. Es folgen die Handlungsfelder Finanzen,
rungen der Coronapandemie. Existenzgefähr- Wohnungspolitik und Verkehr, in denen sich die
dung von Handel, Gastronomie und Kulturszene Gewichtungen nur graduell verschoben haben.
rangieren ebenso wie die Verödung der Innen- Im Vergleich der Antworten der Stadtspitzen
städte ganz weit oben. Die Innenstädte stehen in aus den letzten Jahren ist eine Kontinuität in den
Coronazeiten für wirtschaftliche Existenzgefähr- „großen Linien“ der Kommunalpolitik – und den
dung von Gastronomie und Einzelhandel, leere gewünschten Verbesserungen der Rahmenbedin-
Alle Details Innenstädte verlieren ihre Aufenthaltsqualität. gungen für die Arbeit vor Ort – festzustellen.
Das „erzwungene Experiment“ der Digitalisierung
www.difu.de/16644 durch Corona – insbesondere die massive Zu-
www.difu.de/12580 nahme von Onlinehandel und Homeoffice – hat
5Forschung & Publikationen
Berichte 2/2021
Ausweitung kommunaler
Wohnungsbestände
In vielen Städten steht die Wohnungsfrage ganz oben auf der Agenda. Damit gewinnen die
kommunalen Wohnungsunternehmen weiter an Bedeutung – als Bestandshalter und bei
der Umsetzung von Neubauvorhaben.
Foto: Ricarda Pätzold/Difu
Wohnen ist ein Grundbedürfnis und eine Woh- und Ankauf als wohnungspolitische Strategie“
nung die Voraussetzung für Teilhabe am sozialen ging das Deutsche Institut für Urbanistik gleich
und gesellschaftlichen Leben. In den wachstums- mehreren Fragen nach: Unter welchen Rahmen-
starken, dynamischen Regionen Deutschlands bedingungen werden kommunale Wohnungen
gehören Wohnungsmarktengpässe und Preisstei- gebaut? Wie laufen die Abstimmungsprozesse zu
gerungen schon seit Jahren zum Alltag. Dagegen Zielen und Strategien und wer sind die Zielgrup
hilft – so ist allerorten zu hören – vor allem der pen der Unternehmen? 20 Fallstudienstädte
Neubau von bezahlbaren sowie gebundenen wurden dabei von 2017 bis 2020 in den Fokus
Wohnungen. Diese Aufgabe wird unter anderem genommen – gefördert im Rahmen des Experi-
von den kommunalen Wohnungsunternehmen mentellen Wohnungs- und Städtebaus (ExWoSt).
umgesetzt. Die Schnittstelle „Liegenschaften“ zwischen Stadt
und Wohnungsunternehmen spielt eine zentrale
In Deutschland befinden sich rund 2,3 Millio- Rolle - und so ist die Baulandbereitstellung die
nen Wohnungen oder zehn Prozent des Miet- häufigste Form der Unterstützung der Ausweitung
wohnungsbestandes in kommunaler Hand. kommunaler Wohnungsbestände. Allerdings sind
Sicherlich würden viele Kommunen die Aussage städtische Flächen ein knappes Gut. Ein weiterer
von Elisabeth Merk, Stadtbaurätin der Landes- wesentlicher Motor ist die soziale Wohnraumför-
www.difu.de/11693 hauptstadt München, unterstreichen: „Städtische derung, die von den kommunalen Unternehmen
BBSR-Umfrage zu Kommu- Wohnungsbaugesellschaften sind ein Regulativ genutzt wird. Allerdings betonen diese die Be-
nalen Wohnungsbeständen: für den Wohnungsmarkt und ein Garant für lang- deutung von gemischten Beständen und Neu-
www.bit.ly/3vlZaR9 fristig bezahlbaren Wohnraum.“ Doch lag der bauquartieren, um Stigmatisierungsprozessen
kommunale Wohnungsneubau viele Jahre brach. vorzubeugen.
Selbst in München, wo bereits vor zehn Jahren ein
akuter Wohnungsmangel diagnostiziert wurde, Die Dimension der kommunalen Wohnungen ist
Dipl.-Ing. stellten die kommunalen Wohnungsunternehmen oft historisch bedingt. Nicht jede Stadt hat ein
Ricarda Pätzold GEWOFAG und GWG im Jahr 2009 lediglich 400 Wohnungsunternehmen in der Größe, in der sie
+49 30 39001-190
Wohnungen fertig – 2019 waren es wieder 1.500 es bräuchte. Selbst wenn jetzt der Wohnungsbau
paetzold@difu.de
Wohnungen. forciert wird, ändert sich diese Situation nicht
Dr. Thomas Franke schnell genug. Die Versorgung mit bezahlbarem
+49 30 39001-107 Im Forschungsprojekt „Ausweitung des kom- Wohnraum bleibt damit vorerst eine Aufgabe brei-
franke@difu.de munalen Wohnungsbestands durch Neubau ter „Schichten“ der Wohnungswirtschaft.
6Forschung & Publikationen
Berichte 2/2021
Wie kann Wohnen im Umland Vorteile
für Stadt und Land bringen?
Für das Verbändebündnis Wohnungsbau hat das Deutsche Institut für Urbanistik (Difu)
ermittelt, wie Kommunen in Stadtregionen die Wohnungsmärkte der Kernstädte entlasten
können und unter welchen Rahmenbedingungen diese Entwicklung forciert werden sollte.
Im Fokus der Difu-Studie stehen die Potenziale
der Pendler-Verflechtungsräume von Großstädten.
Sie sind die traditionellen Zielorte der Suburbani-
sierung und meist durch Neubau von Ein- und
Zweifamilienhäusern geprägt. Im Unterschied
dazu sollte der „Entlastungswohnungsbau“ einen
Beitrag zu lebendigen Quartieren und Stadtteilen
leisten. Auch geht es darum, zusätzlichen Pendler-
verkehr nicht durch motorisierten Individualver-
kehr zu bewältigen, sondern nur durch einen Aus-
bau des ÖPNV und weiterer Verkehrsträger des
Umweltverbunds – wie beispielsweise einer guten
Infrastruktur für den Radverkehr. Voraussetzung
dafür ist die gute Erreichbarkeit der Standorte mit
dem Umweltverbund, angemessene Dichten und
vielfältige Wohnangebote, die unterschiedliche
Zielgruppen ansprechen. Zudem soll der Neubau
lokale Stadtqualitäten aufnehmen bzw. weiter-
entwickeln, um dezidiert die weitere Verstärkung
des „Donut-Effekts“ – d.h. ein Ausbluten der Zen-
tren – zu vermeiden. Insgesamt kann so für eine
Stadt-Umland-Region ein Mehrwert – auch für die
bereits ansässige Bevölkerung – erreicht werden.
Die Anspannung der städtischen Wohnungs-
märkte führte bereits vor 2020 zu verstärkten
Wanderungsverlusten – insbesondere Familien
Grafik: Ricarda Pätzold/Difu
verließen die Kernstädte in Richtung Umland.
Im Saldo wuchsen die Städte vor allem durch
die Außenzuwanderung. Die Stadtregion leistete
damit bereits einen Beitrag zur Entlastung, aller-
dings wirkte sich dies nicht preisdämpfend auf die
städtischen Wohnungsmärkte aus. Als zentrale
Stellschraube für „Post-Corona“-Wohnstandort-
entscheidungen wird – neben dem Dauerbrenner den ÖPNV bedeutet die Nachfrageentwicklung
Wohnkosten – die Veränderung der Arbeitswelt in der Pandemie einen Trendbruch nach einem
durch Homeoffice-Möglichkeiten diskutiert. Wenn jahrelangen kontinuierlichen Wachstum. Dass der
der Weg zum Arbeitsplatz ins Zentrum seltener ÖPNV das Potenzial hat, Mobilität mit weniger
notwendig ist, steigt die Entfernungstoleranz der Flächeninanspruchnahme, weniger Schadstoff-
www.difu.de/16617 Pendler*innen an. Ein positiver Effekt könnte in emissionen und weniger Ressourceneinsatz zu
der intensiveren Nutzung der Angebote des jewei- gewährleisten und darüber hinaus eine wichtige
ligen Wohnumfelds bestehen. Bisher kaum the- Aufgabe der Daseinsvorsorge erfüllt, wird durch
matisiert wird indes, dass eine Verstetigung von die Pandemie sachlich nicht in Frage gestellt.
Dr. phil. Jürgen Gies Homeoffice neue Anforderungen an Wohnungen Allerdings ist es vermutlich noch schwerer gewor-
+49 30 39001-240
im Hinblick auf Arbeitsräume stellt. den, Menschen von der Nutzung des ÖPNV zu
gies@difu.de
überzeugen. Verlässliche Angebote, die Vermei-
Dipl.-Ing. Aber auch wenn die Arbeit im Homeoffice zu- dung überfüllter Verkehrsmittel und Tarifangebote
Ricarda Pätzold nimmt und dadurch die Zahl der Pendler*innen für eine veränderte Arbeitswelt sind für einen als
+49 30 39001-190 sinkt: Viele Berufe erfordern eine Präsenz vor Ort attraktiv wahrgenommenen ÖPNV mehr denn je
paetzold@difu.de und Mobilität bleibt von zentraler Bedeutung. Für notwendig.
7Forschung & Publikationen
Berichte 2/2021
KfW-Kommunalpanel 2021: Keine
Entwarnung für die Kommunalfinanzen
Die Entwicklung der kommunalen Finanzlage bleibt offen. Der Investitionsrückstand der
Kommunen steigt nur leicht auf 149 Mrd. Euro. Unterstützungsmaßnahmen sind aus Sicht
der Kommunen unerlässlich, um die Handlungsfähigkeit der Kommunen zu sichern.
Die deutschen Kommunen sind in finanzieller Der von Kommunen wahrgenommene Investi-
Hinsicht bislang glimpflicher durch die Krise ge- tionsrückstand ist für das Befragungsjahr 2020
kommen als erwartet. So konnten sie das Haus- auf insgesamt rund 149 Mrd. Euro gestiegen
haltsjahr 2020 – dank der Hilfsmaßnahmen von (2019: 147 Mrd. Euro). Nach wie vor besteht der
Bund und Ländern – sogar mit einem kleinen größte Investitionsbedarf bei Schulgebäuden
Überschuss abschließen. Für eine Entwarnung (46,5 Mrd. Euro), Straßen (33,6 Mrd. Euro) und
ist es aber noch zu früh, wie die Ergebnisse des Verwaltungsgebäuden (16,4 Mrd. Euro). Die Inves-
KfW-Kommunalpanel 2021 verdeutlichen, das titionen in die verschiedenen Infrastrukturbereiche
das Deutsche Institut für Urbanistik (Difu) durch- finanzieren die Kommunen zu etwas mehr als
geführt hat. Denn die Bewertung der Finanzlage einem Drittel aus Eigenmitteln (36 Prozent). Diese
durch die befragten Kämmereien hat sich massiv geraten durch die Krise besonders unter Druck.
verschlechtert, vor allem mit Blick auf das lau- Finanzausgleichzuweisungen (16 Prozent) und
fende Jahr 2021 und darüber hinaus. 85 Prozent Fördermittel (20 Prozent) sind weitere wichtige
der Städte, Kreise und Gemeinden erwarten kri- Finanzierungsquellen, wobei auch hier noch nicht
senbedingt geringere Einnahmen. 52 Prozent der klar ist, welche mittelfristigen Auswirkungen die
Kommunen sehen perspektivisch höhere Ausga- Krise haben wird. Zudem geben 55 Prozent der
ben auf sich zukommen. Die positive Nachricht: Kämmereien an, dass sie bald stärker auf Kredite
Investitionen und Investitionsplanungen der Kom- zurückgreifen werden. Dies deutet auf einen künf-
munen sind durch die Krise bisher noch kaum tigen Aufwuchs der Kommunalverschuldung hin.
betroffen. In der Planung für 2021 rechnen die
Kommunen sogar mit einem neuen Investitions- Um die Handlungsfähigkeit der Kommunen wei-
höchststand von rund 39,2 Mrd. Euro. Der Grund terhin zu bewahren, halten die Kämmereien in
dafür liegt in den langen Vorlaufzeiten für öffentli- der kurzfristigen Perspektive insbesondere die
che Investitionen. Allerdings gehen 57 Prozent der Kompensation von Steuereinnahmeausfällen, wie
Kommunen davon aus, dass sie ihre Investitionen schon 2020 durch den Bund erfolgt, für hilfreich.
kürzen müssen, wenn die Einnahmen auch in die- Perspektivisch gewinnen aber strukturelle Anpas-
sem Jahr wegbrechen. sungen in der Finanzmittelverteilung zwischen
den föderalen Ebenen eine höhere Bedeutung.
In der Einzeldarstellung der
Infrastrukturbereiche sind
jene mit sehr geringen An-
teilen ausgeblendet. In der
Gesamtsumme sind sie
enthalten.
www.difu.de/16614
Christian Raffer, M.Sc
+49 30 39001-198
raffer@difu.de
Dr. Henrik Scheller
+49 30 39001-295
scheller@difu.de
8Forschung & Publikationen
Berichte 2/2021
Erster nationaler Fortschrittsbericht
zur New Urban Agenda erschienen
Das Difu hat im Auftrag des Bundesinstituts für Bau, Stadt- und Raumforschung und des
Bundesministeriums des Inneren, für Bau und Heimat den ersten nationalen Fortschritts-
bericht zur Umsetzung der New Urban Agenda erstellt und an die UN übermittelt
Städte gelten als Brennglas für Nachhaltigkeits- kommunale Strukturen und Voraussetzungen,
herausforderungen: Sie nehmen nur etwa zwei die oftmals sektoral und durch mangelnde Res-
Prozent der globalen Fläche ein, tragen jedoch sourcen geprägt sind. Größere und wachsende
zu ~ 70 Prozent des Bruttoinlandprodukts, des Kommunen haben grundsätzlich bessere Voraus-
Energieverbrauchs, der Treibhausgasemissionen setzungen, um ein Nachhaltigkeitsmanagement
und des Abfallaufkommens bei. Deutschland und -monitoring vor Ort zu etablieren. Im Zuge
stellt hier mit seinem überdurchschnittlich hohen des Projekts wurde aber auch deutlich, dass selbst
Urbanisierungsgrad von inzwischen mehr als 75 viele kleinere Kommunen über den politischen
Prozent keine Ausnahme dar. Für die Vereinten Willen, engagierte Verwaltungsmitarbeiter*innen
Nationen war das Anlass genug, um 2016 auf der und den Rückhalt lokaler Initiativen verfügen, um
Habitat-III-Konferenz der UN eine gemeinsame Vi- ihre drängendsten Nachhaltigkeitsherausforde-
sion zur nachhaltigen Stadtentwicklung zu verab- rungen aktiv anzugehen.
schieden. Damit Urbanisierung nicht nur mit ihren
negativen Folgewirkungen in Verbindung gebracht
wird, sondern als starkes Instrument für nachhal-
tige Entwicklung aktiv genutzt wird, stellt die New
Urban Agenda mit ihren 175 Paragraphen den
Fahrplan für nachhaltige Stadtentwicklung dar.
Eben jene Entwicklung soll im Rahmen eines Mo-
nitorings alle vier Jahre überprüft werden. Somit
wurde im gleichnamigen Difu-Projekt von 2019
bis 2021 der erste Fortschrittsbericht auf natio-
naler Ebene erstellt. Da die New Urban Agenda
keinen eigenen Überprüfungsmechanismus ent-
hält, jedoch über vielfältige Anknüpfungspunkte
mit den nachhaltigen Entwicklungszielen (SDGs)
verfügt – insbesondere SDG 11 „Nachhaltige
Städte und Gemeinden“ –, wurde methodisch ein
an die Anforderungen der New Urban Agenda
angepasstes SDG-Monitoring angewendet und Das Monitoring als erster Schritt für dieses En-
anschließend zusammen mit insgesamt neun gagement weist einen sehr unterschiedlichen Ent-
Partnerkommunen erprobt. Hierbei standen die wicklungsstand auf. Während Mobilitätsdaten in
Schwerpunkte Klimaschutz und Klimaanpas- der Regel gut verfügbar sind und die teils beschei-
sung sowie Mobilität im Stadt-Umland-Kontext denen Fortschritte aufzeigen, werden Klimabilan-
– jeweils ergänzt um das wichtige Querschnitts- zierungen, statistische Auswertungen zu erneuer-
www.difu.de/16642 thema Digitalisierung – im Vordergrund der baren Energien und Projektevaluationen eher
Untersuchungen. seltener durchgeführt – und das, obwohl ver-
fügbare Daten und Umfragewerte auf ein sehr
Im Ergebnis zeigt sich, dass in Deutschland auf hohes Aktivitätsniveau hindeuten. Oftmals werden
Oliver Peters, M.Sc. allen Ebenen vielfältige Anstrengungen unter- Maßnahmen, gerade im Bereich Klimaanpassung,
+49 30 39001-204 nommen werden, um die Rahmenbedingungen in verschiedenen Stellen der Verwaltung umge-
opeters@difu.de für Nachhaltigkeit in Städten und Gemeinden zu setzt und nicht unter dem Dach der nachhaltigen
stärken. Mit dem interministeriellen Arbeitskreis Entwicklung subsumiert. Grundsätzlich besteht
Dr. Jasmin Jossin
für nachhaltige Stadtentwicklung, den Nachhal- im Bereich des Nachhaltigkeitsmonitorings also
+49 30 39001-200
jossin@difu.de
tigkeitsstrategien der Länder und Initiativen auf noch viel Verbesserungspotenzial, um auf dieser
kommunaler Ebene, wie der Musterresolution Grundlage ein wirkungsorientiertes Nachhaltig-
Dr. Henrik Scheller zur Agenda 2030, werden die diversen Aktivi- keitsmanagement aufzubauen oder mancherorts
+49 30 39001-295 täten im Nachhaltigkeitsbereich sichtbar. Diese auch erst das notwendige Bewusstsein für nach-
scheller@difu.de Bemühungen treffen jedoch auf unterschiedliche haltige Stadtentwicklung zu schaffen.
9Forschung & Publikationen
Berichte 2/2021
Forschungsimpulse für eine
nachhaltige Stadt
Neue Broschüre informiert über Leitbilder und Visionen aus der Zukunftsstadtforschung,
dokumentiert methodische Vorgehensweisen und zeigt praktische Handlungswege für
Kommunen zu ganz unterschiedlichen thematischen Schwerpunkten.
Das Generieren von Forschungswissen für die der Kommunikation der Ergebnisse in die (Fach-)
Transformation zu einer nachhaltigen Stadtent- Öffentlichkeit richtet SynVer*Z sein Augenmerk
wicklung mit lebenswerten Quartieren ist das Ziel auch auf die im Rahmen der BMBF-Forschung
der Zukunftsstadt-Forschung des Bundesminis- zur Zukunftsstadt ausgehenden Auswirkungen.
teriums für Bildung und Forschung (BMBF). Die Es geht also um die Frage, welche Anstöße von
Umsetzung erfolgt in zahlreichen Projekten im der Forschung für die städtische Praxis ausgehen
Rahmen der Forschung für Nachhaltige Entwick- und wie positive Entwicklungen verstärkt werden
lung (FONA). Gemeinsam wurden unter diesem können.
Dach seit 2016 von Wissenschaft, Kommunal-
politik und Verwaltungspraxis, Zivilgesellschaft Eine im Rahmen der Projektarbeit im März 2021
und Wirtschaft rund 50 transdisziplinäre Projekte herausgegebene Broschüre dokumentiert einen
gestartet. Thematisch geht es dabei um ein weites Zwischenstand der Zukunftsstadtforschung. Sie
nachhaltiges Themenspektrum: um Klimaanpas- präsentiert exemplarisch entlang der geförderten
sung und urbane Resilienz, um Grünflächen und Projekte die verschiedenen Leitbilder und Visio-
Freiräume, urbane Mobilität und Logistik, sozialen nen der Zukunftsstadt-Forschung, dokumentiert
Zusammenhalt und Teilhabe, urbane Produktion methodische Vorgehensweisen und zeigt mög-
sowie städtische Infrastrukturen in der Zukunfts- liche Handlungswege in ganz unterschiedlichen
stadt. So vielfältig die Themen, so verschieden thematischen Schwerpunkten. Die kostenlose und
www.difu.de/11588
www.bit.ly/3v6HpWk (PDF) sind auch die Modelle urbaner Transformation. illustrativ bebilderte Broschüre eröffnet der inte-
Gemeinsam ist jedoch allen Projekten ihr experi- ressierten Leserschaft vielfältige Möglichkeiten
Printexemplar kostenfrei via mentelles Vorgehen. Hier spielt in vielen Projekten der fachlichen Vertiefung. Darüber hinaus werden
krebs@difu.de bestellbar das Forschungsformat des Reallabors eine beson- zahlreiche Verweise auf die Veröffentlichungen
dere Rolle. einzelner Projekte gegeben. So können weitere
Kommunen sich von dem in der Broschüre doku-
Das Synthese- und Vernetzungsprojekt Zukunfts- mentierten Erfahrungswissen anregen lassen und
Dr. Jens Libbe
stadt (SynVer*Z), gemeinsam getragen vom davon profitieren.
+49 30 39001-115
libbe@difu.de
Deutschen Institut für Urbanistik (Difu), dem ISOE
– Institut für sozial-ökologische Forschung sowie
Robert Riechel Gröschel Branding, begleitet seit einigen Jahren
+49 30 39001-211 all diese Aktivitäten. Neben der Vernetzung, Syn-
riechel@difu.de these des Forschungswissens zum Thema sowie
10Forschung & Publikationen
Berichte 2/2021
Zukunftsszenarien für Infrastrukturen
der öffentlichen Daseinsvorsorge
Neue Veröffentlichung von Difu und FiFo mit der Stadt Köln zeigt anhand szenariobasierter
Betrachtungen, wie mögliche Risiken, Wechselwirkungen und Chancen in kommunale
Planungs- und Entscheidungsprozesse integriert werden können.
Schon lange beschäftigen sich die Difu-Wissen- einer sozial-ökologischen Transformation zu er-
schaftler*innen mit der Abschätzung des langfris- wartenden finanziellen Auswirkungen im Modell
tigen kommunalen Infrastruktur- und Investitions- abbilden lassen. Im Vergleich zu einem „Weiter wie
bedarfs. Mittlerweile hat die dadurch entfachte bisher“ lassen sich daraus, trotz der erforderlichen
Diskussion sowohl über den Nachholbedarf als Vereinfachungen im Modell, wichtige Erkennt-
auch den Investitionsstau den Blick auf die Wech- nisse für den strategischen Diskurs gewinnen –,
selwirkungen zwischen kommunaler Infrastruktur und dies ohne großen Aufwand und zeitliche
und generationengerechter Finanzierung öffentli- Verzögerungen.
cher Aufgabenwahrnehmung gelenkt. Neben der
Diagnose für Deutschland insgesamt – beispiels- Darüber hinaus wurden die Auswirkungen eines
weise im Rahmen des KfW-Kommunalpanels – inklusiven Wachstums für die Tragfähigkeit des
hat das Difu zusammen mit der Stadt Köln und kommunalen Haushalts untersucht und die bisher
dem Finanzwissenschaftlichen Forschungsins- im Kölner Tragfähigkeitskonzept noch nicht spezi-
titut der Universität zu Köln (FiFo) ein spezielles fisch ausgewiesene Konnexitätslücke szenarioba-
Instrumentarium entwickelt. Damit sind eine ver- siert abgeleitet.
gleichsweise differenzierte Schätzung des Inves-
titionsbedarfs und eine Analyse der damit zusam- Durch eine enge Einbindung der Mitarbeiter*in-
menhängenden Tragfähigkeit des kommunalen nen der Kämmerei wurden in Köln die Voraus-
Haushalts für einzelne Städte möglich. setzungen dafür geschaffen, zukünftig weitere
Szenarien analysieren zu können. Dadurch wird es
Vor dem Hintergrund der lokalen Auswirkungen möglich, Themen aufzugreifen, die in der Stadtge-
von Megatrends – wie dem Klimawandel, der Digi- sellschaft oder im politisch-administrativen Kon-
talisierung und demographischen Veränderungen, text diskutiert werden. Es war erklärtes Ziel der
beispielsweise durch Migrationsprozesse – steigt
die Bedeutung einer vorausschauenden Daseins-
vorsorge- und Infrastrukturplanung jedoch weiter
an. Um den Risiken und Wechselwirkungen, aber
auch den Chancen dieser Trends trotz bestehen-
der Haushaltsrestriktionen mit einem politischen
Gestaltungsanspruch proaktiv und strategisch
begegnen zu können, muss das entwickelte Ins-
trumentarium in kommunale Planungs- und Ent-
scheidungsprozesse integriert werden. Auf diese
Foto: Martin Randelhoff, Qimby
Weise kann auch ein fach- und periodenübergrei-
fender Diskurs unterstützt werden.
Aufbauend auf den Erkenntnissen und Erfahrun-
gen aus der gemeinsamen Arbeit mit der Stadt
Köln, haben das Difu und das FiFo nun anhand
von szenariobasierten Betrachtungen gezeigt, wie
eine solche Einbindung in zukünftige Strategiedis-
kurse aussehen könnte. Projektpartner*innen, die Erkenntnisse und Erfah-
rungen sowie die einer langfristigen und genera-
Ein Schwerpunkt war dabei die Abschätzung tionengerechten Infrastruktur- und Finanzplanung
www.difu.de/16405
des Infrastruktur- und Investitionsbedarfs in Ab- zugrundeliegende Philosophie auch dem breiteren
hängigkeit von unterschiedlichen strategischen (Fach-)Publikum zugänglich zu machen. Die Pub-
Gestaltungsoptionen. Ausgehend von der Vision likation der kostenfrei zugänglichen Studien-
Dr. Stefan Schneider des Umweltbundesamtes „Die Stadt für Mor- ergebnisse kann daher auch für andere Kommu-
+49 30 39001-261 gen“ wurde anhand zweier Beispielszenarien im nen als wichtige Informationsgrundlage dienen.
schneider@difu.de Bereich Mobilität dargestellt, wie sich die bei
11Forschung & Publikationen
Berichte 2/2021
Welche Auswirkungen hat die Krise
auf bürgerschaftliches Engagement?
Eine empirische Untersuchung am Beispiel der Stadt Speyer verdeutlicht den großen
Wertschöpfungsanteil ehrenamtlicher Arbeit in Zeiten der Coronapandemie. Die
Veröffentlichung stellt exemplarisch Aktivitäten in der Stadt Speyer dar.
Bürgerschaftliches Engagement ist in Deutsch- einem Viertel des Jahreshaushalts. Rund zwei
land weit verbreitet und in nahezu allen Lebens- Drittel der befragten Institutionen gaben an, dass
bereichen anzutreffen. Allein im Bereich „Sport“ sich ihre Tätigkeiten qualitativ und/oder quanti-
sind rund 88.000 Vereine registriert. Zwischen tativ unter dem Einfluss der Pandemie verändert
zwanzig und vierzig Prozent der Bevölkerung haben. So summierte sich der pandemiebedingte
sind bürgerschaftlich engagiert. In einer empiri- Wertschöpfungsrückgang auf rund 30 Prozent.
schen Untersuchung wurden neben dem Bereich Dieser wäre noch höher, wenn darin auch das
Arbeitsvolumen berücksicht wäre, das anfiel, um
die Tätigkeiten „pandemiesicher“ zu gestalten.
Aufgrund dieser Herausforderungen und dem von
den Einrichtungen – zumindest für eine begrenzte
Zeit – erlebten personellen Aderlass, liegt die
Frage nach der Unterstützung des Staates und
der kommunalen Verwaltung nahe.
Seitens der Stadtwerke, deren Gesellschafterin
zu 100 Prozent die Stadt ist, wurden vier einzelne
Projekte durch eine kleine Summe gefördert. Zwei
weitere Programme werden vom Land finanziert
und von der Stadt verantwortet.
Für das Projekt „Speyer hält zusammen“ – wel-
ches nicht ausschließlich gemeinnützigen Or-
ganisationen zu Gute kommt – wurden im Un-
tersuchungszeitraum 20 Prozent der vom Land
„Sport“ auch Einrichtungen betrachtet, die im bereitgestellten Mittel eingesetzt. In Zahlen aus-
Bereich „Soziales“ tätig sind sowie politische gedrückt bedeutet dies, dass 25 Euro je Bürger*in
Parteien. Bürgerschaftliches Engagement ist ein zur Verfügung standen, von denen bisher fünf
stets präsentes und nahezu alle Lebensbereiche Euro seitens der Stadt angeboten wurden und
betreffendes Thema, gerade auch während der rund zwei Euro für das ehrenamtliche Engage-
Pandemie. Denn die Pandemiefolgen führen zu ment verwendet wurden.
großen Einschnitten im gesellschaftlichen Leben
und können durch „Lockdowns“ weitere Probleme Das Projekt „Schutzschild für Vereine in Not“ war
und Erschwernisse hervorrufen. Daher war es von bisher für Speyer ohne praktische Relevanz, denn
Interesse zu untersuchen, ob die Coronapandemie diese Fördermittel werden nur dann ausgezahlt,
auch das bürgerschaftliche Engagement in ver- wenn Vereine wegen der Pandemie in Existenznot
schiedenen Dimensionen beeinflusst und was die geraten – was bisher nicht der Fall war.
Menschen zu ihrem Engagement bewegt. In einer
für die Deutsche Universität für Verwaltungswis- Als Musterbeispiel mit Modellcharakter kann das
senschaften verfassten und gemeinsam mit dem durch das DRK betriebene „Abstrichzentrum“
Difu veröffentlichten Arbeit wurden öffentliche gelten, das maßgeblich von Ehrenamtlichen und
www.difu.de/16657 Hilfsprogramme und ein ehrenamtlich betriebenes Vereinen organisiert und auch betrieben wurde.
Abstrichzentrum der Gebietskörperschaft Speyer
untersucht. Zudem wurden ehrenamtlich tätige Organisatorische Unterstützung gewährten die
Institutionen und Bürger*innen befragt. Stadt und das Praxisnetz Vorderpfalz. Vorbildlich
Florian Harz, M.A.
floharz@web.de
war diesbezüglich auch das Zusammenwirken der
Die Wertschöpfung freiwillig erbrachter Leistun- verschiedenen Beteiligten. Im Untersuchungszeit-
Prof. Dr. Carsten Kühl gen wurde vor der Pandemie in der 50.000-Ein- raum wurden hier ehrenamtlich Arbeitsstunden im
+49 30 39001-214 wohner*innen-Kommune mit rund 33,5 bis 41 Gegenwert von rund 200.000 Euro geleistet.
kuehl@difu.de Millionen Euro beziffert und entsprach damit
12Forschung & Publikationen
Berichte 2/2021
Moderne Stadtgeschichte:
Städtisches Wissen
Die neue Ausgabe der vom Difu vertriebenen Zeitschrift „Moderne Stadtgeschichte – MSG“
beleuchtet verschiedene Wissensbestände und -formen, die in Städten entstanden, aber
auch das alltägliche Wissen der Stadtbewohner*innen.
„Städtisches Wissen“ ist der Schwerpunkt des im und Dieter Schott (Antwerpen/Darmstadt) befasst.
Sommer erscheinenden Themenhefts 1/2021 der Sie konstatieren eine Pluralisierung von lokalem
Modernen Stadtgeschichte (MSG). Die Heraus- Geschichtswissen, das vor allem in der kritischen
geber, Martina Heßler (Darmstadt) und Clemens Auseinandersetzung mit der bis dahin wenig be-
Zimmermann (Saarbrücken), richten den Blick achteten lokalen NS-Geschichte und der Indus
darauf, wie Wissen in spezifisch lokalen Kontexten triekultur entstand. Ajit Singh und Kathrin Meißner
produziert, vermittelt und praktiziert wurde. An- (Berlin) zeigen am Beispiel des Dragoner-Areals
gesprochen sind damit verschiedene Formen und in Berlin, wie das Wissen um die wechselvolle
Bestände von Wissen, die in einer Stadt entstan- Geschichte des Ortes in die stadtplanerischen
den, vor allem aber auch das alltägliche Wissen Debatten über die Konversion des ehemaligen
der Stadtbewohner*innen. Insbesondere befasst Kasernengeländes einfloss. Ihr Beitrag lenkt damit
sich das Themenheft mit gesellschaftlichem, den Blick auch auf die Rolle partizipativen Wissens
stadtplanerischem und historischem Wissen, das in der Gegenwart. Auch der Beitrag von Jonas
in Städten über die jeweiligen Städte entstand. van der Straeten und Mariya Petrowa (Darmstadt)
geht der Frage nach der Bedeutung von lokalem
In einem ersten Beitrag untersucht Clemens Wissen für den Städtebau nach. Ihre Untersu-
Zimmermann (Saarbrücken) die Entstehung der chung zeigt, wie relevant lokale Wissensformen in
bis heute einflussreichen ethnographischen und usbekischen Städten selbst auf dem Höhepunkt
sozialwissenschaftlichen Studien von Friedrich zentralisierter sowjetischer Wohnungsbaupoli-
Engels über Manchester (1845) sowie den Re- tik waren. Die abschließende Leitrezension von
ports von Henry Mayhew (1861/62) und Charles Christiane Reinecke (Leipzig) nimmt die zentralen
Booth (1889-1897) über London. Dabei zeigt er, Aspekte des Themenheftes wieder auf.
wie subjektive Beobachtungen und erzählerische
Beschreibungen mit Kartierungen und der Erstel- Clemens Zimmermann (Saarbrücken) gibt im
lung von Statistiken einhergingen. Der Beitrag von Forumsteil einen Überblick über den Stand der In-
Katrin Minner (Siegen) wendet sich der Funktion dustriestadtforschung und Jörg Oberste (Regens-
kommunaler Archive für die Produktion und Ver- burg) stellt in der Rubrik das Konzept vormoderner
www.difu.de/publikationen breitung von Wissen über die eigene Stadtge- Metropolität vor. Ergänzt werden die Beiträge
Erscheint in Kürze.
schichte zu. Minner zeichnet nach, wie sich die durch Berichte über Tagungen zu sogenannten
Archive im Laufe des 20. Jahrhunderts von einem „Arrival Neighborhoods“, zu „Histories and Le-
Reservoir an Herrschaftswissen zu einem Ort gacies of Industrial Cities“, zu „20th Century
Prof. Dr. entwickelten, der vielfältigen Nutzungsinteressen European Urbanism“ und über einen Workshop
Christoph Bernhardt offen steht. In diesem Kontext entstanden in den zu „Sozialdaten und Geschichtsschreibung von
christoph.bernhardt@ 1980er-Jahren auch Geschichtswerkstätten, mit Wohneigentum und Sozialräumen“.
hu-berlin.de denen sich der Beitrag von Sebastian Haumann
14Forschung & Publikationen
Berichte 2/2021
Jugendklimarat & Co: Vorbildliche
Klimaaktivitäten für alle sichtbar
Klimaschutz und Maßnahmen zur Anpassung an den Klimawandel sind vielfältig. Eine neue
Online-Publikation des Difu stellt erfolgreiche Projekte vom Strombilanzkreismodell bis
zum Einsatz einer neuen Energie-Pflanze vor. Zehn Kommunen zeigen, wie es gehen kann.
Die Städte Aalen, Geisa, Dresden, Osnabrück, Zusammenarbeit von Jugendlichen und Verwal-
München und Bremerhaven sowie der Main-Tau- tung stärkt und den Mitgliedern tiefere Einblicke
nus-Kreis, der Landkreis St. Wendel, der Rems- in kommunale Entscheidungsprozesse ermöglicht.
Murr-Kreis und der Kreis Steinfurt haben mit Mit eigenen Projekten und Initiativen kann sich der
ihren vorbildlichen Projekten beim Wettbewerb Jugendklimarat aktiv im kommunalen Klimaschutz
„Klimaaktive Kommune 2020“ gewonnen. In den und bei der Entwicklung von Anpassungsmaßnah-
Bereichen Ressourcen- und Energieeffizienz, Kli- men an die Folgen des Klimawandels einbringen.
maanpassung, Klimaaktivitäten zum Mitmachen Dies fördert das Klimaschutzbewusstsein junger
und gemeinsame Aktivitäten von Jugend und Menschen in Bremerhaven und trägt zu einer zu-
Kommune bieten sie damit vielen anderen Kom- kunftsfähigen Stadtgestaltung bei.
munen gute Ideen und Blaupausen. Nachahmen
ist ausdrücklich erwünscht. Hier eine kleine Aus- Auch in diesem Jahr konnten Städte, Landkreise
wahl der ausgezeichneten Projekte. und Gemeinden beim Wettbewerb „Klimaaktive
Kommune“ mitmachen und ihre Bewerbungen
Der Main-Taunus-Kreis in Hessen entwickelte mit bis zum 20. April 2021 einreichen. Gefragt waren
seinem Strombilanzkreismodell eine Strategie, um
überschüssige erneuerbare Energie, die in seinen
Liegenschaften produziert wird, bilanziell nicht ins
öffentliche Netz einzuspeisen, sondern in eigenen
Liegenschaften ohne regenerative Stromerzeuger
zu verbrauchen. Dadurch erhöht der Kreis die
Wirtschaftlichkeit seiner Anlagen und den Versor-
gungsgrad mit selbst erzeugtem, klimafreundli-
chem Strom vor Ort. Jährlich können so Gelder in
fünfstelliger Höhe eingespart und in den Ausbau
erneuerbarer Energien investiert werden.
Der saarländische Landkreis St. Wendel leistete
Foto: Hearts&Minds/Difu
dagegen mit dem systematischen Probeanbau der
Energiepflanze „Durchwachsene Silphie“ einen
Beitrag zu Klimaanpassung und -schutz. Dank
dieses Pioniergeistes trägt die klimarobuste Ener-
giepflanze nun zur Einsparung von Ressourcen
und zur regionalen Energiewende bei.
Mit seinem Förderprogramm „Agenda 2030 – erfolgreiche Projekte aus den Bereichen Ressour-
Projekte für eine nachhaltige Entwicklung mit cen- und Energieeffizienz, klimafreundliche Mobi-
Bezug zum Klimaschutz“ unterstützt der Rems- lität, Klimaaktivitäten zum Mitmachen sowie Kli-
Murr-Kreis aus Baden-Württemberg gemeinnüt- maschutz durch Digitalisierung. Die Auszeichnung
zige Vereine mit Sitz im Kreis bei der Umsetzung der Preisträger erfolgt voraussichtlich im Novem-
www.difu.de/16593 von klimaschutzrelevanten und nachhaltigen ber 2021 in Berlin. Ausrichter des Wettbewerbs
Projekten. Andere Kommunen können das För- sind das Bundesumweltministerium und das Difu;
derprogramm bei Interesse an ihre Bedürfnisse Kooperationspartner die kommunalen Spitzenver-
anpassen und übernehmen. Notwendige Infor- bände. Der Wettbewerb wird im Rahmen des vom
Anna Hogrewe-Fuchs
mationen und Unterlagen stellt der Kreis gern zur Bundesumweltministerium geförderten Projekts
+49 30 340308-16
Verfügung. „Klimaaktive Kommunen – Ideenpool und Weg-
hogrewe-fuchs@difu.de
weiser“ durchgeführt.
Ulrike Vorwerk Die Stadt Bremerhaven schließlich hat mit
+49 30 340308-17 dem Jugendklimarat Bremerhaven ein stän-
vorwerk@difu.de diges Beteiligungsgremium etabliert, das die
15Was ist eigentlich...? Mikromobilität Begriffe aus der kommunalen Szene, einfach erklärt Mikromobilität ist die Fortbewegung mit elek- trisch motorisierten sowie nicht motorisierten Kleinst- und Leichtfahrzeugen, auch Elektro kleinstfahrzeuge genannt. Dazu zählen E-Tret- roller bzw. E-Scooter, Tretroller, Segways, E-Leichtfahrzeuge, Hoverboards, Mono- wheels und auch E-Skateboards und klassi- sche Skateboards. All diese Fortbewegungs- mittel sind leicht, kompakt und in erster Linie für die individuelle Mobilität konzipiert. Ihre geringe Größe und der meist elektrische An- trieb bieten besonders im städtischen Umfeld deutliche Vorteile gegenüber dem Pkw. Mikromobilität dient nicht in erster Linie dazu, bisherige Hauptverkehrsmittel zu ersetzen. Sie kann die individuelle Mobilität jedoch er- leichtern und umweltfreundlicher gestalten. Die größten Potenziale werden im Einsatz als Zubringer auf der ersten bzw. letzten Meile im Zusammenspiel mit dem öffentlichen Verkehr gesehen, zum Beispiel zur Verknüpfung von Umland, Stadtrand und Innenstadt. ———————————————————————— „Mikromobile leisten einen Beitrag zur Ver- besserung der Luftqualität, vor allem, wenn sie konventionelle Pkw-Fahrten ersetzen.“ ———————————————————————— Der erste Sharing-Anbieter im Segment E-Tretroller ging im Herbst 2017 in Santa Monica/USA an den Markt. Anschließend zogen erste europäische Städte nach. In Deutschland erfolgte die Einführung mit In- krafttreten der Verordnung über die Teilnahme von Elektrokleinstfahrzeugen (mit Lenk- und Haltestange) am Straßenverkehr im Juni 2019. Seitdem ergänzen E-Tretroller das Mo- bilitätsangebot deutscher Großstädte. In welchem Umfang die neue Mikromobilität als Baustein nachhaltiger Mobilität auch einen Beitrag zur angestrebten Verkehrswende leisten kann, werden künftige Studien zeigen. Aktuell gibt es noch zu wenige Untersuchun- gen zu den (Umwelt-)Wirkungen von Elektro kleinstfahrzeugen und deren Sharing-Ange- boten, um dies beurteilen zu können. Weitere Begriffe online: www.difu.de/6189 16
Veröffentlichungen
Berichte 2/2021
Edition Difu – Das Bebauungsplanverfahren nach Straßen und Plätze neu entdecken –
Stadt Forschung Praxis dem BauGB 2007 Verkehrswende gemeinsam gestalten
Muster, Tipps und Hinweise Fachtagungsdokumentation
So geht‘s Von Marie-Luis Wallraven-Lindl u.a., M. Hertel, T. Bracher, T. Stein (Hrsg.)
Fußverkehr in Städten neu denken und 2011, 2., aktualisierte Auflage, 224 S., 35 € Bd. 8/2018, 90 S., 15 €
umsetzen ISBN 978-3-88118-498-4, 29,99 € ISBN 978-3-88118-625-4, 12,99 €
Uta Bauer (Hrsg.)
2019, Bd. 18, 240 S., vierfarbig, zahlreiche Abb. Städtebauliche Gebote nach dem Junge Flüchtlinge – Perspektivplanung
und Fotos, 39 € Baugesetzbuch und Hilfen zur Verselbstständigung
ISBN 978-3-88118-643-8, 33,99 € A. Bunzel (Hrsg.), von M.-L. Wallraven-Lindl, Veranstaltungsdokumentation
A. Strunz, 2010, 188 S., 30 € Dialogforum (Hrsg.), Bd. 7/2018, 188 S., 20 €
Vielfalt gestalten ISBN 978-3-88118-486-1 ISBN 978-3-88118-626-1, 16,99 €
Integration und Stadtentwicklung in
Klein- und Mittelstädten Difu-Impulse Neue Konzepte für Wirtschaftsflächen
Bettina Reimann, Gudrun Kirchhoff, Ricarda Herausforderungen und Trends am Beispiel des
Pätzold, Wolf-Christian Strauss (Hrsg.) Vielfalt und Sicherheit im Quartier Stadtentwicklungsplanes Wirtschaft in Berlin
2018, Bd. 17, 364 Seiten, kostenlos Konflikte, Vertrauen und sozialer Zusammenhalt Von S. Wagner-Endres u.a.
ISBN 978-3-88118-618-6 in europäischen Städten Bd. 4/2018, 84 S., 15 €
www.difu.de/12236 Gabriel Bartl, Niklas Creemers, Holger Floeting ISBN 978-3-88118-614-8, 12,99 €
(Hrsg.)
Wasserinfrastruktur: Den Wandel Bd. 3/2020, 182 S., 20€ Lieferkonzepte in Quartieren – die letzte
gestalten ISBN 978-3-88118-667-4, 16,99 € Meile nachhaltig gestalten
Technische Varianten, räumliche Potenziale, Lösungen mit Lastenrädern, Cargo Cruisern
institutionelle Spielräume Verkehrswende nicht ohne attraktiven und Mikro-Hubs, W. Arndt und T. Klein (Hrsg.)
Martina Winker und Jan-Hendrik Trapp (Hrsg.), ÖPNV Bd. 3/2018, 96 S., 12,99 €
2017, Bd. 16, 272 S., vierfarbig, 39 € Wie lassen sich große ÖPNV-Projekte
ISBN 978-3-88118-584-4 erfolgreich umsetzen? Difu-Papers
Jürgen Gies (Hrsg.)
Kommunaler Umgang Bd. 2/2020, 104 S., 18 € Klimaschutz, erneuerbare Energien
mit Gentrifizierung ISBN 978-3-88118-648-3, 15,99 € und Klimaanpassung in Kommunen
Praxiserfahrungen aus acht Kommunen Maßnahmen, Erfolge, Hemmnisse und Entwick-
Von Thomas Franke u.a., 2017, Bd. 15, 316 S., Checkpoint Teilhabe lungen – Ergebnisse der Umfrage 2020
vierfarbig, zahlreiche Abb., 39 € Kinder- und Jugendhilfe + BTHG – Von J. Hagelstange, C. Rösler und K. Runge
ISBN 978-3-88118-579-0 Neue ganzheitliche Lösungen entwickeln! 2021, 24 S., nur online
Veranstaltungsdokumentation www.difu.de/16344
Sicherheit in der Stadt Dialogforum „Bund trifft kommunale Praxis“
Rahmenbedingungen – Praxisbeispiele – Bd. 1/2020, 160 S., 20 Euro Altersarmut in Städten
Internationale Erfahrungen ISBN 978-3-88118-653-7, 16,99 € Kommunale Steuerungs- und Handlungsmög-
Holger Floeting (Hrsg.), 2015, Bd. 14, 392 S., lichkeiten. Von Beate Hollbach-Grömig u.a.
zahlreiche Abbildungen, 39 € Was gewinnt die Stadtgesellschaft durch 2020, 56 S., 5 €, 3,99 €
ISBN 978-3-88118-534-9, 33,99 € saubere Luft? www.difu.de/15789
Die lebenswerte Stadt: Handlungsfelder und
Orientierungen für kommunale Planung Chancen Kommunale Wirtschaftsförderung 2019
und Steuerung – Ein Handlungsleitfaden Von Tilman Bracher u.a., Bd. 2/2019, 68 S., 15 € Strukturen, Aufgaben, Perspektiven: Ergebnisse
Von Jens Libbe unter Mitarbeit von ISBN 978-3-88118-642-1, 12,99 € der Difu-Umfrage
Klaus J. Beckmann, 2014, Bd. 13, 212 S., 29 € Von Sandra Wagner-Endres
ISBN 978-3-88118-529-5 Öffentlichkeitsbeteiligung beim 2020, 42 S., 5 €, 3,99 €
Netzausbau www.difu.de/15617
Städtebauliche Verträge – Evaluation „Planungsdialog Borgholzhausen“
Ein Handbuch Von Stephanie Bock, Jan Abt, Bettina Reimann Smart Cities in Deutschland –
Vierte, aktualisierte und erweiterte Auflage. Bd. 1/2019, 98 S., 15 € eine Bestandsaufnahme
Mit Berücksichtigung der BauGB-Novelle 2013 ISBN 978-3-88118-640-7, 12,99 € Von Jens Libbe und Roman Soike
Von A. Bunzel, D. Coulmas und G. Schmidt- 2017, 28 S., 5 €, 3,99 €
Eichstaedt, 2013, Bd. 12, 466 S., 39 € www.difu.de/11741
ISBN 978-3-88118-508-0, 33,99 € ————————————————————————————————————————————
Übersicht aller Publikationen + Bestellmöglichkeit
Difu-Arbeitshilfen
www.difu.de/publikationen
eBooks: http://difu.ciando-shop.com/info/einside/ – Info für Zuwender: www.difu.de/12544
Die Satzungen nach dem Baugesetzbuch
3. Auflage
Vertrieb: Difu gGmbH, Zimmerstraße 13-15, 10969 Berlin,
A. Bunzel (Hrsg.), von A. Strunz,
Tel. +49 30 39001-253, Fax: +49 30 39001-275, Mail: vertrieb@difu.de
M.-L. Wallraven-Lindl, 2013, 172 S.,
zahlreiche Satzungsmuster, 29 €
Alle Difu-Veröffentlichungen und -eBooks sind für Difu-Zuwender kostenlos, die mit Stern
ISBN 978-3-88118-526-4
gekennzeichneten Publikationen gibt es exklusiv für Zuwender auch digital.
17Veröffentlichungen
Berichte 2/2021
Sonderveröffentlichungen Investitionsbedarfe und finanzielle Tragfä- Bestand und Zustand des gemeindlichen
(teilweise auch/nur als Download) higkeit im „Konzern Stadt Köln“ Straßennetzes in Sachsen-Anhalt
Szenariobasierte Betrachtungen Mittel- und langfristige Investitionsbedarfe
Bürgerschaftliches Engagement in der Von Stefan Schneider, Henrik Scheller u.a. Von Christian Raffer u.a.
Pandemie 2021, 42 S., nur online 2020, 37 S., nur online
Eine empirische Untersuchung am Beispiel der www.difu.de/16405 www.difu.de/16173
Stadt Speyer
Von Florian Harz und Carsten Kühl Klimaschutz im Gebäudesektor – Neue Klimaschutz in finanzschwachen Kommu-
2021, 42 S., nur online Wege für die Wohnungswirtschaft nen: Mehrwert für Haushalt und Umwelt
www.difu.de/16657 Impuls für das Strategieforum „Wohnungswirt- Eine Handreichung für Kommunen
schaft“ des Grünen Wirtschaftsdialogs Von Corinna Altenburg u.a.
Jahresrückblick 2020 Von D. Michalski, P. Reiß, W.-Chr. Strauss 2020, 31 S., kostenlos, auch online
Difu (Hrsg.) 2021, 29 S., nur online www.difu.de/15833
2021, 24. S., nur online www.difu.de/16372
www.difu.de/16636 Kommunale Antworten auf die globale
Parking Standards as a Steering Instru- Corona-Krise: Finanzen, Innovationskraft
OB-Barometer 2021 ment in Urban and Mobility Planning und Lebensqualität verbessern
Difu (Hrsg.) Von Jürgen Gies, Martina Hertel, Susan Tully Kurzexpertise im Auftrag des DST
4 S., kostenlos 2021, 40 S., nur online Von Carsten Kühl, Henrik Scheller u.a.
www.difu.de/16654 www.difu.de/16332 2020, 26 S., nur online
www.difu.de/15723
Das Umland der Städte Monitor Nachhaltige Kommune – Bericht
Chancen zur Entlastung überforderter Woh- 2020 Emissionen sparen, Platz schaffen,
nungsmärkte. Plausibilitäten – Determinanten Schwerpunktthema Klima und Energie mobil sein
– Restriktionen Von J. Jossin u.a., Bertelsmann Stiftung (Hrsg.) Handlungsleitfaden City2Share
Von Carsten Kühl, Ricarda Pätzold u.a., 2021, 140 S., nur online Uta Bauer, Thomas Stein, Victoria Langer (Hrsg.)
i.A. des Verbändebündnisses Wohnungsbau www.difu.de/16324 2020, 68 S., kostenlos, auch online
2021, 72 S., nur online www.difu.de/15889
www.difu.de/16618 DStGB-Dokumentation „Kommunen
innovativ“ Stadtentwicklung in Coronazeiten
KfW-Kommunalpanel 2021 Ansätze für eine zukunftsorientierte Entwicklung Von Arno Bunzel und Carsten Kühl
Von Christian Raffer und Henrik Scheller, von Städten und Gemeinden 2020, 36 S., nur online
i.A. der KfW Bankengruppe Von S. Bock und J. Diringer, DStGB u. Difu (Hrsg.) www.difu.de/15641
2021, 32. S., nur online 2021, 36 S., nur online
www.difu.de/16620 www.difu.de/16323 Klimaschutz in Kommunen
Praxisleitfaden. 3. Aufl., 2018, 454 S., nur online
Klimaguides No. 2, 3 und 4: Gemein- Studie Lokale Ökonomie BIWAQ www.difu.de/11742
schaftsküche im Quartier, Mobilitätspor- ESF-Bundesprogramm „Bildung, Wirtschaft
tal, Gemeinschaftsgärten und Arbeit im Quartier – BIWAQ“ Zeitschrift
Von diversen Difu-Autor*innen, BMU (Förd.) Von Stefan Schneider u.a., BBSR (Hrsg.)
2021, je 7 S., nur online 2021, 73 S., nur online Städtisches Wissen
www.difu.de/16609, /16610, /16611 www.difu.de/16327 Moderne Stadtgeschichte
MSG, Heft 1/2021, ca. 180 S., in Vorbereitung
Nationaler Fortschrittsbericht zur Umset- Aktive Bodenpolitik – Fundament der Einzelheft 12 Euro, Jahresabo (2 Hefte) 19 €
zung der New Urban Agenda Stadtentwicklung
Von Oliver Peters u.a., BBSR (Hrsg.) Bodenpolitische Strategien und Instrumente im 50 Jahre Moderne Stadtgeschichte
2021, 123 S., nur online Lichte der kommunalen Praxis Moderne Stadtgeschichte
www.difu.de/16613 Von L. Adrian, A. Bunzel, D. Michalski, R. Pätzold MSG, Halbjahresschrift, Heft 2/2020, 184 S.
2021, 115 S., online und kostenlose Printversion Einzelheft 12 Euro, Jahresabo (2 Hefte) 19 Euro
Ausgezeichnete Praxisbeispiele 2020 www.difu.de/16296
Klimaaktive Kommune 2020. Ein Wettbewerb
Dokumentationen
des Bundesumweltministeriums und des Deut- Mit On-Demand-Angeboten ÖPNV-
schen Instituts für Urbanistik Bedarfsverkehre modernisieren
Kommunalwissenschaftliche
Von Anna Hogrewe-Fuchs u.a., Difu (Hrsg.), Werkstattbericht zu Chancen und Herausforde-
Dissertationen
BMU (Förd.) rungen
Rita Gräber (Bearb.), 2020, 174 S.
2021, 82 S., nur online Von J. Gies und V. Langer, BMBF (Hrsg.)
Einzelband 27 €, Jahresabo 20 €
www.difu.de/16593 2021, 55 S., nur online
www.difu.de/16340
www.difu.de/16282
#Klimahacks No. 8 – Mach dein Projekt
Graue Literatur zur Stadt-, Regional-
zur Digitalisierung für die Energiewende Vom Stadtumbau zur städtischen Trans-
und Landesplanung 2020
formationsstrategie
Christine Bruchmann, Jan Treibert (Bearb.)
Eine Anleitung für mehr Klimaschutz Von R. Riechel, H. Scheller, J. Trapp, J. Libbe u.a.,
2021, 210 S.,
Von M. Peters und U. Vorwerk, BMU (Förd.) BBSR (Hrsg.)
Einzelband 36,40 €, Jahresabo 28 €
2021, 8 S., nur online 2020, 94 S. nur online
www.difu.de/16341
www.difu.de/16588 www.difu.de/16357
18Sie können auch lesen