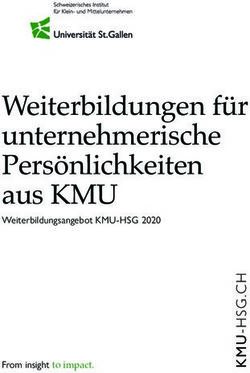Gehirn, Kognition und Sprache
←
→
Transkription von Seiteninhalten
Wenn Ihr Browser die Seite nicht korrekt rendert, bitte, lesen Sie den Inhalt der Seite unten
Gehirn, Kognition und Sprache
D
er Profilbildende Forschungsbereich
untersucht höhere geistige Funktionen
Gehirn, Kognition und Sprache 54
wie Aufmerksamkeit, Wahrnehmung, Interview mit dem Sprecher des Profilbildenden
Lernen, Gedächtnis, Motorik und Sprache. Forschungsbereiches „Gehirn, Kognition und Sprache“,
Prof. Dr. Rudolf Rübsamen
Ziel ist es, die hirnorganischen Grundlagen
dieser kognitiven Prozesse aufzuklären, zu Affen und Menschen im Vergleich 58
einem vertieften Verständnis assoziierter
Der Alzheimerschen Erkrankung auf der Spur 60
Hirnerkrankungen beizutragen und innova-
tive Therapieansätze zu entwickeln. Hierzu Der Mensch als „animal grammaticus“ 62
vereint der Profilbildende Forschungsbereich
die Aktivitäten zahlreicher universitärer und
außeruniversitärer Forschungseinrichtungen
der Natur- und Geisteswissenschaften, sowie
der Medizin: Die beteiligten Wissenschaftler
widmen sich fachübergreifend den vielfäl-
tigen Aspekten des Themenkomplexes „Ge-
hirn, Kognition und Sprache“. Im Vordergrund
stehen dabei interdisziplinäre Forschungspro-
jekte, in denen ein breites Methodenspekt-
rum zur Anwendung kommt. Es erstreckt
sich von genetischen Untersuchungen, der
Erfassung von Zell-Zell-Interaktionen und Be-
schreibung neuronaler Netzwerke, über die
Verhaltensanalyse, bis hin zur Untersuchung
der Sprachverarbeitung und der Analyse
des formalen Aufbaus von Sprache. Dabei
werden sowohl ontogenetische als auch phy-
logenetische Aspekte der Hirnentwicklung
und Hirndifferenzierung betrachtet. Dieser
multidimensionale Forschungsansatz bietet
die Möglichkeit, nachhaltige Fortschritte im
Verständnis der hochkomplexen Arbeitsweise
des Gehirns zu erzielen.
53Prof. Dr. Rudolf Rübsamen
Mit dem Gehirn
das Gehirn
ergründen
,QWHUYLHZPLWGHP6SUHFKHUGHV3URÀOELOGHQGHQ)RUVFKXQJVEHUHLFKHV
Å*HKLUQ.RJQLWLRQXQG6SUDFKH´3URI'U5XGROI5EVDPHQ
Das menschliche Gehirn ist ein hochkomplexes Organ, das Gehirn diese erstaunlichen Fähigkeiten? Jegliche Erklärungs-
dessen Funktionsweise die Forschung seit langer Zeit versuche dazu müssen immer berücksichtigen, dass dieses Organ
ergründen will. Können Sie den wissenschaftlichen Hin- keine ingenieurtechnische Konstruktion ist! Bei unseren gemein-
tergrund schildern vor dem sich dazu der Profilbildende samen Bemühungen um ein Verständnis des Gehirns müssen wir
Forschungsbereich entwickelt hat? zwei Gegebenheiten bedenken:
Zum einen hat sich das Gehirn bei tierischen Organismen als zen-
Unser Gehirn verleiht uns die Fähigkeit des Denkens und Fühlens, trales Steuerorgan im Zusammenhang mit dem Erwerb der freien
mit ihm wägen wir Argumente ab, treffen Entscheidungen und Beweglichkeit entwickelt. Es ist bei entwickelten Säugetieren und
setzen diese in Handlungen um. Die Gesamtaktivität des Gehirns bei uns Menschen klar hierarchisch organisiert. Das heißt, dass
bestimmt unsere Persönlichkeit, und diese ist eng verknüpft mit verschiedene Aspekte einer eingehenden Information vom Gehirn
unserem „Ich“. in nacheinander geschalteten Verarbeitungsstationen analysiert
Die Kognitionswissenschaften erforschen die kognitiven Fä- werden. Aus der engen Beziehung zwischen Körperorganisation
higkeiten, also höhere geistige Leistungen wie Wahrnehmung, und Verhaltens- bzw. Bewegungsanpassung kann man unmittel-
Denken, Lernen, Gedächtnis, Motorik und Sprache und bemühen EDUIHVWVWHOOHQ
'HU$XI EDXGHV*HKLUQVVSLHJHOW6SH]L¿NDGHU
sich um eine Erklärung dieser mentaler Funktionen mit Hilfe von Körperorganisation wider.
theoretischen Konzepten aus der Informationsverarbeitung. Man =XPDQGHUHQVLQGGLHPLWHLQDQGHUYHUÀRFKWHQHQ9HUDUEHLWXQJVOHL-
kann hier auch von einer Meta-Theorie sprechen, die jegliches stungen des Gehirns – wenn überhaupt – nur zu verstehen, wenn
Verhalten auf mentale Prozesse zurückführt. Wie aber erlangt wir berücksichtigen, wie sich das Gehirn stammesgeschichtlich
54Gehirn, Kognition und Sprache
(phylogenetisch) entwickelt hat und wie es sich während der Unverzichtbar für das Vorhaben ist die enge Zusammenarbeit
Individualentwicklung (Ontogenese) verändert. Das erfordert mit den drei in Leipzig ansässigen Max-Planck-Instituten (MPI),
es, die Merkmale des Gehirns in der embryonalen Frühphase zu dem MPI für Kognitions- und Neurowissenschaften, dem MPI
analysieren, aber auch seine Leistungen in den kindlichen Ent- für Evolutionäre Anthropologie und dem MPI für Mathematik in
wicklungsstadien und im Erwachsenenalter zu erfassen. Dabei den Naturwissenschaften. Führende Wissenschaftler aus diesen
spielen auch die hirnorganischen Veränderungen im hohen Alter Forschungseinrichtungen kooperieren bereits heute in Projekten
eine Rolle. zu einzelnen Aspekten des Gesamtkomplexes „Gehirn, Kognition
Diese Gegebenheiten galt es bei der Konzeption des breit ange- und Sprache“.
legten Forschungsverbunds „Gehirn, Kognition und Sprache“
zu beachten. Es sind also zahlreiche wissenschaftliche Aktivitäten die
miteinander verknüpft werden. Wie funktioniert eine
Können Sie, nachdem Sie die Ausgangssituation skiz- solche Zusammenarbeit verschiedenster Forschergrup-
ziert haben, das konkrete Ziel und die Vorgehensweise pen und wer genau ist am Verbund beteiligt?
des Forschungsverbundes beschreiben?
Bei der Betrachtung eines Netzwerkes gibt es keinen natür-
Wir wollen die Beziehung zwischen Gehirn und Kognition lich bestimmten Anfangspunkt. Beginnen wir mit der Ebene
aufklären. Um das komplexe System Gehirn zu verstehen und des Verhaltens: In der Abteilung für Primatologie des Max-
seine Arbeitsweise weiter zu ergründen, muss man einen multi- Planck-Institutes für Evolutionäre Anthropologie untersucht
dimensionalen Forschungsansatz wählen. Man könnte das, was Prof. Christophe Boesch die Evolution des sozialen Verhaltens,
wir vorhaben, als eine Verschränkung ver- die kognitiven Fähigkeiten und die Kultur
tikaler und horizontaler Betrachtungsweisen bei Menschenaffen durch Beobachtung
charakterisieren. Die vertikale Sichtweise der Tiere in ihrer natürlichen Lebensum-
berücksichtigt die Tatsache, dass Informa- Um das komplexe gebung. Im Zentrum steht die Frage nach
tionsverarbeitung im Gehirn immer hier- System Gehirn zu den basalen sozial-kognitiven Prozessen.
archisch organisiert ist. Das heißt, dass sie Es soll geklärt werden, wie Menschenaffen
in kreisförmig geschlossenen, nacheinan-
verstehen und seine kommunizieren, miteinander interagieren
der geschalteten Verarbeitungsmodulen Arbeitsweise weiter zu und sozial lernen. In allen Fällen geht es
über mehrere Stufen hinweg stattfindet. ergründen, muss man darum, grundlegende Prozesse zu identi-
Zusätzlich gibt es zwei unterschiedliche ¿]LHUHQGXUFKGLH0HQVFKHQDIIHQLQGHU
horizontale Sichtweisen: Die eine ist auf einen multidimensio- Lage sind, Kommunikationsstrukturen und
die individuelle Entwicklungsdynamik des nalen Forschungsansatz LKUHDUWVSH]L¿VFKH.XOWXU]XHUKDOWHQXQG
Gehirns fokussiert, untersucht diese also zu entwickeln. In der Abteilung für Ent-
von einem ontogenetischen Blickwinkel aus.
wählen. wicklungs- und Vergleichende Psychologie
Die andere horizontale Betrachtungsweise untersucht Prof. Michael Tomasello die
vergleicht die kognitiven Leistungen von kognitiven und sozial-kognitiven Prozesse
Menschen und Menschenaffen, wobei hier in unmittelbarem Vergleich von Menschen-
der phylogenetische Blickwinkel der Hirnentwicklung betont wird. affen und Menschen mit einer besonderen Berücksichtigung der
Während in früheren kognitionsrelevanten Forschungsansätzen frühkindlichen Entwicklung sozialer Kommunikation …
meist nur eine dieser Betrachtungsweisen thematisiert wurde,
liegt der innovative Ansatz am Forschungsstandort Leipzig Bei Kommunikation denkt man ja sofort an Sprache.
darin, dass wir die Möglichkeit haben, alle Ebenen miteinander Gibt es denn auch Projektgruppen, die auf diesem Ge-
zu vernetzen. Das erreichen wir, indem wir die vielfältige am biet zusammenwirken? Sprache ist doch die besondere
Ort vorhandene Forschungskapazität bündeln – das bedeutet kognitive Leistung, die wir Menschen mit keiner weite-
interdisziplinäre Zusammenarbeit. Wir können somit parallel ren Spezies teilen.
die Hierarchie kognitiver Prozesse sowie dynamische Aspekte in
der Ontogenese und Phylogenese untersuchen und die Resultate Und weil das so ist, bildet die Sprache auch in unserem Verbund
konstruktiv miteinander verbinden. einen wichtigen Forschungsschwerpunkt. So untersuchen Prof.
Gereon Müller und Prof. Balthasar Bickel von der Philologischen
Welche Einrichtungen der Universität und welche au- Fakultät sowie Prof. Bernhard Comrie vom Max-Planck-Institut
ßeruniversitären Forschungsstätten sind es denn, die für Evolutionäre Anthropologie Sprachen als symbolische Syste-
im Profilbildenden Forschungsbereich „Sprache, Gehirn me. Prof. Angela Friederici und Prof. D. Yves von Cramon vom
und Kognition“ kooperieren? Max-Planck-Institut für Kognititions- und Neurowissenschaften
sowie Prof. Jörg Dieter Jescheniak von der Fakultät für Biowissen-
Es gibt an der Universität Leipzig gut aufgestellte kognitions- schaften, Pharmazie und Psychologie betrachten die Neurokogni-
wissenschaftliche und neurowissenschaftliche Arbeitsbereiche tion der Sprachverarbeitung und Sprachproduktion. Ein besonde-
in der Medizinischen Fakultät, der Philologischen Fakultät, in res Augenmerk gilt dabei der Ontogenese der Sprachkompetenz
der Fakultät für Biowissenschaften, Pharmazie und Psycholo- und den Fehlfunktionen im gestörten System. Von dort ist es nur
gie sowie an der Fakultät für Physik und Geowissenschaften. ein kleiner Schritt dahin, auch Aufmerksamkeitsprozesse in die
55Betrachtung kognitiver Leistungen einzubeziehen. Auf diesem Es war ein glücklicher Umstand, dass bereits vor der Gründung
Gebiet forschen die Arbeitsgruppen von Prof. Erich Schröger und der Max-Planck-Institute in Leipzig die Neurowissenschaften an
Prof. Matthias Müller von der Fakultät für Biowissenschaften, der Universität ein ausgewiesenes Schwerpunktthema waren.
Pharmazie und Psychologie. Wie Handlungen gesteuert werden, Hinzu kam, dass diese Arbeitsbereiche durch die kognitionswis-
wird durch Prof. Wolfgang Prinz vom Max-Planck-Institut für senschaftlichen Themenstellungen am Max-Planck-Institut für
Kognititions- und Neurowissenschaften untersucht. Kognitions- und Neurowissenschaften und am Max-Planck-In-
stitut für Evolutionäre Anthropologie weiter aufgewertet wurden.
Sie sprachen bisher vor allem von Arbeitsgruppen, die So wurden Kooperationen mit den beiden Max-Planck-Instituten
Leistungen des Gehirns auf Verhaltensebene untersu- sofort nach deren Einrichtung in den Jahren 1994 und 1997 aufge-
chen. Werden die Aspekte auch auf Ebene der einzelnen nommen. Auch das 1996 gegründete MPI für Mathematik in den
Nervenzelle oder gar auf genetischer Ebene erforscht? Naturwissenschaften ist inzwischen durch gemeinsame Projekte
in das Netzwerk kognitionswissenschaftlicher Arbeitsgruppen
Ja, natürlich. Eine besondere Brisanz unseres Forschungsansatzes integriert.
ergibt sich gerade daraus, dass wir vergleichende genetische Ana- Aufgabe der Universität ist es, Spezialisten auszubilden, die in
lysen zwischen Menschen und Menschenaffen mit einbeziehen. anspruchsvollen Berufsfeldern Leitungsfunktionen übernehmen
Dadurch wollen wir ein besseres Verständnis von Ursprung und N|QQHQ$XVGLHVHU*UXSSHUHNUXWLHUHQVLFKDXFKKRFKTXDOL¿-
von Zeitverläufen der Migration der Früh- zierte Nachwuchswissenschaftler, die die
menschen und seiner nächsten Verwandten Wissenschaft selbst voranbringen. In der
erlangen. Die Untersuchungen dazu werden Auswahl solcher Nachwuchswissenschaft-
in der Abteilung für Evolutionäre Genetik 0DQ¿QGHWVLFKHUQXU ler und in deren weiterer fachlicher und
des Max-Planck-Instituts für Evolutionäre theoretischer Qualifikation sehe ich ein
Anthropologie durch Prof. Svante Pääbo sehr wenige Orte auf gemeinsames Interesse der Universität und
durchgeführt. der Welt, an denen, im der Max-Planck-Institute.
Über Genaktivitäten werden mittels mole- $XHUGHPOlVVWVLFKGLH(I¿]LHQ]YRQ)RU-
kularer Kontrollmechanismen auch Hirn- Bereich der Neuro- und schungsarbeiten deutlich steigern, wenn
funktionen gesteuert. Die neuronale Pla- Kognitionswissen- vorhandene Ressourcen der Universität
VWL]LWlWDOVRGLHVSH]L¿VFKH9HUNQSIXQJ schaften, wissenschaft- und der Max-Planck-Institute gemeinsam
von Nervenzellen, wird durch solche Steue- genutzt werden. Dies gilt sowohl für die
rungsprozesse kontrolliert. Ist das System liches Arbeiten auf Verwendung hochinstallierter molekular-
gestört, können diese Prozesse aber auch hohem Niveau mit biologischer und genetischer Labore als
fehlreguliert sein und es entstehen beispiels- auch für den Einsatz moderner, sehr auf-
weise neurodegenerative Erkrankungen wie einem so breiten wendiger Messverfahren wie beispielsweise
Parkinson oder Alzheimer. Mit neuronalen Methodenspektrum der funktionellen Magnetresonanz-Tomo-
Regulationsstörungen befassen sich eine möglich ist. graphie (f MRT) und transmagnetischen
Reihe sehr produktiver Arbeitsgruppen an Stimulation (TMS). Dadurch können Kräfte
der Medizinischen Fakultät der Univer- gebündelt werden.
sität unter der Leitung von Prof. Thomas Zusätzlich erreichen wir durch die Zu-
Arendt, Prof. Jürgen Meixensberger und sammenarbeit eine Verbreiterung der For-
3URI-RKDQQHV6FKZDU]'LHSKDUPDNRORJLVFKH%HHLQÀXVVXQJ schungsbasis. Beispielsweise können wir kognitionsrelevante
der kognitionsrelevanten neuronalen Plastizität, also die Verän- Themen, die im direkten Bezug zur Sprache stehen, auf die
derung der Neuronenaktivität durch chemische Substanzen, ist soziale Kommunikation ausweiten. Themen, die zelluläre und
ein weiterer wichtiger Aspekt, der in den Arbeitsgruppen um molekulare Grundlagen bearbeiten, können wir durch verschie-
Prof. Peter Illes und Prof. Andreas Reichenbach bearbeitet wird. denste hochkomplexe Analyseverfahren untersuchen.
Dynamische Aspekte der Interaktion zwischen Neuronen sowie Ein weiterer großer Vorteil ergibt sich für den hier ausgebilde-
Struktur-Funktionsbeziehungen von neuronalen Netzwerken be- WHQZLVVHQVFKDIWOLFKHQ1DFKZXFKV0DQ¿QGHWVLFKHUQXUVHKU
trachten die Arbeitsgruppen von Prof. Josef Käs an der Fakultät wenige Orte auf der Welt, an denen, im Bereich der Neuro- und
für Physik und Geowissenschaften, Prof. Jens-Karl Eilers und Kognitionswissenschaften, wissenschaftliches Arbeiten auf ho-
Prof. Torsten Schöneberg von der Medizinischen Fakultät, Prof. hem Niveau mit einem so breiten Methodenspektrum möglich
Rudolf Rübsamen an der Fakultät für Biowissenschaften, Pharma- ist. Dies beginnt bei der genetischen Analyse, setzt sich fort
zie und Psychologie und Prof. Jürgen Jost am Max-Planck-Institut über die Charakterisierung von Signalverarbeitungsprozessen,
für Mathematik in den Naturwissenschaften. Neuron-Neuron-Interaktionen, Analyse neuronaler Netzwerke,
Zusammenhang neuronaler Systeme mit Verhaltensleistungen
Ein herausragendes Merkmal dieses Forschungsbereichs bis hin zur Verhaltensanalyse im Vergleich zwischen Mensch und
ist also die Kooperation zwischen Universität und den Menschenaffen. Diese methodische und thematische Vielfalt mit
drei in Leipzig ansässigen Max-Planck-Instituten. Ein be- der besonderen Fokussierung auf kognitionsrelevante Fragestel-
sonderer Vorzug des Wissenschaftsstandortes Leipzig? lungen macht den Wissenschaftsstandort Leipzig auch besonders
56Gehirn, Kognition und Sprache
interessant für engagierte junge Wissenschaftler aus dem interna- im luftleeren Raum statt! Die erzielten Ergebnisse können später
WLRQDOHQ5DXP
6LHNRPPHQJHUQQDFK/HLS]LJ'DYRQSUR¿WLHUHQ wichtige Grundlage für anwendungsorientierte Forschungsvorha-
wiederum auch die am Verbund beteiligten Institutionen. ben sein, beispielsweise im Bereich der Biotechnologie.
Wenn wir die Alzheimersche Erkrankung in Zukunft therapieren
Welche Forschungskooperationen bestehen bereits im wollen, dann müssen wir die zellulären Verarbeitungsprozesse im
Profilbildenden Forschungsbereich? Gehirn in ihrer gesamten Komplexität verstehen. Das heißt, wir
müssen wissen, in welcher Weise Neurone miteinander in Wech-
Der Forschungsbereich gründet sich auf einer Reihe von inter- selwirkung treten, wie sie mit Gliazellen interagieren und welche
disziplinären Forschungsprojekten in Leipzig. Sie bilden das Prozesse bei degenerativen Vorgängen wie der Alzheimerschen
Fundament für zukünftige Aktivitäten. Sehr erfolgreiche Arbeiten Erkrankung fehlgesteuert sind. Viele spezialisierte Arbeitsgrup-
wurden in der DFG-Forschergruppe „Arbeitsgedächtnis: Input-, pen müssen mit einem breiten Methodenrepertoire eine solche
Output- und Kontrollprozesse“ sowie im DFG-Schwerpunktpro- Problematik bearbeiten. Erst wenn wir das gesamte Funktions-
gramm „Zeitgebundene Informationsverarbeitung im zentralen JHÀHFKWYHUVWDQGHQKDEHQN|QQHQ9RUVWHOOXQJHQXQG.RQ]HSWH
auditorischen System“ geleistet. Neu hinzugekommen ist die entwickelt werden, an welcher Stelle eine erfolgreiche Therapie
Forschergruppe „Grammatik und Verarbeitung verbaler Argu- angreifen könnte. Unsere Grundlagenforschung ist somit unerläs-
PHQWH³VRZLHGDV(83URMHNW³8QLYHUVDODQG6SHFL¿F3URSHUWLHV slich für die Entwicklung von Therapien und für das Design von
of Uniquely Human Competence“. Medikamenten, sie führt aber nicht unmittelbar dorthin.
Zusätzlich haben wir eine Reihe von Einrichtungen zur struktu- Ein zweites Beispiel ist der Themenkomplex Sprache. Es gibt
rierten Doktorandenausbildung etabliert: Unter dem gemeinsa- differenzierte Beschreibungen von Störungen des Spracherwerbs
men Dach der interdisziplinären DAAD-Graduiertenschule „Von bei Kindern sowie Sprachstörungen bei Erwachsenen. Die hirn-
der Signalverarbeitung zum Verhalten (From Signal Processing organischen Ursachen für solche Störungen sind aber bisher nur
to Behavior)“ gibt es in den verschiedenen Forschungsfeldern ansatzweise verstanden. Hier ist sehr viel Basisarbeit zu leisten.
einzelne Graduiertenkollegs, die jeweils unter einem konkreten Bevor fundierte Methoden entwickelt werden können, die Sprach-
Themenaspekt arbeiten: „Die Ursprünge des Menschen (Human störungen nachhaltig therapieren, müssen wir zunächst unbedingt
Origins)“, „Die Bedeutung von Aufmerksamkeit bei kognitiven wissen, wie Sprache strukturiert ist. Nur so bekommen wir Zu-
Prozessen (Function of Attention in Cognition)“, „Universalität gang zu der Art und Weise, wie gesprochene und geschriebene
und Diversität: Linguistische Strukturen und Prozesse (University Sprache im Gehirn repräsentiert ist. In unmittelbarer Beziehung
an Diversity of Language)“ bzw. „Interdisziplinäre Ansätze in dazu steht auch die Frage, wie kleine Kinder sich die Sprache an-
den zellulären Neurowissenschaften (InterNeuro)“. Sie werden eignen, wie sich ihre Sprachkompetenz entwickelt und in welcher
durch die Max-Planck-Gesellschaft oder durch die DFG geför- Beziehung diese zur gesamten intellektuellen Entwicklung steht.
GHUWXQGVLQGLQVWLWXWLRQVEHUJUHLIHQGDQJHOHJW
+LHU¿QGHQVLFK Ungeklärt ist ebenfalls noch, wie das Sprachsystem im Gehirn
junge Akademiker aus Psychologie, Biologie, Biochemie, Physik, eingewoben ist. Unerlässlich ist es auch, die Sprachkompetenz
Medizin etc. zusammen, lernen und wirken gemeinsam. So wird des Menschen mit dynamischen Aspekten der Kommunikations-
GHUQlFKVWHQ*HQHUDWLRQYRQKRFKTXDOL¿]LHUWHQ.RJQLWLRQVXQG kompetenz bei Menschenaffen zu vergleichen. Erst ein tieferes
Neurowissenschaftlern interdisziplinäres Arbeiten vermittelt. Verständnis der hier aufgezeigten Wechselbeziehungen wird
Mittelfristig ist es unser Ziel, die Graduiertenausbildung an Therapiekonzepte ermöglichen.
der Universität Leipzig im Rahmen einer „Leipzig Research
Academy“ zu organisieren. Wir wollen so den jungen Forschern Welche Perspektive sehen Sie für den aus unterschiedli-
eine optimale fachliche Förderung gewähren, damit sie auch im chen Partnern bestehenden Forschungsverbund? Worin
internationalen Vergleich zur Spitzengruppe der Nachwuchswis- liegt sein Entwicklungspotential?
senschaftler gehören.
'HU3UR¿OELOGHQGH)RUVFKXQJVEHUHLFKÄ*HKLUQ.RJQLWLRQXQG
Der Forschungsbereich beinhaltet im Prinzip klassische Sprache“ ist durch keine festgeschriebene Organisationsform
Grundlagenforschung. Könnte es in Zukunft dennoch in ausgewiesen. Er soll vielmehr ein dynamisches Netzwerk sein.
einigen Teilgebieten zu wissenschaftlichen Ergebnissen Im Verbund sollen sich, abhängig von der Weiterentwicklung ein-
kommen, die im Bereich der Prävention, der Diagnostik zelner Forschungsbereiche, neue Knotenpunkte interdisziplinärer
oder der Rehabilitation zu praktischen Anwendungen Zusammenarbeit herausbilden und alte erfolgreich bearbeitete
führen? Verknüpfungsstellen wieder lösen. Die Dynamik im Gesamt-
system ist durch die Kreativität der beteiligten Wissenschaftler
Ich kann gut nachvollziehen, dass im Zusammenhang mit einer und durch die Bereitschaft zur Zusammenarbeit gegeben. Die
VROFKXPIDQJUHLFKHQ)RUVFKXQJVNRQ]HSWLRQZLHGHP3UR¿OELO- hier in Leipzig bereits geleisteten Vorarbeiten im kognitions- und
denden Bereich „Gehirn, Kognition und Sprache “ die Frage nach neurowissenschaftlichen Forschungsbereich stimmen mich sehr
möglichen praktischen Anwendungen gestellt wird. Das, was wir optimistisch. Ich bin der festen Überzeugung, dass wir auf einem
tun, ist als reine Grundlagenforschung einzustufen. Als solche guten Weg sind.
steht sie nicht in einem unmittelbaren Zusammenhang mit prak-
WLVFKHQ$QZHQGXQJHQ*UXQGODJHQIRUVFKXQJ¿QGHWDEHUQLFKW ,QWHUYLHZ
%HQMDPLQ+DHUGOHXQG6DQGUD+DVVH
57Affen und
Menschen
im
Vergleich
6DQGUD+DVVH%HQMDPLQ+DHUGOH
E
s ist wissenschaftlich unbestritten: Mensch und Menschen- ren über die Straße, tragen Älteren schwere Tüten die Treppen
affe entwickelten sich aus einem gemeinsamen Vorfahren. hinauf, erklären Fremden den Weg oder spenden Blut und Geld
Aus diesem Grund existiert ein großer Klärungsbedarf für karitative Zwecke. Das Prinzip des uneigennützigen Handelns
darüber, welche Merkmale und Fähigkeiten uns von unseren leistet damit einen essentiellen Beitrag zum Funktionieren unserer
tierischen Verwandten trennen und welche uns mit den Men- Gesellschaft.
schenaffen verbinden. Auf dem Gebiet der Kognition und Kom- Julias Verhalten ist stellvertretend für die Resultate der Un-
munikation forscht dazu die Abteilung für Vergleichende und tersuchungen von Warneken und Tomasello: Uneigennütziges
Entwicklungspsychologie am Max-Planck-Institut für Evolutionä- Verhalten existiert demnach nicht nur bei Erwachsenen, sondern
re Anthropologie unter Leitung von Prof. Michael Tomasello. In schon bei sehr kleinen Kinder. Dies ist äußerst erstaunlich,
drei spannenden Forschungsprojekten fanden die Wissenschaftler meint Warneken, schließlich „fangen sie gerade erst an zu spre-
jetzt erste Belege für Altruismus bei Kleinkindern und Schim- chen, aber sie erkennen schon genau, wenn sie jemandem helfen
pansen, wiesen kooperatives Handeln bei Affen nach und stellten können“. Die Kinder unterstützten Warneken nicht, wenn er die
fest, dass sich Schimpansen weder selbstlos noch missgünstig Wäscheklammer absichtlich zu Boden warf, sondern nur, wenn
verhalten. er wirklich Schwierigkeiten hatte – dann aber unaufgefordert
und umso eifriger.
Julia sitzt auf dem Fußboden. Aufmerksam beobachtet das 18 Mo- In einer Reihe weiterer ähnlicher Spielsituationen konnten War-
nate alte Mädchen, wie eine Wäscheklammer mit schnipsendem neken und Tomasello ihre Erkenntnisse bestätigen: Kleinkinder
Geräusch zu Boden fällt. Ein junger Mann, der sich zusammen mit legten verrutschte Bücher auf einen Bücherstapel zurück, öffne-
-XOLDLP5DXPEH¿QGHWYHUVXFKWHUIROJORVGDQDFK]XJUHLIHQ'HV- ten Schranktüren oder angelten in Kisten gefallene Löffel durch
halb eilt ihm nun das Kleinkind zu Hilfe, nimmt mit den winzigen eine Klappe wieder heraus. Dies taten die Kinder aber nur dann,
Fingern die Klammer und reicht sie dem jungen Mann zurück. wenn sie erkannten, dass ihr Gegenüber dringend Hilfe benötigte.
Dieser Mann ist der Verhaltenswissenschaftler Felix Warneken Damit war ein Beleg dafür erbracht, dass bereits Kleinkinder fä-
vom Max-Planck-Institut (MPI) für Evolutionäre Anthropologie hig sind, sich vorzustellen, was in den Köpfen anderer Personen
LQ/HLS]LJ
GLH6LWXDWLRQLQGHUVLFK-XOLDEH¿QGHWLVWHLQH6WXGLH vorgeht, und dass sie sich zum Wohle anderer verhalten.
Warneken geht zusammen mit Prof. Michael Tomasello, dem Wenn also bereits sehr kleine Kinder eine altruistische Tendenz
Direktor der Abteilung für Vergleichende und Entwicklungspsy- aufweisen, liegt die Vermutung nahe, dass dieses Verhalten an-
chologie des MPI, der Frage nach, ob bereits Kleinkinder fremden geboren und in unseren Genen verankert ist. Diese stimmen zu
Personen bereitwillig zur Hand gehen, wenn sie selbst keinen 98,7 Prozent mit dem Erbgut der Schimpansen überein. Keine
Nutzen davon tragen. Dass erwachsene Menschen selbstlos und andere Affenart ist dem Mensch so nah in ihrer genetischen
damit altruistisch handeln, ist bereits bekannt. Sie helfen ande- Ausstattung. Aus diesem Grund wollten Prof. Tomasello und sein
58Gehirn, Kognition und Sprache
7HDPKHUDXV]X¿QGHQREVLFKGHQQDXFK6FKLPSDQVHQJHJHQEHU Beutetiere rotten sich zum Schutz gegen Feinde zusammen. Die-
Menschen altruistisch verhalten. Die Ergebnisse der Studie zeig- sem Verhalten muss keine Denkleistung zugrunde liegen und es
ten: ja, aber nur in einfachen Situationen. Für die jungen Affen kann sich, wenn jedes Tier einer Gruppe dasselbe Ziel verfolgt,
waren komplexere Herausforderungen, die die Kleinkinder noch als Zufälligkeit herausstellen. Auch der Mensch kooperiert – aber
gemeistert hatten, zu schwierig. Dann halfen sie nicht. Verein- auf komplexere Art und Weise. Durch die gezielte Wahl potenter
fachten die Forscher die Spielsituation, zeigten sich die Schim- Kooperationspartner lassen sich Probleme besser lösen und Vor-
SDQVHQDEHUVHKUZRKOKLOIVEHUHLWHWZDZHQQLKUH7LHUSÀHJHULQ haben schneller verwirklichen als im Alleingang. Teambildung
nach Gegenständen zu greifen versuchte, die sie nicht erreichen HUZHLVWVLFKLQGHU5HJHODOVHI¿]LHQWHUXQGHUWUDJUHLFKHU
konnte. „Dies ist die erste experimentelle Studie, die altruisti- 8PKHUDXV]X¿QGHQZLHNRPSOH[GLH=XVDPPHQDUEHLWVFKRQ
sches Verhalten zumindest ansatzweise bei nicht menschlichen bei Schimpansen ausgeprägt ist, führte Alicia Melis eine weitere
Primaten nachweist“, erklärt Warneken. In Zusammenarbeit mit Studie durch. Von den Affen wurde in den Versuchen ein hohes
Prof. Dr. Tomasello konnte er damit die bisherige Annahme widerle- Maß an Geschicklichkeit verlangt: Sie mussten an beiden Enden
gen, dass Schimpansen ausschließlich eigennützig handeln. eines Seiles ziehen, um an ein mit Futter beladenes Holzbrett zu
Die Versuche mit den Menschenaffen, die zu solchen Erkenntnis- JHODQJHQGDVPLWGHP6HLOYHUEXQGHQZDU'DV5DI¿QLHUWH
'LH
VHQIKUHQ¿QGHQKDXSWVlFKOLFKLP:ROIJDQJ.|KOHU=HQWUXP Tiere mussten an beiden Enden gleichzeitig ziehen. Taten sie das
für Primatenforschung im Zoo Leipzig statt. In der weltgrößten nicht, löste sich das Seil aus der Verankerung. Ganz trickreich
Menschenaffenanlage, dem Zoobesucher besser bekannt als wurde es, wenn die Seilenden so weit voneinander entfernt wa-
Ã3RQJRODQG¶N|QQHQ3URI'U7RPDVHOORXQGVHLQH0LWDUEHLWHU ren, dass sie ein Schimpanse allein nicht gleichzeitig mit beiden
Schimpansen, Bonobos, Gorillas und Orang-Utans unter idealen Armen erreichen konnte. Allein, das war dem Affen schnell klar,
Voraussetzungen beobachten. „Die Bedingungen, unter denen wir kam er in diesem Fall an das Futter nicht heran. Deshalb konnte
im Pongoland arbeiten, sind exzellent“, urteilt Prof. Tomasello. er die Hilfe eines von zwei Artgenossen in Anspruch nehmen,
=LHOGHUYRQLKPJHOHLWHWHQ$EWHLOXQJLVWHVKHUDXV]X¿QGHQZLH die in einem separaten Nebenraum auf ihren Einsatz warteten.
sich kognitive, insbesondere kommunikative Fähigkeiten, im Eine schwierige Situation und eine große Herausforderung für die
Laufe der Primaten-Evolution entwickelt haben. Dafür gilt es Tiere: „Sie mussten nicht nur wissen, wann sie Hilfe brauchen,
aufzuklären welche kognitiven Fähigkeiten die verschiedenen sondern diese sich auch selbst herbeiholen. Schließlich mussten
Menschenaffen mit uns Menschen teilen und welche nur wir besit- sie warten, bis der Helfer den Raum betritt und gleichzeitig mit
zen. Wie Affen kommunizieren und wie sie es lernen, sich sozial ihm am Seil ziehen. Dazu mussten sie wirklich verstanden haben,
in ihre Gemeinschaft einzufügen bildet dabei einen Forschungs- wozu sie den Partner brauchen“, erklärt Melis. In den Versuchen
schwerpunkt. Verglichen werden die Erkenntnisse teilweise auch zeigte sich, dass jeder Affe das Essen lieber alleine zu sich her-
mit Befunden aus der Forschung an Babys und Kleinkindern. anzog – wenn er es denn konnte. Vor die Wahl gestellt, das Futter
Untersucht wird, wie die Kinder lernen und wie sie Sprache, Auf- nicht greifen zu können oder teilen zu müssen, rekrutierten die
merksamkeit, Gedächtnis und Urteilsfähigkeit entwickeln. Schimpansen allerdings einen Partner. Auch in dieser Situation
Unter diesem stets vergleichenden Ansatz war es auch von Inter- lernten sie rasch. Stellte sich der eine Helfer ungeschickt an, wur-
esse zu prüfen, ob bereits Affen den Menschen ähnelnde Verhal- de bald nur noch der Clevere der beiden zu Hilfe geholt. Die Affen
tensweisen wie Missgunst und Boshaftigkeit zeigen. Das sollte erinnerten sich also genau, wer von beiden Kooperationspartnern
ein weiteres Projekt der Arbeitsgruppe Tomasellos aufklären. Der der schlechtere, welcher der bessere Helfer war. Ihre Wahl war
Wissenschaftler Keith Jensen analysierte mit Hilfe eines Tests, eindeutig: Sie bevorzugen den effektiveren Helfer. „Ein so hohes
wie boshaft oder selbstlos Schimpansen sich verhalten, wenn es Maß an Verständnis für kooperatives Handeln haben wir zuvor
um Futter geht. Er stellte die Tiere vor die Wahl: Sie konnten bei Tieren bislang nicht festgestellt“, konstatiert Melis.
entweder anderen Schimpansen durch Ziehen an einem Seil zu Diese Resultate stellen nur einen kleinen Teil der Erkenntnisse
Futter verhelfen oder den Leckerbissen stattdessen in einen leeren der Wissenschaftler des Max-Planck-Instituts für Evolutionäre
Raum befördern. In beiden Fällen ging dabei der Schimpanse, der Anthropologie dar, die darauf hinweisen, dass der Mensch sehr
am Seil zog, leer aus. Das Ergebnis: In der Hälfte aller Versuche viel mehr Fähigkeiten mit seinen nächsten Verwandten teilt, als
taten die Affen gar nichts, in je einem Viertel der Fälle wurde man bisher dachte. Daraus ergeben sich weitere spannende Fra-
das Futter zum Nachbarn oder in den leeren Raum gezogen. Die gen. „Bislang wissen wir nur, dass Schimpansen Menschen helfen.
Schimpansen handelten also weder selbstlos noch missgünstig. In weiteren Studien wollen wir untersuchen, ob die Schimpansen
„Sie schienen einfach nicht auf den anderen Schimpansen zu vielleicht auch andere Schimpansen altruistisch unterstützen,
achten“, erklärt Projektleiter Jensen. Das Interesse der Affen habe wenn es nicht um Futter geht“, gibt Prof. Tomasello als Ausblick.
ausschließlich dem Futter gegolten, auf nichts anderes hätten sie „Zudem müssen wir testen, ob die Affen auch dann miteinander
sich konzentriert. „Selbst als die Schimpansen herausgefunden kooperieren, wenn sie noch komplexere als die bisher von uns ge-
hatten, dass sie selbst das Futter nicht bekommen können, verhal- stellten Aufgaben lösen müssen.“ Auch Kinder wie Julia sollen in
fen sie ihrem Artgenossen nicht dazu“, sagt Jensen. Selbstlosigkeit Zukunft schwierigere Aufgaben bewältigen und werden durch ihr
oder Missgunst konnte den Schimpansen also nicht nachgewiesen Agieren das Wissen der Forscher erweitern. Beispielsweise soll
werden. geklärt werden, inwieweit die Kinder mit einem Erwachsenen zu-
Was aber passiert, wenn sich zwei Schimpansen zusammentun sammenarbeiten, um ihr Ziel zu erreichen. Dann wird sich zeigen,
müssen, weil sie nur durch Teamarbeit an Futter gelangen kön- ob wir unterschätzt haben, was in den Köpfen der Kleinen bereits
QHQ"6LHPVVWHQNRRSHULHUHQ,P7LHUUHLFKLVWGDVHLQHKlX¿J vorgeht, und vielleicht, dass Kleinkinder zu weit mehr kognitiven
anzutreffende Strategie: Raubtiere jagen effektiver in Rudeln, Leistungen fähig sind, als bisher angenommen.
59Der Alzheimerschen
Erkrankung auf der
Spur
%HQMDPLQ+DHUGOH6DQGUD+DVVH
E
twa 1.000.000 Menschen leiden in Deutschland unter Menschen in Deutschland bis zum Jahr 2050 mehr als verdoppeln.
der Alzheimerschen Erkrankung. Bislang gibt es jedoch Weltweit bemühen sich deshalb Forscher, wirkungsvolle Therapi-
keine Möglichkeit, diesem Leiden vorzubeugen oder es en zu entwickeln. Dabei sind sie Ansätze ganz verschieden.
wirkungsvoll zu therapieren. Auch die diagnostische Abgrenzung In der Abteilung für Neuroanatomie am Paul-Flechsig-Institut
gegenüber anderen Krankheiten mit ähnlicher Symptomatik ist arbeitet man an einem Konzept, dass davon ausgeht, dass bei
insbesondere in der Erkrankungsfrühphase schwierig. An den der Alzheimerschen Erkrankung die Fähigkeit des Gehirns zur
weltweiten Aktivitäten zur Aufklärung des Erkrankungsmecha- Selbstorganisation gestört ist: Das Gehirn ist dann nicht in der
nismus und der Entwicklung diagnostischer und therapeutischer Lage, seine eigene strukturelle Organisation und seine Arbeits-
Strategien ist in Deutschland auch das Paul-Flechsig-Institut für weise entsprechend anzupassen (neuronale Plastizität), wenn dies
Hirnforschung der Medizinischen Fakultät der Universität Leipzig durch veränderte funktionelle Anforderungen notwendig wird.
maßgeblich beteiligt: Die Forschergruppe um den Institutsleiter Besonders betroffen davon ist die Großhirnrinde. Eine Billion
Prof. Thomas Arendt entwickelte verheißungsvolle Ansätze für (1012) Nervenzellen lagern dort, und jede von ihnen kann mit
eine Therapie und einen Bluttest zur Frühdiagnose. 10.000 anderen Nervenzellen kommunizieren, sodass in diesem
Gehirnbereich mindestens eine Billiarde (1015) synaptische Kon-
'LH(UNUDQNXQJEHJLQQWODQJVDPXQGKlX¿JXQVSH]L¿VFK
$Q- taktstellen vorhanden sind. Hier sind die sogenannten höheren
fangs kann der Betroffene sich Namen oder Telefonnummern geistigen Leistungen lokalisiert: beispielsweise Bewusstsein,
nicht mehr merken. Später fallen ihm alltägliche Wörter nicht Gedächtnis und Kreativität. Durch die stetig aus der Umwelt
mehr ein, oder die Aussprache ist gestört. In diesem Stadium fällt eingehenden Informationen und die Auseinandersetzung mit
es manchen Patienten bereits schwer, sich räumlich zu orientieren. diesen werden in der Großhirnrinde ständig Verknüpfungen
Ist die Erkrankung noch weiter fortgeschritten, werden selbst zwischen Neuronen auf-, ab- und umgebaut. Solche dynamischen
Angehörige nicht mehr erkannt, und der Patient wird vollkommen Vorgänge sind die Grundlage aller menschlichen Lernprozesse.
DEKlQJLJYRQ3ÀHJHXQG%HWUHXXQJ6HLWGHUED\HULVFKH1HUYHQ- Dabei restrukturiert sich das Gehirn fortwährend und passt
arzt Alois Alzheimer vor einhundert Jahren (1906) den ersten Fall sich damit optimal an die Umweltbedingungen an. Das geht
dieser „eigenartigen Nervenkrankheit“ veröffentlichte, forschen 50, 60 oder auch 70 Jahre gut, doch dann reagieren mitunter
Wissenschaftler nach der Ursache. Im weltweiten Wettbewerb um GLHHLJHQWOLFKÀH[LEOHQ1HUYHQ]HOOHQQLFKWPHKUVRZLHHVLKUH
GLHNQLIÀLJH6XFKHQDFK'LDJQRVHXQG7KHUDSLHP|JOLFKNHLWHQ eigentliche Bestimmung vorsah. Stattdessen wird ein genetisch
der Erkrankung wirkt auch das renommierte Paul-Flechsig-Insti- gesteuertes Entwicklungsprogramm reaktiviert, das bei ausge-
tut für Hirnforschung in vorderer Reihe mit. reiften Nervenzellen Mechanismen der Zellteilung auslöst. Das
Die Alzheimer-Krankheit, die vor allem Menschen im höheren führt fatalerweise zum Tod der Neurone. Wie dies vonstatten
Alter heimsucht, ist in den Augen von Prof. Arendt „eine der geht, können die Wissenschaftler im Detail beschreiben – die
größten sozial-ökonomischen und medizinischen Herausforde- Frage nach dem Warum bleibt aber bislang noch unbeantwortet.
rungen“, denn in den westlichen Industriestaaten kommt es durch „Neuronale Plastizität und Zellteilungsmechanismen sind offen-
den derzeitigen demographischen Wandel, hin zur überalterten bar alternative zelluläre Effekte, die vergleichbare molekulare
Gesellschaft, zu einem drastischen Anstieg der Patientenzahlen. Mechanismen zur Grundlage haben“, erklärt Prof. Arendt. „Unter
Beispielsweise wird sich nach aktuellen Angaben der Deutschen bestimmten Bedingungen, die wir bisher ungenügend verstehen,
Alzheimer Gesellschaft die Zahl der unter Alzheimer leidenden kann die Nervenzelle aus dem ‚Plastizitätsprogramm‘ in das
60Gehirn, Kognition und Sprache
‚Zellteilungsprogramm‘ umschalten. Genau dies geschieht bei schränkt und umfassen immer nur bestimmte Aspekte der Er-
der Alzheimerschen Erkrankung mit verheerenden Folgen für krankung. Allerdings gibt es immer wieder Hoffnungsschimmer:
das betroffene Neuron – es stirbt.“ So konnten die Forscher des Paul-Flechsig-Instituts nachweisen,
Der Forschungsansatz, mit dem die Leipziger Neurowissenschaft- dass bestimmte molekulare Veränderungen, die bislang als für
ler gegen die in den USA auch unter dem Namen „schleichende die Alzheimersche Erkrankung spezifisch galten, auch unter
Epidemie“ bekannte Krankheit vorgehen wollen, führt in Rich- physiologischen (nicht-pathologischen) Bedingungen vorkommen
tung Gentherapie. Mit einem sogenannten Genschalter wollen die können. Dies belegten Versuche mit europäischen und arktischen
Forscher die Aktivität des „P16 Gens“ im Gehirn anschalten – ein Nagetieren, die Winterschlaf halten, was mit deutlich verminder-
Steuerungs-Gen, das den Eintritt einer Nervenzelle in den Zell- ter Hirnaktivität einhergeht. Dieser Zustand ist in einer Weise mit
teilungszyklus verhindert. Ziel der Therapie ist also die selektive Veränderungen von zellulären Strukturproteinen verbunden, die
Aktivierung des P16 Gens, die Nervenzellen daran hindern soll, bisher nur von der Alzheimerschen Erkrankung bekannt waren.
den Mechanismus der für sie tödlichen Zellteilung zu aktivie- Am Ende des Winterschlafs, wenn die Tiere ihre Hirnaktivitäten
ren. In Experimenten mit Labormäusen waren die Forscher mit innerhalb weniger Stunden wieder drastisch erhöhen, verschwin-
dieser Methode schon erfolgreich. Bei Menschen ist die gezielte den diese Veränderungen vollständig. Eine Fähigkeit, über die das
Genaktivierung jedoch weitaus komplizierter. Demzufolge ist es Gehirn von Alzheimer-Patienten nicht verfügt. Die Untersuchung
äußerst schwierig und zeitaufwendig, eine wirkungsvolle Thera- der zugrunde liegenden Regelmechanismen bei den Nagetieren
pie zu entwickeln. Bis zur Anwendung beim Menschen wird noch lieferte wichtige neue Erkenntnisse darüber, wie die Zellaktivität
umfangreiche experimentielle Forschung notwendig sein. und der Zelluntergangs im Gehirn gesteuert werden. Dafür wurde
Derzeit gibt es ausschließlich eine Behandlung gegen die Sym- den Leipziger Hirnforschern im Jahr 2004 von der Universität
ptome von Alzheimer: Medikamente, die den Abbau von Aze- Frankfurt am Main der Alois-Alzheimer-Preis verliehen.
tylcholin verlangsamen. Der Hintergrund: Die Neurone der Auch auf dem Feld der Diagnostik kann das Paul-Flechsig-Insti-
menschlichen Großhirnrinde produzieren selbst den neuronalen tut erste Erfolge vermelden: Die Wissenschaftler entwickelten
Botenstoff Azetylcholin. Sterben sie aufgrund der Alzheimer- einen bislang einzigartigen unkomplizierten Bluttest, mit dem
schen Erkrankung, kommt es zu einem Mangel an Botenstoff und zukünftig auch ein niedergelassener Hausarzt die Krankheit
dies verursacht gestörte Hirnfunktionen. Durch das Medikament schon im Frühstadium nachweisen könnte. Ansatzpunkt für die
können solche Leistungsverluste wie Gedächtnisprobleme zu- Entwicklung des Tests war die Beobachtung, dass die im Gehirn
nächst gemildert werden, der fortschreitende Krankheitsverlauf entdeckte gestörte Zellteilung auch andere Bereiche des Körpers
wird jedoch nicht aufgehalten. In der Regel verstirbt der Patient betrifft. So lässt sich die Zellteilungsstörung beispielsweise an
acht Jahre nach der Diagnose. ZHLHQ%OXWN|USHUFKHQXQPLWWHOEDUPHVVHQ0RPHQWDQEH¿QGHW
Der bislang erfolglose Kampf gegen die unheilbare Krankheit sich der Test in der Erprobungsphase und liefert erste positive
hat mehrere Gründe: So ist immer noch ungenügend verstanden, Zwischenergebnisse. Dies ist eine Bestätigung für die Leipziger
wie die neuronale Plastizität reguliert wird. Zudem ist mit der Forscher, doch Prof. Arendt schränkt zugleich ein: „Eine Diagno-
Großhirnrinde genau jene Hirnregion betroffen, die das höchste se ist nur dann sinnvoll, wenn es auch eine Therapiemöglichkeit
Maß an neuronaler Plastizität besitzt. Auch sind therapeutische gibt.“ Nach Schätzung der Leipziger Wissenschaftler wird es
Eingriffe in die Regulationsmechanismen prinzipiell schwer zu jedoch noch mindestens 30 Jahre dauern, bis Alzheimer geheilt
realisieren, weil sie immer das Risiko bergen, kognitive Fähig- werden kann.
keiten zu beeinträchtigen. Erschwerend kommt hinzu, dass das Seit nunmehr fast 25 Jahren arbeitet Prof. Arendt am Paul-Flech-
in einer knöchernen Schale liegende Gehirn zu Lebzeiten nur sig-Institut – einer Einrichtung, die der für seine Forschung zur
schwer zu untersuchen ist: Es gibt bisher keine Verfahren, die es Myelogenese weltweit bekannte Paul Flechsig im Jahre 1883 als
ermöglichen, die hochkomplexen Verknüpfungen zwischen den „hirnanatomisches Laboratorium“ gründete. Diese Tradition
Nervenzellen zu analysieren. Andere Organe wie beispielsweise setzt sich bis heute fort: Leipzig hat sich zu einem international
Leber, Lunge oder Niere sind einer Untersuchung wesentlich anerkannten Standort der Alzheimer-Forschung entwickelt.
besser zugänglich. Mittlerweile gibt es auch ein Alzheimer-Zentrum in Leipzig,
Derzeit gibt es zwei Varianten, mit denen die Wissenschaftler das über das die Wissenschaftler des Paul-Flechsig-Instituts mit
menschliche Gehirn genauer untersuchen können: zum einen mit- vielen Kliniken kooperieren. Mit dem Max-Planck-Institut für
tels nicht-invasiver bildgebender Verfahren wie Positronenemis- Evolutionäre Anthropologie, dem Max-Planck-Institut für Ko-
sions-Tomographie (PET) oder Magnetresonanz-Tomographie gnitions- und Neurowissenschaften und der Forschungsinitiative
(MRT), die in Zusammenarbeit mit dem Max-Planck-Institut für „Neurodegeneration und Demenz – Kolleg für Angewandte Neu-
Kognitions- und Neurowissenschaften durchgeführt werden, zum rowissenschaften Leipzig“ existiert in Leipzig ein aktives lokales
anderen über die postmortale Untersuchung des Gehirns. Diese Alzheimer-Netzwerk: eine wertvolle Stütze für den weiten und
bildet einen Arbeitsschwerpunkt der Forscher am Paul-Flechsig- beschwerlichen Weg zur Heilung der Erkrankung. „Es ist faszi-
Institut. Doch was diese Methoden vermögen, ist begrenzt. Die nierend zu erleben, wie sich unser Wissen über diese Erkrankung
tomographische Darstellung der Hirnaktivität liefert noch keine in den letzten Jahren entwickelt hat“, resümiert Prof. Arendt, „und
DXVUHLFKHQGJXWH$XÀ|VXQJDXI=HOOHEHQHXQGSRVWPRUWHP8Q- wie wir über diesen Umweg uns zugleich dem Verständnis der
tersuchungen von Hirngewebe lassen es nicht zu, rückwirkend normalen Hirnfunktion weiter annähern.“
Aussagen über dynamische Ablaufe in der Hirnrinde zu treffen.
Da die Alzheimersche Erkrankung bei Tieren nicht auftritt, sind
Möglichkeiten zu Untersuchungen an Tiermodellen sehr einge-
61de gi ku bo de bo gi to de b
gi to de bo gi ku de gi ku b
de bo gi ku de gi ku bo de b
Der Mensch als
ku boanimal
de bo gi to de bo gi k
de bo grammaticus
gi ku de gi ku bo de
gi ku de gi ku bo de bo gi t
%HQMDPLQ+DHUGOHXQG&RUQHOLD-lQLFKHQ
U
nser Sprachvermögen ist bekanntlich ein wesentliches dert Jahre nach der ersten Autopsie ist das vollständig erhaltene
Merkmal, das uns von nicht-menschlichen Primaten Orginalgehirn des 1865 verstorbenen Patienten „Tan“ in einem Pa-
unterscheidet. Aber wie ist es uns möglich, Sprache zu riser Anatomie-Institut einer erneuten Untersuchung unterzogen
verstehen und zu erzeugen? Welche neuroanatomischen und funk- worden. Die Forscher konnten mit Hilfe der gerade entwickelten
tionellen Besonderheiten besitzt der Mensch? Wie sind Anatomie Computertomographie eine viel größere Schädigung des Gehirns
und Funktion des Gehirns miteinander verknüpft, um uns zum im gesamten vorderen Teil der linken Hemisphäre feststellen, als
Sprachverstehen zu befähigen? Mit diesen grundlegenden Fragen von außen sichtbar war.
beschäftigt sich am Leipziger Max-Planck-Institut für Kognitions- Um 1874 beschrieb der deutsche Neurologe und Psychiater Carl
und Neurowissenschaften die Arbeitsgruppe „Neurokognition Wernicke (1848 – 1905) ein anderes beobachtbares Phänomen bei
von Sprache“ unter Leitung von Prof. Angela Friederici. In einem Patienten, die Verletzungen in der oberen Windung des Schläfen-
Forschungsprojekt fanden die Wissenschaftler kürzlich heraus, ODSSHQVDXIZLHVHQ6LH]HLJWHQ]XP7HLOVFKZHUH'H¿]LWHEHLP
dass komplizierte Satzstrukturen in einem Hirnareal analysiert Sprachverständnis, benutzten Wörter und bildeten Sätze, die
werden, über das nur der Mensch als „animal grammaticus“ zu keinen Sinn ergaben (sog. „Wernicke-Aphasie“). Bis vor wenigen
verfügen scheint. Jahrzehnten noch galten im Gehirn Spracherzeugung (-produkti-
on) und Sprachwahrnehmung (-perzeption) durch Lokalisierung
Der französische Arzt und Neurologe Paul Pierre Broca (1824 des „Broca-Areals“ als des motorischen Sprachzentrums und
– 1880) hat als einer der ersten Wissenschaftler an einem Patien- des „Wernicke-Areals“ als des sensorischen Sprachzentrums
ten festgestellt, dass unsere Sprachproduktion dann erhebliche funktionell voneinander abgrenzbar.
Beinträchtigung erfährt, wenn ein spezieller Bereich in der Seitdem entwickelten sich jedoch Theoriebildung, Forschungs-
linken vorderen Hirnhälfte (Hemisphäre) beschädigt ist. Dieser methoden und -ansätze auf der Suche nach den neuronalen
Fall ist in die Geschichte der Neuropsychologie als „Monsieur Grundlagen des menschlichen Sprachvermögens rasant. So zeigen
Tan“ eingegangen, da betreffender Patient einfache Fragen zwar neuere Studien mit bildgebenden Verfahren, dass das Broca-Areal
verstehen, diese jedoch nur noch mit der Silbe „tan“ beantworten ebenso bei Prozessen des Sprachverstehens mit beteiligt ist. Einen
konnte. Die Diagnose, die sogenannte „Broca-Aphasie“, führte wesentlichen Anteil an diesen neuartigen Erkenntnissen haben die
zu der Schlussfolgerung, dass sich im unteren Teil der dritten Forschungen der Arbeitsgruppe „Neurokognition von Sprache“
6WLUQKLUQZLQGXQJGHU6LW]GHU6SUDFKHU]HXJXQJEH¿QGHW+XQ von Direktorin Prof. Angela Friederici am Leipziger Max-Planck-
62b Gehirn, Kognition und Sprache
b Institut für Kognitions- und Neurowissenschaften. Erst kürzlich,
Anfang 2006, war von ihrem Wissenschaftlerteam herausgefun-
den worden, dass im menschlichen Gehirn ein weiteres Hirnareal,
das sogenannte „frontale Operculum“, für die Verarbeitung von
Sprache aktiviert wird.
Experiment im Gegensatz zu natürlich gesprochener Grammatik
ist der, dass andere Strukturelemente der Sprache (Semantik,
3KRQRORJLH0RUSKRORJLH NHLQH]XVlW]OLFKHQ(LQÀVVHDXIGHQ
neurologischen Verarbeitungsprozess nehmen können.
Zwei Tage vor dem Experiment trainierten vierzig Versuchsper-
In der von Jörg Bahlmann durchgeführten Studie entdeckten die sonen beide Grammatiktypen. Eine Gruppe lernte die „Über-
b MPI-Forscher, dass in dieser evolutionär älteren Hirnregion nur
einfache Grammatiken und Sprachstrukturen verarbeitet werden.
Für das Verstehen komplizierter Sprachstrukturen „nutzt“ der
Mensch das entwicklungsgeschichlich später entstandene Broca-
Areal. Verschiedene Verarbeitungsleistungen der Sprache laufen
gangswahrscheinlichkeit“, die andere Gruppe die „Hierarchie“.
Während der fMRT-Untersuchung wurden neue Abfolgen von
Silben über einen Bildschirm präsentiert, die syntaktisch „richtig“
(korrekte Sequenzen) oder „fehlerhaft“ (inkorrekte Sequenzen)
waren. Dabei wurde das Anwendungsvermögen der gelernten
folglich nach einem fein ausbalancierten Erkennungsprogramm Regeln gemessen bzw. die Versuchspersonen sollten jede Se-
k DE,QQHUKDOEYRQ%UXFKWHLOHQHLQHU6HNXQGHLGHQWL¿]LHUHQXQVHUH
Nervenzellen im Gehirn Wörter und ihre grammatischen Zuord-
nungen (z. B. Substantiv, Verb). Zusammen mit dem Broca-Areal
werden Sätze auf Syntax, Logik und Sinn hin geprüft und wird
letztlich für eine Interpretation des Gesprochenen gesorgt.
quenz nach der Grammatikalität bewerten (richtig/falsch). Beim
Verarbeiten beider Regeltypen ließen sich, wie zuvor als These
aufgestellt, Aktivitäten in einem menschheitsgeschichtlich älte-
ren Hirnareal (frontales Operculum) nachweisen. Wie vermutet
worden war, zeigte eine jüngere Hirnstruktur (Broca-Areal)
Speziell das Anwenden komplexer sprachlicher Regeln wird nur dann Aktivitäten, wenn hierarchische Regeln von den Ver-
dafür verantwortlich gemacht, dass Menschen im Gegensatz zu suchspersonen verarbeitet wurden. Wenn einfache Regeln vom
anderen Spezies lange Sätze erzeugen und verstehen können. Gehirn verarbeitet werden, wie beim Affen offenbar auch, wird
Wenn man die Regeln der Sprache (Syntax) analysiert, kann man das stammesgeschichtlich ältere Areal aktiviert. Beim Anwen-
zwei grundlegende Muster von Grammatik unterscheiden. Eine den komplexerer Regeln, die der Affe nicht beherrscht, wird das
einfache Regel ist das richtige Bilden von grammatisch korrekten Broca-Areal herangezogen.
t
(wahrscheinlichen) Wortverbindungen (Übergängen) wie z. B. In einem zweiten Versuchsteil, bei dem die Methode der diffusi-
bei Artikel und Substantiv („ein Lied“) gegenüber ungrammati- onsgewichteten Bildgebung (diffusion tensor imaging, DTI) zum
schen (unwahrscheinlichen) Wortverbindungen wie z. B. Artikel Einsatz kam, wurden strukturelle Verknüpfungen (Konnektivität)
und Verb („ein gefällt“). So ist die Wahrscheinlichkeit, dass ein der beiden Hirnregionen untersucht. Beide Hirnareale konnten
Substantiv auf einen Artikel folgt, sehr hoch, dass demgegenüber auch hier voneinander abgegrenzt werden. Das frontale Opercu-
ein Verb einem Artikel nachsteht, jedoch sehr gering. Um aber lum war über die Faserverbindungen (fasciculus uncinatus) mit
längere Sätze verstehen zu können, benötigt man ein komplexe- den vorderen Bereichen des Schläfenlappens verknüpft. Hinge-
res Strukturmodell, das hierarchische Abhängigkeiten zwischen gen wies das Broca-Areal Verknüpfungen auf, welche (über den
Satzverbindungen festlegt, um diese miteinander zu verknüpfen fasciculus longitudialis superior) zu den hinteren Bereichen des
(z. B. eingeschobener Nebensatz: „Das Lied [das der Junge sang] Schläfenlappens führten.
JH¿HOGHP/HKUHU³ Zusammenfassend konnte festgestellt werden, dass durch zwei
Tecumseh Fitch, Kognitionsbiologe an der schottischen University unterschiedliche bildgebende Verfahren (fMRT und DTI-Mes-
of St. Andrews und Leibnizprofessor der Universität Leipzig im sung) beide Hirnareale in Funktion und Struktur voneinander
Wintersemester 2005/06, konnte in Verhaltensexperimenten nach- abgrenzbar waren. Höchst aufschlussreich ist dieser Befund
weisen, dass nicht-menschliche Primaten wie die Tamarin-Äff- für die Lokalisierung entscheidender Funktionsbereiche im
chen einfache grammatische Übergangsregeln verarbeiten kön- menschlichen Gehirn, die Sprachverarbeitungsprozesse steuern.
nen, nicht aber hierarchische Regeln. Dieses interessante Ergebnis Zum anderen konnten die Forscher zeigen, auf welche Weise
hatte die Max-Planck-Wissenschaftler um Angela Friederici dazu komplexe Fragestellungen wie zum Beispiel die Entstehung des
YHUDQODVVWLQHLQHPIXQNWLRQHOOHQ0DJQHWUHVRQDQ]WRPRJUD¿H menschlichen Sprachvermögens fachübergreifend in den mo-
(fMRT)-Experiment die Hirnaktivitäten beim Menschen bei der dernen Kognitions- und Neurowissenschaften aufgegriffen und
9HUDUEHLWXQJGHUEHLGHQ0RGHOOHÃhEHUJDQJVZDKUVFKHLQOLFKNHLW¶ untersucht werden.
XQGÃ+LHUDUFKLH¶PLWHLQDQGHU]XYHUJOHLFKHQ Doch dies ist für MPI-Direktorin Friederici, die außerdem Di-
Dazu erzeugten sie künstliche Grammatiken mit sinnlosen, aber rektorin des Zentrums für Kognitionswissenschaften (ZfK) am
strukturierten Silben (z. B. de bo gi to). Die Aneinanderreihung Zentrum für Höhere Studien der Universität Leipzig ist, erst der
dieser Silben erfolgte entweder gemäß der einfachen Regel Anfang. Derzeit laufen ihr zufolge Vorbereitungen, ähnliche
(„Übergangswahrscheinlichkeit“) oder der komplexeren Regel Versuche in Zusammenarbeit mit dem MPI für evolutionäre
(„Hierarchie“). Alle Silben wurden in zwei Kategorien unterteilt. Anthropologie auch mit Menschenaffen durchzuführen. Schim-
Kategorie A-Silben endeten mit lautlich hellen Vokalen (de, gi, pansen, dem Menschen in ihren Genen am nächsten, kämen dafür
le ...), Kategorie B-Silben endeten mit dunklen Vokalen (bo, fo, in Frage, aber denkbar seien die Versuche auch mit Bonobos.
gu, …). Die einfache Regel bildete abwechselnde Folgen von den Und noch eine Aufgabe haben die Grundlagenforscher vor sich:
Kategorien A und B (z. B. AB AB = de bo gi ku), die komplexe Sie wollen als nächstes wissen, was die unterschiedlichen Ver-
Regel bildete dagegen Hierarchien durch das Verknüpfen beider knüpfungen der frontalen Hirnreale zum Schläfenlappen für die
Kategorien (z. B. AA BB = de gi ku bo). Dieses Prinzip entspricht Sprachverarbeitung im Detail bedeuten.
dem Versuch, Grammatik auf einfachste formale Regeln zu redu-
zieren. Das heißt, der Vorteil von künstlichen Grammatiken im
63Sie können auch lesen