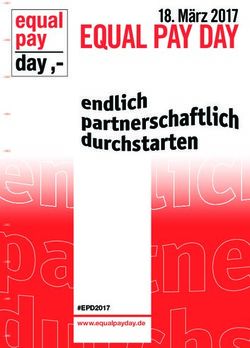Genossenschaftliche Potenziale für Empowerment am Beispiel türkischer Frauengenossenschaften
←
→
Transkription von Seiteninhalten
Wenn Ihr Browser die Seite nicht korrekt rendert, bitte, lesen Sie den Inhalt der Seite unten
Seyda Göksu
Genossenschaftliche Potenziale für Empowerment am
Beispiel türkischer Frauengenossenschaften
Keywords: Empowerment; Frauengenossenschaften; Genossenschaften; genossenschaftliche
Prinzipien; Sozialgenossenschaften; türkisches Genossenschaftswesen
Empowermentprozesse beziehen sich auf solidarische Aktionen benachteiligter Menschen, die
durch gemeinschaftliche Selbsthilfe schwierige Lebenslagen überwinden möchten. Qualitative
Interviews mit aktiven Mitgliedern türkischer Frauengenossenschaften hinsichtlich erlebter
Empowermentprozesse zeigen, dass das Ausleben genossenschaftlicher Prinzipien in der Orga‐
nisationsform der Frauengenossenschaft ein großes Potenzial für das psychologische, politi‐
sche und ökonomische Empowerment von Frauen in sich birgt.
1. Einleitung
1.1 Problemstellung
Angesichts der internationalen Wirtschafts- und Finanzkrisen, der fortschreitenden Globalisie‐
rung und des Strukturwandels im sozialen Sektor sind Genossenschaften wieder vermehrt in
den Fokus der Öffentlichkeit gerückt. In Genossenschaften schließen sich Personen freiwillig,
autonom und selbstverantwortlich zusammen, um ihre Interessen durch ein gemeinsam getrage‐
nes, demokratisch kontrolliertes Unternehmen zu fördern. Insbesondere Sozialgenossenschaften
haben zum Ziel, die sozialen Belange ihrer Mitglieder, Dritter und der Allgemeinheit zu för‐
dern. Als Alternativen innerhalb der kapitalistischen Wirtschaftsordnung sind sie für die Eman‐
zipation und das Empowerment benachteiligter Menschen von Interesse. Zu den sozioökono‐
misch benachteiligten Gruppen der Gesellschaft gehören bis heute auch Frauen in vielen Berei‐
chen des Lebens. Diese Ungleichheit begründet die Relevanz der vorliegenden Untersuchung.
Im internationalen Kontext konzentrieren sich Untersuchungen zu Frauen und Genossenschaf‐
ten u.a. auf das Empowerment von Frauen. Empowermentprozesse beziehen sich auf solidari‐
sche Aktionen benachteiligter Menschen in Lebenssituationen relativer Ohnmacht, die durch
gemeinschaftliche Selbsthilfe schwierige Lebenslagen gemeinsam überwinden möchten. Auf‐
grund ihrer besonderen Prinzipien scheinen Genossenschaften geeignete Gebilde für die Schaf‐
fung und Entwicklung von Empowermentprozessen zu sein. Diesem Gedanken folgend wird
am Beispiel türkischer Frauengenossenschaften untersucht, ob die Mitgliedschaft in Frauenge‐
nossenschaften als ein spezifischer Typ von Sozialgenossenschaften zum Empowerment von
Frauen beiträgt. Es wird folgende Forschungsfrage formuliert:
https://doi.org/10.5771/0344-9777-2020-1-2-132
Generiert durch IP '46.4.80.155', am 27.06.2025, 11:41:17.
132 Das Erstellen und WeitergebenZögU 43. Jg.dieses
von Kopien 1-2/2020,
PDFsDOI: 10.5771/0344-9777-2020-1-2-132
ist nicht zulässig.Genossenschaftliche Potenziale für Empowerment am Beispiel türkischer Frauengenossenschaften
„Trägt das aktive Mitwirken als Mitglied einer Frauengenossenschaft zum Empowerment türki‐
scher Frauen bei?“
1.2 Ziel der Arbeit
Anhand der Problemstellung wird deutlich, dass Empowerment eine Nähe zur genossenschaftli‐
chen Organisationsform widerspiegelt und daher auf genossenschaftliche Selbsthilfegebilde an‐
wendbar ist. Ziel der empirischen und konzeptionellen Arbeit ist es daher, genossenschaftliche
Potenziale für Empowerment zu identifizieren und somit einen Beitrag zur Empowerment- und
Genossenschaftsforschung zu leisten. Der Fokus der empirischen Untersuchung liegt auf den
subjektiven Wahrnehmungen von aktiven Genossenschaftsmitgliedern hinsichtlich erlebter Em‐
powermentprozesse. Diese werden auf Basis von qualitativen Interviews mit Mitgliedern türki‐
scher Frauengenossenschaften in der Türkei erhoben.
1.3 Aufbau der Arbeit
In Kapitel 2 werden zunächst die konzeptionellen und begrifflichen Grundlagen erläutert. Für
eine systematische Beantwortung der Forschungsfrage ist ein grundlegendes Verständnis von
Genossenschaften Voraussetzung. Daher werden in Kapitel 2.1 zunächst die genossenschaftli‐
chen Prinzipien sowie die Wirtschafts- und Rechtsform von Genossenschaften erläutert. Dar‐
auffolgend werden Sozialgenossenschaften und Frauengenossenschaften als ein spezifischer
Typ von Sozialgenossenschaften vorgestellt und definiert. In Kapitel 2.2 werden die Entstehung
des Begriffs Empowerment und verschiedene konzeptionelle Auffassungen wiedergegeben, be‐
vor eine eigene Definition vorgenommen wird. Nachdem in den ersten beiden Unterkapiteln
strukturelle Merkmale von Genossenschaften identifiziert und Empowerment operationalisiert
wurden, wird darauf aufbauend für den empirischen Teil der Arbeit in Kapitel 2.3 ein konzep‐
tioneller Bezugsrahmen zu genossenschaftlichen Potenzialen für Empowerment entworfen. In
Kapitel 3 wird der Untersuchungsgegenstand türkische Frauengenossenschaften aus verschie‐
denen Perspektiven vorgestellt. Dem wird eine kurze Einführung in das Genossenschaftswesen
der Türkei vorgeschoben, was dem Leser Hintergrundinformationen für ein tieferes Verständnis
der empirischen Daten geben soll. Das methodische Vorgehen wird in Kapitel 4 erläutert. Es
umfasst die Planung der empirischen Untersuchung, den Verlauf der Datenerhebung und die
Analyse und Interpretation der leitfadengestützten Interviews. In Kapitel 5 werden die kategori‐
enbasierten Ergebnisse vorgestellt und analysiert. Kapitel 6 dient der Zusammenfassung und
Bewertung der zentralen Ergebnisse.
2. Begriffliche und konzeptionelle Grundlagen
Kapitel zwei behandelt die begrifflichen und konzeptionellen Grundlagen, die für das Verständ‐
nis der Arbeit als wesentlich erachtet werden. Im ersten Teil des Kapitels erfolgt zunächst eine
https://doi.org/10.5771/0344-9777-2020-1-2-132
Generiert durch IP '46.4.80.155', am 27.06.2025, 11:41:17.
ZögU 43. Jg. 1-2/2020 Das Erstellen und Weitergeben von Kopien dieses PDFs ist nicht zulässig. 133Seyda Göksu
zusammenfassende Erläuterung des Genossenschaftsbegriffs. Hierbei werden Frauengenossen‐
schaften als ein spezifischer Typ von Sozialgenossenschaften definiert. Im zweiten Teil werden
verschiedene konzeptionelle Auffassungen von Empowerment vorgestellt und eine eigene Defi‐
nition formuliert. Das Kapitel endet mit der Entwicklung eines konzeptionellen Bezugsrahmens
zu den genossenschaftlichen Potenzialen für Empowerment.
2.1 Genossenschaften
2.1.1 Die genossenschaftliche Wirtschafts- und Rechtsform
Der Genossenschaftsbegriff ist entwicklungsgeschichtlich betrachtet kein Rechtsbegriff, son‐
dern ein wirtschaftlicher und soziologischer (vgl. Beuthien u. a. 2011, S. 31). Das gemeinsame
Wirtschaften unter Menschen gab es schon lange vor der Etablierung der genossenschaftlichen
Rechtsform bzw. ohne dass ein bestimmtes Organisationsgesetz für diese Art des Wirtschaftens
existierte (vgl. Blome-Drees u. a. 1998, S. 14). Somit wird in der Genossenschaftswissenschaft
zwischen der genossenschaftlichen Wirtschafts- und Rechtsform unterschieden.
Bei der genossenschaftlichen Wirtschaftsweise handelt es sich um eine Form wirtschaftlicher
Kooperation. Ziel dieser Kooperation ist es, die Lebenslagen der Mitglieder zu verbessern oder
zumindest zu stabilisieren. Im Grunde geht es um die Schaffung von Teilhabemöglichkeiten,
Handlungsspielräumen und Verwirklichungschancen, die Mitglieder der Genossenschaft für
ihre persönliche Lebensgestaltung nutzen können (vgl. Blome-Drees 2018, S. 237). Die Idee
der genossenschaftlichen Wirtschaftsweise ist prinzipiell rechtsformneutral (vgl. Zerche/
Schultz 2000, S. 3), d.h. Unternehmen mit genossenschaftlicher Zielsetzung müssen keine ein‐
getragenen Genossenschaften (eG), sondern können beispielsweise auch Aktiengesellschaften
oder GmbHs sein. Entscheidend sind die Einhaltung bzw. das Ausleben der als wesensbestim‐
mend erachteten genossenschaftlichen Werte und Prinzipien. Wirtschafts- und Rechtsform sind
auf einen gemeinsamen Zweck der Mitglieder ausgerichtet, und zwar die Förderung der Mit‐
glieder (Förderprinzip). Der Unterschied zwischen der Wirtschafts- und Rechtsform der Genos‐
senschaft ist, dass die eG ihren Förderzweck nicht irgendwie, sondern auf eine ganz bestimmte
Art und Weise verfolgt: „Die Besonderheit des Förderzwecks einer eG besteht darin, dass deren
Mitglieder in gemeinschaftlicher Selbsthilfe ein Unternehmen gründen und unterhalten, dem sie
als Kunden gegenübertreten, um bestimmte, in der Satzung näher festgelegte Förderleistungen
zu erhalten“ (Beuthien u. a. 2011, S. 11).
Daraus folgt das Identitätsprinzip. Dieses beinhaltet, dass die Mitglieder identisch mit den Kun‐
den bzw. Lieferanten (bei Fördergenossenschaften) oder Mitarbeitern (bei Produktivgenossen‐
schaften) einer Genossenschaft sind. Im deutschen Genossenschaftsgesetz (GenG), stark von
den Überzeugungen des Genossenschaftspioniers Hermann Schulze-Delitzsch geprägt, wird das
Förder- und Identitätsprinzip in § 1 Absatz 1 GenG zwingend festgelegt, weshalb man die eG
als gesetzlich zweckgebundene Vereinigung bezeichnet: „Gesellschaften von nicht geschlosse‐
ner Mitgliederzahl, deren Zweck darauf gerichtet ist, den Erwerb oder die Wirtschaft ihrer Mit‐
glieder oder deren soziale oder kulturelle Belange durch einen gemeinschaftlichen Geschäftsbe‐
https://doi.org/10.5771/0344-9777-2020-1-2-132
Generiert durch IP '46.4.80.155', am 27.06.2025, 11:41:17.
134 Das Erstellen und Weitergeben von Kopien dieses PDFs ist nicht zulässig. ZögU 43. Jg. 1-2/2020Genossenschaftliche Potenziale für Empowerment am Beispiel türkischer Frauengenossenschaften
trieb zu fördern, erwerben die Rechte einer "eingetragenen Genossenschaft" nach Maßgabe die‐
ses Gesetzes“ (§ 1 Absatz 1 GenG).
Die Verantwortung gegenüber den Mitgliedern ist das zentrale Element der genossenschaftli‐
chen Unternehmenspolitik (vgl. Blome-Drees 2008, S. 19). Nichtmitgliedergeschäfte sind prin‐
zipiell möglich, stellen jedoch nur Mittel zum Zweck einer wirksameren Mitgliederförderung
dar. Die eG erhält keinen Förderauftrag, sondern verfolgt lediglich ihren satzungsgemäß näher
bestimmten Förderzweck, der, ebenso wie der Unternehmensgegenstand, von den Mitgliedern
der Genossenschaft selbst definiert wird (vgl. Beuthien u. a. 2011, S. 11 f.). Fördermittel und
Förderziel sind rechtlich untrennbar miteinander verknüpft. Es dürfen weder hauptsächlich er‐
werbswirtschaftliche, noch überwiegend drittnützige Ziele verfolgt werden. Jedoch ist es der
eG gestattet, neben ihrem förderwirtschaftlichen Hauptzweck auch nichtförderwirtschaftliche,
z. B. drittnützige Nebenzwecke zu verfolgen (Nebenzweckprivileg). Dies ist vor allem im Hin‐
blick auf Nichtmitgliedergeschäfte relevant. Genossenschaften streben zunächst nicht nach
einer möglichst hohen Kapitalrendite und sind nicht von Investor-Interessen dominiert, denn
Wertschöpfung und Wertverteilung sind an die Zweckbestimmung der eigenen Mitglieder ge‐
bunden. Das Kapital hat lediglich eine dienende Funktion, nämlich die langfristige Förderung
der Mitglieder durch die Errichtung und Erhaltung eines gemeinschaftlichen Geschäftsbetriebs
(vgl. Blome-Drees 2008, S. 20).
Genossenschaften werden gesetzlich organisatorische Regelungen vorgeschrieben, die sich an
den normativen Prinzipien der gemeinschaftlichen Selbsthilfe, Selbstverantwortung und Selbst‐
verwaltung ausrichten. Diese Prinzipien sind entscheidend für die Struktur der Rechtsform, sind
aber auch für die genossenschaftliche Wirtschaftsweise in anderen Rechtsformen grundlegend.
Gemäß ihrer Geschichte und Zwecksetzung sind Genossenschaften Selbsthilfeinstrumente ihrer
Mitglieder (vgl. Dülfer 1977, S. 322). „Was der Einzelne nicht vermag, das vermögen viele.“
Dieses Zitat von Friedrich Wilhelm Raiffeisen bildet den Kern aller Genossenschaften. Es
bringt zum Ausdruck, dass durch einen Zusammenschluss zur kollektiven, solidarischen Selbst‐
hilfe mehr erreicht werden kann, als durch den Einzelnen alleine. Demgegenüber steht die indi‐
viduelle Selbsthilfe, das Bestreben einzelner Personen, ihre sozialen und ökonomischen Le‐
benslagen im Alleingang zu verändern. In Genossenschaften schließen sich Personen freiwillig,
autonom und selbstverantwortlich zusammen, um ihre Interessen durch ein gemeinsam getrage‐
nes, demokratisch kontrolliertes Unternehmen aus eigener Kraft heraus zu fördern. Der Selbst‐
hilfegedanke setzt die offene Mitgliedschaft voraus, welche den freiwilligen Beitritt in und die
Möglichkeit des Austritts aus einer Genossenschaft meint (Freiwilligkeitsprinzip). Ein anderer
Ausdruck dafür ist die nicht geschlossene Mitgliederzahl. Dieses Merkmal soll hervorheben,
dass die eG von ihrer Grundstruktur her ein Verein mit Geschäftsbetrieb ist. Gemeint ist nicht,
dass eine Genossenschaft ihre Mitgliederzahl nicht begrenzen darf oder, dass jeder einen An‐
spruch auf Mitgliedschaft hat. Vielmehr soll es zum Ausdruck bringen, dass die eG unabhängig
vom Ein- oder Austreten von Mitgliedern Bestand hat. Es sei denn, die Mindestmitgliederzahl
wird unterschritten. Dann gilt es die eG aufzulösen (vgl. Beuthien u. a. 2011, S. 10). Selbsthilfe
meint auch keine Fremdhilfe. Durch private und staatliche Hilfen könnten Genossenschaften in
Abhängigkeiten geraten, was ihre Autonomie untergraben könnte.
Mit der Ablehnung der Fremdhilfe kommt die Notwendigkeit auf, sich innerhalb des gemein‐
schaftlichen Geschäftsbetriebes selbst zu organisieren und zu verwalten. Selbstverwaltung
https://doi.org/10.5771/0344-9777-2020-1-2-132
Generiert durch IP '46.4.80.155', am 27.06.2025, 11:41:17.
ZögU 43. Jg. 1-2/2020 Das Erstellen und Weitergeben von Kopien dieses PDFs ist nicht zulässig. 135Seyda Göksu
meint, dass die Genossenschaft von den eigenen Mitgliedern geführt und kontrolliert wird, was
in der genossenschaftswissenschaftlichen Literatur als Selbstorganschaft bezeichnet wird. Die
Besetzung der Organe – Generalversammlung, Aufsichtsrat und Vorstand – wird durch die Mit‐
glieder durch demokratische Wahlen bestimmt. Organisationsrechtlich sind die Aktivitäten von
Vorstand und Aufsichtsrat somit durch die Mitglieder legitimiert (vgl. Beuthien u. a. 2011,
S. 32). Damit einher geht das sog. Demokratieprinzip. Die Kooperation innerhalb der Genos‐
senschaft ist durch sozial-ethische Werte wie die Gleichheit aller Mitglieder, unabhängig von
der Anzahl der eingebrachten Kapitalanteile geprägt, wodurch sie sich von anderen Organisati‐
onsformen und Rechtstypen unterscheidet (vgl. Grosskopf u. a. 2017, S. 51). Es findet eine so‐
ziologische Gleichbewertung jedes Individuums statt, da jedes Mitglied nur über eine Stimme
in der Generalversammlung verfügt (one man, one vote). Diese weitgehende Eliminierung fi‐
nanzieller Maßstäbe birgt ein großes Demokratiepotenzial (vgl. Schulz-Nieswandt 2017,
S. 347) in sich und führt unter anderem dazu, dass breiten Schichten ökonomische Handlungs‐
spielräume geboten werden (vgl. Draheim 1952, S. 36 f.).
Aus dem Selbstverwaltungsprinzip folgt unmittelbar das Prinzip der Selbstverantwortung. Die‐
ses Prinzip bringt zum Ausdruck, dass die Genossenschaftsmitglieder für die Verbindlichkeiten
der Genossenschaft persönlich, mit ihrem Privatvermögen oder Geschäftsguthaben, haften müs‐
sen: „Sie macht jedem Genossen ständig bewusst, dass die förderwirtschaftliche Selbsthilfe nur
dann Erfolg haben kann, (...) wenn jeder einzelne selbst so viel wie irgend möglich zum ge‐
meinschaftlichen Geschäftsbetrieb beiträgt“ (Beuthien u. a. 2011, S. 33). Der Grundsatz der
Selbstverwaltung betont folglich die Relevanz des aktiven Mitwirkens als Mitglied der Genos‐
senschaft. Jedoch ist es aktuell so, dass Mitglieder von Gläubigern nicht direkt zur Haftung her‐
angezogen werden, sondern der gemeinschaftliche Geschäftsbetrieb. Sofern es in der eigenen
Satzung festgeschrieben ist (un-/beschränkte Nachschusspflicht), müssen Mitglieder erst im
Konkursfall Nachschüsse leisten (vgl. Blome-Drees u. a. 1998, S. 13). Mitglieder des Vorstands
und Aufsichtsrats haften dann, wenn sie ihren Sorgfaltspflichten nicht angemessen nachkom‐
men. Des Weiteren gilt der Grundsatz der Wirtschaftlichkeit. Mit den Mitteln der Genossen‐
schaft sind sparsam und rentabel zu wirtschaften.
Zusammenfassend lässt sich festhalten, dass Genossenschaften zum Zweck der gemeinsamen
Selbsthilfe gegründet werden und nach den daraus hergeleiteten Grundsätzen der Selbstverant‐
wortung und Selbstverwaltung organisiert sind. Mitglieder wollen mit den Leistungen des ge‐
meinschaftlichen Geschäftsbetriebes ihre wirtschaftlichen, sozialen und kulturellen Lebensla‐
gen gemeinsam verbessern. Im Kern geht es bei der genossenschaftlichen Kooperation um eine
Strategie der Emanzipation und des Empowerments, die der Befreiung aus z.B. sozialen, recht‐
lichen oder wirtschaftlichen Abhängigkeiten durch kollektives Handeln dient (vgl. Laurinkari/
Brazda 1990, S. 70). Neben dem Prinzip der gemeinschaftlichen Selbsthilfe werden vor allem
das Identitäts- und Förderprinzip sowie das Demokratieprinzip als bestimmende Wesensmerk‐
male von Genossenschaften erachtet (vgl. Blome-Drees u. a. 1998, S. 14).
Der Internationale Genossenschaftsbund (IGB, englisch: International Cooperative Alliance,
ICA) wurde im Jahr 1895 als erste internationale Kooperation von nationalen Genossenschafts‐
https://doi.org/10.5771/0344-9777-2020-1-2-132
Generiert durch IP '46.4.80.155', am 27.06.2025, 11:41:17.
136 Das Erstellen und Weitergeben von Kopien dieses PDFs ist nicht zulässig. ZögU 43. Jg. 1-2/2020Genossenschaftliche Potenziale für Empowerment am Beispiel türkischer Frauengenossenschaften
verbänden und Genossenschaften gegründet. Genossenschaften, die Mitglieder der IGB sind,
müssen folgende seitens der IGB 1995 verfasste Prinzipien verfolgen:1
● Freiwillige und offene Mitgliedschaft
● Demokratische Mitgliederkontrolle
● Ökonomische Teilhabe der Mitglieder an der Genossenschaft
● Erziehung und Ausbildung der Mitglieder, die Information der Öffentlichkeit
● Kooperation unter Genossenschaften
● Verantwortung für die nachhaltige Entwicklung der lokalen Gesellschaft
Diese Prinzipien sind auf die Redlichen Pioniere von Rochdale zurückzuführen, die vor über
160 Jahren die Vision einer kooperativen Gemeinschaft hatten, die den Menschen Alternativen
zu Armut, Bildungsmangel und Arbeitslosigkeit bieten sollte (vgl. Elsen 2003, S. 68). Der IGB
hat zum Ziel, die genossenschaftlichen Prinzipien der globalen Öffentlichkeit zu vermitteln und
alle genossenschaftlichen Organisationen zu vertreten. Er definiert eine Genossenschaft als „au‐
tonomous association of persons united voluntarily to meet their common economic, social, and
cultural needs and aspirations through a jointly-owned and democratically-controlled enter‐
prise“.2
Einige Autoren heben bei der Begriffsbestimmung das personale Element von Genossenschaf‐
ten hervor. Draheim beispielsweise betont die Doppelnatur einer jeden Genossenschaft als So‐
zial- und Wirtschaftsorganisation. Demnach ist sie grundsätzlich immer eine Personenvereini‐
gung, d.h. eine Gruppe im Sinne der Soziologie und Sozialpsychologie, und ein Gemeinschafts‐
betrieb der Mitgliederwirtschaften (vgl. Draheim 1955, S. 16). Boettcher stellt bei seiner Defi‐
nition drei Elemente heraus. Ihm nach ist eine Genossenschaft eine Gruppe von Wirtschaftssub‐
jekten (1), die als Mitglieder gemeinsam eine Unternehmung (2) betreiben, um ihre eigenen
Wirtschaften durch die Leistungen der Genossenschaft zu fördern (3) (vgl. Boettcher 1980,
S. 1-7). Nach Blome-Drees sind Genossenschaften demokratisch verfasste Unternehmen mit
förderwirtschaftlicher Zielsetzung: Genossenschaften sind auf freiwilliger Basis errichtete
Selbsthilfeorganisationen von Personen, die mittels eines gemeinsam errichteten und getrage‐
nen Betriebes in ihren wirtschaftlichen, sozialen und kulturellen Interessen gefördert werden
wollen und die ihre gemeinsamen Angelegenheiten durch demokratische Selbstverwaltung re‐
geln.
Es gibt verschiedene Kriterien nach denen Genossenschaften in Arten oder Typen unterschiede‐
nen werden können. Kriterien können z.B. die unterschiedlichen Leistungsarten der Genossen‐
schaften, die Art der Mitgliederwirtschaften, das Identitätsprinzip (Förder- oder Produktivge‐
nossenschaft) oder sozialpolitische Kriterien (vgl. Engelhardt 1985, S. 30) (aussagekräftige
Merkmale über die Lebenslagen3 von Mitgliedern) sein. Engelhardt identifiziert sechs verschie‐
dene Widmungstypen bzw. Entwicklungsrichtungen von Genossenschaften, welche Idealtypen
darstellen: erwerbswirtschaftliche, förderungswirtschaftliche, gruppenwirtschaftliche, stiftungs‐
wirtschaftliche, verwaltungswirtschaftliche und gemeinwirtschaftliche Genossenschaften (vgl.
1 vgl. https://www.ica.coop/en/cooperatives/cooperative-identity, abgerufen am 4.5.2019.
2 https://www.ica.coop/en/cooperatives/cooperative-identity, abgerufen am 11.5.2019.
3 "Als Lebenslage gilt der Spielraum, den die äußeren Umstände dem Menschen für die Erfüllung der Grundan‐
liegen bieten, die ihn bei der Gestaltung seines Lebens leiten oder bei möglichst freier und tiefer Selbstbesin‐
nung zu konsequentem Handeln hinreichender Willensstärke leiten würden" (G. Weisser 1978: 275).
https://doi.org/10.5771/0344-9777-2020-1-2-132
Generiert durch IP '46.4.80.155', am 27.06.2025, 11:41:17.
ZögU 43. Jg. 1-2/2020 Das Erstellen und Weitergeben von Kopien dieses PDFs ist nicht zulässig. 137Seyda Göksu
Engelhardt 1983, S. 40). Einzelne Widmungstypen können als Bezeichnung nur dann herange‐
zogen werden, wenn eine unter den sechsen intensiver vorkommt und somit die anderen überla‐
gert. In der Realität kommen Genossenschaften jedoch weit häufiger als Mischtypen als in „rei‐
ner“ Form vor (vgl. Engelhardt 1955, S. 139; Blome-Drees 2007, S. 113). Im Folgenden wird
näher auf die gemeinwirtschaftlichen Genossenschaften bzw. auf die Gemeinwohlorientierung
von Genossenschaften eingegangen.
Der Begriff Gemeinwirtschaft bezeichnet die Gesamtheit der Einzelwirtschaften, die im Rah‐
men einer erwerbs- und privatwirtschaftlich dominierten Ordnung im öffentlichen Interesse
handeln. Diese werden als gemeinwirtschaftliche Unternehmen bezeichnet und nach öffentliche
(Unternehmen der öffentlichen Hand), öffentliche gebundene (privatwirtschaftliche Unterneh‐
men mit dem Zwang zu gemeinwirtschaftlichem Handeln) und freigemeinwirtschaftliche (Un‐
ternehmen gesellschaftlicher Akteure, die sich frei dazu entscheiden, öffentliche Aufgaben zu
erfüllen) Unternehmen unterschieden (vgl. Thiemeyer 1975, S. 32 f.). Zu letzterem gehören Ge‐
nossenschaften. Betrachtet man Genossenschaften in ihrer morphologischen Konstitutivität –
die genossenschaftlichen Wesensprinzipien – so können sie gemeinwohl-relevant sein (vgl.
Schulz-Nieswandt 2015, S. 37). Gemeinwirtschaftliche oder gemeinwohlorientierte Genossen‐
schaften sind solche, die gemäß ihrer Selbstauffassung im öffentlichen Interesse tätig werden,
wobei diese bei jeder Genossenschaft im Einzelnen anknüpft. Gemeinwohlorientierung von Ge‐
nossenschaften geht jedoch nicht allein aus der Selbstauffassung hervor; notwendig ist nicht nur
die Aufnahme gemeinwirtschaftlicher Ziele ins genossenschaftliche Zielsystem, sondern auch
das tatsächliche gemeinwirtschaftliche Handeln und die daraus folgenden gemeinwirtschaftli‐
chen Wirkungen (vgl. Blome-Drees 2018, S. 236). Genossenschaften besitzen das Potenzial,
über die Förderung ihrer eigenen Mitglieder hinaus zur gesellschaftlichen Wohlfahrt bzw. zum
Gemeinwohl beizutragen (vgl. Göler von Ravensburg 2010, S. 31). Elsen betrachtet Genossen‐
schaften daher als ideale Organisationsform und Chance für das Gemeinwesen, vor allem wenn
es um die Integration benachteiligter Gruppen geht: „Die besondere Eignung genossenschaftli‐
chen Wirtschaftens zur Entwicklung der Gemeinwesenökonomie resultiert aus den genossen‐
schaftlichen Grundprinzipien Selbsthilfe, Selbstkontrolle und Selbstverwaltung. Sie sind Ope‐
rationalisierungen des Subsidiaritätsprinzips“ (Elsen 2003, S. 69). Oftmals entstehen derartige
Genossenschaften als Antwort auf Versorgungslücken oder einen Mangel an alternativen Mög‐
lichkeiten zu benötigten Dienstleistungen, die durch Staats- und/oder Marktversagen aufkom‐
men können. Zielgruppe gemeinwohlorientierter Genossenschaften sind vor allem Personen
oder Gruppen, die als sozial, politisch und/oder wirtschaftlich eher schwach eingeschätzt wer‐
den und bei denen eine Förderbedürftigkeit oder gar –notwendigkeit seitens der politischen In‐
stanzen im jeweiligen Gemeinwesen anerkannt wird (vgl. Engelhardt 1983, S. 45).
Das innovative Potenzial von Genossenschaften liegt in ihrer „hybriden Mischlogik (...) als so‐
ziale und wirtschaftliche Assoziationen, die in lebensweltlichen Kontexten und weitgehend in
bürgerschaftlicher Selbstorganisation Lösungen jenseits der Logiken der Systeme Markt und
Staat generieren“ (Elsen 2014, S. 34 f.). Als „selbstverwaltete Sozialgebilde der selbstorgani‐
sierten Selbsthilfe“ (Schulz-Nieswandt 2017, S. 37) werden Genossenschaften in konkreten Le‐
bensumständen gegründet und können als lokal bzw. regional orientierte Unternehmen in-/
direkte Wirkungen auf ihre Mitglieder und die soziale und/oder wirtschaftliche Entwicklung
https://doi.org/10.5771/0344-9777-2020-1-2-132
Generiert durch IP '46.4.80.155', am 27.06.2025, 11:41:17.
138 Das Erstellen und Weitergeben von Kopien dieses PDFs ist nicht zulässig. ZögU 43. Jg. 1-2/2020Genossenschaftliche Potenziale für Empowerment am Beispiel türkischer Frauengenossenschaften
vor Ort haben (vgl. Schmale/Blome-Drees 2014, S. 187). Wirkungen von Genossenschaften
können nach Zerche/Schmale/Blome-Drees wie folgt unterschieden werden:
Abbildung 1: Wirkungen von Genossenschaften. Quelle: Blome-Drees u. a. 1998, S. 104. Eige‐
ne Darstellung.
Ähnlich der Inhalte von Abbildung 1 listet Ringle in einem Katalog materielle und immaterielle
Anreize der Genossenschaften für ihre Mitglieder auf. Materielle Anreize sind u.a. der Markt‐
zugang durch die Mitgliedschaft, mitglieder-orientierte Preis-Leistungs-Kombinationen und
Überschussverteilung. Immaterielle Anreize sind hingegen die ermöglichte soziale Teilhabe als
Gefühl der Gruppenzugehörigkeit, die demokratische Teilhabe als Einbringung eigener Interes‐
sen in die demokratische Willensbildung, Selbstorganisation etc. (vgl. Eschenburg 1988,
S. 256 f.). Weitere individuelle Motivationen zum Beitritt sind nach Draheim z.B. das Bedürfnis
nach Sicherheit und zu einem größeren Ganzen zu gehören, der Wunsch, aus der Ohnmacht
herauszutreten und ein aktives handelndes Subjekt zu werden, das Bestreben nach kollektivem
Handeln in bestimmten Lebenslagen, Nächstenliebe, Hilfsbereitschaft und Solidarität (vgl. Dra‐
heim 1955, S. 21 f.). Andere mögliche Wirkungen von Genossenschaften sind nach Elsen die
Einbringung informeller Arbeitskraft in den Markt und somit die Schaffung von Erwerbsarbeit,
die Findung bedarfswirtschaftlicher Lösungen für Mitglieder und Dritte, die Integration des
bürgerschaftlichen Engagements zugunsten des Gemeinwohls und die Ermöglichung lokaler
bzw. regionaler Wertschöpfungsprozesse (vgl. Elsen 2014, S. 34). Ein weiteres Potenzial von
Genossenschaften ist, dass sie Bedarfs- und Mitgliederwirtschaften sind, d.h. es geht primär um
die spezifische Bedarfsdeckung der Mitglieder, wozu sich die eG rechtlich verpflichtet (vgl.
Schmale 2017, S. 15; Elsen 2017, S. 140 f.; Elsen und Walk 2016, S. 61). Dieses Merkmal un‐
terscheidet sie deutlich von erwerbswirtschaftlichen Unternehmen. Wie bereits oben erklärt, ha‐
ben Genossenschaften keinen öffentlichen Auftrag. Jedoch können ihre Aktivitäten positive ex‐
terne Effekte zugunsten des Gemeinwohls bewirken: Stadtteilgenossenschaften expandieren das
lokale Dienstleistungsangebot und tragen somit zur Verbesserung von Arbeits- und Lebensbe‐
dingungen und zur Sicherung der Infrastruktur bei, Wohnungsgenossenschaften engagieren sich
im Städtebau, Sozialgenossenschaften bieten Dienstleistungen in den Bereichen Pflege und Ge‐
sundheit an (vgl. Klemisch/Vogt 2012, S. 68). Insgesamt liegt die Stärke von Genossenschaften
in der Bündelung der Kräfte und der Ausrichtung nach den oben vorgestellten genossenschaftli‐
chen Prinzipien und Werten.
https://doi.org/10.5771/0344-9777-2020-1-2-132
Generiert durch IP '46.4.80.155', am 27.06.2025, 11:41:17.
ZögU 43. Jg. 1-2/2020 Das Erstellen und Weitergeben von Kopien dieses PDFs ist nicht zulässig. 139Seyda Göksu
2.1.2 Sozialgenossenschaften
Vor dem Hintergrund der negativen Auswirkungen der Industrialisierung auf die wirtschaftliche
Existenz von Kleinunternehmern, Handwerkern und Landwirten verfolgen Genossenschaften
seit ihrer Gründung im 19. Jahrhundert das Ziel, die wirtschaftlichen und sozialen Lebenslagen,
sowohl auf der individuellen als auch auf der kollektiven Handlungsebene, durch die Stärkung
der Fähigkeiten ihrer Mitglieder zu verbessern (vgl. Schmale/Degens 2013, S. 119 f.). Ange‐
sichts der internationalen Wirtschafts- und Finanzkrisen, der fortschreitenden Globalisierung
und des Strukturwandels im sozialen Sektor sind Genossenschaften wieder vermehrt in den Fo‐
kus der Öffentlichkeit gerückt. Besonders der demographische Wandel und der Rückzug der öf‐
fentlichen Hand aus einigen Leistungsbereichen, machen Veränderungen in der Organisation
des sozialen Dienstleistungssektors, quantitativ sowie qualitativ, notwendig. Hinzu kommt, dass
viele Menschen eine kritische Haltung bezüglich der „moralische[n] Qualität der Marktwirt‐
schaft und dessen Eigenlogiken, die den Prinzipien der Nutzenmaximierung und dem Wettbe‐
werb folgen“ (Blome-Drees 2014, S. 163), entwickelt haben. Als Alternativen innerhalb der ka‐
pitalistischen Wirtschaftsordnung bieten Genossenschaften ein großes Lösungspotenzial für ak‐
tuelle und künftige gesellschaftliche und ökonomische Herausforderungen des 21. Jahrhun‐
derts. Wichtige soziale Bereiche sind vor allem Wohnen, Gesundheit und Soziales, Bildung,
Pflege, Armut und Arbeitslosigkeit, das Ende der fossilen Energie und die lokale Daseinsvor‐
sorge.
Um auf das genossenschaftliche Geschäftsmodell aufmerksam zu machen, erklärten die Verein‐
ten Nationen das Jahr 2012 zum Internationalen Jahr der Genossenschaften.4 Schon zuvor ver‐
öffentlichten sie Guidelines5 zur Schaffung attraktiver Umweltbedingungen zur Gründung und
Entwicklung von Genossenschaften. Auch die Internationale Arbeitsorganisation (IAO) hebt in
einer Empfehlung die Relevanz von Genossenschaften für eine nachhaltige Wirtschaftsweise
und die Ermöglichung der größtmöglichen Teilhabe aller Menschen an sozialen und wirtschaft‐
lichen Entwicklungen hervor.6 Im Jahr 2006 wurde das Gesetz zur Einführung der Europä‐
ischen Genossenschaften (Societas Cooperative Europaea, SCE) erlassen und brachte einige
Gründungserleichterungen für Genossenschaften mit sich. Da europäisches Recht supranationa‐
les Recht ist, war auch das deutsche Genossenschaftsgesetz von den Veränderungen betroffen.
Seit der Gesetzesnovellierung besteht der Förderzweck der Genossenschaften laut § 1 Absatz 1
GenG nicht nur mit Hinblick auf die wirtschaftlichen, sondern explizit auch sozialen und kultu‐
rellen Bedürfnisse der Mitglieder. Neu ist nun also die zusätzliche Förderung ideeller Mitglie‐
derbedürfnisse. Im Gesetz wird nicht geklärt, warum unter nichtwirtschaftlichen Mitgliederin‐
teressen ausgerechnet die sozialen und kulturellen genannt werden, oder was die Begriffe „sozi‐
al“ und „kulturell“ genau meinen (vgl. Beuthien u. a. 2011, S. 16). Dies obliegt folglich der
Einschätzung der Mitglieder der Genossenschaft selbst.
Genossenschaften mit sozialer Zielsetzung oder Sozialgenossenschaften sind aktuell ein belieb‐
tes Phänomen in der realen Welt. Sie bilden ein heterogenes Feld und umfassen ein äußerst
4 siehe https://www.un.org/en/events/coopsyear/ abgerufen am 1.6.2019.
5 siehe https://undocs.org/A/56/73 abgerufen am 24.5.2019.
6 siehe Recommendation No.193 https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_emp/---emp_ent/---coop/docu
ments/publication/wcms_311447.pdf abgerufen am 5.6.2019 abgerufen am 1.6.2019.
https://doi.org/10.5771/0344-9777-2020-1-2-132
Generiert durch IP '46.4.80.155', am 27.06.2025, 11:41:17.
140 Das Erstellen und Weitergeben von Kopien dieses PDFs ist nicht zulässig. ZögU 43. Jg. 1-2/2020Genossenschaftliche Potenziale für Empowerment am Beispiel türkischer Frauengenossenschaften
vielfältiges Spektrum von Genossenschaften, deren Beschäftigte oder Mitglieder im sozialen
Sektor tätig bzw. diesem zuzuordnen sind. Zu diesen Genossenschaften gehören z.B. Sozialge‐
nossenschaften zur Vereinbarkeit von Familie und Beruf oder sozialen Belangen von Menschen
mit Behinderung, Kunst-, Umwelt-, Senioren- oder Arbeitslosengenossenschaften. Im sozialen
Sektor ermöglichen sie erweiterte Handlungsmöglichkeiten durch die Bereitstellung von sozia‐
len Dienstleistungen (vgl. Grossekettler 1989, S. 3ff.). Ziel dieser Genossenschaften ist es, die
sozialen Belange ihrer eigenen Mitglieder, Dritter und womöglich der Allgemeinheit zu fördern
(vgl. Blome-Drees 2017, S. 63). Ihr Förderanspruch geht demnach über die reine Selbsthilfe hi‐
naus, da sie die Förderung eigener Mitglieder mit sozialpolitisch verantwortlichem Agieren
vereinen (vgl. Göler von Ravensburg 2012, S. 4). Unter sozialen Belangen sind all jene zu ver‐
stehen, die die Lebensführung der Person betreffen und einer Förderung bedürfen: geistige, kör‐
perliche, seelische und materielle (vgl. Blome-Drees 2018, S. 35 f.). Sozialgenossenschaften
setzen an den Versorgungslücken an. Es geht um die Versorgung von Menschen mit besonderen
Problem- und Bedarfslagen (Krankheit, Arbeitslosigkeit, geistige/körperliche Behinderungen
etc.), die aus sozialpolitischer Sicht als sozial und/oder wirtschaftlich eher schwach einge‐
schätzt werden.
Der Begriff „Sozialgenossenschaften“ ist nicht unumstritten. Es gibt verschiedene Interpretatio‐
nen des Begriffs. Klemisch/Vogt zeigen auf, dass der Begriff unterschiedlich aufgefasst und de‐
finiert wird. Zum einen kann damit lediglich die Branche, in der die Genossenschaft tätig ist,
gemeint sein, zum anderen kann darunter aber auch die Nähe zur économie sociale verstanden
werden (vgl. Klemisch/Vogt 2012, S. 42). Es kann jedoch festgehalten werden, dass unter dem
Begriff solche Genossenschaften definiert werden, die Dienstleistungen verschiedener sozialer
Art anbieten. Sie entstehen vor allem dort, wo sich neue Bedarfe ergeben oder sich der Staat
aus der Gewährleistung der lokalen Daseinsvorsorge und Infrastruktur zurückzieht oder zurück‐
zuziehen vermag. Es wird zwischen Sozialgenossenschaften unterschieden, welche sozialrecht‐
lich normierte Dienstleistungen (Kinder- und Jugendhilfe, Bildung, Arbeitsförderung, Rehabili‐
tation und Teilhabe von Menschen mit Behinderungen) und nicht gesetzlich definierte Dienst‐
leistungen mit unmittelbarem sozialen Nutzen erbringen (vgl. Stappel 2017, S. 149).
Die Internationale Vereinigung für Industrie- und Dienstleistungsgenossenschaften (CICOPA)
definiert Sozialgenossenschaften als „one of the main responses of the cooperative movement
to people`s emerging needs“ (Rules of CICOPA 2004, Art. 1.3). Die Definition der CICOPA
basiert auf der Definition, den Werten und Prinzipien, die seitens der IGB formuliert wurden
sind (s.o.). Daneben betont die CICOPA weitere spezifische Charakteristika von Sozialgenos‐
senschaften:
● Explizite Definition eines gemeinnützigen Auftrags und die direkte Erfüllung dessen durch
die Produktion von Waren und Dienstleistungen.
● Nichtstaatlicher Charakter und Autonomie, unabhängig von der Art und dem Ausmaß der
bezogenen staatlichen oder zivilgesellschaftlichen Hilfen.
● Mögliche Multi-Stakeholder-Mitgliedschaftsstruktur.
● Erträge der Genossenschaft werden zu einem geringen Anteil oder gar nicht ausgeschüttet.
● Repräsentation Beschäftigter zu mindestens ein Drittel der Stimmen.
Nach Flieger lassen sich drei Typen unterscheiden: professionelle Sozialgenossenschaften, So‐
zialgenossenschaften Betroffener und solidarische Sozialgenossenschaften (vgl. Flieger 2003,
https://doi.org/10.5771/0344-9777-2020-1-2-132
Generiert durch IP '46.4.80.155', am 27.06.2025, 11:41:17.
ZögU 43. Jg. 1-2/2020 Das Erstellen und Weitergeben von Kopien dieses PDFs ist nicht zulässig. 141Seyda Göksu
S. 14 f.). Diese können sowohl den Förder- als auch den Produktivgenossenschaften zugeordnet
werden. Sie werden anhand des Förderprinzips nach den Kriterien Ertragsverwendung, Ertrags‐
erzielung, Effektivität und Produktivität unterschieden. Professionelle Sozialgenossenschaften
sind häufiger den Produktivgenossenschaften zuzuordnen. Wie andere Unternehmen bieten sie
ihre Leistungen am Markt an und erhalten dafür einen Marktpreis. Die Mitglieder bzw. Ange‐
stellten gehören oftmals zu einer qualifizierten Berufsgruppe aus dem sozialen Bereich (vgl.
Flieger 2003, S. 16), nicht selten aus dem Sozial- und Gesundheitswesen.
Bei Sozialgenossenschaften Betroffener schließen sich Personen mit denselben Problem- bzw.
Bedarfslagen zur gemeinschaftlichen Selbsthilfe zusammen. Spezifische gemeinsame Charak‐
teristika der Betroffenen wie Krankheit führen dazu, dass diese Wirtschaftsunternehmen im
Wettbewerb diverse Benachteiligungen erleben. Da sie sozialpolitische Leistungen übernehmen
und anbieten, benötigen sie als Ausgleich dafür mindestens gleichwertige Förderbedingungen
wie staatliche und kirchliche Träger: „Aufgrund ihres Charakters der kollektiven Selbsthilfe
müssten sie diesen gegenüber im Sinne des Subsidiaritätsprinzips sogar eindeutig bevorzugt
werden“ (Flieger 2003, S. 15). Jedoch werden in Deutschland, im Gegensatz zu anderen
europäischen Ländern wie Italien, Frankreich oder Schweden, weder Genossenschaften, noch
deren Verbandsstrukturen finanziell gefördert (vgl. Klemisch/Vogt 2012, S. 62).7 Schon zuvor
wurde angemerkt, dass die Inanspruchnahme staatlicher oder privater Ressourcen mit der Ge‐
fahr verbunden ist, dass Genossenschaften an Autonomie verlieren könnten. Nach Göler von
Ravensburg sind an diesem Punkt die Kompetenzen und das Knowhow der Mitglieder entschei‐
dend, die Konsequenzen einer externen Förderung bzw. angenommener Fremdhilfe einschätzen
und abwägen zu können (vgl. Göler von Ravensburg 2010, S. 39). Wichtig sei, dass die Zustän‐
digkeit für die Aufnahme neuer Mitglieder, die Besetzung der Organe, die Satzungsgestaltung
und die allgemeine Geschäftspolitik ausschließlich bei der Genossenschaft liegt und nicht von
Förderern beeinflusst wird. Ziel von Sozialgenossenschaften Betroffener ist neben dem Förder‐
zweck die soziale Integration der Mitglieder.
Solidarische Sozialgenossenschaften leben zum großen Teil vom Ehrenamt, d.h. die Motivation
der Mitglieder (als nicht unmittelbar Betroffene) meist unbezahlte Leistungen zu erbringen
gründet primär auf Solidarität, nicht auf Arbeit und Einkommen (vgl. Flieger 2003, S. 15). Hier
profitieren neben den eigenen Mitgliedern auch Dritte bzw. benachteiligte Nicht-Mitglieder von
den angebotenen Leistungen der Genossenschaft. Oftmals gehören die Mitglieder zu den sog.
Randgruppen der Gesellschaft, die Merkmale wie Behinderungen oder fehlende Qualifikatio‐
nen für einen Arbeitsmarkteintritt aufweisen. Im Fokus steht nicht das Generieren eines Ein‐
kommens durch den gemeinsamen Geschäftsbetrieb, sondern die Verbesserung der Lebensla‐
gen von Mitgliedern und Dritten durch eine Vielfalt von angebotenen Leistungen als Unterstüt‐
zungsressourcen.
Ahles betont, dass es sich bei Sozialgenossenschaften, die der sozialen Daseinsvorsorge im en‐
geren Sinne zuzuordnen sind, zumeist um Multi-Stakeholder-Genossenschaften mit heteroge‐
nen Mitgliedern handelt, die sich Fliegers Typologie nicht genau zuordnen lassen (vgl. Ahles
7 Schmale (2017, S. 36 f.) nennt vereinzelte Beispiele zur staatlichen Förderung kleiner Genossenschaften. Da je‐
doch Kommunen und Bundesländer solche genossenschaftlichen Gebilde divers behandeln, lässt sich keine
Systematik staatlicher Förderung erfassen.
https://doi.org/10.5771/0344-9777-2020-1-2-132
Generiert durch IP '46.4.80.155', am 27.06.2025, 11:41:17.
142 Das Erstellen und Weitergeben von Kopien dieses PDFs ist nicht zulässig. ZögU 43. Jg. 1-2/2020Genossenschaftliche Potenziale für Empowerment am Beispiel türkischer Frauengenossenschaften
2017, S. 125 f.). Demnach sind sie morphologisch betrachtet als Mischformen zwischen Fremd-
und Selbsthilfe zu verstehen. Im Bereich der Sozialleistungen im gesetzlichen Sinne haben
Nichtmitgliedergeschäfte eine besondere Bedeutung, denn eine Ausgrenzung von Nichtmitglie‐
dern von den Leistungen käme einer Diskriminierung gleich: „Sofern es um soziale Dienstleis‐
tungen im Rahmen des staatlichen Gewährleistungsauftrages geht, ist der Bruch mit dem Iden‐
titätsprinzip [Eigentümer und Kunde gleich Mitglied] strukturbedingt“ (Ahles 2017, S. 126).
Sozialgenossenschaften können auch als neue Solidargemeinschaften überfamiliärer Netze be‐
trachtet werden. „Als demokratische Organisationsformen sind sie aus der Perspektive der
Emanzipation und des Empowerments benachteiligter Menschen von Interesse, da sie Alternati‐
ven gegenüber der Entwertung im Arbeitsmarkt und der wohlfahrtsstaatlichen Bevormundung
darstellen“ (Elsen 2017, S. 142). Empowerment meint, benachteiligten Menschen in Lebenssi‐
tuationen relativer Machtlosigkeit die Erfahrung individueller und kollektiver Handlungsmacht
zu vermitteln. Als lokal bzw. regional orientierte Unternehmen sind Sozialgenossenschaften
ideale Gebilde für die Schaffung und Entwicklung von Empowermentprozessen. Dazu weiteres
in Kapitel 2.2 und 2.3.
2.1.3 Frauengenossenschaften
2.1.3.1 Kontext und Definition
Frauen gehören bis heute immer noch in vielen Bereichen des Lebens zu den sozialpolitisch
und sozioökonomisch benachteiligten Gruppen der Gesellschaft. Im internationalen Kontext
werden Frauen in oder Frauen und Genossenschaften vor allem vor dem Hintergrund der Ge‐
schlechtergleichheit und dem Empowerment von Frauen untersucht. Geschlechtergleichheit be‐
zieht sich auf die Chancengleichheit, Gleichberechtigung und Gleichbehandlung von Frauen
und Männern in allen Lebensbereichen. Gemeint ist, dass die Rechte und Pflichten, der Zugang
zu Ressourcen und der Status von Menschen nicht davon abhängen sollen, ob sie als Mann oder
Frau geboren werden.
Eine Untersuchung der internationalen und deutschen genossenschaftswissenschaftlichen Lite‐
ratur zum Thema Frauen und Genossenschaften oder spezifischer Frauengenossenschaften ver‐
weist auf eine geringe Relevanz von Frauen in der Geschichte der Genossenschaftsbewegung,
da kaum Publikationen vorzufinden sind, so Kluge im Jahr 1992: „Von Selbsthilfe in Gestalt
spezifischer Frauengenossenschaften machte die Frauenbewegung – von einzelnen Ausnahmen
angesehen – bislang keinen Gebrauch“ (Kluge 1992, S. 63). Die Frauen- und Genossenschafts‐
bewegung sei trotz kleiner Berührungspunkte nebeneinander hergelaufen. Er schlussfolgert,
dass die Geschichte von Frauen und Genossenschaften bis dahin eher als eine Geschichte von
Genossenschaften ohne Frauen zu bewerten sei.
Diese Entwicklung begann sich mit der vierten Weltfrauenkonferenz der Vereinten Nationen im
Jahr 1995 zu verändern. Zum Abschluss der Konferenz wurde die Erklärung von Beijing ange‐
nommen, die strategische Ziele definiert und Maßnahmen zur Förderung der Rechte von Frauen
und die Gleichstellung der Geschlechter in allen Bereichen des wirtschaftlichen, sozialen, kul‐
https://doi.org/10.5771/0344-9777-2020-1-2-132
Generiert durch IP '46.4.80.155', am 27.06.2025, 11:41:17.
ZögU 43. Jg. 1-2/2020 Das Erstellen und Weitergeben von Kopien dieses PDFs ist nicht zulässig. 143Seyda Göksu
turellen und politischen Lebens festlegt.8 Seither beschäftigen sich v.a. die Vereinten Nationen,
der IGB und die IAO mit den Belangen von Frauen, speziell mit der Thematik Frauen und Ge‐
nossenschaften. Wesentliche Fragestellungen sind insbesondere welche Wirkungen Genossen‐
schaften auf die Entwicklung von Geschlechtergleichheit und das Empowerment von Frauen
haben und wie Frauen durch Genossenschaften Zugang zu Möglichkeiten erhalten können, die
ihnen sonst verwehrt blieben.9
Mit Frauengenossenschaften explizit beschäftigen sich nur wenige Studien. In der untersuchten
Literatur konnte keine Definition für Frauengenossenschaften gefunden werden. Im Folgenden
wird daher eine eigene Definition vorgenommen. Anschließend werden Studien zu den Wir‐
kungen von Frauengenossenschaften zusammenfassend dargestellt. Ziel dessen ist es, dem Le‐
ser einen Einblick in den Forschungskontext zu geben und ihm ein Verständnis über Frauenge‐
nossenschaften zu vermitteln.
Frauengenossenschaften sind Genossenschaften, die von Frauen für Frauen gegründet werden
und in denen nur Frauen aktiv mitwirken. Männer werden grundsätzlich von der Mitgliedschaft
ausgeschlossen. (Inwiefern dies mit dem genossenschaftlichen Prinzip der offenen Mitglied‐
schaft vereinbar ist, kann an anderer Stelle diskutiert werden.) In dieser Arbeit werden sie als
ein spezifischer Typ von Sozialgenossenschaften definiert, die ihren Schwerpunkt auf die För‐
derung der sozialen Belange (materielle, geistige, körperliche, seelische) von Frauen setzen. Da
Nur-Frauen-Genossenschaften Untersuchungsgegenstand der vorliegenden Arbeit sind, wird
der Aspekt der Geschlechtergleichheit lediglich als ein möglicher gesellschaftlicher Outcome
der aktiven Partizipation von Frauen in Frauengenossenschaften berücksichtigt, sodass der kon‐
zeptionelle Fokus auf dem Empowerment von weiblichen Genossenschaftsmitgliedern liegt.
2.1.3.2 Wirkungen von Frauengenossenschaften – ein Überblick
Aufgrund ihres Charakters als Solidargemeinschaft stellt die Genossenschaft eine überaus ge‐
eignete Form der gemeinschaftlichen Selbsthilfe für weibliche Lebensperspektiven dar, die ne‐
ben wirtschaftlichen auch kulturellen oder allgemein immateriellen Herausforderungen gegen‐
überstehen (vgl. Döse 1992, S. 248). Um Frauen dabei zu helfen, im wirtschaftlichen und politi‐
schen Leben der besetzten palästinensischen Gebiete Fuß zu fassen, arbeitet der UN-Frauen‐
fonds für die Gleichstellung der Geschlechter mit lokalen Nichtregierungsorganisationen zu‐
sammen. Ziel ist es, genossenschaftliche Geschäftsmodelle für Frauen zu entwickeln, in denen
sie arbeiten und Zugang zu Ausbildungsmöglichkeiten erhalten können. Besonders benachtei‐
ligt sind Frauen in den Gebieten, in denen die ohnehin schon traditionellen Einstellungen durch
andere Alltagsbeschränkungen verstärkt werden. Die Bildung des Mannes beispielsweise wird
allgemein bevorzugt und ein Großteil der bezahlten Arbeit geht an Männer. Von Frauen wird
meist erwartet, dass sie im privaten Bereich leben und sich auf unbezahlte häusliche Aufgaben,
oftmals im informellen Sektor, konzentrieren. Eine Studie (vgl. UN Women 2012) der UN Wo‐
men zu den palästinensischen Frauengenossenschaften zeigt, dass Frauen durch die aktive Par‐
8 vgl. UN Women (o.J.), https://www.unwomen.de/schwerpunkte/peking-20/die-aktionsplattform-von-peking.ht
ml abgerufen 12.06.19.
9 siehe z.B. IAO (o.J.b); IAO (o.J.d); IAO/IGB 2005; IAO/IGB 2015; UN 2012.
https://doi.org/10.5771/0344-9777-2020-1-2-132
Generiert durch IP '46.4.80.155', am 27.06.2025, 11:41:17.
144 Das Erstellen und Weitergeben von Kopien dieses PDFs ist nicht zulässig. ZögU 43. Jg. 1-2/2020Genossenschaftliche Potenziale für Empowerment am Beispiel türkischer Frauengenossenschaften
tizipation in Genossenschaften tiefgreifende Veränderungen in ihren Einstellungen erleben. Sie
berichten, dass sie sich im Allgemeinen selbstbewusster fühlen und sich ihres Potenzials als
Mitglieder der Gemeinschaft bewusster sind. Dies spiegelt sich u.a. darin wieder, dass sie Inter‐
essenvertretungen für Frauenbelange bilden, die mit Gewerkschaften, Organisationen der Zivil‐
gesellschaft und öffentlichen Behörden zusammenarbeiten, um beispielsweise den sozialen
Schutz für informelle Arbeitnehmerinnen zu verbessern.
Frauengenossenschaften im Jemen stehen vor ähnlichen kulturellen Barrieren. Familienstand
und Erbrechte können hemmende Faktoren bei der Partizipation von Frauen am Arbeitsmarkt
sein. Eine frühzeitige Heirat oder ein mangelnder Zugang zu grundlegenden sozialen Diensten
und Land stellen für Frauen v.a. in ländlichen Gebieten schwierige Lebenslagen dar. Soziale
Einschränkungen wie die der Mobilität (z.B. notwendige Erlaubnis vom Ehemann, um das
Haus verlassen zu können) werden häufig als wesentliche Einschränkungen für den Zugang zu
Ressourcen, Informationen und Märkten angeführt (vgl. IAO o. J. c, S. 3 f.). Des Weiteren stellt
sich heraus, dass Mitglieder von Frauengenossenschaften häufig nur begrenzte Managementfä‐
higkeiten und Knowhow besitzen, die es ihnen ermöglichen, die Genossenschaft effizient und
effektiv zu führen und wettbewerbsfähig zu halten. Meist sind solche kleinen unprofessionellen
Gebilde auf externe Finanzierungsquellen sowie technische Unterstützung angewiesen, was
eine Herausforderung für ihre Nachhaltigkeit darstellt. Darüber hinaus kommt es auch vor, dass
Frauengenossenschaften Initiativen von Regierungen, politischen Parteien oder der Zivilgesell‐
schaft sind (vgl. IAO o. J. b, S. 3).
Eine andere Untersuchung (vgl. IAO o. J. a.) der IAO konzentriert sich auf das Potenzial von
Genossenschaften zum Empowerment von Frauen in arabischen Staaten (Libanon, Irak, West‐
jordanland, Gazastreifen). Auch hier stehen Frauen vor denselben kulturellen Herausforderun‐
gen. Frauengenossenschaften tragen erheblich zur Einkommensgenerierung der Frau, durch die
demokratische Willensbildung zur Verbesserung der gesellschaftlichen Position der Frau, zur
Entwicklung von Vertrauen, gegenseitiger Unterstützung und sozialem Zusammenhalt sowie
zur innergesellschaftlichen Transformation sozialer Normen hin zu mehr Geschlechtergleich‐
heit bei. Jedoch konzentrieren sich ihre Tätigkeiten häufig auf Fertigkeiten im Zusammenhang
mit hausgemachten Tätigkeiten, was die traditionellen Rollenerwartungen wiederum verstärkt.
In Befragungen berichten weibliche Mitglieder häufig von einem erhöhten Selbstwertgefühl
und einem Gefühl der Solidarität und Unterstützung, die durch die Arbeit in der Frauengenos‐
senschaft erlebt werden. Zu ähnlichen Ergebnissen kommen Fallstudien (vgl. Estey 2011,
S. 347-365; Jan 2008; IAO 2018 b; Jones u. a. 2012, S. 13-32) von Frauengenossenschaften in
Nigeria, Indien und den USA.
Frauengenossenschaften ermöglichen Frauen sowohl in typisch weiblichen als auch neuen Tä‐
tigkeitsbereichen u.a. eine stärkere Beteiligung an Unternehmensentscheidungen, eine Aufwer‐
tung ihrer allgemeinen Arbeitsbedingungen und eine bessere Nutzung ihrer beruflichen Fähig‐
keiten (vgl. Döse 1992, S. 248). Durch den Ausschluss von Männern können soziale und kultu‐
relle Zwänge, denen Frauen unterliegen und die ihre Beteiligung an der Erwerbsbevölkerung
einschränken, überwunden werden (IAO o. J. b, S. 2). Insbesondere für Frauen in ländlichen
Gebieten, in der informellen Wirtschaft und mit niedrigem Einkommen, eröffnen sich durch die
Mitgliedschaft wichtige Beschäftigungsmöglichkeiten und der Zugang zu Ressourcen und
Dienstleistungen. Es wurde auch gezeigt, dass die genossenschaftlichen Prinzipien Selbstver‐
https://doi.org/10.5771/0344-9777-2020-1-2-132
Generiert durch IP '46.4.80.155', am 27.06.2025, 11:41:17.
ZögU 43. Jg. 1-2/2020 Das Erstellen und Weitergeben von Kopien dieses PDFs ist nicht zulässig. 145Seyda Göksu
antwortung und Selbstverwaltung sowie das kollektive Handeln unter Frauen Sozialkapital pro‐
duzieren, das sonst schwer zu erreichen wäre. Die Mitgliedschaft in kooperativen Geschäftsmo‐
dellen wie Frauengenossenschaften ermöglicht es Frauen, sowohl berufliche als auch persönli‐
che Beziehungen aufzubauen, was häufig zu einer Verbesserung ihres sozialen Ansehens führt
(vgl. UN 2012; Weltbank 2009). Außerdem gewinnen Frauen an kollektiver Verhandlungs‐
macht gegenüber externen Machtzentren wie Institutionen der öffentlichen Hand oder des pri‐
vaten Sektors (IAO/IGB 2015, S. 9).
Insgesamt wird erkannt, dass die genossenschaftliche Organisation unter Frauen eine geeignete
Strategie zur Selbstermächtigung sein kann, jedoch müssen dabei soziale, kulturelle und politi‐
sche Herausforderungen berücksichtigt werden. Die Potenziale, die Genossenschaften aufgrund
ihrer Wesensmerkmale bieten, sind, wie der Literaturüberblick zeigt, nicht universell bzw. in
verschiedenen Settings unterschiedlich entfaltbar. Kulturelle Normen, soziale Praktiken, gesell‐
schaftliche Rollenerwartungen oder die Infrastruktur in ländlichen Gebieten beispielsweise
können hierbei einflussnehmende Faktoren sein. Darüber hinaus stehen sie vor Herausforderun‐
gen wie der Qualitätsproduktion, dem Zugang zu Märkten, marktgerechter Preise und einer feh‐
lenden „fairen“ Gesetzgebung. Damit Frauen in Frauengenossenschaften effektiv arbeiten kön‐
nen, müssen sie sich ihrer Rechte und Rollen als Mitglieder und der Methoden zur Führung und
Verwaltung eines Unternehmens bewusst sein. Dies gilt insbesondere dann, wenn Frauen unter‐
würfige, weniger sichtbare Rollen im Haushalt und in der Gemeinschaft innehaben. Daher
scheint das Verständnis über das Wesen von Genossenschaften durch entsprechende Ausbil‐
dung, ggf. externe Unterstützung und Förderung durch die Bereitstellung von Ressourcen als
grundlegend.
2.2 Empowerment
In diesem Teil der Arbeit werden Empowerment als Begriff erläutert, verschiedene Definitio‐
nen vorgestellt und die Nähe des Konzeptes zu Genossenschaften aufgezeigt. Diese Erkenntnis‐
se werden dann im letzten Unterkapitel in einem konzeptionellen Bezugsrahmen dargestellt.
2.2.1 Ursprung des Begriffs
Der Begriff stammt ursprünglich aus dem US-amerikanischen Sprachraum und wurde vom So‐
zialwissenschaftler Rappaport in die Gemeindepsychologie eingeführt: “The Concept suggests
both individual determination over one’s own life and democratic participation in the life of
one’s community (…). Empowerment conveys both a psychological sense of personal control
or influence and a concern with actual social influence, political power, and legal rights. It is a
multilevel construct applicable to individual citizens as well as to organizations and neighbor‐
hoods; it suggests the study of people in context” (Rappaport 1987, S. 121). Er definiert Em‐
powerment als einen Prozess, „by which people, organizations, and communities gain mastery
over their lives” (Rappaport 1984, S. 3).
https://doi.org/10.5771/0344-9777-2020-1-2-132
Generiert durch IP '46.4.80.155', am 27.06.2025, 11:41:17.
146 Das Erstellen und Weitergeben von Kopien dieses PDFs ist nicht zulässig. ZögU 43. Jg. 1-2/2020Sie können auch lesen