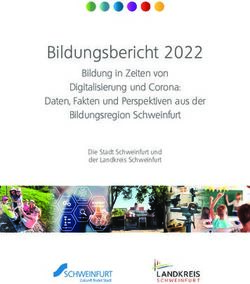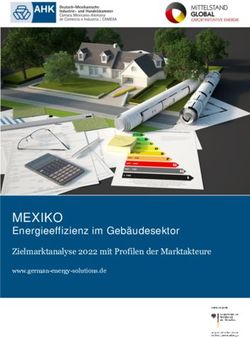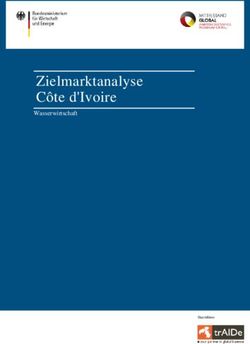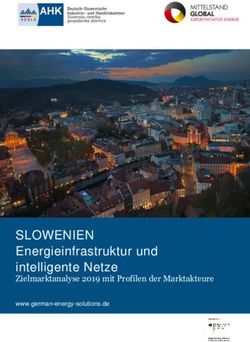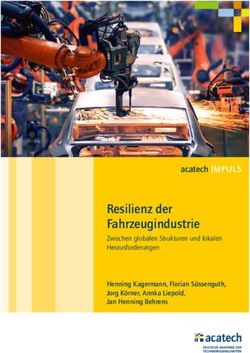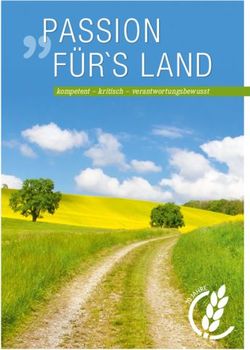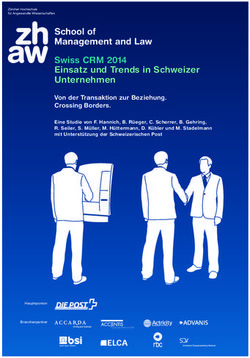Grobkonzept zum Projekt "Klimaidee Wädenswil"
←
→
Transkription von Seiteninhalten
Wenn Ihr Browser die Seite nicht korrekt rendert, bitte, lesen Sie den Inhalt der Seite unten
Grobkonzept zum Projekt
«Klimaidee Wädenswil»
im Rahmen der beantragten Förderung durch die
Landschaftsentwicklungskommission (LEK) Wädenswil
erarbeitet durch
Transition Wädenswil und Partnerorganisationen
mit finanzieller Unterstützung durch
CC-BY-NC 4.0, im März 2020Impressum Titel: Grobkonzept zum Projekt «Klimaidee Wädenswil» – im Rahmen der beantragten Förderung durch die Landschaftsentwicklungskommission (LEK) Wädenswil Autoren: René Reist, Christina Muser, Karin Hüppi Fankhauser, Rita Hug, Undine Gellner, Nathan Germa- nier, Matthias Gantner, David Bassler, Raphael Bünter (Redaktion & Gestaltung) Kontakt: Transition Wädenswil, Projekt «Klimaidee Wädenswil», Obere Bergstrasse 119, CH-8820 Wä- denswil, E-Mail: klimaidee@transition-waedenswil.ch Mediawiki-Seite: https://wiki.transition-waedenswil.ch/klimaidee Version: 2020-03-26 (März 2020), Lizenz: CC-BY-NC 4.0 Klimaidee Wädenswil 2 26.03.2020
Inhaltsverzeichnis
1 Einleitung.......................................................................................................................................7
2 Grundlagen Klimaidee Wädenswil..............................................................................................8
2.1 Hintergrund & Inspiration........................................................................................................8
2.2 Grundmechanismus der Projektidee........................................................................................9
2.3 Credo und Projektziele.............................................................................................................9
2.4 Projektvision & Rahmenbedingungen...................................................................................11
2.4.1 Orientierungspunkte Gesamtprojekt..............................................................................11
2.4.2 Übergeordnete Leitlinien...............................................................................................12
2.4.3 Warum den Fokus auf das Lokale legen?......................................................................13
3 Klimawandel als Kulturwandel..................................................................................................14
3.1 Äussere und innere «Anpassung»..........................................................................................14
3.2 Kulturlokal als Dreh- und Angelpunkt...................................................................................15
4 Regionale Entwicklung und mögliche Ziele..............................................................................16
4.1 Nationale Förderprogramme Regionalentwicklung...............................................................16
4.2 Landschaftsentwicklungskonzept (LEK) Wädenswil............................................................17
4.3 Entwurf möglicher Entwicklungsziele...................................................................................18
5 Teilbereiche & Arbeitsgruppen (Massnahmenbeschriebe)......................................................18
5.1 AG 1 – Landwirtschaft & Humusaufbau...............................................................................19
5.1.1 Herausforderungen & mögliche Entwicklungen...........................................................19
5.1.2 Umweltzielsetzungen, Agrar- und Klimapolitik.............................................................20
5.1.3 Landwirtschaftsböden & Humus...................................................................................21
5.1.4 Lösungsansätze Teilprojekt AG 1...................................................................................23
5.1.5 Weitere Optionen und Lösungsansätze..........................................................................29
5.1.6 Auflistung möglicher Partnerschaften...........................................................................30
5.2 AG 2 – Energie & Mobilität...................................................................................................31
5.2.1 Lösungsansätze Teilprojekt AG 2...................................................................................32
5.2.2 Weitere Optionen und Lösungsansätze..........................................................................34
5.2.3 Auflistung möglicher Partnerschaften...........................................................................35
Klimaidee Wädenswil 3 26.03.20205.3 AG 3 – Einkauf & Konsum....................................................................................................36
5.3.1 Lösungsansätze Teilprojekt AG 3...................................................................................36
5.3.2 Weitere Optionen und Lösungsansätze..........................................................................44
5.3.3 Auflistung möglicher Partnerschaften...........................................................................45
5.4 AG 4 – Bildung & Beratung..................................................................................................47
5.4.1 Lösungsansätze Teilprojekt AG 4...................................................................................48
5.4.2 Weitere Optionen und Lösungsansätze..........................................................................52
5.4.3 Auflistung von Partnerschaften......................................................................................53
6 Zertifikathandel & Kompensationsplattform...........................................................................54
7 Projektkommunikation und -vernetzung..................................................................................56
8 Verwaltungsstruktur & Reporting.............................................................................................56
8.1 Trägerschaft & Rechtsform....................................................................................................56
8.2 Organisationsstruktur.............................................................................................................57
8.3 Nicht-Finanzielle Erfolgsmessung.........................................................................................58
9 Planungshorizont: Zeitplan, Meilensteine, Finanzen...............................................................59
9.1 Teiletappen und Budgetierung...............................................................................................59
9.2 Kurzfristiger Ausblick und Fragen LEK................................................................................60
9.2.1 Nächste Projektschritte 2020.........................................................................................60
9.2.2 Offene/geklärte Fragen LEK.........................................................................................61
Klimaidee Wädenswil 4 26.03.2020Abstrakt
Klimaproteste, Coronaviren und die zukünftige Wirtschaftskrise rütteln uns wach. Der globale
Fussabdruck der Schweiz verschlingt die Ressourcen von rund 4 Erden. Der Anteil Kohlenstoffdi-
oxid (CO2) in der Erdatmosphäre steigt unnatürlich stark. Unsere globalisierten Wirtschaftssyste-
me zeigen in Krisen fragile Strukturen. Die Digitalisierung verstärkt den Geldabfluss aus der Regi-
on weiter. Wie weiter?
Bist Du bereit für einen Wandel? Einen Kulturwandel, der unseren Gesellschaftsentwurf in fairere
Bahnen lenkt und das Lokale wieder wertschätzt? In Wädenswil sehen wir ein grosses Potential
für eine klimawirksame, regenerierende Veränderung. Wir sind überzeugt: Es braucht einen tief-
greifenden Kulturwandel, eine Vernetzung und Konsolidierung der bestehenden Nachhaltig-
keitsprojekte und -akteurInnen, ein gemeinsames «in Aktion treten». Es braucht eine Initiative wie
die «Klimaidee Wädenswil».
Wir wollen in Wädenswil eine enkeltaugliche, CO2-neutrale Kultur etablieren.
Durch lokale CO2-Zertifikate generieren wir die dafür nötigen Mittel zur Kapita-
lisierung der ökologisch-sozial und später auch wirtschaftlich tragbaren Projekte.
Die Klimaidee Wädenswil stösst damit den breitenwirksamen Wandel hin zu ei-
nem enkeltauglichen, lebenswerten und zukunftsfähigen Wädenswil an.
Verschiedene Arbeitsgruppen widmen sich zentralen Aspekten dieses Kulturwandels – lokal, fair,
regenerativ (Direktlink zu Massnahmen in Kapitel 5):
1. Landwirtschaft & Humusaufbau: Ressourcenschonende Bewirtschaftung unserer Lebens-
grundlagen → CO2-Bindung im Boden, verlustarme und effektive Düngerwirtschaft, Agro-
forst-Systeme
2. Energie & Mobilität: Anreize schaffen für intelligentere Energielösungen → Erneuerbare
Heizungen mieten, Elektro-Carsharing und kombinierte Mobilität
3. Einkauf & Konsum: Einkauf und Genuss lokaler Erzeugnisse im Fokus, gemeinschaftlich
und selbstbestimmt → Ernährungsrat & -strategie, Nahrungsmittel-Kooperativen, neuartige
Gemeinschaftsverpflegung
Klimaidee Wädenswil 5 26.03.20204. Bildung & Beratung: Bewusstseins- und Aktionswandel durch lokal wirksame Umwelt-
und Nachhaltigkeitsbildung→ ressourcenleichte Lebensstile etablieren & kreativ reduzie-
ren
Für die Projektentwicklung erachten wir ein Kulturlokal (Wandel-Hub oder Wandel-Zentrale) als
zentral, in dessen Räumen sich das kreative Kapital entfalten kann – Gemeinschafts-Arbeitsplätze,
Einmach-Werkstatt, Unverpackt-Einkaufsmöglichkeiten und kulturelle Angebote inklusive.
Das folgende Grobkonzept ist das Resultat unserer Vorarbeit zum lokalen «Klimawandel». Einen
Zeit- und Budgetplan, Ausblick und offene Fragen präsentieren wir im Kapitel Planungshorizont.
Gerne stellen wir interessierten WädenswilerInnen die Ideen und Inhalte bei der Start-Infoveran-
staltung im Sommer 2020 vor.
Klimaidee Wädenswil 6 26.03.20201 Einleitung Die Bevölkerungen westlicher Staaten verbrauchen durch ihren globalisierten Lebensstil unver- hältnismässig viele Ressourcen (Stichwort: Externalisierungsgesellschaft). Speziell die Bereiche Nahrungsmittelproduktion und -bereitstellung, Energieerzeugung und -bereitstellung, Mobilität und das Konsumieren von Gütern und Dienstleistungen aus dem globalen Markt wirken sich nega- tiv auf die ökologische wie auch soziale Bilanz unserer Länder aus. Der globale Fussabdruck der Schweiz ist mitunter einer der höchsten aller vergleichbaren Staaten; wenn alle Länder so lebten wie wir, benötigten wir die Ressourcen von rund 4 Erden (vgl. Wackernagel & Beyers, 2016). Wir haben aber nur eine! Unsere Herausforderungen liegen in den Bereichen Biodiversitätsverlust, Bodenversiegelung/-ver- dichtung, Überdüngung – alles Themen mit massgeblicher Beteiligung der Landwirtschaft – und im Ausstoss von Treibhausgasen (Schweizer Bundesrat, 2018). Denn viele unserer Prozesse und grundlegenden Bereitstellungsstrukturen basieren (noch) vorwiegend auf fossiler Energie wie Erd- öl oder -gas. Deren Extraktion aus dem Erdmantel ist nicht nur mit mannigfaltigen umwelttoxi- schen Wirkungen verbunden, sondern schädigt, durch Ressourcenkriege und wirtschaftliche Nicht- Teilhabe, auch lokale Gemeinschaften nachhaltig. Fossilenergie wird zur Bereitstellung von Wär- me und Strom in Verbrennungsreaktionen zu Kohlenstoffdioxid (CO2)1 oxidiert. Dieses für das Ge- deihen unserer Pflanzenbiomasse unverzichtbare Gas entweicht in die Erdatmosphäre. Die relative Trägheit des natürlichen, globalen Kohlenstoffzyklus kann die hohe Gasfracht jedoch nicht innert für menschliche Verhältnisse nützlicher Frist “verarbeiten”. Dies führt, nebst dem Umstand, dass die Reserven an fossilen Brennstoffen immer unwirtschaftlicher zu erschliessen und grundsätzlich nicht erneuerbar sind, zu globalen Klimaveränderungen aufgrund von Treibhauseffekten. Der An- teil CO2 in der Erdatmosphäre hat sich so seit der vorindustriellen Zeit um rund 40 % erhöht und steigt weiter (Riebeek, 2011). Dabei spielt auch unser Ernährungssystem als Ganzes, von der Lebensmittelproduktion bis zum Einzelhandel, eine gewichtige Rolle und ist für ein Drittel aller Treibhausgase verantwortlich. Gleichzeitig ist die Landwirtschaft besonders stark vom Klimawandel bedroht (Darmaun et al., 1 CO2 dient uns der Einfachheit halber als Modellmolekül; gerechnet wird grundsätzlich mit CO 2-Äquivalenten, d.h. weitere klimarelevante Moleküle wie Methan (CH4), Lachgas (N2O) und Stickoxide (NOx) werden durch entsprechende Faktoren in CO2 umgerechnet. Klimaidee Wädenswil 7 26.03.2020
2019). Das müssen wir ändern, wenn wir bleiben wollen. Lösungsansätze sind vorhanden, monetä- res und kreatives Kapital auch. Was es nun braucht, sind AkteurInnen, die in ihren lokalen Ge- meinschaften aktiv werden und selbst-wirksam die nötigen Veränderungen anstossen und mitge- stalten, die mannigfaltigen Handlungsspielräume nutzen. Dies auch als «erwachsene» und unmit- telbare Antwort auf die medienwirksamen Klimaproteste der Jugendlichen. Hier will das Projekt «Klimaidee Wädenswil» ansetzen. 2 Grundlagen Klimaidee Wädenswil 2.1 Hintergrund & Inspiration Für den generationenverträglichen, ganzheitlichen Wandel unserer Stadt sind breitenwirksame Massnahmen und ein tiefgreifender Kulturwandel nötig. Ein paar isolierte Nachhaltigkeitsprojekte garantieren kein Entkommen aus dem Nischendasein. Es braucht eine Initiative, die bestehendes vernetzt und innovatives etabliert und welche über das gesamte gesellschaftlich-kulturelle Spek- trum wirken kann; also vom primären Sektor und der Energiebereitstellung über die Konsumge- wohnheiten und die soziale Teilhabe bis hin zur Nachhaltigkeitsbildung und Informationsakquise. Vorbild für eine solch ganzheitliche Initiative könnte uns die Ökoregion Kaindorf in der Oststeier- mark (AT) sein, die sich als Modellregion einer ökologischen Kreislaufwirtschaft und der CO 2- Neutralität verschrieben hat und bereits seit 2007 wirksame Projekte umsetzt. So zum Beispiel ein landwirtschaftliches Humusaufbauprogramm mit lokaler CO2-Kompensation oder auch mannigfal- tige Projekte für enkeltaugliche Mobilitätslösungen. Nachfolgend ein paar interessante Weblinks zu Projekten der Ökoregion Kaindorf: Projekthauptseite https://www.oekoregion-kaindorf.at/index.php?id=328 Humusaufbau https://www.oekoregion-kaindorf.at/humusaufbau.95.html Mobilität https://www.oekoregion-kaindorf.at/index.php?id=330 Klimaidee Wädenswil 8 26.03.2020
2.2 Grundmechanismus der Projektidee
Das Projekt “Klimaidee Wädenswil” baut auf freiwilliger CO2-Kompensation von Firmen und Pri-
vaten auf. Die Gelder fliessen direkt in lokale Projekte zur Förderung einer enkelgerechten Ent-
wicklung und zur Schaffung resilienter Strukturen mit starker Gemeinwohlorientierung; beispiels-
weise zur Förderung von Massnahmen für den landwirtschaftlichen Bodenhumusaufbau oder den
vermehrten Konsum lokal produzierter Lebensmittel. Die CO 2-Kompensationen für einen Flug,
eine Veranstaltung oder den eigenen Betrieb könnten beispielsweise über ein öffentliches, fundier-
tes Berechnungswerkzeug wie myclimate kalkuliert werden. Zu finden unter
https://www.myclimate.org/de/kompensieren/. Der erhaltene Betrag wird dann an die lokale “CO 2-
Börse” (Fonds der Rechtsform der Klimaidee Wädenswil) einbezahlt, die daraufhin ein Kompen-
sationszertifikat ausstellt und das Kapital den entsprechenden Teilprojekten zur Verfügung stellt.
Die Projektgelder sollen möglichst lange lokal zirkulieren, um Mehrwerte zu potenzieren und den
Kapitalabfluss in globale Märkte zu unterbinden (vgl. Plugging the Leaks).
2.3 Credo und Projektziele
Unser Credo lautet:
Wir wollen in Wädenswil eine enkeltaugliche, CO2-neutrale Kultur etablieren.
Durch lokale CO2-Zertifikate generieren wir die dafür nötigen Mittel zur Kapita-
lisierung der ökologisch-sozial und später auch wirtschaftlich tragbaren Projekte.
Die Klimaidee Wädenswil verwaltet die Kapitalien und weist diese den entspre-
chenden Projekten zu – für ein enkeltaugliches, lebenswertes und zukunftsfähiges
Wädenswil.
Unsere Hauptziele sind eine enkeltaugliche1 Entwicklung und die Etablierung einer CO 2-
neutralen Kultur in der Stadt Wädenswil. Zur Erreichung dieser Ziele stellen wir uns im We-
sentlichen folgende Aufgaben:
1 Adj.; eine Handlung/ein System, das auf die Maxime der intergenerationellen Gerechtigkeit, im Rahmen
einer nachhaltigen Entwicklung der Gesellschaften und der Ökosysteme Rücksicht nimmt; als Grundlagen
dienen die Sustainable Development Goals der UNO & Prinzipien der Permakultur nach
Mollison/Holmgren od. Präambel CH-Bundesverfassung: Handlung, die „Verantwortung gegenüber den
künftigen Generationen verlangt“ (vgl. https://www.enkel-tauglich.bio/was-bedeutet-enkeltaugliche-
landwirtschaft)
Klimaidee Wädenswil 9 26.03.2020• Finanzierung von Projekten zur Reduktion und Kompensation von Treibhausgasen auf dem
Stadtgebiet
• Unterstützung von Projekten innerhalb der lokalen Wertschöpfungskette, welche nachhalti-
ge Lösungen aufzeigen (vgl. Abschnitt 2.4.2)
• Unterstützung von Projekten zur Kulturschaffung im Rahmen des erweiterten Projekt-
zwecks
Folgende Abbildung (Abb. 1) verdeutlicht grafisch den Mechanismus der Projektidee. Ein detail-
lierter, praxisorientierter Beschrieb des lokalen Zertifikathandels am Beispiel Humusaufbau in der
Landwirtschaft findet sich in Kapitel 6.
Abb. 1: Vereinfachtes Schema der Abläufe innerhalb der lokalen CO2-Kompensation des Projekts
Klimaidee Wädenswil (Quelle: Bünter, 2020
Klimaidee Wädenswil 10 26.03.20202.4 Projektvision & Rahmenbedingungen
2.4.1 Orientierungspunkte Gesamtprojekt
Wir orientieren uns am Prinzip der Erneuerbarkeit (Regeneration) und dem Denken in Kreisläufen
(Zirkulärwirtschaft). Die Klimaidee Wädenswil ist darum ein Projekt zur regenerativen Regional-
entwicklung und ihre wirtschaftlichen Tätigkeiten dienen der Steigerung des Gemeinwohls. Fol-
gende Abbildung (Abb. 2) zeigt die Teilsphären des Projekts «Klimaidee Wädenswil». Diese wir-
ken als Einflussfaktoren auf den zugrundeliegenden, lokalen Wertschöpfungsraum Wädenswil.
Abb. 2: Grafische Darstellung der Teilsphären der Klimaidee Wädenswil (Quelle: Bünter, 2020)
Wir streben die Wiederentdeckung respektive Neuetablierung lokaler Wertschöpfungsräume im
Bereich Ernährung, Wohnen, Mobilität und Konsum an. Im Zuge dieser Re-Lokalisierung geht es
im Kern auch um die Wädenswiler Landwirtschaft und ihre Produktivität, ihre Absatzmärkte, die
Schwierigkeiten, die Finanzen – zentraler Aspekt der Klimaidee Wädenswil ist die Frage nach dem
lokalen Selbstversorgungsgrad mit Nahrung und weiteren Gütern des täglichen Bedarfs. Darüber
hinaus geht es um ein lebendigeres Wädenswil, eine kulturelle Aufwertung, die Frage nach «dem
Klimaidee Wädenswil 11 26.03.2020guten Leben für Alle» und ein faireres Miteinander und Verständnis von Produzierenden und Kon- sumierenden. 2.4.2 Übergeordnete Leitlinien Die geförderten Teilprojekte orientieren sich einerseits am ökologischen Vorrangmodell der Haupt- säulen der Nachhaltigen Entwicklung (Ökologie, Soziales, Ökonomie), den planetaren Gesetzmäs- sigkeiten und Grenzen, den Klimazielen des Bundes sowie den Nachhaltigkeitszielen der UNO (Sustainable Development Goals) und werden flankiert durch die Maximen der Subsistenz (mehr Selbstversorgung), Suffizienz (kreative Reduktion des Materialismus) und Subsidiarität (mehr Selbstbestimmung). Wir sprechen darum vielfach von einer gerechten Entwicklung innerhalb der bestehenden und gegenüber den kommenden Generationen oder auch von einer enkeltauglichen Entwicklung innerhalb der planetaren Grenzen. Folgende Darstellung (Abb. 3) verdeutlicht unseren Handlungsspielraum (grüner Bereich) als Pro- jekt der regenerativen Regionalentwicklung: Klimaidee Wädenswil 12 26.03.2020
Abb. 3: Der für die Menschheit sichere und gerechte Handlungs- und Entwicklungsraum
befindet sich innerhalb der planetaren Grenzen und der eigenen Bedürfnisbefriedigung,
flankiert durch die gemeinsam ratifizierten Ziele der UNO (Quelle: BAFU, 2018)
2.4.3 Warum den Fokus auf das Lokale legen?
Ein paar kritische Punkte für die Neuetablierung lokaler Strukturen (verändert nach DTNI, 2019;
Ward & Lewis, 2002):
• Lokal zirkulierende Geld- und Warenströme wirken als Multiplikator für die enkeltaugliche
Regionalentwicklung:
Der Konsum von Gütern und Dienstleistungen am Globalmarkt (Handelsketten, Internet)
lässt permanent Kapital aus den lokalen Märkten abfliessen, wo es jedoch für die nachhalti-
ge Entwicklung und Entstehung einer resilienten Lokalwirtschaft dringend nötig wäre.
Klimaidee Wädenswil 13 26.03.2020• Eine inklusive und vernetzte Lokalökonomie mit starkem Finanzplatz eröffnet sich und der
zugrundeliegenden Gemeinschaft unbeschränkte Handlungsfelder:
Um sich gegen «Globalplayer» durchzusetzen, müssen sich lokale KMU, die Zivilgesell-
schaft und die Politik operativ vernetzen (assoziative Wirtschaft) und gemeinsam für ihren
Wertschöpfungsraum einstehen (Selbstermächtigung) → der Multiplikatoreffekt für jeden
CHF der lokal ausgegeben und zirkuliert wird, kann sich so potenzieren und die lokale
Wirtschaft auch ohne Kapital von Aussen prosperieren lassen.
3 Klimawandel als Kulturwandel
Wir wollen nicht einfach ein neues Geschäftsmodell in der Nachhaltigkeitsbranche etablieren, son-
dern einen umfassenden, transformativen Kulturwandel – der auf einer regenerativen Regionalent-
wicklung fusst – auf den Weg bringen. Der Klimawandel als Kulturwandel.
3.1 Äussere und innere «Anpassung»
Im Endeffekt betreffen die angedachten Teilprojekte und Massnahmen das “Klima” in zweierlei
Hinsicht (Hypothesen):
1) Intrinsischer Klimawandel: im Sinne eines Kulturwandels der menschlichen Beziehungen
untereinander und zur Mitwelt. Ein Beziehungsklimawandel, der enkeltaugliche Systeme
erst wirklich ermöglicht – Gerechtigkeit, Nichtausbeutung, Kooperation und gesundes
Wachstum. Im Gegensatz zur heutigen «Lösung» mit permanentem Wettbewerb und Kon-
kurrenz um Ressourcen, und damit verbunden, Existenzängste, die unser Nervensystem
traumatisieren und den Status Quo noch mehr zementieren (Angst = Lähmung).
2) Extrinsischer Klimawandel: als Anpassung des lokalen Gesellschaftsentwurfs an die verän-
derten, äusseren Klimabedingungen. Als Folge bewussterer Ernährungs- und Konsumver-
halten mit Fokus auf Lokalität und einem bewussteren Umgang mit Natur und Umwelt
durch gezielte Bildungs- und Beratungsmassnahmen kann auf der Handlungsebene effektiv
ein niedrigerer CO2-Ausstoss erreicht und somit die Klimaanpassung in Wädenswil geför-
dert werden.
Klimaidee Wädenswil 14 26.03.2020Diese Doppeldeutigkeit kommt im Projektnamen KLIMAIDEE voll zur Geltung: Lokal den exter- nen Klimawandel, die Veränderungen der Langzeitwetterverhältnisse, mit nötigen Anpassungen unseres Gesellschaftssystems zu integrieren, also uns zu adaptieren, sowie den internen Klimawan- del, der unsere Beziehungskultur betrifft, mit entsprechenden Projekten und Dialog voranzutrei- ben, die falschen Systemzwänge abzulegen und Wahrheit, Freiheit und Verantwortung zuzulassen. Die folgende Abbildung (Abb. 4) verdeutlicht plakativ die Absicht der Klimaidee Wädenswil: der dadurch angestossene transformative Prozess wird durch konkrete Aktion unsere lokale Kultur ver- ändern und die Diversität fördern, was zu resilienten Strukturen und enkeltauglichen Systemen führt. Abb. 4: Der Transformationsprozess, angestossen durch die Kapitalumlagerungen und das Aktionspotential der Klimaidee Wädenswil, soll zu resilienten und nachhaltigen Systemen führen (Quelle: Bünter, 2020) 3.2 Kulturlokal als Dreh- und Angelpunkt Für die Projektentwicklung und die Vernetzung erachten wir es als zentral, ein Kulturlokal (Wan- del-Hub oder Wandel-Zentrale) zu betreiben, in dessen Räumen sich das kreative Kapital entfalten kann. Darin eingeschlossen könnten Gemeinschafts-Arbeitsplätze (Co-Working-Space), ein Pro- duktionsraum für landwirtschaftliche Produktveredelung (Einmach-Werkstatt), Einkaufsmöglich- keiten für Unverpackt-Erzeugnisse und kulturelle Angebote wie Infoveranstaltungen, Werkstätten, Klimaidee Wädenswil 15 26.03.2020
Konzerte und dergleichen sein. Die soziale Inklusion, beispielsweise von Geflüchteten, wäre inte- graler Bestandteil des Kulturlokals. 4 Regionale Entwicklung und mögliche Ziele Transition Town Wädenswil übernimmt in den einzelnen Teilprojekten (vgl. Kapitel 5) eine Gover- nance-Rolle um regionale AkteurInnen zu unterstützen und Partnerschaften im öffentlichen und privaten Sektor zu ermöglichen. Es ist essentiell, dass nicht nur die “Bevölkerung”, sondern auch wirtschaftliche, soziale und politische Interessengruppen zusammen mit RepräsentantInnen öffent- licher und privater Institutionen für die Entwicklung und Umsetzung der einzelnen Teilbereiche mit einbezogen werden. Die Klimaidee Wädenswil kann als Basis dienen, um die regionale Nachhaltigkeits-Entwicklung im Raum Wädenswil zu fördern und sichtbar zu machen sowie entsprechende Entwicklungsziele für die Region zu definieren. Analog Süddeutscher Regionen könnte sich Wädenswil als erste Schweizer Öko-Modellregion etablieren und ihre Produktions- und Konsumstrategien möglichst gesamtheitlich auf ökologische Prinzipien ausrichten. Die Klimaidee Wädenswil legt den Grund- stein dazu. 4.1 Nationale Förderprogramme Regionalentwicklung Möglichkeiten für zusätzliche Unterstützung bei der Erreichung regional erarbeiteter Entwick- lungsziele bieten beispielsweise das Ressourcenprogramm des Bundes, welches Projekte rund um die nachhaltige Nutzung von natürlichen Ressourcen in der Landwirtschaft fördert. Eine Eingabe ist viermal pro Jahr (31. Januar/ 30. April/ 31. Juli/ 31. Oktober) möglich und wäre ein nächster Schritt um die für die Landwirtschaft gesetzten Ziele (beispielsweise Humusaufbau, Agroforstsys- teme, Düngemittelstabilisierung → Abschnitt 5.1.4) zu erreichen. Eine weitere Option ist die Planung und Einreichung eines Projektes zur regionalen Entwicklung (PRE) um gezielt den Teilbereich der Landwirtschaft und landwirtschaftsnahen Sektoren (bei- spielsweise Nahrungsmittel-Kooperationen, gemeinschaftliche Verarbeitungs- und Vermarktungs- lösungen → Abschnitt 5.3.1) innerhalb des Gesamtprojektes zu fördern. Hier wird nach der Einrei- chung einer Projektskizze und positiver Beurteilung ein detailliertes Projektgesuch erarbeitet. Klimaidee Wädenswil 16 26.03.2020
Darüber hinaus liefert die Vereinigung regiosuisse auf ihrer Onlineplattform weitere interessante
Unterstützungsangebote für Regionalentwicklungsprojekte: https://regiosuisse.ch/finanzhilfen-
fuer-die-regionalentwicklung.
4.2 Landschaftsentwicklungskonzept (LEK) Wädenswil
Das LEK Wädenswil setzt sich zum Ziel, einen Rahmen für die anzustrebende, langfristige Ent-
wicklung der Landschaft zu formulieren und die darin stattfindenden Nutzungen im Sinne einer
nachhaltigen Nutzung zu optimieren. Im Fachbericht zum Landschaftsentwicklungskonzept 2012
wurden unter anderem nachfolgend aufgelistete Ziele festgehalten (AquaTerra, 2012):
• Standort- und Lebensqualität der Stadt Wädenswil in Bezug auf Erholung, Wohnen, Ge-
sundheitsförderung (gesundheitliches Wohlbefinden), Landschaft und Natur erhalten und
fördern
• Bevölkerung für die Erholungs-, Wohn- und Naturqualitäten von Wädenswil sensibilisieren
und für eine aktive Mitgestaltung motivieren
• Grün- und Freiräume inner- und ausserhalb des Siedlungsraums mit hoher Natur-, Aufent-
halts- und Erlebnisqualität erhalten und fördern
• Grundlagen für die landwirtschaftliche Produktion erhalten und fördern sowie landwirt-
schaftliche Dienstleistungen für die Bevölkerung sichtbar und zugänglich machen
• Entscheidungsgrundlage für den Stadtrat im Umgang mit Zielkonflikten im Landschafts-
raum bereitstellen
Diese allgemeinen Ziele dienen dem Projekt «Klimaidee Wädenswil» als weitere Rahmenbedin-
gungen für die Projektentwicklung. Im LEK-Fachbericht (AquaTerra, 2012, S. 19) werden die all-
gemeinen Zielvorstellungen in den sogenannten Wirkungszielen (W) und Umsetzungszielen (U)
konkretisiert. Es heisst dazu: «Die Wirkungsziele beschreiben die angestrebte Wirkung von Mass-
nahmen in den bearbeiteten Themenbereichen („Was soll mit dem LEK bzw. den vorgeschlagenen
Massnahmen erreicht werden ?“), die Umsetzungsziele beschreiben die Umsetzung, das Vorgehen
und das Verfahren, mit welchem die angestrebte Wirkung erreicht werden soll. Die Wirkungs- und
Umsetzungsziele werden für alle Massnahmen spezifisch definiert».
Klimaidee Wädenswil 17 26.03.20204.3 Entwurf möglicher Entwicklungsziele
Wir streben die Entwicklung hin zu einer «Regenerativen Stadt» an, mit ressourcenschonenden
Lebensstilen und grösstmöglicher Nahversorgung der Grundbedürfnisse an. Mögliche Ansätze für
künftige Ziele sind (nicht abschliessend):
• Teilnahme an einem Ressourcenprogramm des Bundes als Ziel für 2021
• Nationales Regio-Entwicklungsprogramm (PRE) anstreben für strategische Ernährungs-
wende → Nahrungsmittel-Kooperationen, «Lokalisierung» Gemeinschaftsverpflegung
• Erarbeitung einer Fair Trade Town-Zertifizierung auf Stadtebene
• Konkrete Fragestellungen: Was sind Umweltprobleme in Wädenswil (bspw. Fliessgewäs-
ser) in Wädenswil? → Zusammenarbeit mit Studierenden der ZHAW
• Agroforstsysteme auf Versuchsfläche etablieren → Wädenswil ist traditionell Obstanbau-
gebiet; entwickeln zu Kompetenzzentrum für Agroforst-Wirtschaft
• Förderung solidarische Landwirtschaft → eigenständige, bewusst wirtschaftende und
selbstwirksame BäuerInnen → Weg der Direktzahlungen verlassen und dafür lokal-solida-
risch getragene Strukturen etablieren
5 Teilbereiche & Arbeitsgruppen (Massnahmenbeschriebe)
Die Ausarbeitung von konkreten Teilprojekten der Klimaidee Wädenswil, die alsdann durch den in
Abschnitt 2.2 beschriebenen Mechanismus der freiwilligen CO2-Kompensation finanziell gespeist
werden, erfolgt in Arbeitsgruppen (AGs). Diese sollen demografisch möglichst breit aufgestellt
und basisdemokratisch organisiert sein. Zumindest eine Vertreterin jeder mitgestaltenden Partner-
organisation, relevanten Berufs- oder Branchengruppe und der betroffenen Verwaltungseinheit
sollte in der Arbeitsgruppe Einsitz nehmen und ihre Ansichten und Lösungen einbringen (dazu
mehr in Abschnitt 8.1).
Nachfolgend werden für vier initiale Arbeitsgruppen mögliche Handlungsfelder aufgelistet: 1)
Landwirtschaft & Humusaufbau, 2) Energie & Mobilität, 3) Einkauf & Konsum sowie 4) Bildung
& Beratung. Die auszuarbeitenden Massnahmen streifen je nach Auslegung die in Abschnitt 4.2
wiedergegebenen Allgemeinziele des Landschaftsentwicklungskonzepts (AquaTerra, 2012). Nach
Klimaidee Wädenswil 18 26.03.2020Möglichkeit werden aus Gründen der Konsistenz die auszuarbeitenden Massnahmen analog des LEK-Fachberichts auch mit Wirkungs- und Umsetzungszielen ergänzt. Zudem werden mögliche bereits vorhandene (✓) oder potentielle (∞) Synergieprojekte aufgelistet. Potentielle Projektpart- nerschaften mit Unternehmen und Organisationen sind bei jedem Arbeitsgruppenbereich tabella- risch hinterlegt. 5.1 AG 1 – Landwirtschaft & Humusaufbau Regenerative Landwirtschaft, Bodenaufbau und Düngemittelstabilisierung 5.1.1 Herausforderungen & mögliche Entwicklungen Die Schweizer Landwirtschaft ist jener Wirtschaftszweig mit der grössten Flächennutzung und so- mit hoher Verantwortung gegenüber den Ökosystemen und ihren Dienstleistungen. Die hohen Stickstoff- und Phosphorüberschüsse, primär aus der Tierhaltung, gefährden Biodiversität und Ge- wässer und heizen den Klimawandel an. Zudem führt nicht standortgerechte Bodenbewirtschaf- tung zu Bodenverdichtungen und Erosion sowie Einträgen von Dünge- und Pflanzenschutzmitteln in den Gewässerraum. Darüber hinaus belastet der hohe Dünge- und Futtermittelimport (graue Energie) die Umwelt im Ausland (Schweizer Bundesrat, 2018). Die landwirtschaftlichen Produktionsbetriebe sehen sich nicht nur zunehmender Kritik seitens ei- ner aufwachenden Bevölkerung (Stichwort: Trinkwasserverschmutzung) gegenüber konfrontiert, sondern werden zukünftig auch aufgrund der klimatischen Veränderungen und beispielsweise er- höhten Gefahr von Starkwetter-Ereignissen ihre Betriebsstrukturen anpassen (müssen). Resiliente- re Agrarsysteme, die auf agrarökologischen Erkenntnissen aufbauen (vgl. www.agroecology- pool.org), werden zum Schlüsselereignis der Klimaanpassungsstrategien unserer lokalen Nah- rungsmittelproduktion. Neueste Studien zeigen, dass eine auf agrarökologischen Prinzipien aufbauende Landwirtschaft die Lebensgrundlage Boden erhalten, die Biodiversitätsverluste mildern und die Agrarsysteme wider- standsfähiger gegen unvorhergesehene Ereignisse (Wirtschaftskrisen, Dürren, Starkregen, Klima- veränderungen) machen kann. Ausserdem können sich dadurch die Produktvielfalt und die sozia- len Bedingungen der in der Landwirtschaft Tätigen verbessern (Darmaun et al., 2019). Klimaidee Wädenswil 19 26.03.2020
Ein Systemwechsel ist angezeigt. Wir wollen mit unseren Vorschlägen im Rahmen des vorliegen- den Konzepts den Grundstein der lokalen Ernährungswende legen und die LandwirtInnen bei ihrem Übergang in einen ressourcenschonenden und effizienten Landbau unterstützen. Das Prinzip der Klimaidee: Die Kompensationszahlungen sollen für Bodenaufbau respektive Humusaufbau und Düngemittelstabilisierung/Kompostierung eingesetzt werden, und so den Auswirkungen von Immissionen (CO2/NOx) und Emissionen (Stickstoff, Phosphor) auf die Umwelt entgegenwirken, sowie auch regenerative Landbaumethoden ermöglichen (Know-How, Technik, Kapital). 5.1.2 Umweltzielsetzungen, Agrar- und Klimapolitik Die Schweiz hat sich aufgrund der nationalen Gesetzgebung (Umweltschutzgesetz, Luftreinhalte- verordnung) und internationalen Abkommen (UNECE) dazu verpflichtet, die Belastung der Um- welt mit Luftschadstoffen zu erheben und über Immissionen und Emissionen Bericht zu erstatten (Kupper et al., 2013). Die Herausforderungen der Schweizer Landwirtschaft liegen bei zu hohen Stickstoff- und Phosphoremissionen in die Umwelt, die negative Auswirkungen auf natürliche Ökosysteme (Boden/Wasser/Luft) haben (BFS, 2018). Aufgrund der überhöhten Messwerte, bei- spielsweise bei den Stickstoffformen und deren kritischen Eintragsfrachten in sensible Ökosyste- me, definierte der Bund 2008 die 13 Umweltziele Landwirtschaft (UZL), darunter Massnahmen zur Reduktion der Bodenverdichtung und -erosion, der stickstoffhaltigen Schadstoffe wie Lachgas (N2O) und Nitrat (NO3-) sowie der Treibhausgase. 2016 konstatierte der Statusbericht des Bundes, dass keines der 13 definierten Umweltziele vollständig erreicht wurde (BAFU & BLW, 2016). Wir müssen also dranbleiben. Es zeigt sich, dass die Schweiz auch im Bereich Boden-Biodiversität Defizite aufweist und die nötige Wissensgrundlage im Hinblick auf die langfristige Erhaltung der Bodenfunktionen noch er- weitert werden muss (Schweizer Bundesrat, 2016). Im Zuge der weltweiten Klimadebatte, welche momentan eine der wichtigsten umwelt-, gesellschafts- und wirtschaftspolitischen Herausforderun- gen darstellt, müssen auch die Treibhausgasemissionen der Landwirtschaft gesenkt werden (BAFU, 2016). Für die Agrarpolitik 22+ (AP 22+) setzt der Bundesrat deshalb mit Zwischenzielen auf eine Reduktion der Nährstoffverluste (u.a. 10 % Reduktion der Stickstoffverluste bis 2025 ge- genüber 2015 und 20% bis 2030) um die damit verbundenen Umweltauswirkungen zu verringern. Er gesteht aber auch, dass für das Erreichen der Umweltziele stärkere Reduktionen nötig sind (Schweizer Bundesrat, 2020b; Schweizer Bundesrat, 2020a). Klimaidee Wädenswil 20 26.03.2020
Klimastrategie Landwirtschaft: 2011 definierte der Bund (BLW) seine landwirtschaftliche Klimas-
trategie, die wir mit unserer Klimaidee lokal bestmöglich unterstützen wollen. Als Oberziel heisst
es in der Bundespublikation:
Die Schweizer Landwirtschaft passt sich vorausschauend an die Klimaverände-
rung an und kann dadurch sowohl die Produktion als auch die gemeinwirtschaft-
lichen Leistungen steigern. Sie nutzt die technischen, betrieblichen und organisa-
torischen Möglichkeiten zur Vermeidung von Treibhausgasemissionen optimal
und erreicht so eine Reduktion von mindestens einem Drittel bis 2050 im Ver-
gleich zu 1990. Mit einer entsprechenden Entwicklung der Konsum- und Produk-
tionsmuster wird in der Ernährung insgesamt eine Reduktion um zwei Drittel an-
gestrebt.
Anstehende Initiativen für Sauberes Trinkwasser (vgl. https://www.initiative-sauberes-trinkwas-
ser.ch/) und eine Wirtschaftsweise ohne Einsatz synthetischer Pestizide (vgl. https://lebenstatt-
gift.ch/) gehen einen Schritt weiter, und zeigen den Wunsch der Bevölkerung nach einer natürli-
cheren Landwirtschaft und einem regenerativen Umgang mit unseren Ressourcen.
5.1.3 Landwirtschaftsböden & Humus
Boden ist nicht nur Lebensgrundlage für uns und eine Vielzahl weiterer Organismen, sondern auch
eine endliche Ressource, zu der wir ausserordentlich Sorge tragen müssen. Die Bodenfunktionen
werden derweil durch Schadstoffeinträge, Kohlenstoffverlust, Erosion und mechanische Belastun-
gen (Verdichtung) teilweise empfindlich beeinträchtigt. Dies kann zum Abbau von Oberboden
(Humus) und damit zur Reduktion der Bodenfruchtbarkeit führen (Schweizer Bundesrat, 2018).
Die Schweiz wirkt diesem Umstand bereits seit Einführung des Ökologischen
Leistungsnachweises (ÖLN) entgegen. Dies genügt jedoch nicht, denn die Ansprüche an unsere
Agrarböden nehmen weiter zu (Spezialisierung, Intensivierung & Kostendruck; vgl. Charles,
Wendling, & Burgos, 2018). Nicht zuletzt aufgrund der Ausdehnung der Siedlungsflächen (meist
zulasten wertvollen Agrarlandes) und der Bevölkerungszunahme, müssten die vorhandenen Böden
inskünftig mehr produzieren können, als es ihre momentane Kapazität zulässt. Wo also ansetzen,
um auch in Zukunft funktionsfähige, lebendige Böden zu bewirtschaften und potentiell mehr und
diverser zu produzieren? Humusaufbau!
Klimaidee Wädenswil 21 26.03.2020Humus ist die Gesamtheit der organischen Bodensubstanz und besteht zu rund 6 % aus Stickstoff
und 58 % aus Kohlenstoff. In dieser Definition sind alle Bodenlebewesen wie Bakterien, Pilze,
Strahlenpilze, Algen, Einzeller usw. enthalten, alle Wurzel- und Ernterückstände, sowie auch die
stabilen Huminsäuren. Unter Dauerhumus versteht man den Anteil Humusstoffe, welcher über
Jahrhunderte stabil bleiben kann und unter anderem für die Bodenstruktur (Krümelbildung) verant-
wortlich ist (Kolbe & Zimmer, 2015). Die Welt des Bodenhumus befindet sich in einer Art Fliess-
gleichgewicht zwischen den verschiedenen Teilbereichen, wie in Abbildung 5 ersichtlich.
Humus trägt massgeblich zum Bodenschutz
durch Speicherung von Nährstoffen und
Wasser, Strukturbildung und Ernährung der
Bodenorganismen bei. Bereits eine minimale
Verringerung der organischen Bodensub-
stanz, und somit des Humusgehalts, kann zu
negativen Auswirkungen auf die Bodenfunk-
tionen und -eigenschaften und das agronomi-
sche Ertragspotential führen. Deshalb besteht
weitgehender Konsens, dass der Humusge-
halt in Agrarböden erhalten und nach Mög-
lichkeit gesteigert werden sollte.
Durch seriös betriebenen Humusaufbau kann
eine Reihe von positiven Effekten gleichzei-
tig erreicht werden: Klimaschutz, Wasser-
Abb. 5: Die verschiedenen Kompartimente des Bodenhumus schutz, Bodenschutz, Ökologisierung der
fliessen dynamisch ineinander und bilden eine Art Produktion und gesündere Lebensmittel
Kontinuum (Quelle: emev.de, 2020)
(Dunst, 2011).
Klimaidee Wädenswil 22 26.03.20205.1.4 Lösungsansätze Teilprojekt AG 1
Teilprojekt: Mögliche Partnerorganisationen:
Lokales Humusaufbauprogramm Landwirtschaftl. Verein Wädenswil/Schönen-
berg/Hütten, ZHAW Institut Umwelt & Natürli-
che Ressourcen, bodenproben.ch AG, Biomas-
sehof Wädenswil, Verora GmbH, Verein Agri-
cultura Regeneratio
mögliche Synergieprojekte: Budget & Finanzplanung:
• Düngemittelstabilisierung & Kompos- offen; nebst Klimaidee sind Finanzierungslö-
tierung (∞) sungen durch AgroCO2ncept Flaachtal, Res-
• Kompetenzzentrum Agroforst (∞) sourcenprogramme Bund oder Regionalent-
wicklungsprogramme möglich
Beschrieb:
Böden sind die grössten Kohlenstoffsenken, die der Mensch direkt nutzen kann: angewandte
CO2-Bindung durch Anpassung der Bewirtschaftung (Lal, Negassa, & Lorenz, 2015). Vorreiter-
projekt ist das umfassende und mit über 280 partizipierenden Betrieben grösste Humusprojekt
Europas, gestartet durch die Ökoregion Kaindorf. Kurz und knapp und doch informativ nachzule-
sen in der Broschüre-Humusaufbau.
Jedoch sind auch in der Schweiz Firmen und Landwirtschaftsbetriebe mit fundiertem Wissen im
effektiven Humusaufbau vorhanden. So zum Beispiel die auf Pflanzenkohleprodukte spezialisier-
te Firma Verora GmbH (Kontakt: Fredy Abächerli) oder die an der Marktetablierung einer «Hu-
muszertifikatbörse» beteiligte CarboCert GmbH.
Humus & Bodenfruchtbarkeit:
Durch den Humusaufbau wird die Bodenbiologie gestärkt. Damit einhergehend auch das
Mikrobiom der Pflanzen. Humusaufbau fördert nachweislich die Bodenfruchtbarkeit, reduziert
den Dünge- und Spritzmitteleinsatz und die Widerstandsfähigkeit gegenüber Wetterextremen (Er-
tragssicherheit, Abschwemmung und Überschwemmung infolge Starkregen) und Erosion durch
Wind und Wasser (Charles et al., 2018). Der Humusgehalt ist ein entscheidender Faktor bei der
Beurteilung der nachhaltigen Bodenbewirtschaftung.
Klimaidee Wädenswil 23 26.03.2020Das Prinzip ist simpel und effektiv: Die LandwirtInnen bauen Humus auf, schonen die Umwelt, binden CO2 und entlasten unser Kli- ma. Neben einem fruchtbaren und widerstandsfähigen Boden erhalten die Landwirte aus dem Zertifikathandel ein Zusatzeinkommen, sozusagen als Prämie für die CO2-Bindung – und werden zu KlimaschützerInnen (Sihn-Weber & Fischler, 2020). Bei intensivem Humusaufbau nach dem Vorbild der Ökoregion Kaindorf könnte jährlich eine Humusanreicherung von 1 % auf etwa 10 % der Flächen erreicht werden – im Durchschnitt also 0,1 % Humusaufbau auf sämtlichen Agrar- flächen der Schweiz. Dies würde einer Bindung von rund 10 Tonnen CO2 pro Hektare entspre- chen. Praktiker wie Franz Kaiser aus Neuheim ZG demonstrierten, dass diese Zahlen stimmen (Schmidt & Kammann, 2018). Regenerative Landwirtschaft & Strategien für den Humusaufbau: Die Massnahmen orientieren sich an der Praxis einer Regenerativen Landwirtschaft und reichen von bodenschonender Bearbeitung über den Einsatz komplexer Winterbegrünungen und Zwi- schensaaten bis hin zu intensiver, regelmässiger Kompostzufuhr. Der Verzicht auf Fungizide und Agrochemikalien sowie die Optimierung des Kalzium-Kalium-Magnesium-Komplexes sind wei- tere Schlüsselelemente. Für eine fundierte Umsetzung eines Humusaufbauprogramms ist indessen zentral, dass Arbeitskreise zwischen Landwirten und fachlichen BeraterInnen gebildet werden, um die Zielsetzungen zu definieren und Massnahmen effektiv durchführen zu können (Dunst, 2011). Mögliche Ausgestaltung vor Ort: LandwirtInnen können mit Schlägen von jeweils maximal 1–5 ha am Humusaufbauprogramm teilnehmen. Ausser den Kosten für die Bodenprobe (aktuell CHF 135 pro Schlag, vgl. bodenpro- ben.ch AG) gehen die Landwirte keine Verpflichtung ein. Im Zuge der Anfangsuntersuchung wer- den pro Schlag an 25 GPS-vermessenen Punkten Bodenproben von einer zertifizierten Firma ent- nommen. Die Bodenproben werden anschliessend analysiert. Drei bis sieben Jahre nach der An- fangsuntersuchung wird die Folgeuntersuchung durchgeführt. Pro nachweislich gebundener Ton- ne CO2 erhält der Landwirt ein (nicht garantiertes) «Erfolgshonorar» in Höhe bestimmter Höhe CHF (Sihn-Weber & Fischler, 2020). Die Firma CarboCert GmbH, die Humusaufbau als Ge- schäftsmodell etabliert hat, schreibt dazu, dass beim Aufbau von einem Prozent Humus pro Hekt- are (ha) ein Umsatz von ca. CHF 1300 durch den Handel von CO2-Zertifikaten realisiert werden kann (vorbehaltlich der Etablierung eines bundesweiten Markts für diese Zertifikate). Pro Jahr ist Klimaidee Wädenswil 24 26.03.2020
eine Steigerung von 0.1–0.2 % Humus realistisch. Dies bei konsequenter Umsetzung der regene-
rativen Landwirtschaft (vgl. https://www.bodenproben.ch/anmeldungen/anmeldung-carbocert).
Links:
https://agricultura-regeneratio.org/
https://www.oekoregion-kaindorf.at/index.php?id=515
https://www.sonnenerde.at/de/erd-gefluester/detail/humusaufbau-ein-buch-fuer-alle/
Wirkungsziele: Umsetzungsziele:
• BäuerInnen in der Region Wädenswil • Bildung eines Arbeitskreises zwischen
werden für den gemeinsamen Humus- Bauern und Fachpersonen aus Wissen-
aufbau sensibilisiert und sind motiviert schaft und Praxis
diesen zu fördern • Entwicklung eines kollektiven Projektes
• Monitoring: Gleichbleibende oder stei- unter den LandwirtInnen in der Region;
gende Bodenqualität (2021-2026) Fokus auch auf Mechanisierung für re-
generativen Landbau
• Nutzung logistischer Synergien unter
den BäuerInen und Wiederverkäufern
zur Belieferung der Region Wädenswil
Teilprojekt: Mögliche Partnerorganisationen:
Düngemittelstabilisierung & Landwirtschaftl. Verein Wädenswil/Schönen-
Kompostierung berg/Hütten, ZHAW Institut Umwelt und natür-
liche Ressourcen, Biomassehof Wädenswil,
Verora GmbH
mögliche Synergieprojekte: Budget & Finanzplanung:
• Lokale Kompostwirtschaft Biomassehof offen, betriebsindividuell
Wädenswil (✓)
• Lokales Humusaufbauprogramm (∞)
Klimaidee Wädenswil 25 26.03.2020Beschrieb: Die Anwendung stabilisierter Hofdünger und ausgereifter Komposte ist zentraler Bestandteil ei- nes nachhaltigen Boden- und Nährstoffmanagements. Wird auf Bodenaufbau gesetzt, kommen grosse Mengen ausgereifte Komposte auf die betreffenden Flächen. Kompost ist quasi fertiger Humus und kann sich direkt mit dem Bodengefüge verbinden (Dunst, 2011). Die Massnahmen in der Düngemittelstabilisierung müssen je nach Hof, dessen Betriebsstruktur und Stallsystem individuell betrachtet werden. Mögliche Massnahmen sind sehr vielfältig und reichen von gezielter artgerechter Fütterung, kombiniert mit Futtermittelzusätzen wie Leinsaat oder Pflanzenkohle, Aufbereitung und Lagerung der anfallenden Hofdünger, der Ausbringung bis hin zur Optimierung von offenen Stallsystemen (Verminderung Ammoniakverluste). Auch im Be- reich flüssiger Hofdünger können in den Lagertanks viele Massnahmen wie die Zumischung von Pflanzenkohle oder Hackschnitzel als Flotatschicht umgesetzt werden. Empfehlenswert ist dieses AgroCleanTech-Faktenblatt zur klimafreundlichen Düngung Schlüsseltechnologie Pflanzenkohle: Der Einsatz von Pflanzenkohle liesse sich in einer Kaskadennutzung, je nach Betriebstyp, inte- grieren um geschlossene Nährstoffkreisläufe zu etablieren (= weniger Verluste durch Auswa- schung/-gasung). Pflanzenkohle dient als Trägermaterial für Nährstoffe und kann mit Hofdüngern beladen werden. Sie fördert so effizient das Pflanzenwachstum. Als Futterzusatz kann sie Emissi- onen (Ammoniak) aus der Tierhaltung minimieren (Schmidt, 2012). Ab 2020 wird durch das Eu- ropean Biochar Certifcate (EBC) für qualitativ hochwertige Pflanzenkohle erstmals Zertifikate ausgestellt. Diese belaufen sich auf rund CHF 30 pro Tonne, wenn die Kohle nachweislich dem Boden zugeführt wird (Fredy Abächerli, mündliche Mitteilung, März 2020). Kompostwirtschaft: Der Biomassehof Wädenswwil (Kontakt: Rainer Bossert) ist bereits in der Fertigung von Landwi- irtschaftskompost tätig. Diese Synergie sollte genutzt werden. Die Systeme liessen sich auf verlu- starmere Kompostiermethoden umstellen. Beispielsweise auf ein Terra Preta-System, wo sich durch die Zumischung von hohen Anteilen Pflanzenkohle die Verluste an Kohlenstoff und Stick- stoff weiter reduzieren lassen (Dunst, 2011). Links: https://www.haab-bossert.ch/ Klimaidee Wädenswil 26 26.03.2020
https://www.klimabauer.ch/images/Fachleute/Workshops/Klimaschonende-Mineralduenung.pdf
www.ithaka-journal.net/pflanzenkohle-eine-schlusseltechnologie-zur-schliesung-der-
stoffkreislaufe
Wirkungsziele: Umsetzungsziele:
• Senkung der Nährstoffverluste (Emissi- • Umfassende, lokale Kompostwirtschaft
onen) und Umweltverschmutzungen etablieren
(Immissionen) aus mangelhaft stabili-
sierten Düngemitteln
• Kompostierung und Pflanzenkohle als
Schlüsseltechnologie für regenerativen
Landbau etablieren
Teilprojekt: Mögliche Partnerorganisationen:
Baumpflanzungen & Landwirtschaftl. Verein, ZHAW Institut Umwelt
Hochstammobstgärten und natürliche Ressourcen, Forschungsanstalt
(Agroforstsysteme) Agroscope, Naturschutz Wädenswil, Hoch-
stamm Suisse
mögliche Synergieprojekte: Budget & Finanzplanung:
• Obstgartenprojekte Naturschutz/BirdLi- offen
fe (✓)
• Agroforst Kompetenzzentrum Wädens-
wil (∞)
Beschrieb:
Agroforstwirtschaft: Landwirtschaftsparzellen werden mit Reihen von Hochstamm-Feldobst-
oder Wertholzbäumen & Hecken aufgewertet. Dies generiert nicht nur wichtige Biomasse, bspw.
als Ausgangsstoffe für die betriebseigene Kompostwirtschaft, und diversifiziert die Produktpalet-
te, sondern potenziert auch die Kohlenstoff-Bindung im Boden durch die tiefreichende Wurzel-
Klimaidee Wädenswil 27 26.03.2020masse der Bäume (Seitz et al., 2017). Flächenerträge der Ackerkulturen nehmen um bis zu 40 % zu. Teilweise auch die innere Qualität der Feldfrüchte. Nützlinge in den Gehölzen regulieren Schädlinge der Ackerfrucht. Baumwurzeln dienen zudem als Nährstoff- und Wasserpumpen aus tieferen Schichten (Spiecker et al., 2010). Wichtig für die Schweiz als Tierhaltungshochburg: Modellrechnungen ergaben, dass Agroforst- systeme in Kombination mit Tierhaltung einen Beitrag zur klimafreundlichen Tierproduktion leis- ten können (CO2-Bindung der Bäume; Briner, Hartmann, & Lehmann, 2011). Pionierhafte Praxis- betrie, die zusätzlich auf Kompostwirtschaft setzen, weisen mitunter sogar negative CO2-Bilanzen auf (Schmidt & Kammann, 2018). Hochstamm-Obstgärten: Wädenswil gilt als traditionelle Obstbauregion; es gilt den ökologisch-sinnvollen Hochstam- mobstbau zu fördern, auch für Tafelobstproduktion. Auch das LEK-Ziel K3 Landschafts- und Na- turwerte (Kultur-, Landschafts- und Naturwerte) zielt auf die Unterstützung von Hochstamm- Obstgärten/Streuobstbaum-Beständen ab (AquaTerra, 2012, S. 81). Einen guten Start verzeichnete in diesem Bereich das Obstgartenprojekt Horgen-Wädenswil (Kontakt: Patrick Heer, vgl. auch Massnahmenbericht 2017). Nun könnte dieses Projekt inner- halb der Klimaidee und mithilfe eines Regionalen Entwicklungsprojekts zur weiteren Ressour- cenakquise ausgebaut und vertieft werden (Verarbeitungsstrukturen, Absatzkanäle, Produktinno- vation). Als wichtige Partnerin für Ankauf und Vermarktungslösungen ausserhalb Wädenswils könnte auch die Vereinigung Hochstamm Suisse dienen. Möglichkeiten im Rahmen der Klimai- dee wären bspw. auch Obstgarten-Patenschaften, die die Ressourcen für Aufbau- und Pflegeleis- tungen neuer Anlagen für 5 Jahre sicherstellen. Agroforst-Kompetenzzentrum: Durch die vertiefte Auseinandersetzung der Wissenschaft mit Agroforstsystemen – das heisst, die Produktion von Holz und Baumerzeugnissen mit Ackerkulturen zu verbinden – und der Schluss- folgerung, dass solche Systeme nicht nur enorm produktiv sind, sondern auch der Anpassung an klimatische Veränderungen dienen, soll sich diese traditionelle Landbewirtschaftungsform wieder etablieren (vgl. http://www.agroforstkampagne.net/forschung). In Kooperation mit der Forschungsanstalt Agroscope und der Forschungsgruppe Hortikultur, ZHAW IUNR (Kontakt: Mareike Jäger) könnten lokale BäuerInnen ein Kompetenzzentrum für zukunftsweisende Agroforstsysteme aufbauen. Klimaidee Wädenswil 28 26.03.2020
Sie können auch lesen