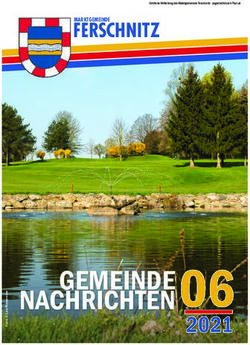Iris Wolff: Die Unschärfe der Welt. Roman. Klett-Cotta Verlag, Stuttgart 2020. 216 Seiten.
←
→
Transkription von Seiteninhalten
Wenn Ihr Browser die Seite nicht korrekt rendert, bitte, lesen Sie den Inhalt der Seite unten
Jahrbuch für Internationale Germanistik
pen Jahrgang LIII – Heft 2 | Peter Lang, Bern | S. 203–220
Iris Wolff: Die Unschärfe der Welt. Roman.
Klett-Cotta Verlag, Stuttgart 2020. 216 Seiten.
Nominiert für den Deutschen Buchpreis 2020 hat Iris Wolff mit Die Unschärfe
der Welt ihr viertes Buch nach Halber Stein (2012), Leuchtende Schatten (2015)
und So tun, als ob es regnet (2017), alle im Otto Müller Verlag erschienen, bei
Klett-Cotta vorgelegt.
Als Motto wählt die 1977 in Hermannstadt (Siebenbürgen) geborene
Autorin Verse des rumänisch-deutschen Dichters Richard Wagner, die seinem
letzten Buch Gold (Aufbau Verlag2017) entstammen: „Ich sah / den Stein
schmelzen und die Liebe gehen / ruft der Vogel aus dem Baum / Wir sagen:
Er singt“. Diese Verse haben eine enge Verbindung zum Roman und nennen
wichtige Elemente, die Die Unschärfe der Welt ausmachen: die Verbindung von
Landschaft, Leben und Liebe durch eine musikalische, sehr lyrische Sprache.
Der Roman besteht aus sieben Kapiteln mit den Titeln: „Zăpadă“, „Echo“,
„Leviathan“, „Windwanderer“, „Makromolekular“, „Jupiter“ und „Prestigio“.
Darin werden die Lebenswege von mehreren Figuren erzählt, die sich zwi-
schen Rumänien (Siebenbürgen und Banat) und Deutschland (Baden-Würt-
temberg und Sylt) im 20. Jahrhundert verbinden, verlieren und wiederfinden.
Im Mittelpunkt steht eine Familiengeschichte, die über vier Generationen in
einer Reihe schlaglichtartig erzählt wird. Aus der Generation der Großeltern
in Siebenbürgen begegnet man der Großmutter Karlina, einer überzeugten
Monarchistin (mit ihren „königliche[n] Episoden“, 81). Die Eltern Florentine
und Hannes übersiedeln ins Banat, wo Hannes als Pfarrer tätig ist. Ihr Sohn
Samuel, der als Kind lange nicht sprechen konnte, hilft seinem Freund Oswald,
aus Rumänien zu fliehen, lebt später in Deutschland, kehrt nach der Revolution
von 1989 zurück und findet seine alte Liebe Stana wieder, die ein Kind von
ihm geboren hat, Livia, die zusammen mit ihrem Bruder Jarik die jüngste
Generation bildet, von der erzählt wird.
Das Zusammenspiel der Familie mit Freunden und Dorfbewohnern, wie
Mariana die Zigeunerin, „die alles mitbekam“ (19), Stanas Eltern Malva und
Konstanty Novac, Ruth und Severin, deren Sohn Echo in der Marosch ertrinkt,
und weiteren Besuchern, wie Benedikt und Lothar, die aus der DDR kommen
und denen Samuel in Deutschland wieder begegnet, spielen eine entscheidende
Rolle in der Struktur des Romans. Und im Dorf kennt man sich: „Es war allge-
mein bekannt, dass Samuel nicht sprechen konnte, dass Hannes gerne Fußball
spielte (manch einer mutmaßte, er sei nur Pfarrer geworden, weil sein Traum,
Fußballprofi zu werden, sich nicht erfüllt hatte). Es war bekannt, welche Kuh
© 2021 doi http://doi.org/10.3726/JA532_203 - Except where otherwise noted, content can be used under the terms of the Creative Commons
Attribution 4.0 International license. For details go to http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/204 | Francesca Bravi: Iris Wolff
wann kalbte, wer um wen warb, wer zu Untreue neigte und wahrscheinlich auch,
wann und wie oft die Dorfbewohner einander liebten.“ (28-29) Dies spiegelt sich
in den Eigennamen der Figuren wider, die zum Teil abgekürzt werden: Livia
wird Liv genannt, „Ich bin Benedikt, nenn mich Bene.“ (23), Stana wird Sana
genannt, weil „Sana Träumerin hieß und im Arabischen ‚der blaue Himmel‘“
(112), Oswald bekommt von Samuel einen Spitznamen, „Oswald sei zu lang,
und das ‚Wald‘ ergebe in seinem Namen keinen Sinn. Der Zauberer Oz, wie
er ihm in einem Buch begegnet war, besaß die Fähigkeit, immer in einer an-
deren Gestalt zu erscheinen.“ (136) Hannes’ Hund heißt Schopenhauer: „es sei
nicht ihr Einfall gewesen, sie hätten ihn von dem vorherigen Pfarrer geerbt.
Schopenhauer hätte einen Umzug nicht überlebt. Er sei alt, sehr alt, er würde
nicht einmal bellen, wenn das Haus abbrannte.“ (26)
Geburt und Tod unterhalten eine enge Verbindung in Wolffs Roman. Der
Tod ist schwarz: „Wer trauert, trägt Schwarz, wer das Leben und die Aufer-
stehung feiert, Weiß. Die Abwesenheit der Farben wirkte fremd im grünblau
beflaggten Garten und strahlte eine Sachlichkeit, Eindeutigkeit, ja, Wahrheit
aus wie sonst nur Buchstaben auf Papier. Die Zumutung des Todes wurde so zu
einem objektiven Tatbestand. Anders war es nicht auszuhalten.“ (60) Wie auch
im Film Sieranevada von Cristi Puiu (2016) wird hier der auf den in Rumä-
nien üblichen Brauch, bei einem Trauerfall im Haus die Spiegel zu bedecken,
angespielt: „In der vordersten Stube stand nur noch ein Schrank, die anderen
Möbel waren fortgeschafft, die Spiegel mit dunklem Stoff verhangen worden.
Der Tod sollte sich nicht wiederfinden, verdoppeln, ebenso der Kummer im
eigenen Gesicht.“ (43)
Im ersten Kapitel spielt hingegen Weiß eine so wichtige Rolle, weil der
Schnee („Zăpadă“) im Mittelpunkt steht: „Es schneite seit einer Woche. Zuerst
kleine, unschuldig anmutende Flocken, die den Hof sprenkelten wie den Rücken
eines Tieres.“ (11) Aber auch später im Roman fallen „Schneeflocken, dick
und wässrig“ (207). Wolff geht mit Farben sehr sorgfältig um und bedient sich
einer vielseitigen Farbpalette, die sprachlich sehr lyrische Töne annimmt. Es
entsteht „ein grauschwarzes Muster im fortgesetzten Weiß“ (13), die „Farben
verblassten, ein salziger Geruch kam von den Feldern, und wenn sie die Augen
schloss, sah sie silbrig-schwarze Fische im Schnee.“ (30)
Die Farben zeugen von einer großen Nähe zu den Landschaften und weisen
weitere Nuancen auf: „Lichtstreifen berührten die Äcker, lösten Farben aus
den Feldern, welkes Grün, Violettbraun, Kupfer.“ (174) Es sind Siebenbürgen
(„Transilvania“, 75) und Banat in Rumänien, dörfliche, ländliche Landschaften:
„Ein Dorf, das mehr Störche als Einwohner zählte. Neben der Kirchenburg am
Zibin, den römisch bezifferten Gassen, die nur in der Mundart Namen trugen,
vermisste er vor allem die Karpaten. Ihre Gegenwart veränderte das Licht. Zu
Mittag war es grünlich-violett (im Winter silbrig-blau), am Nachmittag ein
Goldgelb, das am Abend ins Kupferfarbene überging. Jeden Morgen hatten
Jahrbuch für Internationale Germanistik, Jahrgang LIII – Heft 2 (2021) Peter LangFrancesca Bravi: Iris Wolff | 205
die Berge die Farben wieder ausgewaschen.“ (46) Es sind einsame rumänische
Regionen, die aber mit verschiedenen Verkehrsmitteln, wie beispielsweise
„Pferdewagen“ (11), oder dem berühmten Orient-Express, „der Wien und Buka-
rest miteinander verband und gegen Mitternacht in Arad hielt“ (86), durchquert
werden können und zu Bahnhöfen führen, die so im Banat eingerichtet sind, „als
gäbe es keine Notwendigkeit, irgendwo anzukommen.“ (20). Die Grenzregion
Banat, die in Rumänien, Serbien und Ungarn liegt, und über die Autorinnen
wie Herta Müller (Mein Vaterland war ein Apfelkern, Hanser 2014) und Esther
Kinskys (Banatsko, Matthes & Seitz 2011) erzählen, ist von weiten Feldern,
„Weizen- und Kukuruzfeldern“ (41), und Kuh- und Schafherden in „ihrem
selbstvergessenen Grasen“ (35) durchzogen. Schafe insbesondere erzeugen „ein
nicht näher zu bestimmendes Wohlgefühl […] zwischen Rührung, Melancholie
und Dankbarkeit. Diese Empfindung hatte sich bei Karline im Laufe der Jahre
auch auf den Anblick der Wolken ausgedehnt.“ (80)
Die Natur wird personifiziert: „Die Weizenfelder waren abgeerntet, der
Mais stand noch. Die Ebene reichte so weit man sehen konnte. Der Himmel
beanspruchte den größten Raum, ohne Widerspruch von Bergen und Wäldern.
Wie eine Ader schlängelte sich die Marosch durchs flache Land.“ (106) Der
Wind wird als ein „großer, eigenwilliger Atem“ (46) beschrieben. Er spielt im
ganzen Buch eine tragende Rolle: „Ein sachter Wind kühlte den Nacken, fing
ab und an ein Wort auf.“ (23) Man ist „dem Wind ausgeliefert. Wind, der einem
Staub in die Augen streute, in den Ohren schmerzte, die Haare zerzauste. Wind,
der Dachschindeln von den Häusern fegte, an Fensterläden rüttelte, Türen
zuschlug. Der ohne Vorwarnung Kerzen ausblies, Buchseiten umblätterte,
Zeitungen verwehte.“ (46) Auch für die Landwirtschaft ist der Wind wegen der
Anemochorie unverzichtbar, er „trage Samenkörner mit sich, auf der Suche nach
gutem Boden. Damit etwas wächst, brauche es nicht mehr als die Berührung
des Windes.“ (64) Stana „lernte von den Windwanderern, lernte, nicht gegen
das Wasser zu kämpfen, auch, gegen den Vater nicht zu kämpfen.“ (100) So wie
Samen transportiert der Wind aber auch Wörter: „Florentine hatte erzählt, dass
Samuel sich als Kind vorgestellt habe, der Wind trage Worte mit sich. Worte
anderer Sprachen, Worte, die er oft gehört hatte, und andere, deren Sinn sich
nur langsam offenbarte […]. “ (212)
Der Wind spielt auch in einem anderen Roman von Iris Wolff eine eine
wichtige Rolle, So tun, als ob es regnet: „Vicco […] fragte sich, welche Sprache
näher an der Wirklichkeit war: sein Dialekt, in dem der Wind gemächlich ‚ging’,
das Hochdeutsche ‚wehte’, oder das Rumänische, in dem der Wind kräftig
‚schlug’, vîntul bate.“ (So tun, als ob es regnet, Otto Müller 2017, 93-94). Auf
die sprachliche Umsetzung der Handlung des Windes bezieht sich auch Herta
Müller in ihrem Beitrag zur Festschrift Murnau Manila Minsk — 51 Jahre
Goethe-Institut anlässlich einer Ausstellung des Deutschen Historischen Muse-
ums und des Goethe-Instituts, Inter Nations e.V. vom 5. Juli bis 25. September
Peter Lang Jahrbuch für Internationale Germanistik, Jahrgang LIII – Heft 2 (2021)206 | Francesca Bravi: Iris Wolff
2001 mit dem Titel Wenn sich der Wind legt, bleibt er stehen oder Wie fremd
wird die eigene Sprache beim Lernen der Fremdsprache: „Im Dialekt des
banatschwäbischen Dorfes, in dem ich aufgewachsen bin, sagte man: Der Wind
geht. Im Hochdeutschen, das man in der Schule sprach, sagte man: Der Wind
weht. Und das klang für mich als Siebenjährige, als würde er sich wehtun.
Und im Rumänischen, das ich damals in der Schule zu lernen begann, sagte
man: Der Wind schlägt, vintul bate. Das klang damals, als würde er anderen
wehtun.“ (Beck 2011, online unter: https://www.dhm.de/archiv/ausstellungen/
goethe/katalog/mueller.htm)
Die Sprache, bzw. die Sprachen im Plural (Deutsch, Rumänisch,
Slowakisch, Ungarisch), spielen eine sehr wichtige Rolle im Roman, die „Über-
einstimmung zwischen einem Land und den Nationalitäten“ (138), die darin
leben, wird problematisiert. Florentine fragt an einer Stelle: „Was meinst du
mit einheimisch? Schwäbisch, slowakisch, ungarisch, rumänisch, tschechisch,
jüdisch oder vielleicht serbisch?“ (113)
Bei der Figur von Samuel sind Sprechen und Schweigen eng miteinander
verbunden: Er „hatte spät angefangen zu sprechen, ein Gemisch aus dialektal
gefärbtem Deutsch, Rumänisch und Slowakisch.“ (47) Seine Mutter Florentine
macht sich deswegen Vorwürfe und hat selbst eine schwierige Beziehung zur
Sprache: „Florentine spürte Worten gegenüber ein nie ganz aufzulösendes Un-
behagen. Die Unschärfe der Aussagen verunsicherte sie. Wie sehr sie sich auch
bemühte: Sprechen reichte nicht an die Wirklichkeit der Erfahrung heran.“ (22)
Im Dialekt werden andere Wörter verwendet „immer leicht abweichend vom
Hochdeutschen. Das Jackett hieß Rock, der Kühlschrank Eiskasten, der Backo-
fen Rohr.“ (201) Es ist ein magischer Moment, als Samuel das Wort „Zăpadă“,
rumänisch für Schnee, ausspricht, als Schneeflocken auf ihn und seine Mutter
fallen: Und „er sagte ein Wort, mit zwei stumpfen und einem klingenden ‚a‘, so
laut und deutlich, dass der Wind es nicht fortnehmen konnte.“ (38) Neue Wörter
behandelt er „wie einen Fund, eine Entdeckung, die nur ihm gehörte. Manchmal
schenkte er ihr ein Wort, […] oder wies sie auf besonders schöne hin: ‚greoaie‘,
auf Rumänisch ,unhandlich‘, ein Adjektiv, das nichts Besonderes anzeigte, dafür
aber fünf Vokale brauchte – oder ,oaia‘, das Schaf, das ganz ohne Konsonanten
auskam.“ (112) Auch Herta Müller weist auf dieses Wort hin: „Die weichen
Diphthonge und Triphtonge wie ,toate‘ — alle — und ,oaie‘ — Schaf, das gab
es im Deutschen nicht. Ich hab die Wörter so gerne ausgesprochen, die waren
im Mund so schön, sie haben mir von Anfang an, wie soll ich sagen, ästhetisch
geschmeckt.“ (Mein Vaterland war ein Apfelkern, Hanser 2014, 84-85)
Schafen und Hirten evozieren eine bestimmte Idee von Literatur:
„Florentine mutmaßte, dass sich rumänische Literatur vor allem durch Schaf-
hirten übers Land verbreitete. Schafe waren in Rumänien heilige Tiere. Pferde,
Büffel und Rinder gab es auch viele, aber nur über Schafe existierten Lieder
und Gedichte.“ (37)
Jahrbuch für Internationale Germanistik, Jahrgang LIII – Heft 2 (2021) Peter LangFrancesca Bravi: Iris Wolff | 207
Einige, wenige weitere Wörter, Sprichwörter oder Redewendungen auf
Rumänisch werden genannt: „Ţară fericită“ (56), „Vine furtuna“ (81), „In jedem
Wind steckt ein Teufel, sagten die Rumänen.“ (50), „Wenn es regnet, heißt es,
es tue dem Toten um das Leben leid […].“ (62)
Das Deutsche wird als „gerundet, mit langen Vokalen und vielen
Sch-Lauten“ (138) beschrieben.
Man erfährt die Herkunft der Bezeichnung für das Schwarze Meer auf
Rumänisch „Marea Neagră.“ (149): „Die Perser benannten die Himmelsrichtun-
gen nach Farben. Weiß der Westen, Rot der Süden, Grün der Osten, Schwarz
der Norden. So erhielt das Schwarze Meer seinen Namen, Marea Neagră. Das
All war schwarz, Luthers Gewand war schwarz.“ (122)
Ungarisch und Slowakisch werden auch erwähnt. Oma Karina wurde von
ihrer ungarischen Gouvernante Károly genannt: „Die gegen die Vorderzähne
schlagende Zunge war eine angemessene Strafe für die Verkehrung ihres
Namens ins ungarische Maskulin. / Ihr erster Freund hatte eine englische
Mutter und verfiel irgendwann auf den Einfall, sie Charlie zu nennen.“ (70)
Samuel spricht durch die Verbindung mit Stana, der Tochter von Malva und
Konstanty Novac, auch fließend Slowakisch: „Diese Freundschaft hatte dazu
geführt, dass Samuel auf Slowakisch zählte: Jeden, dva, tri, štyri, päť, šesť, sedem,
osem, deväť, desať. Hannes hatte ihm wiederholt die deutsche Zahlenreihe aufge-
sagt, musste aber zugeben, dass dem Slowakischen eine Musikalität innewohnte,
die es leichter machte, sich die Zahlen einzuprägen.“ (47) Das spiegelt sich in
seiner Stimme, die in dieser Sprache anders klingt „entschiedener, rascher“ (172)
wider. Ihm scheint es sogar im Slowakischen mehr Wörter zu geben.
Die verschiedenen Sprachen sind auch mit verschiedenen Religionen
verbunden: „Zuletzt wurde das Lied Dreihundertachtundachtzig gesungen,
was der Kurator in einer Sprachverwirrung mit Dreihundert optzecişiopt an-
kündigte.“ (62) Ihre Glocken offenbarten, welcher Konfession man angehört,
insbesondere bei einem Todesfall: „Starb ein junger Mensch wie Echo, läuteten
alle Kirchenglocken. Das Ausläuten begann mit der evangelischen Kirche, dann
stimmten die anderen Kirchen ein, über alle Dächer und Konfessionen hinweg,
die reformierte, die orthodoxe, die griechisch-katholische.“ (59)
Eng verbunden mit der gesprochenen Sprache sind Worte, die mit Nah-
rungsmitteln verbunden sind: „letzten Tomaten aus dem Garten, Telemea,
Brot, Pflaumenmarmelade und Akazienhonig, dazu Kaffee“ (27), Maisgrieß
aus Siebenbürgen „Palukes mit Milch“ (42), „Paprikasch […] saure Gurken,
[…] Kleingebäck“ (63), „Vinete und Tomaten nur von unten, an den Wasser-
melonen klopfen, auf den dumpfen, hellen Klang horchen, der verriet, wann
sie reif waren.“ (97)
Die gesprochene Sprache ist sehr eng mit den Gefühlen von Fremdsein
und Zugehörigkeit verbunden: „Im Banat gab es diese Fremdheit nicht, und Liv
dachte, dass es vielleicht für jeden einen Platz gab, an den er gehörte. Manche
Peter Lang Jahrbuch für Internationale Germanistik, Jahrgang LIII – Heft 2 (2021)208 | Francesca Bravi: Iris Wolff
Menschen mussten fortgehen, um diesen Ort zu finden, andere wiederum
würden ihn nie finden, wenn sie fortgingen.“ (202) Wie etwa Samuel, der erst-
mal wegfahren musste, nach Deutschland, um zurückzukommen. Das konnte
aber erst zum richtigen Zeitpunkt geschehen nach der Revolution von 1989. Es
wird genau beschrieben, was im Dezember 1989 in Temeswar geschah, „bei
den Befestigungsanlagen im Norden der Stadt einfinden, beim ehemaligen
Wiener Tor. Die Straßen waren voller Tauben. Sie nahmen den Boulevard ein,
den Platz vor der Oper, den Domplatz. Eine graue, wogende Masse, ihre ru-
ckelnden Köpfe eine umgekehrte Verneinung. Inmitten eines Taubenschwarms
stand eine Frau und fütterte die Tiere. Regenwolken hingen dräuend über den
Dächern. Die Farben rutschten ins Gräuliche.“ (127)
Ironisch und bitter wirkt die Bezeichnung Ceaușescus als „Genie der
Karpaten“, der „bescheiden“ lebte: „Das mit dem Palast war ihm eigentlich nur
so nebenbei passiert. Er hätte auch kleiner ausfallen können, doch wenn man
einen Sitzungssaal hatte, brauchte es auch einen Ballsaal. Zweifellos, wenn
man so beliebt war, brauchte man zahllose Gästezimmer. Wenn man eine Frau
hatte, aber etwas auf seine Unabhängigkeit hielt, brauchte man zwei separate
Treppenaufgänge. Und wenn man sein Volk liebte, liebte man auch dessen
Kunst und brauchte Archive, Ausstellungsräume, einen Theatersaal. Wie gut,
dass man religiöse Kunstgegenstände ab und zu bei den Kapitalisten zu Geld
machen konnte.“ (130) Seine Frau Elena wird „Titanin“ genannt: „Ein einfaches
Mädchen aus der Vorstadt Mahala konnte da nicht reichen. Es musste schon
eine Wissenschaftlerin von Weltruhm sein.“ (131)
Von der Revolution erfährt Samuel von Deutschland aus den Medien. Das
Radio „plärrte“ (18) und bringt so wie in Lutz Seilers Kruso (Suhrkamp 2014)
und Stern 111 (Suhrkamp 2020) die Nachrichten über 1989: „Samuel stellte das
Radio lauter. Der Sender ‚Freies Europa‘ brachte Nachrichten aus Rumänien. Es
war von Unruhen in Temeswar berichtet worden. Die Demonstrationen weiteten
sich aus, Tausende gingen in Arad auf die Straße, jetzt auch in Bukarest. Die
Armee setzte Wasserwerfer und scharfe Munition gegen die Demonstranten
ein, aber es wurde auch von Solidarität mit den Aufständischen berichtet.“
(168) Von „den ersten Bestimmungen der Übergangsregierung und dass es in
Bukarest noch immer vereinzelt Schießereien gab“ (178), hört Samuel auch im
Radio. Aber dort wir auch Musik gespielt, so zum Beispiel Manchild von Neneh
Cherry aus dem Jahr 1989: „Ein Lied wurde im Radio gespielt, irgendeines
jener Lieder, die in den Charts waren. ‚Manchild, look at the state you’re in /
Could you go undercover / And sell your brand new lover (could you?)‘.“ (169)
Samuel sieht mit Benedikt Bilder der Revolution auch im Fernsehen: „Auf
dem Tisch brannten Kerzen, in den Fenstern Lichterketten, und Bene und Samuel
sahen zu, wie junge Demonstranten ‚Nieder mit Ceauşescu‘ riefen. Dann wurden
Armeesoldaten im eroberten Palast gezeigt, von ihren Mützen und Uniformen
hatten sie das sozialistische Abzeichen entfernt. Die Nachrichtensprecherin gab
Jahrbuch für Internationale Germanistik, Jahrgang LIII – Heft 2 (2021) Peter LangFrancesca Bravi: Iris Wolff | 209
bekannt, dass der Diktator und seine Frau auf der Flucht waren.“ (171) Durch
den Fall der Berliner Mauer fiel der „ganze Ostblock, Ungarn, Polen, Bulgari-
en, Jugoslawien, die ČSSR“ auseinander, „weil die Sowjetunion auf Reformen
gesetzt hatte. Nur in Rumänien herrschte bleierne Ruhe.“ (163) Jahrzehntelang
hatten die Menschen hinter dem Eisernen Vorhang „in einer Metapher“ gelebt:
„Auch etwas, das über Jahrzehnte das Leben unzähliger Menschen bestimmt
hatte, konnte fallen, konnte zerbrechen, und er fragte sich, ob Metaphern Er-
fahrungen verbergen oder zum Vorschein bringen.“ (163)
Wolff spricht auch die Situation der Deutschen in Rumänien an, sie spricht
vom „Ausverkauf der Deutschen – die in den Securitate-Korrespondenzen zu
seiner Erheiterung unter dem Decknamen ‚pădureni‘ (Waldbewohner) geführt
wurden.“ (132) Die Situation in der Zeit unmittelbar nach der Revolution wird
auch beschrieben: „Die Straßen des Dorfes waren verlassen. Alles sah aus wie
immer. Und war nicht wie immer. Bene bemerkte das Verfallene, Unsanierte,
die abgeplatzten Farben der Fassaden. An die Kirche konnte er sich erinnern,
ihren schmalen Turm, die ockerfarbenen Mauern, und auch an das grüne Tor
des Pfarrhauses – der Rest der Straße war ihm fremd, und er fragte sich, mit
welchen Gefühlen Samuel das alles wiedersah.“ (175) Denn Kommunismus
„lebte davon, dass jeder schuldig war.“ (59)
In Wolfss Roman Die Unschärfe der Welt sind diese sehr realistischen
Passagen mit traumhaften und märchenhaften Elementen verbunden. Darunter
sind Träume zu verzeichnen: „Hannes hatte einen wiederkehrenden Traum“, in
dem er in seinem Bett liegt und in seinem Körper gefangen ist und sich nicht
rühren kann. (50) Severin behauptet, „seine Kühe würden träumen.“ (43) Er
beobachtet eine junge Färse beim Träumen, wie sie, die Augen feucht, „der
Kopf leicht zur Seite geneigt. Sie sah erstaunt aus. Ihr helles Fell, das tagsüber
farblos und matt wirkte, glänzte wie Seide.“ (66)
Auf eine ähnliche Art und Weise werden biblische und mythologische
Figuren erwähnt. Beispielsweise in der Figur Leviathan ist die Bibel wieder-
zufinden. So wird eine Maschine beschrieben, die Karlines Vater baute: „Die
Maschine, die er schließlich entwickelte und patentieren ließ, ähnelte immer
noch der Leviathan, die es seit achtzehnhundertdreiundsechzig gab. Sie be-
stand aus einer Waschkufe, in der die vorsortierte Wolle durch eine rotierende
Trommel untergetaucht und im Becken hin- und hergeschoben wurde, während
eine Gabel rhythmisch in die Wolle stach.“ (79)
An anderer Stelle im Roman wird ein Prophet der Bibel erwähnt: „Nur ein
Prophet in Jerusalem, Jeremia, warnte vor einem Krieg gegen Babylon und zog
sich den Hass der Mächtigen und Priester zu, denen es schließlich gelang, ihn
ins Gefängnis zu werfen. Dort besuchte ihn der König. – Gibt es ein Wort des
Herrn?, wollte er wissen. Er erwartete Orientierung, ein tröstendes Gotteswort.
Doch Jeremia sagte: Du wirst dem König von Babel in die Hände fallen. Gott
wird dich nicht erretten.“ (104-105)
Peter Lang Jahrbuch für Internationale Germanistik, Jahrgang LIII – Heft 2 (2021)210 | Francesca Bravi: Iris Wolff
Die römische Mythologie ist durch die Abbildung auf einem Buchum-
schlag präsent: „Auf dem Einband war Jupiter, der Schutzgott Roms, abge-
bildet, der als Stier Europa entführt, Leda in Gestalt eines Schwans verführt,
Ganymed als Adler raubt. Das Buch klappte von alleine an der Stelle auf, wo
das Weinblatt lag, zwischen Trevibrunnen und Piazza Navona.“ (171)
Aus der Märchenwelt entstammt ein Drache mit Flügeln, Krallen und
gespaltener Zunge, der Oswald begleitet und bei dem er weiss, „dies war
kein Traum“ (126), weil alles so überdeutlich ist: „Oz spürte das Zittern der
Drachenfüße auf dem Acker, sah die Spannweite der Flügel als Schatten über
den Dächern des Dorfs, hörte den Schuppenpanzer, jede Bewegung ein silbrig
helles Geräusch. Manchmal zeigte der Drache sich wochenlang nicht. Dann
tauchte er auf, in der Abgeschiedenheit der Ebene oder, was schlimmer war,
hinter einem Menschen, mit dem Oz sprach. Es kostete ihn einiges an Kraft,
sich nichts anmerken zu lassen. Doch die meisten Menschen hatten Übung
darin, sich täuschen zu lassen.“ (127)
Im Fall von Karlines Erinnerungen werden die reale und die phantastische
Ebene verwischt, es sind die Erinnerungen an König Michael I. von Rumä-
nienaus dem Hause Hohenzollern-Sigmaringen, der in der ersten Hälfte des
20. Jahrhunderts König von Rumänien gewesen war: „Jetzt, gerade jetzt, sie
wusste nicht warum, spürte sie die Hand des Königs in ihrer Hand. Er lächel-
te. Er lächelte so, wie die Sonne aufging – die Vögel kündigten sie an, lange
bevor sie zu sehen war. Es war ein warmer Apriltag, die Vögel sangen in den
Bäumen, flogen auf, und König Michael, der Erste, lächelte.“ (69) Karline fängt
im Alter an, die Erinnerungen über den König und seinen Castelul Peleș, sein
Märchenschloss, „zu erfinden“ (92): „Erst vor einiger Zeit hatte König Michael
seine Schlösser in Rumänien zurückerhalten und damit indirekt auf den Thron
verzichtet. Ihm das zu verzeihen, fiel Karline als überzeugter Monarchistin
schwer.“ (199)
Mit der Figur der Großenkelin Liv kommt außerdem die Dimension der
Zauberei ins Spiel, die zum Teil aber bereits durch den Freund ihres Vaters
Oswald gegenwärtig ist, der Oz „wie der Zauberer?“ (142) genannt wird: „Jeder
Zauberer, sagte Liv, während sie die Karten mischte, habe eine Karte, die er am
wenigsten mochte. Bei ihr sei es der Pik-König, der Herrscher mit dem umge-
drehten schwarzen Herz. Die Bezeichnung komme von der französischen pique,
einem Spieß.“ (193) Das Zaubern wird als Handwerk beschrieben, die Zauberin
muss mit ihrem Publikum umgehen, seine Aufmerksamkeit kennen und lenken,
denn das „Publikum wird dort hinsehen, wo der Zauberer hinsieht.“ (213) Vom
Zaubertrick werden die drei Phasen („Akte“) beschrieben: „Der Magier führte
in das Thema ein, zeigte etwas, dann brachte er es zum Verschwinden, aber
erst, wenn er die Dinge wieder auftauchen ließ, war der Trick gelungen. Dieser
Teil war der schwerste, barg die Möglichkeit des Scheiterns und war doch der
wichtigste, Prestigio – das Finale.“ (195)
Jahrbuch für Internationale Germanistik, Jahrgang LIII – Heft 2 (2021) Peter LangFrancesca Bravi: Iris Wolff | 211
Liv kann als Zauberin dafür sorgen, dass die Dinge nicht verloren gehen
(205), was sonst nur Lügner können. Zwischen Realität, Zauberei und Lüge
scheint sich Iris Wolff in ihrem Roman Die Unschärfe der Welt zu bewegen.
Die Familiengeschichte, die über vier Generationen erzählt wird, trägt in sich
Phantasie und Erinnerung, die Unschärfe der Außenwelt wird mit der Schärfe
einer verdichteten Sprache festgehalten, denn die „Erinnerung ist ein Raum
mit wandernden Türen“ (69) und der „Blick des Zauberers ist der Blick des
Publikums.“ (213)
Francesca Bravi
Kiel
Peter Lang Jahrbuch für Internationale Germanistik, Jahrgang LIII – Heft 2 (2021)212 | Sibylle Lewitscharoff, Heiko Michael Hartmann: Poetischer Streit im Jenseits
Sibylle Lewitscharoff und Heiko Michael Hartmann: Warten auf:
Gericht und Erlösung: Poetischer Streit im Jenseits. Freiburg u.a.: Herder
2020, 208 S.
Das Jenseits hat Konjunktur in der Gegenwartsliteratur. Bekannte Autorinnen und
Autoren der Gegenwart, wie Martin Walser, Urs Widmer, Michael Köhlmeier,
Thomas Lehr, Daniel Kehlmann, Georg Klein und Thomas Hettche, schreiben
Jenseitserzählungen.1 Sogar ein Pop-Autor wie Thees Uhlmann hat mit Sophia, der
Tod und ich (2015) einen Jenseitsroman verfasst.2 Unter ihnen sticht insbesondere
Sibylle Lewitscharoff als Jenseits-Expertin hervor: In vielen ihrer Bücher, wie
Consummatus (2006), Blumenberg (2011), Das Pfingstwunder (2016) und Von oben
(2019), geht es ums Jenseits.3 Auch Warten auf: Gericht und Erlösung: Poetischer
Streit im Jenseits, das Lewitscharoff mit Heiko Michael Hartmann zusammen
geschrieben hat, ist ein Jenseitsdialog. Michael Heiko Hartmann wurde von Rolf-
Bernhard Essig in der Zeit als »Solitär der Gegenwartsliteratur«4 bezeichnet. Seine
bisherigen Romane MOI (1997), ein »genial böse[s] Splatter-Debüt«, Unterm Bett
(2000), eine »trägt emphatische[...] Beamten-Hommage«5 und Das schwarze Ei
(2006) sind nicht als Jenseits-Romane bekannt. Allerdings schreibt Essig dem
Schwarzen Ei »mystische [...] Ideen« zu, »die sich durch den Roman ziehen«.6
Bei Lewitscharoff sind Kooperationen mit anderen Schriftstellern und Künstlern
keine Ausnahme. Abraham trifft Ibrahim. Streifzüge durch Bibel und Koran (2018) hat
sie mit Najem Wali geschrieben und die Pong-Serie (1998-2017) zusammen mit ihrem
Ehemann, dem Künstler Friedrich Meckseper, gestaltet. Die Texte sind in sich auch
dialogisch, was ebenfalls typisch für Lewitscharoff ist. In Consummatus kommentieren
die Toten den Bewusstseinsstrom des Ich-Erzählers und Protagonisten Ralph Zim-
mermann. Dabei sind die Gesprächsbeiträge grafisch voneinander abgehoben – was
die Geister sagen, ist in einem Grauton gedruckt. Im Pfingstwunder wird der Dialog
zum Multilog: die Kongressteilnehmer sprechen vor ihrem Verschwinden alle wild
durcheinander, einen »Wortsalat«7 aus verschiedenen Sprachen. Auch in intertextueller
Hinsicht befindet sich Lewitscharoff stets in einem intertextuellen Dialog mit Dante,
Beckett, Goethe, Jean Paul, Kafka und Kierkegaard. Hartmann weist seinerseits
intertextuelle Bezüge zu Kafka, Kleist und zum BGB auf.8
Schon der Titel von Warten auf: Gericht und Erlösung ist ein intertextueller
Verweis auf Samuel Becketts berühmtes Stück Warten auf Godot (1952). In siebzehn
Kapiteln mit Titeln wie »Mein Tod«, »Der Weg zum Heil«, aber auch »Husch«, »Wi-
schiwaschi« und »Im Gedicht« diskutieren die Figuren Gertrud Severin, geborene
Herzsprung, und ein namenloser Philosophieprofessor als frisch Verstorbene mitein-
ander ihre metaphysische Problemlage. In einem Interview mit Florian Felix Weyh von
Deutschlandfunk Kultur erklärt Lewitscharoff, dass sie die Frauenfigur geschrieben
hat und Heiko Michael Hartmann den Mann.9
Dieser Jenseits-Dialog gehört zur Gattung der Totengespräche und steht damit
in der Tradition der Lukianischen Satire. Dementsprechend stehen sich die beiden
Dialogpartner weltanschaulich fern, befinden sich in einem extramundanen Schau-
platz und es werden Probleme der Gegenwart – wie religiöser Fundamentalismus und
Orientierungslosigkeit, Wissenschaftsgläubigkeit und Transkulturalität – kritisch
Jahrbuch für Internationale Germanistik, Jahrgang LIII – Heft 2 (2021) Peter LangSibylle Lewitscharoff, Heiko Michael Hartmann: Poetischer Streit im Jenseits | 213
verhandelt.10 Erzähltheoretisch lassen sich die beiden Dialogpartner als tote Erzähler
nicht so leicht analysieren. Sie sind oder vielmehr waren Teil der Figurenwelt, zugleich
nähert sie ihr Wissen und ihr Überblick allwissenden Erzählinstanzen an.11 Da sowohl
die beiden toten Erzähler als auch der Ort, an dem sie sich befinden, physikalisch und
logisch unmöglich sind, handelt sich um unnatürliche Erzählelemente im Sinne von
Jan Alber.12
Die beiden Toten haben zwar eine Art »transzendentalen Leib« (S. 50), dennoch
können sie einander nicht sehen, sondern nur hören, was sie sehr irritiert. Sie sind bei
einem Flugzeugabsturz umgekommen, erinnert sich Gertrud nach und nach (S. 135).
So richtig sympathisch ist keine von den beiden Figuren: Sie erscheint als eine etwas
selbstgerechte Plaudertante mit einem gewissen Bildungsdünkel, während er schroff
und verbohrt in seinen Abstraktionen herumsumpft – rechthaberisch sind sie alle beide.
In einer Art Prolog unter einem Bibelzitat prallen die beiden Figuren erstmals
aufeinander. Ihre Äußerungen sind grafisch voneinander abgesetzt durch zwei
verschiedene Schrifttypen. Es ist bezeichnend, dass die umständliche Gertrud die
Serifenschrift erhält und ihr schnörkelloser Widerpart die serifenlose. Lewitscharoff
erläutert im Interview, dass »das Serifenlose für den Himmel-und-Hölle-Verächter«
das Richtige sei und die Serife bei der Figur der Gertrud »ein kleines Häckchen setzt
auf das Wunder hin«.13 Dass der Himmel-und-Hölle-Verächter selbst nach dem Tod
noch sprechen und reflektieren kann, bringt ihn von Anfang an in die schlechtere
Position, da er davon ausging, dass mit dem Tod alles zu Ende sei.14
Das Gespräch zwischen den beiden Seelen ist konflikthaft. Er hält sie zunächst
für »das Nichts«, das seine Schwäche nutzt, um ihn »mit treuherzigem Geplapper
endgültig auszulöschen« und für eine »lächerliche Tante aus der Provinz« (S. 14, 25).
Gertrud meint, er sei »irgendein niederer Geselle aus der Schar der Teufelsbrut« und
ein »Stinkstiefel« (S. 18).
Die beiden sind in einer Art Nichts gelandet: »Wo ... wo ... bin ich bloß gelandet?
[…] alles so wattig, so leer. […] Komme mir vor, als hätte man mich an der Luft aufge-
hängt« (S. 7), jammert Gertrud. Die beiden sind vorerst allein: »Kein Jesus, kein Gott,
kein Heiliger Geist, keine Engel, keine Sünder – einfach nichts und niemand davon«
(S. 20), beklagt sich Gertrud. Dieses schwerinterpretierbare und -aushaltbare Nichts,
dem schon Wilhelm Görtz in Von Oben ausgesetzt war, deuten die beiden Figuren als
»so etwas wie [...] Fegefeuer« (S. 21). Im Interview aber macht Lewitscharoff deutlich,
dass es sich um »einen unklaren Ort« handle, der »noch nicht aussortiert in eine der
drei klassischen Aufbewahrungsorte« ist.15 Wie es für Jenseitsliteratur typisch ist,
wird ein besonderer Raum entworfen.16 Zum einen ist es ein transitorischer Ort des
Wartens.17 Zum anderen wird ein metaphysischer Raum inszeniert.18
Die beiden Dialogpartner fragen sich, warum ausgerechnet sie beide sich alleine
in diesem Vorraum des Jenseits wiederfinden. Gertrud rätselt, ob es daran liege, dass
sie zufällig zur selben Zeit gestorben seien. Der Philosophieprofessor meint, dass
Gertrud seine Qualen verkörpere. Ihre Unterschiedlichkeit sei ihr Fegefeuer, in dem
sie geläutert werden sollen. Während des Gesprächs werden sich die beiden Hauptfi-
guren sympathischer. Für ihre Erlösung sollen sie ihre Unterschiedlichkeit aufgeben
und diese Aufgabe sei nichts Geringeres als die Liebe, meint er – allerdings nicht in
einem irdisch-körperlichen Sinn. Aber: »Die Liebe ist ein schwieriges Ding, auch
Peter Lang Jahrbuch für Internationale Germanistik, Jahrgang LIII – Heft 2 (2021)214 | Sibylle Lewitscharoff, Heiko Michael Hartmann: Poetischer Streit im Jenseits
unter frisch Verstorbenen« (S. 67), muss er einräumen. Aussagen, wie »[s]ie ist etwas
völlig Fremdes, von dem ich weiß, dass es aufs Engste zu mir gehört« und »[i]ch bin
deine eigene Stimme« (S. 168, S. 194), legen nahe, dass die Beiden zwei Seiten einer
Medaille verkörpern. Zugleich sind ihre Positionen grundsätzlich nicht vereinbar,
wie seine folgende Äußerung zeigt: »Wie der Mond die Erde umkreise ich sie, ohne
Hoffnung mich je mit ihr vereinigen zu können.« (S. 168).
Erst möchte der Philosophieprofessor die verwirrte und verängstigte Gertrud
beraten und kritisiert, dass Religion nur dann Trost spenden dürfe, wenn sie die Sicht
auf den Abgrund des Lebens, nämlich die Schrecklichkeit und Endgültigkeit des Todes,
nicht verdecke. Sonst führe sie bloß in eine »mundwarme Bonbon-Finsternis« (S. 34)
und nicht zur Erkenntnis. Gertrud hingegen erinnert sich lieber an religiös motivierte
Kulturgüter – wie Michelangelos Fresken und die Oratorien von Johann Sebastian
Bach – und stellt sich ein paradiesisches Jenseits vor:
Beseligende Freude, Weisheit, ein wenig unterfüttert mit homerischem Geläch-
ter, sprachliche Ausdrucksformen, schwer zu unterscheiden von einer Musik,
die auf Wellen tanzt, Klanggebilde von höchster Präzision, in denen immer
neue Formen der Erkenntnis aufscheinen, welche helfen, die verschwiegenen
Rätsel der Unermesslichkeit des Alls und damit Gottes Wirkwerk in seiner
Komplexität zu begreifen. Was je gelebt hat, ist darin enthalten und entfaltet
sich wieder zu neuer Blüte in einer in Schönheit dargereichten und aufgeho-
benen Seinszuversicht. Alles und jedes lebt und regt sich, ohne einander zu
fressen, ohne sich zu malträtieren oder sich zu bekriegen. (S. 167).
Während sie auf die Einlösung dieses Wunders wartet, sieht sie »Gestalten vorü-
berhuschen« (S. 44). Er sieht nichts, er »will es auch gar nicht« (S. 61), da er seinen
Sinnen misstraut. Gertrud hingegen kann sogar mit ihnen sprechen. Es sind Tote, die
schon länger da sind als die beiden Dialogpartner. Lewitscharoff verrät, dass Gertrud
diese Seelen sehen kann, weil sie schon näher am Purgatorium dran sei als der Philo-
sophieprofessor.19 Die Gesprächsbeiträge der Toten sind in Graudruck gehalten, wie
in Consummatus, und sind zudem kursiv hervorgehoben. Die universalen Verständi-
gungsmöglichkeiten des Pfingstwunders sind in leichter Variation in diesem Vorraum
des Jenseits Wirklichkeit geworden: »Hier spricht jeder in seiner Sprache und hört
die Stimmen der anderen auch in seiner Sprache, obwohl er früher kein Wort davon
verstanden hätte« (S. 100), sagt eine der umherschwirrenden Toten zu Gertrud. Unter
den Toten im Dazwischen sind jede Menge Berühmtheiten von Goethe bis zu Marilyn
Monroe. Ins Gespräch kommt Gertrud mit einer Gruppe von Autoren, wie Christine
Lavant, Samuel Beckett, Carson McCullers, Marie-Luise Fleißer und Raymond
Queneau. Bei dieser Autorengruppe handelt es sich um »bis auf einen lauter Leute,
deren Bücher« sie »ganz gut« (S. 189) kennt und liebt. Gertrud berichtet weiter: »Sie
warten alle auf die gnadenreiche Aufnahme und eine weitere Transformation der Exis-
tenz. Nicht im Sinne der Wiedergeburt, sondern eines völlig anderen, nie gekannten
Lebens, für das es kein Wort und keine exakte Beschreibung gibt« (S. 176). Allerdings
trifft sie in diesem Vorraum keine Seelen, die aus einem anderen Kulturkreis stammen.
Es scheint in Warten auf: Gericht und Erlösung – anders als im Pfingstwunder, wo
Jahrbuch für Internationale Germanistik, Jahrgang LIII – Heft 2 (2021) Peter LangSibylle Lewitscharoff, Heiko Michael Hartmann: Poetischer Streit im Jenseits | 215
Angehörige verschiedener Religionen in den Himmel auffahren – »eine strikte reli-
giöse Kohortentrennung« (S. 198) zu geben. Im Sinne des unnatürlichen Erzählens
kann diese Begegnung auch als Abbildung des – gläubigen und kulturell homogenen
– Innenlebens eines Protagonisten – in diesem Fall von Gertrud – gelesen werden.20
Jedoch wird insgesamt die Transkulturalität der Religionen aus dem Pfingst-
wunder in Warten auf: Gericht und Erlösung in das Christentum hinein verlegt. So
sagt der Philosophieprofessor:
Ich kenne so viele christliche Götter, welchen meinst du? Den aus dem zweiten,
den aus dem achten, den aus dem einundzwanzigsten Jahrhundert? Den christ-
lichen Gott der Stuttgart-Degerlocher oder einen aus Moskau, Tenessee, Af-
rika, Südamerika, China? Den christlichen Gott der Katholiken, Orthodoxen,
Lutheraner, Calvinisten, Methodisten, Mormonen oder einen der anderen über
zweitausend christlichen Konfessionen? (S. 91).
Diese innere Vielfalt des Christentums könnte man mit Wolfgang Welsch auch als in-
ternen Hybridcharakter der christlichen Kultur bezeichnen.21 Das Bewusstsein interner
Transkulturalität befähigt nach Welsch Individuen dazu, mit äußerer Transkulturalität
besser zurechtzukommen: »[S]ie werden in einer Begegnung mit ›Fremden‹ eher in
der Lage sein statt einer Haltung der Abwehr Praktiken der Kommunikation zu ent-
wickeln«.22 Zugleich wird zugestanden, dass »östliche Religionen, die den Körper,
seine Kräftigung und seine Bedeutung für unsere Gefühle weit stärker miteinbeziehen,
der christlichen den Rang« (S. 95) ablaufen. Insofern ist auch in diesem Buch eine
transkulturelle Dimension von Religion angelegt.
Der Philosophieprofessor aus Warten auf: Gericht und Erlösung sieht keinen
der anderen Geister, er sieht als einziges eine Aktentasche, was erstmal etwas absurd
anmutet. Es ist seine eigene. Er hätte nämlich in Nizza einen akademischen Vortrag
halten sollen, was durch den Flugzeugabsturz verhindert wurde. Dieser steckte in
seiner heißgeliebten Aktentasche und kommt in Bruchstücken, über das Buch ver-
teilt, auch tatsächlich vor. Der Vortrag befasst sich »aus religionsphilosophischer
Sicht […] mit existentieller Verunsicherung, Untergangsängsten und damit einherge-
hender politischer Radikalisierung« (S. 86). Dafür greift er auf Søren Kierkegaards
Verzweiflungsbegriff zurück. Entsprechend beginnt der Vortrag mit dem folgendem
Kierkegaard-Zitat: »Verzweiflung ist eine Krankheit im Geist, im Selbst, und kann so
ein Dreifaches sein: verzweifelt sich nicht bewußt sein, ein Selbst zu haben (uneigent-
liche Verzweiflung); verzweifelt nicht man selbst sein wollen, verzweifelt man selbst
sein wollen.« (S. 86).23 Infolgedessen fragt Lewitscharoffs Philosophieprofessor sich,
ob es diese Art der Verzweiflung sei, die sie beide nicht sterben lasse. Über ihn ist
festzustellen, dass er nicht mehr sein möchte und zugleich auch jemand besserer sein
will als der, der er ist. Insofern treffen auf ihn durchaus die zwei letzteren Formen des
Kierkegaardschen Verzweiflungsbegriffs zu. Das zeigt sich auch daran, dass er sich
von seinem Vortrag nicht lösen kann und sich vorstellt, dass wenn er ihn hätte halten
können, er ihn und die Wahrnehmung von ihm verändert hätte. So sagt er, alleine zu-
rückgelassen, gegen Ende des Totengesprächs: »Nicht einmal von dem Vortrag konnte
ich ihr erzählen. […] Wie hab ich dran gefeilt. Vor diesem internationalen Publikum,
Peter Lang Jahrbuch für Internationale Germanistik, Jahrgang LIII – Heft 2 (2021)216 | Sibylle Lewitscharoff, Heiko Michael Hartmann: Poetischer Streit im Jenseits
es wäre die Krönung gewesen ... […] Mensch Gertrud, wenigstens das Ende hätt‘ ich
dir gern noch vorgetragen.« (S. 206).
Auch im Dialog der beiden Figuren lassen sich Spuren von Kierkegaards Krank-
heit zum Tode (1849) finden. Ohne die beiden Dialogpartner eindeutig Kierkegaards
Religiosität A und Religiosität B zuzuordnen, entspricht der Philosophieprofessor
tendenziell der Religiosität A, da er versucht, »mit Hilfe des Geistes seinen eigenen
Grund zu bestimmen«24, auch wenn er seine Erkenntnisse häufig paradox formuliert.
Sein Denken kommt dabei an eine Grenze. Gertrud hingegen mit ihrem Glauben und
ihrer Hinwendung zum Anderen entspricht eher Religiosität B. Eine Vermittlung
zwischen beiden ist »epistemologisch versperrt«25 und entsprechend kommt es auch
zu keiner Einigung zwischen den Dialogpartnern.
In ihrer Befragung der Jenseitsräume räumt Gertrud ein, dass die Apokatastasis,
die Allversöhnung, nach der alle, auch die größten Verbrecher, in den Himmel dürfen,
für sie ein Problem darstellt: »Seit an Seit mit Völkermördern und Massenschlächtern
will ich nicht im himmlischen Gefild lustwandeln. Das wäre ein obszöner Alptraum.«
(S. 50). Der Philosophieprofessor aber kontert: »Aus welchem Loch strömt Ihnen diese
Kraft eines wütenden Racheengels zu? […] Die Allmacht Gottes preisen, ihm aber
das freie Gnadenrecht vorzuenthalten, erkennen Sie da keinen Widerspruch?« (S. 51).
Die Dialogpassage zeigt die Ambivalenz in der gegenwärtigen theologischen Debatte
auf, in der die Idee der Hölle weder verabschiedet noch an ihr festgehalten werden
kann.26
In diesem Zusammenhang wirft der Philosophieprofessor seiner Gesprächspart-
nerin zu starke prädikative Zuweisungen an Gott – »der gerechte Gott« (S. 59) – vor und
setzt dagegen die negative Theologie: »Es entstand dabei auch die sogenannte ›negative
Theologie‹, die sich aller prädikativen Aussagen über Gott enthält.« (S. 60). Wie es der
Philosophieprofessor beschreibt, erinnert die negative Theologie an den Vorbehalt,
unter dem jede Rede von Gott steht, da sich Gott notwendig und unvermeidlich allen
Versuchen begrifflichen Begreifens entziehe. Ihr Anliegen ist es, dass die Theologie
die Gott zugedachten Namen, Begriffe und Attribute um der Unverfügbarkeit und
Alterität Gottes willen immer wieder zurücknehmen muss.27 Entsprechend definiert
der Philosophieprofessor in Warten auf: Gericht und Erlösung die Menschen, wenn
sie sich Gott vorstellen, als »Metzger, die ihr Hackfleisch wieder zusammennähen
möchten« (S. 67).
In all diesen Debatten erfasst einen der Verdacht, dass das Jenseits dieser Figu-
ren letztlich die Literatur ist.28 Diese These lässt sich durch poetologische Textstellen
stützen, denn der Philosophieprofessor meint: »Dürfen wir noch jemandem erschei-
nen, dann bloß zerronnen wie Druckerschwärze auf Papier.« (S. 30). Das beschreibt
letztlich, was die beiden Figuren für ihre Leser materialiter sind. Zudem erklärt der
Philosophieprofessor, dass er sich vorkomme »wie die Erfindung eines Schriftstellers:
eine Person, die, von Anfang an tot, zum Leben desjenigen erwacht, der etwas über sie
liest.« (S. 84). Tatsächlich ist er eine Erfindung Lewitscharoffs und Hartmanns, der in
den Köpfen des Lesepublikums von Warten auf: Gericht und Erlösung lebendig wird.
Zwischen den monologischen und dialogischen Redeanteilen der Dialogpartner
sind in Schwarz-Weiß kleine fotografische Bilder des Mondes oder der Erde eingerückt.
Diese Unentscheidbarkeit und der planetare Dialog zwischen beiden ist zweifellos
Jahrbuch für Internationale Germanistik, Jahrgang LIII – Heft 2 (2021) Peter LangSibylle Lewitscharoff, Heiko Michael Hartmann: Poetischer Streit im Jenseits | 217
gewollt. Ohnehin spielt der Mond eine wichtige Rolle in Lewitscharoffs Werken –
zum Beispiel in Pong und in Von oben. In letzterem Roman weicht der sprachliche
Sinn im letzten Kapitel stellenweise graphischen Möndchen-Zeichen und trägt einen
symbolischen Mehrwert zur Frage bei, wie die himmlische Sphäre zwischen Erde und
Mond metaphysisch gestaltet ist.
Der Dialog endet damit, dass ein »Tödlein« (S. 203) kommt, sich als dasjenige
von Gertrud outet und sie mitnimmt.29 Wohin sie geführt wird, bleibt ebenso offen,
wie was aus dem Zurückbleibenden wird. Immerhin behält er das letzte Wort. Wenn
sie allerdings schon vorher dem Purgatorium näher war, wirkt es so, wie wenn sie
in der Abstufung der Jenseitsräume weiterkäme – wie der Titelheld am Ende von
Blumenberg – und der Philosophieprofessor dagegen steckenbliebe. Insofern wirkt
ihre Orientierung an und Liebe für die Kunst seiner Philosophie überlegen.
Das Buch von Lewitscharoff und Hartmann ist ein anspruchsvoller und unter-
haltsamer Beitrag zur Gegenwartsliteratur, der ein literarisches Jenseits entwirft und
in jener Schwebe hält, deren gegenwärtige Darstellungen des Wunderbaren bedürfen.
Isabelle Stauffer, Eichstätt
1 Zum Jenseits in der Gegenwartsliteratur vgl. Isabelle Stauffer (Hrsg.): Jenseitserzählungen
in der Gegenwartliteratur. Heidelberg 2018 und Leonhard Herrmann/Silke Horstkotte:
Gegenwartsliteratur. Eine Einführung. Stuttgart 2016, S. 155-157.
2 Vgl. Isabelle Stauffer: [Rezension zu] Thees Uhlmann: Sophia der Tod und ich. Roman.
In: Jahrbuch für Internationale Germanistik 50/2 (2018), S. 285-294.
3 Vgl. Verena O. Lobsien: Jenseitsästhetik: Literarische Räume, letzte Dinge. Berlin: Berlin
University Press 2012, S. 266-316; Isabelle Stauffer: Jenseits im Diesseits: Paradies und
Hölle in Thomas Lehrs ›Frühling‹ und Sibylle Lewitscharoffs ›Consummatus‹. In: Zeit-
schrift für Germanistik 25/3 (2015), S. 551-564; Julia Bertschik: In einer anderen Welt.
Poetik des Jenseits in Sibylle Lewitscharoffs Gelehrten-Roman ›Blumenberg‹ (2011). In:
»Sei wie du willt namenloses Jenseits«: Neue interdisziplinäre Ansätze zur Erforschung
des Unerklärlichen. Hrsg. von Christa Tuczay u.a. Wien 2016, S. 191-200; Isabelle Stauffer:
Antik und biblisch inspirierte Jenseitsräume bei Sibylle Lewitscharoff, Urs Widmer und
Michel Houellebecq. In: Jenseitserzählungen in der Gegenwartsliteratur. Hrsg. von dies.
Beiträge zur neueren Literaturgeschichte 387. Heidelberg 2018, S. 235-257 und Isabelle
Stauffer/Ulrich Rüdenauer: [Art.] Sibylle Lewitscharoff. In: Kritisches Lexikon zur
deutschsprachigen Gegenwartsliteratur. Grundwerk einschließlich der 126. Nachlieferung.
Hrsg. von Hermann Korte und Heinz Ludwig Arnold. Göttingen 2020, S. 1-22.
4 Rolf-Berhard Essig: Schussfahrt ins Grauen. Heiko Michael Hartmanns neuer Roman
›Schwarzes Ei‹. In: Zeit Online vom 08.02.2007, https://www.zeit.de/2007/07/L-Hartmann
[letzter Zugriff: 01.02.2021].
5 Essig (s. Anm. 4).
6 Essig (s. Anm. 4).
7 Sibylle Lewitscharoff: Das Pfingstwunder. Berlin 2016, S. 345.
8 Vgl. Essig (s. Anm. 4).
9 Vgl. Sibylle Lewitscharoff: Quasselstrippe trifft Widerborst: In: Deutschlandfunk Kultur
vom 31.10.2011, https://www.deutschlandfunkkultur.de/sibylle-lewitscharoff-ueber-dialo-
ge-im-jenseits.1270.de.html?dram:article_id=486721 [letzter Zugriff: 30.01.2021].
10 Herbert Jaumann: [Art.] Totengespräche. In: Reallexikon der deutschen Literaturwissen-
schaft. Hrsg. von Jan-Dirk Müller. Bd. 3. Berlin 2003, S. 652-655, hier S. 652-653; Gero
Peter Lang Jahrbuch für Internationale Germanistik, Jahrgang LIII – Heft 2 (2021)218 | Sibylle Lewitscharoff, Heiko Michael Hartmann: Poetischer Streit im Jenseits
von Wilpert: [Art.] Totengespräche. In: Sachwörterbuch der Literatur. Hrsg. von ders. 8.
Aufl. Stuttgart 2001, S. 838.
11 Vgl. Silke Horstkotte: Der Tod des Erzählers. Thomas Hettches ›Nox‹, Thomas Lehrs
›Frühling‹ und Georg Kleins ›Roman unserer Kindheit‹. In: Jenseitserzählungen in der
Gegenwartliteratur. Hrsg. von Isabelle Stauffer. Heidelberg 2018, S. 61-97, hier S. 64.
12 Vgl. Jan Alber: Unnatural Spaces and Narrative Worlds. In: A poetics of unnatural nar
rative. Hrsg. von ders. u. a. Columbus 2013, S. 45-66, hier S. 47 und Jan Alber: Unnatural
Narrative. In: The living handbook of narratology. Hrsg. von Peter Hühn u.a. Hamburg,
Abs. 1-21, hier Abs. 1, https://www.lhn.uni-hamburg.de/node/104.html [letzter Zugriff:
03.02.2021].
13 Lewitscharoff (s. Anm. 9).
14 Dies gibt Lewitscharoff im Interview auch unumwunden zu: »[D]as hat mir Spaß gemacht,
ihn auf unsauberes Terrain zu entführen, da will er eigentlich nicht so richtig hin.« Lewit-
scharoff (s. Anm. 9).
15 Lewitscharoff (s. Anm. 9).
16 Vgl. Stauffer (s. Anm. 1), S. 23.
17 Vgl. Lobsien (s. Anm. 3), S. 408-409.
18 Alber (s. Anm. 12), S. 49.
19 Vgl. Lewitscharoff (s. Anm. 9).
20 Vgl. Alber (s. Anm. 12), S. 48.
21 Vgl. Wolfgang Welsch: Was ist eigentlich Transkulturalität? In: Kulturen in Bewegung.
Beiträge zur Theorie und Praxis der Transkulturalität. Hrsg. von Dorothee Kimmich und
Schamma Schahadat. Bielefeld 2012, S. 25-40, hier S. 28.
22 Vgl. Welsch (s. Anm. 21), S. 32.
23 Søren Kierkegaard: Gesammelte Werke. Hrsg. von Erich Hirsch und Hayo Gerdes.
Bd. 24/25, Gütersloh 1985, S. 8.
24 Klaus Viertbauer: Kierkegaards Menschenbild. Wie lässt sich der Subjektgedanken exis-
tenzialisieren? In: Salzburger Jahrbuch für Philosophie LXII (2017), S. 49-68, hier S. 63.
25 Viertbauer (s. Anm. 24), S. 64.
26 Zu dieser Debatte vgl. Herbert Haag: Abschied vom Teufel. Vom christlichen Umgang mit
dem Bösen. 9. Aufl. Zürich 1996; Hans Urs von Balthasar: Kleiner Diskurs über die Hölle
– Apokatastasis. Neuausg. d. 3. Aufl. (= Neue Kriterien Bd. 1). Einsiedeln 1999; Magnus
Striet: Streitfall Apokatastasis. Dogmatische Anmerkungen mit einem ökumenischen
Seitenblick. In: ThQ 184 (2004), S. 185–201; Michael N. Ebertz: Die Zivilisierung Gottes.
Der Wandel der Jenseitsvorstellungen in Theologie und Verkündigung. (= Zeitzeichen
14). Ostfildern 2004; Ottmar Fuchs: Das Jüngste Gericht. Hoffnung auf Gerechtigkeit.
Regensburg: 2007 sowie als Übersicht: Markus Schulze: Ist die Hölle menschenmöglich?
Das Problem der negativen Endgültigkeit in der deutschsprachigen katholischen Theologie
der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts. Freiburg im Breisgau 2008.
27 Vgl. Andreas Benk: [Art.] Negative Theologie. In: WiReLex, Das Wissenschaftlich-Re-
ligionspädagogische Lexikon im Internet, https://www.bibelwissenschaft.de/wirelex/
das-wissenschaftlich-religionspaedagogische-lexikon/wirelex/sachwort/anzeigen/de-
tails/negative-theologie/ch/d659879ca0455d41ae36af04ae857fc4/#h2 [letzter Zugriff:
01.02.2021]. Grundlegendes zur negativen Theologie vgl. auch Andreas Benk: Gott ist nicht
gut und nicht gerecht. Zum Gottesbild der Gegenwart. 2. Aufl. Ostfildern 2012; Thomas
Rentsch: Negative Theologie, Transzendenz und Existenz Gottes. In: Letztbegründungen
und Gott. Hrsg. von Edmund Runggaldier und Benedikt Schick. Berlin/New York 2011,
S. 115-133; Jacques Derrida: Wie wir nicht sprechen. Verneinungen. Wien 1989; Hans Urs
von Balthasar: Bibel und negative Theologie. In: Sein und Nichts in der abendländischen
Mystik. Hrsg. von Walter Strolz. Freiburg im Breisgau 1984, S. 13-31.
Jahrbuch für Internationale Germanistik, Jahrgang LIII – Heft 2 (2021) Peter LangSie können auch lesen