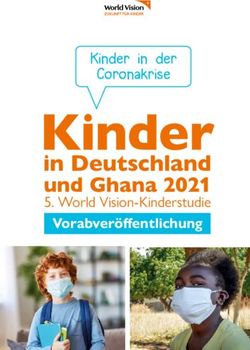Klöster als Bildungszentren. Von den (Elite-)Schulen des Frühmittelalters zur Universität
←
→
Transkription von Seiteninhalten
Wenn Ihr Browser die Seite nicht korrekt rendert, bitte, lesen Sie den Inhalt der Seite unten
1
Maria E. Dorninger
Klöster als Bildungszentren. Von den (Elite-)Schulen des Frühmittelalters
zur Universität
I. Einleitung
Spricht man gegenwärtig von Orden, wie Herz Jesu Missionaren, Kreuzschwestern,
Ursulinen, Jesuiten, Benediktinern oder etwa Augustiner Schulschwestern, so werden diese
mit der Tätigkeit des Unterrichtens assoziiert. Doch nicht nur Ordensgemeinschaften
allgemein, sondern auch ganz konkrete Orte, die mit ihnen verbunden sind, nämlich Klöster,
stehen für und gelten noch immer als Garanten für eine gute schulische Ausbildung. Bekannt
dafür sind, beispielsweise im Österreichischen, die Klöster der Benediktiner von
Kremsmünster, Admont und Seitenstetten oder das der Zisterzienser von Schlierbach.1 Die
Liste lässt sich beliebig fortsetzen. Die Bedeutung der Klöster, nicht der Kathedralschulen
oder Stadtschulen, in der Bildungslandschaft des mittelalterlichen (Mittel-)Europas soll hier
vor allem im Zentrum stehen. Dabei werden sich Berührungspunkte zu den Darstellungen von
Heinz Dopsch oder Christian Rohr ergeben.2
Ausgehend von der bereits sich in den Anfängen des Mönchstums abzeichnenden
Bedeutung der Mönche für Literatur und Bildung und dem Stellenwert der artes liberales,
wird ein besonderer Schwerpunkt auf die Bildungsreform Karls des Großen gelegt, die
wegweisend für die europäische Bildung sein sollte und wichtige Anstöße für die
Verschriftlichung der Volkssprachen gab. Daran anschließend werden einige mönchische
Gelehrte hervorgehoben, die den hohen Bildungs- und Wissenschaftsstandard der Klöster
repräsentieren. Diese gelehrten Mönche wurden ausgebildet und wirkten wiederum an
Klöstern, wie z.B. Fulda, die als Eliteklöster bzw. hohe Schulen fungierten. Den Abschluss
der Erörterungen bildet der Übergang der höheren Studien auf die entstehenden Universitäten,
wobei die Klöster weiterhin Buchproduktion und wissenschaftliche Tätigkeit, letztere jedoch
mehr in stiller Auseinandersetzung, pflegten.
II. Mönche als Bewahrer der antiken Literatur und Bildung. Die Artes liberales.
Schottisches Mönchtum auf dem Kontinent
II.1. Mönche als Bewahrer der antiken Literatur und Bildung
Wie noch heute erkennbar, nahmen Klöster im Bildungswesen und in der Kultur des
Abendlandes immer eine besondere und lange Zeit sehr zentrale Stellung ein.
Das junge Christentum war wie das Judentum, aus dem es stammt, eine Religion der
Offenbarung und des Buches. Für die Verkündigung war die Schriftüberlieferung zentral, für
die das Mönchtum im Mittelalter eine große Rolle spielte, dem – gerade in der schweren Zeit2
der Völkerwanderung – die Tradierung der römischen Schriftkultur wesentlich zu verdanken
ist.
Die Anfänge des Mönchtums liegen im Orient, doch bald hatte sich ebenso im
Abendland ein Mönchtum entwickelt. Schon im 2. Jh. ist der Begriff monachus belegt, der
eigentlich „allein lebend“ bedeutet, doch meint er erst ab dem 4. Jh. einen bestimmten Stand.3
Wichtig für die Ausbreitung des Mönchtums im Westen wurde jedoch im 4 Jh. die Vita
Antonii des Athanasius.4 Um den Eremiten Antonius († 356) hatte sich, als er westlich des
Roten Meeres lebte, eine Mönchskolonie gebildet. Eben seit diesem Jahrhundert fand auch im
Westen der Übergang zum Coenobitentum, einem Leben in der Gemeinschaft (vita
communis) des Klosters statt. Besondere Bedeutung hatte dafür die Mönchsregel des
ägyptischen Eremiten Pachomios († 346). Dieser, zuerst als Eremit lebend, fühlte sich
jedoch zu einer anderen Lebensform berufen und gründete im 1. Viertel des 4. Jh.s das
Kloster Tabennisi. Zuletzt leitete er elf Klöster (darunter zwei Frauenklöster) als eine Art
Generaloberer. Unter seinen Schriften befindet sich eine wohl ursprünglich koptisch verfasste
Regel, die der Kirchenvater Hieronymus ins Lateinische übersetzte und die großen Einfluss
auf die Entwicklung des westlichen Mönchtums hatte.5 Sie enthält gleichfalls Anweisungen,
wie mit Büchern umzugehen sei.6 Auf diese Regel stützte sich auch Benedikt von Nursia,
als er eine Eremitengemeinschaft in die vita communis führte. Nach Intrigen in seiner
Gemeinschaft in Subiaco ließ er sich mit einigen Mönchen auf dem Berg über Casinum
zwischen Rom und Neapel nieder, wo die kleine Gemeinschaft regen Zulauf fand, bedingt
durch den Ruf und die große Anziehungskraft der Persönlichkeit Benedikts, möglicherweise
zum Teil auch gefördert durch die immer neu gegebene Bedrohung durchziehender Haufen in
dieser Zeit der Völkerbewegungen. Die Gründung dieses für die Mönchsgeschichte des
Abendlandes bedeutendsten Klosters, Montecassino, wird um 529 angesetzt. Für diese nun
schon große Gemeinschaft verfasste Benedikt seine Regel.7 Der Eigenbedarf an Büchern für
Liturgie und Meditation (dazu gehörte die lectio divina, die geistliche Lesung) war der Anlass
für die Förderung des Buchwesens. Für die Pflege der Bildung in den Klöstern war jedoch
Cassiodor von noch größerer Bedeutung. Wahrscheinlich von syrischer Abstammung und
im hohen Staatsdienst bei König Theoderich, hatte er schon früher den Plan, eine christliche
Schule in Rom zu gründen. Ihm selbst war der Bedarf an öffentlichen Lehrern der heiligen
Schrift deutlich geworden. Im Alter zog er sich zurück und gründete das Kloster Vivarium, in
Süditalien, Kalabrien, auf seinen eigenen Ländereien. An die Mönche hatte er ganz konkrete
Anforderungen, die er vor allem in seinen Werken den „Institutiones divinarum et
humanarum artium“ und der Schrift „De orthographia“, darlegt. In „De orthographia“ werden
die Mönche in das Abschreiben von Manuskripten eingeführt. Die zwei Bücher
„Institutiones“ (zw. 551 und 562) mit enzyklopädischem Charakter können dagegen als eine
Art Kompendium der Bibelwissenschaft gelten und geben eine Anleitung zum
Schriftstudium, wobei auch Bibel-Kommentare erwähnt werden. Ebenso findet sich darin eine
Einführung zu den artes liberales, die für das Christentum nutzbar gemacht werden sollen.
Cassiodors Darstellungen dazu wurden für bedeutende Autoren und Gelehrte des Mittelalters,
wie Alkuin oder Hrabanus Maurus, maßgeblich. Bei Cassiodor finden sich jedoch neben der
Wertschätzung der antiken Literatur und Literaturverweisen – auch im Sinne einer3
wissenschaftlichen Propädeutik – 8 ebenso Hinweise zur Lektüre für praktische Studien, wie
für Gartenbau und Medizin. Cassiodor selbst zeigt sich von Augustinus und Boethius
beeinflusst. Christliche Bildung äußert sich bei ihm gewissermaßen als Synthese antiker
Traditionen und theologischer Studien.9 Seine Autor-Erwähnungen waren richtungsweisend
für die Zusammenstellung der berühmten Bibliothek von Vivarium. Die Anordnung des
Stoffes wiederum wirkte auf die mittelalterlichen Schullehrpläne ein, wie in den diversen
Klosterbibliotheken und Skriptorien erkennbar ist.10
II. 2. Die Artes liberales
Ähnlich positiv dem antiken Bildungsgut gegenüber eingestellt, zeigte sich Isidor
von Sevilla († 636), der mit seiner Enzyklopädie, den „Etymologiae“ auch das Bildungsgut
und Wissen der Antike zu bewahren suchte.11 Dieses Werk fand im Mittelalter, besonders zur
Zeit der Karolinger – doch auch noch danach – weiteste Verbreitung im Schulunterricht und
war Anregung für zahlreiche Gelehrter, so für Beda Venerabilis oder Hrabanus Maurus, die
sich darauf stützten. Es wurde, wie Brigitte Englisch formuliert, geradezu zum „Handbuch“
der artes liberales. Der Stellenwert Isidors in der mittelalterlichen Literatur und
Bildungsgeschichte wird deutlich, wenn man bedenkt, dass es bereits in der 1. Hälfte des 9.
Jh.s zu einer Vorstufe einer Gesamtausgabe der Werke Isidors kam.12
In den XX Büchern der „Etymologiae“ behandelt Isidor die artes liberales, die er in
den ersten drei Büchern ausführt, wobei die Grammatik einen besonderen Schwerpunkt
bildet. Dann folgen Medizin und Recht, theologische Themen, z.B. Gott, Engel, Märtyrer,
Propheten, Stände der Kirche, wie Kleriker und Mönche, und häretische Sekten. Er geht auf
Sprach-, Völker- und Gesellschaftsgruppen, doch ebenso auf naturwissenschaftliche und
praktisch orientierte Themen ein, beispielsweise auf Zoologie, Kosmologie, Geographie,
Städte und Gebäude der Menschen, Steine und Metalle, Landwirtschaft, Kriegswesen,
Handwerke, Ernährungswesen und Haushaltsgegenstände.13
Insgesamt ist eine Reihen- und Rangfolge – sacra vor mundalia – zu beachten.
Charakteristisch für Isidor ist sein methodisches Vorgehen. Gemäß dem Titel seiner
Enzyklopädie geht er von den Wörtern aus, erläutert diese mit den grammatischen Kategorien
der Analogie, der Etymologie, der Glosse oder der Differenz und gelangt von da zur
eigentlichen Sache.14
So erläutert Isidor die Grammatik in Etymologiae I,V,1 als scientia recte loquendi et
origo et fundamentum liberalium litterarum, als Wissenschaft des rechten Sprechens und
Ursprung wie Fundament der artes liberales. Die Bezeichnung „grammatica“ führt er wie
Cassiodor zurück auf das griechische Wort grámmata, eigentlich ein Plural, der die
Buchstaben bzw. die Wissenschaften bedeutet. Im Weiteren folgen einzelne Themenbereiche,
durch die diese Disziplin erschlossen wird. Als grundlegend für die Grammatik sieht Isidor
von Sevilla sowohl Bereiche, die nach heutigem Verständnis als Teile der Sprachwissenschaft
bzw. auch im engeren Sinne zur Grammatik gerechnet würden, doch auch andere, die nun
eher zur Rhetorik oder allgemein zur Literaturwissenschaft gehörig erscheinen. Isidor4
behandelt im Grammatikteil u.a. die Wortarten, die einzelnen Buchstaben, die Silben, Metrik,
Orthographie, Methoden der Analogie und Etymologie, der Differenz, Erscheinungen wie
Barbarismus, Redefiguren, allgemein Prosa versus metrische Dichtung oder grundsätzliche
Unterschiede literarischer Gattungen wie Fabula und Historia und zu vermeidende Fehler. Als
prominenten Vertreter für diese ars nennt er den Grammatiker Aelius Donatus aus dem 4. Jh.
In ähnlicher Manier werden in den zwei folgenden Büchern der „Etymologiae“ die
anderen Disziplinen der artes behandelt, wobei, wie bei Cassiodor, die vier Disziplinen des
Quadriviums auch unter dem Oberbegriff der Mathematik gefasst werden können.
Die Rhetorik (Etym. II,1-21) definiert Isidor traditionell als „ars bene dicendi“ mit
dem ethischen Anspruch, mit Hilfe ihrer Anwendung vom Guten und Rechten zu überzeugen
bzw. dazu zu überreden. Als Vertreter und Begründer der Rhetorik gelten Isidor u.a. die
Griechen Georgias (5./4. Jh.v.Chr.) und Aristoteles (4. Jh.v.Chr.) oder die Römer Cicero (2./1.
Jh.v.Chr.) und Quintilian (1. Jh.n.Chr.). Einzelne Kapitel des Rhetorikabschnittes erörtern
diverse Bereiche, wie etwa die Genera der Rede oder rhetorische Syllogismen.
Die Dialektik (Etym. II,22-31) wird als Logik definiert und damit als Unterdisziplin
der Philosophie gesehen, die wiederum der Erkenntnis göttlicher und menschlicher Dinge
dient. Für die Philosophie stehen Gelehrte wie Thales von Milet (7./6. Jh.v.Chr.), Plato,
Sokrates (beide 5./4. Jh.v.Chr.) oder Aristoteles (4. Jh.v.Chr.).
Die Arithmetik (Etym. III,1-8) als deren Begründer die Griechen gelten, namentlich
Pythagoras (6. Jh.v.Chr.) und Nikomachos (2. Jh.n.Chr.), dann auch die Römer Apuleius (2.
Jh.n.Chr.) und Boethius (5./6. Jh.n.Chr.),15 ist die Wissenschaft von den Zahlen, von ihren
Eigenschaften und ihren Relationen, Funktionen und Klassifikationen. In diesem
Zusammenhang werden u.a. die geraden und ungeraden Zahlen behandelt.
Die Geometrie (Etym. III, 8-14), deren Name sich von der Erdmessung ableitet,
beschäftigt sich dagegen mit Größen und Formen, d.h. mit den Ebenen, den numerischen und
rationalen Größen außerdem mit den körperlichen Figuren. Die Ursprünge dieser
Wissenschaft liegen nach Isidor in Ägypten. Als ihr bedeutendster Vertreter gilt dem
Mittelalter der griechische Mathematiker Euklid von Alexandrien im 4. Jh.v.Chr., den Isidor
im Gegensatz zu Cassiodor jedoch nicht anführt.
Die Musik (Etym. III, 15-23), deren Bezeichnung sich von den Musen ableitet und
die Isidor als peritia modulationis sono cantuque consistens definiert, besteht aus drei Teilen:
Harmonie, die tiefe und hohe Töne unterscheidet, Rhythmik und Metrik. Die drei Formen der
Musik, harmonica, organica und rhythmica, jedoch beziehen sich auf die Instrumentenlehre.
Harmonica berücksichtigt den melodischen Gebrauch oder Gesang der Stimme, wie er bei
Schauspielern oder überhaupt jedem, der die eigene Stimme verwendet, zu finden ist, und den
Zusammenklang mehrerer Töne. Organica und rhythmica dagegen behandeln Instrumente,
deren Töne durch den Hauch des Mundes, durch Blasen, oder durch das rhythmische
Schlagen der Finger bewirkt werden. Zu diesen Blasinstrumenten gehören beispielsweise
Flöte und Trompete, zu den Schlaginstrumenten Kithara wie ebenso Glocken und Klapper.
Als Vertreter der Musik gilt neben dem biblischen Tubal16 u.a. auch der Grieche Pythagoras.
Bei der Astronomie (Etym. III,24-71), die die Wissenschaft von den
Himmelskörpern und den ihnen innewohnenden Gesetzen umfasst, vergisst Isidor nicht als5
Teilbereich die Astrologie zu erwähnen, die er jedoch zum Teil, wenn es um Weissagungen
aus den Sternen geht, etwa um Horoskope bzw. dem Einfluss der Gestirne auf den
menschlichen Charakter, auch dem Aberglauben zurechnet. Der herausragende Vertreter
dieser Wissenschaft ist Ptolemäus, König von Alexandrien.17
Besonders großen Einfluss auf die Rezeption der artes liberales hatte jedoch die
allegorisch-enzyklopädische Schrift von Martianus Capella, „De nuptiis Philologiae et
Mercurii“, die Hochzeit Merkurs mit der Philologie, die ebenso Cassiodor bekannt war und
spätplatonischen Einfluss zeigt. Von Martianus Capella, dessen Lektüre von Cassiodor
empfohlen worden war, ist nicht viel bekannt. Er selbst nennt sich Felix Capella und sagt von
sich, er sei ein Anwalt. Bereits um 500 wird das Werk zum ersten Mal erwähnt, das auch
Gregor von Tours im 6. Jh. kannte und das vor allem ab dem 9. Jh. eine sehr reiche
Verbreitung fand, u.a. wurde das Werk von Johannes Scotus Eriugena im 9. Jh. kommentiert
und die ersten beiden Bücher im 10. Jh. ins Althochdeutsche von Notker Labeo, dem
Deutschen, übersetzt, der ein Lehrer der artes liberales und der Theologie an der St. Galler
Klosterschule war.18 Das Werk genoss noch in der frühen Neuzeit eine hohe Einschätzung.
Ausschlaggebend für den Erfolg waren vermutlich die Präsentation, die auch
Unterhaltungswert hatte, wie ebenso die dargebotene, klare Systematik der artes liberales.
Die „Hochzeit der Philologie“ gliedert sich in IX Bücher, in denen Prosa und Vers vermischt
sind. Eine mythologische Rahmenhandlung umfasst dabei die eigentliche Abhandlung, die der
Darstellung der sieben freien Künste dient. Merkur, dem Gott der Beredsamkeit, wird als Braut das
Mädchen Philologia empfohlen, was im Sinne Martians ein anderer Name für disciplina ist, dem
wissenschaftlichen, geordneten Streben nach Weisheit. Beide lieben sich, doch sie berechnen zuerst
ihre Namen und stellen fest, dass die ihnen zugrunde liegenden Zahlen Vollkommenheit bringen. Die
Ehe ist also vollkommen (3+4=7), denn die Sieben bedeutet bzw. ist der Pallas, der Weisheit, heilig.
Philologia erhält von Merkur die septem artes als Dienerinnen und Brautgabe geschenkt. Diese
eröffnen ihr Wissen und werden als Künste präsentiert, die zudem der Beschäftigung mit dem
Himmlischen dienen.
Bei der Darstellung erlaubt sich Martianus auch eigene Bemerkungen, so spielt er, z.B.
auf die Langeweile bei der Beschäftigung mit dem Quadrivium, an.
Die Allegorisierung der sieben freien Künste und ihre Beziehung auf Überirdisches
erleichterte überdies ihre Eingliederung in christliche Bildungskonzepte.19
Eine Weiterentwicklung dieser Allegorisierung kann im „Anticlaudianus“, einer
Dichtung in Hexametern, von Alanus ab Insulis (Lille) im 12. Jh. gesehen werden, die
Motive der „Psychomachia“ des Dichters Prudenz (4./5. Jh.) aufgreift. Alanus selbst hatte in
Chartres studiert und lehrte in Paris, später auch in Montpellier die septem artes liberales und
Theologie.20
Im „Anticlaudianus“ beruft Natura eine Versammlung der Tugenden ein, da sie einen
vollkommenen Menschen erschaffen will. Dieser soll in der Welt herrschen und ein Goldenes Zeitalter
anbrechen lassen. Prudentia geht nun auf Reise, um von Gott eine Seele für diesen geplanten idealen
Menschen zu erbitten. Die Pferde, die ihren Wagen ziehen, sind die fünf Sinne, die sieben freien
Künste jedoch haben den Wagen für sie gebaut. Die Grammatik baut die Deichsel, die Logik fertigt
die Achse für den Wagen der Klugheit an, die Rhetorik schmückt die Deichsel mit Edelsteinen und
Silber und meißelt Blumen in die Achse, die Arithmetik, Geometrie, Musik und Astronomie
verfertigen jeweils ein Rad des Wagens und die Eintracht fügt zuletzt alle Teile zusammen. (Diese6
Handlungsfolge dient vor allem der Schilderung der Tätigkeiten und Lehrbücher der artes liberales.)
Doch gelingt es nicht ohne Hilfe der allegorisierten Theologie zu Gott vorzudringen, der gerne die
Seele gibt. Prudentia kehrt wieder zurück. Auf der Erde wird nun der Körper für einen puer senex
21
geschaffen, der sich im Kampf gegen die auf ihn einstürmenden Laster erfolgreich bewährt.
Die artes,22 ihre Beschreibungen und Ausgestaltungen wie ebenso Anspielungen auf
sie fanden überdies Eingang in die Vulgärsprachen und daher auch in die mittelhochdeutsche
Literatur, so etwa im 12. Jh. bei Hartmann von Aue23 oder im 13. Jh. bei Thomasin von
Zerklaere, der auf die artes etwas ausführlicher eingeht und sie im „Welschen Gast“, einer
höfischen Verhaltens- und Morallehre, bespricht und empfiehlt.24 Auch Hugo von Trimberg
fand sich im „Renner“ veranlasst, zumindest auf die Grammatik als Mutter der artes und
Amme der Schüler einzugehen, die die Liebe Gottes entzündet.25 Die Tradition des
„Anticlaudian“, in dem die artes liberales den Wagen für Prudentia bauen, wird jedoch
besonders deutlich von Heinrich von Neustadt im 14. Jh. aufgegriffen, der sich auf
Alanus selbst beruft, als Quelle jedoch vor allem die Prosaversion des „Compendium
Anticlaudiani“ benutzt. In der gerafften Darstellung Heinrichs von Neustadt wird wie im
„Compendium“ die Schöpfung des neuen, vollkommenen Menschen auf die Menschwerdung
Christi gedeutet.26
Exkurs: Beispiele bildlicher Darstellungen der Artes liberales
Schon früh gab es Darstellungen der artes liberales wie eine Abbildung im „Hortus
deliciarum“ der Äbtissin von Hohenburg, Herrad von Landsberg, zeigt, die eine Zeitgenossin der
berühmten, im 12. Jh. lebenden Hildegard von Bingen war.27
Im Innern von zwei konzentrischen Kreisen thront die Philosophie. Sie trägt eine Krone mit
drei Köpfen, die an die Trinität gemahnen und nach Plato die Ethik, Logik und Physik darstellen. Die
beiden Spruchbänder: „Omnis sapientia a Domino deo est/ Alle Weisheit kommt von Gott dem Herrn“
und „Soli quod desiderant facere possunt sapientes/ Allein die Weisen können tun, was sie begehren“
weisen auf die Verbindung der Philosophie zur göttlichen Theologie. Unter der Philosophie sitzen in
Schreibhaltung an einem Pult zwei ihrer Vertreter, Sokrates und Platon. Aus der Brust der Philosophie
entspringen sieben Quellen, die die Fächer des Trivium und Quadrivium repräsentieren, die im
äußeren Kreis mit ihren Attributen dargestellt werden:
Buch und [Zucht-]Rute sind Zeichen der Grammatik; Tafel und Stift präsentiert die Rhetorik.
Die Dialektik hält in einer Hand einen bellenden Hundekopf, der die wie ein Hundebellen rasch
aufeinander folgenden Argumente symbolisiert. Die Arithmetik führt als ihr charakteristisches Attribut
eine Zählschnur mit sich, während sich die Geometrie mit einem Zirkel befasst. Mit diversen
Instrumenten (z.B. Kithara [Harfe]) zeigt sich die Musik und die Astronomie, die in der Linken ein
Spiegelgerät parat hält, weist mit der Rechten auf die Sterne. Außerhalb der Kreise im unteren
Bildfeld befinden sich vier Dichter oder „magi“ ohne Namen. Sie werden räumlich entfernt von der
göttlichen Inspiration dargestellt, mit der die artes liberales verbunden werden können. Schwarze
Vögel raunen diesen „magi“ ins Ohr und geben deutlich ein Gegenbild zu mittelalterlichen
Darstellung der göttlichen Inspiration, die durch die Inspiration mittels einer Taube, Sinnbild des hl.
Geistes, sichtbar gemacht wird.
Gewisse Ähnlichkeiten, doch auch Unterschiede zu Alanus von Lille zeigen die Illustrationen
einer Handschrift aus dem 2. Viertel des 15. Jh.s der Universitätsbibliothek-Salzburg, M III
36, die auch Motive aus dem „Compendium Anticlaudiani“ aufgreift. Sie zeigt auf den Folien 239v-
243r die allegorisierten artes liberales, die hier mit dem Wagenmotiv verbunden sind, das sich bei
Alanus findet.28 Den Allegorien der Artes, die gemeinsam einen Wagen bauen, ist jeweils ein Vertreter
zugeordnet. In zwei übereinander angeordneten Kreisen bzw. Medaillons werden auf einem Blatt7
immer eine ars oben und ihr Vertreter im unteren Medaillon dargestellt und kleine Erläuterungen wie
auch Sentenzen oder Merkverse beigegeben.
Fol. 239v Die GRAMMATIK fällt die Bäume, um das Holz für den Wagen zu gewinnen. Im Medaillon
darunter ist ihr als ihr Vertreter der antike Grammatiker PRISCIAN zugeordnet.29
(http://www.ubs.sbg.ac.at/sosa/handschriften/MIII36(4v).jpg)
Fol. 240r: Die RHETORIK, deren Repräsentant Marcus Tullius CICERO ist, schlägt das Holz für den
Wagen zurecht. (http://www.ubs.sbg.ac.at/sosa/handschriften/MIII36(5r).jpg)
Fol. 240v: Auch die LOGIK, die Wahres und Falsches erkennen kann, trägt zum Wagenbau bei. Ihr
Vertreter ist ARISTOTELES. (http://www.ubs.sbg.ac.at/sosa/handschriften/MIII36(5v).jpg)
Die vier Disziplinen des Quadriviums beschäftigen sich mit den Rädern und fertigen diese an.
Fol. 241r: Die ARITHMETIK behandelt die Zahlenwerte. Sie misst mit dem Messstab ein Rad ab,
während das Medaillon darunter den Gelehrten BOETHIUS zeigt.
(http://www.ubs.sbg.ac.at/sosa/handschriften/MIII36(6r).jpg)
Fol. 241v: Die GEOMETRIE, die sich mit den Figuren und Gestalten beschäftigt, vermisst mit dem
Zirkel ein Rad. Im Medaillon unter ihr lehrt der griechische Mathematiker EUKLID.
(http://www.ubs.sbg.ac.at/sosa/handschriften/MIII36(6v).jpg)
Fol. 241r: Die MUSIK verfertigt ein weiteres Rad. Sie hat Glöckchen; Zeichen für die Musiktheorie,
darauf geschlagen und bringt diese nun mit einem Hammer zum Erklingen. Ihr ist Pythagoras
zugeordnet. (http://www.ubs.sbg.ac.at/sosa/handschriften/MIII36(7r).jpg)
Fol. 242v: Die ASTRONOMIE baut das letzte Rad und hat darin Sterne befestigt. Mit einem
astronomischen Messgerät weist sie darauf, während König Ptolemäus im Medaillon darunter
dargestellt ist. (http://www.ubs.sbg.ac.at/sosa/handschriften/MIII36(7v).jpg)
Fol. 243r: Zuletzt ist der Wagen fertig. Die Allegorien des Triviums haben sich in die Seile, die an der
Deichsel befestigt sind, gespannt und ziehen den Wagen, während die Allegorien des Quadriviums die
Räder in Bewegung setzen oder in die Speichen greifen. So kommt der Wagen gut voran. Bei der
Geometrie ist dem Illustrator ein kleines Missgeschick passiert. Er hat sie fälschlich zuerst als
„Gramatica“ vermerkt und musste diese unrichtige Angabe wieder korrigieren. Petrus Lombardus (der
im 12. Jh. an der Kathedralschule Notre Dame lehrte.30) feuert das Gefährt mit einer Geißel, eigentlich
hier ein Symbol für die Zuchtrute als Zeichen seines Lehrerstatus, an. Über ihm wird seine „Summa
sententiarum“, das theologische Schulbuch auch für die nachfolgenden Jahrhunderte, erwähnt. Im
Wagen selbst sitzt die gekrönte heilige Theologie, der alles dient. In der einen Hand hält sie einen
Christuskopf mit Nimbus, vielleicht ein Symbol für eine Hostie, und weist mit der anderen Hand
darauf; so zeigt sie ihre Beziehung zum Göttlichen. Der Wagen selbst fährt in die Höhe, Richtung
Gott, wie die Fahrtrichtung des Wagens und der Blick der Grammatik zeigen.
(http://www.ubs.sbg.ac.at/sosa/handschriften/MIII36(8r).jpg)
II. 3. Das Kloster als Bildungszentrum. Die Bedeutung der iroschottischen
Mission und der angelsächsischen Bildungsstätten
Die Bedeutung der Klöster, die zum Bewahrungs- und Tradierungsort des christlichen
und antiken kulturellen Erbes wurden, kann im Westen nicht hoch genug eingeschätzt
werden. Noch im „Codex Theodosianus“ wurden Lehrer als Staatsbeamte eingeschätzt. Doch
verloren die Grammatik- und Rhetorikschulen, die die Völkerwanderung überdauerten, den
öffentlichen Charakter und verschwanden. Ein Grund dafür waren, so Laetitia Böhm, die
germanischen Herrscher (die Westgoten ausgenommen), die es verabsäumten, die antike
Bildungsgesetzgebung fortzusetzen,31 jedoch fühlte sich die christliche Kirche durch die
Anforderungen der religiösen Verkündigung und Lehre immer wieder dem Bildungsauftrag
verbunden.
In der Bildungsgeschichte kann eine Wende im 6. Jh. gesehen werden, für die auch
Papst Gregor der Große repräsentativ ist. Die römische Kirche begann sich zu dieser Zeit8
immer mehr von Ostrom zu lösen. Analog zu diesem Vorgang wuchs eine eigenständige
Missionierung. In Verbindung damit verlagerte sich die Bildungs- und Erziehungsarbeit von
der Vermittlung altrömischer Kultur immer mehr auf die Liturgie und das sakramentale
Leben. Papst Gregor selbst trat für eine Abgrenzung der weltlichen gegenüber der kirchlichen
Bildung ein, die in gewissem Sinne zu einer Zweigleisigkeit des Bildungswesens führte.32
Nicht eindeutig beantwortet ist die Frage nach einem Schulwesen vor der Karolingerzeit. In
historiographischem Schrifttum, doch ebenso in Heiligenviten finden sich einige Hinweise
dafür. So wurden beim Eintritt in ein Kloster oder auch in den Kirchendienst gewisse
Grundkenntnisse vorausgesetzt, die möglicherweise an einem Hof oder vielleicht in der
Familie erworben wurden.33
Die Sorge der Kirche um die Ausbildung des Nachwuchses führte jedoch zu neuen
Unterrichtsformen, wobei als Vorbilder die Priestergemeinschaften dienten, die Bischof
Eusebius von Vercelli wie auch Augustinus von Hippo eingeführt hatten. Wiederum geht es
hier um eine vita communis.34 So legte das Konzil von Vaison 529 fest, Presbyter sollten
Nachwuchskleriker (iuniores lectores) in ihre Häuser aufnehmen, um sie zu erziehen.35 Nach
dem 18. Lebensjahr konnten sich diese dann zwischen einem Kirchendienst oder einer Heirat
entscheiden. Für Gallien, Spanien, Italien und Afrika sind solche schola lectorum vel
cantorum (schola bedeutet hier Kommunität) belegt. Diese scholae bilden die Wurzeln für
das Schulwesen der Klöster, der Dome und Pfarren.
Andere Bedingungen als auf dem Kontinent gab es im irisch-schottisch-
englischen Raum. Die geographische Randlage innerhalb Europas förderte eine
Eigenständigkeit von der römischen Gesetzgebung, die hier jedoch zu einer hohen Blüte des
Schulwesens und der Kultur führte. Der christliche Glaube war mit den Römern auf die Insel
gekommen. Nachdem die Germanen im 5. Jh. nach England drängten, wichen die keltischen
Briten in die Gegenden von Cornwall und Wales zurück. Diese Altbriten gelangten auch nach
Irland und bewirkten in gewissem Sinne ein Anwachsen der Eigentümlichkeiten bei den
Schotten (= den irischen Kelten).36 Die iroschottische Kirche formte sich zu einer „in die
politische Stammesorganisation eingebundenen Mönchskirche“, die aus einem Netz von
Großklöstern bestand. Diese wurden zu Bildungszentren von höchstem Niveau im Hinblick
auf Liturgie, Sprache oder auch intellektueller Ausprägung, wie etwa die Klöster Clonard, im
östlichen Mittelirland, oder Bangor, im Nordosten der Insel. Durch diese Bildungszentralen
wurde Irland zur insula doctorum. In Irland waren diese Klöster geistliche und geistige
Zentren, die die weltliche Herrschaft ergänzten, und konnten so mit der Unterstützung der
Könige rechnen. Demgemäß wurden so die Klöster zu einer Art „Ausweis für die
Königsfamilien“, wo sich auch ihre Mitglieder führende Positionen sicherten. Von dieser
Verbindung geben die Namen der adeligen Gründer von Klöstern Zeugnis, die bisweilen mit
gegenwärtigen irisch-politisch-geographischen Bezeichnungen identisch sind, da die Namen
der Familien auf ihr Herrschaftsgebiet übertragen wurden. Die Lehren der artes liberales
fanden zumindest zum Teil Eingang in die Klöster irischer Prägung,37 in denen berühmte
Werke der Buchkunst entstanden, wie etwa das „Book of Kells“.38 Nach der
Kirchengeschichte, der „Historia ecclesiastica gentis anglorum“, von Beda Venerabilis (†
735), einem der einflussreichsten Gelehrten des Frühmittelalters, war es zudem bei9
vornehmen Angelsachsen und Franken üblich, Söhne und Töchter zur Bildung und Erziehung
in die Mönchs- und Nonnenklöster Irlands zu senden.39 Die Hochblüte dieser irischen Zentren
lag vor allem zwischen 600 und 740. Die irischen Mönche mit ihrer spezifisch ausgeprägten
Bußdisziplin, Gelehrsamkeit wie ihrer technischen Begabung waren erfolgreich auf den
Inseln und auf dem Kontinent, wo sie neben den bischöflichen Zentren, die sich seit dem 4.
Jh. im Gebiet des Römischen Reiches gebildet hatten, tätig waren. – Diesen bischöflichen
Zentren waren auch Klöster angegliedert, in denen eine geistige Elite für kirchliche und
politische Verwaltung ausgebildet wurde, wie dies am Beispiel von Tours deutlich ist.40 – Die
irischen Missionare betätigten sich gleichfalls als Klostergründer. Columban der Ältere (†
597), der aus dem Königsgeschlecht der Uí Néill stammte, missionierte in Nordengland und
Schottland und gründete das für seine theologische Gelehrsamkeit berühmte Kloster Iona.41
Columban der Jüngere wirkte im Frankenreich, wo er in Burgund das Klöster Luxeuil
(590) und in Oberitalien das Kloster Bobbio (612) gründete. In Bobbio etablierte sich eines
der bedeutendsten Skriptorien im Königreich der Langobarden. In den heutigen Salzburger
Raum war der Ire Fergil 42 gekommen, der möglicherweise aus dem Kloster Iona stammte.
Unter ihm als Abt (ab 746/47) und Bischof (ab 749) erreichte Salzburg seine erste kulturelle
Hochblüte. Das Kloster St. Peter war hier jedoch bereits vom hl. Rupert begründet worden,
der um 712/715 das Frauenkloster auf dem Nonnberg stiftete, das seine Nichte Eringardis
leitete.43 Dieses Kloster steht im Mittelpunkt fortlaufender Forschungsprojekte von Gerold
Hayer.44 Aus dem englischen Exeter, in dessen Kloster er als puer oblatus erzogen worden
war, stammte Winfried-Bonifatius († 754), der immer wieder den Nutzen der Grammatik
für das Bibelstudium betont.45 Bonifatius war auch als päpstlicher Legat für das fränkische
Königtum tätig und ist mit Salzburg durch die Einrichtung der Salzburger Diözese verbunden,
wo er einen Bischof einsetzte. Zudem sind von ihm Auseinandersetzungen mit Bischof
Fergil/Virgil bekannt. Bonifatius hatte neben dem berühmten Kloster Fulda, das 765
Königskloster wurde und unter Hrabanus Maurus im 8. Jh. zu besonderer Berühmtheit
gelangte, ebenso Frauenklöster gegründet, so in Bischofsheim an der Tauber, zu Kitzingen
oder in Ochsenfurt am Main. Von Bonifatius wurden vornehme angelsächsische Damen, die
sich seinem Dienst zur Verfügung stellten, als Lehrerinnen oder Vorsteherinnen an diesen
Klöstern eingesetzt. Bekannt sind eine gewisse Chunihilt und Berhtgit, ihre Tochter, die sehr
gebildet in den artes liberales waren. Sie wurden von Bonifatius in thüringisches Gebiet als
Lehrerinnen gesandt. Eine Lioba erhielt von ihm den Auftrag, in Bischofsheim, im heutigen
Unterfranken, zu unterrichten.46
Mit der iroschottischen Mission und Kultur verbinden sich auch die Namen von
Gelehrten, deren Beiname ihre Herkunft bezeichnet: Johannes Scottus Eriugena (9. Jh.),
Sedulius Scottus (9. Jh) oder Duns Scottus (12./13. Jh.).47 Eine gewisse Konkurrenz bzw.
Ergänzung zur iroschottischen Mission wurde die sogenannte römisch-benediktinische, die
von Papst Gregor I. betrieben wurde, der Ende des 6. Jh.s Mönche nach England entsandte.
Diese Mönche im Verein mit den iroschottischen trugen zum Aufschwung des Kloster- und
Schulwesens der Angelsachsen bei,48 die wiederum eine Basis für die Karolingischen
Reformen bildeten bzw. auf diese einwirkten.4910
III. Die Bildungsreform Karls des Großen
Bonifatius und seine Schüler, die in Kontakt mit den fränkischen Herrschern und den
Päpsten standen, hatten eine neue Periode der Kolonisation durch Kirche und Staat
eingeleitet. Auf ihr konnte die Reichs- und Kirchenreform Karls des Großen aufbauen, die zur
Institutionalisierung des Schulwesens der Kirche führte. Karl der Große selbst sah sich als a
deo coronatus, von Gott gekrönter und damit erwählter Herrscher, der seine Herrschaft von
Gottes Gnaden hatte. Mit seiner Reform hat sich nachhaltig Josef Fleckenstein
auseinandergesetzt. Die vom Hof aus gelenkte Kulturpolitik sollte über den Weg einer
reparatio bzw. correctio die rechten Zustände wiederherstellen und letztlich der Einheit des
Reiches der Franken dienen. Diese Einheit konnte jedoch nur durch eine gewisse
Vereinheitlichung der Kirche und ihrer Gepflogenheiten geschaffen werden, das bedeutete die
Vereinheitlichung von „Lehre, Liturgie, Recht, Klosterobservanz, Sprache, [und] Schrift“.50
Die eingeleitete Reform zeigte dauerhafte Konsequenzen für das Klosterwesen und wurde
prägend für das Bildungswesen Europas.
Die Reform Karls umfasste drei Initiativen: 1) die Schaffung einer geistig-
religiösen Zentrale durch die Berufung von Gelehrten und Künstlern an den Hof;51 2) eine
große Kapitularien-Gesetzgebung, die die Verantwortung für die Durchsetzung der
Reform den weltlichen, doch vor allem den kirchlichen Amtsträgern auferlegte; und 3)
gezielte Einzelaufträge hinsichtlich des Schriftwesens.
Diese Initiativen spiegeln sich ebenso in der „Vita Karoli Magni“ von Einhard,
einem Geschichtsschreiber und – so könnte man sagen – Bautenminister am Hofe Karls des
Großen wider. Er war in Fulda erzogen worden, wurde jedoch zur Vervollständigung seiner
Erziehung von Abt Baugulf an den Hof Karls gesandt, wo er ein Schüler Alkuins wurde und
in den Kreis um Karl gelangte. Den kurzgewachsenen, doch künstlerisch Hochbegabten setzte
Karl der Große in zahlreichen Missionen ein. Im Alter zog sich Einhard mit seiner Gemahlin
Imma, die nun als carissima soror galt, nach Seligenstadt zurück, wo er auch 840 verstarb.52
Die „Vita Karoli Magni“ orientiert sich an den römischen Kaiserviten Suetons (2. Jh.)
und berichtet in 33 Kapiteln von Karls Bedeutung für die Ausweitung und Konsolidierung des
Frankenreiches. Dabei werden ähnlich wie bei Sueton bestimmte persönliche Charakteristika
des Herrschers hervorgehoben, die auch seine Politik erhellen.
Im 25. und im 26. Kapitel berichtet Einhard von den Interessen Karls des Großen und
seiner christlichen Einstellung:
„25. Karl war ein begabter Redner, er sprach fließend und drückte alles, was er sagen
wollte, mit äußerster Klarheit aus. Er beherrschte nicht nur seine Muttersprache, sondern
erlernte auch fleißig Fremdsprachen. Latein verstand und sprach er wie seine eigene
Sprache. Griechisch konnte er allerdings besser verstehen als sprechen. Er war rednerisch
so begabt, daß er manchmal beinahe zu weitschweifig erschien. Die Sieben Freien Künste
pflegte er mit großem Eifer, achtete seine Lehrer sehr und erwies ihnen große
Ehrbezeugungen. Der Diakon Peter von Pisa, der schon ein alter Mann war, lehrte ihn
Grammatik. Ein anderer Diakon, Albinus, genannt Alcuin, ein Mann sächsischer
Abstammung aus Britannien, der der größte Gelehrte seiner Zeit war, unterrichtete ihn in11
den übrigen Wissenschaften: der König verwendete viel Zeit und Mühe auf das Studium
der Rhetorik, Dialektik und besonders der Astronomie. Er lernte Rechnen und verfolgte
mit großem Wissensdurst und aufmerksamem Interesse die Bewegungen der
Himmelskörper. Auch versuchte er sich im Schreiben und hatte unter seinem Kopfkissen
im Bett immer Tafeln und Blätter bereit, um in schlaflosen Stunden seine Hand im
Schreiben zu üben. Da er aber erst verhältnismäßig spät damit begonnen hatte, brachte er
es auf diesem Gebiet nicht sehr weit.
26. Die christliche Religion, mit der er seit seiner Kindheit vertraut war, hielt er
gewissenhaft und fromm in höchsten Ehren. [...] Er besuchte die Kirche regelmäßig
morgens und abends, nahm an den nächtlichen Horen und an den Messen teil, solange es
seine Gesundheit erlaubte. [...] Größte Aufmerksamkeit widmete er der Verbesserung des
liturgischen Lesens und des Psalmengesanges: er war in beidem selbst wohl bewandert,
wenngleich er in der Öffentlichkeit nie vorlas und nur leise im Chor mitsang.“53
Die Stelle, mag sie auch ein etwas idealisiertes Bild von Karl geben, zeigt jedoch
deutlich die regen geistigen Interessen Karls, die gleichfalls sein Bildungsprogramm
durchdrangen. Im Zentrum steht die Erlernung von Fremdsprachen, hier besonders der
Sprachen der Gebildeten und der Kirche, Latein und Griechisch, und der Unterricht in den
artes liberales, dem sich Karl als Erwachsener wohl schon in einem etwas
fortgeschrittenerem Bildungsstadium unterzog. Die Erwähnung der Gelehrten, doch ebenso
das Lernen Karls – besonders interessant sind die Schreibstudien, denen sich Karl sogar in der
Nacht unterzieht – weisen auf den Hof als Bildungszentrum.54 Seine Versuche, die kirchliche
Liturgie und den Psalmengesang zu verbessern – Karls Bemühungen um den Kirchengesang
wurden auch in den „Gesta Karoli“ Notkers I., des Stammlers, von St. Gallen im 9. Jh.
anekdotenhaft verewigt55 – zeigen seine Bemühungen das Bildungsniveau von Mönchen und
Geistlichen zu heben. Damit illustrieren die beiden Kapitel von Einhards „Vita“ Teilbereiche
der vorhin kurz erwähnten ersten beiden großen Initiativen Karls.
1) Die Schaffung einer geistig-religiöse Zentrale am Hof Karls des
Großen sollte durch die dort wirkenden Gelehrten und ihre Schüler in die Schulen und
Ausbildungsstätten des ganzen Reiches ausstrahlen. Die am Hof Gebildeten wurden damit zu
Multiplikatoren einer gehobenen und anspruchsvollen Bildung. Als Leiter der sogenannten
Hofschule wirkte der Angelsache Alkuin, der Karl den Großen auch persönlich unterrichtete.
Karl der Große hatte ihn 781 in Parma kennengelernt und ihn an seinen Hof berufen. Alkuin
war damals bereits Leiter der Kathedralschule in York, das zu dieser Zeit nach W. Heil56 die
berühmteste Ausbildungsstätte des christlichen Europas war. Berühmt war York damals
ebenso für seine Bibliothek.57 Alkuin betonte den Wert eines genauen und sorgfältigen
Schreibens, das für ihn die Basis jeder geistigen Arbeit bildete. Besonders förderte er die
septem artes liberales als Kern des Schulunterrichtes.58 Am Hofe Karls des Großen traf
Alkuin auf weitere, bei Einhard erwähnte Gelehrte, etwa auf den Hymnendichter Paulinus,
den Grammatiker Petrus von Pisa oder den Historiographen Paulus Diaconus oder
Theodulf von Orléans, der durch seine Gedichte bekannt wurde und in dem Carmen „Ad
Carolum regem“ ein Festmahl schildert, das allegorisierend Einblick in die gelehrte
Atmosphäre bei Hof gibt. Die Teilnehmer des Festmahls werden dabei mit Pseudonymen
versehen (Alkuin = Flaccus, Angilbert, der Hofkaplan, der eine nichtsanktionierte Ehe mit12
einer der Töchter Karls, Bertha, einging = Homer, Einhard = Nardulus [kleine Narde]).59 Zu
Alkuins Schülern kann in gewissem Sinn ebenso Arn von Salzburg gezählt werden, der
mit ihm auch persönlich befreundet war, wie der erhaltene Briefwechsel zeigt. Unter Arn
wurde in Salzburg die Bibliothek und Schule von St. Peter für die Mönche begründet.60 Zu
den Schülern Alkuins zählte gleichfalls Hrabanus Maurus, ein Oblate aus dem Kloster
Fulda, der u.a. eine Enzyklopädie „De rerum naturis“ verfasste, die als eine ihrer Quellen die
„Etymologiae“ Isidors von Sevilla einbezieht.61 Alkuin verstarb 804 in Tours, wo er 796 Abt
des Klosters St. Martin geworden war.
Wie aus den Schriften Alkuins deutlich wird, funktionierte diese Hofschule nach dem
Prinzip von mehreren ordines, Fachgruppen oder Abteilungen, wie „sacerdotes Christi,
ministri, medici, versifici, scriptores“. Diese widmen sich unter einem Magister bestimmten
Aufgaben. Die Schreiber waren in Verbindung mit der Bibliothek, die die Funktion eines
Archivs und gleichzeitig auch einer Schreibschule erfüllte.62
2) Die Reformen benötigen für ihre Durchsetzung auch eine
Gesetzgebung. Die Kapitularien Karls des Großen bauten auf vorhandene Strukturen auf,
wobei sich Karl bei seinen Reformen zum Teil auf seine Vorgänger berief.63 Mit Kapitular
werden nach H. Mordek vor allem die Erlässe, Verordnungen oder sonst Verlautbarungen
unter den fränkischen Herrschern verstanden, die gesetzgebenden, religiös belehrenden und
administrativen Charakter haben. Da diese Verordnungen meist in Kapitel gegliedert waren,
wurden sie als Kapitulare bezeichnet. Jedoch wird der Ausdruck capitulare oder capitularis
nicht ausschließlich angewendet, sondern er findet sich ebenso neben den Begriffen
decretum, constitutio oder praeceptum.64
Karl der Große, der 768 fränkischer König wurde, hatte schon um 784/85 einen Brief,
die „Epistula de litteris colendis“, an den Abt des Klosters Fulda, Baugulf,65 gerichtet.
Dieser war jedoch nicht als Privatbrief, sondern als Rundbrief gedacht. Fulda, dessen
Gründung Winfried-Bonifatius vorbereitet hatte,66 war zu diesem Zeitpunkt ein bedeutendes
Bildungszentrum, zudem gab es einzelne große Gelehrte im Reich, jedoch waren insgesamt
die Zustände der Ausbildung der Geistlichen, wie hier im speziellen Fall der Mönche, im
Reich nicht zufriedenstellend. Auf dieses Manko weist Karl hin, der die Pflege der
Wissenschaft neben dem klösterlichem Lebenswandel wünscht, wobei Glaube und
Wissenschaft aufeinander bezogen werden sollen, da sie sich gegenseitig ergänzen, ja
notwendig sind.:
„Wir Karl, durch Gottes Gnade König der Franken und Langobarden und Schirmherr der
Römer, richten einen liebenswürdigen Gruß an dich, Abt Baugulf, und deine ganze
Gemeinde [...] Wie die Ordensvorschriften ehrbare Sitten erstreben, so würde dann
anhaltender Fleiß im Lernen und Lehren Ordnung und Schmuck in die Wortfolge
bringen. Wer sich also bemüht, Gott durch eine richtige Lebensweise zu gefallen, der
wird sich dann auch darum kümmern, ihm durch eine richtige Redeweise zu gefallen. Es
steht nämlich geschrieben: ‚Entweder wirst du aus deinen Worten gerechtfertigt, oder
nach deinen Worten verdammt.’“6713
Gerade in dem letzten Satz scheint beinahe eine gewisse Drohung, zumindest eine
eindringliche Mahnung gegeben, die Ausbildung der Mönche voranzutreiben.
In einer anderen Stelle des Briefes weist Karl deutlich auf die Missstände in der Ausbildung
hin, die auch im praktischen Leben nachteilige Konsequenzen haben können, vor allem
jedoch beim Schriftverständnis und damit im religiösen Leben, das die Essenz von
Klostermitgliedern oder Geistlichen ist. Rhetorisch geschickt verweist hier Karl als rex
christianus auf seine Sorge um eine rechte Vermittlung des Christentums, die sich auf ein
richtiges Textverständnis gründet, dessen Voraussetzung wiederum eine solide Bildung ist.
Diese Bildung ist insofern unabdingbar, da auch die heiligen Schriften eine anspruchsvolle
Lektüre sind, die einen geschulten Geist erfordern:
„Es sind Uns [Karl] in den letzten Jahren aus mehreren Klöstern öfters Schreiben
zugegangen, worin Uns berichtet wurde, daß die dort weilenden Brüder in frommen und
heiligen Gebeten für Uns wetteiferten. In der Mehrzahl dieser Zuschriften fanden Wir
zwar einen rechten, tüchtigen Sinn, aber auch eine ungebildete Sprechweise, weil infolge
der Nachlässigkeit im Lernen die ungebildete Zunge nicht das fehlerfrei auszudrücken
vermochte, was im Herzensinnern fromme Ergebenheit getreuen Sinnes diktierte.
Deshalb wurde in Uns die Besorgnis rege, es möchte bei dem Mangel an
schriftstellerischem Können auch an der Einsicht und Erkenntnis der heiligen Schriften
viel weiter, als es nur irgendwie sein dürfte, fehlen. Und doch wissen wir alle recht wohl,
daß, wenn schon Wortfehler sehr gefährlich sein können, Sinnfehler doch noch weit
verhängnisvoller werden dürften. [...] Da sich nämlich in der Bibel rhetorische Figuren,
Tropen und anderes dergleichen findet, so kann niemand zweifeln, daß sie jeder Leser um
so schneller in ihrer geistigen Bedeutung erfasst, je mehr und je vollkommener er zuvor
wissenschaftlich geschult ist.“68
In Aachen kam es 789 zu einer Synode,69 als deren Frucht die „Admonitio
generalis“ betrachtet werden kann. Dieses Send- und Mahnschreiben umfasst 82 Kapitel
und ist, wie die Bezeichnung besagt, ein umfassendes Schreiben, das sich nicht nur an die
Bischöfe oder den weltlichen Klerus, sondern auch an weltliche Würdenträger wie überhaupt
an das Volk (den populus [christianus]) wendet. Im ersten großen Abschnitt der „Admonitio“
werden Teile der kirchlichen Ordnung behandelt, während der zweite (Kapitel 60-82) das
eigentliche Reformprogramm enthält. Im 62. Kapitel des Kapitulars wird das
Zusammenwirken geistlicher und weltlicher Gewalten betrachtet und diese zur
Zusammenarbeit und zur Partnerschaft verpflichtet. Diese Zusammenarbeit kann als eine
Grundlage für das Reich Karls des Großen gelten. Kapitel 72 der „Admonitio“ dagegen gibt
genauere Anweisungen für die Ausführungen des Bildungsprogramms, das bereits
grundsätzlich in der „Epistula“ von 784/5 eingefordert worden war.70
In der „Admonitio“ wird dieses Programm konkret angesprochen als errata corrigere
(Fehlerhaftes verbessern), superflua abscindere (Überflüssiges oder Unnützes beseitigen),
recta cohartare (das Rechte bekräftigen).71 Bei dieser Aufforderung zur Emendation,
Verbesserung und Korrektur beruft sich Karl auf den biblischen „heiligen König[] Josia“ (2
Könige 22), der sein Volk durch Visitation (circumeundo), Korrektur (corrigendo),
Ermahnung (ammonendo) zur Verehrung des wahren Gottes zurückrufen wollte. König Josia14
und später König David werden so zu exempla und zu Identifikationsfiguren für Karl den
Großen, der den Ruhm Gottes verbreiten und ein heiliger König sein will, und weisen so auf
sein Selbstverständnis als christlicher König.72
Die vorhandenen Bildungsgüter konnten jedoch nur in der erwünschten Weise
bereinigt werden, wenn man sich Beispiele korrekt verfasster Werke verschaffte, wobei als
Muster auch die Bibel und die Schriften der christlichen Väter gelten konnten. Für eine
zufriedenstellende Lösung dieser Aufgabe waren jedoch ebenso gewisse Basiswerke
erforderlich, die sich auf den Gebrauch der Sprache selbst bezogen. So verfasste Alkuin ein
Lehrbuch der Orthographie und eine Grammatik der lateinischen Sprache, die durch
regionale Ausprägungen von ihrer klassischen bzw. von der spätantiken Form deutlich
abgewichen war.73
Unter correctio verstand man jedoch nach Laetitia Böhm auch das Verbot von
irreführenden Texten, so sollten falsche Märtyrernamen oder unsichere Heilige korrigiert
oder gegebenenfalls beseitigt werden.74
Ebenso war dazu die Sammlung von Texten nötig, was zu Einrichtung von
Bibliotheken bzw. ihrem Ausbau führte: Alkuin selbst baute seine Bibliothek in Tours nach
dem Vorbild der berühmten Bibliothek von York aus, der Hofkapellan Karls des Großen,
Angilbert, schenkte seinem Kloster über 200 Bände oder auch Arn von Salzburg ließ über
150 Bücher schreiben.75
In den Skriptorien führte die Forderung zur Sorgfalt auch zur Ausbildung der
karolingischen Minuskel, einer neuen klaren Schrift mit wohl verteilten Proportionen. Um
möglichst Fehler zu vermeiden, sollten Kopien im Sinne der emendatio von reifen Schreibern
hergestellt werden.76
Die Klosterbibliotheken, wie etwa in Fulda, umfassten anscheinend überwiegend
geistliche Literatur, dazu gehörten Bibelhandschriften, Bibelerklärungen, Werke der
Kirchenväter oder liturgische Werke für den Gottesdienst, doch wurden gleichfalls die
Handschriften antiker Autoren vermehrt, darunter finden sich die Historiker Tacitus, Sueton,
Livius wie auch Ammianus Marcellinus, der Rhetoriker Cicero oder die Schrift des römischen
Architektur-Theoretikers Vitruvius. Die Werke der heidnischen Antike hatten ihren Platz im
Studium der artes liberales, auch sie halfen den Verstand zu üben und zu schärfen und in die
Geheimnisse der heiligen Schriften vorzudringen.77 Zudem waren Rechtskenntnisse
kirchlicher und weltlicher Art aus den richtigen Quellen notwendig.
3) Die dritte Initiative Karls des Großen innerhalb seines Bildungsprogramms
war die Zuweisung bestimmter Aufgaben. Dieser Punkt überschneidet sich zum Teil
mit der zweiten Initiative und weist oft deutlich auf das Ideal der rectitudo in Karls
Bildungsprogramm, die wiedergewonnen werden soll.
Karl der Große veranlasste eine Kopie der regula Benedicti nach einer Handschrift
aus dem Kloster Montecassino, die – wie man meinte – auf den hl. Benedikt selbst
zurückging. Papst Hadrian ließ Karl auf seine Anfrage hin eine Sammlung des vielseitig
gelehrten Kanonisten Dionysius Exiguus, eines Freundes Cassiodors, zukommen, die der15
kirchenrechtlichen Orientierung diente. Ebenso sollte die Liturgie, die Texte der Messe bzw.
auch anderer Feiertage, mithilfe eines authentischen Sakramentariums im Frankenreich
vereinheitlich werden, das Karl aus Rom erbeten hatte.78 Aufgabe Alkuins war es, einen
bereinigten Text des Alten und des Neuen Testamentes herzustellen. Zu diesem
Zwecke veranlasste Alkuin in Tours die Kopien mehrerer Bibeln.79 Im ganzen Frankenreich
wurde das auf Wunsch Karls des Großen von dem langobardischen Gelehrten Paulus
Diaconus überarbeitete Homiliar, das an die Stelle der oft verderbten Lesungen des
Officiums treten sollte, maßgebend. Paulus Diaconus war Erzieher der Tochter, des letzten
Langobardenkönigs, Desiderius, gewesen, den Karl der Große besiegt hatte.80 Alkuin befasste
sich in Zusammenhang mit der Reform der lateinischen Sprache mit der Überarbeitung des
Stils von Heiligenviten.81
Dazu gab es auch ganz konkrete bildungspolitische Anstöße, durch die die
Vulgärsprachen gefördert wurden. Davon gibt gleichfalls Einhard in der Vita Karoli Magni
im 29. Kapitel ein genaueres Bild. Hier werden noch einmal die Prinzipien der emendatio,
correctio und rectitudo der Bildungsreform deutlich gemacht, wobei das Fränkische, Karl war
ein Franke, etwas mehr im Mittelpunkt steht. Einhard sieht diese Initiativen vor allem in der
Zeit nach der Kaiserkrönung Karls des Großen.
„29. Nachdem er (Karl der Große) den Kaisertitel angenommen hatte, widmete er seine
Aufmerksamkeit den Gesetzen seines Volkes, die in vielem mangelhaft waren. Die
Franken haben nämlich zweierlei Rechte [salisches und ripuarisches Recht], die in
manchen Einzelheiten stark voneinander abweichen. Karl beabsichtigte, Fehlendes zu
ergänzen, Widersprechendes auszugleichen und alles Falsche und Verkehrte zu
verbessern. Doch kam er nicht weit damit und fügte den bestehenden Gesetzen nur
wenige und unvollständige Ergänzungen hinzu. Er ließ aber alle ungeschriebenen Gesetze
der von ihm beherrschten Stämme [Thüringer, Sachsen, Friesen] sammeln und schriftlich
aufzeichnen. Auch die uralten heidnischen Lieder, in denen die Taten und Kriege der
alten Könige besungen wurden, ließ er aufschreiben, um sie für die Nachwelt zu erhalten.
Außerdem begann er mit einer Grammatik seiner Muttersprache.
Weiter gab er den Monaten einheitlich fränkische Namen: sie waren bisher bei den
Franken teilweise durch lateinische, teilweise durch einheimische Bezeichnungen benannt
gewesen. Die zwölf Winde unterschied er ebenfalls durch passende Ausdrücke: vorher
hatte es nicht mehr als vier Benennungen dafür gegeben. Er nannte den Januar
uuintarmanoth, den Februar hornung, den März lenzinmanoth, den April ostarmanoth
[...]“82
Manche dieser Bezeichnungen für die Monate sind noch aus Dialekten bekannt, wie
etwa der „Hornung“ oder „Horner“ im Schweizerischen.83
All diese Initiativen, die wiederum zum Teil auf eine gewisse Vereinheitlichung
hinweisen – z.B. im Bereich des Rechts –, förderten zudem die Bewahrung von mündlich-
überlieferter Literatur, wie etwa der Heldenlieder, und die Durchdringung und Regulierung
gesprochener Sprachen, worauf der Versuch, eine fränkische Grammatik zu erstellen,
hinweist. Diese Initiativen beinhalteten jedoch auch ein Bemühen, korrekt aus dem
Lateinischen in die Volksprache zu übersetzen. Dies alles begünstigte und förderte die
vulgärsprachliche Literatur. So entstanden im deutschen Sprachraum ein „Vaterunser“ oder –16
als eines der ältesten Sprachdenkmäler – der „Weißenburger Katechismus“ (Ende 8. Jh.s) und
Übersetzungen, wie die der „Regel Benedikts“ oder der „Lex Salica“.84
Die Reform wirkte nachhaltig auf das Klosterwesen ein, das zunehmend eine
Vereinheitlichung erfuhr, zumal seit 802 die Regel Benedikts verbindlich für alle Klöster im
Reich gelten sollte. Mit dieser Reform Karls des Großen erhält das Kloster eine bedeutende
Funktion in der Bildungspolitik. Die klösterliche Ausbildung sollte nicht allein die Mönche
und den Weltklerus formen, sondern zielte auch auf die Qualifikation für Schlüsselstellungen
in der Verwaltung des Reiches. Wie weit diese Reform, die durch Schenkungen und
königliche Privilegien unterstützt wurde, wirksam werden konnte, lässt die große Anzahl der
Klöster erahnen, die zwischen 800 und 820 existierten. Laetitia Böhm spricht von 650
Klöstern allein im Frankenreich, ohne diejenigen im italienischen Raum.85 Unter denen im
deutschen Sprachraum sind beispielsweise zu nennen: Salzburg, Freising, Regensburg (St.
Emmeran), St. Gallen, Reichenau, Murbach (im Elsass), Mainz, Trier, Mondsee, Passau,
Tegernsee. Dort sollte und suchte man nun die Ideale des Bildungsprogramms und somit
diejenigen der „Admonitio generalis“ umzusetzen. Dazu gab es gewisse Vorgaben: den
Lehrstoff wie auch ein Mindestmaß an Bildung. Ein besonderer Nachdruck galt der
römischen Liturgie und Predigt und für Mönche gab es die Verpflichtung zu emendieren.86
Die Anregungen, die von dieser Reform ausgingen, befruchteten jedoch nicht nur die gelehrte
lateinische Literatur, sondern nachhaltig ebenso die Entwicklung der vulgärsprachlichen
Literaturen, die ihren Ausgangspunkt in der Bildung und Wissenschaftspflege der Klöster
fanden.
IV. Gelehrsamkeit im Kloster. Große Gelehrte im Heiligen Römischen Reich
Einige Klöster und ihre (literarischen) Leistungen sollen nun hervorgehoben werden,
dabei handelt es sich oft um sogenannte Reichsklöster, die dem König unterstellt waren, unter
seinem Schutz standen und einen Immunitätsstatus genossen.
Der Ruf der Klöster war auch mit den dort wirkenden Gelehrten verbunden, die diese
zu Eliteschulen machen konnten. Stellvertretend für viele Klöster des Reiches sollen hier
Fulda, Corvey und St. Gallen stehen, die zahlreiche Gelehrte hervorgebracht haben, die in
ihnen wirkten oder aus ihnen hervorgingen. Als Beispiel für einen Ort weiblicher
Gelehrsamkeit wird das Kloster bzw. Stift87 Gandersheim erwähnt.
Hrabanus Maurus, ein Schüler Alkuins, hatte 804 die Fuldaer Schule
übernommen, die im 9. Jh. führend war und unter ihm größte Bedeutung im Reich erlangte.
Der Schwerpunkt seiner wissenschaftlichen Tätigkeit lag auf der Kommentierung der
biblischen Bücher, so existieren von ihm etwa Kommentare zum Matthäus-Evangelium und
zu den Paulusbriefen. Mit seiner Enzyklopädie „De rerum naturis“ (22 Bücher), die weite
Verbreitung fand, sollte den Klerikern das nötige Wissen für die Seelsorge vermittelt werden.
Angeregt wurde er dazu von der Enzyklopädie Isidors von Sevilla, den „Etymologiae“.
Hraban jedoch gibt seinem Werk eine neue Anordnung. Ungleich Isidor beginnt er mit derSie können auch lesen