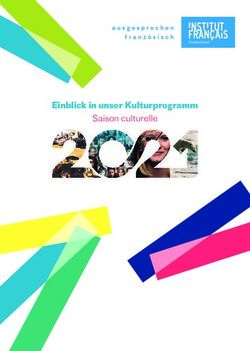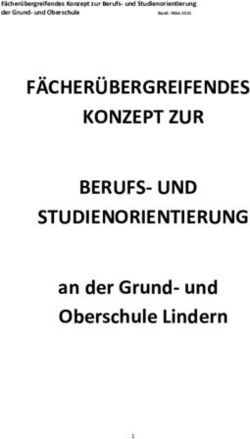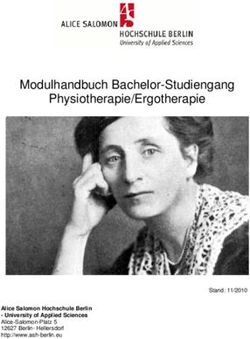L'autonomie, défi pour la promotion de la santé et la prévention
←
→
Transkription von Seiteninhalten
Wenn Ihr Browser die Seite nicht korrekt rendert, bitte, lesen Sie den Inhalt der Seite unten
L’autonomie, défi pour la promotion de la
santé et la prévention
15e Conférence nationale sur la promotion de la santé
Jeudi 30 janvier 2014, Centre de Congrès de Beaulieu, Lausanne
Atelier no 1 : consommateurs, quelle autonomie face aux choix alimentaires ?
• Barbara Pfenniger, Responsable Alimentation, Fédération romande des
consommateurs (FRC), Lausanne
1. Introduction
Cet atelier a été orienté sur les besoins des participants en matière de connaissances
face aux choix alimentaires, pour développer leur autonomie.
La présentation de Mme Pfenniger est ainsi largement exhaustive quant aux thèmes
traités.
2. 2. Thème de l’atelier
L’atelier a été initié par une consultation des participants sur leur définition d’une
alimentation saine. Les éléments principaux qui en sont ressortis sont les suivants :
o Respect de la pyramide alimentaire
o Eau comme boisson principale
o Alimentation exempte d’additifs
o Alimentation variée
o Goût des aliments
o Alimentation respectueuse de l’environnement
Par la suite, les participants ont pu décrire les différents obstacles à une alimentation
saine… :
o Aspect des aliments (fraîcheur, qualité, sûreté) et leur perception
o Origine des aliments
o Confusion sur l’étiquetage des produits
o Paresse de cuisiner
o Achat spontané versus achat rationnel
o Prix
o Nombre de labels
o Méconnaissance de la législation
.. ce qui a permis de développer les thèmes suivants :
Eventail de produits alimentaires à disposition
o Lecture de l’étiquetage : transparence, composition, origine
o Notion d’aliments transformés
o Additifs alimentaires
o Définition d’un produit de proximitéo Méthodes de production des aliments
o Accessibilité des prix
o Marges financières des intermédiaires
o Législation suisse en matière d’alimentation
o Répression des fraudes alimentaires
o Cahiers des charges concernant les aliments bio
o « Swissness »
3. 3. Travaux de groupes
a) Que puis-je retirer de la présentation pour mon travail ?
o Inciter les consommateurs à la prudence > renforcer le message
o Complexité du thème de l’alimentation > beaucoup de données à transmettre
o Valoriser la consommation de produits alimentaires non transformés, à tous les
niveaux
o Alimentation est un thème où il y a beaucoup de confusion > transmettre des
messages clairs
o Difficulté de reconnaître les aliments et additifs problématiques > mettre à
disposition une liste simple
o Actions individuelles sont plus efficaces combinées avec des actions collectives
o Situation des OGM en Suisse, par rapport au niveau international
b) Que vais-je faire différemment dans mon travail pour renforcer l’autonomie dans une
perspective de promotion de la santé ?
o Sensibiliser les personnes et les informer au maximum
o Mettre l’accent sur l’information
o Promouvoir les cours « bien manger à petit prix »
o Rappeler les messages de base en matière d’alimentation saine
o Rien
o Faire plus de recherches sur les différents labels pour les connaître et les faire
connaître
o Evaluer ce que les personnes comprennent des emballages alimentaires
4. Clôture
L’atelier s’est achevé sans avoir pu traiter de manière approfondie les nombreuses
interrogations des participants sur les thèmes traités dans la première partie.
Ainsi que nous l’avions prédit, ces derniers sont autant venus chercher des informations
pour être autonomes en matière d’alimentation à titre personnel, qu’à titre professionnel.
Il ressort néanmoins l’impression générale des participants que le thème est si complexe
qu’il mérite que les messages à destination de la population soient répétés et renforcés
Seite 2 von 2Autonomie als Herausforderung für die Gesundheitsförderung und Prävention 15. Nationale Gesundheitsförderungs-Konferenz 2014 30. Januar 2014 im Kongresszentrum Beaulieu Lausanne Workshop Nr. 2 „Elternpartizipation – eine Chance für die Gesundheitsförderung!?“ • Maya Mulle, Leitung Fachstelle Elternmitwirkung, Zürich 1. Fachinput Maya Mulle von der Fachstelle Elternmitwirkung präsentiert die Ergebnisse einer Befragung zur Elternarbeit im Schulbereich vor. Sie fasst Stolpersteine und Herausforderungen in der Zusammenarbeit zwischen Schulen und Eltern zusammen sowie die sich daraus ergebenden Folgerungen und Rahmenbedingungen für ein besseres Gelingen. 2. Arbeit in Gruppen : Ergebnisse Bemerkung: Die Ergebnisse aus der Gruppenarbeit wurden nicht nach a) Relevante Aspekte der Präsentation für die Arbeit der Teilnehmenden oder b) Was muss ich in meiner Arbeit ändern, um die Autonomie im Sinne der Gesundheitsförderung zu stärken? sortiert, sondern direkt nach Thema geclustert. Gemeinsames Ziel (Fachleute, Lehrpersonen und Eltern) • Gesund aufwachsen und gut lernen als Ziel • Überzeugungsarbeit von Kitas, Spielgruppen, Schulen usw. bei den Eltern unter dem Aspekt „spielend aufwachsen“ Rahmenbedingungen • Politische und strukturelle Rahmenbedingungen für die Elternarbeit (kantonale Ebene) • Zusammenarbeit zwischen Bildung und Gesundheit • Gesamtstrategie oder Konzept zur Elternarbeit Einbezug Eltern • Erziehungs-Bildungs-Partnerschaft • Höhere Wirksamkeit und Nachhaltigkeit von GF/P durch Einbezug der Eltern • Türöffner „Das beste für das Kind“ • Grundhaltung: Eltern haben Ressourcen • Echter Einbezug bedingt Interesse und Offenheit • Eltern resp. deren Bedürfnisse abholen • Eltern als Zielgruppe von Anfang an einbeziehen • Auch kleine Schritte als Erfolg honorieren • Zusammenarbeit ist Beziehungsarbeit • Methode „Elterncafé“ mit fachlichem Kurzinput eignet sich zum Abholen von Bedürfnissen • Väter „aktiv“ abholen (z.B. Lager, Draussen etwas unternehmen)
• Zu welchen Zeiten sind Eltern verfügbar? Arbeits- und Betreuungszeiten in Planung
berücksichtigen
Zusammenarbeit Schule-Fachpersonen-Eltern
• Rolle, Haltung von Schule / Lehrperson
• Bessere Vernetzung Fachstelle und Schule (=> Bildungslandschaft)
• Systematischer Ansatz: Schule /Lehrpersonen – Eltern –Schüler und Schülerinnen
(SuS)
• Persönliche Kontakte (zwischen Fachstelle und Schule/Lehrpersonen)
• Zyklus: Fachperson => Schule => Lehrperson => Eltern => SuS
Kulturelle/Soziale Aspekte
• Wie Umgehen mit sozialen und kulturellen Unterschieden ausserhalb unseres
Wirkungsbereichs?
• Kulturelle Differenz auch in der Fachwelt (unterschiedliche fachliche
Haltungen/Prioritäten)
• Femmes-Tische Moderatorinnen als Schlüsselperson nutzen für die Arbeit mit Eltern
mit Migrationshintergrund
3. Schlüsselelemente der Synthese
Übergeordnetes Ziel der Bemühungen von Fachstellen, Schulen und Eltern soll sein, dass
die Schüler und Schülerinnen (SuS) „gesunde aufwachsen und gut lernen“. Förderlich
sind eine gemeinsame Strategie und die gute Zusammenarbeit von Bildung und
Gesundheit in der Elternarbeit. Weiter sind die Themen auf allen Ebenen (Fachperson,
Schule, Lehrpersonen, Eltern, SuS) einzubringen und insbesondere die Bedürfnisse und
Ressourcen der Eltern gilt es noch besser abzuholen resp. zu nutzen. Der Bericht zur
Befragung der Fachstelle Elternmitwirkung ist auf deutsch und französisch bei den
Workshop-Downloads im Internet verfügbar. Er enthält ebenfalls eine gute Übersicht über
die verschiedenen Modelle der Elternmitwirkung.
Seite 2 von 2Autonomie als Herausforderung für die
Gesundheitsförderung und Prävention
15. Nationale Gesundheitsförderungs-Konferenz 2014
30. Januar 2014 im Kongresszentrum Beaulieu Lausanne
Workshop 3: Gesundheitsförderung in der Sozialhilfe: Spannungsfeld zwischen
Ohnmacht und Autonomie
• Jürg Fassbind, Leiter Kompetenzzentrum Arbeit, Bern
• David Lätsch, Dr., Dozent Berner Fachhochschule, Fachbereich Soziale Arbeit,
Bern
Arbeit in Gruppen – Ergebnisse
a. Relevante Aspekte der Präsentation für die Arbeit der Teilnehmenden
• Bestätigung: Schwierigkeit gewisse Menschen zu erreichen
• Prävention in Alltag der Zielgruppe integrieren
• Nicht eigene Vorstellung von „was ist richtig, was ist wichtig“ auf
andere übertragen
• Nicht in Freizeit sondern in Arbeitszeit Interventionen
planen/durchführen
• Kleine Schritte (führen zum Erfolg / sind auch ein Erfolg)
• Niederschwelliger Zugang zu Angeboten sicherstellen
• Tiefe Selbstwirksamkeitserwartung als Herausforderung für
Gesundheitsförderung
b. Was muss ich in meiner Arbeit ändern, um die Autonomie im Sinne der
Gesundheitsförderung zu stärken?
• Es gibt nicht DIE Zielgruppe, Menschen dort abholen, wo sie sind.
• Enthusiasmus vs. Autonomie
• Erfahrung ermöglichen (z.B. Bewegung)
• Wie viel „Zwang“ ist zulässig?
• Zwang ist kontraproduktiv? -> hohe Professionalität in
Beratung/Begleitung
• Bestätigung der eigenen Arbeit, mit kleinen Erfolgen zufrieden sein
• Peeransatz? (z.B. Anonyme Alkoholiker) funktioniert nicht überall…
• Bei vulnerablen Gruppen zuerst das Terrain bereiten
Schlüsselelemente der Synthese
Der Titel des Workshops hat das Ganze auf den Punkt gebracht.L’autonomie, défi pour la promotion de la
santé et la prévention
15e Conférence nationale sur la promotion de la santé
Jeudi 30 janvier 2014, Centre de Congrès de Beaulieu, Lausanne
Atelier no 4 : www.ciao.ch, une fenêtre virtuelle favorisant l’autonomie des jeunes
romands
• Anne Dechambre, Responsable site, Association romande CIAO, Lausanne
• Claire Hayoz Etter, Responsable projets, Association romande CIAO, Lausanne
1. Thème de l’atelier
CIAO.ch est la plateforme internet qui permet aux jeunes romands de poser des
questions dans tous les domaines de la santé. Une équipe de professionnels y répond
dans les délais les plus brefs possibles. Par son fonctionnement, CIAO contribue à la
promotion de la santé et au renforcement de l’autonomie de ses utilisateurs (information,
empowerment, prévention par les pairs, intervention précoce).
2. Travail de groupe : résultats
a. Eléments de la présentation pertinents pour le travail des participants
• Importance de l’anonymat
• Offre à bas seuil / accessibilité de l’outil (de par l’anonymat et la gratuité)
• Interactivité du site
• Rôle joué par les pairs :
• coresponsabilité des adolescents
• aspect participatif de la démarche (les adolescents eux-mêmes peuvent
apporter des pistes de solutions/ des réponses)
• en plus de l’aspect individuel (réponses individualisées), création d’une
communauté
• Encouragement de la collaboration entre les partenaires (les professionnels) et les
pairs
• Rapidité des réponses (tout en respectant là où en est la personne)
• Adaptation du langage des réponses données
• Liberté dans l’utilisation de l’outil (on y vient quand on veut)
Tous ces éléments font que cette plateforme doit être connue et diffusée.
b. Que vais-je faire différemment dans mon travail pour renforcer l’autonomie
dans une perspective de promotion de la santé ?
- Faire connaître ciao.ch et l’utiliser
- Adapter les moyens aux supports utilisés (publics-cible)
• Considérer Internet comme outil incontournable et actuel dans nos domaines• Renforcer l’accessibilité des services
• Favoriser l’échange et l’écoute (entre professionnel-le-s et vécu)
• Poser un cadre et faire confiance aux ressources
• Favoriser la prévention par les pairs
• Favoriser la participation
• Importance du processus d’empowerment
• Importance de l’anonymat ( non jugement)
• Vulgariser davantage
3. Eléments clés de la synthèse
CIAO.ch est la seule plateforme en ligne qui permet aux jeunes de poser des questions
sur tous les thèmes de santé. Les réponses sont données par des professionnels des
domaines spécifiques et dans des délais très courts. De plus, les jeunes ont aussi la
possibilité de donner leurs réponses. Le fait que l’utilisateur puisse utiliser le site comme il
le souhaite (consultation des échanges ou participation active, accès via internet, tablette
ou Smartphone) et de manière anonyme, qu’il y trouve des informations de qualité, qu’il
puisse jouer un rôle de « pair aidant » fait de cette plateforme un outil à bas seuil
promouvant l’empowerment et l’autonomie, d’un point de vue de la promotion de la santé.
Cet exemple concret met ainsi en évidence des aspects primordiaux de la promotion de
l’autonomie en matière de prévention et de promotion de la santé :
• Accessibilité de l’information (offre bas seuil)
• Qualité de l’information
• Aspect participatif
• Liberté d’utilisation (quand on veut)
• Multi-modalité de l’utilisation (comme on veut)
Seite 2 von 2Autonomie als Herausforderung für die
Gesundheitsförderung und Prävention
15. Nationale Gesundheitsförderungs-Konferenz 2014
30. Januar 2014 im Kongresszentrum Beaulieu Lausanne
Workshop 5: Finanzkompetenzen stärken – Gelstress vermeiden
• Christof Maag, Leiter Fachstelle Integration, Caritas Schweiz, Luzern
Nazmi Kurtaj, Programmverantwortlicher Fachstelle Integration, Caritas Schweiz,
Luzern
Zusammenfassung
1. Gruppenresultate
a. Relevante Aspekte der Arbeit
- Kenntnis über vorhandenes Material i. verschiedenen Sprachen
- Begrenztheit des individuellen Budgets (unabhängig in welcher Höhe)
- Räume schaffen, in denen man darüber reden kann
- Budgetberatung in bestehenden Projekten einbauen
- Konkret Verantwortung an Junge übergeben
- Kursleiterweiterbildung (Lesen und Schreiben) damit Atelier in Budgetberatung
oder „wie gehe ich mit Geld um?“ anbieten.
- Unterschiede Romandie /Deutschschweiz existiert
- Idee: Finanzkompetenz als obligatorisches Schulfach einführenb. Was ändern, um Autonomie zu stärken
- Über Zusammenhänge informieren zwischen einer gesundheitlichen
Stresssituation und Konsequenzen
- Infomaterial erstellen für Jugendliche
- Hinweise auf kompetente Budgetberatung aufnehmen in Projekte
- Multiplikatoren anweisen Adressen für Budgetberatung vor Ort herauszusuchen
- Multiplikatoren unterstützen
- Triage der Support-Angebote
- Lebenskompetenzen fördern
- Lebenswelten erschaffen und fördern
- Mutter- und Vaterberatung informieren
- Anlaufstellen kommunizieren
Seite 2 von 3-
2. Schlüsselelemente
Auch wenn man meint, dass die angebotene Dienstleistung bereits bekannt ist, wird
einem vor Augen geführt, dass noch viele das Angebot nicht kennen.
Nur mit Multiplikatoren wird man stark, Zusammenarbeit mit anderen ist kritisch.
Mutter- und Vaterberatung wäre ein weiterer möglicher Multiplikator.
Einsicht, dass der Schaden (Schulden) meist schon entstanden ist, wenn die
Personen Hilfe suchen.
Seite 3 von 3Autonomie als Herausforderung für die
Gesundheitsförderung und Prävention
15. Nationale Gesundheitsförderungs-Konferenz 2014
30. Januar 2014 im Kongresszentrum Beaulieu Lausanne
Workshop 6: Autonomie unter erschwerten Bedingungen. Kampf gegen
Übergewicht - auch mit Handicap
• Leitung: Heinrich von Grünigen und Kees de Keyzer
1. Schlüsselfragen an die Teilnehmenden
• Was verbinden Sie mit „Autonomie“?
- Selbstbestimmung, Unabhängigkeit, Eigenverantwortung, Chancengleichheit,
Partizipation, Inklusion
- Umwelteinflüsse (wirken beispielsweise auf das Ernährungs- und
Bewegungsverhalten), Staat: Paternalismus als Präventionsstrategie
• Was kann man „aus eigener Kraft“ tun, um eine Situation fortzusetzen/am Laufen
zu halten? Ist das Autonomie?
• Welche Konzepte sind für Menschen mit Beeinträchtigungen eventuell noch
wichtiger als Autonomie?
• Ist Autonomie ohne soziale Unterstützung möglich?
• Ist man immer auf dem Weg zur Autonomie?
2. Autonomie bedeutet (Definition nach Heinrich von Grünigen und Kees de
Keyzer):
• Selbstbestimmung und
• Eigenverantwortung basierend auf
• Kenntnissen Kompetenzen und
• Verhältnissen, die optimale Entscheidungen für die eigene und die
Lebensqualität für alle begünstigen.3. Transkription der Stellwand-Zettel
Welche Aspekte der Präsentation sind für Anhand der in der Präsentation gelieferten
meine Arbeit relevant? Inputs, was muss ich in meiner Arbeit
ändern, um die Autonomie im Sinne der
Gesundheitsförderung zu stärken?
- Unvoreingenommenheit - Keine Pauschalisierung
- Zielgruppen - Win-win-Situationen schaffen
- Äussere Umstände - Therapiesituation: Kinder und
- Fremdbestimmung Eltern gemeinsam in der
- Sozialer Druck Beratung
- Zielabhängigkeit - Keine Regel ohne Ausnahme
- Ethik - Rahmen = Sicherheit
- Professionalität - Mitdenken ist gut aber nicht zu
- Zu viel Nachdenken führt zum viel Überlegen!
Stillstand - Erfahrungen besser einfliessen
- Funktioniert Autonomie ohne lassen
soziale Unterstützung? - Leute befähigen, etwas zu tun
- Reduktion von Stigmatisierung
und Vorurteilen
- Politische und gesetzliche
Rahmenbedingungen schaffen
- Wahlfreiheit?!
4. Schlüsselpunkte und Essenzen aus der Diskussion
→ Zu viel Nachdenken führt zu Stillstand: etwas „einfach machen“ oder „etwas
einfach machen“ (Doppeldeutigkeit!)
→ „Just do it“!
→ Autonomie hängt stark vom Ziel und von der Zielgruppe ab: kein negativer
Paternalismus!
→ Politischer und gesetzlicher Rahmen geben Sicherheit
→ Vielfalt der Handlungsmöglichkeiten
→ Theorie ≠ Praxis: Der Praxisalltag muss erleichtert werden!
Franziska Widmer Howald │04. Februar 2014
Seite 2 von 2Autonomie als Herausforderung für die
Gesundheitsförderung und Prävention
15. Nationale Gesundheitsförderungs-Konferenz 2014
30. Januar 2014 im Kongresszentrum Beaulieu Lausanne
Workshop 7: Behinderung zwischen Autonomie und Abhängigkeit – am Beispiel
des Projektes Procap bewegt
• Helena Bigler, Leiterin Reisen & Sport, Procap Schweiz, Olten
• Stefan Häusermann, Projektmitarbeiter Procap bewegt, Procap Schweiz, Olten
Zusammenfassung
• In den Bilderwelten von Marketing etc. sind Sujets mit von Menschen mit
Behinderungen mit zu berücksichtigen.
• In der Planung von BGM-Projekten sind auch Randgruppen, wie Menschen mit
Behinderungen, mitzudenken.Seite 2 von 2
L’autonomie, défi pour la promotion de la
santé et la prévention
15e Conférence nationale sur la promotion de la santé
Jeudi 30 janvier 2014, Centre de Congrès de Beaulieu, Lausanne
Atelier no 8: Promotion de la santé chez les personnes âgées: Embrigader ou
encourager?
Christine Jaquet-Berger, Présidente AVIVO Suisse, Co-présidente FARES VASOS,
Lausanne
Résumé de l’atelier
Principaux points soulevés par Mme Jaquet-Berger:
• Les personnes arrivent plus souvent en meilleure forme au moment de la retraite,
devenir vieux ne signifie pas seulement être malade.
• Malgré cela, l’espace urbain (ergonomie) mais aussi les activités de la vie
quotidienne ne sont pas toujours adaptés aux aînés.
• Petit à petit les aînés perdent leurs repères et tendent vers l’isolement. Leur état
de santé se dégrade alors.
• Il existe de multiples pistes pour la prévention:
o Favoriser les déplacements (ex: solution lausannoise: taxis au pris du bus)
o Tenir compte des différences entre les aînés, réponses adaptées aux
problèmes spécifiques
o Qualité du logement: norme SIA 500 devrait être obligatoire
o Favoriser des lieux de rencontre (repas, thés dansants, quartiers
solidaires, …)
o Favoriser les milieux associatifs mais sans ghetto
o Considérer que de la vie à la mort, il y a un projet de l’être humain!Résultats des discussions
Question 1
Projet qui donne du Volonté pour des
sens à la vie solutions créatives
Construire un
projet avec les
Adapter la société au
ainés
vieillissement
Changer la perception des
personnes âgées
Dialogue entre les
générations Attitude positive
envers le fait de
vieillir (humain)
Créer des synergies Mieux informer Considérer la
Décloisonner personne âgée
Assurer la continuité dans toute son
Droit d’info entité (≠ malade)
Être à l’écoute des bénéficiaires
Seite 2 von 3Résultats des discussions
Question 2
«Notihing about us
without us»
Comment
fonctionne la
Entendre les solutions
participation
envisagées par la personne
(compétence)?
Soins plutôt elle-même et les proches
qu’administration
d’actes (TARMED) Travailler avec
Démarche
participative Détourner le message
Approche
communautaire
Développer la
collaboration des
professionnels, des
proches aidants et des
bénévoles intervenants
auprès des âgés Paternalisme vs autonomie
Diversifier les
réponses
Croiser les
domaines
Synthèse
• Vieillir n’est pas une fatalité et il faut se projeter dans l’avenir, avoir des projets
(réalisables).
• Il faut changer les stéréotypes que l’on a sur les aînés.
• Il faut trouver des solutions adaptées pour chaque problème et non des solutions
d’ensemble (clés en main).
Et le mot de la fin: il faut consulter les aînés, ils savent ce qui est bon pour eux!
Seite 3 von 3Autonomie als Herausforderung für die
Gesundheitsförderung und Prävention
15. Nationale Gesundheitsförderungs-Konferenz 2014
30. Januar 2014 im Kongresszentrum Beaulieu Lausanne
WorkshopNr. 9: AltuM– Alter und Migration im Gesundheitsbereich – gesund fühlen trotz
Alter
1. Kernpunkte des Inputs • Projekt AltuM im Kanton Aargau steht derzeit in der
Pilotphase: Veranstaltungen zu altersrelevanten
Themen wie Sozialsystem, Altersvorsorge,
Ernährung und Bewegung; Gymnastikkurse.
• Zielgruppe: Frauen und Männer über 55 Jahre mit
türkischer Herkunft.
• Spätere Ausdehnung der Zielgruppe auf weitere
Migrationsgruppen vorgesehen.
• Mit Blick auf die Autonomie, teils ambivalente Rolle
der Schlüsselperson der Community, i. e. Imam:
Dank dessen Einbezug (als Vertrauensperson) sind
die Angebote attraktiv, die Beteiligung der
Community gut, doch bei dessen Fernbleiben nur
noch geringe Beteiligung der Community.
2. Arbeit in Gruppen: Ergebnisse
a. Relevante Aspekte der • Genügend Zeit für den Einstieg ins Projekt einplanen.
Präsentation für die Arbeit der • Monokulturelles Vorgehen.
Teilnehmenden • Imam bzw. andere Schlüsselpersonen ansprechen.
• Fachpersonen wie interkulturelle Vermittler
einbeziehen.
• (Individuelle) Bedürfnisse der Community u n d der
Stakeholder identifizieren.
• Zielgruppe in die Entwicklung und Umsetzung der
Angebote einbinden.
• Rolle von Schlüsselpersonen / Imam zusammen mit
Gruppe klären.
b. Was muss ich in meiner Arbeit • Vermehrt niederschwellige Angebote (Kochen etc.)
ändern, um die Autonomie im • Zielgruppen-adaptierte Informationen.
Sinne der Gesundheitsförderung • Zur Bedürfnis-Analyse regionale Stakeholder
zu stärken? einbeziehen.
• Multiplikatoren / Secondos einbeziehen.
• Zeit geben für die Entwicklung und Bewährung neuer
Angebote.
• Idee: Gesundheitsförderung und Integration
verknüpfen: GF-Infos (z. B. Ernährung) in
Deutschkurs integrieren.• Angebote wirklich als Angebot zur Verfügung stellen
und nicht mit der Idee einer Pflicht.
3. Schlüsselelemente der
Synthese
• Bei der Implementierung neuer Angebote für die
Zielgruppe älterer MigrantInnen ist viel Geduld und
Zeit nötig.
• Die Zielgruppe älterer MigrantInnen ist schwer
erreichbar. Der Einbezug von Schlüsselpersonen wie
z. B. den Imamen ist deshalb wichtig. Anderseits
kann die Beteiligung dieser Schlüsselpersonen die
Autonomie der MigrantInnen auch behindern. Die
Klärung der Rollen innerhalb des Projekts mit den
Schlüsselpersonen und mit der Community ist daher
für den Projekterfolg von fundamentaler Bedeutung.
Seite 2 von 2Autonomie als Herausforderung für die
Gesundheitsförderung und Prävention
15. Nationale Gesundheitsförderungs-Konferenz 2014
30. Januar 2014 im Kongresszentrum Beaulieu Lausanne
Workshop 10: Lesen und Schreiben: (K)eine Selbstverständlichkeit?!
• Brigitte Aschwanden, Geschäftsführerin, Verein Lesen und Schreiben D-CH,
Bern
Mariangela Pretto, Projektleiterin, Verein Lesen und Schreiben D-CH, Bern
Zusammenfassung
• Illetrismus ist nicht Analphabetismus, sondern kommt auf unterschiedlichen (allen)
Niveaus vor. Es bedeutet sprachliche Inkompetenz angesichts bestimmter
Anforderungen. Ein Arzt z.B. kann Mühe haben, einen Krankheitsbericht zu
schreiben. Es kann also alle treffen nicht nur Migranten!
• Wir diskutierten auch darüber, ob Illetrismus der richtige Begriff ist – weil er
verwirrend wirkt. Als Alternative bietet sich lediglich an "Funktionaler
Analphabetismus" (wird in Deutschland verwendet). Das ist nicht besser.
• Wichtig ist zu erkennen, dass Illetrismus keine Krankheit und keine geistige
Behinderung ist, sondern alltäglich ist und viele Menschen betrifft. Man muss
lernen, das Problem anzusprechen! Und sich helfen/unterstützen zu lassen und
nicht verdrängen.
•
Sensibilisierung bei sich und bei den Mitmenschen ist wichtig.
• Allenfalls bereits früh in der Ausbildung (z.B auch Fachhochschulen)
thematisieren.Autonomie als Herausforderung für die
Gesundheitsförderung und Prävention
15. Nationale Gesundheitsförderungs-Konferenz 2014
30. Januar 2014 im Kongresszentrum Beaulieu Lausanne
Workshop 11: Autonomie und gemeinschaftliche Selbsthilfe
• Referentin: Sylvia Huber, Kontaktstelle für Selbsthilfe St. Gallen und Appenzell
• Moderation: Lisa Guggenbühl, Gesundheitsförderung Schweiz
1. Workshop-Thema
Sylvia Huber referierte zum Thema „Förderung der gemeinschaftlichen Selbsthilfe – ein
Handlungsansatz zur Stärkung der Autonomie- und Gesundheitskompetenz“. Sie führte
zunächst in die Arbeit der Förderung der gemeinschaftlichen Selbsthilfe ein, zeigte das
Spektrum von bestehenden Selbsthilfegruppen auf, erläuterte die Arbeitsgrundsätze und
die Vorgehensweisen.
Ziel von gemeinschaftlicher Selbsthilfe ist es individuelle und kollektive
Bewältigungsprozesse von Krankheiten und psychosozialen Belastungen zu ermöglichen
und zu fördern. Durch die Auseinandersetzung mit der eigenen Betroffenheit fördert die
Selbsthilfe den Bewältigungsprozess, was ein autonomes Krankheitsmanagement fördert
und damit die Gesundheitskompetenz stärkt.
Das Potential der gemeinschaftlichen Selbsthilfe für die Gesundheitsförderung sieht die
Referentin insbesondere in der Zusammenführung von Fachwissen mit dem
Erfahrungswissen von Betroffenen. Damit dies gelingen kann, müssen entsprechende
Gefässe und Rahmendbedingungen geschaffen werden, welche Partizipation erlauben.
2. Arbeit in Gruppen: Ergebnisse
Relevante Aspekte der Präsentation für die Arbeit der Teilnehmenden
- Selbstwirksamkeit erfahren lassen (statt defizitorientiert vorgehen), Verbindlichkeit
und Selbstverantwortung fördern
- Vielfalt von Selbsthilfegruppen - alte Bilder der SH müssen durch neue ersetzt
werden
- Kollektive Dimension von Autonomie; widersprechen sich Autonomie und Selbsthilfe
(Gruppe)?
- Selbsthilfe erreicht die Migrationsbevölkerung nur schwer
- Gibt es auch Selbsthilfe ohne Betroffene? Zwischen Selbsthilfe und Professionalität
- Themen sind teilweise schwierig, themenübergreifender Ansatz suchen?
- Der Gruppenprozess (einer Selbsthilfegruppe) ist sehr spezifisch und manchmal auch
langeWas muss ich in meiner Arbeit ändern, um die Autonomie im Sinne der
Gesundheitsförderung zu stärken?
- Didaktik von Kursen anpassen
- Stete Reflexion des eigenen Tuns, eigene Ressourcen immer mitdenken
- Gezielte Zusammenarbeit mit der Selbsthilfe suchen
- Was ist und wer ist autonom? Kollektive Dimension von Autonomie (bez. Gesundheit)
- Welche Angebote gibt es für Menschen, die keine Ressourcen für die Selbsthilfe
haben?
3. Schlüsselelemente der Synthese
Autonomiekompetenz setzt Ressourcen voraus, zum Beispiel sprachliche.
Selbsthilfegruppen von Migranten/innen kommen nur sehr selten zu Stande, weil
Verständigung eine grundlegende Voraussetzung ist. Bildung ist aber keine
Voraussetzung für die gemeinschaftliche Selbsthilfe, weil auf Erfahrung gebaut wird. Eine
zu enge Community kann ebenfalls ein Hindernis sein (Bspw. Eltern drogenabhängiger
Kinder in ländlichen Regionen).
Gemeinschaftliche Selbsthilfe ist ein Angebot unter vielen, das längst nicht für alle
Betroffenen die richtige Wahl ist. Sie kann aber eine wichtige Rolle in der sozialen
Stabilisierung von Betroffenen spielen. Dabei dient die Erfahrung als Lernboden, die
erfahrungsorientierte Veränderungsprozesse ermöglicht. Selbsthilfegruppen können auch
eine wichtige Rolle in der Enttabuisierung von Themen und in der politischen
Sensibilisierung spielen.
Wichtig ist, dass die Initiative für eine Selbsthilfegruppe von aussen resp. Betroffenen
kommt, und nicht von Institutionen. Wichtig ist auch die Bekanntmachung von
bestehenden Selbsthilfegruppen, diese sind Fachleuten oft wenig bekannt.
Aus der Optik der Gesundheitsförderung könnte die gemeinschaftliche Selbsthilfe evtl. als
verhältnispräventives Angebot betrachtet werden. Und es gilt das Erfahrungswissen aus
Selbsthilfegruppen (bspw. von Adipositas) für Gesundheitsförderung nutzbar zu machen.
Seite 2 von 2Autonomie als Herausforderung für die
Gesundheitsförderung und Prävention
15. Nationale Gesundheitsförderungs-Konferenz 2014
30. Januar 2014 im Kongresszentrum Beaulieu Lausanne
Workshop Nr. 12: Ausbildung und Schulung im Bereich der sexuellen Gesundheit:
Für Autonomie im sexuellen Bindungsverhalten / Education et formation à la santé
sexuelle: pour l’autonomie dans les comportements sexuels et relationnels
Referenten / Intervenants:
- Gilberte Voide Crettenand, Santé Sexuelle Suisse
- Noël Tshibagu, Santé Sexuelle Suisse
1. Thème de l’aterlier / Workshopthema:
a. Was bedeutet sexuelle Gesundheit ?(Definition WHO):
«Sexuelle Gesundheit ist ein Zustand des körperlichen, emotionalen, Geistigen und
sozialen Wohlbefindens bezogen auf die Sexualität und bedeutet nicht nur die
Abwesenheit von Krankheit und Funktionsstörungen oder Schwäche. Sexuelle
Gesundheit erfordert sowohl eine positive, respektvolle Herangehensweise an
Sexualität und sexuelle Beziehung als auch die Möglichkeit für lustvolle und sichere
sexuelle Erfahrung, frei von Unterdrückung, Diskriminierung und Gewalt. Wenn
sexuelle Gesundheit erreicht und bewahrt werden soll, müssen die sexuellen Rechte
aller Menschen anerkannt, geschützt und eingehalten werden.»
a. Définition de la santé sexuelle (OMS) :
« La santé sexuelle est un état de bien-être physique, émotionnel, mental et social
relié à la sexualité. Elle ne saurait être réduite à l’absence de maladies, de dysfonctions
ou d’infirmités. La santé sexuelle exige une approche positive et respectueuse de la
sexualité et des relations sexuelles, ainsi que la possibilité d’avoir des expériences
plaisantes en toute sécurité, sans coercition, discrimination et violence. Pour
réaliser la santé sexuelle et la maintenir, il faut protéger les droits sexuels de chacun.»
b. Autonomie in der sexuellen Gesundheit /Autonomie dans la santé sexuelle
Selbstbestimmung fördern durch individuelle Kompetenzerhöhung bei der: / Promouvoir
l’autonomie par augmenter la compétence individuelle par:
- Wahlmöglichkeit / la possibilité de choix
- Eigeninitiative / l’esprit d‘initiative
- Selbstverantwortung / responsabilité individuelle
2. Ergebnisse der Gruppenarbeit / Résultats travail de groupe
a) Relevante Aspekte der Präsentation für die Arbeit der Teilnehmenden / Elements
de la présentation pertinents pour le travail des participants- Poids de la culture et du contexte social, des valeurs
- Définition : état en évolution ; droits / ganzheitliche Definitionen
- Collaboration avec les bureaux de l’égalité
- Droits sexuels droits humains : le porter au niveau de la stratégie cantonale
- Formation des professionnels
- Ne pas aborder la sexualité sous l’ongle des maladies
- Angebote von Instrumenten (Zielgruppengerecht)
- Strukturierte Matrix über alle Lebensphase (unterschiedliche Bedürfnisse)
- Mettre en avant les déterminants de la santé sexuelle (pour augmenter l’impact)
- Elargir le cercle des acteurs
b) Que vais-je faire différemment dans mon travail pour renforcer l’autonomie dans
une perspective de promotion de la santé? / Was muss ich in meiner Arbeit
ändern, um die Autonomie im Sinne der Gesundheitsförderung zu stärken ?
- Autonomie domination
- Autonomie identité
- Verantwortung führt zu Autonomie (Reflexionszeit)
- Action collective / action individuelle: Réflexion sur plusieurs dimensions
- Oser parler plus dans le sens de la définition globale
- Importance de savoir bien communiquer (dire et ressentir chez l’autre : feed back
sincère)
- Manque de données (autre que sur maladies ou certains comportements
spécifiques)
3. Schlüsselelemente der Synthese
- Connaissance du domaine (formation, importance des documents de référence)
- La santé sexuelle est encore peu étudiée : les sociologues commencent à s’y
intéressé
- Égalité d’accès
- Boîte à outils
- Erweiterung des Akteurenkreises (formelle, informelle Akteure)
- Gratwanderung Eltern – Lehrer (Sexualpädagogik in der Schule: ja oder nein)
- Standards zur sexuellen Ausbildung: gehören in Ausbildung; sollen bekannter
gemacht werden
Seite 2 von 2L’autonomie, défi pour la promotion de la santé et la prévention 15e Conférence nationale sur la promotion de la santé Jeudi 30 janvier 2014, Centre de Congrès de Beaulieu, Lausanne Atelier no 13: Les pairs praticiens en santé mentale: un plus pour l’autonomie des personnes souffrant psychiquement? Hartmann Esther, Jaggi Yahann Thème de l’atelier Madame Hartmann et Madame Jaggi (Association romande Pro Mente Sana) ont exposé la thématique de pairs praticiens en santé mentale. Le pair aidant est une personne vivant ou ayant vécu un trouble grave de la santé mentale. A partir de son expérience de la maladie et de son processus de rétablissement, le pair praticien aide la personne en souffrance à surmonter les obstacles et à identifier les outils favorisant le rétablissement. Cette personne a pour but d’accompagner ses pairs sur le chemin de l’autonomie. L’association romande de Pro Mente Sana souhait que les pairs praticiens soient considérés comme des professionnels intégrés au sein d’une équipe de soin pluridisciplinaire. Madame Hartmann et Madame Jaggi décrivent l’utilité du pair praticien en santé mentale sous deux visions distinctes. Premièrement, le pair praticien en santé mentale vient en aide au malade, en tant que porte-parole du pouvoir d’agir, de l’espoir et du changement. Le pair praticien apporte une compréhension réciproque et un soutien à la personne souffrante. Il est un médiateur entre l’usager et le professionnel. Deuxièmement, le pair praticien en santé mentale retrouve un statut, un rôle responsable au sein de la société lui permettant de se sentir utile. Le but final étant un changement de paradigme passant de l’impuissance au pouvoir d’agir, du désespoir à l’espoir, du manque de sens au projet de vie. Travail de groupe : résultats Les participants à l’atelier ont identifié les éléments suivant comme étant pertinents : - Le rétablissement est davantage qu’une absence de symptôme. Le rétablissement n’est pas égal à la guérison, ce n’est pas un retour au point de départ mais bien un processus individuel et non-linéaire dans lequel il s’agit d’accepter ses limites et de découvrir ses nouvelles possibilités. - La considération des pairs en tant que personnes ressources. - Le manque de validation de l’approche des pairs. Actuellement aucune donnée ne permette de prouver l’effet positif des pairs praticiens en santé mentale sur le processus de rétablissement de la personne souffrante. - Le pair aidant, personne « bénévole » devient à la suite dans formation continue un professionnel. Dans une perspective de promotion de la santé et afin de renforcer l’autonomie, les participants à l’atelier aimeraient travailler différemment en ouvrant les portes de leur réseau professionnel et en réfléchissant à la possibilité d’intégrer des pairs praticiens en entreprise ou au sein d’ateliers occupationnels. Selon les participants à l’atelier, les pairs
praticiens en santé mentale ne devraient pas intervenir lorsque la personne souffrante est
en situation de crise mais lors d’un traitement ambulatoire ou à domicile.
Synthèse
La professionnalisation de pairs aidant ou pairs praticiens en santé mentale, étant à ses
prémices, il convient d’acquérir un certains nombres d’expériences afin de porter les
améliorations nécessaires à la formation continue proposée. De plus, le cahier des
charges des pairs praticiens en santé mentale doit être défini précisément afin que ces
personnes formées trouvent leur place dans une équipe de soin pluridisciplinaire, d’ores
et déjà conséquente. Finalement, une évaluation de la phase pilote servant à valider ou
invalider l’approche est souhaitée.
Seite 2 von 2Autonomie als Herausforderung für die
Gesundheitsförderung und Prävention
15. Nationale Gesundheitsförderungs-Konferenz 2014
30. Januar 2014 im Kongresszentrum Beaulieu Lausanne
Workshop 14: Autonomie und Teilhabe ermöglichen! Methodische Prinzipien des
Programms Femmes-Tische
• Sibylle Brunner, Geschäftsführerin Femmes-Tische Schweiz, Zürich
Viviane Fenter, Leiterin Zweigstelle Romandie, Formation des parents, Lausanne
Zusammenfassung
Welche Aspekte der Präsentation sind für meine Arbeit relevant?
- Peer-Ansatz
- Und die Männer?
- Eigenverantwortung fördern
- Fokus Information ≠ Integration
- Wertschätzung & Selbstwertgefühl
- Bedürfnisse stehen im Zentrum
- Freiwilligkeit
- Mitbestimmung nach eigenen Interessen
- Niederschwellig durch: eigene Sprache / vertrauter Rahmen
- Soziale Vernetzung
- Muttersprache – Ein spezifisches Angebot entwickeln
- Anzahl / Finanzen / Autonomie der Gruppe / Welche Themen? / Zusammenhang
Schule?
Was kann ich an meiner Arbeit ändern, um die Autonomie in Zusammenhang mit der
Gesundheitsförderung zu stärken?
- Flexibilität / Methodenvielfalt
- Menschen abholen, wo sie stehen
- Angebot auf Anfragen
- Bedürfnis-orientiertes Arbeiten
- Peer-Ansatz in Strategien aufnehmen
- Schwerpunkte überdenken
- Evident vs. Handlung nach Praxiserfahrung
- Beteiligte = Betroffene
Wichtige Punkte aus der Diskussion im Anschluss
- Der Peer-Ansatz sollte berücksichtigt werden bei der Entwicklung der NCD
Strategie (insb. Psychische Gesundheit)
- Warum werden Frauen mit Migrationshintergrund berücksichtigt?
Warum nicht andere? Z.B. Schweizer Frauen, Illettrismus, Männer/Familienväter.Das wäre durchaus möglich, das Projekt ist historisch in diese Richtung
gewachsen.
- Sibylle Brunner wäre interessiert, den Ansatz auch in die (Gross-)Unternehmen zu
bringen. Eine Teilnehmerin aus einem Grossbetrieb, signalisiert Bereitschaft, ins
Gespräch zukommen weist aber auch darauf hin, dass das Vorhaben in den
Unternehmen komplex ist.
Seite 2 von 3Seite 3 von 3
Sie können auch lesen